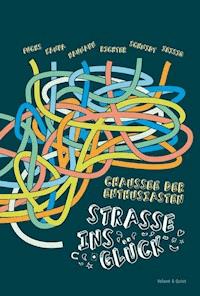8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die erste Liebe. Der erste Tod. Rebekka ist in einer Orientierungsphase. Die junge Reiseverkehrskauffrau knabbert an der Trennung von Adrian. Dass sie selbst den Anlass dazu gegeben hat, weil sie ihn betrog, davon will sie nichts mehr wissen. Sie sucht Rat in der Gruppe «Männerentzug»: lauter Frauen, die vor allem eins lernen wollen – auf eigenen Beinen stehen, unabhängig werden. Was Rebekka außerdem noch lernt: sich nicht so wichtig zu nehmen angesichts wichtigerer Probleme wie dem Sterben ihrer Freundin Jette. Eine Geschichte von der ersten Liebe und vom ersten Tod im Leben einer jungen Frau. Ein Roman, der an die Nieren geht. Und ans Herz. «Wieder voll von Fuchs' ganz eigener Sprache, die vergnügt mit den Wörtern spielt und doch alles zweifelsfrei auf den Punkt bringt.» (Brigitte) «Diese Sprache produziert eine Energie und eine Lebendigkeit, die in der deutschen Gegenwartsliteratur ihresgleichen sucht.» (Der Spiegel)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Kirsten Fuchs
Heile, heile
Roman
Es geht los und nicht, um anzukommen. Der Samstag, an dem sie das Klingelbrett auf dem Trödelmarkt kaufte, war so außergewöhnlich kalt für Anfang November, dass der Wetterbericht jede halbe Stunde wiederholte, wie außergewöhnlich kalt es für Anfang November sei. Beim dritten Mal «außergewöhnlich kalt» stand sie endlich auf und schaltete dem Radiowecker den Mund aus. Sie zog sich etwas außergewöhnlich Warmes für Anfang November an und fuhr mit dem Fahrrad zum Trödelmarkt.
Sie trank einen Kaffee im Bahnhof am Imbiss im Stehen am Tisch. Richtig schlimmer Imbisskaffee. Bitter, bitter! Der Verkäufer sollte in der Hölle den ganzen Tag diese Plörre saufen müssen. Sie stierte in irgendeine Richtung, und manchmal liefen Menschen durch ihren Blick.
Adrian hatte sich vor drei Wochen getrennt. Schrecklich, schrecklich! Und noch ein Schrecklich, für jede Woche eins. Ohne ihn fühlte sich alles an wie versalzene Schürfwunden. Sie wollte Adrian etwas so Unglaubliches zum Geburtstag schenken, dass er sie wenigstens wieder an seinem Leben beteiligen würde, worauf er seit der Trennung lieber verzichtete. Das fand sie außergewöhnlich kalt für Anfang November. Er sollte durch ihr Geschenk erkennen, dass sie wenigstens seine beste Freundin war. Sie log sich natürlich die Hucke voller gebogener Balken, denn er sollte nicht nur erkennen, dass sie seine beste Freundin war, sondern auch seine beste Frau, sein bester Mensch.
Der Trödelmarkt war voller Menschen, trotzdem liefen die Geschäfte eher kläglich. Sie standen geradezu. Wenn es irgendwo auf der ganzen Welt etwas gäbe, das Adrian gefallen könnte, sehr gefallen könnte, so sehr gefallen könnte, dass sie selbst ihm wieder gefiel, sehr gefiel, so sehr gefiel, dass er ihr vergeben würde, dann nicht auf diesem Trödelmarkt. Sie müsste eine Zeitmaschine finden und kaufen und dann sechs Wochen zurückwuppen, um nicht fremdzugehen. Oder sie würde drei Wochen zurückwuppen und Adrian nicht beichten.
Adrian hatte nicht gesagt: «Bete Ave-Marias und Rosenkränze und was du sonst noch beten kannst.» Er hatte gesagt: «Ich zieh aus.»
Ihr Angebot war, dass sie doch erst mal ausziehen könne. Von erst mal wollte Adrian gar nichts wissen. Es ging ihm um ein dauerhaftes Erst-mal, solange man erst mal lebt.
Sie zogen dann beide aus, weil die Wohnung für einen allein zu groß war. Eine Woche schlief Adrian auf dem Sofa, obwohl das die Schäm-dich-Schlafecke für sie gewesen wäre, aber er wollte nie wieder im gemeinsamen Bett liegen, wo sie vielleicht…
«Nein, nicht hier. Ich hab nicht hier», beteuerte sie, aber er hatte keine Lust, ihr irgendwas zu glauben. Sie war von heute auf morgen Schlangenmund.
Eine Zeitmaschine gab es auf dem Trödelmarkt nicht, so wie sie das überschauen konnte, aber sie wusste auch nicht genau, wie eine Zeitmaschine aussah. Vielleicht war es der Holzroller mit dem mit Pflaster umwickelten Lenker, die Kaffeemühle, auf der eine Windmühle abgebildet war, der Hornkamm, die Musikkassette ohne Hülle und ohne Beschriftung, der Küchenkalender aus dem Jahre 1976, bedruckt mit Darstellungen von Schnittblumen, das Kartenspiel, bei dem unter Garantie eine Karte fehlte, Bube, Dame, kein König, Ass.
Weil sie zu lange den hässlichen Kalender betrachtet hatte, sprang der Händler sie verbal an. Er erklärte, dass das Jahr 1976 identisch sei mit dem nächsten Jahr. Der Händler sprach über Schaltjahre, und sie sah etwas, das von all dem Trödelmarkttrödel noch am ehesten eine Zeitmaschine sein könnte: ein Klingelbrett voller handgeschriebener Namen, klebrig verdreckt. Eine Familie hieß Klöthgen. Igitt, igitt. Wie Imbisskaffee.
«Wollen Sie den Kalender nun kaufen?»
«Nein», sagte sie erstaunt, und nochmal mit Kopfschütteln: «Nein.»
Der Händler setzte sich auf seinen Campingstuhl zurück und ließ von ihr ab. Er hatte wieder einmal mehrere Sätze umsonst gesagt. Sie konnte unmöglich weiter dort vor dem Stand stehen, ohne etwas zu kaufen. Ihre Augen suchten den Tisch ab: eine Kaffeebüchse der Firma Tchibo mit einem zu großen Deckel der Firma Eduscho, ein Sparschwein in Form eines Kaktus, ein Sparkaktus. Der Händler räumte seine Halswirbel auf, es knackte wie ein Zweitehandnacken.
«Wie viel kostet denn das Klingelbrett?»
«Die Türanlage?», fragte er. «Die ist ganz alt und gut erhalten. Für Sie fünfzehn.»
«Euro?», fragte sie erstaunt.
«Ja, Euro. Oder haben Sie noch Mark? Dann kostet sie dreißig Mark.» Er lachte. Sie zögerte. Er lachte immer noch. Sie immer noch nicht.
«Nee», sagte sie.
«Zehn Euro, und Sie nehmen den Kalender dazu.»
Das war aus ihrer Sicht betrachtet, wenn sie das aus seiner Sicht betrachtete, nicht gut gehandelt. Die Geschäfte mussten wirklich schlecht laufen an diesem Samstag.
«Für neun», sagte er.
Sie schüttelte den Kopf. Das erste Mal in ihrem Leben war sie gut darin zu feilschen, weil sie das erste Mal um etwas feilschte, das sie gar nicht haben wollte.
«Ich nehm den Kalender und das Klingelbrett für sechs», beschloss sie, «letztes Angebot», beschloss sie, weil sie es eben für sechs bekam oder sofort ging.
Dem Händler wurde nach seinen Füßen in den dünnen Turnschuhen das Lachen kalt. «Harte Frau», sagte er, nicht ohne Anerkennung, und verkaufte ihr die zwei Gegenstände für sechs Euro.
Wenn 1976 identisch war mit dem nächsten Jahr, wüsste sie wenigstens, was sie zu erwarten hatte. Sie würde nochmal vierten Geburtstag feiern, Ulrike Meinhof würde sich nochmal erhängen, und der Palast der Republik würde ganz in der Nähe des Trödelmarkts nochmal feierlich eröffnet werden. Sie stopfte die zwei Gegenstände in den Rucksack und verließ mit einem Tempo den Trödelmarkt, als hätte sie etwas Hochexplosives bei sich.
Was will eigentlich dieser dusslige Fisch, der sich auf allen Singlepartys herumtreibt, mit einem Fahrrad, dachte sie, als sie nach Hause radelte. Klingelbrett sucht Kalender. Frau sucht Heimweg.
Als sie zu Hause ankam, waren ihre Hände außergewöhnlich kalt für Anfang November. Sie fand sich außergewöhnlich blöd für Anfang dreißig. Warum hatte sie diesen Kalender gekauft? Und das Klingelbrett erst. Bevor sie die Haustür aufschloss, sah sie sich das erste Mal das Klingelbrett an, auf dem ihr eigener Name stand. Meiler. Das Klingelbrett an ihrem Haus war auch keine Schönheit. Vielleicht war ein Klingelbrett ein Gegenstand, den es in schön nicht gab, so wie Steckdosen. Frau Meiler dachte, dass, wenn in vielen Jahren dieses Haus abgerissen sein wird, wenn wir alle hier weggezogen sein werden, dann irgendeine Frau, in einem Jahr, das identisch sein wird mit 1976, von einer Trennung schwer anlädiert, das hässliche Klingelbrett dieses Hauses kaufen wird, ohne zu wissen, warum. Frau Meiler schloss die Haustür auf, polterte mit ihrem Fahrrad die Kellertreppe runter und wunderte sich, dass sie «Wir» gedacht hatte und in dieses Wir ungefragt die anderen Mieter mit reinzerrte. Sie dachte im Keller «unser Keller, unser Lichtschalter, unsere Ratte». Die Ratte ließ das Rattengift aus den Pfötchen fallen und flüchtete. Ein Leben gerettet.
Frau Meiler ging die Treppen hinauf, «unsere Treppen, unser Linoleum», und schloss die Wohnungstür auf, «aber meine Wohnungstür». An der Klingel stand R.Meiler. R.Meiler ließ ihren Rucksack gleichzeitig mit der Tür fallen, auf den Boden das eine und ins Schloss das andere. Dann setzte sie sich auf den Hocker und kickte die Stiefel in die Tiefen des Flurs. R.Meiler saß noch eine Weile im Flur, der mit mehreren Türen die Möglichkeiten aufzeigte, in der Stube weiter einsam zu sein, im Bad einsam zu sein, in der Küche einsam zu sein oder zum Einsamsein gleich ins Schlafzimmer zu gehen und dort zu weinen. Heule, heule.
Sie entschied sich für die Stube, weil da der Fernseher war. Ihre Hände tauten langsam, jedoch ohne dass Wasser aus ihnen abtropfte. Sie tauten so, wie wenn eine Tüte mit einem Brocken Kartoffelsuppe aus dem Gefrierfach genommen wird. Die Flüssigkeit blieb in den Händen wie in Tüten. Als ihr die Kartoffelsuppe im Gefrierfach einfiel, hatte sie gleich keinen Appetit. Für sich alleine kochen schmeckt nicht. Wenn jemand in ihrer Nähe gewesen wäre, hätte sie «Ach ja» sagen können, aber es war niemand da. Und wäre jemand da gewesen, wäre ihr nicht so sehr danach zumute, «Ach ja» zu sagen. Das ist das Problem an «Ach ja».
Sie hing im Sessel und sah einen Sender, der damit warb, nur Originale zu zeigen. Das klang besser als Wiederholungen. Bill Cosby stellte seinen Kindern eine pfiffige Erziehungsfalle. Danach spielte Alf mit Essen. Dass sie eingeschlafen war, bemerkte R.Meiler erst, als sie wieder aufwachte. Und dann erst klingelte das Telefon.
«Ja», meldete sie sich.
«Hallo, Rebekka!»
Johanna sagte nie: «Hier ist Johanna», nicht mal: «Ich bin’s», aber Rebekka wusste immer, dass es Johanna ist, wenn es Johanna war, weil Johanna sich zum Telefonieren verabredete. Sie sagte: «Ich rufe Samstagnachmittag an», und dann rief sie Samstagnachmittag an.
«Na, hast du was für Adrian gefunden?»
Ausatmend: «Nichts.»
«Gar nichts?»
«Ich habe schon was gekauft, aber…»
Johanna fand sowohl den Kalender irgendwie gut, «genial», sagte sie, als auch das Klingelbrett, «spannend», sagte sie. «Und wie geht’s dir so? Adriantechnisch meine ich.»
Rebekka versuchte vorsichtig anzudeuten, dass es ihr so schlecht ging wie noch nie einem Menschen zuvor, aber Johanna holte lauter Positivfähnchen heraus und winkte damit fröhlich. Rebekka kam sich veräppelt vor. Sie winkte nicht zurück.
«Na, wie auch immer. Wollen wir heute was machen?», fragte Rebekka.
«Ahhh, heute habe ich keine Zeit. Nee. Lars kommt gleich her. Wie findest du morgen?»
Morgen fand Rebekka gut. Morgen fand Rebekka immer gut, weil in dem Wort «morgen» die Hoffnung steckte, dass über Nacht die beiden Haudegen Freude und Kraft wieder zu ihr zurückkehren würden.
«Ich komm einfach zum Frühstück zu dir, muss doch mal sehn, wie weit du mit der Wohnung bist. Ich ruf dich an, und dann können wir ja nochmal auf einem anderen Trödelmarkt was für Adrian suchen.»
«Dann kauf ich wieder so einen Quatsch wie das Klingelbrett.» Einwurf Rebekka.
Johanna legte ein für alle Mal fest, dass das Klingelbrett toll sei. Ohne es gesehen zu haben, beschloss sie, dass sich daraus etwas machen ließe. «Mach was draus! Kopf hoch, Bekka!» Punkt Johanna.
«Kopf ab, Hanna!» Satz Bekka.
Rebekka räumte die Wohnung auf, weil Johanna am nächsten Tag vorbeikommen würde. Sie hatte «Kopf ab!» zu Johanna gesagt, und die hatte weder darüber gelacht noch dagegen protestiert. Sicherlich war Johannas Gehirn mit der Vorfreude auf Lars beschäftigt gewesen, deshalb hatte sie das rüde «Kopf ab!» nicht gehört. Freundin Johanna war einfach nicht brauchbar, wenn es irgendwo nach Lars roch. Lars ging immer vor, weil er sich nicht so oft aus seiner Ehe rausschwindeln konnte, um zu seiner Affäre zu schleichen. Über ein Jahr lief das schon mit Johanna und Lars. So was heißt Affäre. So was kann man übelnehmen, aber Rebekkas Ausrutscher mit einem Exfreund doch nicht, ein Mann, mit dem sie schon vor Adrian geschlafen hatte. Der in einer anderen Stadt wohnte. Das war eine Wiederholung, kein Original, das war nur Hannes. Das konnte doch nichts wegnehmen, nichts zerstören, nichts ändern. Hatte es aber. Hatte es aber. Hatte es aber. Rebekka würde sich gerne als Entschuldigung vor den Augen von Adrian in den Arsch beißen. Sie ärgerte sich, dass sie dazu nicht gelenkig genug war. Yoga müsste sie anfangen, damit sie sich in den Arsch beißen könnte. Sie ärgerte sich über Johanna und ihr «Mach was draus». Das Einzige, das Rebekka aus allem machte, war Ärger. Sie war wie ein Ärgerrumpelstilzchen, das aus allem Ärger spinnen konnte. «Mach was draus» war doch nur Geseier, mit dem verlassene Frauen beruhigt werden sollen, damit sie nicht töten, ihn oder sich selbst oder eine gute Freundin gar. Was sollte sie denn aus einem Klingelbrett machen? Sollte sie aus dem Klingelbrett ein Fahrrad machen? Ein Fahrrad, das einen Fisch sucht? Und aus dem Fahrrad könnte sie dann einen neuen Mann machen? Und dem kochte sie dann freitags Fisch? Mach was draus! Das sollte Rebekka doch nur daran erinnern, dass jedes Ende auch ein neuer Anfang war, der auch wieder zu Ende gehen würde. Mach was draus! Rebekka könnte ihre viele Zeit der Volkshochschule anvertrauen und Kissen besticken mit dem Satz «Hier sitzt kein Mann». Sie könnte einen ganz verrückten Kuchen backen, mit Badminton anfangen, was mit dem Badmintonpartner anfangen, und wenn es mit dem Sportsfreund wieder vorbei war, dann: «Tja, mach was draus!»
Die Energie für den Wohnungsputz war pupsgleich entfleucht. Warum sollte sie aufräumen für Johanna? Am Tag ihres Einzugs hatte Freundin Johanna einen Anruf von ihrem Larsi erhalten, der zwei Schäferstündchen im Sonderangebot hatte. Und wer weg war, war Johanna. Sie verschwand so feucht und fröhlich, dass sie fast zu Lars hätte schwimmen können. «Soll ich danach wiederkommen?», hatte sie Rebekka noch gefragt. «Kannste dir stecken», war Rebekkas Antwort. Das fand Johanna lustig, wegen anzüglich, haha.
Nach Alf kam Bonanza. Ein Bruder war verliebt, ein Bruder vermisste die Mutter, der dicke Bruder fraß, ein Rind kalbte. Rebekka versuchte, einen Joghurt zu essen, aber es war wie Katzen mit Zwiebeln füttern. Adrian saß in seiner neuen, nach Farbe riechenden Wohnung und aß allein, während sie ebenso allein in ihrer neuen, nach Farbe riechenden Wohnung hockte und nicht aß.
Rebekka hatte Adrian beim Tanzen kennengelernt. Die unverputzten Wände des Kellerraums saugten den Schweiß der jungen Leute auf, aber Rebekka behielt ihren Schweiß an dem Abend lieber für sich. Sie verharrte in der Zwickmühle, in die sie mit vierzehn eingezogen war, dass sie den Moment gerne genießen wollte, aber sich zu sehr darüber bewusst war, dass sie ihn genießen wollte. Am schlimmsten war es, wenn sie irgendwo Eintritt bezahlt hatte. Dann wollte Rebekka sich ganz viel freuen, um den Preis des Eintritts abzufreuen. In der Hoffnung, dass Alkohol helfen könnte, stand sie am Tresen und trank Bier. Johanna tanzte, von solchen Zwickmühlen gar nichts wissend, mit Jenny derwischgleich ihre Haare in Filz. Jenny war eine Freundin aus der Berufsschulzeit. Rebekka fand sie dumm wie Diätnahrung, völlig ohne Inhaltsstoffe. In der Ausbildungszeit konnte Rebekka noch mit der Diätnahrung reden, die restliche Klasse war geistig gleich ganz im Hungerstreik, aber nach der Ausbildung hatte es sich für Rebekka ausgejennyt. Johanna wollte Jenny unbedingt jedes Mal dabeihaben, wenn es tanzen ging. Sie waren inzwischen seit einem Jahr drei fertige Reiseverkaufsfrauen, deren eigene Reisen am Wochenende nur in diesen Club gingen.
Johanna hopste mit Jenny herum, und beide hielten kichernd die Hand vor den Mund, wenn sie jemandem auf die Füße sprangen. Sorry, sorry. Rebekka wartete an der Bar auf Spaß oder wenigstens eine eigene Entscheidung. Sie war unentschieden, ob sie stinkig auf Johanna war, weil die versprochen hatte, Rebekka irgendwann nach Hause zu fahren. Rebekka sah schon, dass Johannas Nacht erst enden würde, wenn das Tageslicht die Nacht beendete.
Johanna kam verschwitzt zu ihr, weil Jenny auf die Toilette gegangen war, und spuckte ihr ins Ohr: «Du willst gehen, wa?»
Rebekka zuckte die Schultern. Sie schrie nicht gern in der Disco herum. Das war auch der Grund dafür, dass Johanna und Rebekka ihr eigenes System hatten, Männer in Discos zu bewerten, ohne sich anzuschreien. Sie zogen Gesichter, die aussahen wie nach dem Kosten von Erdbeeren, Bier, Brot, Schlamm, Kapern oder Zitrone. Es ging um lecker oder nicht lecker und wie sehr lecker und wie sehr nicht lecker. Johanna war zu der Zeit solo, wie eigentlich fast immer, nachdem sie drei Jahre mit einem Typen zusammen gewesen war, der so ein großes Arschloch war, wie nicht mal Wale eins haben. Johanna fand danach fast alle Männer Brot, ein Grundnahrungsmittel, das man immer essen kann, weil man davon satt wird. Manchmal fand sie einen Mann auch Bierchen, kein wirklich leckerer Geschmack, aber wenn man sich dran gewöhnt hatte, eine schöne Alltagsdroge. Johanna tanzte gern Brotmänner an. Sie suchte gar keine Erdbeere. Johanna küsste Brot, schlief ein paarmal mit Brot, und weg war Brot. Rebekka war seit zwei Jahren mit Hannes zusammen und spielte darum das Spielchen mit dem Männerbewerten nicht mehr mit viel Hingabe. Wenn der Einkaufswagen voll ist, dann ist er eben voll.
Als Rebekka Adrian sah, wollte sie den Einkaufswagen auskippen und ihr Geld zählen, obwohl sie wusste, dass die paar Kröten nicht reichen würden. Adrian war so ein hübscher Typ, wie die Pubertätsrebekka davon einige aus der BRAVO ausgeschnitten hatte, die manchmal durch drei feuchte Paar Mädchenhände aufgeweicht und zerfleddert bei ihr angekommen war. Diese Jungs hatte sie bis zum Zuckerschock angestarrt. Diese Typen hatten Mädchenfrisuren, Sternchenaugen, rote Bäckchen – sie waren wie die Kinder, die man mal haben wollte: süß. Es waren aber auch die Typen, die ihre Fotos, als die Achtziger vorbei waren, gut verstecken mussten, damit keiner einen Lachkrampf bekommt: weiße Jeans, Strähnchen, peinlich, peinlich. So einer stand da. So einer!
Als Johanna Adrian sah, zog sie wie immer ein Brotgesicht. Rebekka hingegen wollte sich nicht nur vorstellen, wie Adrian schmecken könnte, sie wollte schmecken. Johanna feixte, als sie Rebekkas Gesicht sah. «Na aber, Frau Meiler!», schrie sie gespielt entrüstet gegen die Musik an. Sie hätte es gut gefunden, wenn Rebekka Hannes betrügen würde. Das war ein Thema, über das sich reden ließ.
Rebekka schüttelte ihre Begeisterung ab, wie ein nasses Tier den Regen abschüttelt. Das brachte doch nichts. Der war nichts für sie. Und als sie auch ihre Augen von Adrian abschütteln wollte, nahm der seine Hände aus den Hosentaschen, um eine davon Jenny zu reichen, die ihm die ihre hinhielt und danach mit dem Zeigefinger einen unsichtbaren Pfeil quer durch den Club zu Johanna und Rebekka schickte. Das war nicht Amors Pfeil. Der verpeilte Depp mit dem Köcher war vorher schon besoffen durch die Welt geeiert und hatte Adrian auf einer Party halbseitig gestreift. Jenny hatte Adrian auf dieser Party mit den Wimpern zugewunken, aber so was machte Jenny nebenbei, nur so. Sie konnte ihre Augen überhaupt nie bei sich lassen. Adrian hatte sich gemerkt, wo Jenny nach eigener Auskunft tanzen ging. Das hatte Jenny Adrian nur erzählt, weil sie ihn ein geeignetes Pausenbrot für Johanna fand. Johanna interessierte ihn nicht, er war nett zu ihr, und Rebekka interessierte ihn auch nicht, er war nur nett zu ihr, aber Jenny, die sich für Adrian nicht interessierte, interessierte sich auf einmal doch für Adrian, nur so. Rebekka sah, wie Jenny auf der Welle von Anschmachtschaum surfte, die Adrian mit jedem spendierten Drink für sie aufbranden ließ. Rebekka fand Adrian auch aus der Nähe toll. Wie sein dunkelblondes Haar ins Gesicht fiel, wie seine Augen so klar gezeichnet waren, fast wie geschminkt, und so dunkel waren und so Wimpern hatten. Rebekka wollte schon immer einen Mann wie ihn oder aussehen wie er. Er bewegte sich, als wüsste er nicht, wie er aussieht. Fast unsicher. Wie süß! Beinah hätte er eine Flasche Bier umgeworfen. Rebekka lachte über alles, was lustig war, genauso laut wie Jenny, aber Adrian hatte nur zwei Ohren, und die waren beide auf Jennys Lachen ausgerichtet. Johanna schmiss einen Gag nach dem anderen raus. Alle redeten Zeug, nur Rebekka fragte Fragen, die das Schreien in einem Club nicht wert gewesen wären. «Und warum machst du dein Abitur nach? Du bist richtig in Berlin geboren?» Sie konnte dafür nah an sein Ohr. Ein kleiner Ohrring drin.
Jenny nahm Adrian an dem Abend mit nach Hause. Adrian stieß sich beim Sex, kein Wunder bei dem Hin und Her, Amors ungenauen Treffer tief ins Herz. Jenny sagte Huppala und Tschüs. Weg war Adrian, wie niemals da. Jenny sagte, er sei ihr zu unmännlich gewesen, irgendwie hampelig und im Bett darum auch nicht die große Nummer. Kicher, kicher. Rebekka fand das gar nicht lustig.
Sonntag. Rebekka stand auf und machte eine Katzenwäsche, räumte noch etwas auf, kaufte Brötchen, nahm das Handy mit zum Bäcker, weil Johanna anrufen könnte. Tat sie auch.
«Lars’ Frau ist heute den ganzen Tag beschäftigt. Bist du böse, wenn ich…?»
«Nein, dann ein andermal.»
«Mach was aus deinem Tag!», sagte Johanna.
Was sollte sie aus diesem Tag schon wieder machen? Sie machte sich nichts aus diesem Tag. Das Frühstück lag geschmiert und verschmäht auf dem Teller. Trennung war die erste Diät, die Rebekka durchhielt. Danach stürzte sie sich in das volle Pflegeprogramm. In Frauenzeitschriften stand, dass man sich nur zehn Minuten Zeit am Tag nehmen müsste für das Dekolleté, nur zehn Minuten für die Tränensäcke, nur zehn Minuten für die Hände, nur zehn Minuten für die Oberschenkel, nur dreißig Minuten für das Haar. Rasieren, rupfen, peelen, cremen, massieren, damit die Falten weggingen, auf die jeder Mensch, der sein Gesicht benutzt, eigentlich ein Recht hat. Vielleicht sahen Models so gut aus, weil sie nie ihr Gesicht verzogen. Rebekka versuchte teilnahmslos in den Spiegel zu glotzen. Sie sah aus, wie sie eben aussah. Wie ein gesundes Landei. Auf dem Landei obendrauf waren kurze blonde Haare, die dünn waren, was in Frauenzeitschriften fein heißt. Fein, fein.
Abends wurde Rebekka angerufen und rief selber an. Wie geht’s dir? Wie geht es dir? Und dir? Und dir?
«Och», sagte sie zu Jette. Bei Jette wollte sie sich nicht beklagen. Die beklagte sich auch nie. Jette war wieder zu Hause bis zur nächsten Therapie. Sie erzählte, wie es im Krankenhaus war, dass die Ärzte erst nach der dritten Chemo sagen könnten, ob sie anschlägt. Sie hatte ein gutes Gefühl. Rebekka hatte auch lieber ein gutes Gefühl. Sie verabredeten sich für Dienstag und freuten sich.
«Och, mir ging es schon besser», sagte Rebekka danach zu Ramona und lenkte das Gespräch auf Jette. Was anderes hatte Rebekka sowieso nicht zu erzählen, aber da sie gut darüber informiert war, wie es um Jette stand, konnte sie wenigstens das erzählen. Ramona erzählte, dass sie vor ein paar Tagen erst mit Andy darüber geredet hatte, der mal wieder von seiner an Krebs gestorbenen Schwester erzählt hatte. Rebekka schnaufte, als sie das hörte, und fand, dass Andy nicht immer alle mit seiner toten Schwester erschrecken müsste wie mit einem Gespenst.
Ramona sagte: «Ach, na ja, das ist sicher nicht so gemeint von Andy. Das ist halt das, was ihm bei dem Thema einfällt.»
«Aber seine Schwester ist gestorben. Das ist so was von unpassend. Erzählt er das Jette auch jedes Mal, oder was?»
«Ach, reg dich doch da nicht drüber auf.»
Also regte sich Rebekka woanders drüber auf. Christian wollte davon auch nicht viel hören. Er wollte alle Menschen mögen und unterstellte jedem nur Gutes: «Andy macht sich eben Sorgen. Und Ramona mag Andy, glaube ich, ein bisschen mehr, zumindest mehr als mich.»
Christian wieder! Egal worüber man redet, er redet über Körbe, die er bekommt.
Rebekka hätte sich bei Iris aufregen können. Iris versuchte nie Ärger aufzuhalten. Immer raus damit. Sie hätte nie gesagt: «Andy hat seine Schwester eben geliebt, und Ramona mag Andy eben, und Christian ist halt einsam», aber Rebekka hatte keine Lust, mit Iris zu reden.
Als Johanna, die alte untreue Schlunze, anrief, um zu fragen, ob Rebekka sauer sei wegen der Absage morgens, vergab Rebekka ihr schon beim «Hallo» und erzählte dann der Reihe nach, wer was gesagt hatte.
«Na, geht es Jette nun gut oder nicht? Das ist doch entscheidend», sagte Johanna. Sie war frisch gevögelt gut gelaunt. «Jette hatte als Erstes ’ne richtig geile große Wohnung, ’ne Festanstellung, ’nen Ehemann und ’n Kind. Die kriegt das schon hin. Lass doch Andy reden, was er will.»
Rebekka machte nur: «Hm.» Irgendwas gefiel ihr schon wieder nicht.
Da nach Johanna aber niemand mehr anrief, konnte Rebekka mit niemandem darüber reden, was sie nun schon wieder gestört hatte.
Rebekka wusch ab und erstarrte mit einem tropfenden Teller in der Hand. Wenn Jette immer die Erste war, dann müsste sie auch als Erste sterben. Der Gedanke sprang Rebekka wie ein Raubtier an, hatte schartige Eckzähne und gewetzte Krallen. Johanna war so blöde. Vom Tellerrand tropfte die Zeit ab. Irgendwann würde Rebekka auf diesen Moment zurückblicken können, Teller in der Hand, und wissen, wie alles ausgegangen sein wird. Sie würde wissen, ob Jette gestorben ist. Irgendwann würde sie sich daran erinnern, wie sie einen Teller abgewaschen hatte und sich vorgekommen war wie in einem Film, in einer Schlüsselszene, in der jedem Zuschauer klar wurde, dass es nicht gut ausgehen würde. Jette hatte die dritte Chemo, ein geflicktes Zwerchfell, nur eine Niere, seit diesem Sommer nur noch eine halbe Lunge, noch so viel vor, ein Kind, einen Mann, Sommersprossen, schöne weiße Fingernägel, einen tollen Humor, einen gutartigen. Und immer wieder Tumore.
Rebekka wusch den nächsten Teller ab. Irgendwann würde sie auch wissen, ob Adrian ihr verzeihen oder ob sie einen anderen Mann kennenlernen wird. Als sie fertig war und den Stöpsel zog, das Wasser schnell im Ausguss verschwand, musste sie heulen. Sie wusste nicht, ob wegen Adrian oder Jette, und sie fand es schlimm, dass sie vielleicht wegen Adrian heulte anstatt wegen Jette. Falls sie wegen Jette heulte, fand sie das auch schlimm, weil es nicht zuversichtlich war. Das abfließende warme Wasser legte ihre immer noch kalten Hände frei. Abtrocknen, schlafen gehen, dachte sie. Aufwachen, Montag, im Reisebüro wollen alle Leute ständig weg, aufwachen, Dienstag, alle Leute wollen weg, Jette treffen, zuversichtlich sein.
Aus dem Radiowecker kam «I don’t like Mondays». Dann quatschte die Moderatorin mit der hohen Stimme fröhlich in das ausklingende Lied und behauptete, dass sie Montag auch nicht möge. Rebekka fand Montag nicht schlimm. Montag hieß, dass etwas anfing, auch wenn es nur eine Woche war.
Rebekka stand an der Haltestelle mit den anderen müden Gesichtern. Im Bus bekam sie einen Fensterplatz und konnte kurz das Haus sehen, in dem sie ein Jahr lang mit Adrian gewohnt hatte. Sie wollte sehen, ob die neuen Mieter schon eingezogen waren, ob in ihrem ehemaligen Bad Licht war, in der ehemaligen Stube die Gardinen vorgezogen, ob die Lampe an ihrem ehemaligen Hauseingang mal wieder kaputt war. Sie war mal wieder kaputt.
Rebekka schloss den Laden auf. Im Flackern der Neonröhre, die sich erst einblinzeln musste, zuckten die Palmenposter an den Wänden auf, dann war Licht. Die Poster taten so, als wäre plötzlich die Sonne aufgegangen. Im Laden war es saukalt, und Rebekka stellte die Heizung auf vier. Heize, heize.
Sie hängte ihren Mantel in den hinteren Raum, setzte Kaffee auf und schaltete das Radio ein. «I don’t like Mondays» und ein Moderator, der drüberschwatzte: «Es ist Montag, es ist kalt, wer könnte bei diesem Wetter…»
Rebekka fuhr den Computer hoch und holte ihren Kaffee aus der Küchenbuchte. Seit der Reiseanbieter, für den sie arbeitete, auch Safaris im Angebot hatte, stand ein hüfthoher Pappelefant neben der Eingangstür. Er hatte ein Schild im Rüssel: «Komme gleich wieder». Rebekka sollte den Elefanten von innen vor die Eingangstür schieben, wenn sie mal kurz den Laden verließ. Der Elefant war hohl, er ließ sich leicht verschieben, aber gleich als Rebekka ihn das erste Mal verrückte, zerriss sie seine Papierhaut am Hintern. Wenn Dumbo so stand, wie er meistens stand, war sein Hintern zur Wand gedreht. Und wenn Rebekka ihn herumdrehte, weil sie mal kurz den Laden verließ, und Dumbo der Kundschaft sein Schild entgegenrüsselte, dann war ja niemand im Laden, der Dumbos zerrissenen Hintern sehen konnte. Also machte es nichts, auch nicht dem Elefanten.
Früher wurde das Schild einfach an die Tür gehängt, jetzt musste sie einen Elefanten umdrehen. Sie tat das bereitwillig, denn in allen anderen Filialen des Reiseanbieters wurde ja auch jedes Mal ein Elefant herumgedreht. Rebekka trug ein hellblaues Hemd, ein dunkelblaues Jackett, einen dunkelblauen knielangen Rock und ein oranges Halstuch, weil die Kolleginnen in allen anderen Filialen das auch trugen. Die Mitarbeiter sollten an Flugzeugpersonal erinnern und die Reiselust wecken.
Die E-Mails waren da. Die bestellten neuen Kataloge würden erst morgen kommen, aha, aha; eine Beschwerde wegen eines nicht erreichten Anschlussfluges, ohoh; eine neue Tabelle zum Errechnen eines Tauchurlaubes, jetzt preislich gestaffelt nach Einsteigertarif, Profitarif und Familienangebot, soso. Rebekka setzte einen Antwortbrief für die Beschwerde auf. Dafür gab es eine Dokumentvorlage. Name rein, Entschuldigung stand schon da, Erklärung, mit herzlichen Grüßen. Der Reiseanbieter lehne jegliche Verantwortung ab und rate, sich an die Fluglinie zu wenden. Sie packte in den offenen Briefumschlag noch einen kleinen Prospekt für viertägige Busfahrten und legte den Briefumschlag auf die rechte Tischkante. Im Verlauf des Tages würden noch einige Briefe dazukommen, Buchungsbestätigungen und immer wieder Entschuldigungen, Preiserstattungen und Abwiegelungen. Die Menschen waren leicht vergnatzbar, wenn es darum ging, dass etwas ihren perfekten Urlaub unperfekt beeinflusste, und das konnte die kleinste Kleinigkeit sein: eine schimmlige Gurke in einem Küchenschrank, ein Ausblick in einen Innenhof, ein sexistischer sächselnder Reiseleiter, ein stinkender Busfahrer, eine für Besucher nicht geöffnete Sehenswürdigkeit. Wenn es dann Beschwerden gab, saß Rebekka in ihrem Kostümchen hinterm Schreibtisch und nickte verständnisvoll. Aha. Nein? O Gott! Sexistisch sagen Sie, Frechheit! Wenigstens wurde Rebekka nie für die zwei Hauptgründe verantwortlich gemacht, die einen Urlaub nicht so erholsam werden ließen wie erhofft. Keiner wollte das Geld zurück, weil das Wetter nicht schön war, und bis jetzt hatte sich auch noch keiner beschwert, weil er mit dem falschen Partner verreist war. Rebekka hätte gerne aus Spaß einen Antwortbrief daraufhin verfasst: «Bitte wenden Sie sich mit Ihren Beschwerden an den verantwortlichen Partner Ihrer Wahl und prüfen Sie Ihre Reisebegleitung nächstes Mal vorab genauer.»
Hannes war eine Zumutung im Urlaub. Er wollte sich den halben Tag nur entspannen, was für ihn sitzen, liegen, lesen oder essen bedeutete. Er aß Kekse und kaufte sich billige Sonnenbrillen. Er cremte sich nur die Nase ein. Den anderen halben Tag raffte er sich auf und suchte Kontakt zu anderen Reisenden und Einheimischen, an denen er seine Fremdsprachenunkenntnis austobte. Hannes lachte viel mit alten zahnlosen Männern, die ihn zum Bier einluden. Rebekka saß wie mit Zahnstochern im Po vor rumpeligen Lädchen und musste sich von der Matrone des Hauses die Haare befummeln lassen. Hannes bat darum, mit Rebekka fotografiert zu werden, und drückte sie fest an sich. Es schlenkerte ihn bei jeder Gasse vom Weg ab, um Katzen zu füttern oder mit Hunden zu spielen. Er knipste dreckige Stellen und dunkle Hinterhöfe. Dass sie nie ausgeraubt wurden in ihren Urlauben, war nur Hannes’ Glück als naiv fröhlichem Touritölpel zu verdanken. Wenn sie nach Hause kam, war Rebekka jedes Mal urlaubsreif.
Mit Adrian zu verreisen war immer sehr einfach gewesen. Sie interessierten sich für einige Reiseziele, und dann suchte Rebekka in ihren Prospekten nach einem Angebot, das preiswert war, aber von dem sie wusste, dass es bis jetzt keine Beschwerden gegeben hatte. Sie konnte sich auf die inoffizielle Stiftung Kundentest immer verlassen. Ihre Urlaube waren alle schön gewesen, Madeira, Island, Riga und so weiter. Adrian und sie waren sich unausgesprochen einig, dass sie nur schnuppern wollten. Sie sahen sich alles an, was wichtig und schön war, und aßen dort, wo es sauber und schön war, und schliefen dort, wo es ruhig und schön war. Nachts blieben sie im Hotel. Sie waren nicht die Typen für Abenteuer und Risiko, warum sollte man im Urlaub auch völlig anders leben als zu Hause? Zu Hause waren sie ruhige und beobachtende Zeitgenossen und in Madeira auch, in Island auch, auch in Riga und so weiter. Nach dem Urlaub hatten sie einen Eindruck davon, was für Haare Isländer haben, was für Gewürze in Madeira verwendet werden und was für Lieder in Riga aus dem Radio kommen. Wieder zu Hause waren sie glücklich, weil die Reise sie nicht verändert hatte, weil es keinen Anlass zum Streiten gegeben hatte und weil Rebekka vom Reiseveranstalter immer Rabatt bekam. Eigentlich verstanden sich Rebekka und Adrian im Urlaub sogar besser als im Alltag. Angeblich ist das bei anderen Paaren anders, aber Adrian und Rebekka spielten sich in ihren Urlaubstagen richtig aufeinander ein. Sie wachten morgens fast gleichzeitig auf, hatten gleichzeitig Hunger, wollten erst die wichtigen Sehenswürdigkeiten sehen und dann die unwichtigen, sie wurden nachmittags müde und mussten eine Pause machen. Abends schrieben sie im Hotelzimmer Postkarten und teilten die Liste der Freunde untereinander auf. Zum Schluss unterschrieben sie gegenseitig den kurzen Text des anderen, der davon erzählte, dass sie eine geflochtene Strandtasche in einem dunklen, kühlen Laden gekauft hätten, dass das Wasser den Himmel spiegele oder der Himmel das Wasser, dass Island eine ursprüngliche Erfahrung sei, dass sie sich Fahrräder geliehen hätten und Adrian gestürzt sei. Sie hatte Adrians Arm damals mit ihrem Halstuch verbunden und gepustet. Ei, ei.
Dienstag. Jette sah genauso schön aus wie zu der Zeit, als sie schwanger war. Rebekka umarmte sie, nicht zu lange, aber auch nicht zu kurz, Hauptsache, nicht irgendwie anders als normal. Jette sah meistens gut aus. Sie hatte ein eindrucksvolles großes Gesicht, gar nicht weil sie einen großen Kopf hatte, nur alles in ihrem Gesicht war groß, die Augen, der Mund. Die Nase war nicht wirklich groß, aber lang. Jette sah toll aus mit kurzen Haaren, auch ganz ohne Haare. Sie sah aus wie eine Schwarze mit ihren großen Lippen, aber eben in Weiß, wie eine Athletin eines klugen Sports, vielleicht Hürdenschach. Sie war einfach schön, aber als sie damals schwanger war, blühte sie noch mehr auf, wie mehrere Rosenhecken. Sie schritt würdevoll wie mehrere Richter und saß im Schneidersitz wie mehrere Buddhas. Jette hatte die Komplimente damals abgetan und gesagt, dass sie so schön aussehe, liege daran, dass in ihr ein großes Geheimnis wohne. Und so sah Jette an diesem Tag wieder aus. Ein großes Geheimnis.
«Wie geht’s dir?»
«Gut», sagte Jette und nahm Rebekka den Kuchen ab. Sie hatte darum gebeten, dass Rebekka Kuchen mitbringt. Was für Kuchen, war Jette egal, und das war auch gut so, weil es um sechs beim Bäcker keine große Auswahl an Kuchen mehr gab. Nur noch was mit Obst, was Trockenes und was mit Sahne. Irgendwas davon würde Jette schon schmecken.
Jette sagte: «Seltsames Abendbrot, oder? Ich weiß auch nicht, warum mir so viel nach Naschwerk ist.»
«Bist du schwanger?», fragte Rebekka.
«Ach, i wo!», sagte Jette. «Ich hab nich mal mehr meine Tage. Das bekommt mein Körper nich hin. Dafür hat der gar keine Kraft.»
«Wo sind denn Enno und Klara?», wollte Rebekka wissen.
«Die sind bei der Ömmi.» Jette stellte den Kuchenteller auf den Tisch und suchte im Schrank nach Gläsern: «Saft?»
Rebekka nickte. Sie fühlte sich wohl, weil Jette Ömmi gesagt hatte. Jette hatte einen Hang dazu, Wörter anders zu betonen, als sie normalerweise betont werden. Sie betonte sie oft auf der letzten Silbe, wie es im Deutschen gar nicht üblich ist. Sie sagte Flasch-é, oder Blu-mén. Aus dem normalen Wort Truhe machte sie das beschwingte Tru-hé, wie Juch-hé. Es war hochgradig unverständlich, dass gerade Jette Krebs hatte. Das war unangebracht, so unangebracht, wie Krankheiten immer sind, und dann nochmal doppelt so unangebracht dazu. Wenn Johanna Krebs hätte, dann hätte sie ihn, weil sie unglücklich mit Lars war, weil sie vorher mit einem anderen Mann unglücklich gewesen war und weil sie so viel blödes Zeug redete. Rebekka fielen sogar mehr Gründe ein, warum sie selbst Krebs haben könnte. Die Scheidung ihrer Eltern hatte ihr einige Türen im Vorschulherzen zugeknallt. Die Schlösser blieben eingeschnappt. Rebekkas Eltern hatten ihrer Tochter eine dauerhafte Streitüberempfindlichkeit zusammengeschrien. Das, was ein schöner Zopf gewesen war, wurde damals auseinandergeflochten, meins, deins und Kind. Es wurden Aufkleber in die Kühlschrankfächer geklebt, um das Fach des Vaters vom Fach der Mutter zu unterscheiden, roter Punkt Vater, gelber Punkt Mutter. Gelbe Karte, rote Karte, Platzverweis, raus. Rebekka hatte nicht mehr gewusst, was sie essen durfte und wo ein Kind hingehörte, wenn es um meins und deins ging. Davon kann man Krebs bekommen, aber doch nicht von einem Leben wie dem von Jette, wo immer alles glattging, wie eine neue Rutsche auf einem schönen Spielplatz, auf der man hinuntersausen kann, dass sich die Windjacke bläht. Das frohe Kreischen hallt bis zum Sandkasten, und die Kapuze knattert, und der Schal flattert. Juch-hé!
«Und, wie geht’s dir?», fragte Jette und nahm sich die Hälfte des Himbeerkuchens.
«Och, ich stell mich zu blöd an, die Trennung hinzunehmen. Ich glaub das einfach nicht. Das kann einfach nicht sein. Ich bin schon so lange in ihn verliebt. Seit, hm, immer? Und, na ja, für immer? Ich will nicht ohne ihn leben.»
«So was darfst du nicht sagen.»
«Darf ich nicht?»
«Nein.»
«Gut, dann nicht.»
Rebekka nahm die andere Hälfte des Himbeerkuchens, obwohl sie Himbeeren nicht mochte, weil die Kerne in ihren Backenzähnen stecken blieben.
Rebekka erzählte davon, dass sie Adrian ein schönes Geschenk zum Geburtstag kaufen wollte, aber noch nicht die richtige Idee hatte. Sie erzählte, dass sie sich in der neuen Wohnung nicht richtig wohlfühlte. Sie erzählte, erzählte eigentlich alles, außer das mit den Himbeerkernchen. Das kam ihr nicht wichtig vor.
«Ich muss mir deine Wohnung mal ansehen», beschloss Jette.
Rebekka nickte und nahm die andere Hälfte des Marmorkuchens, den Jette mit dem Messer geteilt hatte, so wie sie auch das dritte Stück Kuchen teilen würde, denn geteiltes Leid ist halbes Leid, und geteilter Kuchen ist doppelt lecker. Jette fand die Idee mit dem Geschenk für Adrian gut, sie hatte sogar eine Idee zu der Idee: «Adrian mag doch Filme so gerne und Kino und so…»
Daran hatte Rebekka auch schon gedacht, aber jeder, der Adrian kannte, dachte daran als Erstes, wenn Adrian Geburtstag hatte: Filmplakate, Kinogutscheine, Eimer voller Popcorn. Sie müsste ihn doch besser kennen als andere, die ihn kennen.
«Was wollte er denn schon immer haben?»
«Julia Roberts», sagte Rebekka.
Jette lachte: «Die ist zu teuer, außerdem wird gerade dieses Geschenk nicht dabei helfen, dass ihr wieder zusammenkommt. Was anderes. Na? Na? Na? Oder ist Adrian einer von denen, die man nicht beschenken kann, so wie Opas und Omas, dann musst du ihm Pralinen schenken. Los, denk nach! Na? Na? Na?»
«Ich kann so nicht nachdenken.»
«Nein? Nein? Nein?»
Sie kicherten sich aus. Danach konnte Rebekka wieder nachdenken.
Einen Flipperautomaten wollte Adrian immer haben. Rebekka war es auf den Keks gegangen, dass Adrian am Computer so viel flipperte. Adrian nannte das Ersatzbefriedigung, ein richtiger Flipper sei viel toller. «Und lauter», hatte Rebekka gesagt. Damit war die Diskussion beendet.
Jette war sich sicher, dass im Internet ein preiswerter Flipperautomat zu finden sein müsste.
«Stimmt», sagte Rebekka und zündete innerlich mehrere Streichhölzer an, und damit dann mehrere Wunderkerzen, die fröhlich runterbritzelten. Juch-hé! Ein Flip-pér! Dann waren die Wunderkerzen runtergefreut, und Rebekka fiel auf, dass Adrian offenbar einen Vorteil davon hatte, dass er nicht mehr mit ihr zusammenwohnte. Er konnte jetzt endlich einen Flipper haben. Das war schlecht. Aber wenn er ihn von Rebekka bekäme, war das schon wieder gut.
«Wie lange ist es denn her, dass du Adrian gesehen hast?»
«Pffff», machte Rebekka mit vollem Mund und pustete Kuchenkrümel, die treffsicher auf den Teller flogen. Sie lachten, und noch mehr Kuchenkrümel wurden nicht treffsicher neben den Teller gelacht.
«Seit dem Auszug. Er hat gesagt, dass er mich erst mal nicht sehen will.»
«Jaaaa, das hat er gesagt. Er hat sich doch getrennt, weil er so eifersüchtig war, also aus Liebe. Vielleicht braucht er noch ein bisschen Zeit, aber irgendwann wird sich das wieder zusammenruckeln. Ich denke, er freut sich, wenn er dich sieht und wenn du kämpfst.» Jette ballte die Faust und sah dabei so stark aus, als könnte sie jeden Typen verprügeln, alles erreichen und auf jeden Fall gesund werden. Rebekka dachte ja auch, dass es sich, wie Jette gesagt hatte, wieder zusammenruckeln würde, wie wenn ein Teil in einer Maschine lose ist und etwas klemmt. Wenn das Teil wieder reinrutschte, dann würde wieder alles funktionieren. Dampf käme aus den Kesseln, beispielsweise Erbsen würden abgefüllt, Etiketten zugeschnitten, Laufbänder würden alles transportieren, und Rebekka bekäme ein Schild, auf dem stünde «Mitarbeiterin des Monats». Sie war zuversichtlich. Jettes Krankheit war zwar nicht ansteckend, ihre Zuversicht war aber ansteckend. Jette wirkte nie so, als ob sie sich Sorgen machte. Die drei Pferde, die ihren Wagen zogen, hießen Wird-schon, Komm-schon und Ausdauer! Rebekkas Pferde waren schreckhafte Hottehüs. Sie hießen Kann-sein, Ich-weiß-nicht und Wieso-denn. Rebekka wollte viel lieber Jettes Wagen hinterher, als nachzudenken, wohin mit ihren Gäulen.
Jette und Rebekka pickten wie die Spatzen die letzten Kuchenkrümel vom leeren Teller, aber nicht mit dem Schnabel, sondern mit den angeleckten Fingern.
«Erzähl mal, was die im Krankenhaus gesagt haben.»
Jette winkte ab. «Ach, was die gesagt haben… Sind doch nur Pappnasen. Die haben gesagt, dass sie noch drei Zyklen machen wollen, außer es stellt sich heraus, dass es nicht anschlägt. Das wird nach der nächsten Infusion gekuckt. Dann bekomme ich Tabletten. Das ist Plan B.Und dann gibt es noch eine höherdosierte Chemo. Plan C.Das ist das Zeug, was ich nach der Operation letztes Jahr bekommen habe. Das haut auf jeden Fall alles weg. Es gibt sogar auch noch einen Plan D.Ich hab gefragt, ob sie auch Scheintherapien machen, also mir Placebo verschreiben würden, ohne es mir zu sagen. Das wäre Plan D, haben sie gesagt, und ich hab gesagt, den könnten sie sich klemmen. Das will ich nicht.»
Rebekka nickte und sagte: «Nee, das würde ich auch nicht wollen», wobei ihr selber nicht klar war, ob sie meinte, dass sie es an ihrer Stelle nicht wollen würde oder ob sie es für Jette nicht wollen würde. Sie konnte sich gar nicht richtig in Jettes Lage versetzen, nicht tief genug, um zu überlegen, was sie für sich selbst in dieser Lage wollen würde. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass ihr halbe Organe fehlten und dass sie einen Port gelegt bekam, durch den die Chemie in sie eingespritzt werden konnte. Jette hatte Rebekka mal den Port gezeigt. Wie eine kleine Steckdose. Es sah nicht schlimm aus. Sie hatte ihr auch mal ihre große S-förmige Operationsnarbe auf dem Oberkörper gezeigt. «Wie Superman», hatte Jette gesagt. Das sah schlimm aus. Die Operation war letztes Jahr gewesen. Sechs Stunden, und danach fehlte einiges, das Jette vorher brauchte, und einiges, das Jette überhaupt nicht gebrauchen konnte. Ein Tumor, groß wie ein Fußball. Die Chemo danach sollte den Rest erwischen, den die Operation vielleicht nicht erwischt hatte. Eine Art Schiffeversenken mit Atombombe. Jettes Haare wuchsen danach heller und lockig. Jette ging wieder arbeiten, Teamleiterin bei einem der größten Hersteller für Industriekeramik. Sie trug einen Hosenanzug und fuhr zu Messen, um mit einem Teleskopkuli auf Diagramme zu zeigen. Ihr Chef hatte ihr die Stelle frei gehalten und nur vorübergehend mit jemand anderem besetzt, der diese Stelle dann dauerhaft bekam, als bei Jette ein Dreivierteljahr später Metastasen in der Lunge gefunden wurden. Wieder Operation. Halbe Lunge weg. Wieder Chemo. Weil es bei Metastasen in der Lunge klar ist, dass es gestreut hat. So war der Verlauf. Das war der Stand. Rebekka hatte sich fast daran gewöhnt, dass der Krebs zu Jette gehörte. Er kam immer wieder, weshalb er wahrscheinlich dazwischen auch nie weg war. Jette hatte nun mal Krebs, dann wieder nicht, dann wieder doch, jedenfalls starb sie nie daran. Der erste Tumor war zu Schulzeiten entfernt worden. Deshalb musste Jette die Zwölfte wiederholen und kam zu Rebekka in die Klasse. Der erste Tumor war nur im Gewebe, nicht in einem Organ, halb so wild. Ach, viertel so wild. Zwischendurch war gar nichts. Nur Leben. Und dann war der Krebs wieder da, richtig wild, dann war er weg, dann wieder da, wirklich wild. Er tobte in Jette herum wie ein durchgeknallter Hausbesetzer, dem jede Hausordnung egal ist. Er ließ Zellen wachsen, die gar nicht wachsen sollten. Er baute Verbindungen, wo keine sein sollten. Er übernahm sinnlose Aufgaben, die nicht seine Aufgaben waren, Arschloch. Rebekka fand das alles über jedes Schimpfwort hinausgehend. Jette sagte «der Kreps», und das klang wie Crêpes, lecker zu essen, nicht so erschreckend. Das Leben ging weiter, wenn auch mit ungewöhnlichen Momenten. Enno musste Jette die Spritzen geben, die sie zwischen zwei Krankenhausaufenthalten brauchte und die Jette sich nicht selbst setzen wollte. Er ließ sich anmotzen, wenn es wehtat, und tat so, als würde er nicht hinhören. Jette sagte, sie wäre unzumutbar manchmal.
«Und Enno ist total streng, strenger als das Krankenhauspersonal. Wenn er mitbekommt, dass ich nur faul bin und mich gehenlasse, dann bedient er mich nicht. Frechheit. Ah, wenn man vom Engel spricht…»
Die Wohnungstür wurde aufgeschlossen. Klara flog in Jettes Arme und grüßte ganz lieb von der Ömmi.
«Hallo, Rebekka», sagte Enno und umarmte sie. Das hatten sie die ersten Jahre nie getan. Sie hatten im Krankenhaus damit angefangen, weil es sich in Krankenhäusern leichter umarmt. Nur Jette ließ sich im Krankenhaus nie gut umarmen, weil sie mit ihrem Lungenwassergerät auf Rädern herumlief. Ein anderes Mal waren die Narben zu frisch. Trotzdem wollte Jette immer umarmt werden. Sobald sie wieder halbwegs fit war, wollte sie unbedingt andere Nasen sehen als ihre Zimmergenossinnen, die nervten und manchmal starben. Jette freute sich über Menschen mit Haaren.
«Hallo, Enrico», sagte Rebekka zu Enno. Der grinste. Es war für Rebekka am Anfang schwer herauszubekommen, ob Enno nur so grinste oder aus einem anderen Grund als eben nur so. Er grinste ständig. Er grinste für sich allein, zufrieden, abwesend, wie eine überdrehte Katze. Das kam ihr so unnatürlich gutgelaunt vor, aber ohne dass sich diese gute Laune an jemanden richtete. Er hatte sie nicht von etwas und nicht für etwas, von niemandem und für niemanden.
Nach dem Kuchen gab es noch richtiges Abendbrot, und Rebekka aß das erste Mal seit der Trennung, als hätte sie Bärenhunger, dabei hatte sie nur Bärenappetit. Nach dem Abendbrot spielten sie «Mensch ärgere dich nicht», und Klara ärgerte sich. Sie verlor, weil sie sich nicht traute, ihre Mutter rauszuwerfen, auch wenn die Klara immer wieder dazu aufforderte. Klara wollte sich mit ihrer gelben Spielfigur lieber neben die hellgrüne Spielfigur von Jette stellen. Rebekka fühlte sich wie im Urlaub, denn ihre Familie hatte nur im Urlaub «Mensch ärgere dich nicht» gespielt, weil es auf dem Zeltplatz keinen Fernseher gab. Bei Jette und Enno wurde immer viel gespielt, weil es nicht nur im Urlaub keinen Fernseher gab. Nachdem einmal Rebekka und zweimal Enno gewonnen hatte, begleitete Enno Klara ins Bad, wo die kleinen Zähne geputzt wurden.
«Und deine Mutter?», fragte Jette in der unmotivierten Art, die sie manchmal wie eine Gesprächsoase zum Entspannen zwischendurch anbot.
«Nu ja, muss ja», sagte Rebekka.
«Und dein Vater?»
«Ja, auch.»
Sie seufzten gespielt altersschwach.
«Hab ich was verpasst?», fragte Enno.
«Nee», lachten die Weiber.
Dann hieß es «Ab ins Bettchen, Klärchen!», und Klara zögerte die Vertreibung aus der paradiesischen Küche mit Küssen und Schmusen raus.
«Jetzt aber los in die Klärgrube!», sagte Enno strenger, und Klara sauste gar nicht müde ins Kinderzimmer: «Ich lass das Licht noch ein bisschen an, ja?»
«Is gut», rief Enno.
Jette erklärte, dass Klara Leuchtsterne an der Decke habe und diese aufladen wolle. «Die hat Enno mit ihr gebastelt», sagte sie in einem komischen Tonfall, mit einem komischen Blick zu Enno. «Klara hat ’ne Schere benutzt und Enno einen Cutter.»
Rebekka verstand nicht, was hier genau los war, aber es klang so, als ob noch was Lustiges käme. Enno grinste etwas doller als sonst. «Ich hab was druntergelegt», sagte er.
«Ja, einen Tisch», lachte Jette, «was noch nicht so schlimm gewesen wäre, wenn Enno nicht versucht hätte, das seiner Tochter anzuhängen. Der Heinz von einem Horst.» Jette knallte ihre Faust auf den Tisch.
Enno grinste. «Das ist doch viel glaubhafter so. Sag doch mal ehrlich, Rebekka, wenn du tiefe Kratzer auf einem Kindertisch sehen würdest, dann würdest du doch auch denken, dass da ein Kind etwas ungeschickt gebastelt hat. Und du würdest dem Kind keine Vorwürfe machen, weil – so sind Kinder eben. Aber einem liebevollen Vater kann das natürlich auch mal passieren.» Er zwinkerte Jette an.
«Jaja», sagte die und erzählte Rebekka lachend, dass alles nur aufgeflogen war, weil Klara ihrer Mama zeigen wollte, welche Sterne sie gebastelt hatte und welche der Papa. «Klaras Sterne waren die kleinen dicken und Papas die großen mit den dünnen Strahlen. Und der Umriss auf dem Tisch», sagte Jette mit erhobenem Finger, «hat lange dünne Strahlen. Klara hat ja behauptet, dass sie die Tischplatte zerkratzt hatte, und als ich gefragt habe, ob es nicht doch der Papa war, da hat sie geschluchzt: Aber sag dem Papa nicht, dass ich ihn verraten habe.»