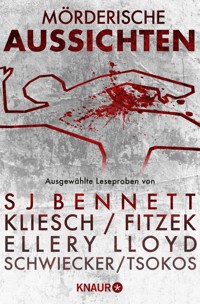14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Fälle Ihrer Majestät
- Sprache: Deutsch
Royaler Cosy Crime im England der 50er-Jahre: »Die Tote trug Diamanten« ist der 4. Band der englischen Krimi-Serie »Die Fälle Ihrer Majestät«. Schon zu Beginn ihrer Regentschaft wird Queen Elizabeth in ihre erste Mord-Ermittlung verwickelt! 1957 sucht England noch nach seinem Platz im Europa der Nachkriegszeit – da erschüttert ein skandalöser Mord in der Nähe des Buckingham Palace das Land: Nur mit sexy Wäsche und einem Diamant-Diadem bekleidet liegt eine junge Frau tot auf einem Bett, ihr zu Füßen ein strangulierter Mann. Die Polizei hat schnell eine ganze Reihe von Verdächtigen, denn am Tatort hat sich zur Zeit des Mordes eine Herrenrunde aus Londons High Society getroffen. Doch die Herren geben einander gegenseitig Alibis. Auch Prinz Philip war in der Mord-Nacht in der Gegend. Sein Alibi – die junge Queen – weiß sehr genau, dass er die ganze Nacht nicht zu Hause war. Zum Glück entdeckt Elizabeth unter ihren Typistinnen die erstaunlich gewitzte Joan, die ihr bei den hochgeheimen Ermittlungen diskret zur Seite steht. Humorvoller und intelligenter Whodunit-Krimi mit der unvergleichlichen Queen Elizabeth als heimlicher Detektivin Mit viel Respekt vor dem englischen Königshaus lässt die britische Krimi-Autorin S. J. Bennett Queen Elizabeth zum 4. Mal ermitteln. Ende der 50er-Jahre ist die junge Elizabeth noch nicht lange Königin und hat mit allerlei Widerständen zu kämpfen. Die cosy Krimis um Queen Elizabeth und ihre ebenso scharfsinnigen wie tatkräftigen Assistentinnen sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Das Windsor-Komplott - Die unhöfliche Tote - Ein höchst royaler Mord - Die Tote trug Diamanten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
S. J. Bennett
Die Tote trug Diamanten
Ein Queen-Elizabeth-Krimi
Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein skandalöser Mord in der Nähe des Buckingham Palace erschüttert England, das 1957 noch nach seinem Platz im Nachkriegseuropa sucht: Nur mit sexy Wäsche und einem Diamant-Diadem bekleidet liegt eine junge Frau tot auf einem Bett, ihr zu Füßen ein strangulierter Mann. Die Polizei hat schnell eine ganze Reihe von Verdächtigen, denn am Tatort hat sich zur Zeit des Mordes eine Herrenrunde aus Londons High Society getroffen. Auch Prinz Philip war in der Mordnacht in der Gegend. Sein Alibi – die Queen – weiß sehr genau, dass er die ganze Nacht nicht zu Hause war. Zum Glück entdeckt Elizabeth unter ihren Typistinnen die erstaunlich gewitzte Joan, die ihr bei den geheimen Ermittlungen diskret zur Seite steht ...
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Zitat
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Teil 2
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Teil 3
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Teil 4
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Einige Nachbemerkungen
Für meine Großmütter Joan und Jessie
»Wir brauchen die Art Mut, die der subtilen Verderbtheit der Zyniker zu widerstehen vermag, um der Welt zeigen zu können, dass wir keine Angst vor der Zukunft haben. Es war immer schon leicht, zu hassen und zu zerstören. Etwas aufzubauen und zu schätzen, ist weit schwieriger …
Ich kann Sie nicht in die Schlacht führen, ich gebe Ihnen keine Gesetze, um für Gerechtigkeit zu sorgen, aber ich kann etwas anderes, ich kann Ihnen mein Herz und meine Zuneigung schenken, Ihnen, diesen alten Inseln und allen Völkern unserer Bruderschaft der Nationen.«
Aus der Weihnachtsbotschaft der Queen im Jahr 1957
Teil 1
Vive la Reine
Kapitel 1
Die Queen wusste gleich, dass sie einen fatalen Fehler begangen hatte, bildlich ausgedrückt.
»Mais bien sûr, madame. Tout de suite.«
Beim Candle-Light-Dinner im Louvre, am zweiten Abend ihres ersten Staatsbesuchs in Frankreich, hatte sie vielleicht eine Idee zu sehnsüchtig erwähnt, dass sie die Mona Lisa noch nie gesehen habe. In der Salle des Caryatides des Museums tummelte sich Le Tout Paris. Alle Minister, bekannten Gastgeberinnen und bedeutenden Würdenträger schienen anwesend zu sein, dicht gedrängt und aufs Edelste gekleidet saßen sie da und beobachteten sie. Aber abgesehen von der einen oder anderen Statue und der herrlichen Decke hatte sie noch keine Kunst zu sehen bekommen.
Nach einer kurzen Besprechung der führenden Köpfe des Museums jedoch trugen zwei Angestellte den Leonardo in den Saal, prächtig in seinem reich verzierten vergoldeten Rahmen. Sie lehnten ihn für sie an einen Stuhl, und es war absolut außerordentlich: diese zwei berühmten Augen, die sie geheimnisvoll unter ihren schweren Lidern her anstarrten. Man kannte das Bild so gut als Illustration für alles Mögliche, dass es erstaunlich war, das Original vor sich zu haben. Die Queen fühlte für einen Moment, was viele Menschen empfinden mussten, wenn sie ihr gegenübertraten.
Für die riesigen Erwartungen, die man mit dem Porträt verband, schien es so aus der Nähe, im flimmernden Licht, bemerkenswert menschlich. Hinter den Augen sah die Queen eine junge Frau, auf schöne Weise gefasst und ein wenig verlegen, weil sie so genau betrachtet wurde. Ich weiß, wie du dich fühlst, dachte sie. Die Malerei war wundervoll, doch es war schwer, sich darauf zu konzentrieren, während sich alle vorbeugten und ihre Reaktion sehen wollten.
»C’est merveilleux, n’est-ce pas?«, sagte sie und war sich dabei voll bewusst, dass dies wohl das Understatement ihres Besuchs schlechthin gewesen war.
Kurz darauf, als in einem anderen prächtigen Salon weitere Große und Gute zu ihnen stießen, geriet die Queen noch stärker in den Mittelpunkt. Hunderte Menschen drängten heran, um sie zu begrüßen, spitze Ellbogen gruben sich in eingezwängte Taillen, und alle wollten ihr nahe sein, sie besser sehen. Irgendwann schwappte die Menge in einer Welle vor, und die Queen konnte den Druck spüren. Sie wurde eingeklemmt, und es blieb kaum Raum zum Atmen. Einen Moment lang bekam sie fast Angst. Es war befriedigend, so beliebt zu sein, doch in diesem Augenblick wäre sie dankbar gewesen, der Situation mit heiler Haut und intakter Garderobe entkommen zu können.
Aber dann dachte sie daran, was ihre Großmutter, Queen Mary, sagen würde, und sie fasste sich und ließ sich nichts anmerken. Ihr Blick glitt über das Meer erwartungsvoller Gesichter, aus dem zwei hervorstachen. Eines sah nicht direkt zu ihr, sondern zu jemandem in der Menge hinter ihr. Es verzog sich kurz zu einer ungeschützt düsteren Miene, und in den Augen blitzte blanker Hass auf. Die Queen hatte solch einen Blick verschiedentlich in Windsor gesehen, als Teenager, wenn Offiziere oder ihre Familien die übelsten Grausamkeiten des Krieges beschrieben. Sie wusste, wer der Mann war, kannte seine Geschichte und glaubte zu wissen, zu wem er hinstarrte.
Das andere Gesicht ließ den Blick mit unverhohlener Verachtung durch den Raum schweifen, den Mund frustriert zusammengepresst. Endlich fanden die Augen ihre und wurden auf der Stelle völlig ausdruckslos. Aber die Queen hatte genug gesehen. Sie kannte ihren Besitzer nur zu gut.
Sie hatte verschiedene Dinge zu erledigen, wenn sie nach Hause kam, denn es war klar, dass jemand aus ihrem engsten Umkreis versuchte, ihren Besuch zu sabotieren. Eine entsprechende Antwort darauf war schwierig, und sie musste vorsichtig vorgehen, war sie doch nicht wirklich sicher, wem sie trauen konnte.
Im Auto zurück zur britischen Botschaft sagte sie zu Philip: »Ist dir eigentlich aufgefallen, dass sie uns heute Abend Austern serviert haben?«
»Ja, und zwar sehr gute.« Er schenkte ihr ein wissendes Lächeln, bevor er die Brauen leicht zusammenzog. »Ich hatte jedoch nicht den Eindruck, dass du sie mochtest. Hast du sie überhaupt probiert?«
»Nein, habe ich nicht, so gern ich Austern mag.« Sie erwiderte sein Lächeln. »Aber im Ausland kann ich sie einfach nicht essen.«
»Ich glaube, wir können den Franzmännern bei diesem Anlass trauen. Sie werden kaum versuchen, dich zu vergiften. Und sie verstehen sich besser als alle anderen auf Austern. Taten sie immer schon.«
»Das bezweifle ich nicht. Es sind nicht die Franzosen, sondern die Austern selbst. Man weiß nie. Und ein verkorkster Magen wäre eine Katastrophe.«
»Das wäre er wohl. Schade. Sie waren erste Klasse.«
Die Queen zog ihre Fellstola um die Schultern zurecht und sah hinaus zu den glitzernden Lichtern der Place de la Concorde. Sie würden gleich schon zurück in der Botschaft sein. Sie liebte diesen großartigen Platz beim Fluss mit dem klassisch noblen Hotel Crillon im Hintergrund und dem uralten, goldgekrönten, Größe ausstrahlenden Obelisken in der Mitte, wobei ihr bewusst war, dass hier ein König und seine Familie buchstäblich die Köpfe verloren hatten.
Sollte sie Philip sagen, was sie wirklich dachte?
Die Limousine umrundete den Platz und fuhr die Rue Royale hinunter. Das letzte Mal, als sie und ihr Mann hier gewesen waren, 1948, war sie, was noch niemand wusste, mit Charles schwanger gewesen. Oh, zweiundzwanzig zu sein, frisch verheiratet, hoffnungslos verliebt und zum ersten Mal in Paris, wo die Menschen überall noch voller Ausgelassenheit waren und die Freude der Befreiung in sich trugen. Was das für eine Reise gewesen war!
Als sie vor zwei Tagen hergekommen waren, hatte sie nicht gedacht, dass sie das Erlebnis wiederholen könnten – jetzt, da sie das respektable Alter von dreißig erreicht und zwei Kinder zu Hause hatte, die Sorge um das Land auf den Schultern trug und endlose unbegründete Gerüchte um ihre Ehe ertragen musste. Aber wenn sie die Pariserinnen und Pariser die Straßen säumen sah, begeistert wie eh und je, rührte es sie über alle Maßen. Philip hatte recht, und sie bezweifelte ebenfalls, dass jemand versucht haben könnte, sie zu vergiften oder ihr mit einer zweifelhaften huître zuzusetzen.
Und doch …
Die Queen bat um wenig, wenn sie ins Ausland reiste. Sie verfügte über eine robuste Konstitution und ein ziemliches Durchhaltevermögen, war mehr als bereit, sich anstrengenden Terminplänen zu unterwerfen, und aß so gut wie alles, was man ihr vorsetzte. Schalentiere bildeten eine seltene, aber entschiedene Ausnahme. Man konnte einfach seine Pflichten nicht erfüllen, wenn man sich unter Magenkrämpfen wand. Ihr persönliches Büro machte das stets klar, und doch waren ihr gestern sechs Austern à la sauce mignonette avec fraises et champagne serviert worden, als hätte niemand etwas gesagt.
Es wäre leicht, das einem versehentlichen Durcheinander zuzuschreiben. Ganz unvermeidlich gingen immer ein paar kleine Dinge daneben, und in aller Regel war das eher komisch. Aber da war auch die Sache mit der verloren gegangenen Rede.
Ihre Antwort auf den Toast des Präsidenten der Republik vor vierundzwanzig Stunden sollte das Glanzstück ihres ersten Tages in Frankreich sein. Es war eine Erinnerung daran, dass sie fließend Französisch sprach, eine Hymne auf die Entente cordiale, die ihre beiden Nationen miteinander verband, und auf die gemeinsamen Opfer, die trotz widrigster Umstände zum Sieg des Krieges geführt hatten. Der Text war nicht lang, aber über Wochen ausformuliert worden, und sie hatte ihn immer wieder eingeübt.
Dann, eine Stunde vor ihrem Aufbruch in den Élysée-Palast, wo sie die Rede halten sollte, kam ihr Privatsekretär zu ihr, leichenblass, und unterrichtete sie, dass sowohl das Original als auch sämtliche Kopien und Durchschläge verschwunden waren. Er und der Botschafter mühten sich verzweifelt, etwas Neues zu formulieren, doch sie wusste, es würde nicht das Gleiche sein. Es bestand das große Risiko, dass die Rede durch ihre mangelnde Vertrautheit mit den neuen französischen Sätzen, einen Großteil ihrer Kraft verlieren würde.
Glücklicherweise erinnerte sie sich jedoch daran, dass eine der letzten Versionen des Originals von einer der Schreibkräfte im Buckingham Palace mit ein paar ausgezeichneten Gedanken zu französischen Spracheigenheiten zurückgekommen war. Vielleicht hatte die Frau ja, dachte die Queen, einen Durchschlag der Rede behalten, und so war es: Fünfzig Minuten später diktierte die Typistin dem Privatsekretär der Queen über das Telefon den genauen Wortlaut in die Maschine. Die Katastrophe war abgewendet.
Dass das Original kurzzeitig verloren gegangen war, konnte man für einen Unglücksfall halten. Aber gleich auch alle Kopien und Durchschläge? Wirklich?
Und jetzt kam zu der Rede und den Austern auch noch der hasserfüllte Blick in die sich um sie drängende Menge im Louvre hinzu, der alles in einem neuen Licht erscheinen ließ. Da hatte jemand ganz eindeutig etwas dagegen, dass dieser Besuch ein Erfolg wurde. Jemand aus ihrem eigenen Umfeld. Jemand, dem sie bis heute Abend vertraut hatte.
Der Queen war bewusst, dass sich ihr Verdacht, der sich allein auf verschwundene Durchschläge, nicht vorgesehene Schalentiere und eine verdrießliche Miene stützte, leicht als hyperaktive Fantasie einer jungen Mutter abtun ließ, die nach zwei anstrengenden Tagen im Ausland erschöpft und emotional aufgewühlt war und einen ungesunden Komplex entwickelt hatte. Das Risiko, in diesen Verdacht zu geraten, durfte sie nicht eingehen, war der Besuch doch so wichtig.
Und überhaupt, was konnten sie oder Philip in diesem Augenblick schon tun? Der Wagen bog nach rechts in die Rue du Faubourg Saint-Honoré ab, und sie behielt ihre Gedanken für sich.
Kapitel 2
Gut gemacht, Majestät«, erklärte ihr Privatsekretär ihr am nächsten Morgen ein wenig gönnerhaft. »Ich denke, wir können den gestrigen Abend als einen weiteren Erfolg verbuchen.«
»Ich danke Ihnen, Hugh. Es war ein ziemliches Gedränge. Zwischendurch habe ich mich gefragt, ob sie mich mit Haut und Haar verschlingen wollten.«
Sir Hugh Masson lächelte, als wäre ihre Bemerkung nicht mehr als ein Scherz. Er hatte solch eine Welle der Zuwendung und Aufmerksamkeit selbst noch nicht erlebt.
Es war noch früh, und ihre drei leitenden, nadelgestreiften Höflinge standen ihr in der Residenz des Botschafters in einer ordentlichen Reihe gegenüber, bereit, die Ereignisse des Tages zu besprechen. Sir Hugh hatte Major Miles Urquhart an seiner Seite, den Stellvertretenden Privatsekretär (oder kurz auch den StPS), sowie Jeremy Radnor-Milne, ihren Pressesekretär. Solide, traditionell eingestellt und verlässlich, standen die drei an vorderster Front der »Schnauzbartträger«, wie Philip sie nannte – womit er die gesamte alte Garde meinte, die der Queen von ihrem Vater vererbt worden war.
Sir Hugh Massons kräftige graue Barthaare fanden ein Gegengewicht in seiner großen schwarz gerahmten Brille, die seine Tendenz zum Gespreizten unterstrich. »Der Premierminister wollte, dass ich Sie wissen lasse, wie erfreut er über den Verlauf Ihres Staatsbesuches ist, Ma’am. Ihre Abendkleider sind ein ganz besonderer Erfolg. Auch die Stickerei wurde sehr bewundert.«
»Mr Hartnell hat sich mit der französischen Blumenwiese große Mühe gegeben.«
»Es ist gut zu sehen, dass das britische Design mit dem französischen Schritt halten kann«, fügte Miles Urquhart, der StPS, freudig hinzu. »Ja, in den Schatten stellt, könnte man sagen.« Sein rostbrauner Schnauzer bebte geradezu vor Wonne und Nationalstolz. Urquhart war absolut überzeugt, dass die britische Monarchie die beste Institution der Welt und die Antwort auf so gut wie jedes Problem war, selbst wenn es um Mode ging. Die Queen empfand es als eine ziemliche Herausforderung, derart hohen Erwartungen zu entsprechen.
»Oh, ich würde vielleicht nicht sagen, dass wir sogar Dior und Balmain übertreffen«, wandte sie ein, »doch ich freue mich, dass wir unseren Platz behaupten können.«
»Man beginnt zu verstehen, warum die Sie als Staatsoberhaupt wollten.«
Sie schüttelte den Kopf. »Das war schon seltsam, oder?«
Es war immer noch erstaunlich, und nicht unbedingt hilfreich dabei, mit Urquharts Erwartungen umzugehen, doch wie nur der britische Premierminister und der engste Kreis um ihn wussten, hatte der französische Premierminister bei einem Besuch im letzten Jahr tatsächlich den Gedanken einer französisch-britischen Union ins Spiel gebracht, mit ihr als Repräsentationsfigur. Es hatte sie alle verblüfft.
»Nach dem, was sie durchgemacht haben, um die eigene Krone loszuwerden«, sagte sie. »Mr Eden hatte recht, Nein zu sagen. Wie auch immer, ich habe den Eindruck, es war allein Monsieur Mollets Plan. Keiner hat seitdem mehr ein Wort darüber verloren.«
Jeremy Radnor-Milne lachte ein wenig zu laut. »Haha! Gut, dass Sie da raus sind, Ma’am. Frankreich hat sich in letzter Zeit nicht mit Ruhm bekleckert. Die Leute hier kommen mir ziemlich verzweifelt vor, wenn man das so sagen darf.«
Der Pressesekretär trug nur einen schmalen schwarzen Fusselstreifen auf der Oberlippe, ganz wie David Niven, wohl um sich an dessen militärische Heldentaten und Weltgewandtheit anzuhängen. Jeremy Radnor-Milne war wie Urquhart ein klarer Patriot und spielte auf Frankreichs unglückseligen Versuch im letzten Jahr an, durch eine Entsendung von Truppen die Kontrolle über den ägyptischen Suezkanal zu erhalten. Allerdings hatte es das Vereinigte Königreich genauso gemacht und war am Ende ähnlich katastrophal gescheitert.
Vorbei waren die Zeiten der Kanonenboot-Diplomatie, als die alten imperialen Mächte Probleme im Ausland mit Truppen und ein wenig Muskelspiel lösen konnten. Heute brauchte man die Amerikaner mit an Bord, und da Mr Eisenhower in Washington äußerst klargemacht hatte, dass er sich an dem Fall nicht beteiligen wollte, waren Franzosen und Briten gezwungen gewesen, sich schmachvoll zurückzuziehen. Mr Eden hatte deswegen sein Amt verloren.
»Das große Thema hier ist eine Freundschaft mit den Hunnen«, sagte Urquhart kopfschüttelnd. »Dieser neue römische Vertrag, die ›Wirtschaftsgemeinschaft‹ oder wie immer sie die Geschichte nennen, man sollte nicht glauben, dass sich Frankreich und Deutschland ein gutes Jahrhundert lang an die Kehle gegangen sind.«
»Ich nehme an, dass sie genau das in Zukunft vermeiden wollen«, sagte die Queen. »Aber ich bin nicht so sicher, ob wirklich alle hinter dem Vertrag stehen.« Sie richtete sich an ihren Privatsekretär: »Das wollte ich Ihnen noch sagen, Hugh, der Comte de Longchamp ist ganz und gar nicht dafür. Sie wissen, was er im Krieg durchgemacht hat und was die Nazis ihm angetan haben. Und soweit ich weiß, genießt er das Vertrauen des Präsidenten.«
»Woher wissen Sie das, Ma’am? Wer hat Ihnen das gesagt?«
»Man konnte es ihm gestern Abend vom Gesicht ablesen«, sagte die Queen. Seines war das erste der beiden Gesichter gewesen, die ihr im Louvre aufgefallen waren. »Eine Miene voller Hass, die sich auf den deutschen Botschafter hinter mir richtete. Ich weiß, dass es der deutsche Botschafter war, weil er einen furchtbaren Mundgeruch hat. Das sollte ihm mal jemand sagen, es ist nicht ideal für einen Diplomaten.«
»Ich werde das weitergeben«, versprach Sir Hugh.
»Nicht das mit dem Mundgeruch.«
»Oh, auch das, Ma’am. Das Außenministerium wird entzückt sein. Danke.«
Sie gingen ihren Tagesplan durch, der von jetzt bis Mitternacht im Fünf-Minuten-Takt beschrieb, wo sie sein und wen sie treffen würde, von den Arbeitern in einem Renault-Werk bis zum Bürgermeister von Paris. Sie sah, dass es zwei Ruhepausen gab, ebenfalls von jeweils fünf Minuten, und nahm sich vor, ihre Flüssigkeitsaufnahme entsprechend zu begrenzen.
Schließlich erwähnte sie die Austern.
Die buschigen Brauen zweier Herren zogen sich entsetzt zusammen, während Jeremy Radnor-Milne verwirrt die Lippen unter seinem schmalen schwarzen Schnäuzer aufeinanderpresste.
»Schalentiere«, erklärte Sir Hugh in gedämpftem Ton, bevor er sich wieder an die Queen wandte. »Haben Sie welche gegessen, Ma’am?«
»Nein. Ich war schrecklich unhöflich. Nur etwas von der Sauce Mignonette.«
Radnor-Milnes Mund war aufgeklappt wie bei einem nach Luft schnappenden Fisch. »Ich … Ich … Ich verstehe nicht, warum um alles in der Welt …«
»Irgendeinem Koch müssen da beim Menü die Pferde durchgegangen sein«, fuhr Urquhart entrüstet auf. »Ich gehe dem nach.«
»Bitte, machen Sie sich nicht die Mühe«, sagte die Queen. »Dafür ist es zu spät.«
Sie hatte die drei genau beobachtet. Die Schnauzbartträger schienen alle ähnlich fassungslos, genau wie vor zwei Tagen, als die Rede verloren gegangen war. Ihr Vater hatte die Dienste dieser Männer geschätzt, und sie verließ sich ganz auf sie, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Aber einer von ihnen, das wusste sie, musste sie belügen. Und was war mit den anderen beiden?
Kapitel 3
Bobo Macdonald – Margaret oder Miss Macdonald für alle bis auf die direkte königliche Familie – verfügte selbst auch über ein paar Barthaare, gehörte aber ganz und gar nicht zu den schnauzbärtigen Männern. Sie war die Garderobiere der Queen und mehr: ihre frühere Kinderfrau, ihre Vertraute, die einzige Person außer ihrer Schwester, die sich je das Schlafzimmer mit der jungen Prinzessin geteilt hatte, und heute war sie die Einzige, die das Vertrauen der Queen besaß, was die Sorge um ihre Kleider betraf. Es gab kein Reiseziel, zu dem Bobo die Monarchin nicht begleitete. Sie war sogar mit in die Flitterwochen des königlichen Paares gekommen.
Auch als sich die Queen auf ihren letzten Abend in Frankreich vorbereitete, tat Bobo ihren Dienst.
»Was denken Sie?«
Die Queen betrachtete sich nervös im Standspiegel ihres Ankleidezimmers in der Residenz des Botschafters. Ihr drittes Abendkleid des Besuches war etwas Neues, und es war das erste Mal überhaupt, dass sie etwas Anliegendes, Körperbetontes trug, im Gegensatz zu den weiten Röcken, wie sie auch für ihre Mutter typisch gewesen waren.
Die Seide glitzerte im Lampenlicht, reich bestickt mit Kristallen. Es war eine wirklich schöne Kreation, aber war es zu viel? Oder nicht genug? Der Designer, Hardy Amies, hatte auch die pfauenblaue Robe geschaffen, die sie am gestrigen Abend getragen hatte. Als er ihr die Skizze zeigte, war sie wegen der Farbe nicht sicher gewesen. Er hatte gemeint, sie passe, weil »Sie eine femme de trente ans sind, Ma’am«. Es war wohl das Unfreundlichste, was er je zu ihr gesagt hatte, und das hatte sie ihm gesagt.
Vielleicht, um es wiedergutzumachen, steckte Mr Amies sie nun in diese schimmernde Silberhaut, die in etwa das war, was Marilyn Monroe sich aussuchen mochte. Würde die femme de trente ans damit durchkommen?
»Sie sehen großartig aus. Das ist Ihr schönstes Kleid überhaupt. Oh, das wissen Sie doch, Lilibet. Sehen Sie sich nur an!«
Wenigstens Bobo war überzeugt davon. Die Queen drehte sich, um ihre Silhouette aus verschiedenen Winkeln zu betrachten, und vermisste das beruhigende Rascheln der Unterröcke. Im letzten November, als sie Miss Monroe bei einer Filmpremiere getroffen hatte, trug die Schauspielerin ein eng anliegendes goldenes Kleid, das auch ein Badeanzug hätte sein können. Die Queen selbst hatte einen Reifrock aus schwarzem Samt angehabt, schmal um die Taille, doch sonst überall weit, und war dankbar dafür gewesen, welches Selbstvertrauen ihr das gab. Die arme Marilyn hatte bereits ihren ganzen Lippenstift weggekaut, als sie sich schließlich die Hände gaben.
Aber sie war eine so nette Gesprächspartnerin gewesen. Sie logierte zu der Zeit in der Nähe von Windsor, und sie versicherten einander, wie schön es doch wäre, sich auch da einmal zu treffen, wobei keine der beiden die Zeit dazu hatte. Die Queen hatte den Eindruck, einer mutigen, aber doch auch zerbrechlichen Person gegenüberzustehen, einem jungen Rennpferd oder auch einem Reh gleich. Sie hätte ihr gern einen Pelz geliehen und sie darin eingewickelt.
Wie auch immer, jetzt war sie diejenige in einem engen Kleid, und sie wollte eine zweite Meinung. »Bobo, könnten Sie den Duke für mich rufen?«
Für alle bis auf die Queen war Prinz Philip der »Duke of Edinburgh« oder einfach »Sir«. Er hatte selbst keine Bobo, die ihn mit seinem Spitznamen anredete und wie einen vertrauensvollen Freund behandelte. Ganz sicher nicht, seit er kürzlich seinen Privatsekretär durch einen Scheidungsskandal verloren hatte und ihn schmerzlich vermisste. Wenigstens hatte er sie.
Bobo sprach mit dem Pagen vor der Tür, der Philip die Nachricht in sein Ankleidezimmer brachte. Die Antwort war, dass er ein paar Minuten brauchen würde, was der Queen die Zeit gab, ihren Lippenstift nachzuziehen und den Schmuck anzulegen, den Bobo ihr herausgelegt hatte. Während sie an ihrem Frisiertisch mit den Ohrringen beschäftigt war, versuchte Bobo, ihre ungewöhnlich nervöse Dienstherrin zu beruhigen.
»Haben Sie die Schlagzeilen gesehen? Die Franzosen nennen sich Monarchisten! Zu Hause bei uns sind allein Sie und die Chelsea-Morde auf den Titelseiten.«
»Die Chelsea-Morde?«, fragte die Queen und drehte sich mit dem linken Ohrring in der Hand um. »Was für Morde?«
»Oh, es ist schrecklich. In einem der Mews, die kleinen Hinterhäuser bei der Old Brompton Road, sind zwei Leichen gefunden worden. Die Times und der Daily Express sind voll davon.«
»Woher wissen Sie das?«
»Der Botschafter bekommt die Zeitungen per Luftpost aus London. Die Haushälterin hat sie mir gezeigt.«
»Stand da, wer die Toten waren?«
»Noch nicht, meine Liebe. Nur, dass es ein Mann und eine Frau sind, und sie war wohl eine etwas zweifelhafte Person. Schrecklicherweise scheint es so gut wie sicher zu sein, dass der Dean of Bath der Täter ist, oder einer seiner Gäste.« Bobo schüttelte den Kopf. »Es ist sein Haus, in dem es passiert ist, er hat es für seine Besuche in London gemietet. Auf dem Foto sieht er so sanftmütig aus, obwohl sie sagen, dass er gut durch den Krieg gekommen ist – da kann er so sanftmütig nicht sein.«
»War es definitiv Mord?« Die Queen kannte den Dean ein wenig. Er war ein aufrechtes Mitglied der Church of England und gelegentlich ein charmanter Dinner-Gast in Windsor.
»O ja, meine Liebe. Es war eine äußerst gewalttätige Geschichte. Und etwas anrüchig.« Bobo schob die Lippen vor, und in ihren Augen schimmerte es. »Die Frau trug nichts bis auf etwas Satinwäsche und Diamanten. Lag auf dem Bett wie Schneewittchen, schreiben die Zeitungen, aber das haben sie wahrscheinlich dazuerfunden, oder? Ich glaube, ich habe Schneewittchen noch nie in Unterwäsche gesehen.«
»Wen sehen wir in seiner Unterwäsche?«, fragte Philip, der ins Zimmer kam, damit beschäftigt, einen Manschettenknopf in eine widerspenstige Manschette zu bekommen.
»Wir reden von der toten Frau in Chelsea, Sir«, erklärte Bobo.
»Oh?« Er sah nicht auf. Der Manschettenknopf war aus Gold, wurde von einer feinen Kette zusammengehalten und war etwas knifflig zu benutzen. »Wie ist sie gestorben?«
»Laut Zeitung sind sie und ihr Partner erwürgt worden, und ihm wurde zusätzlich noch ins Auge gestochen. Ist es nicht ungeheuerlich, wozu die Menschen fähig sind? Es ist unfassbar.«
»Oh, manchen Leuten traue ich alles zu«, sagte Philip. Er blickte von seinem Hemdsärmel auf. »Du wolltest mich etwas fragen, Lilibet?«
Die Queen hatte mittlerweile die Ohrringe angelegt. Sie schob sich ihre Tiara ins Haar und stand ohne ein Wort auf, weil sie nicht ganz sicher war, wie sie ihre Frage formulieren sollte.
Er musterte sie von Kopf bis Fuß.
»Neues Kleid?«
»Ja.«
»Habe dich in dem Stil noch nicht gesehen.«
»Nein.«
»Es ist anders. Sehr … glitzernd.«
»Oh.«
Es gab ein kurzes Schweigen.
»Ist sie nicht bildschön?«, fragte Bobo mit einem leichten schottischen Tadel in der Stimme.
Da endlich reagierte Philip.
»Du siehst hinreißend aus, mein Schatz.« Er grinste verwegen und trat zu ihr. »Wenn Ava Gardner ein paar Zentimeter kleiner wäre …«
Er nahm die Hände seiner Frau und küsste ihre Handflächen, eine nach der anderen, und sie wurde wieder daran erinnert, wie unwiderstehlich er war. Hoffnungslos war sie ihm verfallen. Nicht nur wegen seines wikingerblonden Aussehens, sondern auch, weil er sie Tränen lachen ließ und im nächsten Moment wieder ganz ernst war, wie jetzt, sich bewusst, wie wichtig dieser Besuch war, wie viel von ihr verlangt wurde und wie sehr sie ihn brauchte.
»Gut, damit wäre das beschlossen«, sagte Bobo. »Ihre Tiara sitzt ein bisschen schief, meine Liebe. Und vergessen wir die Halskette nicht. Ich gehe und hole den Pelz.«
Oben an der Treppe vor ihrem Zimmer hatte sich eine kleine Gruppe versammelt. Sie bestand aus dem Botschafter, den zwei militärischen Stallmeistern, die dem Königspaar bei seinen öffentlichen Pflichten zur Seite standen, Sir Hugh und Philips eigenem neuen Privatsekretär. Man war bereit, sie nach unten zu begleiten, und unterhielt sich mit gedämpften Stimmen, aber die Worte »Cresswell Place« waren deutlich herauszuhören.
»Um was geht es?«, fragte Philip. »Wovon reden Sie?«
»Die Morde in Chelsea«, erklärte der Botschafter. »Haben Sie nicht davon gehört?«
»Oh, doch. Erwürgt und ein Auge ausgestochen«, sagte Philip und tat immer noch mit seinem Manschettenknopf herum. »Meinen Sie die?«
»Ja, genau. Kaum die Vorgehensweise, die man mit den Mitgliedern des Artemis Club verbinden würde.«
»Was?« Philips Kopf fuhr hoch.
»Nun, offenbar hat der Dean an dem Abend dort gegessen und anschließend eine kleine Gruppe zum Kartenspiel mit zu sich genommen. Niemand sonst ist hinein oder hinaus, abgesehen von den Opfern, also …« Der Botschafter verstummte und hustete. »Mir ist durchaus bewusst, dass auch Sie im Artemis Club sind, Sir.«
Philips Miene verhärtete sich. »So ist es.«
Der Botschafter lachte nervös. »Ich will damit nicht sagen … Nein, die Leute, die an dem Abend mit beim Dean waren, waren alle ohne Tadel. Anständige Männer, makellos, was ihren Ruf angeht. Einen von ihnen haben Sie erst letztes Jahr zum Ritter geschlagen, Ma’am.« Er nickte zur Queen hin. Niemand hatte bisher etwas zu ihrem Kleid gesagt, doch es waren Männer, also würden sie es auch nicht tun. »Offenbar haben sie den Dean für eine kurze Partie Canasta nach Hause begleitet.«
Sir Hugh ging mit einem leichten Räuspern dazwischen. »So heißt es. Das Missliche ist, folgt man der Presse, dass der Dean der Putzfrau am nächsten Tag gesagt hat, sie solle oben nicht sauber machen, wie sie es normalerweise getan hätte. Dann ist er zurück nach Somerset, und sie hat die Leichen erst gefunden, als sie eine Woche später nach oben kam.«
»Du meine Güte. Wann ist es passiert?«, fragte die Queen.
»Ich denke, am Sonntag vor einer Woche«, sagte Sir Hugh, der das Geschehen schnell im Kopf überschlug. »Am Einunddreißigsten, dem Abend des Kartenspiels. Sie werden die ganze Woche dort gelegen haben …«
»Verdammt!« Alle Augen wandten sich Philip zu. »Ich habe meinen Manschettenknopf zerlegt. Sie!« Er hielt den Knopf dem jungen Stallmeister hin, der ihm am nächsten stand. »Laufen Sie zu meinem Kammerdiener und holen Sie einen Ersatz. Schnell, sonst kommen wir zu spät.«
Er blickte zur Queen, und sie konnte sehen, wie verärgert er war. Es schienen die Britannia-Manschettenknöpfe zu sein, die er persönlich als Erinnerung an seine jüngste Reise auf die südliche Hälfte des Erdballs entworfen hatte.
»Wahrscheinlich heißt es schon bald, dass ich auch irgendwie damit zu tun habe«, knurrte er.
Sein neuer Privatsekretär hustete. »Das tut es bereits. Verzeihung, Sir, ich hatte noch nicht die Möglichkeit, Sie auf den neuesten Stand zu bringen. Ich habe den Artikel gerade erst gelesen. Darin heißt es, dass auch Sie an dem Abend im Club gegessen haben.«
Philip blickte ihn finster an. »Und steht da auch, dass ich um elf bereits friedlich im Bett lag?«
»Nein, leider nicht.«
»Leider nicht.« Philip zuckte theatralisch mit den Schultern und sah seine Frau an. »Und ich habe nur meine Leibwächter und Ihre Majestät als Zeugen.«
Fünf Augenpaare wandten sich fragend der Queen zu, die nach einer kürzestmöglichen Pause lächelte und auch selbst ganz leicht mit den Schultern zuckte. Sie erlaubten sich ein Glucksen.
»Niemand behauptet, dass Sie zur Gruppe des Deans gehört hätten, Sir«, versicherte ihm der Privatsekretär. »Nur, dass Sie mit ihm im Club waren.«
»War ich verdammt noch mal nicht. Wer ist dieser verwünschte Dean überhaupt?«
»Der aus Bath«, sagte die Queen.
»Oh, ja, den kennen wir, flüchtig. Anständiger Kerl. Hat in der St-George’s-Kapelle gearbeitet. Aber kaum ein Freund.«
»Die Manschettenknöpfe, Sir.«
Der Stallmeister war zurück, das Gesicht gerötet. Die Sporen klirrten an den Stiefeln seiner Uniform, in der ausgestreckten Hand hielt er den erbetenen Ersatz.
»Gehen wir«, sagte Philip. »Die Dinger kann ich im Auto anlegen. Und nehmt die Zeitungen mit. Die lege ich mir zum Lesen auf den Schoß. Das merkt keiner. Wird Zeit, uns wieder anstarren zu lassen.«
Der letzte Programmpunkt des Tages war eine Bootsfahrt auf der Seine, worauf sich die Queen sehr gefreut hatte. Was konnte romantischer sein als eine Frühlingsfahrt unter den Pariser Brücken hindurch, begleitet von ihrem Mann, mit dem Eiffelturm im Rücken und vor sich die erleuchteten Türme von Notre Dame?
Was sie nicht mit einberechnet hatte – und vielleicht hätte sie es tun sollen, stand es doch schwarz auf weiß auf ihrem Tagesplan –, war, dass der französische Präsident neben ihr sitzen würde. Schließlich fuhren sie mit seinem Schiff. Allerdings waren sowohl er als auch Philip eine gute Armeslänge von ihr entfernt, zu weit für eine ruhige Plauderei, und ganz sicher auch zu weit weg von Philip, der ihr somit nicht mitteilen konnte, was er tatsächlich von all den Tafeln hielt, die man extra für sie entlang des Ufers aufgestellt hatte.
Überhaupt war es schwierig, irgendetwas zu erkennen, weil ein Scheinwerfer aus nächster Nähe auf sie gerichtet war. Sie konnte nur sehen, dass mehr Menschen denn je die Ufer säumten, alle reckten die Hälse und drängten sich so eng aneinander, dass man Angst haben musste, sie könnten zu weit vor geraten und in den Fluss fallen. Einen noch unromantischeren Abend in Paris zu verbringen wäre nur mit einigem Aufwand möglich gewesen.
Das neue Kleid glitzerte jedoch gehorsam im Licht, und ihre Wangen wurden ganz taub vom unablässigen Lächeln. Philip grinste zu einer erleuchteten Tafel mit napoleonischen Soldaten bei Les Invalides hinüber, er schien sich bestens zu unterhalten. Das tat er auf dem Wasser immer.
Während sie so dahinglitten, dachte die Queen über das nach, was Bobo über den Artemis Club und den Abend gesagt hatte, an dem die Morde begangen worden waren. Sie stellte sich die arme Frau vor, die man erwürgt hatte, in einem Zimmer mit einem Mann, den sie kaum kannte, nur mit Seide und Diamanten angetan. Was einen innehalten ließ, wenn man selbst gerade Seide und eine reiche Auswahl an Diamanten trug.
Was für eine scheußliche Art zu sterben. Die Ärmste musste sich schrecklich allein gefühlt haben.
Der Queen wurde bewusst, dass sie nicht bei der Sache war, und sie wandte den Blick zu einem in hellem Licht stehenden Chor vor Notre Dame, dessen Gesang ätherisch zu ihnen herüberklang. Schon trieb das Schiff an der Île Saint Louis vorbei, und der Himmel wurde von einem plötzlichen Feuerwerk erhellt.
Und ihre anfängliche Überraschung wandelte sich zu reiner Freude. Sie stellte sich ein junges Paar in der Menge vor, er hatte die Arme von hinten um sie gelegt, sie spürte seine Brust warm und fest auf dem Rücken, beide reckten die Hälse zum Feuerwerk, und niemand beachtete sie.
Ja, das wäre schön.
Sie wandte den Kopf dem Präsidenten zu und rief auf Französisch etwas Angenehmes, Diplomatisches. Das Scheinwerferlicht immer noch auf ihrem Gesicht, fuhren sie schließlich zurück zu ihrem Ausgangspunkt.
Kapitel 4
Nur ein einfaches Mittagessen«, sagte Queen Mum. »Für uns drei. Ihr werdet erschöpft sein nach dieser Reise. Ihr müsst erst wieder zu Kräften kommen.«
Die Queen freute sich, nach den anstrengenden, mit Terminen vollgepackten fünf Tagen zurück in Windsor Castle zu sein. Sie hatte einen wunderschönen Abend mit den Kindern verbracht und auch am Morgen eine Stunde mit ihnen spielen können. Die Kleinen wollten unbedingt sehen, was für Geschenke sie mitgebracht hatte. Die waren jedoch alle zu zerbrechlich, um mit ihnen zu spielen, was bald vergessen war über der wilden Jagd und dem Gelächter mit ihrem Vater, der so glücklich war, wieder bei ihnen zu sein, wie sie.
Nach all der Aufregung war es schön, von den vertrauten Antiquitäten, Vorhängen und Bildern in der Residenz ihrer Mutter umgeben zu sein, dem Frogmore House auf dem Schlossgelände. Die Sonne schien durchs Fenster, und der Butler kam mit Champagner herein. Die Queen lehnte einen Schluck ab, sie hatte verschiedene Besprechungen vor sich, aber ihre Mutter und ihre Schwester nahmen beide ein Glas vom Tablett des Butlers.
»Was hat Philip am Nachmittag vor, weißt du das?«, fragte die ältere Queen Elizabeth.
»Er geht fliegen. Er will das schöne Wetter ausnutzen. Nach Southampton, nehme ich an.« Die Queen lächelte mutig, als sorgte sie sich nicht jede Minute, die Philip am Himmel war, um ihren Mann. Es war nicht so sehr das Fliegen wie das Landen. Ein kriegserfahrener Spitfire-Pilot hatte ihr einmal erklärt, jede Landung sei letztlich ein kontrollierter Absturz. Ein, zwei Mal war es schon knapp gewesen, was Philip fürchterlich witzig fand. Sie nicht.
»Der Glückliche«, sagte die Mutter der Queen mit einem forcierten Lächeln. Sie wusste genau, was ihre Tochter empfand, wollte sich aber lieber nicht einmischen. »Ihr zwei wart so wunderbar in Paris. Haben die sich nicht wahnsinnig gefreut, euch wieder dazuhaben?«
»Hmm«, sagte die Queen mit einem scheuen Lächeln. »Mitunter ein wenig zu sehr.« Sie erzählte Mutter und Schwester von dem Gedränge im Louvre.
»Gott, ins Museum«, stöhnte Margaret. »Sie hätten mit euch auf den Montmartre oder in eine Show gehen sollen. Ich habe gehört, das neue Crazy Horse ist ein tolles Spektakel.«
»Dahin hätten sie mich wohl kaum geschleppt!«, konterte die Queen. »Und das letzte Mal waren wir immerhin bei Edith Piaf.«
»Edith Piaf!« Margaret machte ein Gesicht, als hätte sie in eine Zitrone gebissen. »Yves Montand, das ist der Mann der Stunde. Habt ihr Mr Dior getroffen?«
»Haben wir«, sagte die Queen. »Sehr kurz. Er sah nicht unbedingt gut aus, der Ärmste. Aber er war sehr schmeichelhaft in Bezug auf dich, Mummy. Er meinte, wann immer er an etwas wirklich Schönes denken möchte, erinnert er sich an die Kleider, die Mr Hartnell dir 38 geschneidert hat.«
Queen Mum strahlte vor Wonne. »Meine weiße Garderobe? Für die Paris-Reise? Was für ein Schatz von einem Mann. Eines war natürlich zur Trauer um deine Großmutter, doch auf Französisch trauert es sich so viel interessanter. Le deuil blanc, weiße Trauer. Wie bei Mary, unserer Schottenkönigin.«
»Aber mit Sonnenschirmen«, sagte Margaret. Sie wandte sich zurück an ihre Schwester. »Ich glaube, ein Dior-Kleid hast du auch getragen. Du läufst Gefahr, altmodisch zu wirken.«
Das Lächeln ihrer Mutter bekam etwas Aufgesetztes. Es war nicht immer einfach, eine jüngere Tochter im Haus zu haben, vor allem nicht, wenn die sich gerade von der berühmtesten Liebestragödie des Jahrzehnts erholte und ihre ältere Schwester glücklich verheiratet und Herrscherin über Länder rund um den Globus war.
»Das Essen ist serviert, Ma’am«, verkündete der Butler zu ihrer großen Erleichterung.
Sie gingen hinüber ins Esszimmer, wo der Tisch gedeckt war und die Hausdiener bereitstanden. Queen Mum wusste, ihre ältere Tochter mochte es einfach, und so hatte sie um eine Consommé gebeten, etwas Lachs in Blätterteig, ein wenig grünes Gemüse und Kartoffeln aus den Gärten von Sandringham sowie ein leichtes Zitronen-Posset, und dazu einen recht guten Pouilly-Fuissé aus ihrem persönlichen Keller. Beim Nachtisch kam das Gespräch auf Clement Moreton, den armen Dean of Bath, dessen unanfechtbares Leben als Geistlicher im Moment von sämtlichen Zeitungen auseinandergenommen wurde.
»Der Mann tut mir so leid«, sagte die ältere Elizabeth. »Er ist entzückend. Ein sehr guter Kartenspieler, aber nicht auf die Art, ihr wisst schon. Einfach ein charmanter, empfindsamer Mensch. Und seine Predigten sind immer so kurz. Cissy ist außer sich. Alle sind das.«
Cissy, eine Cousine und Kindheitsfreundin des Dean, war eine der Hofdamen von Queen Mum. Sie wusste mit Hunden umzugehen und war sehr beliebt. Die Queen zeigte sich mitleidig und fragte, ob der Dean mit Philip befreundet sei, was sie, wie ihre Mutter dachte, eigentlich selbst am besten wissen müsse.
»Vielleicht haben sie sich im Krieg kennengelernt«, meinte die ältere Elizabeth, »aber Philip war auf See und Clement bei der Royal Artillery, also bezweifle ich es. Clement hat sich sehr ausgezeichnet, weißt du. Es ist so gut wie ausgeschlossen, dass er etwas damit zu tun hat, und nicht nur, weil Cissy es sagt. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie er ein Glas auf ein Stück Papier gestülpt hat, um eine Spinne nach draußen zu tragen. Zwar wird er in Deutschland Schreckliches gesehen haben, aber das war der Krieg, nicht wahr, und etwas ganz anderes. Und dann ist da die Frage des Flittchens mit der Tiara. Wie soll sie noch heißen?«
»Gina Fonteyn«, sagte Margaret gleich. »Wie Margot.«
»Wer?«
»Die Ballerina, Mummy.«
»Margot Fonteyn? Mein Gott, sind sie verwandt?«
»Nein! Margot heißt eigentlich Peggy Hookham, und Gott weiß, was der wirkliche Name dieser Frau war. In den Zeitungen steht, sie war Italienerin.«
»Wie auch immer, was ist mit ihr?«, fragte die Queen ihre Mutter.
»Es geht mir mehr um die Tiara«, sagte die ältere Elizabeth. »Clement hat Cissy gesagt, dass die Polizei ihm ein Foto der Diamanten gezeigt und gefragt hat, ob er wisse, woher sie stamme. Natürlich hatte er keine Ahnung, aber er sagt, die Tiara besteht aus Rosen und Gänseblümchen aus rosa und weißen Diamanten, mit blassgrünen Peridots für die Blätter. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Kombination, die mich sehr an die Zellendorf-Tiara von 24 erinnert. Von Cartier, sehr zart, für Lavender Hawksmoor-Zellendorf angefertigt. Sie sollte einem englischen Landgarten ähneln. So hübsch. Im letzten Jahr wurde sie verauktioniert, und ich wollte sie schon für dich kaufen, Margaret, aber sie war natürlich viel zu teuer.« Sie seufzte. »Man muss sorgsam mit seinen Ausgaben umgehen.«
Margaret wirkte enttäuscht. »Margaret Rose«, sagte sie und betonte dabei ihren zweiten Vornamen.
»Nun, genau.«
»Wer hat sie stattdessen bekommen, Mummy?«
»Ich weiß es nicht, das ist es ja. Nicht, dass ich mich nicht erkundigt hätte, aber alle reagierten sehr schmallippig. Irgendein ausländischer Kerl, nehme ich an. Die haben heutzutage das ganze Geld. Wahrscheinlich ein Amerikaner, der Aga Khan oder der Schah. Auf jeden Fall ist sie verschwunden. Was schade ist, es ist so ein hübsches Stück.«
Sie hielt inne, da sie spürte, dass ihre jüngere Tochter den Diamanten wehmütig und etwas ungehalten nachtrauerte. Die ältere sah sie leicht kritisch an. Sie hob abwehrend die Hände.
»Seht ihr, man kennt diese junge Frau nicht, aber man kennt die wertvollen Tiaras. Was ich sagen wollte: Wenn es die Zellendorf-Tiara ist, wie um alles in der Welt ist dieses Flittchen dann daran gekommen?«
Nach dem Essen schlug die Queen einen Spaziergang vor, aber Margaret steckte sich eine Zigarette in ihre lange Zigarettenspitze, und einer der Hausdiener gab ihr Feuer.
»Hmm.« Sie blickte nachdenklich in den Rauch. »Cresswell Place. Da geht einiges vor. Ich denke, es ist genau der Ort, an dem man eine Leiche und gestohlene Diamanten findet.«
Die Queen drehte sich zu ihr hin. »Oh?«
»Absolut. Ich war ein paarmal dort. Es gibt da einen Künstler, der diese fabelhaften kleinen Partys veranstaltet. In einem winzigen Hinterhaus, es ist eigentlich mehr eine Puppenstube. Es passen kaum alle hinein. Sie spielen Saxofon und tanzen auf der Treppe, es ist schrecklich komisch, und man weiß nie, ob man mit einem Aktienhändler, einer Halbweltdame oder einem Spion spricht. Oder mit mir.« Sie hob eine Braue. »Ich verstehe, warum es dem Dean dort gefallen hat.«
Ihre Mutter war schockiert.
»Ich bezweifle sehr, dass er die Straße deswegen ausgesucht hat. Cissy sagt, Clement fühle sich über alle Maßen gedemütigt. Und so verunsichert. Sich vorzustellen, dass so etwas unter seinem Dach passiert ist! Und was, wenn er dort gewesen wäre, als der Mörder hereinkam?«
»Ich glaube nicht, dass man den Dekan einer der großen englischen Kathedralen mit einem Juwelendieb und seiner Geliebten verwechseln kann«, sagte Margaret und stieß eine weitere Rauchwolke aus. Sie sah zu ihrer Mutter. »Und ich habe immer noch keine eigene Tiara.«
Die Queen sagte dazu nichts, fühlte sich jedoch leicht enerviert. Der Punkt war ganz eindeutig nicht die Tiara. Vielleicht ritt Margaret darauf herum, weil sie tatsächlich keine eigene hatte, während die Queen nicht zu sagen wusste, auf wie viele genau sie zurückgreifen konnte. Was sie nachsichtiger ihrer Schwester gegenüber machte. Und an einem guten Tag war Margaret schließlich das Inbild von Großzügigkeit.
»… du selbst.«
»Wie?« Margaret hatte etwas gesagt, das sie überhört hatte.
»Ich sagte, du fährst sowieso bald hin, also kannst du dir das Ganze selbst ansehen.«
»Ach, ja?«
»Mummy sagt, ihr besucht Deborah Fairdale in den Boltons. Cresswell Place ist gleich nebenan.«
»Oh! Ja, das tun wir. Am Freitag, auf ein paar Drinks.«
»Nun, dann seht euch mal um. Da steht ihr praktisch auf der Schwelle des Mörders.«
Margaret sagte das fast schon genussvoll. Die Queen freute sich sehr darauf, ihre Freundin wiederzusehen, doch dieser neue Aspekt war eher ein kleiner Schock. Und natürlich auch eine Gelegenheit.
Kapitel 5
Was Fred Darbishire wirklich wissen wollte, war, warum man ihm den Fall überhaupt übertragen hatte. Es war eine große Sache, und eigentlich hätte er an Chief Inspector George Venables gehen müssen, der sich regelmäßig die wichtigen Fälle in Chelsea und Kensington unter den Nagel riss. Venables stand kurz davor, in einem einmalig jungen Alter zum Detective Superintendent befördert zu werden, und alle drehten sich wie kleine Planeten um ihn. Ein Doppelmord direkt vor seiner Tür? Ein bekannter Geistlicher, der verdächtigt wurde? Die Erwähnung des Duke of Edinburgh und der Fall auf allen Titelseiten, neben den Berichten über das Königspaar in Paris? Da gab für Venables normalerweise keine Zweifel.
Aber offenbar war der Liebling des Criminal Investigation Department »indisponiert«. Oder er hatte einen Urlaub gebucht. Gerüchte gab es mehrere, und Darbishire glaubte keines davon. Nicht einmal sein eigenes Totenbett würde George Venables davon abhalten, sich zu nehmen, was er wirklich wollte. Aber jetzt war Darbishire, ein einfacher Detective Inspector, zusammen mit seinem so vertrauenswürdigen wie wenig brauchbaren Sergeant Woolgar für die Chose zuständig. Eigentlich sollte ihn das dankbar stimmen und nicht misstrauisch.
Er stand am Zugang zum Cresswell Place, einer gepflasterten Gasse mit nicht zusammenpassenden zweistöckigen Hinterhäusern, direkt bei der Old Brompton Road, hinter den Boltons. Warum diese kleinen Seitengassen »Mews« hießen, wusste er, weil sich sein Onkel Bill für die Herkunft von Wörtern interessierte: Das Wort mew bezog sich auf die Federn, die ein Raubvogel in der Mauser verlor, und die ersten Mews waren neben der heutigen National Gallery am Trafalgar Square entstanden, wo die Jagdfalken des Königs während der Mauser untergebracht worden waren. Für die Monarchie interessierte sich Onkel Bill nicht so sehr, und so konnte Darbishire nicht sagen, welcher König es gewesen war, nur dass es lange genug her war, dass er mit Falken gejagt hatte.
Die Mews waren irgendwann niedergebrannt und durch Ställe für die königlichen Pferde ersetzt worden, behielten aber ihren Namen. Danach entstanden weitere Mews, um die Pferde, die Kutschen und später die Autos und Bediensteten der großen Londoner Herrenhäuser unterzubringen. Nach dem Krieg jedoch konnte sich kaum mehr jemand eine Dienerschaft leisten, und viele der Mews-Häuser wurden in schicke kleine Zweitwohnungen für eine wohlhabende, noble Klientel umgewandelt. Von Falken zu Pferden, von Zimmermädchen zu Großkotzen. Onkel Bill rümpfte die Nase: Einmal ein Zuhause für Pferdescheiße, immer ein Zuhause für Pferdescheiße. Und mittlerweile, so schien es, waren sie sogar gut genug für den Dean of Bath und seinesgleichen. Und für Männer mit diamantenbehängten Edelnutten.
Das Haus Nummer 44, das der Dean of Bath gemietet hatte, war eine Art Reihenhäuschen in einem verblichenen Schweinchenrosa, das ursprünglich einmal zu einer der großen Villen der Boltons gehört hatte. Wie die meisten Nachbarhäuser besaß es noch eine eingebaute Garage. Laut Aussage des Dean war ebendiese Garage getrennt an einen Oldtimerbesitzer vermietet, was dieser bestätigt hatte. Eine Verbindungstür zwischen Garage und Haus gab es nicht mehr, und es gab auch keinen Hinweis darauf, dass die Garage an dem Abend benutzt worden war, womit ihr Mieter erst einmal aus dem Spiel war.
»Ich verstehe nicht, warum wir da noch mal reinmüssen. Wir haben doch die Fotos«, murmelte Detective Sergeant Woolgar.
Len Woolgar war einen Meter dreiundneunzig groß, ein absoluter Kleiderschrank und unglaublich faul für seine super Form. Setzt man ihn in ein Ruderboot auf einem Fluss, wird er zu einem Dämon, praktisch olympiatauglich, sagten sie im Yard, weshalb er zur Truppe gestoßen war. Die Rudermannschaft der Metropolitan Police war top. Aber an einen Ermittlungsfall gesetzt, der Engagement und Pflichtbewusstsein verlangte, wurde Woolgar zu einer Belastung. Und für gewöhnlich hatte er Hunger. Jetzt wahrscheinlich auch, obwohl er noch zwei Eiersandwiches gegessen hatte, bevor sie losgegangen waren. Ein drittes produzierte eine unansehnliche Ausbuchtung in der Tasche seines Mantels.
»Es ist etwas anderes, wenn man selbst im Raum steht und sich umsehen kann«, erklärte Darbishire ihm. »Vielleicht übersehen wir etwas.« Womit er meinte, dass er womöglich etwas übersah. Woolgar übersah garantiert alles.
Der Constable an der Tür zur Nummer 44 nickte ihnen respektvoll zu. »Guten Tag, Sir. Sergeant.«
»Irgendwelcher Ärger?«
»Nur ein paar Presseleute. Nichts, womit ich nicht zurechtkäme. Dahinten steht gerade einer und macht Fotos von Ihnen.«
»Soll er ruhig.«
Darbishire zog den Hausschlüssel aus der Tasche und öffnete die Tür. Woolgar folgte ihm.
»Passen Sie auf den …«
»Verdammt!«
Der Sergeant war mit dem Kopf gegen den niedrigen Türsturz gerammt. Man sollte denken, wenn einer über eins neunzig ist, lernt er irgendwann einmal, sich zu ducken.
Die Tür führte direkt in einen langen, schmalen Wohnraum mit einer Küchenecke am Ende. Der rechte Teil des Erdgeschosses wurde von der Garage eingenommen. Durch das kleine Fenster über der Keramikspüle sah man hinaus in einen winzigen Garten mit einer efeuüberwucherten Mauer. Woolgar füllte den bescheidenen Wohnbereich vorne fast völlig aus, wo der Dean mit seinen Begleitern Canasta gespielt hatte. Es gab zwei wacklige Kartentische und ein paar alte Mahagonimöbel, auf denen noch die Reste des Fingerabdruckpulvers zu sehen waren.
Neu war allein ein verchromter Getränkewagen, gut ausgestattet, der, wie Darbishire annahm, vom Mieter hergebracht worden war. Man würde einen der höheren Vertreter der Church of England nicht unbedingt für einen versierten Cocktail-Mixer halten, aber nachdem er den Mann kennengelernt hatte, dachte Darbishire, dass das durchaus möglich war.
Clement Moreton und seine drei Kollegen aus dem Artemis Club hatten am Einunddreißigsten das Angebot des Getränkewagens offenbar ausgiebig genutzt. Der Dean hatte ihnen einen selbst kreierten Cocktail mit Zitronensaft und Wodka kredenzt und behauptet, das sei der Grund für seinen Kopfschmerz am nächsten Morgen und auch dafür gewesen, dass er der Putzfrau gesagt habe, nicht länger als absolut notwendig zu bleiben und dieses Mal oben nicht zu putzen.
»Sie ist so laut. Sie poltert herum wie ein Sherman-Panzer, und ich mache ja keinen Schmutz, ich war nur über Nacht da und wollte am selben Tag noch zurück, da dachte ich, eine Woche macht keinen Unterschied, was das Beziehen des Betts angeht …«
Die Gäste an dem Abend waren ein Universitätsprofessor, der mit Clement Moreton seit dessen Tagen in Oxford befreundet war, ein allgemein respektierter Amtsrichter und ein Chorherr von Westminster Abbey gewesen. Die vier kannten sich, kamen aber nicht regelmäßig in der Konstellation zusammen, und nach ihren übereinstimmenden Aussagen hatte niemand die Runde für mehr als ein paar Minuten verlassen.
Zur Rechten Darbishires, an der Wand zur Garage hin, führte eine offene Treppe nach oben. Zwischen ihren Spielen waren Moreton und die anderen drei Männer jeweils einmal hinaufgegangen, um die Toilette zu benutzen. Unten gab es keine. Es war kein Platz dafür da.
Darbishire musste an die Bemerkung des Pathologen vor anderthalb Stunden denken.
»Es ist Ihr Job, und ich rede Ihnen da nicht rein, aber ich fresse einen Besen, wenn es eins der hochwohlgeborenen Clubmitglieder gewesen ist.«
Darbishires Besuch im Artemis Club gestern war eine Enttäuschung gewesen. Der Name war klangvoller als die Sache selbst, zumindest äußerlich. Es war kaum mehr als eine Tür in einer Straße beim Piccadilly, durch die es hoch in ein paar Räume zum Trinken und Spielen sowie ein separates Esszimmer ging. Er fragte sich, ob der Drones Club von Bertie Wooster auch ein bisschen so war. Aber der hatte einen Swimmingpool, also wohl eher nicht.
Wie auch immer, ob nun mit Pool oder ohne, zu den Mitgliedern gehörten der halbe Adel und fast das gesamte Kabinett. Darbishire wusste das eine oder andere darüber, wie es in diesen Kreisen zuging, und traute ihnen so ziemlich alles zu. Das Problem war nicht, woher der Dean und seine Gäste gekommen waren, sondern der Grundriss des Mews-Hauses hier, in das sie gewechselt waren. Es gab schlicht keine Möglichkeit, in der oberen Etage zwei Menschen so zu ermorden, wie sie ermordet worden waren, und dann über die offene Treppe nach unten zu kommen, ohne von den Anwesenden gesehen zu werden. Also steckten sie entweder alle unter einer Decke oder waren, zumindest die Gäste, unschuldig. Alle behaupteten, nichts von dem Paar oben gewusst zu haben, aber das mussten sie, oder?
Er stieg schweren Schrittes die Treppe hinauf. Er wusste, was ihn oben erwartete.
»Das Eine, was ich nicht kapiere, Sir«, sagte Woolgar auf dem Weg nach oben – Darbishire war gespannt, was jetzt kommen würde, denn es gab wenigstens ein Dutzend Dinge, die er nicht verstand, »das ist, Sie wissen schon, das Pärchen … Warum haben sie es, also … nicht miteinander gemacht?«
»Hm.«
Woolgars Schritte auf der Treppe waren noch lauter als seine. Das ganze Haus schien zu wackeln.
»Ich meine, sie war komplett zurechtgemacht. Und sie war eine Prostituierte, oder? Sie hatten das Haus für sich. Nach der Zeugenaussage kommt sie um Viertel vor elf her und er etwas später, sagen wir, um elf. Angenommen, die Zeugin ist verlässlich, dann haben sie gute vierzig, fünfundvierzig Minuten, bevor die Clubleute kommen … Aber sie … Sie wissen schon.«
Der Pathologe hatte gerade noch einmal seine anfängliche Annahme bestätigt, dass es zwischen den beiden zu keinerlei sexuellen Aktivitäten gekommen war, wie Darbishire seinem Sergeant berichtet hatte.
»Was darauf hinweist, dass sie von jemandem überrascht wurden, bevor sie die Möglichkeit dazu hatten«, murmelte er.
»Aber niemand sonst ist vorne hinein, bis der Dean und seine Kumpel kamen. Fünfundvierzig Minuten, Chef. Länger noch, wenn sie gewartet haben, während die anderen unten Karten spielten, und der Dean dann hochkam und sie aus welchem Grund auch immer umgebracht hat. Was haben sie die ganze Zeit gemacht?«
»Vielleicht haben sie auch Karten gespielt. Oder philosophische Gespräche geführt.«
»Glauben Sie wirklich …? Oh. Klar. ’tschuldigung, Sir.« Woolgar wusste nie wirklich zu sagen, wann er seinen Chef ernst zu nehmen hatte. »Was also …?«
»Ich weiß es nicht, Sergeant.«
Mittlerweile hatte Darbishire den Treppenabsatz oben erreicht. Zu seiner Linken lag Clement Moretons Schlafzimmer. Es war spartanisch eingerichtet und bis auf die grüne Glasvase, die man bereits mitgenommen hatte, um sie im Labor zu untersuchen, wenig interessant. Dahinter lag ein Bad, klein, modern und grellgelb gekachelt, die Tür zum Treppenabsatz hin. Die Spurensicherer hatten viel Zeit darin verbracht, weil der oder die Mörder es offensichtlich auch getan hatten und unglücklicherweise sehr gut darin gewesen waren, ihre Spuren zu verwischen.
Rechts lag die Tür zum größeren zweiten Schlafzimmer, das von der Front des Hauses bis ganz nach hinten reichte und über der Garage lag. Hier waren die Leichen gefunden worden. Moreton schwor Stein und Bein und mit allem, was einem Kirchenmann zur Verfügung stand, dass er nie in dem Zimmer gewesen war. Seiner Aussage nach hatte ihm die Vermietungsagentur erklärt, der Besitzer benutze das Zimmer als Lagerraum und deshalb bleibe es verschlossen. Moreton behauptete, einmal ohne Erfolg an der Klinke gerüttelt zu haben. Aber er brauchte den Raum nicht, und so hatte es ihn nicht weiter gestört. So war die Miete nicht so hoch. Die Putzfrau bestätigte die Aussage, obwohl die Tür dann, als sie eine Woche nach den Morden nach oben gekommen war, einen Spaltbreit auf gestanden hatte, worauf sie neugierig geworden sei.
Und doch war der Raum weder verstaubt noch sonstwie verschmutzt gewesen, als die Polizei kam. Aber wenn ihn die Putzfrau nicht sauber hielt, wer dann? Eine weitere Frage.
Die Schlafzimmertür stand offen, und Darbishire ging hinein. Der Raum wurde von einem großen Messingbett mit einer dicken Matratze ohne alles Bettzeug beherrscht. Es stand an der hinteren Wand, gegenüber von einem Erkerfenster, das hinaus auf die gepflasterte Gasse ging. Da war die blonde Frau gefunden worden, auf dem Rücken liegend, die Arme über der Brust verschränkt, mit einem Blumensträußchen, das man darunter geschoben hatte. Das männliche Opfer hatte eingerollt auf dem Boden gelegen, am Fuß des Betts, die Hose bis auf die Knie heruntergeschoben, in einer Blutlache, ein Messer im rechten Auge. Kein Wunder, dass die Schreie der Putzfrau bis halb die Straße hinunter zu hören gewesen waren.
Woolgar stand in der Tür und ließ die Fingerknöchel knacken.
»Was hat Deedar gesagt, Sir?«
Der Pathologe, bei dem Darbishire gewesen war, hieß Johnson, war aber allgemein als Deedar bekannt. Was offenbar mit den Sheffielder Klingen zu tun hatte, die er in seinem Beruf benutzte. Leute aus Sheffield waren als »Dee-Dars« bekannt, weil sie thee und thou statt you sagten. Johnson war in Aberdeen geboren und tat es nicht, und Darbishire hatte lange gebraucht, um den Zusammenhang zu begreifen. Wobei die meisten Kollegen offenbar annahmen, dass Johnsons Spitzname etwas mit den Polizeisirenen zu tun hatte. Aber der Inspector traute einfachen Antworten nicht. Er neigte dazu nachzufragen, bis er zu den komplizierteren vorstieß.
Darbishire wusste auch, dass Woolgar den Termin in der Pathologie heute nicht wegen eines zeitlichen Missverständnisses verpasst hatte, sondern weil ihm der Geruch von Formaldehyd den Magen umdrehte. Wenn in dem vierschrötigen Körper ein großer Ermittler schlummerte, hatte er noch einen ganz schönen Weg zurückzulegen, um herauszukommen.
»Es ist alles weitgehend so, wie wir dachten«, sagte Darbishire. »Sind Sie übrigens mit der anderen Frau weitergekommen? Der ursprünglichen Verabredung?«
Woolgar schüttelte den Kopf. »Sie ist verduftet, keine Überraschung. Beryl heißt sie.«
»Den Namen brauche ich nicht. Ich brauche die Frau.«
Beryl war die Glückliche, die das männliche Opfer eigentlich am Sonntag, dem einunddreißigsten, hätte treffen sollen – ebenfalls blond, wie bei der Escort-Agentur Raffles angefragt. Aber aus irgendeinem Grund war Gina, die Ermordete, in letzter Minute für Beryl eingesprungen.
Darbishire glaubte nicht an glückliche Zufälle. Noch eine Frage.
Ein modernes, mit rauchblauem Samt gepolstertes Schminktisch-Set stand unter dem Fenster, darauf ein dreiteiliger Spiegel und ein leerer Muranoglas-Aschenbecher. Das alles passte ganz und gar nicht zu den leicht angeschlagenen Antiquitäten unten: Dieses Zimmer diente speziellen Verabredungen und war entsprechend eingerichtet. In der hinteren Ecke stand ein Art-déco-Kleiderschrank, von der Größe her ein ideales Versteck für Männer mit Mordabsichten, die auf ihre Opfer warteten, nur dass er randvoll gepackt war mit gastronomiegroßen Kisten Dosenfleisch und einem kaputten Stuhl, der auf seine Reparatur wartete. Es wäre nicht mal genug Platz, um einen Fünfjährigen darin zu verstecken.
In seinen Vierzigern, mit dem zurückgekämmten Haar eines Mittelmeeranrainers oder Südamerikaners, war das männliche Opfer durch die Papiere in seinen Taschen als ein gewisser Dino Perez aus Argentinien identifiziert worden. Die Agentur Raffles hatte die Identitäten des Paares als Erste bestätigt, obwohl sie sich mit der Frau zunächst geirrt hatten. Sie sagten, Perez habe ihnen erklärt, er wohne im Dorchester, aber im Hotel wusste niemand etwas von ihm.
Darbishire ging hinüber auf die andere Seite des Betts. Er wollte sich die Szene vorstellen, so wie sich Deedar und seine Leute dachten, wie die Sache abgelaufen war. Er wollte sehen, ob es funktionierte.
»Laut den Forensikern muss Perez zwischen dem Bett und der Tür gestanden haben, als die Mörder hereinkamen, mit dem Rücken zu ihnen. Der Zustand seiner Hose lässt darauf schließen, dass er sich auf anderes konzentrierte. Er wurde mit einer schmalen, etwa fünfzehn Zentimeter langen Klinge in die Seite gestochen. Es war mit großer Sicherheit das Messer, das ihm nach seinem Tod ins Auge gerammt wurde. So wie das Messer beim Eindringen in seinen Leib verzogen wurde, hat er sich wahrscheinlich umgedreht und die Täter damit überrascht.«
Es musste eine schmerzhafte Wunde gewesen sein, aber nicht gleich tödlich. Es war kaum die wirksamste Weise, einen Mann umzubringen.
Woolgar stand stumm in der Tür, von wo aus die Angreifer mit gezücktem Messer gekommen sein mussten. Darbishire versuchte, sich auch das vorzustellen.
»Irgendwie kam Perez frei«, fuhr er fort und bewegte sich in Richtung Erkerfenster. »Es kam zum Kampf. Er schaffte es zum Fuß des Betts, wo es den Tätern gelang, ihm mit etwas auf den Hinterkopf zu schlagen. Ein Rechtshänder, denkt Deedar. Warum sie das nicht gleich gemacht haben, weiß ich nicht. Mit was der Schlag ausgeführt wurde, ist noch unklar. Perez ging zu Boden …«, Darbishire sah nach dem Blutfleck auf dem Teppich, »hier. Und da wurde er auch erwürgt. Mit Käsedraht oder was Ähnlichem, sagt Deedar. Der Strumpf, den er um den Hals hatte, war überflüssig. Der Draht war schon halb durch die Luftröhre.«
Woolgar nickte. »Doppelt gemoppelt, könnte man sagen.«
Könnte man, Darbishire tat es aber nicht. Es war seltsam, dass sie das gemacht hatten. Waren sie irgendwie zimperlich, die Gangster? Wollten sie die Wunde mit dem Strumpf verdecken? Oder wollten ihn beide in ihrer Wut umbringen? Angesichts des Klappmessers, das dann jemand schaurigerweise in seinem Auge geparkt hatte, war das durchaus denkbar. Es war ein schmales, böse aussehendes Ding. Italiener nannten so was ein Stiletto, aber es war in Deutschland hergestellt worden. Er hatte schon viele in der Art gesehen.
»Also waren sie definitiv zu zweit?«, fragte Woolgar und holte sein Notizbuch hervor.
»Wenn nicht, warum ging dann nicht die Frau dazwischen?«
»Vielleicht tat sie es ja.«
»Und warum hat sie dann nicht das ganze verdammte Haus zusammengeschrien? Niemand in der Straße hat auch nur einen Pieps gehört. Die Putzfrau eine Woche später, die haben alle gehört.«
Woolgar kratzte sich das Kinn. »Es waren also wenigstens zwei – einer, der auf ihn los ist, und einer, der sie ruhig gehalten hat?«
Darbishire hatte das von Beginn an angenommen, und Deedar hatte es bestätigt. »Daher die Blutergüsse auf ihren Armen und Beinen. Sie hat nicht geschrien, aber sich gewehrt. Sie wusste, was kam.«
»Sie könnte zuerst getötet worden sein.«
»Ist nicht unmöglich«, gab Darbishire zu. »Aber die Blutergüsse legen anderes nahe. Übrigens haben sie den fehlenden Strumpf bei ihr benutzt. Der Saum ist auf ihrem Hals noch erkennbar.«
Woolgar zuckte zusammen. Er kam nicht gut mit so was zurecht, wenn es eine Frau war. Er war eindeutig nicht für lange Morgen in der Leichenhalle gemacht.
»Sie wurde gewaschen, bevor sie so hingelegt wurde«, fügte Darbishire hinzu. »Seltsam, was? Nicht am ganzen Körper, aber das Blut haben sie ihr zumindest heruntergewaschen, das hauptsächlich seines gewesen sein muss. Das nasse Handtuch ist anschließend neben dem Bett gelandet. Keine anständigen Fingerabdrücke, nirgends. Dann wurde sie auf diese rituelle Weise hingebettet, mit den lila Blumen …«
»Flieder, Chef.«
»Mit dem Flieder, wenn Sie es sagen … aus der Vase im Nebenzimmer. Schuhe haben sie ihr angezogen, die Tiara hübsch ins Haar gesteckt, auch wenn der Frisur da längst ein paar Nadeln fehlten. Sie hatten ganz offenbar keine Eile. Nicht das Gefühl, dass sie unter Druck stünden oder sich wegen Zeugen Sorgen machen müssten.«