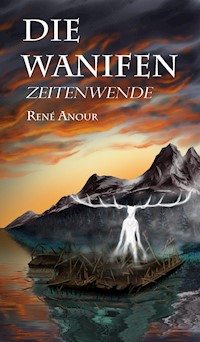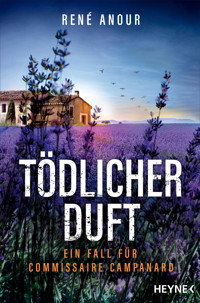Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Totenärztin-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine junge Ärztin Eine heimliche Obduktion Eine gefährliche Entdeckung Wien, 1908. Als ein toter Obdachloser in der Gerichtsmedizin eingeliefert wird, schenkt niemand ihm einen zweiten Blick – niemand außer der jungen Ärztin Fanny Goldmann. Ihr fallen Ungereimtheiten auf, aber keiner ihrer männlichen Kollegen will auf sie hören. Daher obduziert sie die Leiche nachts heimlich. Eine gefährliche Entscheidung, denn plötzlich findet sie sich mitten in einer tödlichen Verschwörung rund um einen charismatischen Dieb und Kaiserin Sissis verschwundene Diamantsterne wieder. Ihre Ermittlung führt Fanny von den mondänen Salons und prunkvollen Palais der Oberschicht bis in die schäbigen Spelunken und Bordelle der Wiener Unterwelt. Hier lauert an jeder Ecke der Tod, dessen Opfer Fanny auf ihrem Sektionstisch ihre intimsten Geheimnisse offenbaren ... Eine atemberaubend spannende Mischung aus Medizinhistorie und Krimi Der erste Fall für Totenärztin Fanny Goldmann
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
René Anour
Die Totenärztin: Wiener Blut
Roman
Über dieses Buch
Eine junge Ärztin.
Eine heimliche Obduktion.
Eine gefährliche Entdeckung.
Wien, 1908. Als ein toter Obdachloser in die Gerichtsmedizin eingeliefert wird, schenkt niemand ihm einen zweiten Blick – niemand außer der jungen Ärztin Fanny Goldmann. Ihr fallen Ungereimtheiten auf, aber keiner ihrer männlichen Kollegen will auf sie hören. Daher obduziert sie die Leiche nachts heimlich. Eine gefährliche Entscheidung, denn plötzlich findet sie sich mitten in einer tödlichen Verschwörung rund um einen charismatischen Dieb und Kaiserin Sisis verschwundene Diamantsterne wieder. Ihre Ermittlung führt Fanny von den mondänen Salons und prunkvollen Palais der Oberschicht bis in die schäbigen Spelunken und Bordelle der Wiener Unterwelt. Hier lauert an jeder Ecke der Tod, dessen Opfer Fanny auf ihrem Sektionstisch ihre intimsten Geheimnisse offenbaren ...
Eine atemberaubend spannende Mischung aus Medizinhistorie und Krimi.
Der erste Fall für Totenärztin Fanny Goldmann.
Vita
René Anour lebt in Wien. Dort studierte er auch Veterinärmedizin, wobei ihn ein Forschungsaufenthalt bis an die Harvard Medical School führte. Er arbeitet inzwischen bei der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit und ist als Experte für neu entwickelte Medikamente für die European Medicines Agency tätig. Sein historischer Roman «Im Schatten des Turms» beleuchtet einen faszinierenden Aspekt der Medizingeschichte: den Narrenturm, die erste psychiatrische Heilanstalt der Welt. Sein zweiter Roman bei Rowohlt ist der Auftakt zu einer Reihe um eine junge Gerichtsmedizinerin in Wien zu Beginn des 20. Jahrhunderts: «Die Totenärztin».
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Ulrike Brandt-Schwarze
Zitat Seite 105 und 207 aus: «Wiener Blut», Operette von Johann Strauß, Text: Victor Léon und Leo Stein, Mainz 1992.
Zitat Seite 324 aus: William Shakespeare, «Ein Sommernachtstraum». Übersetzt von August Wilhelm von Schlegel, Zürich 1979.
Zitat Seite 377: Anna Fischer-Dückelmann, «Die Frau als Hausärztin – ein ärztliches Nachschlagebuch». München 1922.
Kartenillustration Christl Glatz, Guter Punkt, München, unter Verwendung von Motiven von iStock/Getty Images Plus
Covergestaltung Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung Magdalena Russocka/Trevillion Images; Hauptmann & Kompanie
ISBN 978-3-644-00909-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae. –
Dies ist der Ort, wo der Tod sich freut, dem Leben beizustehen.
(Giovanni Battista Morgagni, Padua, 1682–1771)
1. Kapitel
Der lächelnde Tote
Fanny hatte nie eine Frau gesehen, die zufriedener aussah. Natürlich, es war nur ein Bild in einer Zeitung, aber dieses Lächeln. In die Mundwinkel gegrabene Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, die sich die Schneidersfrau Bertha Brocker, wohnhaft in Margarethen, im fünften Gemeindebezirk der Stadt Wien, selbst gewährt hatte.
Und das Ergebnis lag direkt vor Fanny auf dem Tisch.
Berthas Mann. Der Schneider.
Schon beim Entkleiden war ihnen aufgefallen, dass sie ihn nicht «nur» ermordet hatte. Zwischen seinen Beinen fehlte etwas ganz Wesentliches.
«Meinst du, sie hat ihn vorher betrunken gemacht?» Fanny beugte sich fasziniert über den Toten und besah sich die lange Schneiderschere, die in seinem Kehlkopf steckte.
Franz schnaubte und schob Fanny mit seinem blutigen Kautschukhandschuh vom Sektionstisch weg. Manchmal vergaß sie ihre Position, wenn die Begeisterung überhandnahm. Aber sie hatte so viel in Kauf nehmen müssen, bis zu dieser Anstellung als Prosekturgehilfin an der Gerichtsmedizin, dass es ihr einfach schwerfiel, sich zu zügeln.
Franz bedachte das Mordwerkzeug mit einem skeptischen Blick. «Betrunken oder nicht. Ändert doch nichts an der Sauerei.» Der Gerichtsmediziner fuhr fort, den Brustkorb der Leiche mit der Sternumschere zu öffnen.
«Glaubst du, wir finden noch etwas?», fragte Fanny.
«Nein», brummte Franz. «Und ich frag mich, warum ich mir das so spät am Abend noch antu.»
Außer den beiden offensichtlichen Verletzungen hatte die Beschau nichts Ungewöhnliches ergeben. Die Totenstarre war bereits eingetreten. Die Livores, die Totenflecken, die durch das Versacken des Blutes entstanden, bedeckten den gesamten Rücken der Leiche. Sie ließen sich noch wegdrücken, was bedeutete, dass das Herz vor weniger als sechsunddreißig Stunden den Dienst eingestellt hatte.
Fanny streifte das blau angelaufene Gesicht des Schneiders mit einem Seitenblick. Seine Miene wirkte verkrampft. Hervorquellende Augen mit geplatzten Äderchen. Gewiss hatte Bertha noch kurz gewartet, damit er realisierte, was für einen Körperteil sie ihm abgeschnitten hatte, bevor sie es zu Ende brachte.
Gestern hatte Bertha in einer ersten Einvernahme gesagt, dass er sie über Jahre geprügelt und so gut wie jede Woche betrogen hatte.
«Wieso ist sie nicht einfach weg?», murmelte Fanny.
«Was war das?», fragte Franz.
Fanny beobachtete, wie er mit dem Schnitt entlang der Schlüsselbeine begann. Bei jedem Zusammendrücken der Schere wurden Muskeln und Sehnen auseinandergerissen.
Von draußen drangen vereinzeltes Hufklappern und das ferne Dröhnen eines Automobils an ihr Ohr.
«Ich meine nur, wenn sie ihn verlassen hätte, anstatt … Jetzt geht sie ins Gefängnis.»
«Bei der Schweinerei», erwiderte Franz leise, «fällt mir das Mitleid-Haben reichlich schwer.»
In der Körpermitte angekommen, wechselte er die Richtung und folgte dem Verlauf des Brustbeins.
Fanny liebte ihre Arbeit, aber das Geräusch, wenn die Schere knackend Knorpel durchtrennte, verursachte selbst ihr bisweilen ein flaues Gefühl im Magen.
Der Schneider war von schlanker Statur gewesen und, abgesehen von den riesigen Blutflecken auf Hemd und Hose, elegant gekleidet. Sein Haar war an den Schläfen etwas ergraut, und seinen Schnauzer hatte er sorgsam mit Wichse gezwirbelt.
Fanny und Franz hatten die Leiche auf einen der vier metallenen Sektionstische in dem Saal gehievt, den sie gerade zuvor erst sauber gewischt hatte.
Freitagabend war Franz – eigentlich Dr. Franz Wilder – meist der einzige Gerichtsmediziner, der am Institut noch seinen Dienst versah … und Fanny war die Einzige, die ihm noch assistieren konnte. Gert, der andere Prosekturgehilfe, war gelernter Fleischer und musste abends immer in der Schlachthalle in St. Marx aushelfen.
«Sesam, öffne dich», murmelte Franz. Er durchtrennte das letzte Stück des Brustbeins mit einem gezielten Schnitt. Der Rippenbogen sprang förmlich auf und gab den Blick auf das Herz und die Lungen frei.
Fanny hätte zu gerne einmal selbst versucht, einen Herzschnitt durchzuführen. Aber erstens hatte Professor Kuderna es verboten, und zweitens gefiel es Franz nicht, wenn man ihm, wie er es nannte, die Leich’ angrapschte. Darauf reagierte er ähnlich empfindlich, als wäre man ungefragt in sein Schlafzimmer hereingeplatzt. Er schnitt weiter durch die Bauchmuskeln Richtung Nabel und Schambein.
Sie waren gerade dabei gewesen, das Institut abzuschließen und Feierabend zu machen, als die Polizei in einem dieser neuartigen Automobile vorgefahren war und ihnen die Leiche praktisch vor die Tür gelegt hatte. Die Ehefrau Bertha wäre zwar geständig, hatten die Beamten gesagt, aber man erwarte sich trotzdem einen vollständigen Bericht. Das volle Ausmaß ihrer Schandtaten würde das Strafmaß mitbestimmen.
Für eine einfache Schneidersfrau hatte Bertha die Polizei offenbar ziemlich lange an der Nase herumgeführt. Es hieß, sie wäre in einen alten Tunnel unter der Schneiderei geflüchtet, wo man sie erst nach Stunden gefasst hätte.
«Unter den Wiener Palästen und Tanzsälen verbirgt sich eine geheime Welt finsterer Tunnel, manche davon so alt wie die Stadt selbst», hatte Fannys Vater ihr früher vor dem Einschlafen erzählt. Damals hatte sie sich vorgestellt, dass dort unten Zwerge hausten und nach Edelsteinen schürften.
«Dabei hätt ich heut Abend noch bei meiner Großmutter vorbeischauen sollen», seufzte Franz und riss Fanny aus ihren Gedanken.
«Wie geht es ihr denn?», fragte Fanny vorsichtig. Franz sprach selten von seiner Familie. Nur, dass er sich um seine Großmutter kümmerte und ihr schweres Rheuma behandelte, hatte er ihr gegenüber erwähnt.
«Besser wird’s halt nicht. Aber zumindest grantelt sie nicht mehr die ganze Zeit herum.»
«Wie das?»
«Sie bekommt jetzt ein Morphintonikum gegen die Schmerzen. Macht sie zufrieden. Ein Schlückchen und …», Franz setzte ein übertriebenes Lächeln auf, «… glücklich.»
«Immerhin.» Leider fiel ihr nichts Aufmunternderes ein. Sie wandte sich wieder der Leiche des Schneiders zu.
«Was für eine Verschwendung», meinte Fanny. «Er war so gesund.»
«Kannst du dich trotzdem ein bisserl beeilen?», brummte Franz ungeduldig. «Der ist schon tot, dem ist deine geschätzte Aufmerksamkeit ziemlich wurst. Aber ich würd’s schätzen, wenn du endlich anfangen könntest.»
Gehorsam schnappte sich Fanny ihr Klemmbrett und den Bleistift.
«Lage der Organe in Becken, Bauch und Brusthöhle ohne Befund», diktierte er, während sie das Formular ausfüllte.
Nach und nach entnahm Franz die Organe und legte sie in die Metallschalen, die Fanny ihm hastig bereitstellte.
«Nieren, Nebennieren und andere Beckenorgane ohne Befund.»
Fanny seufzte. Franz hielt sich selten an die vorgegebene Reihenfolge, auch wenn er am Ende immer alle Organe begutachtete. Eigentlich hätte er mit Herz und Lunge mitsamt Luft-, Speiseröhre und Kehlkopf beginnen müssen.
«Ich versteh’s nicht», meinte Franz trocken. «Colon, Caecum, Ileum, Jejunum, Duodenum … Milz, Pankreas … Leber und Moment … Ah ja, die Gallenblase! Alles ohne Befund.»
«Was denn?» Fanny legte die Leber behutsam in eine der Schalen, während ein bisschen grüne Gallenflüssigkeit auf ihren Handschuhen zurückblieb. Eins Komma vier Kilo, Fanny notierte das Gewicht neben dem Organbefund.
«Hat ein Mädel wie du eigentlich nichts Besseres zu tun, als mir dabei zuzusehen, wie ich im Leib von diesem Gfrast von einem Kerl herumwühl?»
Fanny sah auf und spürte, wie ihr die Lesebrille tiefer auf die Nase rutschte. Sie hasste es, wenn das passierte. Mit den mit blutigem Schleim bedeckten Handschuhen wollte sie sie nur ungern zurechtrücken. Sie drückte sie mit dem Ellenbogen, so gut es ging, nach oben. Die Brille war zwar lästig, aber sie hatte Fanny schon unzählige Male davor bewahrt, Eiter, Blut oder sonstige Sekrete ins Auge gespritzt zu bekommen.
«Mir gefällt’s!»
«Hmh!», kommentierte Franz und löste Magen und Milz aus dem Bauch. «Ich mein ja nur, ein zartes Fräulein wie du passt doch eher in eine Seidenmalklasse.»
Fanny biss sich auf die Lippen. «Danke, du warst so ziemlich der Einzige, der noch gefehlt hat. Alle anderen haben mir schon gesagt, dass ich nicht hierhergehöre.»
Franz rollte mit den Augen. «Schau her!» Er eröffnete die Wand des prall gefüllten Magens. Ein Schwall säuerlich riechender Flüssigkeit schwappte über den Sektionstisch und tropfte zu Boden. «Das beantwortet deine Frage von vorhin. Ja, sie hat ihn betrunken gemacht. Oder wahrscheinlicher: er sich selbst. Stockbesoffen war er auf jeden Fall.» Franz schüttelte den Kopf.
«Was soll ich beim Mageninhalt eintragen?»
Franz sog prüfend die Luft ein. «Rotwein … und Nussschnaps würd ich meinen. Und auch noch auf nüchternen Magen!»
«Macht es wirklich Spaß, so betrunken zu sein? Ich meine, wieso tut man’s sonst?»
«Du solltest wirklich mehr Zeit mit Menschen als mit Leichen verbringen.»
«So wie du?»
«Touché», erwiderte Franz, während er Luft- und Speiseröhre mit dem Skalpell vom übrigen Gewebe löste. «Aber an mir sollt sich kein Fräulein ein Beispiel nehmen.»
Er führte einen Längsschnitt entlang der Luftröhre und der beiden Hauptbronchien und holte mit dem Daumen einen Brocken geronnenen Blutes hervor, der Fanny vage an Wackelpudding erinnerte. Franz schenkte ihr einen vielsagenden Blick. Fanny notierte die Beobachtung, ohne eine Frage zu stellen. Wenn Blut an einem Ort nichts verloren hatte, dann in den Atemwegen.
Inzwischen öffnete Franz das Herz mit ein paar gezielten Schnitten, sodass die beiden Kammern, Vorhöfe und die Herzklappen zu sehen waren. Fanny konnte gerade noch das Obduktionsformular zur Seite legen, ehe Franz ihr das bluttriefende Herz in die Hand drückte. Für einen Moment hielt sie es, als sei es ein kostbares Juwel, besah sich die Herzklappen und die durchtrennte Aorta. Keine Maschine dieser Welt war so raffiniert wie diese kleine Pumpe und ihre Druckausgleichsfunktion.
«Wunderschön!»
Franz musterte Fanny mit hochgezogenen Augenbrauen. «Schreib lieber ‹ohne Befund›. ‹Wunderschön› macht sich in einem Obduktionsbericht nicht so gut.»
Er legte die Schere weg, nahm ein scharfes Messer und löste den Kehlkopf und die Zunge aus dem umgebenden Gewebe. Dann betrachtete er den herabbaumelnden Kehlkopf und die darin steckende Schere. Mit einer gezielten Bewegung zog er die Mordwaffe heraus.
Kaum Blut. Alles längst geronnen.
Fanny trat neugierig näher.
«Der Schildknorpel ist durchschlagen», wisperte sie. Der Kehlkopf hatte sie immer schon fasziniert, dieses filigrane Konstrukt aus Knorpeln, Bändern, Muskeln und Nerven, ohne dass man kein Wort sprechen oder einen Atemzug nehmen konnte.
«Und schau!», Franz drückte den Kehldeckel hinunter, damit Fanny in Kehlkopf und Luftröhre hineinsehen konnte.
«Von dort kommt das Blut in den Bronchien?», fragte sie leise. «Durchtrennung der … Arteria laryngea superior?»
Franz nickte. «Weißt du, was der gesagt hat, als sie ihn abgestochen hat?»
Fanny sah ihn fragend an.
Franz bewegte die starre Zunge des Schneiders auf und ab.
«Chhhrrr! Chrrr!», röchelte er. Er grinste, als er Fannys Blick bemerkte.
«Und ich dachte, du würdest was Kluges sagen», erwiderte sie milde lächelnd.
«Und du hast recht gehabt.» Franz deutete auf ein durchtrenntes, weißliches Band am Rand des Kehlkopfes.
«Nervus laryngeus recurrens. Der einzige Nerv, der den Kehlkopf weitet. Ohne den kein Atmen oder Sprechen. Aufschreiben!»
Fanny zog sich einen Handschuh aus, damit sie sich Notizen machen konnte.
Franz bedachte sie noch mit einem kurzen Blick und ließ die aneinanderhängenden Organe in die größte der Metallschalen klatschen.
«So, fertig!»
Fanny runzelte die Stirn. «Franz, schau!»
Sie hob den Kehlkopf mit der daran baumelnden Zunge so ruckartig aus der Schüssel, dass etwas Blut auf Franz’ Schürze spritzte. «Ich hab noch was entdeckt!» Sie drückte den Kehlkopfdeckel hinunter und deutete auf eine kaum wahrnehmbare Rötung der Schleimhaut im Bereich der Stimmbänder. «Eine leichtgradige katarrhalische Entzündung, oder?»
«Die Polizei wird außer sich sein. Ihr Mordopfer war ein bisserl verkühlt», kommentierte Franz, «aber schreib’s auf, von mir …»
Die Glocke hallte durch das einsame Institutsgebäude in den ersten Stock hinauf.
«Das gibt’s nicht!», zischte Franz. Er stand da wie gelähmt, noch immer mit dem bluttropfenden Messer in der Hand. Das Bimmeln wiederholte sich.
Franz murmelte etwas, das sich verdächtig nach «solche Gfraster» anhörte, dann erwachte er aus seiner Erstarrung.
«Du machst hier fertig!» Er deutete mit dem Messer auf Fanny, dann auf die ausgeräumte Leiche. Er wandte sich ab und hastete aus dem Sektionssaal.
Fanny seufzte. «Natürlich.»
Sie schob einen der hölzernen Rollwagen an den Sektionstisch heran. Bevor sie den Toten auf die Liege wälzte, reponierte sie seine Organe, so gut es eben ging. Wenn er abgeholt wurde, würden seine Angehörigen ihn gewiss nicht auf Raten begraben wollen.
Sie hätte den Toten gern selbst zugenäht, aber Professor Kudernas Worte klangen ihr noch deutlich im Ohr: «Wegräumen, putzen, Berichte ausfüllen! Das machen Prosekturgehilfen bei uns. Unter keinen Umständen pfuschen Sie den Ärzten sonst wie ins Handwerk, verstanden?»
Wenn sie allein waren, ließ Franz Fanny ohnedies schon mehr tun, als sie eigentlich durfte. Für die anderen war sie ausschließlich die Mamsell vom Dienst, der die Nähe von Blut und anderen Körperflüssigkeiten nichts auszumachen schien.
Fanny stöhnte vor Anstrengung, als sie den Toten auf den Wagen zog. Während sie den Schneider in den Leichenraum schob, hörte sie von unten laute Stimmen.
«Der Schein ist doch nur ausgefüllt, weil ihr die Leiche bei uns abladen wollt! Wisst ihr, wie spät es ist?»
Irgendjemand, den Fanny nicht verstehen konnte, antwortete Franz, dann näherten sich Schritte über die Stufen.
Zwei Polizeibeamte in dunklen Uniformen und glänzenden Helmen tauchten im Sektionssaal auf. Sie schleppten eine Trage, auf der sich eine reglose Gestalt abzeichnete. Eine scharfe Mixtur aus Urin und Alkoholdunst ließ Fanny die Nase rümpfen.
«Ihr nehmt den wieder mit!», zischte Franz. «Verstanden?»
«Hat alles seine Ordnung, Herr Doktor, wie’s auf dem Schein steht», brummte der weiter vorn stehende der beiden Polizisten, ein riesenhafter Kerl. Er sah sich in aller Ruhe nach einer geeigneten Ablage für die Leiche um.
Fanny kannte den Mann. Inspector Kaltenecker. Franz mochte ihn nicht, weil der Inspector es sich gern einfach machte und ihnen Leichen zuschanzte, die in der Gerichtsmedizin eigentlich nichts verloren hatten. Leichen, bei denen kein Mordverdacht bestand, deren Beschau, wenn überhaupt notwendig, jeder beliebige Pathologe durchführen konnte.
«Na, dort legen wir ihn wohl eher nicht hin», erklärte Kaltenecker mit einem Blick auf den blutverschmierten Tisch, den Fanny noch nicht gereinigt hatte.
Das Gesicht des zweiten, etwas korpulenteren Polizisten rötete sich schon vor Anstrengung, als sie den Toten mit einem dumpfen Poltern auf einem der Nachbartische abluden.
Kaltenecker klatschte zufrieden in die Hände. Erst jetzt schien er Fanny wahrzunehmen. «Na, schauen S’, Herr Doktor, Sie haben eh noch eine Schwester da. Die kann dem Patienten das Handerl halten, während Sie ihn zerlegen!»
«Prosekturgehilfin», wisperte Fanny, ohne dass irgendjemand Notiz davon nahm.
«Das gibt eine gesalzene Beschwerde an den Herrn Oberst, darauf können Sie sich verlassen», knurrte Franz.
Kaltenecker zuckte mit den Schultern. «Wenn Sie meinen, Herr Doktor. Aber der Herr Oberst hat die Obduktionsanforderung ja selbst unterschrieben.» Er deutete auf das Stück Papier in Franz’ Hand. «Todesursache unklar. Fremdverschulden nach eigenem Ermessen abklären.»
«Das ist ein toter Sandler, sonst nix», herrschte Franz ihn an. «Hat sich vermutlich zu Tode gesoffen. Bestimmt ein armer Mensch, aber sicher kein Mordopfer!»
«Im Stadtpark konnten wir ihn ja wohl kaum sitzen lassen», meinte Kaltenecker und streckte sich. «Und das Leichenhaus sperrt erst morgen wieder auf.»
Fanny huschte hinter den beiden Streithähnen vorbei und warf einen Blick auf den toten Mann. Der Alkohol- und Pissegestank war in seiner unmittelbaren Nähe kaum zu ertragen.
Der Mann schien im besten Alter gewesen zu sein, doch sein Mantel wirkte zerschlissen, und er trug keine Schuhe. Wahrscheinlich hatten ein paar andere Obdachlose sie ihm ausgezogen, bevor die Polizisten seine Leiche entdeckt hatten.
Franz hatte recht. Das hier sah wirklich nicht nach Fremdeinwirkung aus, keine klaffende Wunde, keine gebrochenen Gliedmaßen, zumindest nicht, soweit man das im angekleideten Zustand erkennen konnte.
Fannys Blick saugte sich an den Zehen des Toten fest. Sie runzelte die Stirn.
«Heißt das, wir kriegen jetzt jede Leich’, die irgendwo auftaucht?», hörte sie Franz hinter sich schimpfen, aber sie nahm es kaum wahr.
Rasch griff sie nach der Hand des Obdachlosen. Dieser Mann war noch nicht sehr lange tot. Der Arm ließ sich noch gut bewegen. Seine Finger fühlten sich durch die Kautschukhandschuhe hindurch klamm an.
Fanny schüttelte den Kopf, während sie sich die Hand genauer besah. «Aber wieso …»
«Jedenfalls machen wir den Kerl nicht auf, der geht morgen schnurstracks ins städtische Leichenhaus!»
«Hauptsache, wir haben keine Scherereien mehr mit dem.» Die Polizisten hatten sich ihre Trage genommen und standen schon wieder in der Tür.
«Herr Doktor», sagte Kaltenecker. Der spöttische Unterton in seiner Stimme war beinahe greifbar. «Schwester.» Er bedachte Fanny mit einem schiefen Grinsen und tat, als würde er seinen Helm lüften. «Wir lassen uns selbst raus!»
Für eine Weile standen Fanny und Franz reglos da, horchten auf die Schritte der Polizisten, ihr Lachen, das ferne Geräusch der Tür.
Franz’ ganze Gestalt schien zu beben. Er stieß ein Knurren aus und wischte eine der blutverschmierten Blechschalen vom Sektionstisch. Dann seufzte er tief. «Als wenn unsere Arbeit ein Witz wär», brummte er, bückte sich und hob die Schale auf.
«F-Franz?» Fanny biss sich nervös auf die Lippe, als er sich ihr zuwandte. «Könntest du … ich glaub, ich hab was gefunden!»
Er rührte sich nicht von der Stelle und stützte sich am Tisch ab. «Was? Hat der tote Sandler auch eine leichte Verkühlung?»
«Ich weiß nicht, aber …»
«Bring ihn in den Leichenraum. Ich lass ihn morgen abholen.»
«Aber … so schau doch!» Sie hob einen Arm des Toten.
«Und?»
«Die Fingernägel!»
«Ich weiß nicht, was du meinst.»
«Sie sind sauber und geschnitten.» Fanny nickte zu den nackten Füßen des Toten. «Die Zehennägel auch, obwohl er keine Schuhe trägt. Ich glaube, vielleicht …»
Franz stöhnte. «Ich weiß, du willst immer irgendwas finden, aber diese feinen Polizeiinspectoren haben uns nur als Ersatzleichenschauhaus benutzt. Lass den armen Mann tot bleiben, der hat’s eh nicht gut gehabt im Leben.»
«Aber er kann doch niemandem mehr erzählen, was mit ihm geschehen ist. Er hat nur noch uns, um herauszufinden …»
«… dass er auf die allernatürlichste Weise krepiert ist!»
«Und der Geruch?»
«Der ist grauslich, na und? Sicher hätte er auch lieber auf einem parfümierten Kissen geschlafen, wenn er gekonnt hätte.»
«Ich schlafe auf keinem … egal. Ich meine, da stimmt was nicht, zuerst dachte ich, er riecht nach Alkohol und Urin, aber … Ich glaube, das ist Pferdeurin, Franz.»
Franz schnaubte. «Vielleicht hat er kein anderes Pläsier gekannt, als sich Tag und Nacht die Nägel zu schneiden und sich in Pferdepisse zu wälzen. So geht’s eben zu. Jetzt bring ihn nach hinten!»
«Aber …»
«Keine Widerrede, Fanny!» Franz bedachte sie mit einem scharfen Blick. «Du machst hier sauber. Ich ruf dir inzwischen einen Wagen vom Kutschenstand. Ist schon nach zehn.»
«Und wenn ich …»
«Ich bin hier der Mediziner. Und ich hab nein gesagt.»
Fanny senkte den Blick.
Für einen Moment öffneten sich Franz’ Lippen, als wollte er noch etwas sagen, aber dann wandte er sich ab und marschierte aus dem Sektionssaal.
«Aber ich bin doch auch Medizinerin», sagte sie, als wäre er noch da, um es zu hören.
Sie hatte gedacht, es würde leichter werden, wenn sie erst ihr Studium abgeschlossen hätte, aber das Gegenteil war der Fall. Auf der Universität war sie als Kuriosum durchgegangen, das man belächelt und nicht ernst genommen hatte. Eine von drei Frauen. Gewiss die Tochter eines reichen Juds, die sich bis zur Heirat die Zeit vertreibt.
Jetzt, wo sie wirklich arbeiten wollte, lagen die Dinge ganz anders. Die Gerichtsmedizin war ein junges wissenschaftliches Gebiet, auf dem man händeringend nach Ärzten suchte, da diese in fast jedem anderen Bereich mehr Geld verdienen konnten.
Dennoch war eine Anstellung als Prosekturgehilfin das Beste gewesen, was man ihr angeboten hatte.
Im Einstellungsgespräch mit Professor Kuderna hatte sie sich eine Litanei darüber anhören müssen, wozu eine Frau nicht in der Lage war. Er hatte sie unter so dichten Augenbrauen angefunkelt, dass ein Paar Sperlinge darin hätte nisten können. Seine Lippen waren in dem krausen Rauschebart kaum auszumachen gewesen, was es Fanny schwergemacht hatte, seine Wutausbrüche vorauszuahnen.
Bei ihrer Vorstellung hatte er sich jedoch beherrscht. Vielleicht war es Fannys Glück gewesen, dass Kudernas Frau Leontine den Professor gerade im Institut besucht hatte, eine Dame der Wiener Gesellschaft, die geradezu verzückt gewesen war, dass eine Frau, noch dazu eine studierte Medizinerin, bei ihrem Mann um eine Stelle ansuchte. Wäre Madame Kuderna nicht gewesen, hätte der Professor Fanny vielleicht gar nicht eingestellt. Seine Sicht der Dinge hatte er dennoch nicht für sich behalten.
«Die Grausamkeiten, denen man hier begegnet, kann der weibliche Verstand nicht erfassen, ohne an rationalem Urteilsvermögen einzubüßen, so dieses überhaupt vorhanden ist», hatte er verkündet. «Auch besitzt eine Frau, deren Naturell im Nährenden und Fürsorglichen begründet ist, weder die Fähigkeit noch den Willen zu einer strukturierten Arbeitsweise. Wenn Sie also unbedingt wollen, dann können Sie eine Weile den Gerichtsmedizinern zur Hand gehen. Wahrscheinlich werden Sie ohnehin bald heiraten, dann erledigt sich das Thema von selbst.»
«Strukturierte Arbeitsweise.» Fanny schnaubte. Franz war noch der strukturierteste Gerichtsmediziner am Institut, und selbst er hielt sich nie an irgendein Protokoll.
Während Franz sich wusch und umzog, schob Fanny den Toten in den Leichenraum.
Im schummrigen Licht betrachtete sie die Miene des Mannes und neigte unwillkürlich den Kopf. Obwohl er ein Obdachloser war, wirkten seine Gesichtszüge so würdevoll, als wäre er ein schlafender König.
«Ich bin sicher, du hättest viel zu erzählen!» Aus einem Impuls heraus streckte sie die Hand aus und strich dem Toten über die Stirn. «Es tut mir leid.»
Franz wartete vor dem Institutsgebäude auf sie. Er trug einen Mantel mit hohem Kragen und eine etwas altmodische Melone, die seinen braunen Haarschopf verbarg. Kaum war Fanny bei ihm angekommen, verabschiedete er sich mit einem Kopfnicken und stapfte ohne ein weiteres Wort in die kalte Märznacht hinaus. Fanny ging mit gesenktem Blick zu der Kutsche hinüber, die Franz für sie gerufen hatte.
«Wohin, gnä’ Fräulein?», fragte der Kutscher mit heiserer Stimme. Er stieg vom Kutschbock und öffnete ihr die Tür.
Fanny seufzte und schlang ihren Mantel um sich. Sie konnte nach Hause fahren. Vielleicht ist Papa noch wach, dachte sie, und ich kann mit ihm eine warme Suppe löffeln und ihm von meinem Tag erzählen.
Morgen war Samstag, und sie würde nicht am Institut sein, wenn sie den Obdachlosen abholten. Im Leichenhaus würde er nur kurz bleiben. Wenn sich niemand meldete, kam er in ein Armengrab. So ging es eben zu. Eine weitere Geschichte, die nie erzählt werden würde.
Oder …
Ein gefährlicher Gedanke. Und es war verboten.
Aber sie hatte mittlerweile doch schon bei einigen Obduktionen zugesehen. Vielleicht könnte sie …
Nein, es gab viel zu viel, das sie nicht wusste. Und sie war nur eine Prosekturgehilfin, ein besseres Dienstmädel für die Herren Doktoren. Wenn jemand dahinterkäme …
Der Kutscher räusperte sich. «Wird Ihnen nicht langsam kalt, Fräulein?»
«Tut mir leid!» Fanny setzte den Fuß auf die erste Stufe der ausgeklappten Kutschentreppe.
«Mich wundert ja nicht, dass Sie so verschreckt sind», brummte der Kutscher. «Hab gehört, da drinnen schneiden’s Leichen auf. Wirklich kein Ort für so ein zartes Fräulein wie Sie!»
Fanny hielt inne. Nach einem Moment des Zögerns trat sie zurück auf die Straße. «Wenn ich es recht bedenke … Ich glaube, ich habe noch etwas vergessen.»
2. Kapitel
Schritte im Dunkeln
Das nächtliche Institut wirkte gespenstisch mit seinen hallenden Gängen. Das Gebäude war modern eingerichtet und verfügte in jedem Stockwerk über elektrische Beleuchtung, aber Fanny wagte es nicht, sie anzuschalten. Auf dem Gelände zwischen den Instituten drehten Nachtwächter ihre Runden, die sonst wohl nachsehen kommen würden.
Sie bog in die Damenumkleide ab, eine extra für sie umfunktionierte Besenkammer, und schaffte es im Dunkeln, sich die gebrauchte Schürze über ihr taubengraues Arbeitskleid zu binden und sich ihre Handschuhe überzustreifen.
Im Sektionssaal war es totenstill. Kam es ihr hier nur plötzlich so unheimlich vor, weil Franz nicht da war? Als ob er ihr bei Gefahr eine große Hilfe gewesen wäre. Vermutlich würde er sich nur über die entstehenden Scherereien beschweren, während jemand sie vor seinen Augen meuchelte.
Fanny schüttelte den Kopf. Wie kam sie nur auf solch absurde Gedanken?
Schneller als nötig hastete sie zu einem der vier Sektionstische und zog an einer Schnur, die eine elektrische Lampe, etwa einen Meter über der Tischplatte, zum Leben erweckte. Dieses Licht war unverhandelbar. Sie musste sehen können, was sie tat, wenn sie es denn wirklich wagen würde …
Sie lief zu einem der wuchtigen, hölzernen Regale am Rand des Saals, wo die verschiedenen Instrumente säuberlich in hölzernen Laden geordnet waren. Das war großenteils ihr Verdienst. Gert hatte die Instrumente einfach hineingeworfen in die Fächer, bevor Fanny vor zwei Monaten am Institut begonnen hatte. Jede Schublade mit Essbesteck war besser sortiert gewesen.
Fanny suchte sich drei verschiedene Größen scharfer Messer aus, die Sternumschere natürlich, ein Skalpell, eine große und eine kleine Pinzette. Nachdem sie die Instrumente auf den Tisch gelegt hatte, überlegte sie einen Moment. Es musste eine abgekürzte Obduktion werden. Kopf und Hals mussten unberührt bleiben, sonst würde sie auffliegen. Und sie durfte nicht zu lange brauchen. Kein Wiegen der Organe. Und natürlich kein offizieller Obduktionsbericht.
Anstatt des Formulars schob sie ein leeres Blatt Papier auf ihr Klemmbrett.
Ihre Freundin Tilde würde sie für verrückt halten, wenn sie ihr das morgen beim Tee erzählte. Allerdings hatte Fanny noch nie erlebt, dass Tilde irgendetwas absonderlich fand. Vielleicht war das der Hauptgrund, weshalb sie noch befreundet waren.
So, alles war an seinem Platz. Fehlte nur noch der Ehrengast.
Fanny lief nach hinten in den Leichenraum. Ein Hauch süßlichen Totendufts schlug ihr entgegen. Sie zog die Decke von der Leiche.
«Oh Gott!» Sie zuckte zusammen, als sie in Schneider Brockers hervorquellende Augen sah. Stimmt, ich habe den Obdachlosen in die Nische auf der anderen Seite abgelegt, schoss es ihr durch den Kopf.
Sie schnappte sich die richtige Leiche, zog den Obdachlosen mit einem Ächzen auf den Rollwagen und schob ihn zurück zu ihrem Sektionstisch.
Sofort stieg ihr wieder der Alkohol- und Urindunst in die Nase.
«Niemand wälzt sich gern in Pferdepisse, Franz», murmelte sie, während sie dem Mann seinen zerschlissenen Mantel auszog, was wegen der nun doch einsetzenden Leichenstarre gar nicht so einfach war.
Um die äußere Beurteilung des Toten korrekt durchzuführen, musste er unbekleidet sein, und zwar völlig.
Fanny legte den Mantel beiseite und runzelte die Stirn.
Seltsam …
Sie beugte sich vor und roch an dem Hals des Verblichenen. Sofort richtete sie sich wieder kerzengerade auf.
Der Mantel. Nur der Mantel stank. Die Leiche selbst – Fanny schüttelte verwirrt den Kopf – roch nach Parfüm. Tatsächlich war das nicht mal das Ungewöhnlichste.
Er trug ein seidenes Unterhemd, das nicht etwa aus besseren Tagen stammte, sondern frisch und sauber wirkte.
Sah man den Toten, wie er jetzt dalag, hätte man nie angenommen, dass es sich um einen Obdachlosen handelte.
«Wer bist du?», flüsterte Fanny ihm zu. «Und warum bist du tot?»
Sie streifte ihm das Unterhemd über den Kopf. Obwohl es zu ihrer Pflicht gehörte, fühlte es sich falsch an, ihm Hose und Unterhose auszuziehen. Sie unterdrückte ihr Unbehagen, nahm ihren Bleistift und fertigte rasch eine Skizze des Toten an. Sie hatte immer schon gut zeichnen können. Franz war bei weitem nicht der Einzige, der sie lieber in einem Seidenmalkursus gesehen hätte.
«Ernährungszustand gut – fast ein bisschen zu gut», murmelte sie. «Alter …» Fanny hatte wenig Erfahrung damit, das Alter von Männern zu schätzen. Sie warf einen Blick auf die ergrauten Locken und die vielen Lachfältchen um seine Augen.
«Etwa fünfzig?», notierte sie unsicher.
Sie unterzog die Körperoberfläche einer genauen Inspektion, hob Arme und Beine an, um auch wirklich jede Stelle zu erfassen. Totenflecke nur am Gesäß. Das passte. Die Polizisten hatten ihn, auf einer Parkbank sitzend, aufgefunden. Einsetzende Totenstarre. Er war noch nicht lange tot gewesen.
«Gesichtsfarbe hochgradig zyanotisch», notierte Fanny mit Blick auf die bläulich schimmernde Haut der Leiche. Ein Hinweis darauf, dass der Mann einen Sauerstoffmangel erlitten hatte, wahrscheinlich sogar erstickt war.
«Warum siehst du trotzdem so friedlich aus?» Fanny tippte sich mit dem Bleistift gegen das Kinn. Sie musste an andere Erstickungsopfer wie den Schneider Brocker denken. Ihre Gesichter, Masken der Qual. Aufgerissene Münder, hervorquellende Augen mit zahlreichen geplatzten Äderchen …
«Oh!» Fanny spürte, wie sie ein kleines bisschen rot wurde. Sie kniff die Augen zusammen. Täuschte sie sich, oder hatte sich dort am Penisansatz etwas be…
Sie streckte die Hand aus, zögerte – dann griff sie doch lieber zu der großen Pinzette und hob damit das Glied des Mannes an. Sie zuckte zurück und ließ die Pinzette fallen.
«Filzläuse!» Sie schüttelte angewidert den Kopf. «Du warst anscheinend ein Lebemann.»
Irgendwie fiel es ihr jetzt schwerer, sich den Toten als anständigen Herrn vorzustellen. Wobei, wer wusste schon, was unter den Frackhosen angeblich sittsamer Männer so alles kreuchte und fleuchte. Filzläuse interessierten sich nicht für die Moral, nur für Blut.
Sie notierte den Befund.
Ansonsten fand sie bei der äußeren Inspektion der Leiche nichts Auffälliges. Keine Blutungen oder Anzeichen von Gewalteinwirkung oder andere Hautabnormalitäten.
Wahrscheinlich einfach ein Herzinfarkt …
Fanny verscheuchte den Gedanken. Ein echter Gerichtsmediziner ließ sein Urteilsvermögen nicht durch Erwartungen trüben.
Sie nahm das Messer zur Hand.
Sie könnte noch abbrechen. Wenn sie ihn wieder anziehen und in den Leichenraum schieben würde, könnte niemand ihr je nachweisen, was sie getan hatte.
Sie zögerte einen Moment, dann rammte sie dem Toten das Messer direkt unter dem Schlüsselbein in die Brust. Ein paar Tropfen Blut quollen aus der Wunde und rannen über seine fahle Haut.
Fanny nahm sich die Sternumschere und drang in die Stichwunde ein. Sie hatte schon so oft zugesehen, wie Franz oder einer der anderen Ärzte den Ypsilon-Schnitt durchführte. Aber es selbst zu tun, war doch etwas ganz anderes. Sie drückte entschlossen die Schere zusammen und spürte das Reißen der Muskelfasern.
Einfach weitermachen, versuchte sie, sich Mut zu machen. Weh tun kannst du ihm nicht mehr.
Sie arbeitete sich vor. Zwei Schnitte entlang der Schlüsselbeine bis zur Körpermitte. Das Knacken des zersplitternden Brustbeins erschien ihr unnatürlich laut. Über dem Bauch ging es wieder einfacher, bis hinunter zum Schambein.
Fanny schnitt die Rippen und die beiden Hälften des Brustbeins heraus, um freie Sicht auf Brust- und Bauchorgane zu haben. Eine Stimme im Hinterkopf drängte sie, sich zu beeilen. Je länger sie brauchte, desto größer wurde die Gefahr, entdeckt zu werden.
Sie seufzte. Wie gern hätte sie in aller Ruhe gearbeitet, so viel gelernt, wie sie konnte, wenn sich schon einmal die Gelegenheit bot. Sie würde das Geschlinge, bestehend aus Magen-Darm-Trakt, Speise- und Luftröhre sowie Kehlkopf und Zunge, im Körper liegend untersuchen. Die anderen Organe würde sie zur Untersuchung entnehmen und genauer ansehen. Ein Kompromiss, der Fanny wurmte, aber in Anbetracht der Umstände musste sie eben improvisieren.
Sie löste die Darmschlingen mit dem Messer aus ihrer Aufhängung, sodass sie sie besser abtasten konnte. Sie eröffnete jeden Abschnitt probehalber, aber der Darm schien weitgehend leer, und die Schleimhaut war frei von Entzündung oder Geschwulsten.
Jetzt der Magen … Im Gegensatz zum Darm schien der Magen mit Flüssigkeit gefüllt.
«Proben», fiel es Fanny siedend heiß ein. Sie legte den Magen zurück, zog sich für einen Moment die blutigen Handschuhe aus und eilte zu den Holzregalen am Rand des Saals zurück. Sie holte sich ein paar mit Korken verschließbare Glasröhrchen sowie eine Metallspritze, mit der sie Flüssigkeiten aufsaugen konnte.
Sie beschloss, mit dem Magen noch ein wenig zu warten. Wenn sie ihn in der Bauchhöhle öffnete – normalerweise ein Tabu –, würde sie alle anderen Organe verdrecken.
So begann sie stattdessen, die anderen Bauchorgane zu begutachten. Milz, Bauchspeicheldrüse, Nieren, alles in Ordnung. Eine etwas vergrößerte Prostata … Fanny achtete darauf, bei der Beurteilung nicht versehentlich sein Gemächt weiter unten zu berühren.
Sie hatte gehofft, die Nieren würden mehr verraten. Wenn ein Organismus an einem plötzlichen Schock zugrunde ging, sahen die Nieren blass und hart aus, aber die Organe dieses Mannes schimmerten rosig.
Die Leber … Fanny ließ ihre Finger über die Oberfläche des Organs gleiten. Es war etwas höckrig, an manchen Stellen verhärtet. Fanny erkannte ein paar gelbliche Einlagerungen im Gewebe.
«Ein Bonvivant in jeder Hinsicht», murmelte sie mit einem Seitenblick auf die Miene des Toten. Sie musterte die Fettleber kritisch. «Aber umgebracht hat dich das nicht.»
Sie setzte sich auf einen Holzstuhl, um ein paar Skizzen der Organe anzufertigen und diese mit Notizen zu versehen.
«Jetzt Lunge und Herz.»
Diese verquere Reihenfolge brachte sie noch ganz durcheinander. Die Lunge, gewiss würde ihr die Lunge etwas verraten.
Doch Fanny wurde einigermaßen enttäuscht. Die Lunge hatte zwar eine rußige Färbung, wie man es bei langjährigen Rauchern fand, aber abgesehen davon war das Atmungsorgan geradezu verblüffend gesund. So auch die Atemwege insgesamt, soweit sie das erkennen konnte. Keinerlei Fremdkörper oder Blut in der Luftröhre und den großen Bronchien. Keine Flüssigkeit, keine Tumore.
Fanny untersuchte die Lungengefäße, ohne einen Stau oder ein manifestes Gerinnsel zu entdecken.
Sie schnalzte mit der Zunge. «Wieso bist du dann so blau?»
Kam es ihr nur so vor oder umspielte ein Lächeln den Mund des Toten?
Sie rief sich zur Ordnung. Es konnte eigentlich nur noch am Herz liegen. Herzinfarktopfer schimmerten auch gern etwas zyanotisch. Fanny trennte das Herz von den großen Blutgefäßen und entnahm es vorsichtig. Sie hatte oft beobachtet, wie Franz die Kammern und Vorhöfe öffnete. Ihr Schnitt war bei weitem nicht so elegant, und sie beschädigte dabei die Aortenklappe. Aber immerhin, sie konnte sehen, was sie sehen musste.
«Kein Infarkt.» Ein gutes Herz für einen Mann mittleren Alters.
Sie nahm sich die Metallspritze und zog etwas Blut aus den großen Gefäßen auf und spritzte es in eines der Glasröhrchen. Nachdem die Körperhöhlen fertig begutachtet waren, konnte sie den Magen öffnen. Ein kurzer Stich. Säuerlicher Geruch stieg ihr in die Nase, als das Organ erschlaffte und sich purpurfarbene Flüssigkeit in die Bauchhöhle ergoss.
Eine furchtbare Sauerei. Das sollte man wirklich nicht innerhalb des Körpers machen, aber Fanny hatte nun einmal keine Wahl. Sie zog eine Spritze des Mageninhalts auf und füllte ihn in ein zweites Röhrchen. Neugierig hielt sie es gegen das flackernde Licht der Glühlampe.
«Rotwein.» Sie verkorkte das Röhrchen und stieß ein frustriertes Knurren aus. «Du bist viel zu gesund, um tot zu sein!», schalt sie die Leiche. Jedenfalls schien diesen Mann auch niemand ermordet zu haben. «Und wieso bist du angezogen wie ein Bettler, wenn du offensichtlich keiner bist?»
Natürlich gab es noch etliche andere Todesursachen, die sie nicht eruieren konnte. Schlaganfall, Hirntumor … die Halsschlagadern, das Gehirn und so vieles mehr – all das entging ihr.
Dabei juckte es sie in den Fingern nachzusehen. Was blieb sonst noch als Möglichkeit? Wenn er erstickt war, vielleicht durch Knebelung oder ein Kissen, hätte er nicht so entspannt ausgesehen. Und vergiftet? Fanny hätte Anzeichen eines Schocks entdeckt, Durchfall, innere Blutungen, abgestorbenes Gewebe, aber nichts deutete darauf hin.
«Das Gehirn …» Fanny hätte sich um ein Haar mit dem blutigen Kautschukhandschuh am Kopf gekratzt. Das Gehirn steuerte die Atmung wie so vieles andere. «Was, wenn etwas deinem Gehirn gesagt hast, dass du nicht mehr atmen sollst?»
Man würde bei der Obduktion nichts finden, gar nichts, es sei denn …
Fannys Blick fiel auf ihre beiden Probenröhrchen.
Ein Geräusch der Tür unten im Foyer ließ sie zusammenzucken. Ein Schlüsselbund klirrte leise, und sie hörte, dass jemand die Treppe heraufkam.
Ein Wimmern drang aus Fannys Kehle. So schnell sie konnte, stopfte sie die Organe zurück in den Körper. Sie packte den Toten an den Armen, stemmte sich mit einem Bein gegen den Tisch und zog ihn zurück auf den Rollwagen.
Die Schritte über die Stufen kamen immer näher.
Licht aus … nein, wenn es der Nachtwächter war, dann war er hergekommen, weil das Licht an war. Wenn sie es ausmachte, würde sie sich verraten.
Das Blut und die Instrumente – dafür blieb keine Zeit. Sollte der Nachtwächter eben glauben, sie hätten nicht aufgeräumt.
Fanny packte die Kleider des Toten und warf sie auf den Rollwagen. Ein leises Klimpern erklang.
Was war das?
Fanny runzelte die Stirn. Etwas war aus den Sachen des Toten gefallen. Etwas Funkelndes. Es lag am Boden in einer Blutlache.
Sie bückte sich nach dem kleinen Metallgegenstand und steckte ihn in die Tasche ihrer Arbeitsschürze.
Sie schob den Toten in Richtung Leichenraum. Die Räder quietschten, sobald sie beschleunigte. Sie betete, dass es über dem Hallen der Stiefelschritte nicht zu hören war.
Dunkelheit und Verwesungsgeruch umfingen sie, sobald sie den Raum erreicht hatte. Sie schloss die Tür hinter sich, gerade als sie hörte, dass jemand den Sektionssaal betrat. Sie nahm eine der Leichendecken und warf sie über den Toten.
Die Geräusche verstummten abrupt. Wer immer es war, er stand nun vor einer flackernden Glühbirne, einem blutverschmierten Sektionstisch und einem Haufen Instrumente, die wahllos über den Tisch verteilt lagen.
Dann hörte sie, wie sich jemand dem Leichenraum näherte. Panik stieg in ihr auf. Sie würde nie wieder eine Anstellung finden, wenn …
Sie packte sich eine zweite Decke, legte sich in eine der für die Toten gedachten Nischen und warf sie sich über.
Für einen Moment geschah gar nichts, dann öffnete sich die Tür mit einem leisen Knarzen. Durch den Stoff der Decke erkannte Fanny fahlen Lichtschein und die Umrisse einer Gestalt. Sie hielt den Atem an und machte sich steif wie ein Brett.
Kehr um, bitte kehr wieder um!
Stattdessen trat der Schemen ein paar Schritte in den Raum hinein. Geradeso, als wüsste er, dass jemand sich hier versteckte.
Da er nicht mehr im Licht stand, konnte Fanny nicht sehen, wohin er ging, aber im nächsten Moment hörte sie ein Rascheln. Der Eindringling musste die Decke von einer der Leichen gezogen haben.
Fanny wurde es ganz anders. Mit ihr lagen drei Körper im Leichenraum, Schneider Brocker, der Obdachlose und sie selbst. Ene mene muh und raus bist du! Die Chancen standen fünfzig zu fünfzig, dass ihre Decke als Nächstes zurückgeschlagen werden würde.
Stattdessen hörte sie ein leises Zischen. Dann Geräusche, die an das Rascheln von Kleidung erinnerten.
Was geschah hier bloß?
Für eine Weile war es wieder still. Dann ein tiefes Seufzen. Das Klackern von Stiefelabsätzen auf dem Fliesenboden. Fanny sah die Umrisse der Gestalt kurz im Licht des Eingangs auftauchen, dann wurde die Tür wieder geschlossen.
Sie wartete, bis sie keinen Laut mehr vernahm, erst dann wagte sie, Luft zu holen und die Leichendecke zurückzuschlagen.
Was sollte das denn? Trieb sich der Nachtwächter öfter bei den Toten herum oder hatte er nur den Verdacht gehabt, dass sich hier jemand versteckte? In der Dunkelheit konnte sie nur Schemen erkennen, aber die Decken schienen säuberlich über die beiden Toten gebreitet.
Fanny wartete noch ein wenig, bis sie sich zurück in den Sektionssaal wagte. Über dem Waschbecken an der Wand hing ein Spiegel. Sie verdrehte die Augen. Der Nachteil an hellrotem Haar war, dass man Gewebestückchen leicht darin übersehen konnte. Sie zupfte sich ein Stückchen Lunge aus der Frisur und schnippte es in das Waschbecken.
Moment, wieso sah sie ihr Spiegelbild eigentlich? Sollte es nicht dunkel sein? War der Nachtwächter hergekommen und hatte die Lampe über ihrem Sektionstisch brennen lassen?
Fanny stützte sich an dem Waschbecken ab. Sie würde den Toten zunähen, ihn wieder anziehen und dann den Sektionssaal so rasch wie möglich säubern.
Sie war nicht sicher, was sie empfinden sollte. Während der Obduktion hatte sie sich so in ihrem Element gefühlt, dass sie alles um sich herum vergessen hatte. Dennoch hatte sie nicht herausgefunden, woran der Mann wirklich gestorben war.
Bestimmt hatte sie es nicht gut genug gemacht, bestimmt hatte sie etwas übersehen, das jedem anderen Mediziner aufgefallen wäre. Vielleicht hatte Professor Kuderna recht, und es fehlten ihr einfach die Voraussetzungen. Sie hatte das schon so oft gehört, von ihren Verwandten, während des Studiums, hier am Institut …
Gott, manchmal wünschte sie sich wirklich, sie könnte dasselbe Tonikum wie Franz’ Großmutter bekommen. Ein Schlückchen und glücklich. Es würde einem viel ersparen, man wäre zufrieden, selbst wenn …
Ein Schlückchen und … Fanny kam eine Idee. Sie lief hinaus und bog in einen kleinen Raum neben der Damenumkleide ab. Die Bibliothek, über die sie verfügten, mochte mit anderen medizinischen Sammlungen nicht mithalten können, aber hier ruhten ein paar wirkliche Schätze.
«Forensische Chemie», flüsterte Fanny und griff nach einem grün eingebundenen Buch, dessen Titel in Goldlettern geprägt war. Zurück im Sektionssaal, begann sie hastig darin zu blättern. Schließlich blieb ihr Zeigefinger an einer Überschrift hängen, unter der sich ein paar Abbildungen befanden.
Marquis-Reaktion.
«Ein Teil Formalin, zwanzig Teile Schwefelsäure …» Fanny sah auf. «Das hab ich, das hab ich!»
Sie holte einen Erlenmeyerkolben aus dem Holzregal und eine Flasche Formalin. Diese Lösung benutzten sie am Institut ständig, um Organteile, die man noch weiter untersuchen wollte, vor der Verwesung zu schützen. Der stechende Geruch war ihr so vertraut, dass sie ihn manchmal beinahe vermisste, wenn sie ihn länger nicht roch. Was die Schwefelsäure anbelangte, so hatte Fanny noch nie erlebt, dass jemand sie eingesetzt hätte. Beim Sortieren der Instrumente und Chemikalien hatte sie jedoch eine kleine, etwas verstaubte Flasche mit der ätzenden Säure entdeckt, die sie am Institut aufbewahrten, um gewisse Arten der Gewebedegeneration nachzuweisen.
Aus dem letzten Winkel des obersten Regalfachs holte Fanny das Fläschchen hervor. Sie goss die beiden Substanzen im angegebenen Verhältnis in den Kolben und schwenkte das farblose Gemisch eine Weile. Dann holte sie ihre Probenröhrchen hervor. Das Blut war gerade noch flüssig.
Mit zitternden Fingern ließ sie ein wenig Blut in das Reagenzglas tropfen. Sofort bildeten sich in der klaren Flüssigkeit dunkelviolette Schlieren.
«Ha!», rief sie und biss sich sofort auf die Lippen, weil ihr Jubelschrei durch das ganze Gebäude zu hallen schien.
Fasziniert schwenkte sie den Kolben und beobachtete, wie die gesamte Flüssigkeit eine violette Färbung annahm.
Sie wiederholte das Experiment in einem zweiten Erlenmeyerkolben und gab diesmal etwas vom Mageninhalt des Toten dazu. Die Reaktion fiel noch viel heftiger aus. Wenige Tropfen färbten das ganze Gemisch sofort dunkelviolett.
Sie wandte sich um und sah Richtung Leichenraum. Morphin …
Deshalb gab es kaum Anzeichen eines Todeskampfs! In zu hohen Dosen führt Morphin zum Aussetzen der Atmung, Erschlaffung der Muskeln, Bewusstseinstrübung … und irgendwann … zum Tod.
«Jemand hat es dir in den Wein gemischt.» Fannys Blick wanderte zu der Leiche. «Und zwar in rauen Mengen.»
Die Freude darüber, hinter das Geheimnis des Toten gekommen zu sein, wich einer vagen Furcht. Entweder hatte er sich das selbst angetan, oder …
«Jemand hat dich ermordet!», flüsterte sie. Fanny fasste in ihre Tasche, holte den Metallgegenstand hervor, der aus seiner Kleidung gepurzelt war, und wischte ihn mit dem Zipfel ihrer Schürze sauber. Eine kaum fingerlange Statuette von Johann Strauss kam zum Vorschein. Wenn sie sich nicht täuschte, dann bestand das Abbild des Walzerkönigs aus purem Gold. In das Loch zwischen seinen Armen und der filigranen Violine, die er zu spielen schien, war ein eingerollter Zettel geklemmt. Fanny entrollte ihn, obwohl er am oberen Ende mit Blut vollgesogen war.
Jemand hatte etwas darauf geschrieben.
9. März, um sieben. Stock im Eisen. Meisterstück des Teufels, Palais Equitable.
Das war diesen Sonntag, also übermorgen … Fannys Hand begann vor Aufregung zu zittern. Was sollte sie jetzt tun?
3. Kapitel
Der Walzerkönig
«G… g…» Fannys Vater atmete tief durch. «Gut geschlafen?»
Sie fasste seine Hand und drückte sie. «Schön gesagt, Papa! Und: natürlich.» Sie küsste ihn auf die Wange.
Es war Samstagmorgen, und unten auf der Josefstädter Straße herrschte schon hektische Betriebsamkeit. Durch die Fenster ihrer Mezzaninwohnung konnten sie das Wiehern von Pferden hören und das Rattern einer elektrischen Tram. Diese Straßenbahnen hatten vor einigen Jahren die Pferdetrams abgelöst und Wien davor bewahrt, in Pferdeäpfeln zu ersticken. Die Stadt wuchs mit jedem Tag und zählte bereits über zwei Millionen Einwohner. In ein paar hundert Metern Entfernung, am Gürtel, hatten sie gerade eine Hochtrasse für eine Stadtbahn gebaut, deren Stationsgebäude in leuchtendem Weiß erstrahlten. So viele wundersam modern aussehende Gebäude schossen an allen Ecken und Enden aus dem Boden. Verspielte Fassaden, klare Linien aus Gold, die sie verzierten … Fanny wunderte sich manchmal, dass die Modernität, die überall erblühte, nicht im selben Ausmaß Eingang in die Köpfe der Menschen fand.
Sie ging in die Küche und stellte den frisch gebrauten Kaffee, Kaisersemmeln, Butter und Marillenmarmelade auf ein Tablett. Sie trug es in den Salon, wo sie bereits aufgedeckt hatte. Es war kein besonders großer Raum, aber gemütlich, wie Fanny fand. Auf der grün-gold gestreiften Tapete hingen ein paar liebliche Landschaftsbilder und ein Porträt von Fannys Mutter in einem weißen Spitzenkleid. Es schien, als würde sie milde lächelnd auf den Esstisch hinabsehen.
Bis auf das Ticken der Wanduhr war es still. Fanny setzte sich an den Tisch.
«Kaffee, Papa?»
Er nickte dankbar, während Fanny ihm einschenkte, und schlug das Buch zu, in dem er gerade gelesen hatte. Fanny goss sich selbst eine Tasse ein.
«Was liest du denn?» Sie beugte sich neugierig über den Tisch und schnappte sich das Buch. «Der Reigen, von Arthur Schnitzler. Worum geht’s da?»
Ihr Vater wurde mit einem Mal rot und forderte das Buch mit einer vehementen Handbewegung zurück. Fanny reichte es ihm stirnrunzelnd, woraufhin er es in der Tasche seines Jacketts verschwinden ließ.
«Weißt du, wenn man ein Geheimnis bewahren will, dann darf man nicht so tun, als handle es sich um etwas Interessantes», bemerkte Fanny lächelnd. «Das hast du mir beigebracht. Im Übrigen hab ich gehört, das Stück wäre etwas», sie kicherte, «verrucht.»
«Pff!»
«Kein Grund, böse zu sein.»
Fanny schnitt ihre Semmel auf und bestrich sie mit Butter.
Ihr Vater rührte in seinem Kaffee und wollte ein Löffelchen davon nehmen. Seine Hand erstarrte über der Porzellantasse, auf die ein filigran gezeichneter Gimpel gemalt war. Der Löffel lag verkehrt in seinen Fingern.
Fanny wollte gerade in ihre Semmel beißen, als sie es bemerkte.
«Oh, Papa!» Sie stand auf und eilte zu ihm hinüber.
Sanft umfasste sie seinen verkrampften Unterarm und drehte den Löffel in seiner Hand.
«So rum!», flüsterte sie sanft.
Ihr Vater legte den Löffel hastig ab und starrte sie aus feuchten Augen an.
Fanny presste die Lippen zusammen, um ihre eigenen Tränen zurückzudrängen. «Das wird schon wieder», sagte sie mit einem Lächeln. «Wir schaffen das!»
Er packte ihre Hand und drückte sie fest.
«Wir schaffen das», wiederholte sie leise.
Die Glocke an der Eingangstür läutete.
Fanny löste ihre Hand aus seinem Griff. «Ich wusste gar nicht, dass wir Besuch erwarten?»
Ihr Vater schien ein Stückchen in seinem Stuhl zu versinken und wich ihrem Blick aus.
«Oh, bitte nicht sie!», stöhnte Fanny. «Du hättest mich vorwarnen können, dann wäre ich …»
Das Läuten wiederholte sich.
«Himmel», wisperte Fanny, strich sich ihr dunkelblaues Kleid zurecht, lief durch den schmalen Flur zur Tür und öffnete sie. «Grüß dich, liebe Tan…»
Die korpulente Frauengestalt hatte Fanny schon zur Seite geschoben und trat in die Wohnung.
«Hier drinnen ist es aber frisch!», erklärte Fannys Tante, während sie Fanny ihren Pelzmantel und ihren Federhut in die Hand drückte. «Heizt du nicht?»
Fanny beeilte sich, Mantel und Hut auf die Messinghaken der Garderobe zu hängen, dann trat sie zu ihrer Tante und gab ihr einen Kuss auf die Wange.
«Grüß dich, Tante Agathe. Natürlich, aber die Wärme vom Ofen reicht kaum bis in den Flur.»
Ihre Tante schien sie gar nicht zu hören, sondern betrachtete Fannys Gesicht prüfend. Sie war nicht größer, aber bestimmt doppelt so dick wie Fanny. Ihre schwarzen Locken saßen auf ihrem Haupt wie eine Krone.
Sie musterte ihre Nichte. «Du bist ganz fahl. Du solltest endlich aufhören zu arbeiten.»
Fanny lief rot an. «Papa wird sich freuen, dich zu sehen», brachte sie hervor.
Ihre Tante war schon dabei, in den Salon zu watscheln.
«Ich habe dir eine Einladung zum Jungdamenkränzchen des jüdischen Kulturvereins zukommen lassen, die musst du wohl verlegt haben», sagte sie, ohne sich zu Fanny umzudrehen. «Leopold!», rief sie dann und breitete die Arme aus, als sie Fannys Vater erblickte. Sofort war sie über ihm und drückte ihm einen Schmatzer auf die Wange. «Mein lieber Bruder. Wie geht es dir?»
Fannys Vater zuckte ob der übertriebenen Lautstärke zusammen.
«Weißt du, er hört wirklich …»
«Ich weiß genau, was er braucht, gell, Poiderl?» Tante Agathe drückte seine Schulter und ließ sich dann mit einem Seufzen auf Fannys Platz nieder, wobei ihr weinrotes Seidenkleid über den Stuhl wogte.
«Möchtest du einen Kaffee?», fragte Fanny.
«Natürlich, Liebes!»
Fanny trollte sich in die Küche, um ein neues Gedeck zu holen. Als sie durch die Tür linste, sah sie, wie ihre Tante eine frische Semmel auf Fannys Teller legte.
«Bekommst du denn auch genug zu essen?», fragte sie ihren Bruder, überlaut und extra langsam. «Du siehst viel zu dünn aus!»
Fanny schüttelte lächelnd den Kopf, nahm noch eine Tasse von dem Porzellanservice aus dem Geschirrschrank und brachte sie ihrer Tante.
«Übrigens …» Tante Agathe zupfte an Fannys Ärmel. Etwas Marillenmarmelade klebte in ihrem Mundwinkel. «Ich habe meine liebe Schwägerin Amalie besucht, sie lässt dich grüßen.» Sie löffelte sich Schlagobers in den Kaffee, bevor Fanny ihr fertig eingeschenkt hatte. «Ich musste ihr einfach von der Begegnung mit ihrem Sohn in der Stadt erzählen.»
«Du hast Schlomo getroffen?», fragte Fanny neugierig. Sie hatte seit Jahren nichts mehr von ihrem Cousin gehört.
«Schlomo?» Fannys Tante schnalzte mit der Zunge. «Als ob er sich noch so nennen würde … Er arbeitet jetzt als Maskenbildner am Burgtheater, und dort kennt man ihn nur unter dem Namen … François. Amalie und unser Bruder Frederik schämen sich zu Tode!» Sie sah Fanny an und schien auf einen Sturm der Entrüstung zu warten. «Eine Schande, nicht wahr, Leopold?»
«Hmh», brummte Fannys Vater.
Fanny räusperte sich. «Das stelle ich mir sehr aufregend vor, und es gibt kein Theater mit mehr Renommee. Und … seine neue Aufgabe passt zu ihm, wenn ich mich recht erinnere.»
Als kleines Mädchen war sie mit ihrer Mutter ein paarmal bei Tante Amalie zu Besuch gewesen. Während die Schwägerinnen Kaffee getrunken und geplaudert hatten, hatte Fanny mit ihrem Cousin in dessen Zimmer gespielt. Nach etwa zwei Stunden hatte ihre Mutter nach ihr gesehen. Schlomo hatte ihr Fanny stolz präsentiert, mit Tonnen von Tante Amalies Schminke im Gesicht. Ihr Haar hatte er mit Hilfe von Pomade zu einem seltsamen Stachel geformt, sodass Fanny an ein grellbuntes Einhorn erinnert hatte.
«Jetzt ist sie Kunst!», hatte ihr Schlomo voller Stolz verkündet. Fannys Mutter hatte gelacht und sogar applaudiert.
Tante Amalie war weniger begeistert gewesen.
Später war Fanny Onkel und Tante ab und zu bei Festen begegnet, Schlomo jedoch nie. Ob er nicht kommen wollte oder nicht eingeladen war, wusste sie nicht. Sie hatte sich schon öfter gefragt, was aus ihrem Cousin geworden war.
«Wie geht es ihm?», fragte Fanny.
Ihre Tante beugte sich über den Tisch und senkte ihre Stimme zu einem Flüstern. «Sein Mantel war violett!» Sie lehnte sich wieder zurück, als wäre das Antwort genug. «Was soll’s, wie geht es dir, Fanny. Was gibt es Neues?»
«Am Institut ist viel zu tun. Gestern habe ich …»
«Papperlapapp, ich meine doch nicht diese Leichenklinik. Ich meine, sonst …»
«Sonst», wiederholte Fanny gedehnt. «Später treffe ich mich mit Tilde Waring zum Tee.»
«Ausgerechnet! Dieses Mädel ist nicht ganz bei sich – es wundert mich, dass sie noch nicht überfahren wurde!»
«Tante!»
«Fanny, Kind, kannst du mir nicht den Gefallen tun, dich manchmal auch mit normalen Menschen zu umgeben?»
Vorsichtig stellte Fanny ihre Kaffeetasse ab. «Du meinst, damit sie mich normaler machen», erwiderte sie leise.
Ihre Tante wischte sich das Schlagobers von den Lippen. «Du bist fünfundzwanzig, Fanny!» Sie hob ihren Zeigefinger. «Das ist schon nicht mehr Gold, sondern nur noch Silber, und Bronze steht vor der Tür.»
Fannys Vater hustete, aber sie hätte schwören können, dass es ein verkapptes Lachen war.
«Und was kommt nach Bronze?», fragte sie.
Ihre Tante starrte sie mit todernster Miene an, dann lehnte sie sich zurück und wies auf ihre überbordenden Rundungen. «Das!», erklärte sie mit Grabesstimme.
Fanny unterdrückte ein Kichern.
«Das ist nicht komisch! Ich habe deiner Mama versprochen, dass ich ein Auge auf euch beide haben werde, sollte ihr etwas passieren. Und was ich sehe, ist nicht in ihrem Sinne.»
«Aber woher …»
Tante Agathe zeigte auf Fannys Vater. «Siehst du nicht, wie es deinem Papa geht?» Fanny schwieg. «Du arbeitest Tag und Nacht für einen Hungerlohn, während er deine Unterstützung braucht.»
«Wir kommen zurecht», wisperte Fanny.
«Die Zeit, egoistisch zu sein, ist vorbei, Kind. Heirate einen guten Kerl, der dich versorgen kann, und kümmere dich um deinen Vater!»
«Ich bin nun einmal Medizinerin, Tante Agathe!»
Die Augenbrauen der Tante hoben sich. «Ah ja? Mir scheint eher, du spielst den Lakaien für die richtigen Mediziner. Aber um deinen Papa zu pflegen, dafür bist du dir zu gut.»
Fanny erhob sich. «Entschuldigt mich. Ich will Tilde nicht warten lassen.» Ihr Vater griff nach ihrem Arm, als sie vorbeistürmte, aber sie wich ihm aus.
Fanny war so aufgewühlt, dass sie beschloss, zu Fuß in den Stadtpark zu gehen, wo sie mit Tilde verabredet war. Sie schlang ihren braunen Mantel eng um sich. Die Sonne schien, trotzdem war es noch empfindlich kalt. Vom bevorstehenden Frühlingsbeginn hatte das Wetter offenbar noch nichts gehört.
Sie hat nicht recht. Uns geht es gut. Papa und mir.
Sie beschleunigte ihren Schritt, während sie den Donaukanal überquerte und auf die Uferpromenade einbog. Das Wasser glitzerte, und ein eisiger Wind ließ Fanny ihren Hut ein wenig tiefer ins Gesicht ziehen.
Jeder behandelte sie wie eine Rebellin, dabei war sie das genaue Gegenteil. Sie war ein ruhiges Kind gewesen. Ihre Lehrer hatten sie für ihren stillen Fleiß gelobt. Sie hatte sich bemüht, immer und zu jedem höflich zu sein, wurde niemals laut, kleidete sich schlicht und schicklich.
Wenn sie ehrlich war, hatte ihr immer davor gegraut anzuecken, den Erwartungen nicht zu entsprechen. Doch dann hatte sie etwas aus ihrer Sicht völlig Normales gemacht: Sie war ihrer Leidenschaft gefolgt und hatte sich zum Medizinstudium eingeschrieben. Natürlich hatte sie gewusst, dass es für junge Frauen nicht unbedingt üblich war zu studieren. Aber immerhin lebten sie im zwanzigsten Jahrhundert, einer modernen Zeit, in der alles möglich zu sein schien. Hatte sie damals zumindest gedacht.
Sie erinnerte sich an den Tag ihrer Inskription. Tante Agathe hatte sie angesehen, als hätte Fanny ein Attentat auf Kaiser Franz Joseph verübt.
Und ihre Kommilitonen! Die hatten sie gemieden wie einen exotischen Virus, von dem man fürchtete, dass sich die eigenen Frauen damit anstecken könnten.
Auf noch mehr Unverständnis war sie gestoßen, als sie ihrer Familie schonend beigebracht hatte, dass sie gar nicht im Sinn hatte, Patienten zu behandeln. Dass ihre Faszination der Pathologie galt, der Suche nach dem Ursprung aller Krankheiten, und einer neuen Disziplin, in der man ebenfalls Tote aufschnitt, der Gerichtsmedizin.
Nein, Fanny war nie eine Rebellin gewesen. Aber so ziemlich alles, was ihrem Wesen entsprach, war offenbar dazu angetan, ihr Umfeld zu provozieren, egal, wie sehr sie sich bemühte, unauffällig zu wirken.