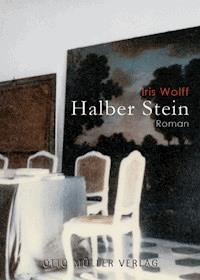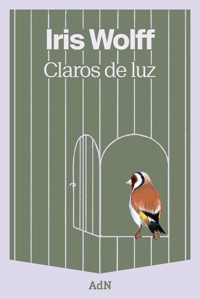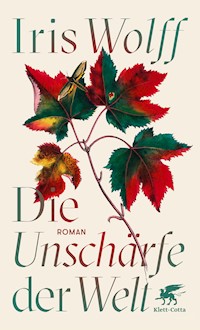
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Eine Autorin mit einem traumsicheren Sprachgefühl« Denis Scheck Iris Wolff erzählt die bewegte Geschichte einer Familie aus dem Banat, deren Bande so eng geknüpft sind, dass sie selbst über Grenzen hinweg nicht zerreißen. Ein Roman über Menschen aus vier Generationen, der auf berückend poetische Weise Verlust und Neuanfang miteinander in Beziehung setzt. Hätten Florentine und Hannes den beiden jungen Reisenden auch dann ihre Tür geöffnet, wenn sie geahnt hätten, welche Rolle der Besuch aus der DDR im Leben der Banater Familie noch spielen wird? Hätte Samuel seinem besten Freund Oz auch dann rückhaltlos beigestanden, wenn er das Ausmaß seiner Entscheidung überblickt hätte? In »Die Unschärfe der Welt« verbinden sich die Lebenswege von sieben Personen, sieben Wahlverwandten, die sich trotz Schicksalsschlägen und räumlichen Distanzen unaufhörlich aufeinander zubewegen. So entsteht vor dem Hintergrund des zusammenbrechenden Ostblocks und der wechselvollen Geschichte des 20. Jahrhunderts ein großer Roman über Freundschaft und das, was wir bereit sind, für das Glück eines anderen aufzugeben. Kunstvoll und höchst präzise lotet Iris Wolff die Möglichkeiten und Grenzen von Sprache und Erinnerung aus – und von jenen Bildern, die sich andere von uns machen. »So schön hat noch niemand Geschichte zum Schweben gebracht.« Stefan Kister, Stuttgarter Zeitung »Iris Wolff erzählt aus einer tiefen Ruhe heraus. Sie weitet dadurch die Zeit. Für ein Jahrhundert und etliche Menschenleben braucht sie nicht einmal zweihundert Seiten. Und nichts fehlt.« Carsten Hueck, SWR2
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Iris Wolff
Die Unschärfeder Welt
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Das vorliegende Werk wurde durch ein Stipendium des Förderkreises deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg gefördert.
Das dem Text vorangestellte Gedicht von Richard Wagner wird mit freundlicher Genehmigung des Aufbau Verlages abgedruckt. Richard Wagner: »Gold. Gedichte«, Berlin 2017.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2020, 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: Favoritbüro München
unter Verwendung © Florilegius / Bridgeman Images
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von Druckerei C.H.Beck, Nördlingen
ISBN 978-3-608-98486-6
E-Book ISBN 978-3-608-12000-4
Für Andreas
Ich sah
den Stein schmelzen
und die Liebe gehen
ruft der Vogel
aus dem Baum
Wir sagen:
Er singt
– Richard Wagner –
Zăpadă
Lass mir das Kind.
Florentine dachte diesen Satz nicht, sie sprach ihn nicht aus. Sie überließ sich ihm. Er hatte sich ihr eingeschrieben, begleitete sie. Zunächst auf dem Pferdewagen, dann im Zug nach Arad, wo sie am Bahnhof ein Taxi zum Krankenhaus nahm. Lass mir das Kind, bitte. Der Satz tönte im Schnee, flog auf wie die Flocken am Straßenrand, rollte mit ihr auf den Schienen dahin, monoton, stoßweise. Ein dünnes, hohes Pfeifen klang wie eine Mahnung darin an. Im Taxi wurde der Satz knotig und fest, er saß ihr in der Speiseröhre, er saß ihr im Magen, in den Fäusten, im Mund. Lass, bitte.
Es schneite seit einer Woche. Zuerst kleine, unschuldig anmutende Flocken, die den Hof sprenkelten wie den Rücken eines Tieres. Sie bedeckten die Dächer der Häuser, nur am Kirchturm rutschten sie zunächst ab. Jede Flocke ein wie im Überfluss entworfenes Einzelstück, ausgeschickt, damit alles verschwand: umliegende Dörfer, Äcker, die Hügel am Horizont, schließlich der Horizont selbst. Hannes hatte aufgegeben, den Schnee im Hof zu schippen, sich darauf beschränkt, den Zugang zur Straße und den Weg zum nächsten Haus freizuhalten. Er ging dreimal täglich hinaus und nahm in Kauf, dass die Schneeberge zu beiden Seiten meterhoch anwuchsen.
Durch diese Hohlwege hatte er Florentine am Vormittag begleitet, aus dem Hof, über die Straße, an der Kirche vorbei. Ein einzelner Wagen stand an der Hauptstraße. Auf dem Kutschbock ein Mann in Pelzmantel und -mütze, eingesunken, als würde er schlafen. Florentine und Hannes tauschten einen Blick. Sie nickte. Als sie sich ihm näherten, richtete sich der Mann auf. Er stieg auf die Ladefläche, öffnete mehrere Holzfässer und pries, was sich darin befand. In einem Fass zeigten die Fischleiber alle in eine Richtung, die Bäuche silbrig, die Rücken grauschwarz, als wären sie ein Schwarm im Meer, bereit, in jedem Augenblick die Richtung zu wechseln. In einem anderen Fass waren sie sternförmig ausgerichtet, der Schwanz zur Mitte, der Kopf nach außen, Dutzende von Köpfen, Kiemen, Augen.
Hannes sagte, worum es ging, steckte dem Mann Geld zu, kaufte ihm schließlich sogar Fisch ab, damit er losfuhr. Der Fisch sollte im Müll landen. Florentine würde nach dieser Fahrt nie wieder gesalzenen Hering essen.
Der Mann gab dem Pferd die Peitsche. Hannes ging einige Schritte mit, als wollte er dem Wagen folgen. Florentine blickte zurück, bis er nach einer Wegbiegung nicht mehr zu sehen war. Kurz darauf war auch das Dorf verschwunden. Die Schlittenkufen glitten über den Schnee, das Geschirr knarrte, ein Glöckchen klingelte, hell, unablässig, und wenn sie ihren Unterleib berührte, meinte Florentine einen Ton zu hören, als bräche Glas entzwei. Jede Wegbiegung war eine Wiederkehr der vorangegangenen, jede Baumgruppe eine Wiederholung der anderen. Es gab keine Farben, keine festen Umrisse, nur das Dahingleiten des Wagens, den hellen Glockenton und den Geruch von gesalzenem Fisch. Auf offener Landstraße, wo weder Bäume noch Häuser den Wind bremsten, sah sie vor sich, wie der Schlitten vom Weg abkam. Fässer und Fische kippten, eine große Hand streute sie gleichgültig über den Schnee aus – ein grauschwarzes Muster im fortgesetzten Weiß.
Der Kutscher schwieg. Florentine bemerkte, dass er sie von der Seite musterte, längst zur Kenntnis genommen hatte, wie sie die Hände vor dem Bauch kreuzte und sich abstützte, wenn sie über holprige Stellen fuhren. Er lenkte das Pferd mitten auf die Straße, drosselte das Tempo in den Kurven – er hatte verstanden, worum es ging. Seine Augen zwischen Mantel und Fellmütze waren das Einzige, was sie sehen konnte. Weder sein Alter war zu bestimmen, noch ob sein Gesicht schön war oder ob es etwas von der Grobheit seiner Hände hatte. Florentine war ihm dankbar. Er kannte sich auf den Straßen aus, konnte sich an spärlichen Markierungen orientieren, an Sträuchern und Bäumen, die für sie bedeutungslos waren. Er wusste, an welchem Baum er abbiegen musste, wich aus, wenn sich Hindernisse andeuteten, die sie viel zu spät wahrnahm. Wahrscheinlich war er seit Jahren auf diesen Straßen unterwegs, sommers wie winters, mit gesalzenem Fisch, der ihm und seiner Familie den Lebensunterhalt sicherte.
Ausgerechnet ein Rumäne, würde ihr Vater sagen. Aber in diesem Augenblick war ihr der Mann näher als jeder andere Mensch.
Der Schnee hatte eine Helligkeit ausgesetzt, die Florentine über die Zeit schreckhaft gemacht, sie in den letzten Tagen unruhig von einem Zimmer des Hauses ins andere getrieben hatte – Zimmer, die ihr noch nicht vertraut waren. Es war, als beobachteten sie die Räume, als würden ihnen selbst geflüsterte Worte und kleine Gesten nicht entgehen, als hätte sich das Haus längst ein Bild von ihnen gemacht: eine Frau mit sommersprossiger Haut, dünn, fast schlaksig, in Schlaghosen und besticktem Leibchen. Ein Mann mit dunklem Vollbart und halblangen Haaren, der Fußball und Gitarre spielte und an die westliche Außengrenze des Landes entsandt worden war, um seine erste Pfarrstelle anzutreten. Ein Paar Mitte zwanzig, das die Abende beim Kartenspiel verbrachte. Das dem Haus mit seinen vielen Zimmern, dem Garten mit den Weinstöcken, Quitten-, Pfirsich- und Birnbäumen prüfend begegnete, ebenso wie die Dorfbewohner ihnen. Florentine war in der Stadt aufgewachsen und hatte nicht gewusst, was ein Leben auf dem Land mit sich brachte, was es ihr abverlangen würde – aber sie wollte alles daran setzen, dass dieses Experiment gelang.
Am gestrigen Nachmittag waren Jugendliche des Christkindspiels von Haus zu Haus gegangen. Alles geschah lautlos. Seit der Schnee fiel, gab es kein sich öffnendes oder schließendes Hoftor, Türenschlagen, Kinderschreien, keine Rufe über Höfe hinweg. Der Schnee hatte die Geräusche in die Häuser verbannt, selbst das Bellen der Hunde war abhandengekommen, das sich mehrmals am Tag, und jede einzelne Nacht, von einem Hund ausgehend fortsetzte, bis das Heulen das ganze Dorf erfasste. Es hörte immer von einem auf den anderen Augenblick auf, setzte eine Stille aus, die tiefer war als zuvor. Wenn Florentine etwas hätte benennen sollen, das ihr neues Leben ausmachte, so wäre es diese Stille.
Florentine hatte den Weg der Jugendlichen vom Küchenfenster aus verfolgt. Sechs in weiße Gewänder gehüllte Gestalten, zwischen den Schneebergen fast nicht zu bestimmen: Josef, Maria mit Brautschmuck, zwei Engel mit Zepter und Schwert, Ochs und Esel mit fratzenhaften Gesichtern und langen Hörnern. Als der zweite Engel Maria in den Flur des Pfarrhauses rief, hatte Florentine etwas Heißes zwischen ihren Beinen gespürt. Sie zog im Bad die Hose hinunter, Blut tropfte über ihre Schenkel auf den Kachelboden. Die Hebamme gab ihr ein blutstillendes Mittel. Als die Blutung am Morgen wiederkam, war Florentine kurzentschlossen aufgebrochen. Sie wollte ins Krankenhaus, auch wenn das Dorf durch den Schneefall vom Zugverkehr abgeschnitten war.
Auf der Fahrt zur Bahnstation dachte sie an das, was Hannes im heutigen Weihnachtsgottesdienst sagen würde: Unbesiegbar sei, wer nicht gewinnen wolle, seinen Willen dem Gottes anheim gab. Florentine war an diesem Tag nicht unbesiegbar. Sie kreuzte die Arme vor dem Bauch, presste die Oberschenkel zusammen und schloss die Augen. Aber sie fand keine Dunkelheit, nur anhaltendes Weiß.
Der Fischverkäufer wartete, bis der Zug kam. Erst später fiel ihr auf, dass sie den ganzen Weg kein Wort miteinander gewechselt hatten. Als der Zug sich in Bewegung setzte, wischte sie ein Guckloch in die beschlagene Fensterscheibe. Er stand am Bahngleis, die Hände in den Manteltaschen, das Gesicht von Mütze und Kragen verhüllt. Sie nickte ihm zu und glaubte, dass auch er nickte, vielleicht aber auch nur die Hand hob; sie konnte sich, schon als der Zug den Bahnhof hinter sich gelassen hatte, nicht mehr daran erinnern.
Auch jemand, dachte sie, der der einzige Mensch auf der Welt für einen gewesen war, kann verschwinden, als hätte es ihn nie gegeben.
Florentine konnte den Arzt am Fußende des Bettes zwischen den Klagen, dem Bitten und Weinen der anderen Frauen kaum verstehen.
Hatte er tatsächlich gefragt, was sie genommen hatte?
Der Arzt hatte einen kahlen Kopf und sehnige Hände, die er nur aus den Kitteltaschen zog, um sich die Nase zu putzen. Untersucht hatte sie bislang niemand.
»Nichts, ich habe nichts genommen. Ich bin hier, damit Sie das Kind retten.«
Florentine machte Anstalten aufzustehen. Eine Schwester, die neben ihrem Bett stand, drückte sie wieder zurück. Dann bequemte sich der Arzt, sie abzutasten. Er legte den Kopf auf ihren Bauch. Sie spürte sein großes, kaltes Ohr. Irgendetwas wurde gesagt, notiert, sie konnte es nicht verstehen. Der Arzt ging, ohne die anderen Frauen zu beachten. Die Schwester reichte ihr eine bläuliche Pille. Florentine betrachtete sie misstrauisch, schluckte sie. Dann, endlich, Dunkelheit.
Als sie erwachte, war vor den Fenstern Nacht. Sie legte ihre Hände auf den Bauch, wie sie es die letzten sechs Monate getan hatte, flach, die Finger gespreizt. Wie merkwürdig es auch klang, sie sah das Kind, konnte seine Umrisse spüren. Nach ihren inneren Vermessungen war sie beruhigt. Sie setzte die Füße auf den Boden und stand, da sie ihre Schuhe nicht fand, widerwillig barfuß auf. Im Nebenbett lag ein Mädchen, kaum älter als fünfzehn Jahre; eine Siebenbürgerin, wie am Nachthemd zu erkennen war. Sie hatte die Augen zur Decke gerichtet, rührte sich nicht. Neben ihr lag eine Rumänin, murmelte etwas vor sich hin, das wie ein Gedicht klang, vielleicht auch ein Gebet. Eine Frau, eigentlich zu alt für eine Schwangerschaft, saß auf der Bettkante, hielt sich den Bauch und schaukelte vor und zurück. Jemand weinte, andere unterhielten sich. Dann spürte sie ein warmes, warnendes Prickeln im Nacken. Eine Frau fixierte sie vom Fenster her, als wollte sie sagen: Hör auf, die anderen anzustarren. Florentine spürte, wie etwas in ihr wegsackte. Die Luft war stickig. Das Stimmengewirr wurde leiser, verklang fast und setzte sich doch immer weiter fort. Ihr kam der Gedanke, dass sie vorsätzlich alle in einem Zimmer untergebracht worden waren. Es entband die Ärzte davon, sie als einzelne Menschen zu sehen, und es war leichter, vom Fußende des Bettes zu urteilen und zu richten.
Sie ging den hell erleuchteten Gang entlang. Niemand war zu sehen. Schließlich fand sie etwas, das sie für eine Toilette hielt. Sie trat ein, lehnte sich an die Tür und schloss die Augen. Dann nahm sie den Gestank wahr. Es gab keine Toilettenschüsseln, nur zwei Löcher im Boden. Der fest gefügte Raum löste sich auf, als sie bemerkte, was auf dem Fußboden lag, wie unachtsam mit einem Eimer ausgeschüttet und mit dem Besen in die Aborte gekehrt. Sie sah die kleinen Arme, die winzigen Hände, noch ganz nah am Körper, die gekrümmten Wirbelsäulen, die reptilienartigen Köpfe mit den zarten geschlossenen Augenlidern, die rosa Haut, die blauen Flecken, das Blut. Florentine konnte sich gerade noch seitlich über eines der Waschbecken beugen und übergab sich.
Eine ungewollte Schwangerschaft beendete man, indem man vom Tisch sprang, schwer trug oder jemanden bat, einem in den Bauch zu schlagen. Die Engelmacherinnen im Dorf rieten zu Salbei, Arnika, Rosmarin, Petersilie, Beifuß oder Angelica in hoher Dosis. Wenn alles nichts half, dann verabreichte man sich gering konzentrierte Blausäure oder versuchte es mit Stricknadeln. Frauen, die solche Maßnahmen ergriffen, nahmen das Risiko in Kauf, unfruchtbar zu werden.
Oder es konnte ihnen ergehen wie Nika.
Sie hatten einander im Rathaus kennengelernt, wo sie, in eine Schlange eingereiht, darauf warteten, zu jemandem vorgelassen zu werden. Nika mutmaßte, dass das Schlangestehen von der Regierung als Leibesübung gedacht war und sie somit von weiteren sportlichen Aktivitäten entband. Die dadurch gewonnene Zeit sollte ihrer Meinung nach beim Kaffee verbracht werden. Oder bei einem Glas Vişinată – noch besser, beidem.
Nika war die erste Freundin, die Florentine im Dorf hatte. Mehrmals in der Woche trafen sie sich zu Kaffee und Sauerkirschlikör. Meist in Nikas Küche, wo das Radio plärrte, eines der drei Kinder spielte und immer ein Kuchen im Rohr oder eine Suppe auf dem Herd stand. Hannes erkannte am Geruch, wo Florentine gewesen war. Eine Mischung aus Küchenaromen, Kaffee und Zigarettenrauch.
Nika, eine Zigarette zwischen den Fingern, der dünne aufsteigende Rauchfaden durcheinandergewirbelt durch die Bewegungen ihrer Hände, die das, was sie sagte, unterstrichen, kommentierten, infrage stellten – war das erste Bild, das auftauchte, wenn Florentine an ihre Freundin dachte. Dann die hellgrünen Augen (ein Ausdruck zwischen Erwartung und Übermut), die Schnelligkeit ihres Verstandes, ihre Ironie und Lust zu lachen, was gleichzeitig ihre Melancholie offenbarte. Ein Erbe der Familie, wie sie sagte. Nika war in der Bukowina geboren worden, in einem Dorf, wo sich ihre erste Liebe mit achtzehn Jahren das Leben genommen hatte. Nur nicht Dichter werden, riet sie ihren Söhnen. Die sterben jung, und sagen, was sie denken, dürfen sie nicht; ob auf dieser oder der anderen Seite der Wälder.
Florentine und Nika wurden beide im Sommer schwanger. Doch Nika wollte kein weiteres Kind. Sie spritzte sich ein Mittel, das man Kühen verabreichte, und starb innerhalb von drei Tagen unter Krämpfen. Im Krankenhaus weigerte man sich, sie zu behandeln. In der Volksrepublik Rumänien gab es keine Abtreibungen.
Der Arzt mit dem kalten Ohr entließ Florentine zum Ende der Woche. Die Zwischenblutungen hatten aufgehört, und weiter konnte man nichts für sie tun. Sie meinte, an seinem Verhalten zu erkennen, dass er ihr noch immer unterstellte, etwas gegen ihre Schwangerschaft unternommen zu haben, sagte aber nichts. Sie war froh, dass sie nach Hause durfte. Aus dem überfüllten Zimmer fortkommen, im eigenen Bett schlafen, ein Bad nehmen, bei Hannes sein – der versucht hatte, sie zu besuchen, jedoch nicht vorgelassen worden war, was Mariana mitbekommen hatte, die alles mitbekam. Florentine war oft zum Bett der Zigeunerin gegangen, sie hatten das Fenster einen Spalt geöffnet und dem Schneetreiben auf der Straße zugesehen.
Mariana trug einen weiten, bodenlangen Hausmantel und ließ die Beine baumeln wie jemand, der auf einer Mauer saß. Sie erwartete ihr viertes Kind und war seit Wochen im Krankenhaus. Das Bett am Fenster wurde schließlich keinen Neulingen zugeteilt. Sie wusste, wie man eine größere Portion Essen erhielt, was man tun musste, damit die Hausschuhe nach dem Putzen nicht verschwanden, und sie zeigte ihr ein Stockwerk tiefer Toiletten, die die Schwestern benutzten.
»Woher weißt du all diese Dinge?«, hatte sich Florentine erkundigt.
»Indem ich nicht danach frage.«
»Wenn dein Sohn kommt«, riet Mariana zum Abschied, »lauf Treppen. Lass dich von diesen Teufeln nicht ans Bett binden.«
Florentine war kaum überrascht, als die Zigeunerin von einem Sohn sprach. Ihre inneren Vermessungen hatten sie zu demselben Ergebnis geführt. Im Zug legte sie die Hände auf den Bauch, flach, die Finger gespreizt, und konzentrierte sich auf die Umrisse des Jungen. Nach einer Weile bemerkte sie, dass sie in die falsche Richtung fuhr. Sie stieg an der nächsten Station aus und fand sich auf einem verlassenen Perron wieder. Wann der nächste Zug kommen würde, war nicht auszumachen. Die Bahnhöfe im Banat waren so eingerichtet, als gäbe es keine Notwendigkeit, irgendwo anzukommen.
Es hatte aufgehört zu schneien. Der Himmel war wässrig blau, Krähen spannten Bögen übers Feld. Und während Florentine Eiszapfen von einer Überdachung brach und an den Mund führte, verwandelte sich alles.
Das Blau tief, die Bögen fort.
Sie setzte sich auf einen Stein und wartete auf einen Zug, der sie wieder zurück nach Arad brachte.
Florentine befolgte Marianas Rat. Sie lief im März wie besessen treppauf und treppab, eine Hand auf dem Geländer, die andere auf dem Bauch. Die Schwestern versuchten, sie zurück ins Bett zu bringen, doch Florentine widersetzte sich, stieg ein Stockwerk hinunter, dann hinauf, hinunter und wieder hinauf. Irgendwann wusste sie, es war genug. Sie legte sich im Kreißsaal auf das Entbindungsbett und sagte, es gehe jetzt los. Die Geburt dauerte weniger als zwei Stunden. Ein Arzt kam erst, als man den Kopf des Kindes sah.
Hannes wartete vor dem Krankenhaus. Besuch war nicht erlaubt, nicht einmal zur Geburt, nicht einmal dem eigenen Mann. Trotz der ersten Anzeichen des Frühlings war es kalt, an manchen Stellen lag noch Schnee. Der Winter hielt sich daran fest, uneinsichtig, widerspenstig.
Das Kind wurde in ein Tuch gewickelt und Florentine auf die Brust gelegt. Sie konnte seinen Herzschlag spüren. Es schrie kurz, wurde dann ganz ruhig, und neben Florentines Erschöpfung, dem allumfassenden Hochgefühl und Stolz, stellte sich ein unerwarteter Ernst ein. Dieser Junge ist es nun, und kein anderes Kind.
Die Schwestern versammelten sich vor dem Fenster.
»Da steht ein Mann auf einem Autodach.«
Florentine lächelte.
»Sagt ihm, es ist ein Junge und er hat kleine Ohren.«
Die Birnbäume trugen kleine, harte Früchte. Die Quitten waren reif.
Es kam Florentine undankbar vor, nicht jede einzelne Gabe des Gartens zu essen, zu Marmelade einzukochen oder auf dem Aufboden zu trocknen. In den ersten Jahren hatte sie versucht, alles allein zu bewältigen (bis ihr die Beeren Hände und Träume rot einfärbten), inzwischen halfen ihre Nachbarinnen. Sie hatten eine Art, bei der Arbeit innezuhalten, die Hände an den Kitteln abzuwischen, Handflächen, dann Handrücken, mit leicht geneigtem Oberkörper; als brauchte es diese durch die leichte Neigung gewonnenen Zentimeter, um eine Botschaft zu übermitteln, die sonst verloren gehen würde. Vom Wind fortgenommen, in die Baumkronen gesetzt.
Ihr Schweigen musste wirken, als hielte sie sich für etwas Besseres. Florentine spürte Worten gegenüber ein nie ganz aufzulösendes Unbehagen. Die Unschärfe der Aussagen verunsicherte sie. Wie sehr sie sich auch bemühte: Sprechen reichte nicht an die Wirklichkeit der Erfahrung heran. Sie mochte es, ihren Gedanken nachzuhängen, während sie Ribisel und Himbeeren zupfte, Trauben erntete, Äpfel pflückte – zuzuhören, was die Wörter miteinander verhandelten, welche Erinnerungen sie anrührten. Sie waren in einem unbestimmten Raum angesiedelt, in dem Denken und Fühlen ineinander übergingen.
Sicher war es ihre Schuld, dass Samuel mit zweieinhalb Jahren noch nicht sprach. Florentine hatte geschwiegen, als er in ihrem Bauch heranwuchs, geschwiegen, als sie mit dem Kinderwagen übers Feld ging, den Fluss entlangspazierte. Boote auf Pfützen entsenden, in einer Hängematte übersommern, sich im Laub verstecken, getrocknete Maiskolben zu Schneegesichtern legen – ihre Spiele der Stille. Samuel zeigte, wenn ihm etwas gefiel; er ließ keinen Zweifel zu, wenn er etwas nicht mochte, sprach mit seinem Lachen, seinen Augen, aber noch war kein Wort über seine Lippen gekommen, nichts, das wie Mama oder Papa klang oder was Kinder sonst als Erstes sagten.
»Du musst es ihm vormachen«, rieten die Leute.
Sie beugten sich zu dem Jungen, formten einzelne Worte, überdeutlich, und zeigten dabei auf Gegenstände.
»Ball«, sagten sie, mit im Mundraum gewölbter Zunge.
»Mama«, sagten sie und wiesen auf Florentine, die unter dem langgezogenen Doppellaut erstarrte. Samuel sah auf Münder, Bälle, seine Mutter, seinen Vater und blieb still.
Hannes wurde unruhig.
Florentine konnte warten.
Sie schwieg neben den schwatzenden Nachbarinnen, konzentrierte sich auf das Rascheln der Schritte im Laub, das Pochen eines Spechts. Quitten kamen in Weidenkörbe, Birnen in Weidlinge, Pflaumen in Schalen aus Emaille. Die tief stehende Sonne rötete Himmel und Ziegeldächer. Der Garten lag im Schatten. Ein sachter Wind kühlte den Nacken, fing ab und an ein Wort auf.
Irgendwann hielt ihr eine der Frauen die Hände hin.
Florentine betrachtete sie, dann ihre eigenen.
»Du bist die Einzige, die rote Hände hat.«
Am Nachmittag kam Hannes in Begleitung zweier Männer in die Küche. Florentines Überraschung hielt sich in Grenzen. Es war üblich, dass Reisende im Pfarrhaus um ein Nachtlager baten. Sie musterte die beiden. Sie konnten nicht älter als zwanzig sein, trugen abgewetzte Hosen und Schuhe, die verrieten, dass sie zu Fuß unterwegs waren. Der eine setzte seinen Rucksack ab und reichte ihr die Hand.
»Ich bin Benedikt, nenn mich Bene.«
»Florentine – ohne Abkürzung.«
»Kann ich helfen?«, fragte er, wusch sich die Hände und begann mit überraschender Geschicklichkeit, Kartoffeln zu schälen.
Florentine erfuhr, dass die beiden angehende Lehrer waren. Sie kamen aus der DDR und wollten per Autostopp zum Schwarzen Meer. Bene hatte schwarze Haare, helle Haut und Grübchen, die Florentine leutselig und zugleich verwegen fand. Seine Hände waren schön, mit langen, schmalen Fingern, die routiniert Zwiebeln und Knoblauch schnitten, Petersilienwurzeln und Sellerie stückelten, während er fragte und erzählte.
Was für ein beeindruckendes Pfarrhaus das sei, mit dem Hoftor, der alles umschließenden Mauer, den vielen Zimmern und hohen Decken. Und erst der Garten. Ob Florentine ihn alleine bewirtschafte? Wie denn der Hund heiße? Schopenhauer? Florentine verneinte, es sei nicht ihr Einfall gewesen, sie hätten ihn von dem vorherigen Pfarrer geerbt. Schopenhauer hätte einen Umzug nicht überlebt. Er sei alt, sehr alt, er würde nicht einmal bellen, wenn das Haus abbrannte.
Bene lachte, und Florentine war, ohne sich dessen bewusst zu sein, während des Kochens in eine angenehme Unterhaltung mit ihm geraten. Beim Abendessen kam sie dazu, sich den Mann näher anzuschauen, der sich als Lothar vorgestellt hatte. Er hatte dunkle Augen und eine markante Nase, die nicht recht zum Gesicht passte, da es sonst nur aus weichen Linien bestand. Seine Stimme war rau, eine unauslotbare Tiefe klang darin an. Er überlegte, bevor er etwas sagte, was womöglich keine Unsicherheit war, sondern dem Wunsch entsprang, das, was er meinte, genau zu treffen. Bene hingegen redete ohne nachzudenken, hatte einen sprunghaften Intellekt, durchsetzt von kindlichem Übermut. Kein Wunder, dass Samuel sofort Freundschaft mit ihm schloss. Er wollte während des Essens neben ihm sitzen, und Bene musste ihn mit Florentine zu Bett bringen.
Er las ihm eine Geschichte vor, etwas mit einem Zauberer und einem Mädchen; Florentine lag auf der Seite des Bettes, die zur Wand zeigte, zog die Locken des Jungen mit Daumen und Zeigefinger nach und atmete den Geruch seines Haares ein. Bene spielte die Szenen weder nach noch veränderte er bei wechselnden Charakteren seine Stimme. Die Geschichte wurde zu einem ruhigen Fluss, der, auch wenn man zunächst nur zaghaft die Hand hineingehalten hatte, alles mit sich fort trug. Florentine stieg in diesen Fluss, Samuel war schon halb von ihm in den Schlaf mitgenommen worden, da bemerkte sie, dass Bene ebenfalls angefangen hatte, Samuel zu streicheln, dessen Fuß unter der Decke hervorlugte. Er strich über die Zehen, die glatte Haut der Ferse, die Waden, die etwas von der Zeit bewahrt hatten, da Samuel ein Säugling gewesen war. Etwas blieb immer erhalten, erlaubte einen langsamen Abschied. Die Weichheit, die Glätte, das Zartgliedrige, Florentine nahm wahr, dass Bene diese Empfindungen nicht suchte, er nahm sie beiläufig auf, während er vorlas.
Als er das Buch zur Seite legte, hörten sie beide auf dieses Zeichen hin auf, das Kind zu berühren.
Jeden Morgen, solange der Junge noch schlief, saß Florentine auf den Treppen, die in den Hinterhof führten. Hannes konnte bis nach Mitternacht über einem Text oder Buch brüten. Sie konnte nicht früh genug ins Bett gehen. Wenn sie das Licht löschte, spürte sie eine kaum näher zu begründende Vorfreude auf den Augenblick des Aufwachens.
Früher war das Erste, was Florentine am Morgen in den Sinn gekommen war, ein allumfassendes »Nein« gewesen. Ein Nein gegen das Klopfen des Vaters an ihrer Tür, gegen die unters Bett gerutschten Hausschuhe, die Kälte des Badezimmers. Ein Nein gegen das Geschirr in der Spüle, das Marmeladenglas, das nicht aufging, den Hosensaum, der sich gelöst hatte – die große, immerwährende Verschwörung der Dinge. Hier war das, was getan werden musste, nicht weniger geworden. Fünf Zimmer, dazu Küche, Dachboden und Weinkeller. Ein Garten, Hühner, Katzen, ein altersschwacher Hund. Und doch gab es kein Nein. Das Haus hatte mehr Zimmerfluchten als sie Ausreden, mehr Fenster, als sie den Blick verschließen konnte. Sie hatte sich gewünscht, frei von Verantwortung zu sein. Aber vielleicht war ein Leben ohne Verpflichtung das Gegenteil von Glück.
Im Internat hatte es kein Wochenende ohne Partys gegeben. Den Unterricht brachte man hinter sich, nachmittags verdiente man sich etwas dazu, half in einer Konditorei aus, bügelte Hemden. Von Freitag bis Sonntag wurden die Nächte durchgemacht. Florentine wollte immer zu den Letzten gehören. Zuletzt wurde am hemmungslosesten getanzt, war klar, wer mit wem nach Hause ging, spielte es keine Rolle, wer bezahlte, gab es jene Aktionen, von denen noch lange erzählt wurde: im Fluss schwimmen, zitternd vor Kälte; die Schlüssel des Hausmeisters stehlen und vom Dach etwas in die Nacht rufen.
Ihr Lieblingsgetränk war Bloody Mary, Tomatensaft mit Wodka, Pfeffer und Salz. Dazu Kent, Nationale rauchte sie nur, wenn sie wenig Geld hatte. Bei einem seiner Besuche entdeckte ihr Vater den überquellenden Aschenbecher auf dem Fenstersims. Dem Wind war die Aufgabe zugedacht, ihn zu leeren. Meist holte Florentine am Morgen einen ausgeräumten Aschenbecher vom Fenster herein.
Die Ohrfeige ihres Vaters traf sie ohne Vorwarnung.
Ganz offensichtlich war es nächtens windstill gewesen.
Florentines Kopf blieb abgewendet, die Hand des Vaters halb ausgestreckt, als wollte er sie nicht wieder an sich nehmen. Das ist das letzte Mal, dass du mich geschlagen hast, beschloss Florentine. Sie war es leid, für seine Launen herzuhalten, seit ihre Mutter fort war. Er war in Russland gewesen, zuerst im Krieg, dann in Gefangenschaft. Lange hatte ihre Mutter versucht, an ihr vormaliges Leben anzuknüpfen, dann war sie gegangen, wie jemand, der einkaufen geht, einen Freund besucht – ohne viel Gepäck, ohne viele Worte. Florentine wusste, sie hatte es versucht. Aber vielleicht hätte sie es länger versuchen, ihre Duldsamkeit ablegen, Grenzen setzen müssen; für die kleinen Kränkungen und die großen, unverzeihlichen.
Nach einem halben Jahr fragte Hannes, ob sie ihn heiraten und ins Banat übersiedeln wolle. Er lud sie ins Kaffeehaus ein. Als sie die Blumen unter dem Tisch sah, wusste sie Bescheid.
Florentine saß auf den Treppen zum Hinterhof mit der Umsicht eines stillen Gastes. Ihr früherer Widerstand hatte dazu geführt, dass sie sich etwas vorenthielt, etwas, das ihr jetzt, Morgen für Morgen, geschenkt wurde und das sie unter keinen Umständen verpassen wollte. Das Geheimnis war, immer zur selben Stunde im Hof aufzutauchen, bis man dazugehörte und sich das, was sich im Verborgenen vollzog, nicht mehr versteckte. Heute war zum ersten Mal eine klamme Feuchtigkeit auf den Treppen, ein dunkles Lila zwischen das Laub gestreut. Der Herbst setzte Weite zwischen die Häuser, rückte sie voneinander ab. Etwas nahm den Raum dazwischen ein, und Florentine war vollauf damit beschäftigt herauszufinden, was es war.
Bene und Lothar schliefen. Florentine richtete das Frühstück. Die letzten Tomaten aus dem Garten, Telemea, Brot, Pflaumenmarmelade und Akazienhonig, dazu Kaffee, im Topf gekocht. Sie bügelte das Beffchen auf, bürstete den Talar, kleidete sich und Samuel an.
Der Mesner begrüßte sie am Seiteneingang. Die Kirche war kühl und dämmrig, obwohl Kerzen brannten. Florentine legte den Kopf in den Nacken und betrachtete die Sterne, mit denen die Decke des Kirchenraums ausgemalt war. Schlichte, schwarze, regelmäßig übers Weiß gestreute Sterne. Die Glocken läuteten, die Kirche füllte sich, Frauen auf einer, Männer auf der anderen Seite. Samuel war bei der Organistin auf der Empore und nur schwer davon zu überzeugen, mit Florentine mitzugehen, als die ersten Orgeltöne angespielt wurden.
Der Mann, der die Treppe zur Kanzel hinaufstieg, war ein anderer als jener, mit dem sie das Bett teilte, die Mahlzeiten einnahm, stritt, lachte und diskutierte. Er war befähigt, Gottes Segen zu erteilen, und es gab kaum einen Kirchgang, bei dem Florentine nicht über diesen Unterschied nachdachte. Seine Stimme war anders, seine Haltung. Seine Worte waren nachdrücklich, seine Gesten ruhig, und sie bewunderte die Selbstverständlichkeit, mit der er diese Rolle einnahm. Während der Predigt ging ihr Blick erneut zum Sternenhimmel. Sie hatte eine Weile gebraucht, um sein Geheimnis zu verstehen. Er setzte sich aus drei Formen zusammen: vierzackige, sechszackige und runde, wie kleine Sonnen. Sie waren mit einer Regelmäßigkeit ausgestreut, die ihr beispiellos vorkam. Jeder Stern fand seinen Platz, hielt Abstand und schien doch die Nähe der anderen zu brauchen. Samuel sah ebenfalls hinauf. Ihre Hände lagen nah beieinander.
Als der Gottesdienst zu Ende war, verabschiedete sie mit Hannes die Besucher. Unter den Kastanien verblieben Gruppen im Gespräch – der Kirchgang war so eingerichtet, dass man, wie nebenbei, alles über die anderen erfuhr. Es war allgemein bekannt, dass Samuel nicht sprechen konnte, dass Hannes gerne Fußball spielte (manch einer mutmaßte, er sei nur Pfarrer geworden, weil sein Traum, Fußballprofi zu werden, sich nicht erfüllt hatte). Es war bekannt, welche Kuh wann kalbte, wer um wen warb, wer zu Untreue neigte und wahrscheinlich auch, wann und wie oft die Dorfbewohner einander liebten.