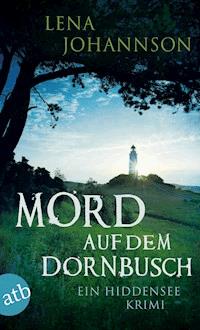6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lübeck im Jahr 1226. Die junge Esther versteht es ausgezeichnet, aus den verschiedensten Zutaten Tinte zu mischen. Ihr größter Wunsch ist es, endlich den Kaufmann Vitus zu heiraten. Als Esther erfährt, dass der Rat der Stadt plant, Kaiser Friedrich II. eine Urkunde zu überbringen, in welcher Lübeck mehr Privilegien zugesichert werden sollen, kommt sie auf eine kühne Idee …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Lena Johannson
Die unsichtbare Handschrift
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Lübeck im Jahr 1226. Die junge Esther ist die Schwester des städtischen Schreibers und versteht es ausgezeichnet, aus den verschiedensten Zutaten Tinte zu mischen. Ihr größter Wunsch ist es, endlich ihren Verlobten, den Kaufmann Vitus, zu heiraten, doch eine Ehe scheiterte bisher am Geld.
Als Esther erfährt, dass der Rat der Stadt plant, Kaiser Friedrich II. eine Urkunde zu überbringen, in welcher Lübeck mehr Privilegien zugesichert werden sollen, kommt die kluge junge Frau auf eine kühne Idee …
Inhaltsübersicht
Die wichtigsten Personen
Köln im Januar 2011 – Christa Bauer
Selburg in Semgallen, Oberlettland im Jahre 1224 – Heilwig von der Lippe
Lübeck im März 1226 – Esther
Sankt Augustin bei Bonn im März 2011 – Christa Bauer
Plöner Bischofsberg im März 1226 – Heilwig von der Lippe
Lübeck, 2. April 1226 – Esther
Lübeck, 3. April 1226 – Esther
Lübeck, 9. April 1226 – Kaspar
Lübeck, 24. April 2011 – Christa Bauer
Plöner Bischofsberg, 8. April 1226
Lübeck, 10. April 1226 – Reinhardt
Lübeck, 11. April 1226 – Esther
Lübeck, 11. April 1226 – Reinhardt
Lübeck, 11. April 1226 – Esther
Lübeck, 22. Mai 2011 – Christa Bauer
Lübeck, 15. April 1226 – Esther
Lübeck, 15. April 1226 – Kaspar
Lübeck, 15. April 1226 – Esther
Lübeck, 17. April 1226 – Heilwig von der Lippe
Lübeck, 17. April 1226 – Magnus
Lübeck, 17. April 1226 – Esther
Lübeck, 17. April 1226 – Magnus
Lübeck, 17. April 1226 – Heilwig von der Lippe
Lübeck, 31. Mai 2011 – Christa Bauer
Lübeck, 18. April 1226 – Esther
Lübeck, 18. April 1226 – Josef Felding
Lübeck, 18. April 1226 – Reinhardt
Lübeck, 18. April 1226 – Josef Felding
Lübeck, 18. April 1226 – Esther
Lübeck, 18. April 1226 – Heilwig von der Lippe
Lübeck, 18. April 1226 – Magnus
Lübeck, 18. April 1226 – Esther
Lübeck, 18. April 1226 – Josef Felding
Vor den Toren Lübecks am Abend des 18. April 1226 – Esther
Lübeck, 19. April 1226 – Marold
Lübeck, 19. April 1226 – Esther
Köln im Jahre 1231 – Josef Felding
Lübeck im Jahre 1261 – Vitus Alardus
Lübeck im September 2011 – Christa Bauer
Anmerkung zur historischen Richtigkeit
Glossar
Danksagung
Die wichtigsten Personen
Christa Bauer Restauratorin, angestellt im Archiv von Lübeck
Ulrich Dobsky Berufstaucher
Carsten Matthei leitender Mitarbeiter der Restaurationsabteilung im Archiv in Sankt Augustin bei Bonn
Dr. Florian Kayser Leiter des Stadtarchivs von Lübeck
Costas Chef des Stammlokals von Christa Bauer in der Fleischhauerstraße, Lübeck
Esther aus Schleswig Waisenkind und Schwester eines Schreibers, für den sie die Tinte macht
Kaspar, ihr Bruder Schreiber profaner Texte vor allem für Kaufleute und Handwerker
Vitus Alardus Getreidehändler, der mit England Handel treibt; Bräutigam von Esther
Malwine Wirtstochter; Kaspar hat ein Auge auf sie geworfen
Heilwig von der Lippe Gattin des Grafen Adolf IV. von Schauenburg und Holstein
Bischof Bernhard von Salonien Heilwigs Großvater
Adolf IV. Graf aus dem Geschlecht der Schauenburger und Enkel des ersten Stadtgründers von Lübeck
Reinhardt und Otto zwei Schreiber, mit denen sich Kaspar seine Schreibstube teilt
Meister Gebhardt ein Baumeister an der Dombaustelle
Marold ein Domherr und Notar der Stadt Lübeck
Josef Felding das Fuchsgesicht; Kölner Englandfahrer
Norwid Sohn eines Müllers, der seine Mühle vor den Toren Lübecks hat
Magnus einst Schreiber des Bischofs von Salonien, später persönlicher Schreiber von Heilwig von der Lippe, Gräfin von Schauenburg und Holstein
Bille ehemalige Magd im Hause des Grafen von Schauenburg und Holstein; Schwester des Müllers Norwid
Bischof Bertold Bischof zu Lübeck im Jahre 1226
Köln im Januar 2011 – Christa Bauer
Die graue Oberfläche des Wassers kräuselte sich, plötzlich ein Schatten, kaum wahrnehmbar zuerst, dann immer deutlicher zu erkennen. Schließlich tauchte ein Kopf auf. Sofort war einer der drei Männer, die das Tauchteam bildeten, mit einer Plastikkiste zur Stelle, die einmal dem Transport frischer Brote gedient hatte. Zwei Arme, in den stramm sitzenden Ärmeln eines dunkelgrauen Neoprenanzugs steckend, die Hände in unförmigen Handschuhen, reichten eine schwarze Masse nach oben. Der Mann mit der Kiste nahm den Klumpen entgegen und ließ ihn in diese gleiten. Augenblicklich quoll schmutziges Wasser durch die unzähligen Löcher der gitterartigen Kistenwände.
Restauratorin Christa Bauer war aus dem Zelt getreten, um eine kurze Pause zu machen. Seit fünf Stunden hatte sie ununterbrochen Papierfetzen, ganze Seiten oder auch mal, wenn sie viel Glück hatte, einen kompletten Ordner mit Hilfe einer Handdusche gründlich gespült und dann in Folie verpackt. Ihre Finger waren eiskalt in den gelben Gummihandschuhen, und in ihren Schläfen pochte es. Der blaue, blank polierte Bauhelm drückte auf ihre Ohren und verstärkte die Kopfschmerzen. Sie hatte weder gegessen noch getrunken und verspürte den Drang, sich eine Zigarette anzuzünden. Doch die würde sie sich natürlich verkneifen, denn sie hatte wenig Lust, wieder mit dem Laster anzufangen, das sie vor genau zwei Jahren und einhundertzweiundsechzig Tagen nach einem letzten tiefen Zug aufgegeben hatte. Den dritten Tag ging das nun schon so. Sie war erschöpft. Trotzdem spürte sie, als sie den Taucher jetzt mit seiner Beute aufsteigen sah, schon wieder das vertraute Kribbeln, das sie seit ihrer Ankunft in Köln begleitete. Es wäre vernünftig, sich einen heißen Tee zu holen. Stattdessen ging sie dem Mann entgegen, der dem Kollegen im Wasser die schlammige Fracht abgenommen hatte, und brachte die Kiste in das Zelt.
Noch war nicht zu erkennen, ob sich zwischen Modder und Dreck ein kleiner Schatz befand oder ob sie es nur mit einer Steuerakte aus dem beginnenden 20. Jahrhundert zu tun bekäme. Für das Kölner Stadtarchiv war jeder Fetzen der einst dreißig Regalkilometer Material von Bedeutung, das war ihr klar. Doch ihr Herz schlug nun einmal für Pergamente aus dem Mittelalter, sie waren ihr Steckenpferd. Alles andere war Pflicht, ein Pergament wäre die Kür.
Das Zelt stand direkt in der Baugrube. Hundert Helfer waren rund um die Uhr im Einsatz, um zu retten, was noch zu retten war. Sie arbeiteten in drei Schichten, so dass wohl etwas über dreißig Menschen gleichzeitig spülten, wischten und verpackten. Unter ihnen waren Archivare und Restauratoren, fachkundige Kollegen also, die ihren Urlaub opferten. Es gab aber auch Ein-Euro-Jobber, was Christa zunächst skeptisch zur Kenntnis genommen hatte. Wenn man nichts um die Bedeutung eines winzigen Stückchen Papiers wusste, wenn man vielleicht nicht einmal erkannte, dass es sich um ein Fragment eines Dokuments oder Buchdeckels handelte, wie sollte man es dann sichern? Doch Christa hatte die Laien offenbar unterschätzt. Jeder schien an diesem Ort das Gewicht und den Wert dessen zu spüren, was seit dem Einsturz des Stadtarchivs im März vor beinahe zwei Jahren bereits geborgen worden war und was noch unter dem Grundwasser auf seine Bergung wartete. Mit Feuereifer und Engelsgeduld harrte jeder an dem provisorischen Arbeitsplatz aus, reinigte und sicherte jedes Fitzelchen. Anders war es nicht zu erklären, dass in den vergangenen zweiundzwanzig Monaten geschätzte neunzig Prozent der Archivalien gefunden und zur Restaurierung auf andere Archive verteilt worden waren.
Nach weiteren drei Stunden, in denen sie nichts Spektakuläres entdeckt, in denen sie dem fließenden Wasser zugesehen hatte, wie es Sand und kleine Steine mit sich nahm, räumte Christa das Feld für die nächste Schicht. Die Wechsel erfolgten pünktlich, so etwas wie Überstunden gab es nicht, denn es stand nur eine feste Anzahl an Arbeitsplätzen zur Verfügung. Selbst wenn hier hundert Helfer gleichzeitig hätten spülen können, wäre es nicht klug, länger als acht Stunden in der Kälte mit Wasser und Papier zu hantieren. Die Aufgabe erforderte höchste Konzentration, und die war nach acht Stunden eben aufgebraucht.
Sie trat aus dem Zelt, warf einen Blick auf den kleinen Bagger, der nach Anweisung der Taucher ebenfalls verschüttete Kostbarkeiten aus der Tiefe holen sollte, und wendete sich zum Gehen. Sie konnte es kaum erwarten, den Helm abzunehmen, der diesen schrecklichen drückenden Schmerz verursachte. Doch das durfte sie erst, wenn sie die Baustelle hinter sich gelassen hatte. Als sie an der Tauchgrube vorbeikam, hievte sich einer der Männer gerade mit Hilfe eines Kollegen aus dem Wasser. Ein seltsamer Anblick. Direkt an der Taucherbrille ragte ein schwarzes rundes Mundstück hervor, das Christa an eine Gasmaske denken ließ. Oberhalb des knallgelb gefassten Brillenglases saßen seitlich am Kopf des Mannes zwei Metallbügel. Überall gab es Schrauben und Halterungen. Sie fühlte sich in einen Film versetzt, der an Bord eines Raumschiffs oder auf einem fremden Planeten spielte. Der Froschmann saß eine Weile am Rand des Beckens, sein Brustkorb hob und senkte sich schnell. Dann half sein Kollege ihm auf die Beine. Schlammiges Wasser kleckerte an ihm hinunter, Matsch schmatzte unter seinen Füßen, als er sich schwerfällig in Bewegung setzte. Plötzlich hatte Christa eine Idee. Während der Schicht war keine Zeit, sich mit den Bautauchern zu unterhalten. Dabei interessierte es sie doch brennend, was dort unten im Krater zu sehen war, mit welchen Schwierigkeiten man zu kämpfen hatte und wie die Prognosen waren.
»Na, auch endlich Feierabend?«, fragte sie darum den Mann, der auf dem Weg zum Fahrzeug der Spezialfirma nur langsam vorankam.
»Ja, Gott sei Dank!« Er schnaufte noch immer hörbar. Seine Stimme klang merkwürdig quäkend, weil die Brille seine Nase zusammendrückte.
»Ich möchte nicht aufdringlich erscheinen.« Christa kam gleich auf den Punkt, das war ihre Art. »Ich bin aus Lübeck und nur zum Helfen hier in Köln. Das bedeutet, meine Abende sind ziemlich einsam. Ihre Arbeit interessiert mich, sehr sogar. Vielleicht haben Sie Lust, mit mir heute Abend essen zu gehen und mir davon zu erzählen? Oder morgen. Nur wenn es Ihnen passt, natürlich.«
Er blieb stehen, löste Maske und Brille und schob beides vom Kopf. Die Haare klebten ihm feucht in der Stirn, tiefe Abdrücke der fest sitzenden Plastik- und Gummiteile hatten sich in das Gesicht gegraben.
Christa spürte, dass sie zu forsch gewesen war – wieder einmal. Sie sah einfach keinen Sinn darin, lange um den heißen Brei herumzureden. Aber sie wollte ihn auch nicht verschrecken, also fügte sie hinzu: »Mein Name ist Christa Bauer, ich bin Restauratorin und wüsste zu gern, wie es ist, durch den ehemaligen Archivkeller zu tauchen.« Sie lächelte.
Inzwischen hatten sie den Wagen erreicht. Er lockerte die Gurte seiner Weste und streifte endlich die schwere Ausrüstung ab, die an seinen Schultern gezerrt hatte. Er stöhnte, als die Last zu seinen Füßen am Boden lag, stützte die Hände kurz auf die Oberschenkel und ließ den Kopf schwer atmend hängen. Nach wenigen Sekunden richtete er sich wieder auf und streckte ihr die Hand entgegen.
»Mein Name ist Ulrich. Im Archivkeller zu tauchen ist alles Mögliche, aber sicher kein Urlaubsvergnügen.« Er grinste sie ein wenig schief an. »Beneiden Sie mich also lieber nicht.« Nach einem weiteren tiefen Atemzug fuhr er fort: »Sie wollen also mit mir essen gehen? Warum nicht? Neunzehn Uhr würde mir passen. Wo?«
Sie saßen in einer der typischen Kölsch-Brauereien, die Christa wegen ihrer ungezwungenen Atmosphäre so mochte. Sie fragte sich allerdings, ob es einen Zeitpunkt gab, an dem es nicht voll, laut und eng war. Mitten in der Woche waren hier alle Stühle und Bänke besetzt, die um die grob gezimmerten Tische herumstanden. Der Geräuschpegel, eine Mischung aus Stimmengewirr, Lachen und Gläserklirren, war so hoch, dass Ulrich und sie sich beinahe anschreien mussten. In den ersten Minuten war ihr Gespräch – wohl auch wegen des Lärms – nur schleppend in Gang gekommen. Doch längst hatten sie ihre anfängliche Zurückhaltung überwunden und unterhielten sich angeregt.
»Ist es nicht bitterkalt im Wasser?«, wollte Christa wissen. »Als ich heute zum Dienst kam, hat es geschneit. Ich wäre nicht gerade begeistert, bei dem Wetter in das Becken steigen zu müssen.«
»So kalt ist das gar nicht. Neun Grad. Ich habe schon Schlimmeres erlebt.«
»Vielen Dank, für mich wären neun Grad definitiv zu kalt.«
»Du musst ja nicht in der Badehose ins Wasser hüpfen.« Er grinste und nahm einen Schluck aus dem schlanken kleinen Kölschglas, das Christa als waschechtes Nordlicht ein wenig albern fand. Das süffige Bier trank sie dagegen sehr gern. »Unsere Neoprenanzüge halten ganz gut warm. Nee, da unten hast du wirklich andere Probleme.«
»Welche zum Beispiel?«
»Das fängt bei der schlechten Sicht an und hört bei dem Chaos auf, das dort herrscht.«
»Kann ich mir vorstellen.« Sie nickte, konnte sich aber, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen, wie es in dem Krater aussah.
Ulrich erzählte: »Meine Hände sind sozusagen meine Augen. Das ist immer so, wenn du als Bautaucher im Einsatz bist.«
»Was sind das sonst so für Einsätze?«, unterbrach sie ihn.
»Ganz verschieden.« Ihm war anzusehen, dass er gern über seinen Beruf sprach. Er gehörte zu der Art Männer, die nicht wirklich erwachsen wurden. Sie hätte einiges verwettet, dass er früher lebende Regenwürmer verspeist oder sich mit den stärksten Jungs angelegt hatte, nur um die Mädchen zu beeindrucken. Heute war es eben sein abenteuerlicher Job, der ihm die Aufmerksamkeit der Frauen garantierte. Er betrachtete das Ganze als einen Sport, einen großen Spaß, der obendrein noch gut bezahlt wurde. »Manchmal muss ich Gegenstände aus Ruderanlagen von Schiffen entfernen, damit der Kahn wieder flott wird. Oder ich muss mit einem Metalldetektor nach versunkenen Dingen suchen. Ich war auch schon in einer Talsperre unterwegs und habe sie auf Risse untersucht und alles auf Video aufgenommen. Das sind natürlich Jobs, die Spaß machen«, erklärte er stolz.
»Und welche Einsätze machen keinen Spaß?«
Er zog die Nase kraus. »Wenn du eine Lüfterkerze im Klärwerk montieren oder die Faultürme kontrollieren musst, wünschst du dir schon, du hättest in der Schule besser aufgepasst und einen anderen Beruf ergreifen können.«
Sie lachte. »Klingt nicht gerade verlockend, stimmt.« Nach einer kurzen Pause fragte sie: »Die Arbeit im Krater des Stadtarchivs ist bestimmt etwas ganz Besonderes, oder?«
»Das kann man wohl sagen.« Er nickte, leerte sein Glas und ließ sich von einer dünnen Kellnerin, die ständig mit einem gefüllten Tablett unterwegs war, ein neues Glas hinstellen. Das Mädchen malte einen Strich auf seinen Bierdeckel und war im nächsten Moment auch schon am Nachbartisch. »Die Schwierigkeit sind die fetten Steintrümmer und spitzen Eisenteile, die überall quer durcheinanderliegen. Dazwischen und drunter klemmen Aktenschränke und Regale. Du siehst das, wie gesagt, aber nicht, sondern musst dir durch bloßes Tasten ein Bild von der Lage machen.«
»Klingt gefährlich.«
»Ja, der Einsatz gehört auf jeden Fall zu den riskanteren Jobs. Du musst immer damit rechnen, dass etwas instabil ist, ins Rutschen kommt und dich begräbt oder dir den Rückweg versperrt. Oder du kannst mit den Schläuchen deiner Ausrüstung oder mit der Rettungsleine hängenbleiben. Dann ist ganz fix Schicht im Schacht.«
Vermutlich war das eine leichte Übertreibung, um vor Christa angeben zu können. Oder nicht? Völlig ungefährlich war die Arbeit mit Sicherheit wirklich nicht.
»Wann immer uns Papier zwischen die Finger kommt, müssen wir es hochbringen, das ist die Ansage. Aber eigentlich sind wir da unten, um richtig aufzuräumen.«
»Das heißt?«
»Das heißt zum Beispiel, dass morgen als Erstes Halterungen an einem Trümmerstück befestigt werden, das vermutlich mehrere Tonnen wiegt. Der Kran soll den Koloss aus dem Weg hieven, weil da drunter nämlich ein Regal liegt.« Er machte eine bedeutungsvolle Pause und sah sie an.
»Und?« Sie hielt die Spannung nur schwer aus. Mit etwas Glück hatten die Taucher in dem Regal Dokumente, womöglich sogar Pergamente ausmachen können.
»Das Regal ist noch komplett mit Akten gefüllt.« Er lehnte sich selbstzufrieden zurück, als hätte er allein das Schmuckstück des Archivs gerettet.
»Das ist großartig!« Sie gönnte ihm den Triumph. Immerhin hatte er tatsächlich einen nicht unerheblichen Anteil an dem Erfolg. »Das bedeutet, dass wir morgen jede Menge spannender Akten unter die Dusche bekommen.«
»Nicht so schnell!« Er hielt beide Hände vor sich, die Handflächen in Christas Richtung zeigend. »Wahrscheinlich sind wir morgen schon so weit, die ersten Akten hochholen zu können, erst muss aber sichergestellt sein, dass das Trümmerstück komplett frei liegt und aus der Grube gehoben werden kann, ohne dass alles ins Rutschen gerät. Sonst richten wir am Ende nur mehr Schaden an, als dass die Aktion was nützt.«
»Klar.«
Ein Kellner brachte das Essen.
Christa schob sich einen Bissen in den Mund und murmelte: »So ein Mist, dass ich nur eine Woche bleiben kann.«
»Warum kannst du nicht länger bleiben?«
»Ich konnte nicht länger Urlaub nehmen. Nächste Woche haben wir eine Veranstaltung im Archiv, die ich vorbereiten und durchführen muss. Leider.«
»Ich habe gehört, dass einige von euch ihre Freizeit damit verbringen, den alten Kram zu waschen. Ganz ehrlich, ich kapiere nicht, dass du extra dafür Urlaub genommen hast. Lohnt sich das alles überhaupt? Kannst du mit der Zeit nichts Besseres anfangen?«
»Ob sich das lohnt? Du redest wie diese eine Journalistin, die immerzu darauf pocht, wie viel das alles kostet und wie viele Brunnen von dem Geld in Afrika gebaut werden könnten.« Sie zog missbilligend eine Augenbraue hoch. »Ich kann mir keine spannendere Art vorstellen, meine Zeit zu verbringen.« Sie machte eine Pause und erzählte dann: »Im April 2009, also ziemlich kurz nach dem Einsturz, haben viele Institutionen Hilfe geleistet, indem sie Fachleute geschickt haben. Das Archiv in Lübeck hat mich sozusagen ausgeliehen. Damals wurden mir die Tage hier als Arbeitszeit angerechnet.« Sie musste wieder daran denken, welch ein Durcheinander geherrscht hatte. Die einen sagten voraus, dass die Bergungsarbeiten in einem halben Jahr abgeschlossen sein würden, die anderen sprachen davon, dass mindestens die Hälfte aller Bestände ohnehin unwiederbringlich zerstört sei. »Nachdem sich die Bergung immer länger hinzieht, wollte ich unbedingt noch einmal wiederkommen. Ich wollte die Chance nutzen, in dieser ganz anderen Phase wieder einen kleinen Anteil an den Rettungsmaßnahmen zu haben. Also habe ich Urlaub genommen.«
»Okay«, setzte er zwischen zwei Bissen an, »für eine Restauratorin ist das Ganze vermutlich eine einmalige Sache. Stellt sich trotzdem die Frage, ob sich das alles lohnt. Die Kosten sind doch irre! Das ist ja wohl nicht von der Hand zu weisen.«
»Nein, die Frage stellt sich nicht«, widersprach sie. »In dem Archiv waren rund dreißig Regalkilometer Materialien gelagert. Kannst du dir das vorstellen? Über tausend Jahre Kölner, aber auch rheinischer Geschichte waren dort versammelt. Und das ist längst nicht alles. Auch für die europäische Geschichte waren einige Dokumente von unschätzbarem Wert. Man muss einfach alles tun, um so viel wie möglich davon zu retten.«
»Soweit ich weiß, wurde doch schon der größte Teil gefunden, bevor wir angefordert wurden.«
»Rund neunzig Prozent sind geborgen, das stimmt. Fünf Prozent müssen wohl als endgültig verloren betrachtet werden. Bleiben aber immerhin noch fünf Prozent, für die man euch gerufen hat.«
»He, mir soll’s recht sein. Ich mache den Job gerne und nehme auch gerne das Geld dafür.« Er lachte und fuhr sich mit einer Hand durch das strubbelige hellbraune Haar. »Wenn ich allerdings höre, dass allein zehn Millionen für das unterirdische Bergungsbauwerk auf den Tisch geblättert wurden! Ganz ehrlich, da muss man schon mal Vergleiche mit Kosten für Brunnen in Afrika anstellen dürfen.«
»Zuerst habe ich mich auch gefragt, warum man nicht einfach das Wasser abpumpt. Das wäre bestimmt günstiger. Nur geht das nicht wegen des Wassers im U-Bahn-Tunnel direkt nebenan. Würden die die Grube abpumpen, wäre der Druck auf die Wand zwischen Krater und Tunnel zu groß, die Wand könnte einstürzen. Also seid ihr unverzichtbar.«
»Ich weiß.« Er grinste. »Das mit dem Druck, meine ich. Selbst mit Wasser ist die Geschichte mächtig instabil. Die Wand wird ständig beobachtet. Bewegt sie sich mehr als zwei Millimeter, sind wir raus aus der Nummer. Dann ist es vorbei mit der Bergung.«
»Das wäre furchtbar.«
»Ach was, ich würde auf diese restlichen fünf Prozent pfeifen. Kosten und Risiko stehen doch in keinem Verhältnis zu lächerlichen fünf Prozent.«
»Das Problem ist nur, dass wir keine Ahnung haben, woraus diese geschätzten fünf Prozent bestehen. Vergiss nicht, dass momentan alle Werte nur geschätzt sind. Es gibt schließlich noch keine vollständigen Aufzeichnungen über die gesicherten Archivalien.« Sie hatte den Faden verloren, war aber sofort wieder bei der Sache. »Ja, von welchen fünf Prozent reden wir also? Sind das nur Gewerbesteuerakten von vor zig Jahren? Oder sind darunter Schätze wie etwa das Tagebuch eines Ratsherrn aus dem 16. Jahrhundert?«
»Toll, für mein Tagebuch würde kein Mensch zehn Millionen hinblättern.«
»Du schreibst Tagebuch?«, fragte sie überrascht.
»Nö, aber wenn ich’s täte, würde es auch keinen interessieren.«
»Das kommt darauf an. Das Tagebuch, von dem ich spreche, umfasst fünftausend Seiten und verrät unendlich viel über die Gesellschaft, die Kultur, die Politik Kölns von der Mitte bis zum Ende des 16. Jahrhunderts.«
»Aus der Sicht eines Ratsherrn.«
»Ja. Ich weiß, was du denkst, aber wir haben nun einmal nicht viele Dokumente, die den Alltag jener Zeit wiedergeben. Man hat nicht wie heute alles in Zeitungen und Büchern festgehalten. Papier oder davor Pergament war kostbar, nicht jeder konnte überhaupt schreiben. Von den einfachen Leuten gibt es darum solche Tagebücher nicht.«
»Schon klar.« Er zog die Augenbrauen hoch, so dass sich die sommersprossige Haut seiner Nase spannte. »Und weil dieses eine Tagebuch noch nicht gefunden wurde, gibt man ein irres Geld aus, um danach zu suchen.«
»Nein, das Buch war nur ein Beispiel. Niemand kann, wie ich schon sagte, bisher überblicken, was noch fehlt. Deshalb muss man um jeden Schnipsel kämpfen, als wäre er ein Heiligtum.« Christa war in ihrem Element. Sie erzählte ihm von Urkunden, die von dem berühmten Barbarossa unterzeichnet waren, von Handschriften von Albertus Magnus und von Nachlässen, wie etwa denen von Adenauer und Böll, die ebenfalls im Kölner Stadtarchiv beheimatet gewesen waren.
»Ja, gut, Böll und Adenauer, das sagt mir natürlich was. Aber von diesem Magnussen habe ich noch nie etwas gehört.«
»Magnus, Albertus Magnus. Er war Philosoph und …«
»Und wen interessiert das? Ich meine, wer entscheidet, was es wert ist, aufbewahrt zu werden, und was nicht?«
»Das ist nicht leicht«, gab sie zu. Sie versuchte ihm die Gedanken näherzubringen, die hinter dem Archivieren von Dokumenten steckten, schwärmte davon, wie viel man über seine Vorfahren, über deren Traditionen, Handel und Gebräuche lernen konnte. »In Archiven erkennen wir, woher wir kommen«, schloss sie und bemerkte, dass viele Gäste gegangen waren. Nur noch wenige Tische waren besetzt, es war tatsächlich beinahe Ruhe eingekehrt.
Sie zahlten und traten hinaus in die eisige Luft. Schneeflocken segelten an ihnen vorbei.
»Wo wohnst du?«, wollte er wissen.
»In einer kleinen Pension nicht weit vom Bahnhof.«
»Nicht weit vom Dom, heißt das. In Köln orientiert man sich am Dom«, wies er sie lächelnd zurecht. »Ich bringe dich nach Hause.«
»Das ist nicht nötig.«
»Ist es doch. Ich will nämlich wissen, ob ihr den ganzen alten Kram überhaupt retten könnt. Geborgen bedeutet doch wohl noch lange nicht gerettet, oder? So wie das Zeug aussieht, wenn es aus dem Wasser kommt …«
»Das ist wahr.« Sie spazierten am Rheinufer entlang. Christa sah zum Schokoladenmuseum hinüber, dessen Lage sie reizvoller fand als seinen Inhalt. »Was gefunden ist, ist in der Tat noch nicht in Sicherheit. Aber gerade die Dokumente, die unter Wasser liegen, haben gute Chancen, das Unglück unbeschadet oder mit wenigen Schäden zu überstehen.«
»Tatsächlich?«
»Ja, das Wasser konserviert gewissermaßen. Wenn die Schriftstücke ununterbrochen im Wasser waren, also nicht zwischendurch an die Luft gekommen sind, dann sollte eine Restaurierung möglich sein.«
»Was macht ihr mit dem Zeug, wenn ihr es im Zelt abgespült habt? Ich sehe immer nur Kisten mit ganz viel Folie, die weggebracht werden.«
»Die Papiere werden nach der gründlichen Reinigung in Plastik eingeschweißt und dann auf verschiedene Kühlhäuser verteilt. Dort werden sie bei etwa minus achtundzwanzig Grad schockgefroren und dann gefriergetrocknet, damit sich gar nicht erst Schimmel bilden kann. Damit ist sozusagen der Ist-Zustand gesichert.« Sie zog den Kragen ihres Mantels höher. »Es wird Jahre dauern, bis alles identifiziert und zugeordnet ist. Na ja, und auch das Restaurieren wird dauern. Ein großer Teil der Archivalien ist zumindest leicht beschädigt, ein anderer Teil stark. Das heißt, Schriftstücke, Dokumente und auch Siegel müssen trockengereinigt, Risse müssen geschlossen, Siegel teilweise neu befestigt werden. Da gibt es jede Menge zu tun.«
Sie waren vor dem unscheinbaren weißen Haus unweit des Doms angekommen.
»Hier wohne ich. Ist ganz in Ordnung«, meinte Christa und blickte an den sechs Stockwerken hinauf.
»Das war ein echt netter Abend. Hätte ich nicht gedacht.«
Sie lächelte spöttisch. »Warum hast du dann zugesagt?«
»Weil es ungewöhnlich ist, dass eine Frau einem Mann ohne Umschweife eine Verabredung vorschlägt. Und ich mag alles, was ungewöhnlich ist.«
»Ich beschäftige mich viel mit dem Mittelalter, beruflich und privat. Wenn ich sehe, was Frauen damals alles nicht konnten oder durften, welche Hintertürchen sie nutzen mussten, um überhaupt ans Ziel zu kommen, dann wird mir immer bewusst, wie gut wir es heute haben. Ich sehe gar nicht ein, mir die von Generationen erkämpften Vorzüge aus falscher Scham entgehen zu lassen.«
»Das leuchtet ein.«
»Also dann, bis morgen.« Sie streckte ihm die Hand hin.
Er nahm sie und drückte sie kräftig. »Bis morgen. Gute Nacht.«
Am nächsten Morgen verschlief Christa. Sie hatte von der Bergungsgrube geträumt, war selbst mit Ulrich unter Wasser. In ihrem Traum hatte es ausgesehen, als wären sie durch das Lübecker Archiv getaucht, das geflutet worden war und in dem die Regale umgestürzt quer durcheinanderlagen. Ulrich schwamm unter einem diagonal angelehnten hohen Regal hindurch, blieb mit der Rettungsleine hängen und strampelte um sein Leben. Christa hatte versucht ihm zu helfen, doch er schlug und trat so heftig um sich, dass sie ihm nicht nahe genug kommen konnte. Seine Leine verhedderte sich dabei immer mehr. Mittelalterliche Pergamente trieben an ihr vorbei, die sie greifen wollte. Doch sie musste sich um den Taucher kümmern, der plötzlich nicht mehr Ulrich, sondern ihr Bruder war und dessen Gesicht sich allmählich blau verfärbte. Sie war mit klopfendem Herzen aufgewacht und hatte einige Zeit gebraucht, bis sie wieder hatte einschlafen können. Als um sechs Uhr ihr Wecker gepiept hatte, hatte sie ihn ausgeschaltet und war gleich wieder fest eingeschlafen. Glücklicherweise hatte etwa zwanzig Minuten später jemand unten auf der Straße mehrfach gehupt. Sie hatte eilig geduscht, die kurzen braunen Haare nur rasch aus dem Gesicht gekämmt und trocknen lassen, während sie sich angezogen hatte und in den Frühstücksraum gestürmt war. Dort kippte sie eine Tasse Kaffee hinunter und schmierte sich nebenbei ein Brötchen, das sie auf dem Weg zur Severinstraße verzehrte.
An der Baustelle angekommen, war ihre rechte Hand, mit der sie ihr Frühstück gehalten hatte, steif vor Kälte. Ihre Laune war im Keller. Sie konnte es nicht ausstehen, schon am frühen Morgen hetzen zu müssen. Womöglich hat Ulrich recht, dachte sie missmutig, als sie ihren Helm aufstülpte. Womöglich stand der Aufwand wirklich in keinem Verhältnis zu dem, was noch im Krater zu entdecken war.
Den ganzen Vormittag musste sie mit ihrer Müdigkeit kämpfen und hatte Mühe, sich zu konzentrieren. Ausnahmsweise machte sie mittags eine Pause. Zum einen würden ihr eine starke Tasse Kaffee und etwas Ruhe guttun, zum anderen wollte sie sich das Spektakel nicht entgehen lassen, das sich an dem Wasserbecken abspielte. Dicke Taue waren an dem Trümmerstück befestigt worden, von dem Ulrich gesprochen hatte. Ein Kran zog das riesige Gebilde, ein Eckstück von einer Hauswand, nun millimeterweise aus dem Krater. Männer mit gelben Bauhelmen und grellen Warnwesten liefen um die Grube herum, bückten sich, um besser sehen zu können, und riefen Kommandos. Es gab Beifall, als der steinige Koloss, von dem Matsch und Wasser tropften, neben dem Becken auf einem Sandhaufen abgelegt wurde. Der Sand gab leicht nach, rutschte ein Stück, kleine Steine kullerten wie aufgescheuchte Insekten den Hang abwärts, einige sprangen mit leisem Platschen ins Wasser. Dann bewegte sich nichts mehr.
Christa spürte, wie sich ihre Laune besserte. Sie winkte Ulrich zu, der in voller Montur am Rand stand und das Schauspiel ebenfalls verfolgt hatte, und zeigte ihm den hochgestreckten Daumen. Sie wusste, dass der Bagger nun zum Einsatz kommen und große Mengen an Material an die Oberfläche befördern würde. Es war also höchste Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen.
Einen Ordner nach dem anderen spülte sie sorgfältig ab, löste die Seiten so gut es ging voneinander, um so viel Dreck wie möglich vorsichtig zu entfernen. Es gab kaum eine Gelegenheit, einen Blick auf die Schrift zu werfen, um eine Idee davon zu bekommen, was man gerade geborgen hatte. Sehr alt schien das Papier nicht zu sein, und die Satzteile, die ihr ab und zu ins Auge sprangen, versprachen auch keine sonderliche Attraktion. Irgendwelche Erbschaftsangelegenheiten vermutlich. So etwas hatte die Menschen vor hundert Jahren ebenso beschäftigt wie vor zwanzig Jahren oder heute. Schon war ihr Korb wieder leer. Sie sah auf die Uhr. Noch knapp eine Stunde bis zum Schichtwechsel. Sie schnappte sich den Behälter und ging noch einmal den Weg hinunter zum Bagger. Sie musste einen Augenblick warten, dann tauchte die metallene Wanne, die sie an ein aufgesperrtes Maul erinnerte, an der Wasseroberfläche auf. Die dreckige Brühe lief in Strömen an allen Seiten hinaus, während die Schaufel über den Boden gelenkt und abgesetzt wurde. Jetzt konnte Christa ihren Korb mit neuer Fracht füllen. Hinter ihr standen schon drei weitere Helfer, die darauf warteten, sich Nachschub zu holen. Es tropfte auf ihre Hose und ihre Gummistiefel, als sie die wenigen Schritte zum Zelt lief. Wie immer versuchte sie schon jetzt etwas zu erkennen. Doch wie jedes Mal musste sie aufgeben, weil der Schlamm zu dunkel und zu dicht auf allem lag, als dass man auch nur erahnen konnte, ob es sich um einen Ordner, ein einziges Blatt oder gar ein Dokument mit Siegeln handelte. Routiniert hievte sie den Korb auf den Gitterrost, um den gesamten Inhalt zunächst vom gröbsten Dreck befreien zu können. Dann griff sie nach der ersten Akte. Abbrausen, in die Folie geben und beiseitelegen. Schon war das nächste Stück an der Reihe. Der gleiche Ablauf. Sie spürte, wie ihre Gedanken nicht mehr bei der Sache waren, sondern sich auf den Weg nach Lübeck machten. Sie überlegte, welche Unterlagen ihr noch für die Veranstaltung in der nächsten Woche fehlten. Sie würde sich sputen müssen, wenn sie zu Hause war, um alles rechtzeitig zusammenzubekommen.
Wieder griff sie in den Korb und erstarrte in der Bewegung. Zwischen den papiernen Akten, die kaum älter als hundert Jahre sein mochten, lag ein einzelnes Blatt. Ein Pergament. Wie war das in dieses Regal geraten? Es war undenkbar, dass jemand das kostbare Stück einfach falsch abgelegt hatte. Nein, die Wucht, die bei dem Zusammensturz des Archivs so viel Zerstörung und für zwei Menschen den Tod gebracht hatte, musste verantwortlich dafür sein, dass der Bogen aus seinem Aufbewahrungskarton gerissen und zwischen diese Akten geschleudert worden war.
Ihr Herz schlug einen Takt schneller. Der Tag hatte so unerfreulich angefangen und brachte ihr anscheinend doch noch den besten Moment der ganzen Woche. Sie nahm behutsam eine Ecke mit dem Gummihandschuh, zog das Blatt zu sich herüber und spülte es Stück für Stück ab. Ihr war durchaus bewusst, dass jeder angewiesen war, nur die besprochenen Handgriffe zu erledigen und sich nicht länger mit einem einzelnen Fund aufzuhalten. Sie würden nicht vorankommen, wenn jeder seine private Neugier befriedigte. Trotzdem konnte sie nicht widerstehen, einen Blick auf die Schrift zu werfen. Die Tinte hatte ziemlich gelitten, viele Buchstaben waren nahezu abgeschliffen, es gab ein großes Loch, und eine Ecke fehlte.
Christa atmete tief durch. Ein Wort sprang ihr geradezu ins Auge, eine Buchstabenkombination, die ihr nur zu vertraut war. Kein Zweifel, da stand mit Tinte auf das Pergament gemalt das mittelalterliche Wort für Lübeck. Und es war von Betrug die Rede, von einem großen, ungeheuerlichen Betrug.
Selburg in Semgallen, Oberlettland im Jahre 1224 – Heilwig von der Lippe
Heilwig von der Lippe eilte mit rauschenden Röcken durch den langen Gang des Bischofspalasts. Sie hatte sich nicht einmal umgezogen, sondern darauf bestanden, dass der Wagen sie direkt und ohne weitere Rast zum Palast brachte. Jetzt trug sie noch immer ihr Reisekleid, das ganz staubig war von den schlechten Straßen, auf denen sie hatte aussteigen müssen, wenn die Pferde zwischendurch getränkt oder getauscht worden waren. Es war ihr gleich. Sie wollte nur ihren Großvater sehen. Der Bischof von Salonien lag im Sterben, und sie wollte ihn noch einmal lebend zu Gesicht bekommen. Sie wünschte sich von ganzem Herzen, er möge seine Hand auf ihren Bauch legen und das Kind segnen, das sie unter dem Herzen trug.
Sie fröstelte. Es war kalt in dem Gemäuer. Dabei wollte draußen bereits der Frühling Einzug halten. Der Schreiber, ein hochgewachsener schlanker Mann mit grauem Haar und ein Freund ihres Großvaters, schritt vor ihr her auf die Privatgemächer des Bischofs zu. Es gehörte gewiss nicht zu seinen Aufgaben, die Enkelin des Kirchenmannes am Hauptportal zu begrüßen und sie durch den Palast bis hierher zu führen, doch hatte er es sich nicht nehmen lassen. Für ihn gab es in diesen Zeiten nichts anderes zu tun. Er wusste genau, dass seine Tage im Bischofspalast im gleichen Maße gezählt waren wie die seines Herrn, bis dieser seinem Schöpfer würde gegenübertreten müssen. Es war vollkommen unüblich, dass ein Bischof einen Schreiber damit beschäftigte, seinen Lebensweg aufzuzeichnen. Zumindest, wenn es sich um einen Mann einfacher, ja geradezu dubioser Herkunft handelte. Für derlei Aufgaben hätten jederzeit die Mönche zur Verfügung gestanden. Doch der Missionsbischof war von Kindesbeinen an als höchst eigensinnig bekannt. So scherte er sich nicht darum, was üblich war oder nicht, sondern tat, was er für richtig hielt. Da er stets ein gottesfürchtiger Mann gewesen war, tat er viele gute Dinge und genoss trotz seiner manchmal wahrlich eigentümlichen Entscheidungen ein hohes Ansehen.
Sie hatten die Tür zu dem Schlafgemach des Bischofs erreicht. Heilwig musste schlucken. In welchem Zustand würde sie ihren Großvater vorfinden? Viel zu lange hatte sie ihn nicht mehr gesehen. Sie erinnerte sich an einen Mann mit Pausbäckchen und blauen Augen, dessen Haar die Farbe von Herbstlaub hatte. Der Schreiber öffnete die hohe, mit Schnitzereien verzierte Holztür. Er ging zur Seite und ließ sie passieren. Heilwig trat auf das kunstvoll gedrechselte Bett zu, über dem ein Baldachin schwebte. Sie hörte hinter sich die Tür ins Schloss fallen. Der Schreiber hatte sich zurückgezogen. Zu ihrer Überraschung hielt niemand bei dem sterbenden Bischof Wache. Sie war allein mit ihrem Großvater. An beiden Seiten seines Betts brannten Lichter in eisernen Ständern mit Krallenfüßen. Sie spendeten wenigstens ein bisschen Wärme. Heilwig kniete an seinem Bett nieder und küsste den Bischofsring, der lose auf dem Finger einer blassen Hand saß. Bernhard schlug die Augen auf.
»Heilwig, gutes Kind, wie schön ist es, dich zu sehen.«
»Großvater!« Sie lächelte ihn an. Seine Haut war wächsern, der sonst stets aufmerksame Blick etwas trübe, doch seine Stimme klang noch immer voll. Auch war er nicht eingefallen, sondern wirkte, als hätte er bis gestern noch gut und reichlich gegessen.
»Du bist wohl allein gekommen?«
Sie hatte sich vor dieser Frage gefürchtet. »Vater muss sich um politische Geschäfte kümmern. Du kennst ihn doch«, antwortete sie mit dünner Stimme. Er ersparte es ihr, nach ihren sechs Geschwistern zu fragen, die sie, wie beide nur zu gut wussten, hätten begleiten können.
»Mein lieber Sohn Hermann konnte sich nie damit abfinden, dass ich mich für diesen Lebensweg entschieden habe. Deshalb ist er nicht mitgekommen. Und warum kann er das nicht? Weil er blind ist.«
Heilwig schwieg. Es war kein Geheimnis, dass im gleichen Maße, wie sie ihren Großvater liebte, der Rest der Familie die Nase über ihn rümpfte. Er war das schwarze Schaf. Sie kannte keinen anderen Grund dafür, als dass er eben seinen eigenen Kopf hatte. Das galt auch für ihren Vater Hermann, weshalb die beiden wohl immer wieder aneinandergeraten sein mochten. Doch darüber war nie gesprochen worden.
»Ich habe für ihn gebetet«, fuhr ihr Großvater fort, »dass unser Herrgott ihm ein Zeichen schickt, wie er mir vor vielen Jahren eines gesandt hat.«
»Was meinst du damit, Großvater? Von welchem Zeichen sprichst du?«
»Bring mir die Kissen von der Chaiselongue.« Er deutete in die andere Ecke des Raums.
Gehorsam stand sie auf und trug zwei dicke Kissen, die mit goldenem Brokat bezogen waren, zu ihm.
»Stopf sie mir in den Rücken, damit ich dich besser ansehen kann. Ich werde noch verrückt, wenn ich weiterhin den Baldachin anstarren muss.« Sie tat auch das. »Schon besser, ja, viel besser«, knurrte er zufrieden und atmete schwer. Bereits der Versuch, sich ein wenig aufzusetzen, hatte ihn angestrengt. »Und nun hol dir einen Stuhl her. Du willst doch wohl nicht die ganze Zeit vor deinem Großvater auf den Knien liegen. Die Reise war gewiss anstrengend. In deinem Zustand …«
Heilwig hatte Mühe, den schweren hohen Lehnstuhl anzuheben. Das letzte Stückchen schob sie ihn über den Steinboden ganz nah an das Bett ihres Großvaters heran. Das Kratzen der Holzbeine hallte laut von allen Wänden des hohen Raums wider.
»Ja«, sagte sie schnaufend, als sie sich zu ihm setzte, »der junge Graf hat mich unterwegs so manches Mal gepiesackt.« Sie legte ihre Hände auf ihren Leib und lächelte.
»Du meinst, es wird ein Junge?« Bischof Bernhard schmunzelte.
»Aber natürlich. Es ist unser erstes Kind, und Adolf ist doch ein gesunder Mann. Außerdem wünscht er sich so sehr einen Sohn.«
»Darüber entscheidet Gott allein.« Er schloss die Augen, und Heilwig meinte schon, er wäre eingeschlafen. »Siehst du, Kind, das ist das Unglück unserer Welt: Grafen, Könige und Kaiser meinen die Geschicke nach ihrem Willen lenken zu können. Dabei kann das nur Gott, unser Vater. Er allein und niemand sonst.« Er öffnete die Augen wieder, die mit einem Mal blitzten, wie sie es früher getan hatten, als Heilwig noch ein Kind gewesen war.
»Ich verstehe nichts von diesen Dingen«, begann sie zögernd, »aber ist es nicht so, dass sie ihre Titel von Gott dem Herrn bekommen, um die Geschicke der Menschen nach seinem Willen zu lenken?«
Er lachte heiser. »So sollte es sein. Doch Gott ist nicht hier, um Titel nach seinem Ermessen zu verteilen. Das erledigen Kirchenmänner in seinem Namen und nach ihrem eigenen Ermessen. Die wenigsten, die Keuschheit, Bescheidenheit und Gehorsam predigen, glauben selbst daran.« Er zog eine Grimasse, als hätte sie ihm eine verdorbene Speise vorgesetzt. »Jeder hat nur seinen eigenen Vorteil im Sinn. Glaube mir, mein Kind, ich zähle wohl um die vierundachtzig Jahre. Das ist eine lange Zeit, in der man viel zu sehen bekommt. Da wird um Titel und Ländereien geschachert, da geht es darum, Macht zu erlangen. Was man dann damit anfängt, hat nichts mit dem zu tun, was man zuvor gelobt hat.« Er hatte sich in Rage geredet und musste eine Pause einlegen. Nach einigen tiefen Atemzügen fuhr er fort: »Ich habe Priester, Kardinäle und Bischöfe gesehen, die sich von Hurenwirten freie Frauen haben bringen lassen, die ihnen dann unter der Kutte zur Hand gegangen sind, während die Herren den Umbau eines Klosters besprochen haben.«
»Großvater!« Heilwig spürte, wie ihr die Hitze ins Gesicht schoss. »Das ist Sünde!«
Wieder lachte er heiser. »Davon spreche ich, Kind. Es ist mehr Sünde in der Welt als Gottesfurcht. Daran wird die Menschheit zugrunde gehen.«
Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Konnte sie ihn jetzt bitten, ihr ungeborenes Kind zu segnen? Und dann brauchte er vielleicht ein wenig Ruhe.
»Ich war nicht besser als sie«, sagte er in diesem Moment leise.
»Aber das ist doch nicht wahr«, widersprach sie augenblicklich. »Du warst ein gottgefälliger Mann, das weiß ein jeder.« Sie selbst wusste das im Grunde nicht. Sehr viel hatte sie nicht an seinem Leben teilgehabt.
»Erst seit ich in das Kloster Marienfeld ging. In der Zeit davor, als ich noch weltliche Macht hatte, da war ich gefürchtet.«
»Du bist nicht immer Mönch gewesen?« Heilwig war überrascht.
»Nein, mein Kind. Schon vor deiner Geburt bin ich Mönch geworden, doch zuvor war ich Ritter und Regent von Lippe. Ich habe zwei Städte gegründet.«
»Das wusste ich nicht.«
»Wie ich dir sagte, schon vor deiner Geburt habe ich die Regentschaft an deinen Vater abgetreten und bin in das Kloster gegangen. Es wundert mich nicht, dass in deiner Familie nicht darüber gesprochen wird.« Ein abschätziges Lächeln erschien auf seinen Lippen. »Du wirst dich fragen, warum ich das getan habe.« Sie nickte. »Gott hat mich für mein Brennen und Rauben, für meine Gier nach Macht, für das Leid, das meine Untertanen durch mich erfahren haben, mit zwei lahmen Füßen bestraft. Die Zisterzienserbrüder haben mich geheilt. Das war das Zeichen. Ich habe es verstanden und bin in ihr Kloster eingetreten.« Er griff nach ihrer Hand, die auf seiner Bettdecke ruhte. »Dort habe ich gesehen, was wahrer Reichtum ist. Bruder Magnus hat mein Leben aufgeschrieben. Ich habe ihm alles erzählt. Aber ich glaube kaum, dass mein Sohn oder dein Gatte die vielen Rollen lesen werden. Darum musst du ihnen den rechten Weg zeigen. Bring sie der Kirche zurück!«
»Wie soll ich das denn anstellen? Ich bin nur eine Frau. Wer wird schon auf mich hören?« Sie senkte den Kopf. »Außerdem tust du Adolf Unrecht. Er ist ein guter Mann, der zur Kirche gehört.«
»Warum ist er dann nicht an deiner Seite? Du trägst sein erstes Kind unter dem Herzen, und er lässt dich allein auf eine gefahrvolle lange Reise gehen.« Seine Stimme wurde allmählich schwächer.
»Wie kannst du so etwas sagen, Großvater? Du weißt, dass er den ewigen Kampf seines Vaters fortführt, den Kampf um Holstein und um die stolze Stadt Lübeck.« Sie spürte nur zu deutlich, dass sie sich mit ihrer Rede selbst überzeugen wollte. Ihr Gatte hatte auch gute Seiten, gewiss, aber sie hatte ihn auch schon hart und unerbittlich erlebt. Und natürlich hatte sie ihn gebeten, sie zu begleiten, was er mit einer Handbewegung fortgewischt und mit einem gehässigen Lachen abgelehnt hatte.
»Ja, ich weiß.« Es klang wie ein Stöhnen, als würde es ihn schmerzen, dass Heilwigs Gatte Adolf IV. sich mühte, alte Herrschaftsgebiete zurückzubekommen.
»Adolfs Vater besaß die Stadtherrschaft, der Dänenkönig Waldemar hat diese zu Unrecht inne.«
»Rede nicht so daher.« Es war nur noch ein Flüstern. »Dein Mann setzt dir derlei Unfug in den Kopf. Aber ich sage dir, dass hinter König Waldemar einer der redlichsten, gottesfürchtigsten Männer steht, die ich je getroffen habe.«
Sie sah ihn neugierig an, ohne zu verstehen, worauf er hinauswollte oder warum er ihr all das erzählte.
»Wenn dein Gatte die Stadtherrschaft über Lübeck von Waldemar zurückhaben will, kämpft er auch gegen Albrecht von Orlamünde aus dem Geschlecht der Askanier. Er aber war stets großzügig der Kirche gegenüber wie kein Zweiter. Er hat zwei Klöster gegründet, und mit ihm unternahm ich eine Kreuzfahrt gegen die heidnischen Livländer. Albrecht ist fromm im Herzen, Kind. Er hat wie ein Held gekämpft, um die Kirche von ihren ungläubigen Feinden zu befreien. Wer gegen ihn ist, ist auch gegen Gott.«
Heilwig erschauderte. Sie hatte den Namen des Grafen Albrecht von Orlamünde schon gehört, ausgespien von den Lippen ihres Gatten.
»Überlege dir gut, auf welcher Seite du stehst«, sagte er und legte die Hand mit dem Bischofsring auf ihren Bauch. »Entscheidest du dich falsch, wird Gott dich strafen, so wie er deinen Gatten strafen wird.«
Lübeck im März 1226 – Esther
Es hatte über Nacht geschneit. Ganz heimlich hatte sich ein weißes Tuch über die Gassen und die Quartiere der Handwerker und Ackerbürger gelegt. Esther liebte Schnee. Zwar bedeutete er noch mehr Mühsal, als der Alltag ohnehin für sie bereithielt, doch deckte er all die abscheulichen Gerüche zu, die sonst durch die junge Stadt Lübeck waberten, und er dämpfte auch den Lärm, der sie manches Mal um den Verstand zu bringen drohte. Wenn es schon im Skriptorium ihres Bruders allzu oft ohrenbetäubend zuging, wollte sie wenigstens draußen die Laute der Natur genießen, das Zwitschern der Vögel, das Grunzen der Schweine und das dunkle Rufen der Rinder, die morgens auf die Weiden und abends wieder in die Stadtmark getrieben wurden, und nicht zuletzt das leise Wiehern der Pferde. Stattdessen bekam sie allezeit nur das Hämmern und Feilen und Brüllen zu hören, das von allen Seiten von den vielen Baustellen erklang. Ein jeder war stolz auf die aufstrebende Stadt Lübeck, die im Jahre des Herrn 1226 höchstes Ansehen genoss. Esther dagegen war zwar fasziniert davon, wie Schritt für Schritt ein stattliches Rathaus und, man stelle sich vor, sogar ein Dom wuchsen und in der Alfstraße und der Fischstraße gar Bürgerhäuser aus Backstein entstanden, doch der allgegenwärtige Tumult, das ständige Getöse gefiel ihr keineswegs. Gerade erst hatte man die Stadtmauer fertiggestellt. Wollte denn dieses zügellose Wachsen des einst beschaulichen Lübecks ihrer Kindheit nie enden?
Sie vertrieb die Gedanken an ihre Kinderzeit und verließ die einfache Holzhütte, die sie mit ihrem Bruder bewohnte. Sie freute sich wie ein kleines Mädchen über die weiße Pracht und spürte, wie ihre Zuversicht und ihre Lebensfreude zurückkehrten. Am Vortag hatte sie sich entsetzlich gefühlt. Der Winter war schon fort, doch der Frühling wollte noch nicht kommen. Tagaus, tagein war es grau und feucht. Ihr Bruder Kaspar war missmutig, denn in der kalten Jahreszeit hatte er Not, das Auskommen für sich und seine Schwester zusammenzubringen. Die Zeit, in der er Dokumente für Kaufleute schreiben oder wichtige Unterlagen kopieren konnte, war kurz. Die Sonne ging spät auf und früh wieder unter. Ständig wurde seine Tinte zäh, und er musste sie aufwärmen. Von seinen Fingern gar nicht zu reden. Lange konnte er den Federkiel nicht halten, bis sie steif vor Kälte waren.
Wenn Esther es recht bedachte, war ihr Bruder zu allen Jahreszeiten missmutig. Zwar war er ein herzensguter Kerl, der sich treu um sie sorgte, doch schimpfte er im Winter über die lausigen Umstände, unter denen er das wenige verdiente, was gerade eben zum Leben reichte, und im Sommer klagte er darüber, dass die Arbeitstage nie zu enden schienen. Denn Fleiß, das wusste jeder, war Kaspars Sache nicht.
Sie ließ die einfache Behausung hinter sich und machte sich auf den Weg zur Trave. Wie fast immer, wenn sie in den Gassen oder am Flussufer unterwegs war, hatte sie ein Messer bei sich. Vielleicht konnte sie ein wenig Eichenrinde schneiden. An diesem Tag hoffte sie jedoch eher darauf, ein kleines Stück gebrannten Ziegel oder gar einen rostigen Hufnagel zu finden. Groß war diese Hoffnung nicht, aber es fehlte mal wieder an allem, um frische Tinte zu kochen. Und das war nun einmal Esthers Aufgabe. Zwar war es üblich, dass jeder Schreiber seine Tinte selber anmischte, doch Kaspar hatte kein glückliches Händchen dafür. Mal geriet ihm die Tinte zu blass, mal zu zäh. Es war auch schon passiert, dass sich die mühevoll auf das Pergament gebrachten Buchstaben kurze Zeit später auflösten, weil er wieder einmal das rechte Mischungsverhältnis vergessen hatte.
Den derben Wollstoff ihres Umhangs fest um die Schultern gezogen, hielt sie mit einer Hand die Kapuze, die der Ostwind ihr vom Kopf zu fegen drohte. Der Schnee knirschte unter ihren Sohlen, der Ost pfiff ihr ins Ohr und trieb ihr Tränen in die Augen, die sie sich ein ums andere Mal abwischte. Kalt war es. Sie kämpfte sich tapfer voran, sich gegen die Böen stemmend, die sie, wie es schien, am Weitergehen hindern wollten. Doch sie ließ sich nicht aufhalten. Sie spürte, dass sie heute Glück haben und wenigstens eine Zutat finden würde, die sie für ihren Bruder so dringend benötigte. Aber schon nach wenigen Augenblicken wurde ihr klar, dass sie sich selbst etwas vormachte. Falls hier wahrhaftig ein oller Nagel vom Huf eines Pferdes läge, hatte der Schnee ihn zugedeckt. Sie seufzte. Ihre fröhliche Stimmung ließ sie sich dennoch nicht versalzen. Sie konnte ihrem Bruder mit ruhigem Gewissen sagen, dass sie es versucht hatte. Es war ja nicht ihre Schuld, dass ihr niemand die rechten Zutaten vor die Füße legte. So genoss sie die Freiheit, einfach ein wenig durch den Schnee zu stapfen, ihren Schuh dorthin zu setzen, wo noch keiner zuvor einen Abdruck in den weißen Teppich gemacht hatte, und dem Skriptorium mit seiner Enge oder der Hausarbeit zu entkommen.
»Hilfe!«
Esther hatte das sumpfige Ufer der Trave erreicht, das recht weit vom Hafen entfernt lag und noch mit Schilf und Bäumen bewachsen war. Ihr war, als hätte jemand geschrien. Oder war es nur der Wind, der sie an der Nase herumführte?
»Hilfe!«
Nein, jetzt war sie sich sicher, da rief jemand um Hilfe. Wieder und wieder hörte sie das Rufen. Es war eine zarte Stimme, doch die Person, der sie gehörte, schien Todesangst auszustehen und ihre ganze Kraft zusammenzunehmen. Esthers Herz schlug schneller, ihr Blut rauschte vor Aufregung in ihren Ohren. Der Hafen war zu weit, als dass sie von dort einen Hilferuf hätte hören können. Ihre Augen suchten das Ufer ab. Wenn der Wind wie an diesem Tag von Osten kam, drückte er viel Wasser in die Trave. Es stieg manches Mal sehr schnell an und leckte über den Uferrand. Wer nicht aufpasste, geriet leicht in den reißenden Fluss. Nicht umsonst hielt sie stets gehörigen Abstand. Einen Strom, ob er ruhig dahinfloss oder seine ganze gewaltige Kraft zeigte, von der Ferne anzuschauen war ihr ein Vergnügen, ihm zu nahe zu kommen war es nicht.
Da, eine Kinderhand! Sie ragte nicht sehr weit von der Uferböschung aus dem eisigen Wasser.
»Warte, ich helfe dir!«, schrie sie.
Das war leichter gesagt als getan. Sie sah sich rasch um, ob sich etwas finden ließe, das sie dem Ertrinkenden reichen konnte. Da lag ein Knüppel, den der Sturm wohl von einem der mächtigen Bäume geholt hatte. Dick war er, nur leider nicht besonders lang. Warum musste ausgerechnet ihr das passieren? Sie würde den Fluten näher kommen müssen, als es ihr lieb war.
»Ich helfe dir!«, rief sie wieder gegen das Pfeifen und Jaulen des Windes und gegen ihre eigene Furcht an, griff nach dem Ast und lief eilig ein Stückchen die Böschung hinab. Ihre Füße versanken im Morast. Heilige Mutter Gottes, flehte sie innerlich, steh mir bei! Sie musste achtgeben, dass sie nicht ausrutschte und selbst in die eisigen Fluten stürzte.
Ein Kopf tauchte auf, das Gesicht verzerrt vor Angst und Pein. Sie erkannte Petter, den Sohn des Hufschmieds, einen fürchterlichen Bengel, der nichts als Unfug im Sinn hatte. Ganz bestimmt war er mal wieder ausgebüxt. Er ruderte mit den Armen. Offenbar hatte er Esther mit dem Knüppel entdeckt und warf sich in ihre Richtung. Seine Bewegungen verrieten, dass er schon schwach war. Er würde es allein nicht schaffen. Und er musste augenblicklich raus aus dem kalten Wasser. Esther sah sich hilfesuchend um. Warum ließ sich nur keine Menschenseele blicken? Die Antwort konnte sie sich leicht selber geben. Die Leute erledigten das Notwendigste vor ihrer Tür oder rund um den Marktplatz. Wer konnte, blieb im Haus am wärmenden Feuer. Und der Hafen war zu weit. Von dort, wo große Warenposten von Schiff zu Schiff verladen wurden oder gar das Salz aus Lüneburg gelagert und weitertransportiert wurde, hatte sie keine Hilfe zu erwarten.
Ihr blieb keine Wahl. Sie hielt sich an den ausladenden Ästen eines Strauchs, der recht nah am Ufer stand, fest und beugte sich so weit wie möglich zu dem Jungen hinüber. Den knorrigen Ast hielt sie am hintersten Ende fest.
»Kannst du ihn packen?«, brüllte sie.
Petter ruderte erneut, reckte einen Arm in ihre Richtung, ließ ihn aber sogleich wieder erschöpft sinken.
»Mann in de Tünn!«, schimpfte sie. Ihre dunkelblonden Haare waren längst vom Sturm unter der Haube hervorgezerrt worden und wehten ihr nun ins Gesicht. Sie konnte sich nicht darum kümmern, konnte auch auf ihre Angst vor Wasser keine Rücksicht nehmen. Sie musste sich um das Balg des Hufschmieds kümmern. Auf der Stelle. Noch einmal blickte sie sich eilig um. Da war niemand weit und breit. Es nützte alles nichts. Sie schnallte ihre Trippen ab und stellte sie beiseite. Die würden im weichen Boden der Trave nur hinderlich sein. Dann ließ sie den Strauch los, der ihr Halt und Sicherheit gegeben hatte, und machte einen Schritt in das eisige Nass. Die vom Wind getriebenen Wellen leckten augenblicklich an ihrem Bein. Es war so kalt, dass es schmerzte. Wie musste der Junge erst leiden! Sie biss die Zähne aufeinander und machte einen weiteren Schritt, dann noch einen. Der Schlamm unter ihren Füßen gab mehr nach als erwartet. Sie strauchelte. Beinahe hätte sie den Ast verloren, den sie Petter hinstrecken wollte. Mit einem Arm musste sie heftig rudern, damit sie nicht das Gleichgewicht verlor und der Länge nach in den Fluss stürzte. Dann wäre sie verloren. Allmählich gelang es ihr, sich zu fangen und wieder festeren Stand zu finden. Sie reckte Petter den knorrigen Knüppel entgegen.
»Los doch, halt dich fest!«, schrie sie ihn an. Ob es der strenge Ton war, den Petters Mutter zu nutzen pflegte, wenn das Früchtchen es mal wieder gar zu doll trieb, oder ob der Überlebenswille dem Kind noch einmal Mumm verlieh, hätte sie nicht zu sagen gewusst. Jedenfalls griff Petter nach dem Ende des Holzes und ließ es nicht mehr los. Esther zog mit aller Kraft. Mit den nassen Sachen war der Knirps ein schwerer Brocken. Ihr Atem ging stoßweise und stieg in kleinen Wolken von ihren Lippen auf.
»Lasst mich das machen, Weib!« Die tiefe Stimme war ganz plötzlich hinter ihr aus dem Nichts aufgetaucht.
Esther konnte sich nicht umsehen, aber ihr fiel ein Stein vom Herzen. Irgendjemand war doch noch an der Trave unterwegs.
»Petter ist ins Wasser gefallen. Allein kriege ich ihn nicht raus«, sagte sie atemlos. Schon war jemand neben ihr. Sie erkannte den Müllerssohn, den sie schon manches Mal auf dem Markt gesehen hatte. »So ein Segen, dass Ihr da seid«, japste sie.
Der junge Müller nahm ihr den Ast aus der Hand. »Geht aus dem Wasser«, kommandierte er.
»Aber ich …«
»Nun geht schon, Ihr holt Euch ja den Tod!« Noch während er sprach, hatte er den Jungen herangezogen. Der rührte sich nicht mehr.
Esther starrte gebannt auf den Körper des Kleinen. Dann tat sie nur zu gerne, was man ihr gesagt hatte. Langsam und vorsichtig drehte sie sich um und stieg die Uferkante hinauf. Sie spürte ihre Füße nicht mehr und begann am ganzen Körper zu zittern, doch sie war unendlich erleichtert, wieder festen Boden unter sich zu haben. Der junge Müller kam mit Petter auf dem Arm gleich nach ihr aus dem Wasser. Der alte Müller, der augenscheinlich mit seinem Sohn unterwegs gewesen war, hatte seinen Mantel ausgezogen, wickelte Petter darin ein und übernahm den reglosen Körper des Jungen. Ohne ein Wort machte er sich mit dem Knaben eilig davon.
Esther blieb mit dem jungen Müller zurück. Beide waren bis zur Hüfte nass.
»Nichts wie nach Hause«, sagte er.
Sie nickte. Ihre Zähne schlugen aufeinander.
»Du liebe Zeit, ist das kalt«, brachte sie klappernd hervor. »Warum muss ich bei dem Wetter auch an der Trave herumlaufen, anstatt in meiner Kammer zu bleiben?«
»Dem Herrn sei Dank, dass Ihr hier herumgelaufen seid. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn Ihr nicht zur Stelle gewesen wärt.«
Er hatte recht. Ihr Herz machte einen Hüpfer vor Freude. Bengel hin oder her, Petter wäre jetzt tot, wenn sie ihn nicht gehört hätte.
»Aber ohne Eure Hilfe hätte ich es nie geschafft.«
»Doch, hättet Ihr. Es hätte nur etwas länger gedauert.«
»Zu lange womöglich. Dann wäre der Junge doch noch erfroren«, gab sie zu bedenken.
Schlotternd liefen sie nebeneinander her auf den Marktplatz zu.
»Wollen wir hoffen, dass er nicht schon erfroren ist«, murmelte Esther, die den Anblick des leblosen Kindes nicht vergessen konnte.
Als sich ihre Wege am Markt trennten, fiel ihr auf, dass sie nicht einmal den Namen des jungen Müllers kannte.
Zu dem winzigen Querhaus, in dem die kleine Schreibstube untergebracht war, die sich kaum ein Skriptorium nennen durfte und die sich ihr Bruder mit zwei anderen Schreibern teilte, war es nicht so weit wie nach Hause. Also hielt sie darauf zu. Dort gab es wenigstens eine Feuerstelle, an der sie sich wärmen und ihre Kleider trocknen konnte.
Kaspar war allein, als sie eintrat. Mit einem schweren Holzhammer schlug er gerade auf die Galläpfel ein, die Esther im vergangenen Herbst gesammelt hatte. Wie üblich ging er ohne jegliches Gefühl vor, so dass die kostbaren kleinen Kugeln durch die Gegend sausten.
»Wo kommst du denn her? Und wie siehst du aus? Deine Lippen sind ja blau wie der Lapislazuli.« Kaspar starrte seine Schwester an, den Hammer in der Luft zum nächsten Schlag bereit. Erst jetzt fiel sein Blick auf ihren Rock, und er ließ das Werkzeug sinken. »Und du tropfst, als hättest du mit deinem Kleid in der Trave gestanden.«
»Ich habe mit meinem Kleid in der Trave gestanden. Ich hätte es bei der Kälte schlecht ausziehen können.«
Immer stärker schlugen ihre Zähne aufeinander.
»Aber was wolltest du denn bei dieser Kälte in der Trave?« Kaspars buschige rote Augenbrauen schoben sich nach oben, dass sich die Stirn in Falten legte. »Und überhaupt, was hat dich dazu bewegt, freiwillig ins Wasser zu steigen, wo du doch sonst sicherheitshalber einen großen Bogen darum machst?«
»Es kann keine Rede davon sein, dass ich etwas im Fluss wollte oder freiwillig hineingestiegen bin.« Sie warf einen getrockneten Fladen in die Flammen, um das Feuer ein wenig zu schüren. »Der Fluss führt Hochwasser, und der Hufschmiedsche Petter ist hineingestürzt.«
»Und du hast ihn gerettet?« Ihm war die Bewunderung für seine kleine Schwester deutlich anzusehen.
»Nicht allein«, sagte sie und erzählte ihm die ganze Geschichte. Dabei stand sie so nah an der Feuerstelle, wie es ihr nur möglich war. Den Stoff ihres Rocks breitete sie mit noch immer steif gefrorenen Fingern aus, damit er schnell trocknen sollte.
»Vitus wird Augen machen, wenn du ihm das erzählst«, brachte Kaspar hervor, als er alles angehört hatte.
»Wird er nicht, weil ich ihm nichts erzählen werde.«
Kaspar holte Luft, um zu widersprechen.
»Und du wirst ihm auch nichts erzählen«, forderte sie ihn auf. Ganz langsam verebbte ihr Zittern, und ihre Lebensgeister kehrten zurück. Wenn sie nur nicht krank wurde. Ein Mittelchen von dem Quacksalber auf dem Markt konnten sie sich nicht leisten. Nicht im Winter. »Er würde sich nur aufregen und mich dafür tadeln, dass ich bei dem Wetter am Traveufer unterwegs war.«
Wieder wollte Kaspar etwas sagen, war jedoch glücklicherweise ein wenig langsam, wie so oft.
Da sie ahnte, dass er sich erst jetzt fragte, was sie dort denn wohl gewollt habe, lenkte sie ihn ab: »Du sammelst jetzt besser die Galläpfel ein. Wir können es uns nicht leisten, dass du sie in alle Winkel schießt und welche verlorengehen. Es ist schließlich noch lange hin, bis ich wieder neue sammeln kann.« Sie rang sich ein Lächeln ab. »Ich gehe rasch nach Hause und ziehe mir etwas Sauberes an. Wenn ich zurück bin, kümmere ich mich um die Gallen.«
»Ich wollte dir nur die schwere Arbeit abnehmen«, gab er zurück. »Diese harten Dinger zu zertrümmern ist keine Arbeit für ein Mädchen. Dafür braucht es Kraft.«
»Nein«, korrigierte sie lächelnd, »dafür braucht es Fingerspitzengefühl. Eben darum ist es gerade eine Arbeit für mich.«
Lübeck lag auf einer Halbinsel, die Esther an den Rücken einer Schildkröte erinnerte, von der sie einmal eine Zeichnung gesehen hatte. Der Panzer fiel zur einen Seite zur Trave ab, und dort stand das Querhaus, in dem das Skriptorium untergebracht war. Auf der anderen Seite des Schildkrötenpanzers, der sich zur Wakenitz neigte, lag das kleine Holzhaus, in dem sie mit ihrem Bruder Unterschlupf gefunden hatte. Sie musste also an jedem Tag mindestens zweimal hinauf zur höchsten Stelle und an der anderen Seite wieder bergab laufen, was gerade im Winter bei Schnee und Eis nicht immer einfach war.
Als sie das Kleid, an dem der Schlamm aus dem Fluss nun getrocknet war, gegen ein anderes tauschte, seufzte sie tief. Sie besaß nicht viele Kleider oder Röcke und nur einen Umhang. Von Schuhen gar nicht zu reden. Kaspar sorgte schon dafür, dass sie ständig zu waschen hatte, denn er schaffte es fast immer, die Tinte auf seinen Ärmeln oder Beinkleidern zu verteilen, statt sie auf das Pergament zu bringen. Sie dagegen ging besonders vorsichtig mit ihren Sachen um, weil sie wusste, dass sie immer ein bisschen dünner wurden, wenn man sie zu oft im Zuber schrubbte. Ärgerlich betrachtete sie ihren Umhang. Sie klopfte den groben Schmutz ab. Das Kleid würde sie auf jeden Fall waschen müssen, mit dem Umhang musste es eben so gehen. Sie konnte sich jetzt nicht damit aufhalten. Schon war sie wieder zur Tür hinaus, die Füße eiskalt in den noch nassen Schuhen.