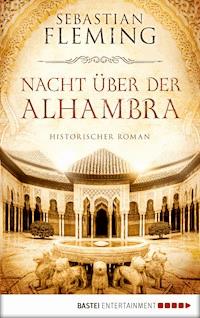
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1453. Sultan Mehmed erobert Konstantinopel. Doch er will mehr: die Herrschaft über das Abendland. Dazu will er das Reich der maurischen Muslime in Spanien wieder stärken und den spanischen König stürzen. Vor dem Hintergrund des epochalen Kampfes müssen sich der aus Spanien stammende türkische Muslim Joanot und die spanische Christin Juana bewähren, bis sie eine schicksalhafte Liebe zusammenführt.
Ein Roman um Treue und Verrat, Machtgier und Leidenschaften - und ein ferner Spiegel unserer Epoche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 827
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
INHALT
ÜBER DIESES BUCH
1453. Sultan Mehmed erobert Konstantinopel. Doch er will mehr: die Herrschaft über das Abendland. Dazu will er das Reich der maurischen Muslime in Spanien wieder stärken und den spanischen König stürzen. Vor dem Hintergrund des epochalen Kampfes müssen sich der aus Spanien stammende türkische Muslim Joanot und die spanische Christin Juana bewähren, bis sie eine schicksalhafte Liebe zusammenführt. Ein Roman um Treue und Verrat, Machtgier und Leidenschaften – und ein ferner Spiegel unserer Epoche.
ÜBER DEN AUTOR
Sebastian Fleming studierte Germanistik und Geschichte. Er schrieb für das Theater, den Rundfunk, das Fernsehen und Bücher zu historischen Themen. Bei Bastei Lübbe ist von ihm mit großem Erfolg der Epochenroman DIE KUPPEL DES HIMMELS erschienen. Der farbenprächtige Renaissanceroman über die Erbauung des Petersdoms wurde in zahlreiche Sprachen, u. a. ins Italienische übersetzt.
SEBASTIAN FLEMING
NACHT ÜBER DER ALHAMBRA
Historischer Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München,unter Verwendung von Motiven von © shutterstock:Rolf E. Staerk | Alex Tanya | trabantos
Kartenillustration: © Markus Weber, Guter Punkt München
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-732-55032-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
DRAMATIS PERSONAE
Neben den Protagonisten Nuria/Jorge und Joanot/Yahya treten in diesem Roman eine Fülle von Figuren an Schauplätzen im ganzen Mittelmeerraum auf. Der Übersichtlichkeit halber sind hier nur die wichtigsten Personen aufgeführt.
Bei den kursiv gesetzten Namen handelt es sich nicht um historische Persönlichkeiten.
Konstantinopel/Stambul, Osmanisches Reich
Péré Julia (gest. 1453), Kaufherr und Konsul der Katalanen
María, seine Frau
Joanot, sein jüngster Sohn/Yahya ibn Catalano
Rosalie, seine ältere Tochter
Demetrios, Grieche, Leiter des Kontors
Mehmed II. (1432–1481), Sultan des Osmanischen Reiches
Yusuf Pascha, Minister Mehmeds II.
Ruggiero da Ischia, italienischer Abenteurer und Spitzel für Mehmed II.
Edirne, Osmanisches Reich
as-Schirazi, persischer Sufi, Lehrer von Yahya
Dorf in Andalusien
Isabella de Solís/Zoraya
Nuria de Solís, ihre jüngere Schwester/Jorge de Castro
Segovia, Spanien
Enrique IV., »el impotente«, (1425–1474), König von Kastilien und Léon, Sohn von Juan II. (1405–1454) aus dessen erster Ehe
Juana de Avis (1439–1475), Königin von Kastilien, zweite Frau von Enrique IV.
Beltrán de la Cueva (1435–1492), Favorit Enriques IV. und dem Gerücht nach Vater der Tochter der Königin
Andrés de Cabrera (1430–1511), Marqués de Moya, Schatzmeister Enriques IV.
Alfonso Carrillo de Acuña (1412–1482), Erzbischof von Toledo
Juan Fernández Pacheco y Téllez Girón (1419–1474), Marqués de Villena
Fadrique Enríquez (um 1465–1538), Admiral von Kastilien
Juan de Torquemada (1388–1468), Kardinal
Luis de Zamora, Waffenmeister des Marqués de Villena
Arévalo, Spanien
Isabella von Portugal (1428–1496), zweite Frau des verstorbenen Juan II. von Kastilien und Léon
Isabel (1451–1504), ihre Tochter, Halbschwester Enriques IV., Johanna die Katholische
Alfonso (1453–1468), ihr Sohn, Halbbruder Enriques IV.
Pedro de Bobadilla, königlicher Hausverwalter
Beatriz de Bobadilla (1440–1511), seine Tochter, Erzieherin der Infanten
Sevilla, Spanien
Hernandez de Cardenas, Waffenmeister
Gustavo, sein Verwalter
Yehuda Sasportas, jüdischer Arzt
Lucia, des Ehebruchs beschuldigte junge Frau, vergewaltigt von Luis de Zamora
Granada, Spanien
Abu Nasr Said al-Musta’in bi-llah (gest. 1465), Emir von Granada
Abu e’Hasan Ali (gest. 1485), Emir von Granada, Saids Sohn
Yehuda Abrabanel, jüdischer Kaufmann
Zoraya/Isabella de Solís
Hasan ibn Khaldin, Philosoph und Dichter
Muhammad ibn Yusuf bin Hasan as-Sarraj, Anführer der Sippe der Sarraj
Murad al-Abdullah al-Banigash, Anführer der Sippe der Banigash
Barcelona, Spanien
Fernando de Aragón (Ferdinand der Katholische, 1452–1516), als Ferdinand V. mit seiner Frau Isabel von 1474–1504 König von Kastilien und Léon, ab 1479 als Ferdinand II. König von Aragón
TEIL I
BLUTMOND
»Wenn wir die Wahrheit gestehen wollen, hat die Christenheit seit vielen Jahrhunderten keine größere Schmach erlebt als jetzt; denn in früheren Zeiten sind wir nur in Asien und Afrika, also in fremden Ländern geschlagen worden, jetzt aber wurden wir in Europa, also in unserem Vaterland, in unserem eigenen Haus, an unserem eigenen Wohnsitz aufs Schwerste getroffen.«
Enea Silvio Piccolomini, 1454auf dem Reichstag zu Frankfurt am Main
1
Stambul, Osmanisches Reich
Als die schwere Tür in seinem Rücken zuschlug, fühlte er sich ausgesetzt wie ein überzähliger Welpe. Seine Augen, die in wachsender Panik das Halbdunkel durchsuchten, fanden weder Vater noch Mutter, nicht Schwestern noch Brüder und füllten sich allmählich mit Tränen, hinter denen der Vorraum der Kirche verschwamm.
»Jungs weinen doch nicht!«, hörte er plötzlich eine helle Mädchenstimme.
Er wandte sich um. Vor ihm stand ein Mädchen, etwa in seinem Alter, mit einer ungebändigten schwarzen Haarflut über einem schmalen Körper. In ihrem Blick tummelten sich der Spott und eine vermutlich unbezwingbare Aufsässigkeit. Als sie lachend den Kopf nach hinten warf, flogen ihre Haare auf wie eine Schar schwarzer Schwäne.
»Was weißt du schon von Jungs?«, gab er empört zurück und rieb sich mit den Fäusten über die Augen. »Wer bist du?«
»Nuria. Und du?«
»Joanot Julia. Mein Vater ist Don Péré Julia, Konsul der Katalanen in Konstantinopel.«
Nuria lachte laut auf. »Konstantin-Popel?«, prustete sie und legte scheinbar erschrocken die Hand vor den Mund. In ihren Augen jedoch stand das Vergnügen, ihn zu necken.
»Konstantinopel heißt Stadt Konstantins«, erklärte Joanot und stampfte mit dem Fuß auf.
Dem Mädchen stand offenbar ganz und gar nicht der Sinn nach einer vernünftigen Unterhaltung. »Konstantins Popel also. Und wie heißt dein Haus? Joanots Popel?«
Wütend machte er einen Schritt auf das Mädchen zu.
Nuria sprang zurück und blitzte ihn herausfordernd an. »Fang mich, wenn du kannst, Joanot-Popel!« Sie wandte sich um und lief vor ihm weg, wobei sie achtgab, nicht zu flink zu sein, denn Joanot sollte die Hoffnung nicht verlieren, ihrer habhaft zu werden. Sonst hätte das Spiel ihr keinen Spaß bereitet.
»Ich kriege dich!«, brüllte der Junge und rannte ihr nach.
»Niemals!«
Doch als sie versuchte, Joanot auszuweichen, stolperte sie über die Beine einer am Boden sitzenden Bettlerin. Das Mädchen kam ins Straucheln und schlug mit der Stirn gegen die scharfe Kante einer Steinnische, in der ein Öllicht brannte.
»Au«, schrie sie, und als er bei ihr war und sie sich ihm zuwandte, blutete es über ihrer rechten Augenbraue. »Teufel auch, Teufel auch«, fluchte sie.
Joanot stand einen Moment hilflos da, dann zog er sein Leinenhemd aus der Hose, riss ein Stück davon ab und drückte es auf die Wunde. Eine Hand, die sich wie trockenes Laub anfühlte, schob ihn mit erstaunlicher Kraft beiseite.
Die Bettlerin hatte plötzlich ein Tuch in der Hand, spuckte darauf und presste es auf die Stirn des Mädchens. »Aus dem Weg, du Tunichtgut. Da habt ihr’s, ihr dummen Kinder! Der Herr will es nicht leiden, dass ihr in seinem Haus Schabernack treibt.«
»Au … au … au … au«, wimmerte das Mädchen.
»Die Wunde wird heilen, aber du wirst eine kleine Narbe über dem Auge davontragen. Und das muss so sein. Denn dieses Mädchen, Joanot, ist für dich bestimmt, wie dieser Junge, Nuria, für dich auserwählt ist. Und an der Narbe über dem Auge, Joanot, wirst du sie an dem Tag erkennen, an dem …«
Türen fielen ins Schloss, Fensterläden wurden zugeklappt. Das dumpfe Geräusch von Holz auf Holz, das Schaben von schweren Kisten auf den Fliesen des Fußbodens drängten sich in Joanots Traum, bevor die Bettlerin ihren Satz beendet hatte, und zerrissen die Bilder, als wären sie Schemen hinter dem weißen Pergament, das man für ein Schattenspiel aufgespannt hatte. Joanot setzte sich auf und rieb sich die Augen.
Vor seiner Zimmertür tobte ein Aufruhr durch die Flure und Räume. Die Neugier trieb ihn aus dem Bett. Ein kurzer Blick zu den Schlafstätten seiner Brüder belehrte ihn, dass diese die Nacht nicht zu Hause verbracht hatten. Das geschah des öfteren seit dem Tag, an dem der Türke Mehmed II. Konstantinopel belagerte und sich Joanots Vater mit seinen älteren Söhnen an der Verteidigung der Stadt beteiligte. Seit Anfang April 1453, als der Sultan seine Armee vor der Stadt versammelt hatte.
Der Neunjährige tippelte zur Tür, öffnete sie und befand sich sogleich im Mittelpunkt des Gewühls. Sein Vater schritt durch den Hauptkorridor. Mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete, gab er Joanots Brüdern, den Dienern und den Angestellten des Kontors, so sie ihren Dienstherrn noch nicht verlassen und Zuflucht in den Kirchen gesucht hatten, Anweisungen, wie sie Fenster und Türen zu verbarrikadieren hatten.
Joanots Blick blieb an einer hageren Gestalt hängen, die mühsam eine Kiste hinter sich herzog. Der alte Mann zwinkerte ihm aus seinen graublauen Augen zu. Der Junge hing sehr an Demetrios, der das Kontor des Konsuls leitete. Solange er denken konnte, stand der Grieche schon im Dienst seines Vaters, und auch Demetrios hatte den Jungen ins Herz geschlossen. Plötzlich legte sich eine Hand auf Joanots Schulter.
»Komm, Joanot, frühstücken!«, sagte María Julia und sah ihren Jüngsten liebevoll an.
Er schlang die Arme um sie und drückte sich eng an sie. »Lass mich nie wieder allein, Mare! Nie wieder, hörst du?«
Erstaunt runzelte sie die Stirn. »Wann habe ich dich denn allein gelassen, Joanot?«
»In meinem Traum.«
»Was für ein garstiger Traum, mein armer Junge.« Sie strich ihm über den Kopf. »Träume sind nur Schäume. Komm, lass uns essen.«
Ein paar Stunden später rutschte Joanot auf der vordersten Bank in der kleinen Kapelle des Hauses hin und her und ahmte mit wachsendem Vergnügen den Gesichtsausdruck des leidenden Jesus am Eichenholzkreuz nach. Doch das genügte ihm bald schon nicht mehr, und er steigerte sich in ein immer wilderes Fratzenschneiden hinein. Dabei hoffte er auf ein Donnerwetter, auf irgendetwas, das ihn aus der Ödnis der Andacht befreien würde. Wenn Jesus Christus schon Gott ist, dachte er, würde ihm doch keine Dorne aus der Krone brechen, von seinem Kreuz zu steigen und mit ihm in der Stadt herumzustromern. Aber der Gekreuzigte war über die Blasphemie erhaben und litt stattdessen lieber stoisch weiter.
Joanots Mutter, die in der Bank hinter ihm saß, schwante offenbar, was die ruckartigen Bewegungen ihres Jüngsten bedeuteten, und versetzte ihm einen sanften Stoß in den Rücken. Mühsam riss er sich zusammen, zwang sich zu einem ernsthaften Gesichtsausdruck und leierte zum tausendsten Male leise das Vaterunser herunter: »… und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Amen.« Er schloss mit den üblichen Worten: »… und beschütze Rosalie und Blanca, Juan und Ferante und natürlich Mare und Pare.« Aus lauter Überdruss fügte er dem Gebet im Stillen einen weiteren Schluss an: … und schenke mir einen schönen Pisspott, und führe mich immer rechtzeitig zu ihm hin, denn mein ist die Pisse in Ewigkeit. Und ich will nicht, dass sie sich in mein Bett ergießt. Und Mare möchte das übrigens auch nicht und Pare schon gar nicht. Da hast du’s! Amen.
Joanots Augen blitzten mutwillig, während er mühsam ein Kichern unterdrückte. Als er sich wieder beruhigt hatte und die Langeweile sich erneut wie ein schweres Tuch um seine Schultern legte, drehte er sich mit einer Leidensmiene, wie nur Kinder sie aufzusetzen verstehen, zu seinem Vater um, der ganz in sich versunken schien. Dann wanderte Joanots Blick zu seiner schönen, rothaarigen Mutter und den beiden Brüdern Juan und Ferante. Schließlich schaute er zu seinen beiden Schwestern Rosalie und Blanca, die links und rechts von ihm knieten. Doch alle waren mit großem Ernst in ein Zwiegespräch mit Déu, mit Gott versunken. Enttäuscht, nicht einen einzigen antwortenden Blick erhascht zu haben, wandte er sich wieder dem kleinen Altar zu.
Heiliger Pisspott, nahm der Knabe seine lästerlichen Gedanken wieder auf, die ihm aber kein Vergnügen mehr bereiteten, wann hören die endlich auf? Er sehnte sich danach, die Kapelle zu verlassen, auf dem Vorplatz herumzujagen. Und wenn das schon nicht ginge, weil sie sich im Krieg befanden, dann wollte er sich wenigstens im Kontor, besser noch im Warenlager verstecken und sich vom alten Demetrios aufspüren lassen.
Überhaupt der Krieg! Er hatte ihn gründlich satt, diesen widerlichen Spielverderber, der die Farben stahl und den Frohsinn erdrosselte wie die jungen Tauben für die Tafel. Ein grauer, freudloser Bursche wie der verrückte Georgios, der in Lumpen gehüllt, schimpfend, fluchend und speiend durch die Straßen lief. Für die Jungen war es eine Mutprobe, ihn zu ärgern. Doch wegen dieses dreimal verfluchten Krieges durfte Joanot nicht mehr auf die Straße, seinetwegen sah er seinen Vater und seinen älteren Bruder oft tagelang nicht, seinetwegen reagierte seine humorvolle und zu manchem Schabernack aufgelegte Mutter oft gereizt. Und wegen des Krieges saßen sie nun schon seit Stunden in der Hauskapelle, beteten und machten so ernste Gesichter, als hätte der Blitz das Haus getroffen und Mutters bestes Geschirr, das sie von ihren Eltern in die Ehe mitbekommen hatte und das nur an Sonntagen benutzt wurde, zerschlagen.
Der Überdruss roch nach verbranntem Wachs. Auf dem Marmoraltar mit dem Kruzifix und dem Bild der Gottesmutter genügten sonst drei Lichter – heute flackerten zum ersten Mal gleich sieben Kerzen, für jedes Familienmitglied eine, und wenn ein Licht zu verlöschen drohte, wurde es sofort durch ein neues ersetzt.
Der Rauch der Kerzen schlängelte sich zum Tonnengewölbe der Kapelle hoch wie das Seil eines indischen Fakirs, dem Joanot einmal auf dem Jahrmarkt zugesehen hatte. Tagelang hatte er von diesem Erlebnis in unterschiedlicher Weise geträumt, mal als Spaß, mal als Erinnerung, aber auch als Nachtmahr mit dem Seil als Drachen, der sein Haupt erhob und den kein Mann, schon gar nicht ein kleiner Junge wie er, sondern nur der Erzengel Georg zu besiegen vermochte. In Joanots Vorstellung vermischte sich der Seiltrick des Fakirs mit dem Tafelbild, auf dem Sankt Georg den Drachen tötete. Ein Maler in Barcelona hatte es seinen Eltern zur Hochzeit geschenkt, und nun hing es links von ihm in der Kapelle. Der Heilige sah ein bisschen so aus wie sein Vater.
Barcelona – der Name der katalanischen Hafenstadt klang in seinen Ohren nach Wunder, nach Geheimnis und Zauberei. Seit elf Jahren lebte seine Familie nun schon in Konstantinopel, denn der Vater hatte seine Faktorei an den Bosporus verlegt, weil es auf der Welt keinen besseren Ort für den Fernhandel gab. In der alten Kaiserstadt trafen sich Ost und West, Nord und Süd. Der schnelle Aufstieg Don Péré Julias zum katalanischen Konsul, zum Vorsteher der kleinen spanischen Kolonie, bestätigte, dass die Entscheidung richtig gewesen war. Die Geschäfte liefen prächtig, und die Familie, allen voran der jüngste Spross, genoss das behagliche Leben im Wohlstand. Obwohl Joanot wie ein kleiner König fröhlich über Konstantinopel als seinem Kinderreich gebot, wuchs in ihm die große Neugier auf Barcelona, so als hätte die unbekannte Heimat sich einen Platz in seiner Seele reserviert. Er empfand ein unerklärliches Heimweh nach der fremden Stadt. Deshalb hatte er Gott auch gebeten, ihn eines Tages über das Meer nach Berselone zu führen, wie sein Vater die Stadt zuweilen auf Katalan nannte. Als Gegenleistung versprach Joanot, täglich zwei Vaterunser zusätzlich zu beten und legte noch das Gelöbnis oben drauf, Blanca nicht mehr an den Zöpfen zu ziehen. Dieses Versprechen bedeutete für den immer zu Streichen aufgelegten Jungen ein echtes Opfer, denn er liebte diese Neckerei über die Maßen, weil dann das runde Gesicht der Schwester so lustig ruckartig nach rechts und nach links schaukelte. Noch mehr liebte er aber ihre Empörung, dann hieß es allerdings, sich schnell aus dem Staub zu machen, wollte er sich nicht eine deftige Ohrfeige einfangen. Einmal war ihm die Flucht missglückt, und seine Wange hatte noch den ganzen Tag gebrannt.
Joanot wandte sich erneut zu seinem Vater um. So viel konnten doch nicht einmal die Erwachsenen erlebt haben, um derart lange mit Gott Zwiesprache zu halten! Allmählich wuchs in ihm der Verdacht, dass es nur so aussah, als ob sie beteten, in Wahrheit aber schliefen.
Diesmal hatte Joanot Glück. Der Konsul schaute auf. Ein Lächeln schlich sich in seine schwarzen Augen, und er öffnete die Arme. Darauf hatte der Junge nur gewartet.
Von der Straße drang Lärm herein, der sich ihnen in beängstigender Geschwindigkeit näherte wie das Knurren eines heranpreschenden Wolfsrudels. Dann brachen Männer mit dicken schwarzen Haarsträhnen, die wie Geißeln von ihren kahlen Schädeln hingen, in die kleine Kapelle ein und streckten ihre Krummschwerter vor sich aus. Joanot zitterte am ganzen Leib. Teufel, dachte er panisch, das sind Teufel. Nie zuvor hatte er Janitscharen gesehen, Angehörige der Elitetruppen des Sultans. Die Männer, deren furchterregende Gestalten sich in dem im Rauch gefangenen Licht der Frühlingssonne abzeichneten, das durch die Fenster fiel, rochen nach Blut, Gemetzel und Tod. Sie stanken so sehr nach der Hölle, dass ihr Geruch Joanot den Atem nahm.
»Ruhig, ruhig«, flüsterte der Vater auf Katalan seinem Jüngsten zu.
Die Janitscharen packten den Konsul und Joanots Brüder und fesselten ihnen mit geübten Griffen im Rücken die Arme. Joanots Mutter griff nach seiner Hand. Gleichzeitig legten sich zwei schwere Pranken auf seine schmalen Schultern und rissen ihn nach hinten. Er schloss die Faust und spürte etwas Spitzes, Kühles. Seine Mutter nickte ihm verschwörerisch zu. Er begriff, dass sie ihm etwas gegeben hatte, dass er unter allen Umständen bewahren musste. Es gelang ihm noch, das kleine Metall in die Hosentasche zu stecken, bevor auch seine Arme auf den Rücken gefesselt wurden. Der grobe Strick schnitt in die weiche Haut seiner Handgelenke. Die Janitscharen trieben ihn hinter seinen Brüdern und seinem Vater aus der Hauskapelle. Sie hatten den Vorplatz gerade erreicht, als Demetrios, der mit großer Anstrengung ein Schwert hochhielt, mit heiserem Gebrüll aus dem Kontor stürzte.
Die Janitscharen starrten ihn verwundert an, dann brachen sie in Gelächter aus. Sie hatten kein Mitleid mit seiner verzweifelten Hilflosigkeit, dieses Gefühl war ihnen fremd – wie alle menschlichen Regungen. Mit seinen dünnen Armen, die ein Leben lang nur die Feder geführt und die Seiten umgeblättert hatten, gelang es dem Kontoristen kaum, den riesigen Zweihänder zu halten, der über Jahre im Kontor an der Wand gehangen hatte. Er war ein Geschenk des Königs von Aragon, weil ihm Péré Julia einst mit einer bedeutenden Summe aus einer Verlegenheit geholfen hatte.
Einer der Janitscharen schlug mit seinem Säbel kurz und kräftig zu. Der Beidhänder fiel scheppernd zu Boden. Als sich Demetrios danach bücken wollte, versetzte der Türke ihm beiläufig, als wäre er eine lästige Fliege einen allerdings gut gezielten Hieb. Demetrios stürzte mit einem herzzerreißenden Aufschrei zu Boden.
Aus den Augenwinkeln sah Joanot, dass das linke Bein des Griechen unnatürlich abgewinkelt dalag und stark blutete.
»Demetrios, lieber Demetrios«, schrie er außer sich und wandte sich um, wollte zu ihm, um ihm zu helfen, aber der Türke hinter ihm stieß ihn vorwärts, wieder und wieder und wieder.
2
Stambul, Osmanisches Reich
Wie sehr hatte er sich gewünscht, wieder an die frische Luft zu kommen! Aber die Luft war nicht frisch. Sie schmeckte nach Rauch und stank nach Urin und Verzweiflung. Himmel und Sonne waren hinter einem schmutzigen Schleier gefangen. Selbst die Kastanien verbargen in diesem Frühling 1453 furchtsam ihre Blüten. Joanot fühlte sich allein. Der Vater und die Brüder hatten nicht einmal den Schatten einer Möglichkeit, Joanot auf dem langen Weg durch die Stadt von der katalanischen Kolonie am Bosporus entlang zum Kaiserpalast zu helfen oder ihn zu trösten, da sie hintereinandergehen mussten. Manchmal patschte er durch aufgeweichten Boden, obwohl es seit Tagen nicht geregnet hatte. Die dürstende Erde trank sich satt am Blut der Menschen.
Starr vor Angst hielt Joanot den Kopf gesenkt, um im Vorbeigehen nicht sehen zu müssen, wie links und rechts von ihm Männer erschlagen oder gefoltert und Frauen vergewaltigt wurden. Und nicht nur Frauen, auch Kinder. Zu gern hätte er sich die Ohren zugehalten. Das Schreien und Wimmern, Gelächter wie tierisches Grunzen, erbarmungswürdiges Geheul und die verzweifelten Melodien eines Flötisten, der gezwungen wurde, zur Hatz aufzuspielen, brandeten zum Himmel auf wie eine Sinfonie der verlorenen Seelen, die Gott um Erbarmen anflehten. Aber Gott schien taub oder verreist zu sein. Vielleicht gelang es ihm auch einfach nicht mehr, sich seiner Barmherzigkeit zu erinnern.
Joanots Augen und Wangen brannten von dem beißenden Qualm, der sich in schwarzen Schwaden durch die Luft drängte. Weil er stolperte, blickte er auf. Auf der Zinne der Seemauer fing ein merkwürdiger Anblick seine Aufmerksamkeit ein. Er brauchte etwas Zeit, um zu begreifen, was er sah, und kniff die Augen zusammen. Als er endlich erkannte, was er eine Weile zu verdrängen versucht hatte, erfasste ihn eine tiefe Traurigkeit. Dort oben stak auf einer Lanze der Kopf eines Mannes. Die Haare flatterten im Wind. Auf dem Schädel saß eine Krähe, die ihm eifrig die Augen aushackte, jetzt, wo er sie nicht mehr benötigte. Joanot meinte, den Toten zu kennen, für einen Moment glaubte er sogar, dass es einer der Bettler war, die gewöhnlich auf den Stufen vor der Hagia Sophia saßen.
Doch sahen nicht alle Bettler gleich aus? Besonders für einen reichen kleinen Jungen, dem der Vater vor dem Besuch des Gottesdienstes ein paar Münzen in die Hand drückte, damit er sie den Bedürftigen schenkte?
Endlich in Blachernae angekommen wurden sie in den Kaisersaal geführt, vorbei an zahllosen türkischen Soldaten und Offizieren, denen der Sieg als schiefes Grinsen ins Gesicht geschrieben stand. Ängstlich schaute Joanot, der seinen Vater oft in den Palast begleitet hatte, sich in dem vertrauten und plötzlich so veränderten Raum um. Fremde statt bekannte Gesichter umgaben den Thron. Raue, ungepflegte Männer, keine Hofbeamten, sondern Krieger. Sie hatten die Wohlgerüche aus dem Palast getrieben. Auf dem Thron saß auch nicht Kaiser Konstantin XI., der große, schöne Mann, den er häufig gesehen und immer bewundert hatte, sondern ein kleiner, hakennasiger Mensch mit Turban. Furcht lähmte das Denken des Knaben.
Plötzlich spürte er einen sanften Druck gegen seinen Arm und wandte den Kopf. Mit seinen gebundenen Händen konnte der Vater Joanot nicht erreichen und hatte ihn deshalb mit der Schulter berührt.
»Was auch immer geschieht«, raunte er ihm zu, »vergiss nie, dass dein Name Joanot Julia ist, ein anständiger katalanischer Name! Und dass wir Christen sind!«
Der Sultan zeigte auf den Konsul.
»Das ist der Agha der Katalanen«, erklärte der Janitscharenführer beflissen.
Mehmed brach in schallendes Gelächter aus. »Da haben dir die Griechen einen schönen Streich gespielt, dich mitten im Kampf allein zu lassen. Jetzt stehst du da wie ein Narr, du Anführer der Katalanen!«
Über eintausend Jahre versanken in den Flammen, weil es kaum noch Römer in Konstantinopel gab, nur noch Griechen. Zu wenige Christen, zu viele Verräter, zu viele Geschäftstüchtige und Feiglinge, dachte der Konsul, von denen sich zu viele in den Kirchen und zu wenige auf den Mauern der Stadt eingefunden hatten. Zu viele Beter, zu wenige Kämpfer. »Viele Griechen haben tapfer an unserer Seite gekämpft«, antwortete er kühl.
»Aber eben nicht alle! Du gibst es also zu, dass du gegen mich gekämpft hast?«, fragte Mehmed wie ein nachsichtiger Vater mit halblauter Stimme, der sich vom Betrug seines Sohnes verletzt zeigt. Joanot spürte die Falschheit in der Stimme des Herrschers.
»Ja, das habe ich!«, entgegnete Don Julia fest.
Der Sultan musterte ihn wortlos und runzelte die Stirn. Joanot kam die einsetzende Stille endlos vor, doch schließlich brach Mehmed sein Schweigen.
»Ich verstehe es nicht, so sehr ich mir darüber auch den Kopf zerbreche. Sei so gütig und erkläre es mir. Du bist doch kein Grieche, kommst vom anderen Ende des Meeres. Warum hast du dann für die Griechen gekämpft? Du hättest fliehen oder dich verstecken können.«
Wieder hatte Mehmed sehr leise gesprochen. So will er wohl alle zwingen, ihm genau zuzuhören, dachte Joanot.
»Ich habe für Christus gekämpft, weil ich ein Christ bin und es meine Pflicht ist, für meinen Glauben einzustehen!«, erklärte der Konsul.
Über den Mund des Sultans huschte ein Lächeln. Er ließ seine rechte Hand ein paar Mal um sein Handgelenk kreisen. »Na, wenn das so ist, gibt es Hoffnung für dich und die deinen. Du musst wissen, dass ich meine Feinde töte. Aber wenn Christus der Grund unserer Feindschaft ist, dann tritt zum Islam über, und Christus steht nicht mehr zwischen uns. Dann sind wir nicht länger Feinde – und du darfst unbehelligt deinem Gewerbe nachgehen. Es gibt ohnehin kein Entrinnen, bald schon werden wir Muslime die Welt beherrschen, wie es von Allah vorgesehen ist.«
Joanot bemerkte, dass der Vater und seine Brüder Blicke wechselten, als redeten sie wie so oft miteinander in einer Sprache, die nur er nicht verstand und die er für sich die Augensprache nannte.
»Nein«, entgegnete der Konsul dem Sultan. »Du kannst mir nur den zeitlichen Tod geben. Verrate ich aber Christus, sterbe ich den ewigen Tod.« Er begann zu beten, nur mit Worten und gesenktem Kopf, denn die Fessel hielt die Hände auf seinem Rücken. »Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.«
Der Sultan wies auf den neunzehnjährigen Ferante. Zwei Janitscharenkrieger ergriffen den jungen Mann und stießen ihn so heftig nach vorn, dass er beinahe gestürzt wäre. Joanots Vater betete ohne Unterlass, auch wenn seine Stimme zu brechen drohte: »Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser …«
Joanot senkte den Kopf. Auf ein Zeichen des Sultans packte einer der Bewacher den Knaben rechts und links am Haupt und riss es hoch.
»Wag es nicht, die Augen zu schließen, sonst lasse ich dir die Lider ausreißen«, drohte ihm der Sultan mit einer donnernden Stimme, die Joanot ihm nicht zugetraut hatte.
Der Konsul unterbrach kurz sein Gebet, um den Sultan um Gnade, um Mitleid für seinen Ältesten, der bereits den Kopf gesenkt hatte, zu bitten. Doch er unterließ es, denn in den kleinen Augen des Herrschers entdeckte er nur die glänzende Lust an der Grausamkeit und setzte das Gebet fort.
Das durch die Brände in der Stadt getrübte Sonnenlicht erhellte den Saal nur schwach, sodass zur Unterstützung Kerzen und Fackeln entzündet worden waren. Joanot aber wünschte sich eine große Dunkelheit, die alles in sich verbergen würde. Die Schergen zwangen Ferante wenige Schritte von ihm entfernt in die Knie – dann sauste das Krummschwert nieder und trennte den Kopf vom Körper seines Bruders. Joanot versuchte verzweifelt, die Welt in Unschärfe zu versenken, blicklos zu blicken.
»Jetzt hast du noch zwei Söhne und dein Leben, Katalane«, sagte der Sultan. »Der Prophet wird dich mit offenen Armen empfangen.«
Der Konsul hielt erneut kurz im Gebet inne und wechselte einen Blick mit dem vierzehnjährigen Juan. Joanot schluchzte auf. »Ruhig, ruhig, mein Sohn. Der Höllenhund kann uns nichts anhaben!« Der Konsul wandte den Kopf zu dem Sultan. »Was kann dein armseliger Prophet mir geben? Vom Himmel herab werde ich dich und deinen Propheten in der Hölle brennen sehen!«
Mehmed schluckte, durchbohrte den Konsul mit seinem starren Blick und gab seinen beiden Gardisten wieder ein Zeichen. Als sie Juan packten, lächelte der Sultan in einem Gefühl der Rache. »Für die Jungfrau Maria!«, rief der Junge stimmbrüchig aus.
»… er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen …«, betete Péré Julia weiter, während das Krummschwert erneut niederfuhr. Wie durch eine makabere Volte des Schicksals rollte der Kopf des jüngeren zu dem des älteren Bruders hin, sodass sie sich im Tode fast zärtlich berührten.
»… und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich …«
Zorn brannte lichterloh im Gesicht des Sultans: »Du Narr, einen Sohn hast du noch – und dein Leben!«
Statt zu antworten, betete Péré Julia nur noch lauter: »Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.«
Der Sultan spuckte aus und wies auf den Konsul, als wollte er ihm seinen Finger wie eine Lanze ins Herz bohren. Daraufhin rissen die beiden Gardisten Joanots Vater nach vorn. Während ihn die Schergen niederdrückten, warf er seinem jüngsten Sohn noch einen liebevollen Blick zu: »Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.«
Dann fiel auch sein Haupt.
Vor den kopflosen Rümpfen bildete sich auf den Terrakottafliesen ein dunkelroter See aus Blut. Still, schwer und endgültig. Vor Joanots Augen verschwamm der Anblick wie ein Bild aus Wasserfarben, die sich im Regen auflösen. Er nahm kaum wahr, dass einer der Gardisten nach ihm greifen und ihn enthaupten wollte.
»Wartet!«, sagte Mehmed und wandte sich an den Knaben. »Welche Sprachen sprichst du?«
Joanot blieb stumm. Er fühlte sich, als weilte er nicht mehr im Reich der Lebenden und auch nicht im Reich der Toten, sondern in einer der labyrinthartigen Zwischenwelten, die einem Menschen Schutz vor seinem übermenschlichen Schmerz boten. Einer der beiden Krieger schlug ihn mit der Faust ins Gesicht, sodass er hintenüber fiel. Ein Schrei drang aus seiner Kehle, der ihn in die grausame Wirklichkeit zurückholte. Auf ein Zeichen des Sultans stellten die beiden Männer Joanot wieder auf die Füße.
»Also, welche Sprachen sprichst du?«
»Katalan, Kastilisch, Griechisch und Latein.« Blut lief Joanot aus der Nase, rann über die Lippen, das Kinn und tropfte zu Boden. Er hätte es gern abgewischt, aber seine Hände waren hinter dem Rücken gefesselt.
»Gut. Türkisch und Arabisch wirst du noch lernen. Ich werde dich zu einem perfekten Diener der Hohen Pforte ausbilden lassen! Und du wirst Muslim! Zu Ehren des Propheten.«
Joanot erschrak zutiefst – nicht darüber, dass er am Leben bleiben sollte, nicht darüber, dass Mehmed ihn zum Muslim machen wollte, sondern darüber, dass seine Nase gebrochen sein könnte und sie dann so hässlich werden würde wie die des Sultans. Er zog Luft durch die geschundene Nase ein, ließ aber sofort davon ab, denn das Blut und der Rotz, den er hochzog, schmerzten wie glühendes Eisen. Er fühlte sich allein, von seinem Vater und seinen Brüdern auf Erden zurückgelassen. Allein, wie in seinem Traum, dabei hatte die Mutter doch versprochen, dass dies niemals geschehen würde und Träume nur Schäume wären. Sie hatte ihn belogen, Träume waren keine Schäume, sondern Verliese, in die man gestoßen wurde.
Er nahm es seinem Vater und seinen Brüdern übel, dass sie ihn nicht mitgenommen hatten in den Himmel. Würde die Mutter ihnen bittere Vorwürfe machen und Ferante oder Juan zurückschicken, um ihn zu holen? Er zweifelte nicht daran, dass auch sie und die Schwestern nicht mehr auf Erden, sondern im Paradies weilten. Wo sollten sie denn sonst sein, wenn der Vater und seine Brüder dort Quartier machten? Die Familie Julia war umgezogen und wohnte nun im Garten Eden. Aber warum?, schrie es in ihm. Warum hatten sie ihn nicht mitgenommen? Was hatte er denn verbrochen? In der Hoffnung, dass die Seele seines Vaters umkehren würde, dass Gott ein Einsehen hätte oder so barmherzig wäre, wie es immer hieß, brüllte Joanot mit seiner ganzen Kraft und, ohne Luft zu holen, nach seinem Vater.
»Pare, Pare, lass mich nicht allein, lass mich nicht hier, Pare, mein lieber Pare, komm und hole mich, nimm mich doch mit, mich, deinen lieben Joanot, Pare, Pare, Pare …«
3
Stambul, Osmanisches Reich
Zwei Tage lang hatte der Junge, den man in einem Zimmer im Palast eingesperrt hatte, durchgeschrien, bis er erschöpft verstummt und in einen tiefen Schlaf gefallen war, der an ein Koma erinnerte. Ein grober, kräftiger Leibgardist des Sultans weckte ihn mit einem derben Stoß, packte ihn am Oberarm und brachte ihn in die Kirche des heiligen Johannes. Obwohl er auf dem Weg verrußte Häuser erblickte, türkische Soldaten, die in Gruppen die Straßen und Gassen durchsuchten und in Häuser eindrangen, in der Hoffnung noch etwas zu finden, das ihre Vorgänger beim Plündern übersehen hatten, schien über allem warm und mild die Sonne, während der Himmel in seinem makellosen Blau nicht zu der rauchenden Welt passte, über die er sich spannte. Joanot verstand den Himmel nicht.
In der Kirche angekommen, stellte der Gardist den Jungen in die Mitte des Kirchenschiffs, sprach kurz mit dem Aufseher und ging. Der Aufseher ließ sich rote Farbe und einen Pinsel bringen und schrieb auf Hemd und Stirn einen arabischen Schriftzug: as-Schirazi. Gekennzeichnet, wie man die Schafe vor der Schur kennzeichnet, dachte Joanot.
Im Kirchenraum saßen viele Knaben in seinem Alter. Einige sprachen, doch nur wenige spielten miteinander, andere weinten oder schwiegen. An diesem Ort herrschte eine ebenso große Bedrücktheit und Trostlosigkeit wie in seinem Herzen. Den Altar hatte man umgestürzt, den Ikonen die Gesichter ausgekratzt, und das große Kruzifix lag auf dem Boden, geschändet und zerbrochen. Der Kopf Christi war in der Mitte von einem Schwert- oder Axthieb gespalten, während in seinem Holzleib, dort, wo man das Herz vermuten könnte, ein Dolch steckte. Joanot entdeckte an der Klinge, zwischen Schaft und der Spitze, die im Holz stak, eine matte, rotbraune Lasur. Das Kind, das nicht wissen konnte, dass an dem Dolch das Blut des Priesters der Kirche klebte, hielt es deshalb für Christi Blut.
Er suchte sich einen Platz an der Wand in einem Seitenschiff und schaute durch das Fenster, dessen Scheiben zerbrochen waren. Hin und wieder wehte ein leichter Luftzug herein. Auf dem Ast einer jungen Platane saß ein kleiner Zeisig. Joanot glaubte, es wäre die Seele seiner Schwester Blanca, und begann mit ihm zu sprechen. Doch dann flog der Vogel auf und kehrte nicht mehr zurück. Der Junge schlang die Arme um die Knie, die er dicht an den Oberkörper zog, und fing an, die Lieder zu singen, die ihm die Mutter oder Blanca, seltener Rosalie, abends vorgesungen hatten, damit er einschlief. Gute, alte katalanische Lieder. Sie erzählten traurig schöne Geschichten von der Liebe und von den Bergen, vom Stierkampf und von einem Mann, den man El Cid nannte. Und Joanot sang mit heller Knabenstimme die Melodie, die er von der Mutter und den Schwestern gelernt hatte:
»Seht ihr das blutige Schwert und das weiß bedeckte Pferd?
Auf solche Weise besiegt man die Mauren auf dem Schlachtfeld.«
Er wippte leicht hin und her, und seine halblaute Stimme trug ihn fort, fort aus der Kirche, fort aus der Zeit, hinauf in die Bläue des Himmels und meinte, das Lachen des Mädchens mit der Narbe über der Augenbraue zu hören, als begleitete sie mit Frohlocken seinen Gesang. Er wusste nicht, wer die Mauren waren, über die El Cid in seinem Lied triumphierte. Nur, dass sie als die argen Feinde der Christen in Spanien galten. Selbst wenn ihn jemand beobachtet oder ihm zugehört hätte, müsste er nicht fürchten, für sein Lied bestraft zu werden, denn niemand in dieser Kirche in Konstantinopel verstand Katalan. Obwohl ihn andere Knaben ansprachen, antwortete er nicht, sondern sang weiter, sodass sie ihn schließlich in Ruhe ließen. Bewegung kam in die Kirche, als Brot verteilt wurde, ein paar Jungen balgten sich darum. Doch Joanot würgte es nur schnell hinunter, ohne dass er dessen Geschmack wahrnahm.
Wie in einem Traum, in dem er nur ein zufälliger Gast war, flossen die nächsten Tage dahin, ohne dass er noch ein Gefühl für die Zeit gehabt hätte. Meist saß er einfach nur mit offenen Augen da. Alles, was geschehen war und noch geschehen würde, hatte nichts mehr mit ihm zu tun, es fand um ihn herum statt. Er aß ohne Hunger mechanisch, was man ihm gab, er schlürfte, was man ihm zu trinken reichte. Seine Welt hatte aufgehört zu existieren.
Eines Morgens zerrten die Bewacher die Kinder unter lautem Schimpfen und mit Schlägen und Tritten aus der Kirche und stellten sie auf der Straße in Dreierreihen auf. Nach ihren grimmigen Mienen zu urteilen, empfanden sie den Auftrag, diese Knaben zu bewachen, als Schande, eines Mannes unwürdig, und dementsprechend grob gingen sie mit ihnen um. Einem Jungen, der plötzlich losrannte, sandte einer der Bewacher einen Pfeil hinterher. Als das Geschoss den schmalen Oberkörper des Flüchtenden durchschlug, hob er sanft die Arme wie Schwingen, als könne er fortfliegen, bevor er zu Boden stürzte. Ob noch Leben in ihm war oder nicht, war den Bewachern gleich. Sie ließen ihn einfach liegen als willkommenes Mahl für Geier und wilde Hunde, den anderen Kindern zur blutigen Lehre. Dann wurden ihre rechten Fußknöchel mit Stricken mit denen der Knaben vor und hinter ihnen verbunden. Joanot ließ es willenlos geschehen. Nichts von alledem widerfuhr ja ihm.
Zehn Tage lang wurde die Kolonne von etwa hundert Jungen unter der brennenden Sonne über staubige Straßen nach Edirne getrieben, der Residenzstadt des Sultans. Joanot kam es aberwitzig vor, Menschen auf den Feldern zu sehen, die ohne Angst ihrer Arbeit nachgingen, unwirklich, durch unzerstörte Dörfer zu kommen, die der Krieg nicht einmal berührt hatte.
Edirne, das einstige Odrysia, war von dem großen Kaiser Hadrian wieder aufgebaut worden und hatte einen neuen Namen erhalten: Hadrianopolis, Adrianopel. Doch dann hatten die Osmanen die Stadt erobert, und ihre Sultane machten sie zur Residenzstadt, in der sie sich nur allzu gern aufhielten.
In Edirne sollten die Knaben verschiedenen Aghas zugeteilt werden, Lehrern, die sie zu fanatischen Dienern des Sultans abrichten sollten. Die Osmanen hatten dafür den zynischen Ausdruck »Knabenlese« geprägt, als wären Kinder Früchte, die man nur zu ernten brauchte. Und ernten bedeutete, sie ihren Familien wegzunehmen. Alle diese entführten Jungen waren verwirrt. Sie unterschieden sich nur dadurch voneinander, wie tief die Verstörung reichte. Mehmed hatte erkannt, dass diejenigen unter ihnen, die am stärksten unter dem Trauma der gewaltsamen Trennung von ihren Familien litten, die größten geistigen Talente besaßen. Die Stumpfen waren nur für Stumpfes, die Feingeistigen für Feingeistiges zu gebrauchen. An der Art seines Schmerzes erkennt man den Menschen, wusste der kluge Sultan. Deshalb gab er die Anweisung, sich gerade um die Sensiblen zu bemühen. Die schwersten Fälle kamen unter die Fittiche eines persischen Sufi namens as-Schirazi, der einen fast mythischen Ruf genoss. Seine große Seelenkunst schützte den geheimnisvollen Heiligen vor den Nachstellungen der muslimischen Orthodoxie – zudem natürlich auch Mehmeds Vorliebe für alles Persische.
In Gruppen von zehn oder zwanzig Kindern wurden sie nun von Jünglingen im Alter seines Bruders Juan abgeholt. Schließlich stand Joanot mit dem roten Schriftzug auf Stirn und Hemd allein auf dem großen Platz im Palastbezirk der Residenz und wartete in Finsternis, denn die helle Sonne schien nicht für ihn. In gelben Hosen und weißem Hemd, das noch kindlich-runde Gesicht von einem weißen Turban gekrönt, trat schließlich ein Junge zu ihm, der sich auf Griechisch als Mustafa vorstellte und ihn höflich bat, ihm zu folgen. Er würde ihn zu as-Schirazi führen.
Nach dem Bad im blau gefliesten Hamam bekam Joanot auf Anweisung as-Schirazis weite, gelbe Hosen, ein weites, langes Hemd und einen blauen Mantel nebst einem Turban im strahlenden Weiß des Hemdes. Im Bad, so erklärte ihm as-Schirazi, solle er den christlichen Schmutz aus jeder Pore ausschwitzen. Als ein Diener seine alten Sachen nehmen und wegwerfen wollte, leuchtete jäh eine Erinnerung in Joanot auf. Mit einer katzenhaften Bewegung entriss Joanot dem Diener seine Hose, fuhr mit der Hand in die rechte Tasche und zog das kleine Metall heraus, das seine Mutter ihm gegeben hatte. Dann warf er dem überraschten Diener die Hose achtlos wieder zu.
Er ahnte, was in seiner geschlossenen Faust lag, und warf as-Schirazi einen lauernden Blick zu. Das schmale Gesicht des drahtigen Persers veränderte sich nicht. Weder streng noch nachsichtig, sondern sanft schaute er Joanot aus seinen großen Augen an, die wegen seiner hellen Haut fast schwarz wirkten.
As-Schirazi bat Joanot, seine Hand zu öffnen. Nie zuvor hatte der Junge ein so weich fließendes Griechisch gehört. Es war, als wäre es dem Sufi gelungen, die Sprache durch Musik zu zähmen. Unschlüssig starrte Joanot zu Boden. Der Perser wiederholte freundlich seine Bitte, und schließlich gab der Junge nach. Er öffnete die Faust und schaute auf das silberne Kreuz am Lederband. Er sah das vertraute Gesicht seiner Mutter vor sich und verlor sich in ihren ernsten Augen. Am liebsten hätte er die Hände nach ihr ausgestreckt. Er spürte, wie sich ihm die Kehle zuschnürte und eine feuchte Wärme in seine Augen drang. Doch die Tränen blieben aus. Aus der Überzeugung, dafür bestraft, vielleicht sogar getötet zu werden, legte er das Kreuz um und betrachtete sich plötzlich von außen. Er sah sich frech grinsen, so frech wie noch nie. Was immer geschähe, es würde nicht ihm widerfahren, sondern nur dem Jungen mit dem Kreuz um den Hals. Eine schwache Hoffnung glomm in seinem wild schlagenden Herzen auf, dass es ihm doch noch – sozusagen auf Umwegen – gelänge, seiner Familie ins Jenseits zu folgen. Herausfordernd schaute er den Sufi an, bereit, alles anzunehmen.
As-Schirazi lächelte. »Behalte es. Muhammad hat nichts gegen Jesus, der ja auch ein Prophet Gottes war.«
So zart wie sie aufgeflammt war, erlosch Joanots Hoffnung wieder. Wie konnte sein Wunsch auch gegen Gott ankommen, der ihn offensichtlich verstoßen hatte. Mehr und mehr wurde ihm das Ausmaß seines Verhängnisses bewusst, und es war eine furchtbare Wahrheit, die sich ihm offenbarte. Er hatte Gott im Gebet verhöhnt, sich über ihn lustig gemacht. Ihn um einen Pisspott gebeten und als Strafe dafür den Tod seiner Eltern, seiner Geschwister statt des Nachtgeschirrs erhalten. Er hatte mit Gott zu scherzen gewagt, und Gott hatte ihm eine blutige Antwort gegeben. Jetzt verstand er alles. Es war seine Schuld! Mit dieser Erkenntnis ließ der Schock nach, unter dem er stand. Zaghaft regte sich Leben in ihm, denn er fühlte die noch leise, aber wachsende Empörung darüber, dass Gott einen kleinen Jungen so unbarmherzig belehrte. Hatte er, der große Herr, der Weiseste der Weisen es nötig, ein schwaches, törichtes Kind zu bestrafen? Wo war Gottes Barmherzigkeit? War Gott überhaupt barmherzig?
»Joanot, das ist auf Arabisch Yahya. Wir werden dich Yahya ibn Catalano nennen, so behältst du deinen Namen, und jeder hier wird ihn verstehen«, sagte der Sufi leise, fast beschwörend auf Griechisch. Stumm und willenlos ließ sich Joanot, der von nun an Yahya hieß, von Mustafa wegführen.
Sie begaben sich zu einer Ansammlung von Kiosken, die verstreut in einem Birkenhain standen. Hier nahmen die Schüler offenbar das Essen zu sich. In dem Pavillon, den Yahya und Mustafa betraten, herrschte zu dieser Stunde gähnende Leere, weil die Jungen sich im Unterricht befanden. Yahya und Mustafa nahmen aus den Händen eines pausbäckigen Kochs mit Bartsträhnen, die wie dunkle Halbmonde rechts und links des Mundes herabhingen, jeweils zwei Schälchen entgegen, eines mit Tee und eines mit Kichererbsenbrei. Sie ließen sich vor dem Kiosk unter einer Birke nieder, deren Gabelung verriet, das einst ein Blitz in den Stamm eingeschlagen hatte. Ein mächtiger Ast berührte im Bogen den Boden. Es sah so aus, als stütze er die rechte Hälfte des Baumes, dessen Blätter zum Sonnenlicht hin wuchsen. Eine Gruppe von Knaben in Yahyas Alter, die von einem sehr hellhäutigen Agha mit strahlend blauen Augen kommandiert wurde, zog in Dreierreihen über den Hof.
Er aß mechanisch, nicht viel, aber so, dass es genügte. Essen konnte man es eigentlich nicht nennen. Der Körper nahm sich gerade so viel, wie er benötigte. Er hatte seinen Geschmackssinn verloren, seine Zunge lag taub wie ein Fremdkörper in seinem Mund. Er hätte auch Sägespäne essen oder fauliges Wasser trinken können. Er fühlte sich schuldig. Nicht weniger als sein Verbrechen bestürzte ihn allerdings Gottes grausame Härte, mit der er ihn bestrafte. Wusste Gott denn nicht, dass er mit seiner Familie auch ihn selbst verloren hatte?
Mustafa nahm ihm die beiden Schüsseln ab und brachte sie in den Kiosk zurück. Ein warmer Wind spielte mit den Blättern der Birke. Yahya schloss die Augen und sah das Schwarze Meer vor sich, so als stünde er an der Spitze der Halbinsel von Konstantinopel. Er stellte sich vor, dass er in die Wellen springen und das Wasser sich über ihn schließen würde wie ein nasses Grab.
4
Edirne, Osmanisches Reich
»Ich zeige dir unser Zimmer«, sagte Mustafa.
Yahya öffnete die Augen, schwieg aber. Zwei beleibte Männer, deren Worte, die sie sich zuwarfen, sich wie Spatzen in der Luft neckten, kamen auf sie zu. Mustafa trat ehrerbietig zur Seite und grüßte sie freundlich. »Aleikum salam«, antworteten sie im Ton ihrer Unterhaltung, ohne von ihm Notiz zu nehmen.
»Kanzleischreiber«, erklärte Mustafa, nachdem die Männer sich bereits etwas entfernt hatten.
Blicklos und ungelenk wie eine Gliederpuppe stand Yahya auf und folgte Mustafa über die Wiese in einen kleinen Palast an der Südseite des Geländes, einen Gang entlang, eine Treppe hinauf. Unbeteiligt glitt sein Blick über das prachtvolle Schnitzwerk der Fenster, die freundlichen, hellen Flure, die bunten, in strahlend hellen Farben gewirkten Teppiche an den Wänden, die Zeichnungen, die Käfige mit Buntfinken und Zeisigen, die lustig sangen. Seine Sinne verweigerten die Wahrnehmung. Was ging ihn die Außenwelt noch an? Ein Hauch von Zimt und Safran, der in den Gängen hing, erreichte ihn dennoch. Der Geruch von Leder, der im Haus seiner Eltern allgegenwärtig gewesen war, fehlte hier hingegen vollständig. Das verwunderte ihn, mehr noch aber die Tatsache, dass er Gerüche wahrnahm. Den Worten brauchte man nicht zuzuhören, das Sehen konnte man in Unschärfe ertränken, doch der Geruch war der einzige Sinn des Menschen, der dem Willen nicht zu Diensten stand. Niemand vermochte das Riechen zu verweigern. Und Yahya schon gar nicht.
Nach dieser verwirrenden Erkenntnis verließ der Knabe die Wirklichkeit und betrat eine Zwischenwelt, die er mit seinen Erinnerungen zu bevölkern begann. Einzig die Gerüche drangen aus der Wirklichkeit zu ihm und hin und wieder Worte, die sich von anderen Geräuschen und Lauten, wie ein Lachen oder der Klang eines Musikinstruments, das Brummen des Bären im Käfig im Innenhof des Palastes oder dem Gesang der Vögel in den vielen Käfigen aus Korb, unterschieden.
Durch einen Vorhang aus bunten aufgefädelten Holzstäbchen gelangten sie in ein kleines Zimmer mit einem breiten und hohen Fenster. Zwei Matratzen mit Decken und Kissen lagen vor der rechten Wand. Am Fenster hielten zwei Stehpulte die Jungen zum Schreiben und Lesen an. In der Mitte des Raumes stand ein kniehoher, runder Tisch, der von Sitzkissen umgeben war. Auf seiner mit vielen glitzernden Mosaiksteinen verzierten Platte wartete ein Schachbrett mit einer angefangenen Partie. Über die Wand lief in Augenhöhe ein kufischer Schriftzug in schöner Kalligrafie mit dem zweiten Vers der Sure al-Fatiha: »Lobpreis sei Gott, dem Herrn der Weltbewohner.« Über den Matratzen waren Fächer an der Wand angebracht, in denen Bücher, Schreibzeug sowie Kleidung lagerten.
»Hier schläfst du, und da oben liegen deine Sachen«, erklärte Mustafa und wies auf die Matratze zwischen seinem Schlafplatz und dem linken Pult vor dem Fenster. Yahyas Fach war bereits mit all dem gefüllt, was Mustafas auch enthielt.
»Spielst du Schach?«, fragte Mustafa.
Yahya nahm weder von der Frage Notiz noch von seinem Fach. Er legte sich hin, drehte sich um, rollte sich zusammen, schaute auf die Wand und schwieg. Mustafa zuckte mit den Achseln und setzte sich mit untergeschlagenen Beinen an den Tisch, um das Spiel gegen sich selbst fortzusetzen, während Yahya durch die Wand hindurchzublicken glaubte und das schwarzhaarige Mädchen mit der Narbe über der rechten Braue in einem Stuhl sitzen sah. Er hätte sich gewünscht, dass sie etwas zu ihm sagte, auch wenn es nur Spott war wie damals, doch sie schwieg. Und ihr Blick war ernst.
Yahya verharrte zusammengerollt und mit dem Blick zur Wand, bis ihn Mustafa am nächsten Morgen aufforderte, ihm ins Bad zu folgen, und ihn anschließend in den Kiosk zum Frühstück mitnahm. Es wurde Tag, und es wurde Nacht, während Yahya weder das Datum kannte noch die Stunden unterschied. Nichts floss, nichts verging, nichts traf für ihn ein, nichts, was Bewegung und also Veränderung bedeutete. Mit dem Verlust der täglichen Gebete und vor allem des Sonntagsgottesdienstes verschwand auch die Zeit aus seinem Leben. Er fühlte keinen Fluss mehr, sondern nur ein stehendes Gewässer, dessen Oberfläche nicht durch den leisesten Hauch gekräuselt wurde. Tief in seinem Innern entdeckte Yahya derweil eine neue Welt von unfassbarer Größe, in der er mit Nuria spielte, Juan und Ferante über ihre Erinnerungen an Barcelona ausquetschte, den Vater neckte, seine Worte wie ein Echo wiederholend, bis der die Arme hob und lachend um Schonung bat. Hin und wieder, aber nur wenn seine Familie nicht dabei war, besuchte ihn auch das schwarzhaarige Mädchen. Die Zwischenwelt war ein freundlicher Ort, denn sie vereinte das sonst Getrennte. Zuweilen erntete Yahya einen besorgten Blick von Mustafa, dann wusste er, dass sein lautes Lachen aus dem Limbus in die wirkliche Welt gedrungen war.
Wenn er nicht zum Essen ging oder Körperpflege betrieb, auf die hier peinlich genau geachtet wurde, kauerte Yahya auf seiner Matratze. Das Bad aber begann er zu lieben, denn wenn er das Wasser auf seiner Haut spürte, fühlte er sie. Das kleine Kreuz legte er nicht mehr ab, weil er damit keinen Glauben mehr verband. Er wusste nicht einmal, warum er es trug, weshalb es ihm so wichtig war. Auch fragte er nicht danach. Wozu auch? Wer dachte schon darüber nach, warum er ein Herz hatte oder ein Gehirn oder eine Seele? Dieses kleine Silberkreuz war etwas ähnlich Wesenhaftes für ihn. Es war, weil es war, nicht, weil es etwas bedeutete.
»Die erste Woche ist herum«, erklärte Mustafa eines Tages und lieferte Yahya nach dem Frühstück bei as-Schirazi ab. Zuerst sang der Sufi, doch das beeindruckte den schweigsamen Jungen mit den erloschenen Augen nur wenig. Diese Augen, die einmal blau, vielleicht sogar blaugrün gewesen sein mochten, waren nun trüb wie ein schlammiger Tümpel. Dann sprang der Sufi unvermittelt auf einem Bein hin und her, bewegte heftig die angewinkelten Arme und ahmte laut gackernd ein Huhn nach, was bei dem dürren Mann mit den langen Armen und Beinen einen erheiternden Anblick bot. Yahya aber verzog keine Miene. Schließlich ließ sich as-Schirazi auf einem bauschigen, grünen Kissen nieder und begann, von einer Frau namens Shahrasad zu erzählen. Sie war mit einem Mann vermählt worden, der sie nach der Brautnacht hinrichten wollte, damit er nie wieder betrogen würde. Dazu kam es jedoch nicht, weil sie ihm eine Geschichte vortrug, die ihn in den Bann schlug. Im Morgengrauen brach sie an der spannendsten Stelle ab und bestand darauf, erst in der kommenden Nacht weiterzuerzählen. So ging es viele Nächte. Der Mann schob die Hinrichtung immer wieder auf, denn er wollte unbedingt das Ende der Geschichte hören.
as-Schirazi brach Shahrasads Erzählung jeweils an eben den Stellen ab, an der auch sie pausiert hatte. Yahya schien zwar nicht zugehört zu haben, doch der erfahrene Sufi fühlte eine kleine Schwingung in dem Jungen, die ihm als erfahrenen Seelenführer als Bestätigung dafür genügte, dass er auf dem richtigen Weg war. Erstaunlicherweise war doch etwas von dieser Geschichte zu Yahya durchgedrungen. Was ihn aufhorchen ließ, war das Wort »enthaupten«. Die weißen Seidensegel seiner Zwischenwelt bluteten. Das ängstigte ihn jedoch nicht, sondern weckte sein Interesse. In seiner Zwischenwelt verlor alles seinen Schrecken, selbst vergossenes Blut, weil es dort keinen Schmerz gab und keine Zeit und keinen Anfang und kein Ende.
Von nun an holte Mustafa Yahya jeden Nachmittag bei as-Schirazi ab und brachte ihn am nächsten Morgen wieder zu dem Sufi, bevor er sich zu seinem eigenen Unterricht begab. So ging es fünf Monate. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat hörte Yahya länger zu, spiegelten sich mehr und mehr Reaktionen in seinem Gesicht wider. Auch fing er an, hin und wieder ein paar Worte mit Mustafa zu wechseln. Sie sprachen über Belanglosigkeiten, nicht über Dinge, die mit seinem oder dessen Leben zu tun hatten. Es drehte sich darum, wie der gefangene Bär im Innenhof hieß oder diese oder jene Speise zubereitet war. Allmählich begann Yahya auch wieder, zu schmecken, was er aß oder trank. Mustafas nicht ganz ohne Eigennutz vorgebrachtes Angebot, ihm das Spiel der Könige beizubringen, lehnte er sanft, aber bestimmt ab. Spiele interessierten ihn nicht.
Eines Tages unterbrach as-Schirazi die Geschichte Scheherazade, kaum, dass er begonnen hatte, sie zu erzählen.
»Warum hörst du auf? Ich will wissen, wie es weitergeht!«, empörte sich Yahya, der nicht bemerkte, dass er seine schützende Zwischenwelt verließ.
Statt einer Antwort stand as-Schirazi auf, ging zum Wandregal, zog zwei Schriftrollen heraus und breitete sie auf dem Tisch aus, hinter dem Yahya mit untergeschlagenen Beinen saß. Der Junge warf einen Blick darauf. Er hatte im Elternhaus Lesen und Schreiben gelernt, doch diese lang gezogenen Bögen, die sich wie Meereswogen wellten, glichen den kunstvollen Inschriften, welche die Wände des Palastes und auch sein Zimmer zierten, und machten ihn ratlos.
»Ich kann kein Arabisch«, stieß er trotzig hervor.
»Dann lerne es!«
»Lernen?«
»Wenn du wissen willst, wie die Geschichte weitergeht, dann lerne, Arabisch zu lesen und zu schreiben. Und damit nicht genug: Übe dich auch, Türkisch zu lesen und zu schreiben, ebenso Katalan, Kastilisch, Französisch und Italienisch. Und wenn du alles kannst, dann widme dich dem Persischen. Lerne die Sprachen der Erde, denn wer die Sprachen beherrscht, ist ein Fürst der Welt. Gebiete über die beiden Imperien einer jeden Sprache, über das Reich des Lesens und über das Reich des Schreibens. Denn bedenke, wer lesen kann, vermag noch nicht zu schreiben, und wem die Schrift geläufig ist, der versteht noch nichts von der Kunst des Lesens, weil Lesen mehr ist, als Buchstaben zusammenzuziehen, und Schreiben mehr, als Worte in Buchstaben aufzulösen. Es sind zwei Imperien. Und nur wer beide Reiche regiert, ist ein wahrer Fürst. Und du, das sehe ich dir an, bist zum Fürsten geboren.«
Der Junge machte große Augen. »Ich? Ein Fürst?« Wie sollte das gehen? Er war nur eine arme Waise.
»Sagt euer Jesus nicht: ›Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Werde mächtig‹? Yahya, du kannst es!« as-Schirazi machte Yahya ein Zeichen, dass er ihn nun allein lassen solle.
Verwirrt kam der Junge der Aufforderung nach. Er wollte gerade auf den Gang hinaustreten, spürte schon den Windhauch, der den Flur durchzog, an Schläfe und Wange, als ihn as-Schirazis Stimme aufhielt.
»Du hast etwas vergessen.«
Yahya drehte sich mit fragendem Blick um. Der Sufi wies auf die beiden Schriftrollen. Gehorsam nahm der Junge sie an sich.
»Komm wieder, wenn du mir diese Geschichte vorlesen kannst. Vorher nicht.«
»Und wenn es zu schwer für mich ist?«
»Dann komm nie wieder.«
as-Schirazi griff zu seiner Qasba. Er setzte die Rohquerflöte an den Mund und fing an, ein persisches Lied zu spielen. Yahya verließ bestürzt den Raum. Er war mit einem für ihn wertlosen Text, weil er ihn nicht zu lesen vermochte, beschenkt und zugleich der schönen Ausflüge unter as-Schirazis Führung ins Reich der Fantasie beraubt worden. Er vermied es, sich einzugestehen, dass er den Sufi vermissen würde – nicht nur seine Geschichten, sondern ihn selbst. Auf dem Weg zurück zu seinem Zimmer watete er durch goldenes Sonnenlicht, das die Gänge überflutete. Allmählich wurde es Herbst.
Das Essen ließ der Junge aus. Er saß in seinem Zimmer und starrte auf die Schriftrollen, als ob eindringliches Anschauen ihm das Geheimnis der fremden Sprache enthüllen würde. Am Abend kam Mustafa und zündete ein Licht an. Man hatte ihn benachrichtigt, dass er Yahya nicht mehr von dem Sufi abzuholen und ihn auch nicht mehr morgens hinzubringen brauchte.
»Was sitzt du im Finstern? Willst du die Dschinns beschwören?«, scherzte er.
»Wie lernt man Arabisch?«
»Durch die religiöse Unterweisung.«
Von diesem Tag an wurde Yahya in die Welt des Islam eingeführt und zudem, so wie as-Schirazis es angeordnet hatte, von morgens bis abends in Sprachen unterrichtet. Immer seltener träumte er von seinen Eltern, nur das Mädchen mit der Narbe über der Augenbraue besuchte ihn regelmäßig im Schlaf. Sie lachte kaum noch, sondern blickte ernst, zuweilen traurig, manchmal schüttelte sie auch nur den Kopf. Er glaubte, dass sie befürchtete, Yahya könnte ihr die Tür zu seinem Traum versperren.
Anders als alle anderen Knaben musste er sich nicht der körperlichen Ertüchtigung widmen und Kampftechniken mit Fäusten und mit Waffen erlernen. All das wurde ihm erlassen, damit ihm keine Zeit für das Studium der Sprachen verloren ginge. Er traf nicht mit den anderen Jungen zusammen, nicht einmal beim Essen im Kiosk. Sein einziger Umgang war Mustafa. Bisweilen kam ihm der Gedanke, dass der Sultan etwas ganz Besonderes mit ihm vorhatte.
5
Andalusien, Spanien
Sechs Jahre, sechs Tage und sechs Stunden später. Am anderen Ende des Mittelmeeres, irgendwo in Andalusien, in einem Flecken, dessen Namen wohl nicht einmal seine Bewohner genau kannten, brach wie überall in Spanien die Nacht herein. Sie kam lau, sie kam behutsam, sie kam freundlich wie ein guter Bekannter. Sie umarmte den Abend, bis nichts mehr von ihm blieb. In einem kleinen Herrenhaus gegenüber der Kirche, zu dem eine Hazienda von tausend Morgen Land, fünfhundert Rinder und fünfzig Pferde gehörten, stritt ihr Besitzer, der Edelmann Sancho Jiménez de Solís, heftig mit seiner Tochter Isabella. So laut und ungestüm, dass seine jüngere Tochter, die achtzehnjährige Nuria, am liebsten in der Suppe, die vor ihr auf dem Tisch stand, verschwunden wäre. Die von Natur aus beherzte Köchin, eine Frau von altersloser Rundlichkeit, stand wie erstarrt in der Tür zum Speisezimmer und wagte nicht, den zweiten Gang zu servieren, der aus einem gefüllten Hasen bestand.
Nuria warf einen Blick aus dem geöffneten Fenster. Draußen saßen der Altknecht Alvaro und der Knappe Rodrigo, ein noch recht junger Mann, der seit seinem Knabenalter im Dienst des Edelmannes stand. Sie nutzten offenbar den Streit, um sich am Roten ihres Herrn gütlich zu tun. Aus Erfahrung wussten sie, dass Don Sancho, wenn er in seinen Jähzorn stürzte, kein Halten mehr kannte, bis er sich schließlich erschöpft in sein Schlafgemach zurückziehen würde, einem Ort vollkommener Einsamkeit. Nurias Mutter war zwei Jahre zuvor verstorben und hatte ihn allein mit seinen Töchtern und seiner großen Liebe zu ihr zurückgelassen. In Don Sanchos Herz hatte die Trauer Einzug gehalten. Er dachte nicht daran, wieder zu heiraten, sondern richtete sich inmitten seiner Erinnerungen ein.
Alvaro war ein schmerbäuchiger, gedrungener Mensch mit kleinen, aber sehr beweglichen Augen, dem man die Vorliebe für Wein an der lilafarbenen Knollennase ansah. Gemeinsam mit Rodrigo lümmelte er nun vor dem Wirtschaftsgebäude, das sich halb rechts vom Herrenhaus befand. Offensichtlich genossen sie den Streit, der bis zu ihnen herausdrang, als Abwechslung zur Öde der langen Abende im Grenzgebiet zum Emirat Granada. Aber was heißt schon Grenzgebiet, dachte Nuria, wenn die Demarkationslinie zwischen Kastilien und Granada sich ständig verschiebt. Mal lag das Dorf haarscharf an der Grenze, dann wieder weit im Hinterland. Wie es gerade stand, wusste im Grunde niemand, denn die Lage konnte sich so schnell drehen wie die unberechenbaren Contrastes, jene gegenläufig gerichteten, oft starken Winde der Gegend.
Nuria unterdrückte ein Kichern, als sie sah, wie die beiden Knechte, angeregt von den Sätzen, die ihnen aus dem geöffneten Fenster des Esszimmers zuflogen, gestikulierten und Fratzen schnitten, um die Streitenden in liebevollem Spott zu karikieren, wobei sie sich gegenseitig zu übertreffen trachteten.
»Was ist so schlecht an Fernando de Aruya, dass du ihn nicht zum Manne willst?«, fragte Don Sancho seine Tochter Isabella. Er war sichtlich am Ende seiner Geduld. Draußen riss Alvaro die Augen auf, mit denen er sogleich rollte.





























