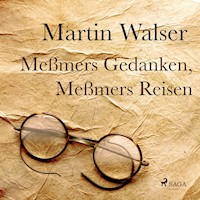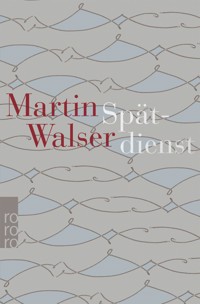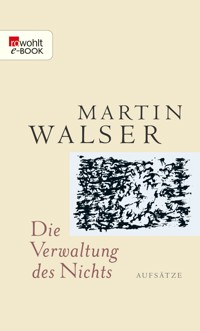
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
«Wenn ich mit Sprache zu tun habe, bin ich beschäftigt mit der Verwaltung des Nichts. Meine Arbeit: Etwas so schön sagen, wie es nicht ist.» Martin Walser In siebzehn thematisch eng verknüpften Aufsätzen resümiert Martin Walser seine Position als Schriftsteller heute: eine philosophische, künstlerische und gesellschaftliche Standortbestimmung, die in ihrer Erkenntnisschärfe, unbestechlichen Wahrnehmung und stilistischen Schönheit ihresgleichen sucht, das vorläufige Fazit eines der größten lebenden Autoren deutscher Sprache. «Eine Literatur, die so tendiert, ähnelt nicht dem Gesinnungsaufsatz, sondern der Oper. Nicht dem Diskurs, sondern der Hymne.» (Frankfurter Rundschau) «Walser über sich selbst: Sich hinreißen lassen können: eine Fähigkeit, die man an diesen Aufsätzen erproben kann.» (Süddeutsche Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Ähnliche
Martin Walser
Die Verwaltung des Nichts
Aufsätze
Über dieses Buch
«Wenn ich mit Sprache zu tun habe, bin ich beschäftigt mit der Verwaltung des Nichts. Meine Arbeit: Etwas so schön sagen, wie es nicht ist.» Martin Walser
In siebzehn thematisch eng verknüpften Aufsätzen resümiert Martin Walser seine Position als Schriftsteller heute: eine philosophische, künstlerische und gesellschaftliche Standortbestimmung, die in ihrer Erkenntnisschärfe, unbestechlichen Wahrnehmung und stilistischen Schönheit ihresgleichen sucht, das vorläufige Fazit eines der größten lebenden Autoren deutscher Sprache.
«Eine Literatur, die so tendiert, ähnelt nicht dem Gesinnungsaufsatz, sondern der Oper. Nicht dem Diskurs, sondern der Hymne.» (Frankfurter Rundschau)
«Walser über sich selbst: Sich hinreißen lassen können: eine Fähigkeit, die man an diesen Aufsätzen erproben kann.» (Süddeutsche Zeitung)
Vita
Martin Walser, 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren, war einer der bedeutendsten Schrifststeller der deutschen Nachkriegsliteratur. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche Preise, darunter 1981 den Georg-Büchner-Preis, 1998 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 2015 den Internationalen Friedrich-Nietzsche-Preis. Außerdem wurde er mit dem Orden «Pour le Mérite» ausgezeichnet und zum «Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres» ernannt. Martin Walser starb am 26. Juli 2023 in Überlingen.
Weitere Veröffentlichungen
Angstblüte. Roman
Leben und Schreiben I. Tagebücher 1951 – 1962
Leben und Schreiben II. Tagebücher 1963 – 1973
Ein liebender Mann. Roman
Tod eines Kritikers. Roman
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverabbildung Abbildung: Henri Michaux «Ink Drawing» © VG Bild-Kunst, Bonn 2006
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-00251-7
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Für Heribert Tenschert
Meine Seele ist, wie ein Fisch aus ihrem Elemente auf den Ufersand geworfen und windet sich und wirft sich umher, bis sie vertrocknet in der Hitze des Tages.
Friedrich Hölderlin
Was soll ich mit den Gefühlen anfangen, als sie wie Fische im Sand der Sprache zappeln und sterben zu lassen?
Robert Walser
Gestern und heute ein wenig geschrieben … Es ist trotz aller Wahrheit böse, pedantisch, mechanisch, auf einer Sandbank ein noch knapp atmender Fisch.
Franz Kafka
I.Die Verwaltung des Nichts
Mehrere Vorreden zur Verwaltung des Nichts
Der Roman ist aus dem Mangel der Geschichte entstanden.
Novalis
Wer zur Zeit nach dem Herkommen fragt, der erfährt, wenn er die Naturwissenschaft fragt, zwei Milliarden Jahre lang seien Nukleinsäuren und Proteinbausteine aufeinander gestoßen, ohne daß dadurch eine lebende Zelle zustande gekommen sei. Dann aber, nach zwei Milliarden Jahren, klappte es, die erste Zelle, die lebendig genannt werden darf, entstand: Fortpflanzung war möglich geworden. Evolution konnte beginnen. Jetzt dauerte es nur noch eine Milliarde Jahre, bis der Mensch entstand. Es habe aber ungeheurer Zufälle bedurft, daß es so weit kam. Der Mensch sei das äußerste Unwahrscheinliche gewesen. Die Zufälle, die das Entstehen des Menschen begünstigten, werden bezeichnet als Ablesefehler bei der Codierung der Proteinbausteine durch die Nukleinsäuresequenzen.
Der Mensch hat sein Herkommen zuerst nur bildlich gefaßt. Mit Schöpfungsmythen der wunderbarsten Art hat er auf die Unwahrscheinlichkeit seines Zur-Welt-Kommens reagiert. Die Mutanten-Abenteuer und Evolutionseskapaden waren da nur mit Gott und Göttern zu fassen. Der Mensch war damals ein Dichter. Und ist es geblieben. Allerdings ist er dann empfindlich geworden gegenüber den wunderbaren Geschichten, mit denen er sein Dasein erklärt bekam. Nehmen wir gleich Hölderlin, er war einer der frömmsten Dichter überhaupt, aber auch einer der empfindlichsten. Und schrieb in seinem ‹Hyperion›: «O ihr Armen, die ihr das fühlt, die ihr auch nicht sprechen mögt von menschlicher Bestimmung, die ihr auch so durch und durch ergriffen seid vom Nichts, das über uns waltet, … so gründlich einseht, daß wir geboren werden für Nichts, daß wir lieben ein Nichts, glauben an Nichts, uns abarbeiten für Nichts, um mählich überzugehen ins Nichts – was kann ich dafür, daß euch die Knie brechen, wenn ihrs ernstlich bedenkt? … Wenn ich hinsehe ins Leben, was ist das Letzte von allem? Nichts. Wenn ich aufsteige im Geiste, was ist das Höchste von allem? Nichts.» Hölderlin verwendet Nichts am liebsten ohne bestimmten Artikel. Seine Sprachempfindlichkeit hätte es offenbar nicht erlaubt zu sagen: das Nichts. Auch wenn wir inzwischen abgebrüht genug, das heißt unempfindlich genug sind, fort und fort das Nichts zu sagen, sollten wir wenigstens manchmal daran denken, daß es besser und schöner wäre, vom Nichts artikellos zu sprechen. Das heißt vom Nichts sprechen, ohne es dem Vokabular auszuliefern, in dem Un-Wörter wie Nihilismus gang und gäbe sind. «So ist denn alles nichts», läßt Goethe gelegentlich seinen Wilhelm Meister empfinden.
In mehr als einem feinen Haus bin ich dem Satz begegnet: Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Da jetzt alles zählbar ist, könnte sicher durch richtigen Knopfdruck festgestellt werden, daß dieser Satz nicht nur Adornos am häufigsten zitierter Satz ist, sondern vielleicht überhaupt der am häufigsten zitierte Satz seit 1951. Da ist er erschienen, in den ‹Minima Moralia›. Ich bin noch keinem begegnet, der diesen Satz auf sich, auf sein eigenes Leben angewendet hätte. Wer immer den Satz verwendet, er meint immer mich oder dich, aber nie sich. Das heißt, er ist im richtigeren Leben als ich und du. Wir, ich und du, sind im falscheren. Und der Satz klingt so gesetzmäßig, daß er, wo er eingesetzt wird, einschüchternd bis drohend wirkt.
Gelegentlich habe ich den Satz in feinen Zimmern auch hinter Glas und eingerahmt gesehen. Ich habe natürlich gegen diesen Satz nicht das geringste einzuwenden, ich rede nur davon, wie er gebraucht wird, also davon, wie er mir begegnet. Dazu darf allerdings daran erinnert werden, daß der Satz bei Adorno einen Abschnitt beschließt, der überschrieben ist: «Asyl für Obdachlose». Und der erste Satz heißt da: «Wie es mit dem Privatleben heute bestellt ist, zeigt sein Schauplatz an.» Der zweite Satz: «Eigentlich kann man überhaupt nicht mehr wohnen.» Und so geht es weiter: «Die traditionellen Wohnungen, in denen wir groß geworden sind, haben etwas Unerträgliches angenommen: jeder Zug des Behagens darin ist mit Verrat an Erkenntnis, jede Spur der Geborgenheit mit der muffigen Interessengemeinschaft der Familie bezahlt.» Aber das Gegenteil dieses Wohnstils kommt nicht besser weg: «Die neusachlichen, die tabula rasa gemacht haben, sind von Sachverständigen für Banausen angefertigte Etuis, oder Fabrikstätten, die sich in die Konsumsphäre verirrt haben, ohne alle Beziehung zum Bewohner: noch der Sehnsucht nach unabhängiger Existenz, die es ohnehin nicht mehr gibt, schlagen sie ins Gesicht.» Und so weiter, bis zu dem Satz mit dem Häufigkeitsrekord: Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Ich bezweifle, daß alle, die den Satz so oft gebrauchen, daran denken oder gar wissen, daß es ein Satz ist gegen Wohnungseinrichtungen. «Eigentlich kann man überhaupt nicht mehr wohnen.» Den Satz müßte man, um vor unangemessener Sinnerweiterung sicher zu sein, immer dazuzitieren. (Daß ein Satz von Adorno mit Eigentlich anfängt, ist ohnehin merkenswert.)
Die sozusagen kritische Grundhaltung gegenüber Wohnungseinrichtungen ist uns allen bekannt. Wer die Möbelmoden eine Zeit lang hat wechseln sehen, der hat auch mitgekriegt, wie Leute nach ihren Einrichtungen beurteilt werden. Leute, die es sich geschmacklich und überhaupt leisten können, drehen ja, bevor etwas drauf ist, die Teller um, murmeln den Herstellernamen und nicken anerkennend. Wenn die Teller nicht ihrem Niveau entsprächen, würden sie die natürlich gar nicht erst umdrehen, sondern sich ihren Teil denken und nachher auf dem Nachhauseweg zum Partner, zur Partnerin sagen: Hättest du das gedacht, daß die von so was essen! Aus diesem Milieu stammt der Satz: Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Der Kulturphilosoph drückt wortradikal aus, was jeder Bürger und Kleinbürger empfindet, wenn er einem Geschmack begegnet, der nicht der seine ist. Der kulturradikale Satz meint nicht nur, daß man unter unseren Umständen keinen guten Geschmack mehr haben kann, er bezieht seine Radikalität auch von dem Widerspruch, daß man besitzen will, aber nicht mehr darf, also mit schlechtem Gewissen besitzt. Wenn das Zitat kritisch kursiert, bleibt von dem ohnehin wirklichkeitsarmen Gerechtigkeitsbedürfnis nur noch diese Formel übrig, die sich, dank ihrer heftig negativen Gestik, als Kritik einsetzen läßt. Die krasse Alternative falsch/richtig ist aber zugleich ein Marx/Engels-Echo; die haben gesetzhaft statuiert, ein Bewußtsein, das den Überbau nicht als ein Ergebnis der gesamtgesellschaftlichen Bedingung erkenne, sei ein falsches Bewußtsein.
Warum wurde der Adorno-Satz, der in ein kritisches Editorial von ‹Schöner wohnen› passen würde, so zum wahrhaft geflügelten Wort? Es muß die kritische, die negierende Potenz sein. Die vollkommene Absprechung einer Lebensmöglichkeit, ohne daß gesagt wird, was das richtige Leben wäre und was das falsche Leben ist. Also eine Passepartout-Kritik. Eine Formel für jede beliebige Verneinung. Über die dialektikabweisende Trennung in ein Falsches und ein Richtiges darf man sich wundern. Bei Adorno. Hegel, zum Beispiel, sagt in der ‹Phänomenologie des Geistes›: «… es gibt ein Falsches so wenig es ein Böses gibt».
Adorno hat, wie es bei Kulturphilosophen üblich ist, etwas, was er für einen Sachverhalt hielt, gesellschaftskritisch bündig und radikal formuliert. Dann aber der unmäßige Gebrauch, den wir davon machen. Das kann heißen, wir sind kritisch gesinnt, verneinungslüstern aufgelegt, und dafür brauchen wir Sprache, deren wir uns bedienen können. Nicht zu vergessen: immer über beziehungsweise gegen andere. Wir brauchen die Negation. Ich vermute, wir spüren uns selber deutlicher, wenn wir einen anderen kritisieren. Einen anderen kritisierend steigern wir unser Selbstgefühl. Gerade hat ein Kritiker den Patron seiner Branche, Walter Benjamin, zitiert: «Nur wer vernichten kann, kann kritisieren.» Aber was fehlt uns eigentlich, daß wir das brauchen, dieses Absprechen, Verurteilen, Verneinen? Zu Nietzsches Immerwiederkehrendem gehört es, daß das Leben nicht in richtig und falsch, wahr und unwahr zerschnitten werden soll, daß «Verzichtleisten auf falsche Urteile ein Verzichtleisten auf Leben, eine Verneinung des Lebens wäre». Das lese ich gern, weil es schon einmal hilft, diese Richtig/Falsch-Einteilung zu schwächen.
Mit zwei unmäßig ausführlichen Zitaten soll jetzt dokumentiert sein, wie Nietzsche selber verfährt, ganz unwillkürlich verfährt. Beide Zitate aus ‹Jenseits von Gut und Böse›, das erste Zitat beginnt auf S. 624, das zweite auf S. 646 (Ausgabe Karl Schlechta, Bd.II). Und dieses ziemlich direkte Aufeinanderfolgen gehört zum Augenöffnenden selbst.
Auf S. 624 heißt es: «Und die Starken zerbrechen, die großen Hoffnungen ankränkeln, das Glück in der Schönheit verdächtigen, alles Selbstherrliche, Männliche, Erobernde, Herrschsüchtige, alle Instinkte, welche dem höchsten und wohlgeratensten Typus ‹Mensch› zu eigen sind, in Unsicherheit, Gewissens-Not, Selbstzerstörung umknicken, ja die ganze Liebe zum Irdischen und zur Herrschaft über die Erde in Haß gegen die Erde und das Irdische verkehren – das stellte sich die Kirche zur Aufgabe und mußte es sich stellen, bis für ihre Schätzung endlich Entweltlichung und höherer Mensch in ein Gefühl zusammenschmolzen … bis endlich eine verkleinerte, fast lächerliche Art, ein Herdentier, etwas Gutwilliges, Kränkliches und Mittelmäßiges herangezüchtet ist, der heutige Europäer …» Und dann S. 646ff.: «Die lange Unfreiheit des Geistes, der mißtrauische Zwang in der Mitteilbarkeit der Gedanken, die Zucht, welche sich der Denker auferlegte, innerhalb einer kirchlichen und höfischen Richtschnur oder unter aristotelischen Voraussetzungen zu denken, der lange geistige Wille, alles, was geschieht, nach einem christlichen Schema auszulegen und den christlichen Gott in jedem Zufalle wiederzuentdecken und zu rechtfertigen – all dies Gewaltsame, Willkürliche, Harte, Schauerliche, Widervernünftige hat sich als das Mittel herausgestellt, durch welches dem europäischen Geiste seine Stärke, seine rücksichtslose Neugierde und feine Beweglichkeit angezüchtet wurde … diese Tyrannei, diese Willkür, diese strenge und grandiose Dummheit hat den Geist erzogen … Hiermit ist auch ein Wink zur Erklärung jenes Paradoxons gegeben, warum gerade in der christlichsten Periode Europas und überhaupt erst unter dem Druck christlicher Werturteile der Geschlechtstrieb sich bis zur Liebe (amour-passion) sublimiert hat.»
Das darf man nicht referieren, das muß zitiert werden. Dann ist aber auch schon alles klar: Wer sich vor solchem Widerspruch hütet, der unterdrückt immer mindestens die Hälfte seines Denkens oder Wissens oder Seins. Der verfährt gegen sich selbst als ein Moralist, der uns, vielleicht um der Normierbarkeit seines Moralisierens willen, eine Konsequenz vorgaukelt, die die Freiheit unseres Geisteslebens auf Widerspruchsfreiheit reduziert. Und das ist von allen Freiheiten die unwichtigste.
Mir sind nicht die Inhalte dieser Nietzsche-Passagen wichtig, wohl aber sein Beispiel des So-und-so-weit-Gehens. Sein Nichthaltmachen im Beweisbaren. Seine Nachgiebigkeit dem Verführerischen gegenüber. Also seine Bewegbarkeit. Keine erreichte Position verdient es, daß man sie feiere, als habe man sie angestrebt und sei jetzt am Ziel.
Wenn wir einem anderen nachsagen, daß er etwas falsch gemacht hat oder daß er falsch lebt, dann empfinden wir: Ich bin nicht wie du. Diesen Unterschied bewerten wir negativ. Wenn uns an einem anderen etwas gefällt, denken wir nicht: Ich bin nicht wie du. Von dem, was uns gefällt, müssen wir uns nicht gleich unterscheiden, nur was uns mißfällt, weckt unser Unterscheidungsbedürfnis, unsere Kritiklust. Gibt es etwas Günstigeres für das Selbstbewußtsein als die Empörung über einen anderen? Es ist sozusagen Futter für unsere Identität, nicht zu sein wie die, an denen uns etwas mißfällt. Wir erleben den Unterschied und erleben dadurch ganz von selbst, also ohne das bewußt zu konstatieren, daß wir richtig sind, so wie wir sind, daß wir klug sind, schön sind, natürlich auch gut sind. Daß man politisch korrekt ist, erlebt sich wahrscheinlich am deutlichsten, wenn man einem anderen nachweist, daß der das nicht ist. Und es wäre doch viel schöner, zustimmend zu sein, nein, nicht viel schöner, sondern überhaupt schön kann nur das Zustimmen sein, das Rühmen und Lieben und Feiern. Das Absprechen und Kritisieren hat keine Schönheits-Chance. Und doch ist die Negation in uns immer auf der Lauer nach einer Gelegenheit, sich in Szene zu setzen. Nietzsche, dem der große Ideengründer Plato des öfteren auf die Nerven ging, hat sich darüber gefreut, daß man unter dem Kopfkissen von Platos Sterbebett keinerlei Bibel fand, also, schreibt er, «nichts Ägyptisches, Pythagoreisches, Platonisches – sondern Aristophanes. Wie hätte auch ein Plato das Leben ausgehalten – ein griechisches Leben, zu dem er Nein sagte – ohne einen Aristophanes!» Also ohne einen vor kritischer Lust andauernd Platzenden.
Adorno läßt den letzten Abschnitt der ‹Minima Moralia›, die er «Reflexionen aus dem beschädigten Leben» nennt, in die Erlösung münden: «Philosophie, wie sie im Angesicht der Verzweiflung einzig noch zu verantworten ist, wäre der Versuch, alle Dinge so zu betrachten, wie sie vom Standpunkt der Erlösung aus sich darstellen.» Ich weiß nicht, ob Adorno selbst den Standpunkt je hat einnehmen können. Aber immerhin hat er eine kulturkritische Weltbetrachtung mit diesem Hochsprung abgeschlossen. Eine überraschende Wendung. Aber das hat er zugelassen. Egal, ob wir noch erlösbar sind oder nicht, allein der Gebrauch des Wortes Erlösung ist wenigstens eine Erlösung aus dem Richtig/Falsch-Dilemma. Und was ihn zum Hochsprung befähigte oder nötigte, nennt er Verzweiflung. Ich glaube nicht, daß jemand ihm diesen Erlösungssprung nachmacht, aber daß sein Kompendium kritischer Maßnahmen so bedürftig endet, läßt sich lesen als ein Zeichen der Sehnsucht nach einem Ausbruch aus der Routine des Verneinungsgehorsams. Walter Benjamin hat das so gesagt: «Erst der Messias selbst vollendet das historische Geschehen.» Auch das ein Hochsprung, und er landet im Religiösen, also da, wo die Verwaltung des Nichts überhaupt ihren Ursprung hat.
Mir hat ein Fachmann erklärt, wie naiv ich doch sein müsse, daß ich Gerhard Schröders Antikriegshaltung im Sommer 2002 nicht als bloße Wahlkampftaktik durchschaut habe; er, der Fachmann, hat mir erklärt, das alles sei bloße Mache gewesen, Umfragenausbeutung und so weiter. Der Fachmann selber war ein Befürworter des von Amerika angefangenen Irakkriegs, und er hatte gute Gründe für seine Meinung, und ich hatte gegen seine Gründe nichts geltend zu machen als meine Empfindungen. Historisch geschulte Empfindungen, glaube ich. Der Fachmann war keine Sekunde lang in Gefahr, meine Empfindungen ernst zu nehmen. Er war kein Parteigänger des Bundeskanzlers. Er war sicher nicht vorbedacht kritisch, aber er freute sich sichtlich, Schröder etwas uneingeschränkt Negatives nachsagen zu können: Nicht aus Überzeugung gegen den amerikanischen Krieg, sondern aus Wahljahrs-Opportunismus. Quotenpolitik und Stimmenfang. Mein Einwand: Sich nach den Leuten zu richten, und das bei Krieg oder Nichtkrieg, sei doch demokratisch, erntete mitleidiges Lächeln. Es ist keine Überlegung wert, ob Schröder selber nicht gegen diesen Krieg gewesen sein könnte, und wenn man selbst für diesen Krieg war, wird unterstellt, Schröder sei auch dafür gewesen, habe aber, um Stimmen zu fangen, den Kriegsgegner gespielt. Der die Bundeskanzlerhaltung Verneinende verneint nicht aus niederen Beweggründen. Er weiß es besser. Das weiß er, daß er es besser weiß. Es gibt für ihn keine andere Möglichkeit, als für diesen Krieg zu sein; also kann einer, der gegen diesen Krieg ist, entweder naiv sein – das billigte er mir zu –, oder er tut nur so, er spekuliert, ja, er lügt. Unwillkürlich weiß man es dann nicht nur besser, sondern man ist dann auch besser. Und das gehört dann unauflösbar zusammen, wird ein Selbstgefühl.
Stellen wir uns einmal vor, jeder könnte sich morgens hinsetzen, ein Blatt Papier nehmen und darauf schreiben:
Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne
Wasser.
Das ist auch ein Schlager, auch schon formelhaft präsent wie Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Und nur, weil wir uns nicht hinsetzen und schreiben können:
Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
nur deshalb müssen wir schreiben: Es gibt kein richtiges Leben im falschen. In mir möchte es auf diesen Satz eben immer antworten: Es gibt kein falsches Leben im richtigen. Das ist genau so unbeweisbar wie das Gegenteil. Wir könnten das genau so häufig als Trost- und Beruhigungsformel hinsagen, wie wir uns mit dem Gegenteil auf kritische Stelzen schwingen. Warum also verfallen wir lieber auf die negativen Sätze? Es ist die Folge eines Mangels. Wir müssen anderen etwas aberkennen, weil uns zu wenig zuerkannt worden ist. Wir erleben uns selber zu wenig als Anerkannte, Bestätigte, Gerechtfertigte, also reagieren wir ganz von selber auf andere so, wie auf uns reagiert wurde, kritisch, verneinend. Mütter sind vielleicht die einzigen Lebewesen, die auf ihre Kinder, wenn sie denen etwas beibringen wollen, bejahend reagieren. Schon Väter neigen dazu, ihre Kinder, wenn die etwas nicht können, was sie können sollten, zu kritisieren. Väter neigen dazu, Kinder spüren zu lassen, daß sie etwas nicht können, was der Vater kann. Daraus wird dann allmählich Autorität. Und der erzogene Mensch, also der Erwachsene, setzt das schlicht fort, er reichert Selbstbewußtsein an dadurch, daß er andere kritisiert.
Dieses unwillkürliche Bessersein und Besserwissen fundiert jede Kritik. Deshalb ist auch Selbstkritik so unglaubwürdig. Ich weiß es doch nicht besser als ich. Vor allem: Ich bin nicht besser als ich. Ich habe mich gelegentlich in Selbstkritik versucht; dabei bin ich mir unseriös vorgekommen. Ist das jetzt eine Selbstkritik? Das einzige, was ich da für feststellbar halte: Jeder Mensch ist immer schon alles, was er sein kann. Und da er sich selber lieben muß, kann er sich nicht selber verneinen. Ohne Selbstliebe kann keiner leben. Und Liebe ist nichts als Zustimmung. Ich rede nicht von Unterhaltungsgepflogenheiten, sondern vom Dasein, vom Leben. Dem Liebenden ist auch das recht, was gegen den Geliebten spricht. Ich erinnere mich an Zeiten, in denen ich eigentlich liebend durch die Welt ging. Von heute aus gesehen, fühlte ich mich ausgestattet mit einer vor nichts Halt machenden Liebesfähigkeit. Ich wollte alle und alles lieben können. Das in der Sprache angebotene Wort für meine damalige Gestimmtheit heißt vielleicht naiv. Der Dichter, der mir diese Daseinsstimmung am schönsten ermöglicht hat, war natürlich Hölderlin. Schiller, auch der jüngste, ist schon ein Soll-Verkünder. Hölderlin feiert. Aber Hölderlins feierlich festes JA zu Allem wird immer erreicht in einem Prozeß, der durch jedes Nein und Nichts führt. Nur, der Prozeß macht nirgends Halt. Der Prozeß hat andauernd Angst vor Halt ist gleich Erstarrung ist gleich Nichts. Davon, von dieser Angst, daß Nichts herrsche, leben seine feiernden Tonfolgen. Zum Beispiel:
Versöhnender, der du nimmergeglaubt
Nun da bist
Oder:
Komm! Ins Offene, Freund! Zwar glänzt ein
Weniges heute
Oder:
Ein Zeichen sind wir, deutungslos …
Wie aber Liebes? Sonnenschein
Am Boden sehen wir
Oder:
Voll Güt ist; keiner aber fasset
Allein Gott.
Wo aber Gefahr ist, wächst
Das Rettende auch.
Das ist es. Das ist der immer angestrebte Gegenton. Das ist das Nichtausruhen im Negativen. Das darf man Dialektik nennen. Das ist die Notwehr, beispielhaft. Nie ist Hölderlins Ton entspannt und ungefährdet. Nie ist er nur Verneinung oder Nichtsalsfeier. Dieser Ton ist schlechthin gezwirnt. Nichts und Gegennichts bewirken ihn gleichermaßen. Das erst bringt Leben hervor. Kühne Anbindung: Bei den Nukleinsäuren und Proteinen war’s auch so, erst als aus deren Begegnung höhere Gebilde entstanden, kombinierte Kreise, erst da entstand aus der leblosen Monotonie das Mehrfache, das Leben. Manfred Eigen nennt es «das Problem der Selbstorganisation von Makromolekülen zu autokatalytischen Hyperzyklen». Aber gesichert ist nichts. Die Drohung bleibt. Die Drohung des Rückfalls in die Erstarrung. Ins Nichts.
Der Dichter hat vorgemacht, daß es nicht genügt, ihm nicht genügt, die Erstarrungsdrohung weiterzusagen, die Verneinung gelten zu lassen, das Verhängnis zu propagieren, er hat sich wehren müssen. Das hat er nicht lebenslänglich ausgehalten, dieses Leuchtenmüssen gegen das gemeine Dunkel. Offenbar ist es gesünder, sich im gemeinen Dunkel einzurichten. Sage ich für mich vor mich hin. Dann allerdings gingen wir finsteren Zeiten entgegen. Das aber darf nicht sein. Wir sind doch alle lichtsüchtig, jeder von uns hat ein Blatt Papier, sein Blatt Papier, und jeder setzt sich einmal pro Tag da hin und schreibt:
Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See.
Und wenn er einmal nichts Eigenes nötig hätte, weil er gerade nicht das Gefühl hat, er selber müsse mehr Helligkeit produzieren, als dieser bestimmte Tag anbietet, dann stattet er sich aus mit Hölderlin. Es hilft nämlich, sich an Hölderlins gelben Birnen und wilden Rosen zu bedienen. Man fühlt sich da mindestens so deutlich, wie wenn man in die ungefüge Zeit hineinsagt, es gebe kein richtiges Leben im falschen.
Nietzsche vermutet, Schopenhauer sei über der Frage: Wie ist Willensverneinung möglich? zum Philosophen geworden. Nietzsche selber schwärmt dagegen von einem, der nichts, was ist und war, verneint, sondern der, heißt es da, «unersättlich da capo» ruft. Das meiste liegt ohnehin an den Wörtern. Sich der Wörter bewußt zu werden hilft. Einsamkeit, zum Beispiel. In Nietzsches Briefen ist es das Hauptwort schlechthin. Gäbe es Einsamkeit, wenn wir das Wort nicht hätten?
Sicher ist das Wort die Antwort auf eine Erfahrung. Und es ist aus dieser Erfahrung ein großes, ein schönes Wort geworden. Es sind auch blöde Wörter entstanden, ganz und gar unschöne, wie Belang, Beziehung, Bewertung. Aber Einsamkeit gehört zu den schöneren. Loneliness ist noch schöner. Solitude und soledad sind unserer Einsamkeit konstruktionsverwandt. Ein solches Wort wirkt auf das, was es sagen, was es ausdrücken soll. Das Wort produziert geradezu das, was es angeblich nur ausdrückt.
Einsamkeit, das ist schon ein Faltenwurf, ein Kostüm, ein Kothurn. Wer einsam wäre und hätte dieses Wort nicht, der wäre elend dran. Der würde tierisch leiden. Der hätte nichts als dieses Unsägliche. Wahrscheinlich müßte er gehen, rennen, pfeifen, singen, schreien bis zur Erschöpfung. Aber es gibt das Wort, er hat das Wort. Sobald das Wort Einsamkeit die Regie übernimmt, gehört der Einsame wieder dazu. Das Wort empfinden heißt, die Einsamkeit mitteilen. Sie ist zur Sprache gebracht. Du hast deine Einsamkeit in der gloriosen Gesellschaft der Einsamen. Du bist einsam wie Nietzsche und andere, wenn es auch – das nebenbei – keinen gibt, der einsamer gewesen sein kann als Nietzsche. Aber er hat sie mitgeteilt, seine Einsamkeit. Zum Glück. Keiner von uns kann Einsamkeit passieren lassen, ohne daß sie ihm nahelegt, sie beim Wort zu nehmen. Die Sprache ist die andauernde Hochzeit von Natur und Geschichte; sie bietet die Wegzehrung für jede noch so dürftige Strecke; in den Wörtern ist immer alles enthalten, was uns fehlen kann. Die Sprache ist in jedem Augenblick so alt wie die ganze Menschheitsgeschichte. Man sieht es ihr nicht an. Was sie andauernd verliert, produziert sie andauernd. In uns.
Keiner, der noch bei Troste ist, kann sagen, er beherrsche die Sprache. Auch sie beherrscht uns nicht. Herrschende Meinung, ja, das gibt es. Das ist die Indienstnahme der Sprache zu etwas, was sie nicht selbst ist, wozu sie aber tauglich gemacht werden kann. Sie wird eingeschränkt auf einen vom Interesse befohlenen Ausschnitt und soll verschweigen, was diesem Interesse nicht dient, und vertuschen, daß sie etwas verschweigt. Diese im Meinungsdienst gehende Sprache ist eine Einschränkung, eine Spezialisierung der persönlichen Sprache. Persönlich hat jeder unendlich viele Verhältnisse mit der Sprache, zur Sprache. Jeder hat seine Sprache. Und er hat nichts, was ihm so eigen ist wie seine Sprache. Die Bewußtseinsbewegung, der Lebensandrang, die Stimmungsfülle, das Daseinsgefühl. In jedem. Das ist seine Sprache. Keiner kann befehlen, was ihm einfallen soll. Er kann Wünsche empfinden. Wünsche wachsen lassen. Vielleicht entspricht die Sprache dann seinen Wünschen. Das hängt davon ab, wie sehr seine Wünsche legitim sind. Ja, das kann man so sagen. Wie gemäß sie mir sind. Mir ungemäße Wünsche lehnt die Sprache ab, beziehungsweise sie erfüllt sie mir so, daß ich erkenne, wie wenig gemäß mir diese Wünsche waren.
Jetzt wünsche ich mir, weil mir danach ist, Berittene. Berittene, welch ein Wort. Berittene also, die in einem begrenzten Gelände ihre Pferde genießen. Endlich soll es Reitern und Pferden gleich viel Spaß machen, sich vor uns zu tummeln. Das wäre paradiesisch, also vorsprachlich. Eine vollkommene Reiterei, Pferde und Reiter gleich glücklich, also gleich schön, zeugenlos. Aber zeugenlos ist nichts schön. An sich ist nichts schön. Und in dem Augenblick, in dem wir zuschauen, beginnt die Quälerei. Und die Schönheitsmöglichkeit.
Ich habe gestern auf einem unebenen Waldweg einen Mann beobachtet, der ging am Stock, an einem zierlichen Stock, dann blieb er stehen, nicht ruckartig, sondern allmählich, blieb stehen und hob seinen Stock. Dann bewegte er diesen schwarzglänzenden Stock durch die Luft, und dann, das war überdeutlich, dann wurden seine Bewegungen so bestimmt, daß sie nichts anderes sein konnten als Dirigieren. Der Mann dirigierte eine Musik, dirigierte ein Orchester, ich schaute zu, dann hörte ich zu. Eine Musik in mehreren Sätzen. Und als er das Finale schon spürte und spüren ließ, als ich mich schon bereit machte, da capo zu rufen, mußte er plötzlich zur Seite springen, na ja, nicht gerade springen, aber sich doch rasch zur Seite bewegen, den Waldweg ziemlich jäh verlassen, was ihm überraschend gut, geradezu elegant gelang. Es sah aus, als gebe er jetzt nicht notgedrungen den Weg frei, weil da diese Reiter hertrabten, schon eher galoppierten als trabten, sondern als rufe er diese Reiter gewissermaßen durch sein elegantes Zurseitetreten erst herbei. Die Reiter, eher Halbwüchsige, Mädchen und Buben, alle mit langen und entsprechend fliegenden Haaren, brausten den Waldweg entlang, Reiter und Pferde in einer unangestrengten, keinem Befehl und keinem Anspruch genügen müssenden Bewegung. Und waren verschwunden. Der Mann ging wieder an seinem Stock den Waldweg weiter. Ich blieb stehen, bis ich ihn nicht mehr sah. Vielleicht müßte ich noch dazusagen, daß dieser Mann einen Schnurrbart hatte, der an Salvador Dalí erinnern sollte.
Ich nagte, als ich weiterging, wieder an meinem Käfig herum. Jeder Satz, der mit Ich beginnt, beschäftigt sich mit meinem Käfig. Vielleicht sollte ich sagen: Ich ist überhaupt mein Käfig. Da ich nicht weiß, wie ich aus diesem Käfig je hinauskommen soll, fange ich an zu überlegen, ob ich andere einladen könnte, mir in meinem Käfig Gesellschaft zu leisten. Darüber lasse ich die Sprache nachdenken. Nicht zum ersten Mal.
Das menschliche Ermessen
Sieben Versuche
Und nochmals: es ist leichter, gigantisch zu sein als schön …
Friedrich Nietzsche
Der HERR läßt Saul durch Samuel sagen, Saul solle die Amalekiter schlagen. Samuel bestellt die Botschaft des HERRN.
Schone seiner nicht
sondern tödte beide
Man und Weib
Kinder und Seuglinge ochsen und schafe camel und esel
Aber Sauls Leute töten trotz dieses göttlich genauen Befehls nur die Menschen, die Tiere lassen sie leben, die wollen sie nämlich dem HERRN opfern. Der HERR reagiert streng, er läßt Saul durch Samuel bestellen, ihm, dem HERRN, sei an Gehorsam mehr gelegen als an Brandopfern. Widerstreben, meldet Samuel, ist Götzendienst. Und der HERR verwirft Saul. Und Samuel schickt er zu Isai. Sieben Knaben läßt sich Samuel vorführen, keiner ist der Erwählte. Sind das die Knaben alle, fragt Samuel. Und erfährt:
Es ist noch uberig der Kleinest
und sihe
er hütet der schaf
Der wird geholt.
Und er war braunlicht mit schönen augen
und guter gestalt
Und der HERR sprach:
Auff und salbe jhn
Denn der ists
So wurde David gefunden und zu Saul gebracht, den er gleich mit Saitenspiel vom bösen Geist befreite.
Dann die Szene, die jeder liest, wie er’s braucht: David gegen Goliath. Mir demonstriert diese Szene, daß Goliath nicht nur keinen Sinn für das Schöne hatte, sondern es verächtlich fand, gut auszusehen:
Er sah David an: und veracht jhn
Denn er war ein Knabe braunlicht und schön.
Aber mehr sagt über das ganze legendäre David-Goliath-Gedöns – Steinschleuderknabe besiegt Panzerriesen –, daß der Kleine den Großen gar nicht mit der Steinschleuder besiegt, sondern mit Hilfe des HERRN Zebaoth. David spricht zu Goliath hinauf:
Du kompst zu mir mit schwert
spies und schilt
Ich aber kome zu dir im Namen des HERRN
Zebaoth des Gottes des zeugs Israel.
Daß er den nachher noch mit dem Stein an die Stirn traf und so ihn tötete, ist ein Entgegenkommen des Geschichtspriesters Samuel an die Gruselbedürfnisse seines Publikums. Die ganze Bibel wird ja so erzählt: Alles, was geschichtlich, politisch und überhaupt gut geht, macht der HERR, alles, was falsch läuft, machen die Menschen und müssen dann vom HERRN wieder auf den rechten Weg gebracht werden.
Mit ein wenig Leichtfertigkeit kann man sagen, daß Geschichtsschreibung als Gottesbeweis ihren Reiz ziemlich schnell einbüßt (heute, bitte!), daß aber die bibelfüllenden Tatsächlichkeiten eine Wirkung haben, die über ihre religiöse Dienlichkeit hinausreicht. Und das ist in der David-Geschichte zum Beispiel, daß er braunlicht und schön ist. Und daß er nicht besonders groß ist. Er ist ja noch ein Knabe. Goliath aber ist nicht schön denkbar. Imposant, gewaltig, furchterregend, aber überhaupt nicht schön. Und deshalb kann man heute mit ein bißchen Willkür den HERRN Zebaoth zumindest vorübergehend ersetzen durch das Schöne überhaupt, das dem Gigantischen überlegen ist. Und es bin überhaupt nicht ich, der das, vom Bedürfnis geblendet, behauptet, sondern der Gang der Geschichte tut es dar: An Gott muß man glauben; das Schöne sieht man.
Wenn sich die Europäer an das biblische Bilderverbot gehalten hätten, hätte der importierte Mythus sich nicht gegen alles Einheimische durchsetzen können. Raffael hat der Madonna mehr genützt als alle Theologen. An Raffaels Madonna muß man nicht glauben, die sieht man, erlebt man, begreift man. So muß Religion aussehen, wenn sie uns erreichen will. Also ist das Christentum schon mal darauf angewiesen, als Schönheits-Phänomen gerechtfertigt zu werden: von Raffael bis Bach, Schubert, Bruckner u.s.w. Oder Haydn: ‹Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze›. Dann stelle man sich vor, was da auf Golgotha in Wirklichkeit passierte! Ohne Kunst wäre das doch nichts als kindheitsgefährdend. Gerade habe ich in Erich Wolfgang Skwaras rücksichtslos genauem Roman ‹Zerbrechlichkeit› gelesen: «Dabei bin ich mein Leben lang doch nur in die Kirche gegangen, um hemmungslos die Schönheit zu bewundern.»
Wie es zu diesen Schönheitsphänomenen kommt, das nennt man in der Wirtschaft Subsidiarität. Wenn der Import nicht vor Ort produktiv umgesetzt, ja, verwirklicht worden wäre, wäre die römische Hierarchie an sich selbst erstickt. Der Vatikan ist ein Gigant, der davon lebt, daß er, was überall draußen vor Ort mit der Botschaft gemacht wird, nicht rechtzeitig verhindern kann. Zum Beispiel Luther, der der größte Subsidiarist aller Zeiten ist. Er ist natürlich auch der größte David aller Zeiten. Es hat auch innerhalb des gigantischen Vatikans jede Menge Subsidiarität stattgefunden; leuchtendstes Symbol: die Sixtinische Kapelle. Das sind glaubenspendende Taten. Und es sind Taten der Schönheit, also der Kunst. Oder: Es ist das Religiöse vor Ort.
Wenn es Gott gibt, ist die Welt natürlich auch ohne das Schöne auszuhalten beziehungsweise gerechtfertigt. Ohne Gott ist die Welt nur als Schönes zu rechtfertigen. Das Gute ist etwas, das man nicht genauer anschauen darf, weil es sonst nicht mehr das Gute ist. Das Schöne gibt es. Und es ist weniger im Großen als im Kleinen. Das David-Goliath-Duell ist – man darf sagen: zum Glück – ein anthropologisches Muster.
Ein bißchen menschenselig formuliert: Jeder Goliath provoziert einen David, der ihn dann umlegt. Zum Beispiel: Sebastian Haffners ‹Geschichte eines Deutschen, Erinnerungen von 1914 bis 1933›, fängt so an: «Die Geschichte, die erzählt werden soll, hat zum Gegenstand eine Art Duell. Es ist ein Duell zwischen zwei sehr ungleichen Gegnern: einem überaus mächtigen, starken und rücksichtslosen Staat, und einem kleinen, anonymen, unbekannten Privatmann … Der Staat ist das Deutsche Reich, der Privatmann bin ich.» Solche Duelle, schreibt Haffner, seien in Deutschland in den Dreißigerjahren «zu Tausenden und Hunderttausenden» ausgefochten worden. Oder: Der Betriebsschlosser Gert Neumann im Keller des Kaufhauses in Leipzig besiegt den Koloß DDR. Beide Taten fanden auf dem Papier statt, unterschieden sich aber dadurch von einander, daß Haffner, was er 1939 in London schrieb, nicht veröffentlichen konnte, es konnte erst im Jahr 2000 erscheinen, als die Geschichte über dieses Deutsche Reich schon gerichtet hatte. Gert Neumanns Roman ‹Elf Uhr› erschien 1981 im Westen, der Autor arbeitete weiter als Schlosser in Leipzig. Er wechselte vom Theater ins Kaufhaus: «Hier, beschloß ich, will ich endlich dem Anspruch der Diktatur, aus der Wirklichkeit ein Kunstwerk gemacht zu haben … auf der von ihr gewählten Ebene begegnen.» Die DDR hatte nach diesem Buch keine Chance mehr. Keine Legitimität. Die Wirklichkeit brauchte noch ein paar Jahre, bis sie das von Gert Neumann haarklein erzählte Urteil vollzog. Das war ein Kampf eines eher zarten Intellektuellen gegen einen Koloß, der sich für großmächtig hielt.
Man sollte unterscheiden zwischen nachträglicher Geschichtsschreibung und Schreiben im prekären Augenblick, in der Zeit, in der noch alles auf dem Spiel steht. Nachträglich über Luther – da ist man schnell auf der richtigen Seite. Ist Geschichtsschreibung nicht auch etwas Elendes? Dieses geschenkte Rechthaben. Der Geschichtsschreiber beweist auch immer nur den Gott, der jetzt gerade dran ist. Taten kommen schon vor, aber eher selten. Dem Koloß die Legitimität zertrümmern: das ist das historische Verfahren der Davide von Luther bis Neumann. Diese Davide müssen dazu nicht mehr mit dem HERRN Zebaoth anrücken, es genügt Sprache. Und je besser die ist, um so verheerender für den Koloß. Ein so ganz aus dem Keller der Ohnmacht geschriebenes Buch wie ‹Elf Uhr› kann kein Koloß überleben.
In einem der Warteräumchen, mit denen mein Zahnarzt seine Behandlungsarenen umlagert, saß ich ziemlich nah vor einer zierlichen Großmutter, der ein Kleinkind schlafend im Arm lag, sechs Wochen alt, aber von den Schühchen bis zur Mütze komplett angezogen. Das Mädchen in Berufsweiß hatte die sechs Wochen des Knäbleins erfragt, dann staunte sie. Ich auch. Sechs Wochen und so groß. Der Kopf fast so groß wie das übrige. Ja, sagte die zierliche Großmutter, so komme es, wenn man einen zu großen Mann heirate. Die Männer würden ja immer noch größer. Dann gehe es eben nur noch mit Kaiserschnitt. Aber das nächste Mal heirate ihre Tochter sicher einen kleineren. Und korrigierte, um nicht falsch verstanden zu werden: Im nächsten Leben. Und wenn es auch im nächsten Leben nur noch solche Mehroderwenigerriesen gibt?
Ich wollte einmal zwischen Immenstadt und Oberstaufen ein vom bäuerlichen Besitzer aufgegebenes Bauernhaus kaufen, ein Höfle eben, auf zirka 900 m Höhe, zirka 200 Jahre alt, mit einem St. Leonhard im Giebel. Als der Bauer uns ins Innere führen wollte, stellte sich heraus, daß die Türen so klein, so nieder waren, daß man in die Knie gehen mußte. Der Bauer sagte in hochdeutscher Anstrengung: Der Mensch kann sich auch bucken.
Die Allgäuer vor 200 Jahren mußten sich überhaupt nicht bucken, um durch diese Türen zu kommen. Die Menschen werden also immer größer. Hoffentlich nicht nur die Männer. Oder ist es denkbar, daß die Evolution pfuscht und die Männer so groß werden läßt, daß die Frauen sie gar nicht mehr gebären können? Die Saurier sind bekanntlich an ihrem unbeherrschbaren Wachstum eingegangen. Und schöner sind sie durch ihr unflätiges Wachstum auch nicht geworden.
Ich habe eine Zeit lang für das Wort Entelechie geschwärmt.