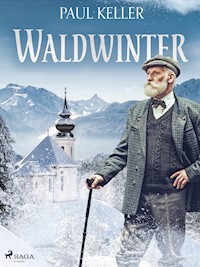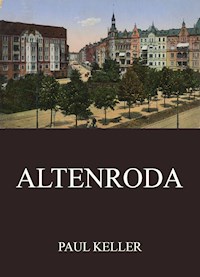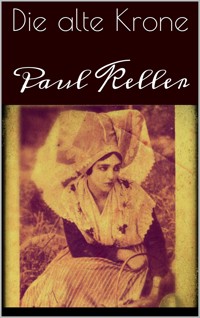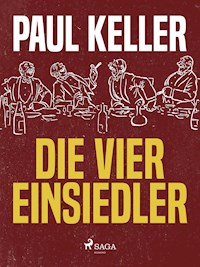
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"In einer Breslauer Weinstube kehrten alle Tage in der stillen Geschäftszeit von fünf bis sechseinhalb Uhr nachmittags vier Männer ein. Andere Gäste waren um diese Zeit nicht anwesend. Jeder der vier Männer saß an einem besonderen Tische, wie es bei Deutschen üblich ist." Es sind dies die titelgebenden "vier Einsiedler", und darüber hinaus sehr unterschiedliche Gesellen: Ein deutschnationaler Offizier, Major a. d. von Bärsfeld, Protestant; der Forschungsreisende Dr. Spelt, linksgerichtet und areligiös; der Katholik Dr. Lowinksy, der nicht nur einen polnischen Namen, sondern auch polnische Wurzeln aus den nach dem Ersten Weltkrieg abgetretenen Ostgebieten hat; sowie der berufslose Max Kröcklein, einst Schiffskoch und von niederem Stande, dabei nicht nur religiös reichlich desinteressiert ... Doch unwillkürlich kommen sich die vier näher, und schon nach wenigen Tagen sitzen sie alle an einem Tisch. Als der Major nun seine Wohnung oben im Gebirge in Gießbrunnen verlieren soll, die er nicht mehr bezahlen kann, hat Kröcklein eine verwegene Idee: "Ich dachte nun, wie es wäre, wenn Herr Dr. Spelt, Herr Dr. Lowinsky und meine Wenigkeit sich zusammentäten, dem Herrn Major sein Haus in Gießbrunnen abmieteten und dort gemeinsame Wirtschaft führten. Wir kämen bei eigener Wirtschaft, meine Herren, sicher mit fünfzig Prozent Ermäßigung bei viel besserer Verpflegung aus, als wenn jeder für sich im Restaurant speist." Eine eigentümliche Wohngemeinschaft der vier so verschiedenen Persönlichkeiten entsteht – in der Streit und reichlich Probleme freilich nicht ausbleiben. Natürlich darf da auch die Haushälterin nicht fehlen, die sich in der Polin Jascha findet, der besonders Lowinksy bald auch menschlich näherkommt; während Hertha, die Tochter des deutschnationalen Majors, ins sozialistische Lager überwechselt ... Paul Kellers 1923 zuerst erschienener und noch heute überaus lesenswerter tragikomischer Zeitroman ist ein eindrucksvolles Plädoyer zu Verständigung über alle religiösen und politischen Lager und Schichten hinaus – direkt aus den dramatisch unruhigen Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg, in denen Deutschland Revolution und tiefe Spaltung drohte.Paul Keller (1873–1932) wurde als Sohn eines Maurers und Schnittwarenhändlers geboren. Zwischen 1887 und 1890 besuchte er die Präparandenanstalt in Bad Landeck und anschließend von 1890 bis 1893 das Lehrerseminar in Breslau. Nachdem er acht Monate als Lehrer im niederschlesischen Jauer tätig war, wechselte er 1894 als Hilfslehrer an die Präparandenanstalt in Schweidnitz. Zwischen 1896 und 1908 war er Volksschullehrer in Breslau. Keller gründete die Zeitschrift "Die Bergstadt" (1912–1931) und schrieb schlesische Heimatromane sowie "Das letzte Märchen", eine Geschichte, in der ein Journalist in ein unterirdisches Märchenreich eingeladen wird, um dort eine Zeitung aufzubauen, und dabei in Intrigen innerhalb des Königshauses hineingerät. Die Namen wie "König Heredidasufoturu LXXV.", "Stimpekrex", "Doktor Nein" (der Oppositionsführer) haben wahrscheinlich Michael Ende zu seinem Roman "Die unendliche Geschichte" angeregt. Zusammen mit dem schlesischen Lyriker und Erzähler Paul Barsch unternahm Keller zwischen 1903 und 1927 zahlreiche Reisen durch Europa und Nordafrika. Zudem führten ihn etliche Lese- und Vortragstourneen durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Tschechoslowakei. Er war 1910 Mitglied der Jury eines Preisausschreibens des Kölner Schokoladeproduzenten Ludwig Stollwerck für Sammelbilder des Stollwerck-Sammelalbums Nr. 12 "Humor in Bild und Wort". Keller starb am 20. August 1932 in Breslau und wurde auf dem dortigen Laurentiusfriedhof bestattet. – Paul Keller gehörte zu den meistgelesenen Autoren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, was sich in einer 1931 bei fünf Millionen liegenden Gesamtauflage seiner Bücher widerspiegelt, und wurde in 17 Sprachen übersetzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Keller
Die vier Einsiedler
Ein Zeitroman
Saga
Die vier Einsiedler
© 1913 Paul Keller
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711517413
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Bekenntnis:
Ich gehöre keiner politischen Partei an. Ich weiss nur, dass ich ein Vaterland habe und in diesem Vaterlande Brüder und Schwestern. Diese liebe ich wegen ihrer tiefen Vorzüge, ich liebe sie selbst in ihren schweren Fehlern, um deretwillen ich sie weit mehr bemitleide als wegen ihrer grossen und kleinen Leiden. Ich weiss in diesen schweren Zeitläuften nichts Besseres für meine Leute zu tun, als dass ich ihnen die Wahrheit sage, soweit ich sie erkenne.
Paul Keller.
In einer Breslauer Weinstube kehrten alle Tage in der stillen Geschäftszeit von fünf bis sechseinhalb Uhr nachmittags vier Männer ein. Andere Gäste waren um diese Zeit nicht anwesend. Der Kellner hatte bis abends „Mittag“. Der dicke Wirt schlief. Die vier Männer waren keine aufregenden Gäste. Drei von ihnen tranken je eine halbe Flasche; der vierte kaufte eine ganze Flasche Roten und teilte sie sich auf zwei Tage ein. Jeder der vier Männer sass an einem besonderen Tische, wie es bei Deutschen üblich ist.
Der dicke Wirt wachte manchmal auf und dachte: Sie sind stupide! Oder vielleicht sinnieren sie! Gott, was gab es in dieser schrecklichen Zeit nicht alles zu sinnieren! Dann seufzte der Wirt und schlief aus lauter Traurigkeit über die Zeitverhältnisse wieder ein. Manchmal aber plagte ihn auch die Neugier; denn alle Schlesier sind neugierig und die Gastwirte besonders.
Es war ganz richtig, dass der Wirt wissen musste, wer die vier waren, und er brachte auch mit Hilfe gelegentlicher anderer Gäste, sowie eines Laufburschen, eines Barbiers, eines Briefträgers und einer Kellnerin vom Nachbarkaffee das Wesentliche heraus.
Der Grosse, Starkknochige, war Offizier, Major a. D. Das sah man ihm an. Er war deutschnational. Das sah man ihm auch an. Er war Protestant. Feine Mienenpfadsucher hätten auch das erkannt. Er hatte wenig Geld. Das bewies die halbe Flasche, die er langsam ausschlütfte, obwohl es Neunzehner war. Achtzehner war auch noch da, aber der Major hatte gesagt, von diesem „verfluchten Jahrgang“ wolle er nichts haben. Die Kellnerin Lina vom Nachbarkaffee wollte ausserdem wissen, dass der Major geschieden sei und eine einzige Tochter habe, welche bei ihrer Mutter lebe, die immer noch bildschön sei. Aber das war ungewiss; denn Lina sprach öfters die Unwahrheit, weil sie zuviel Romane las. Gewiss war, dass der Major den japsigen Kommisston sprach und acht Prozent Trinkgeld gab.
Der zweite war ein Doktor Spelt. Er war Forschungsreisender. Der Laufbursche Reinhold, der mit einem bei einem Arzte bediensteten Zimmermädchen befreundet war, brachte die Nachricht, Dr. Spelt habe die Malaria. Solch interessante Krankheit gibt es sonst in Schlesien nicht; sie ist dort so selten wie der Löwe im Zoologischen Garten. Doktor Spelt war ein magerer, gelbhäutiger, aber sehniger Mann. Er hatte einen so verzwickten Gesichtsausdruck, dass niemand wusste, woran er mit ihm war. Von Religion war dem Gesicht nichts abzulesen; wenn Doktor Spelt überhaupt welche hatte, musste sie ganz und gar inwendig stecken. Politisch aber verriet sich der Doktor; denn er trank Achtzehner, woraus ersichtlich war, dass er parteilich bedeutend weiter links stand als der Major. Doktor Spelt gab zehn Prozent Trinkgeld.
Der dritte hatte einen polnischen Namen. Er hiess Dr. Lowinsky. Früher war er Gymnasialoberlehrer. Das sah man ganz deutlich. Er war katholisch. Das merkte man auch sehr schnell. Er stammte von drüben her aus den Gebieten, die uns von den Polen genommen wurden. Das hörte man. Er war ein Flüchtling, wohl ein unglücklicher Mensch. Seine Sprache hatte etwas Poetisches und Unbeholfenes, was gut zusammenpasste. Lowinsky gab auch acht Prozent Trinkgeld und entschuldigte sich, dass er es leider nicht reichlicher hätte.
Der vierte hiess Max Kröcklein. Was sein Beruf war, wusste er vielleicht selber nicht. Auch auf seine Religionszugehörigkeit hatte er in den wechselvollen Tagen seines Daseins wahrscheinlich vergessen. Sein Schnurrbart war pechschwarz, aber seine Augenbrauen waren rotblond geblieben. Das zeigte, dass Herr Kröcklein in seinen Berechnungen manchmal etwas flüchtig war. Trinkgeld geben wollte Herr Kröcklein gar keines; denn er berief sich darauf, dass Trinkgelder abgeschafft seien. Als ihn aber der Wirt belehrend auf die jedem Zecher gesetzlich von den Kellnervereinigungen auferlegten Prozente hinwies, gab Max Kröcklein seufzend seine acht Prozent, reduzierte aber dafür seinen gewohnten Weinkonsum von einer halben Flasche auf eine Drittel-Flasche für den Tag.
Das waren die vier Leute, die jeden Tag in der stillen Geschäftszeit von fünf bis sechseinhalb einsam in der Breslauer Weinstube sassen. Der dicke Wirt dachte: sie sind stupide oder sie sinnieren, was vielleicht dasselbe ist. Die vier aber, die einzeln an den Tischen sassen, hatten ihre schweren Gedanken. Manchmal guckte einer den anderen verstohlen an. Dann hatte er keine „besondere Meinung“ von ihm.
Es ist eine deutsche Eigentümlichkeit, von dem Nächsten „keine besondere Meinung“ zu haben. Manche Leute bringen es durch lebenslange Übung darin zu grosser Meisterschaft.
*
Eines Tages sassen der Major und der Forschungsreisende zusammen an einem Tische. Der Wirt, der gerade wieder einmal aufgewacht war, wunderte sich darüber. Er holte sich eine Flasche von dem Elfer, den er für sich selbst reserviert hatte, und setzte sich in ein Nachbarabteil, wo er die Unterhaltung der beiden belauschen konnte; denn die Schlesier sind neugierig, und es ist gut, wenn ein Gastwirt weiss, was für Gespräche in seinem Lokal geführt werden. Das ist eine Art stiller Polizei.
Der Major erzählte nichts von seinen Kriegserlebnissen; nur ganz nebenher bemerkte er, dass sein linkes Auge „ausgelöscht“ sei und sein rechtes demnächst wohl auch dran kommen werde, wodann er sich als Blinder die Welt nur noch von innen beschauen könne. Der Wirt wunderte sich, dass ein Mensch über solch schwere Dinge so einfach daher reden könne. Eigentlich fand er es etwas frivol; er putzte sich die Brille und freute sich, dass er noch „eine schwache Nummer“ hatte. Der Forschungsreisende sagte nichts als ganz laut: „Herr Major!“
Trank und setzte sein Glas auf, dass es entzwei ging. Der Wirt eilte mit einer Serviette herbei, sagte, dass das gar nichts mache, und notierte sechsunddreissig Mark Schadenersatz. Zwölf Mark kostete ihn ein neues Glas selber. Der Laufbursche Reinhold kam, räumte die Scherben weg und bekam von Dr. Spelt zehn Mark Arbeitsvergütung.
Vom Kriege wollte der Major nichts erzählen. Er sagte, darüber hätten ja eine Masse von Menschen, die nicht dabei gewesen wären, Memoiren und Sachverständigenurteile geschrieben. Das genüge. Aber er zog den Dr. Spelt auf, von seinen Forschungsreisen zu sprechen. Nun, der war auch zurückhaltend; aber dann fragte er, ob der Herr Major etwas über die Insel Djailolo-Djilolo gehört habe.
„Entfernt!“ sagte der Major, „entfernt!“
„Es ist die grösste Insel in der bekannten Hamahera-See.“
„Ja, ja, das kann schon sein,“ sagte der Major.
Und nun erzählte der Dr. Spelt nicht etwa Heldentaten von sich, sondern Dinge, über die der Major grunzte und die den lauschenden Wirt so begeisterten, dass er nun einen heldenmütigen Entschluss fasste, nämlich den Herren eine von den hundertdreiundvierzig Flaschen Zeltinger Auslese, Jahrgang Elf, die er noch im Keller hatte, zu spendieren.
Er näherte sich bescheiden den zweien und sagte:
„Meine Herren, ich freue mich schon lange, dass Sie mich als Gäste beehren. Ich bitte, dass Sie mich als Wirt mal anhören. Ich habe noch eine Flasche Elfer Zeltinger Auslese im Keller.“
„Zu teuer!“ wehrte der Major ab, „zu teuer!“
„Herr Major wollen gestatten ...“
„Woher wissen Sie, dass ich Major bin?“
Der Wirt meckerte verlegen.
„Ja — Herr Major sind allgemein bekannt — so vom Kriege her ...“
„Blech!“ sagte der Major, „Blech!“
„Und dann der Herr Doktor ...“
„Woher wissen Sie, dass ich Doktor bin?“
„Je — ahi — na, das spricht sich so rum. So von den fernen Inseln ...“
„Lieber Herr Wirt, Sie sind ein guter Menschenbeobachter. Und was ist nun das mit dem Elfer Zeltinger?“
„Eine einzige Flasche habe ich — eigentlich Privateigentum — meine Frau hat sie mir mal zum Geburtstag geschenkt — ich hatte mir nun gedacht, wenn mir die Herren als Stammgäste gestatteten, mir als Wirt, sie Ihnen von mir aus zu kredenzen ...“
„Nee,“ sagte der Major, „geht nicht! Geburtstagsgeschenk — nee!“
„Geht doch!“ rief Dr. Spelt, „holen Sie die Flasche, freundlichster aller Herbergsväter! Der Oderstrom wird Ihren Ruhm bis an den Ozean tragen, der die Ostsee heisst. Vorausgesetzt natürlich, dass Sie uns den anderen Elfer, den Ihnen Ihre Frau wahrscheinlich auch zum Geburtstag geschenkt hat, gelegentlich zu reellem Preise verkaufen.“
Der Wirt beteuerte, anderen Elfer hätte er nicht mehr, holte verdrossen die eine Flasche und ärgerte sich, dass die Herren immerfort lachten, als sie den guten Tropfen tranken.
So fanden sich der Major und Doktor Spelt zusammen.
Fünf Tage später sass auch Dr. Lowinsky bei ihnen. Der Major hatte zwar gesagt, er bekomme Krämpfeanwandlungen, wenn er einen polnischen Namen höre; aber er war im tiefsten Herzen versöhnt, als ihm Dr. Spelt erzählte, Lowinsky hätte an der rechten Hand nur noch zwei Finger, die anderen drei hätten ihm polnische Schurken weggeschnitten. Der Major sah mit dem einen Auge, das noch etwas Licht hatte, mit einer gewissen Zärtlichkeit auf Lowinskys verstümmelte Hand, erhob sein Glas und sagte:
„Na ja — so geht’s halt! — Prosit!“
Der einzige, der von den vier Stammgästen der Weinstube vom allgemeinen Tische noch ausgeschlossen war, das war Herr Max Kröcklein. Aber er kam auch heran und das geschah so:
Es war rauhe Zeit. Der Winter wollte nicht zu Ende gehen. Kalt kam der Ostwind von Polen her. Der Major trat in die Weinstube, prüfte das Thermometer und sagte:
„Nur vierzehn Celsius. Na, Herr Wirt, zum Molligsein ist das beim Stillsitzen nichts.“
„Die Kohlen, Herr Major! Es gibt keine. Auch keinen Koks.“
„Weiss ich! Morgen holt meine Wirtin den letzten Kasten aus dem Keller. Dann verwandeln wir uns in Gefrierfleisch. Die Republik sorgt!“
Die drei, die alle im Leben viel gesehen und erlebt hatten, sassen nun zusammen und sprachen von nichts anderem, als dass sie keine Kohlen hätten. Dr. Spelt, der Forschungsreisende, der an südliche Temperaturen gewöhnt war, sagte, selbst dreifache Unterwäsche nütze nichts gegen diese Fröste, den grössten Teil der Zeit müsse er im Bette liegen. Lowinsky meinte, dass am meisten sein Foxhund zu bemitleiden sei; dem hätten die Polen zum Spasse ein Ohr abgeschnitten. Das sei aber nur ein vorübergehendes Leiden gewesen. Jetzt aber friere das arme Tier andauernd. Foxe brauchten Wärme. Oh, sagte da Dr. Spelt, da solle er erst den Affen sehen, den er mitgebracht habe, der drehe in seiner Abwesenheit immer alles elektrische Licht an, selbst bei hellem Tage. Den Affen wärme das nicht, aber ihn koste das ein Heidengeld. So sprachen sie von der Wärme, die jedes Lebewesen braucht und die damals in Deutschland fehlte. Der Wirt kam und nickte von ferne schwermütigen Beifall.
„Die Kohle! Die Kohle! Und keine zu haben, auch für viel Geld nicht!“
Da stand Herr Max Kröcklein, der einsam am Nachbartische vor seinem Glase Rotwein sass, auf, zog ein Notizbuch, zückte einen Bleistift und sagte:
„Entschuldigen die Herren! — Wieviel Kohle belieben der Herr Major?“
„Wieso? Wieso? — Können Sie denn?“
„Ja, ich kann! Zunächst allerdings nur das Notwendigste. Für jeden der Herren zwanzig Zentner, wenn das recht ist.“ „Zwanzig Zentner? Das können Sie verschaffen? Wann?“ „Morgen Abend. In der Dämmerung. Alles ganz reell, meine Herren. Aber Dämmerung muss sein, wenn man Kohle abfährt, sonst wird man geplündert.“
„Tüchtiger Mann! Wenn ich an meinen Fox denke ...“
„Und ich an meinen Affen ...“
„Und ich an meine Weingäste ...“
„Also, wollen die Herren?“
Ja, sie wollten alle. Auch der Major.
Sie waren nun begierig, ihren Namen, ihren Stand und ihre Wohnung an den wichtigen Mann, der vor ihnen stand, anzugeben, aber Herr Kröcklein winkte ab.
„Das ist nicht nötig, meine Herren. Ich weiss ganz genau, wer Sie sind und wo Sie wohnen.“
Da wurde er mit Zuvorkommenheit an den Stammtisch geladen, und der hocherfreute Wirt sagte, er erinnere sich jetzt doch, dass er noch Elfer habe. Darauf gab er eine Flasche zum besten, und jeder der anderen vier Herren gab auch eine; denn es ist löblicher Brauch in Deutschland, dass alle, denen etwas „zum besten“ gegeben wird, auch solange etwas „zum besten geben“, bis jeder das Seine richtig beglichen hat.
*
So sassen sie manchen Abend beisammen. Sie erzählten oder schimpften und politisierten, was damals in Deutschland dasselbe war. Manchmal lachten sie auch. Aber es war nicht das Lachen, das aus leichtem Herzen, aus ungehemmter Lebenskraft und Freude kommt. Dieses Lachen war wie eine Blume ohne Duft, wie ein Sonnenstrahl ohne Wärme. In diesem Lachen war immer ein Ton von Gram, Hass, Verachtung. Wenn die vier aber doch einmal unversehens herzlich gelacht hatten, dann fasste es jeden bald darauf an wie Reue. Die kalte Hand der Zeit legte sich auf die Stirnen, die Augen verloren den Glanz.
„Was nutzt das alles?“
Bei dieser gramvollen Frage sank jeder in seinen Kummer zurück. Da sassen sie als ein Trüpplein Geschlagener, so wie im ganzen Deutschland damals die Menschen sassen, ohne Freude, ohne Begeisterung, ohne Hoffnung, ja, fast ohne Interesse am eigenen Schicksal.
Nach 1918 war Deutschland wie vom Schlage gerührt. Ein hilfloses, lallendes, mit halbgelähmten Gliedern krabbelndes Wesen, bösen Bettlerblick in den Augen, das Betteln nach aussen, das Bösesein nach innen gerichtet.
So war es.
Wer hat wohl von den vieren angefangen, dass es so nicht weitergehe, dass es nicht mehr lange zum Leben? Es ist gleich, welcher es war. Jedenfalls eine halbe Stunde, nachdem die Frage aufgeworfen war, lagen vier Bekenntnisse auf dem Tisch.
„Es geht nicht mehr! Es langt nicht mehr!“
Keiner schämte sich das auszusprechen. Es war damals in Deutschland eine Ehre, arm zu sein. Reich war mit wenig Ausnahmen nur das Gesindel; freilich war das Gesindel zahlreicher denn je.
„Es langt nicht mehr!“
Das ist wie die grauenvolle Erkenntnis des Wüstenwanderers; das Wasser geht aus, oder wie das Erschrecken des Kranken: das Herz will nicht mehr durchhalten. Das Ende wird sichtbar — es langt nicht mehr!
Dr. Lowinsky sagte: „Ich bekomme ja mein Gehalt von der Negierung, aber alles, was ich besass, habe ich bei der Flucht verloren. Ich besitze an Wäsche nur drei Hemden, vier Taschentücher und ein paar Kragen.“
„Zu wenig für einen Herrn wie Sie,“ sagte Herr Kröcklein, der aus der wehmütig feierlichen Stimmung herausfiel. „Viel zu wenig! Wenn Sie vielleicht was in Wäsche kaufen wollen, Herr Doktor, ich habe meine Beziehungen.“
Lowinsky nahm das Angebot sofort an.
„Gestern habe ich ’n Tigerfell verkauft,“ sagte Dr. Spelt; „hätte nie gedacht, dass ich mich von der alten Katzenhaut, die doch beinahe einmal mein Sarg geworden wäre, je trennen würde. Na ja — hin ist hin! Jetzt liegt ’ne dicke Schiebermadam auf dem Felle, das ich mir aus den Dschungeln holte.“
„Möge sie das gelbe Fieber kriegen!“ rief Kröcklein. „Die Konjunktur ist elend. Wenn ich mal von mir reden darf: Von Hause bin ich Schiffskoch. Bitte um Entschuldigung, meine Herren, dass ich nichts Besseres gewesen bin und nun in dieser vornehmen Gesellschaft ...“
„Quatschen Sie nicht, Kröcklein!“
„Sehr freundlich, Herr Dr. Spelt! Sehr verbunden! Also Schiffskoch. Wie die deutsche Flotte kaput ging, ging ich leider auch mit kaput. Ich lag auf dem Lande wie ein Fisch im Sande. Na, was soll ich machen? Ich muss doch leben. Ich hab’ halt, was jetzt so alle machen, zu handeln angefangen. Aber die Konjunktur ist elend, obwohl ich überall meine Beziehungen habe. Ehrlichkeit ist nicht mehr. Vorgestern kauft ich im „Böhmischen Prälaten“ einen Zentner Rohkaffee. Am nächsten Tage fällt der Kaffee um zehn Prozent. Ich lache und denke: Falle nur; wirst schon wieder steigen! Ja, steigen! Länger als vierzehn Tage hielt ich mit meinen Kapitalien nicht durch. Ich musste meinen Kaffee mit fünfundzwanzig Prozent Verlust verkaufen. Kaum ist er weg, da klettert der Kaffee wie ein Klammeraffe in die Höhe. Wo bleibt da die Ehrlichkeit in Handel und Wandel? Der kleine Geschäftsmann wird zermahlen. Mit Seife bin ich gerade mit einem blauen Auge davon gekommen; nur in chirurgischen Instrumenten habe ich einen netten Gewinn erzielt. Auch habe ich vermittelt eine Jagdpachtung, einen Pianoverkauf und eine Heirat, das alles aber nur mit Gewissensbissen; denn für die Auftraggeber kommt dabei kaum etwas Gescheites heraus. Von der Kriminalpolizei bekam ich eine Belohnung, weil ich mir ganz gut denken konnte, wer bei Fischer & Co. eingebrochen hat; aber glauben Sie, dass Dr. Tarrasch, auf den ich gewettet hatte, im Schachwettkampf auf Cuba gesiegt hat? Capablanca hat ihn geschlagen; das allein bedeutet für mich tausend Mark minus. Auf alle mögliche Art versucht man, sich ehrlich durchs Leben zu schlagen; aber es wird immer schwerer.“
„Vielseitiger Mann!“ sagte Doktor Spelt.
„Scheusslicher Schieber!“ dachte der Major. „Passt natürlich absolut nicht in unseren Kreis.“
„Also ich rechne auf Ihren Beistand wegen der Wäsche, lieber Herr Kröcklein,“ flüsterte Dr. Lowinsky.
*
Eines Abends war der Major grimmigster Laune.
„Also, man will mir meine Wohnung wegnehmen. Zwei Zimmer, meine Herren, die gönnt man einem halbblinden Offizier nicht mehr. Ich habe nämlich da oben im Gebirge in Giessbrunnen noch ein Haus von meiner seligen Mutter her. Schönes Haus mit zwölf Zimmern, Stallung und so. Ich bewohne es aus Privatgründen nicht. War seit 14 nicht mehr dort. Nun kriege ich heute einen amtlichen Wisch, zwei Wohnungen dürfe ich nicht haben, entweder müsse ich das Haus in Giessbrunnen hergeben oder meine Breslauer Behausung. Ist das nicht unerhört? Wohnungsnot! Anno 14 haben fünfundsechzig Millionen Menschen in den Wohnräumen Platz gehabt, in denen jetzt knapp fünfzig Millionen nicht mehr unterkommen. Das ist, weil jeder zwanzigjährige Lausejunge heiraten darf.“
Die anderen liessen das Gewitter austoben.
„Himmeldonnerwetter, mir liegt ja an der Spei-Grossstadt gar nichts. Alle Tage lesen müssen: ‚Massen heraus!‘ und ‚Das verhungernde Proletariat‘ und ‚Grosser Rummel im Lunapark‘ und den ganzen Kinodreck und all den Tanzbums — raus! Aber wohin? Ich wollte aus Privatgründen nicht nach Giessbrunnen, und schliesslich kann ich mir doch auch nicht mein Leben lang dort bloss immerfort die Vogelkoppe und den Finkenwald ansehen.“
Alle schwiegen. Nur Herr Kröcklein bemerkte bescheiden:
„Mir ist’s ganz ähnlich gegangen.“
„Haben Sie auch ein Haus im Gebirge?“ knurrte ihn der nervöse Major an.
„Nein, Herr Major — nein, Gott bewahre, ich bin ja ein armer Mann; aber ich hatte auch zwei Wohnungen — eine draussen im Süden auf der Augusta-, eine draussen im Norden auf der Kreuzburger Strasse. Geschäfts halber! Auf der Augustastrasse haben sie mich rausgeschmissen und auf der Kreuzburger Strasse sind grosszügige Geschäfte nicht zu machen. Keine Gegend!“
„Ich gehe nach Hause!“ sagte der Major und stand auf.
Dieser Kröcklein widerstrebte seiner alten Gesellschaftsseele erschrecklich. Kröcklein hatte ein entferntes Gefühl dafür. Er sagte:
„Ich wollte mich natürlich mit dem Herrn Major nicht vergleichen; ich hatte nur eine plötzliche Idee, wie das mit den zwei Wohnungen des Herrn Major zu machen wäre.“
„Eine Idee haben Sie? Was für eine?“
Der Major zog den Mantel wieder aus und setzte sich.
„Ich meine, ich bin ja nur ein untergeordneter Mensch mit Volksschulbildung und ein bisschen Berufsschule in ...“
„Quatschen Sie nicht, Kröcklein!“
„Sehr verbunden, Herr Dr. Spelt, sehr verbunden! Ich meine, dass es dem einzelnen schlecht geht, liegt hauptsächlich daran, dass er einzeln ist. Tun sich mehrere zusammen, gleich geht’s besser. Bedeutend besser, meine Herren! Ich dachte nun, wie es wäre, wenn Herr Dr. Spelt, Herr Dr. Lowinsky und meine Wenigkeit sich zusammentäten, dem Herrn Major sein Haus in Giessbrunnen abmieteten und dort gemeinsame Wirtschaft führten. Wir kämen bei eigener Wirtschaft, meine Herren, sicher mit fünfzig Prozent Ermässigung bei viel besserer Verpflegung aus, als wenn jeder für sich im Restaurant speist. Der Ökonom wollte ich gerne sein, einkaufen, einrichten, kochen, backen. Ich kann ja das als früherer Schiffskoch. Und wenn wir das Haus in Giessbrunnen mieteten, könnten Herr Major seine Wohnung in Breslau ruhig behalten.“
Sie waren alle verblüfft über den Vorschlag, den dieser Mann machte, Dr. Spelt und Dr. Lowinsky sagten beide nicht viel; sie sagten nur „Hm!“ „Ach ja!“
Der Major aber sah Kröcklein etwas freundlicher an und sagte:
„Das sind Gedanken, die man sich beschlafen muss. Morgen Abend wollen wir darüber sprechen. Ich danke Ihnen, meine Herren!“ Und ging.
*
Wer je einmal längere Zeit Gast an einem Stammtische war, wird diese Beobachtungen gemacht haben:
Stammtische sind Fabriken für Philistertum mit Spiritusbetrieb;
Stammtische sind Auskunfteien über alle Nichtanwesenden und Aburteilungsgerichte ohne Untersuchung und ohne Erbarmen;
Stammtische sind Nachrichtenbüros über alle möglichen politischen, wirtschaftlichen und privaten Dinge, ohne dass (klugerweise) Gewähr geleistet wird;
Stammtische sind Paradeplätze für alle Dilettanten, die dort ihre Rednertribünen aufrichten, sei es in politischer, literarischer, philosophischer oder Gott weiss für einer Richtung. Oft haben sich die Wortführer aus einem den anderen unbekannten Buch oder aus einer Zeitschrift oder auch nur aus dem Konversationslexikon auf ein Thema, auf das sie dann geschickt die Rede hinlenken, vorher „präpariert,“ worauf sie die anderen als kluge Köpfe einschätzen.
Aber Stammtische haben auch ihr Gutes, wie alles in der Gotteswelt sein Gutes hat:
Stammtische sind Zufluchtsplätze aus häuslicher Enge oder junggesellenhafter Einsamkeit, kurz, Sammelplätze für irgendwie Einsame;
Stammtische sind Inseln im ungemütlichen Lebensmeere mit fast häuslicher Behaglichkeit;
Stammtische bringen zuweilen Belehrung oder Anregung, manchmal auch etwas Trost und immer Ablenkung.
Der Major hielt seine Stammtischrede. Er führte aus: Das ganze Unglück Deutschlands komme von der Uneinigkeit des Bürgertums her. Die Macht des Proletariats beruhe auf seiner straffen Organisation. Der Prolet gehöre von der Wiege bis zur Bahre der Sozialdemokratie par ordre du Mufti an, ob er wolle oder nicht. Nach Wunsch und Meinung werde er nicht gefragt. Die Sache sei einfach Zwang. Niemand solle hoffen, dass aus der Scheidung der Proleten in drei Lager eine Schwächung des proletarischen Gedankens erfolgen könne. Im Grunde seien alles gleiche Brüder, nur unter etwas dunkler oder heller rot gefärbten Kappen, alle mit der Parole: Tod dem Bürgertum! Die Methoden seien verschieden; die einen wollten kurz zum Schiessprügel oder Knüppel oder Messer greifen, die anderen wollten die sogenannte Bourgeoisie wirtschaftlich langsam umkommen lassen. Jedenfalls: Tod dem Bürgertum, sei die Losung aller. In grosser Majorität ständen der Sozialdemokratie die bürgerlichen Parteien gegenüber. In Wahrheit müssten sie die Herrschenden sein. Aber in jämmerlicher Zerrissenheit hätten sie überhaupt keine auch nur lose Zusammengehörigkeit. Zersplittert, rechthaberisch, ketzerrichterisch, eigensinnig ihre Parteisuppe kochend, würden sie eines Tages der sozialistischen Minorität zur leichten Beute werden.
Die anderen widersprachen nicht. All das, was der Major gesagt hatte, waren bekannte Gedanken, aber der Major brachte sie temperamentvoll und gut vor. Er fuhr fort:
„Ich hole da ein bisschen weit aus; aber — Donnerwetter — es gibt keine einzige Frage in Deutschland, die so brennend, so einfach schlechthin die Lebensfrage ist wie die: Ist es möglich, das Bürgertum zu einigen? Ist es möglich den Doktrinären einzuprägen: Wichtiger als deine Rechthaberei, wichtiger als deine erbärmliche Eitelkeit, die sich parteilich aufplustert, ist das Wohl des ganzen Volkes. Schafskopf! Glaubst du nicht, dass dein bürgerlicher Bruder von der Nachbarpartei eben so klug und anständig ist wie du? Musst du ihn hassen, musst du ihn verfolgen, in Versammlungen an den Schandpfahl deiner Lügen und Verdrehungen stellen, in deiner gottverfluchten Presse alle Tage besudeln und bespeien? Wicht! Du winselst eines Tages unter der Stachelpeitsche des Proletariats genau so wie der andere. Denk’ nur an Russland, wo man das, was Bildung hatte, das, was bürgerlich war, einfach ‚abgekehlt‘ hat. Unter den Heringen mit durchschnittener Kehle liegst eines Tages auch du; ein Prolet packt dich in ein Zeitungsblatt mit deinen eigenen Zankartikeln und frisst dein bisschen Fett.“
Der Major sprach mehr bilderreich als gemässigt; aber die anderen hörten ihm gern zu; denn er sprach nach ihrer Meinung die Wahrheit.
Und der Major behielt weiter das Wort:
„Ja, ich holte ein wenig weit aus, aber es gehört zur Sache, gibt erst die Folie zu dem, was kommt. Herr Kröcklein hat gestern einen Vorschlag gemacht, nachdem wir uns darüber ausgesprochen hatten, dass es eigentlich bei keinem von uns mehr recht hin und her langt, dass man sich ja schon ein Gewissen draus machen müsste, täglich eine halbe Flasche von diesem elenden Gurkenwasser da zu trinken. Sich zusammentun, hat Herr Kröcklein gemeint, gemeinsame Wirtschaft führen! Das würde für alle Beteiligten vorteilhaft sein! Er will seine Fertigkeiten als früherer Schiffskoch zur Verfügung stellen. Die anderen sollen sich eben finanziell beteiligen. Schön! Ich habe mir den Vorschlag eine halbe Nacht und einen ganzen Tag lang überlegt und bin zu der Überzeugung gekommen, dass er vernünftig ist.“
„Ganz meine Meinung!“ rief Dr. Spelt.
„Bravo!“ sagte Lowinsky.
Kröcklein errötete ob des ihm gewordenen Erfolges und verneigte sich.
„Das heisst,“ fuhr der Major fort, „immer cum grano salis. Es ist eben ein Versuch. Der Versuch, ob es vier Bürgerliche mit verschiedener politischer Anschauung und — hm — wie soll ich sagen — hm — ja bisher verschiedener gesellschaftlicher Einschichtung mit einander aushalten, ob sie sich vertragen, sich helfen, sich fördern können. An einen Dauerzustand denke ich nicht, es muss ja jedem mal wieder freier Weg gelassen werden. Ich denke so an eine Art gemeinsamer Notunterkunft während eines Unwetters.“
Keiner der drei anderen sagte etwas. Aus den Mienen schloss der Major, dass seine letzten Worte nicht allgemein befriedigten. So fuhr er fort:
„Ja, meine Herren, aus meiner alten, im Kriege siebenmal gegerbten und vorher schon durch dreissig Jahre zubereiteten Haut kann ich nicht mehr raus. Umlernen, das ist für mich völlig ausgeschlossen. Die Proleten können mich abkehlen, aber mich zwingen, vor ihrer roten Fahne den Hut zu ziehen, das können sie nicht! Aber abgesehen davon, wir haben uns im Verlauf unserer Stammtischbekanntschaft überzeugt, dass wir zwar alle gut bürgerlich, aber trotzdem oder vielmehr eben deshalb politisch recht verschieden orientiert sind. Na, ich bin ’n alter Konservativer, neuerdings etwas verwaschen Deutschnationaler genannt; Dr. Spelt ist demokratisch und Herr Dr. Lowinsky wohl ein überzeugter Zentrumsmann. Was sind eigentlich Sie, Herr Kröcklein?“
„Parteilos, Herr Major, parteilos! Ein Koch muss parteilos sein, weil er für alle die Speisekarten zu bearbeiten hat.“ „Meinetwegen!“ knurrte der Major. Er wollte schon etwas über die „Charakterlosigkeit“ des Unparteiischseins sagen; aber er erinnerte sich noch rechtzeitig, dass er eben über den Parteihader gewettert hatte und auch Herrn Kröcklein sich nicht vergrämen dürfe.
„Meinetwegen!“ wiederholte er. „Im übrigen, zum Deibel, müsste es doch gehen. Es muss doch möglich sein, dass vier Bürgerliche von drei ausgesprochenen politischen Schattierungen und einer Farbenmischkulanz mit einander auskommen. Oder wenn das nicht geht, geht überhaupt nichts mehr — geht Deutschland vor die Hunde! Ich habe mich so offen zu Ihnen ausgesprochen, meine Herren, weil ich mich entschlossen habe, für den Fall, dass Herrn Kröckleins Vorschlag angenommen wird, mit Ihnen nach Giessbrunnen zu ziehen.“ Da gab es freudige Zustimmung und helles Gläserklingen.
„Jawohl,“ sagte der Major, „es muss gehen. Wir müssen im ganz Kleinen beweisen, dass friedliches Zusammengehen der Bürgerlichen, ja Zusammenhausen im engsten Sinne möglich ist. Donnerwetter, wir müssen über den Parteizank wegkommen und können es auch, wenn jeder nur ein paar Löcher zurücksteckt. Weil ich deutschnational bin, müssen Sie mich deswegen gleich ‚krummer Hund!‘, ‚Reaktionär!‘, ‚Volksvampir‘ schimpfen? Weil Dr. Spelt trotz seiner hohen Intelligenz immer noch an dem bankerotten, verwaschenen Demokratismus hängt, brauche ich ihm doch nicht ins Gesicht zu brüllen: ‚Judenknecht! Manchesterling! Abgetakelter Schmuser!‘ Und mit Dr. Lowinsky kann ich ja andere Gespräche führen als über Ignatius Loyola und die Ketzergerichte und das vatikanische Konzil und die Maigesetze. Mit Herrn Kröcklein werde ich nur über die Küche sprechen.“ Der Major glaubte, eine „Friedensrede“ gehalten zu haben, aber er war arg im Irrtum.
Dr. Spelt sagte in mühsamer Beherrschung:
„Herr Major, Ihre politische Meinung in allem Respekt — aber so werden wir uns wohl kaum einigen. Der demokratische Gedanke ist weder verwaschen, noch bankrott, noch ist da etwas von Schmuserei dabei. Bei einer solchen oder auch nur entfernt ähnlichen Partei, wie Herr Major sie zu kennzeichnen beliebten, würde ich nicht sein. Herr Major haben vorher die scharfe Scheidelinie zwischen Bürgertum und Proletariat gezeigt, die ja leider in der Tat da ist. Herr Major haben aber vergessen, dass vor 1918 noch eine andere ebenso scharfe Scheidelinie da war — die zwischen Bürgertum und „oben“. Die hat grausiges Geschehnis ausgelöscht; die Demokratie will verhindern, dass die andere Grenzlinie, die nach unten, nicht auf noch grausigere Art weggeräumt, sondern friedlich überbrückt werde.“
Der Major dachte: „Schmus! — ‚Berliner Tageblatt‘ —“ aber er sagte: „Ich wollte weder Ihnen noch Ihrer politischen Überzeugung zu nahe treten, Herr Doktor. Ich meinte, gerade klipp und klar dargelegt zu haben, dass bürgerlicher Parteizank das grösste aller Übel ist.“
Dr. Spelt lächelte.
„Ich glaube, Herr Major, dass jeder Parteimann so denkt.
Er hätte gern alles Parteigezänk beseitigt, und wenn sich nur alle Gegner zu seiner Ansicht bekehrten, schlösse er gern den tiefsten Frieden.“
Der Major sah stumm in sein Glas. Nun meldete sich Doktor Lowinsky. Der sonst so bescheidene, blasse Mann hatte einen roten Kopf.
„Herr Major, auch ich als Katholik und Anhänger des Zentrums muss gegen einige Ausführungen des Herrn Major Verwahrung einlegen. Über Ignatius von Loyola urteilt der unparteiische Historiker längst anders, als der Herr Major in seinen Schulen, aus seinen Büchern und in seiner Umgebung kennengelernt haben mag. Die Beschlüsse des vatikanischen Konzils kann ein Protestant nicht verstehen, und die Maigesetze waren eine Gemeinheit und eine Dummheit.“
Das war Dr. Lowinskys mutigste Rede all sein Leben lang. Der Major trank in tiefstem Verdruss sein Glas aus.
„Na, und was sagen Sie, Herr Kröcklein?“
Kröcklein neigte schwermütig den Kopf.
„Mir scheint, die Suppe ist bereits versalzen und ausserdem angebrannt.“
„Das scheint mir auch so; meine bürgerlichen Einigungsbestrebungen sind gescheitert,“ sagte der Major. Er grüsste kurz und ging. Die anderen gingen auch.
An den nächsten drei Tagen dachte jeder der vier: Ich gehe nicht hin. Mögen sie warten. Aber es wartete keiner; denn es war ja keiner da.
*
Am vierten Tage um fünfeinhalb Uhr begegneten sich die vier fast unter der Tür der Weinstube. Sie hatten alle ihren Stolz überwunden; denn sie dachten sich, es ist immer noch besser, bürgerliche Kompromisse zu schliessen, als eines Tages, vom Bolschewismus gezwungen, auf der Strasse Streichhölzer zu verkaufen wie in Moskau.
Verlegen gingen sie nach ihren Plätzen.
Der Wirt brachte den Wein.
„Na, zum Wohl!“ sagte der Major. „Ich hatte die drei Tage mal wieder mit meinem alten Schützengraben-Rheuma zu tun, dass sich die Herren nicht wundern!“
„Ja,“ sagte Dr. Spelt, „ich konnte auch nicht kommen. Ein alter Bekannter war da, dem musste ich Breslau zeigen.“
„Ich habe ’ne Nachhilfestunde angenommen,“ sagte Doktor Lowinsky, „sie aber wieder abgegeben.“
„Oh,“ lachte der Major grimmig; „oh, Kröcklein, da haben Sie wohl hier mutterseelenallein gesessen?“
„Pardon, Herr Major, nein, ich konnte auch nicht kommen. Es war ein Geschäftsfreund von mir aus Przeplewoda da.“
„Darf man wissen, womit Sie diesmal gehandelt haben?“
„Mit Karnickelfellen, Herr Major. ’s ist reeller als das Valutageschäft mit Dollars. Mit den Dollars habe ich erst kürzlich dreitausendfünfhundert Mark eingebüsst, mit den Karnickelfellen habe ich siebentausendfünfhundert plus gemacht. Ganz ehrlich, Herr Major; die Felle steigen rasend. Der sie gekauft hat, kann lachen.“
Schweigen. Nach einer Weile Kröckleins Stimme in bescheidenem Tonfall:
„Wenn ich mir erlauben dürfte, mal vier Kognaks zu bestellen — wegen der siebentausendfünfhundert Mark.“
Wurde abgelehnt. Und dann wieder Schweigen und in drei Köpfen die Frage, ob dieser Karnickelfellhändler, der Kognaks zum Besten bot, nun doch nicht ganz und gar aus dem Rahmen fiele, ob man ihn nicht abschütteln müsse.
Dann fing einer an:
„Die Butter kostet jetzt einhundertachtzig, die Margarine schon einhundertfünfundzwanzig.“ — „Die Schneider verlangen für einen Anzug zehntausend Mark.“ — „Neue Schuhe habe ich mir gekauft; sie sind sündhaft teuer, aber dafür passen sie auch nicht und werden auch nicht halten.“ — „Haben Sie Ihre Steuermahnung schon?“ — „Gestern wollte ich meine Zeitschrift abbestellen; aber man will doch nicht geistig versumpfen. Na, habe ich gedacht, drei Fläschlein dem Rheuma zuliebe erspart, geht’s halt noch mal.“ — „Acht Mark haben sie mir für die Privatstunde in Griechisch geboten, ’n Schneidergesell kriegt dreissig.“ — „Ach, lassen Sie mal, der Portier im Theater bezieht nächstens mehr als der erste Tenor.“ — „Schweineschmalz einfach nicht mehr zu haben.“
So sprachen sie. Den Major würgte es im Halse, und er dachte: „Wenn mir so was früher passiert wäre, hätte ich geglaubt, ich sei in den Kaffeeklatsch eines Vorstadtgartens geraten. Weibergetratsch über Marktpreise. Wie komme ich nur aus diesem Sumpf heraus?“