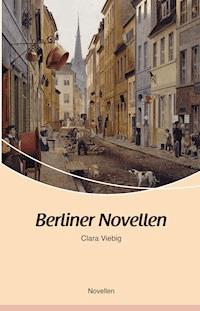Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Die große Erzählerin Clara Viebig hat in diesem Düsseldorf-Roman die Zeit von 1830-1900 beschrieben und dabei die Erfahrungen ihrer Kindheit und Jugend verarbeitet. Sie bietet dem Leser ein Panorama der geschichtlichen Entwicklung dieser Jahre aus der Perspektive der kleinen Leute. Dabei bildet der Gegensatz zwischen Preußischem und Rheinischem ein Leitmotiv, dass den ganzen Roman und das Leben seiner Protagonisten durchzieht. Josefine Rinke, die Tochter eines preußischen Feldwebels und einer Düsseldorferin, wächst in diesem Gegensatz auf, der das gesamte Familienleben bestimmt. Sie erlebt einen Konfessionskonflikt, wie wir ihn uns heute nicht mehr vorstellen können. Dazu kommen die Klassen- und Standesunterschiede jener Zeit, die unter anderem dazu führen, dass ihre Liebe zu Viktor von Clermont, einem Freund aus Kindertagen, vom Vater auf Grund des Standesunterschiedes nicht akzeptiert wird. Der Leser erfährt nicht nur etwas über die Geschichte der preußischen Rheinlande mit dem Feldwebel Rinke, der immerzu hofft, dass endlich einmal ein Krieg ausbricht, sondern auch über das Düsseldorf im 19. Jahrhundert mit seiner verwinkelten Altstadt und den originellen rheinischen-und preußischen-Typen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2014 eBook-Ausgabe 2014 RHEIN-MOSEL-VERLAG Brandenburg 17 56856 Zell/Mosel Tel. 06542/5151 Fax 06542/61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-89801-828-9 Satz und Gestaltung: Cornelia Czerny Umschlagbild: Colorierter Stich eines unbekanntes Künstlers, um 1850, Bibliografisches Institut Hildburghausen Der Text entspricht, außer geringfügigen orthografischen Korrekturen, dem der 14. Auflage von 1904 im Verlag Egon Fleischel & Co., Berlin.
Clara Viebig
Die Wacht am Rhein
Roman
RHEIN-MOSEL-VERLAG
Meiner Mutter zu eigen
Erstes Buch
I
»Kiekt ens an!« rief die Weise Frau.
Sie trat, das in ein buntes Stechkissen eingebündelte Neugeborene auf beiden flachen Händen hinhaltend, es so gleichsam präsentierend, an das Bett, in dem die Mutter auf rot gewürfeltem Kissen lag. Unter einer einfachen, grobhaarigen Decke, über welche ein weißes Laken geschlagen war, ruhte die Wöchnerin.
»Kiekt ens an, Madam Rinke, es dat nit en staats Weit*[1]?!«
Die junge Frau, die bis dahin mit geschlossenen Augen gelegen hatte, rührte sich. Ihr rundes, vollwangiges Gesicht, dem nur die Angst der letzten Stunden ein wenig die Farbe genommen, lächelte.
»Och e ja,« sagte sie erfreut und rückte sich, um ihr Kind besser besehen zu können. Es war ihr erstes Kind. »Wat et für schrumplige Händches hat! Un alles e so rot!«
»Rot?« wiederholte die Weise-Frau, förmlich beleidigt. »Rot?! Kömmert Euch da nit dröm! Weiß es et, weiß wie Allebaster un Lilien. En Haut hat et wie Sammet,« – stolz warf sie sich in die Brust – »Ehr könnt mech dat jlöwe, Madam Rinke, ech han noch nie e so en schön Kink jeholt. Paßt ens op, dat jeht als Engelche mit bei de Prozession!«
Über das lächelnde Gesicht der jungen Mutter flog plötzlich ein Schatten, und sie stieß einen Seufzer aus.
»Jott stonn mech bei, wat es dann noch zu seufzen?!« eiferte Frau Dauwenspeck. »Ehr hat et ja nu hinger Euch, Feldwebelin – un so en staats Weit! Da könnt Ehr wohl in der Lamberteskirch en Kerz für opstecken!«
Die Frau Feldwebel sagte nichts dazu. Sie hatte wieder die Augen geschlossen, aber nicht um zu schlummern, unruhig warf sie den blonden, zerzausten Kopf hin und her.
Kopfschüttelnd trat die Dauwenspeck vom Bett weg an’s Fenster: so eine echte Freude hatte die Feldwebelin doch eigentlich gar nicht! Am Ende weil es kein Junge, bloß ein Mädchen war?! Der Preuße würde sich’s schon in den Kopf gesetzt haben: ›ne Jung‹ – no, natürlich!
»De Leut sin jeck«, brummte sie und sah dabei nachdenklich auf das runde Köpfchen, das schwer und warm in ihrem Arm lag. Mit der freien Linken schob sie die Gardinchen von der schmalen Fensterscheibe zurück. Jetzt, im hellen Licht des Sommertages, sah man erst recht, wie kräftig das Kind war – hochgewölbt die Brust, der Schädel prächtig entwickelt. Entzückt schmunzelnd, prüfte die Weise-Frau das Gewicht: allen Respekt, elf Pfund waren das sicher und gewiß!
»Als ob et immer Junges sein mößten«, brummte sie weiter, »Mädches sin auch wat notz. Wat hätt’ de Adam dann allein op der Welt jemacht?! Pß – sß – bis still, dau lecker Dierke!«
Sie wiegte das kleine Mädchen, das, vom Sonnenlicht getroffen, zu niesen anfing, sanft schaukelnd hin und her, ihren rauhen Baß dabei zum Summen dämpfend:
»Heia Popinke,
Din Motter heißt Kathrinke,
Din Vatter es ene Kappesbuhr
Kömmt de hem, da kiekt de suhr.«
Im Bett rührte sich die Frau nicht mehr, sie war nun doch wohl eingeschlafen. An der niederen Balkendecke des weißgetünchten Zimmers summten die Fliegen; unruhig wirbelten sie um den Stock, der, mit Sirup beschmiert, vom Mittelbalken herabhing.
Es war heiß, Hochsommer. Jenseits des Exerzierplatzes, drüben über’m Kanal, ballte sich eine dicke, dunkle Wolke mitten im lichten Blau. Die vereinzelten Bäume dort rührten sich nicht; wie aus steifem, grünem Papier geschnitten, standen sie starr. Auf dem noch unbebauten Plan jagten sich ein paar große Hunde, scharrten in den Gruben und stürzten dann durstig die Böschung hinunter zum Wasser.
Auf den weiten, staubigen Platz prallte die Sonne; er lag ganz leer, kein Offizier übte mit seinem Pferde dort spanischen Tritt, kein Bursche ließ den Gaul seines Herrn an der Longe laufen, auch keine Mannschaft exerzierte. Alles ausgestorben. Doch horch, jetzt eine Stimme:
»Achtung! Präsentiert das – Gewehrrr!«
No, der war ja wieder gut am Schimpfen, und hier oben war ihm doch ein Kind geboren! Eilig steckte Frau Dauwenspeck ihren Kopf mit der bebänderten Haube zum Fensterchen heraus – richtig, da stand gerade unter’m Fenster eine kleine Anzahl Rekruten, so ein paar Sündenböcke, dicht an der Mauer, um ein wenig Schatten zu haben, und der Feldwebel lief vor ihnen auf und ab in der prallen Sonne und übte selber mit ihnen nach.
»Himmelkreuzsakrament, ihr rheinischen Dickköpfe, wozu sind euch denn die Tatzen an den Leib gewachsen? Immer man feste!«
»Achtung! Gewehr auf – Schulter!«
»Das Gewehrr – über!«
»Pst!« Frau Dauwenspeck neigte sich weiter hinaus. »Feldwebel, he, pst!« Mit beiden Armen streckte sie das Kind von sich und hob es zugleich ein wenig in die Höhe – so mußte er’s sehen!
Er sah es auch. Einen flüchtigen Augenblick schaute er zum Fenster seiner Wohnung hinauf; über sein strenges, braunes Gesicht zuckte etwas wie ein Freudenstrahl, aber gleich darauf fuhr sein Blick wieder rollend über die Soldaten hin.
»Schlaft ihr? Ich wer’ euch lehren, die Kompanie verschimpfieren, ihr Rasselbande! Kopf hoch! Brust ’rraus! Bauch ’rrein!«
»Faßt das Gewehrr – an!«
»Gewehrr – ab!«
Die strenge Stimme tönte über den ganzen Platz und weckte ein hallendes Echo drüben in der stillen Leere jenseits des Kanals.
Indigniert zog sich die Dauwenspeck vom Fenster zurück und ließ sich pustend auf den nächsten Schemel fallen. Das war einer, nicht mal einen Moment kam er heraufgelaufen, sich sein Erstgeborenes anzusehen! Am frühen Morgen schon war er weggerannt, hatte sie mit dem armen Weib in aller Not allein gelassen, und man hätte ihn doch zu einer Handreichung nötig gehabt! ›Käthe‹, hatte er gesagt, und seiner angstvoll blickenden Frau auf die Wange geklopft, ›Courage! Du bist jetzt wie der Soldat vor der Schlacht – man los, man tapfer!‹ Und damit war er gegangen. Ja, die Preußen! Die hatten kein Herz im Leib, die dachten nur an Hauen und Stechen und Schießen!
Die Alte war sehr unzufrieden.
Da waren doch die Pfälzer und Österreicher, die in ihrer Jugendzeit, als Düsseldorf noch Festung gewesen, hier gelegen, ganz andre Leute! Bei der Dame eines Pfälzer Offiziers hatte sie ihre allererste Entbindung gemacht; ausgelernt hatte sie noch gar nicht gehabt, sie verstand’s nur, weil ihre Mutter und Großmutter dasselbe Gewerbe betrieben hatten und ihr Vater ein Barbier- und Ruchwarenlädchen besaß, schröpfte und Zähne zog und mehr Zuspruch hatte wie ein Doktor. Die Dame damals war gar nicht so wohl gewesen wie jetzt die Feldwebelin, aber doch hatte der Pfälzer gesprungen und gepfiffen und einen Zettel an seinen Obersten geschickt: der möchte ihn exküsieren, er könnte heut nicht zum Dienst kommen, seine Frau hätte ein Kind gekriegt. Und Wein hatte er bringen lassen und ein paar Kameraden geladen, da hatten sie auf das Wohl des kleinen Fräuleins getrunken. Und ihr hatte der lustige Herr einen baren harten Taler in die Hand gedrückt, und Geld war doch rar in der Stadt um 1795.
›Käthe‹ – schon allein, daß der Feldwebel ›Käthe‹ zu seiner Frau sagte, war zum Ärgern. Mochten sie in Preußen immerhin ›Käthe‹ sagen, hier am Rhein sagte jedermann ›Kathrina‹ oder ›Trina‹ oder ›Tring‹. Der armen, jungen Frau so den christlichen Taufnamen zu verschimpfieren. Aber was konnte man von dem denn andres erwarten, der war ja ein ›Lutherscher‹! Der Bürger Zillges hätte auch besser getan, seine Tochter einem von hierzulande zur Frau zu geben als dem, der dahergeschneit kam von Gott weiß wo, aus der Sandwüste Berlin. So einem Soldatenjungen, der wohl gar im Marketenderkarren geboren war, beim Troß oder in irgendeinem Festungsgraben. Aber dat Tring war ja wie toll gewesen. Keiner hatte ihr bisher gut genug gedünkt, vierundzwanzig war sie schon geworden, aber sie verließ sich auf ihr rundes Gesicht und des Vaters Geldbeutel. Die Wirtschaft ging flott, und Bürger Zillges konnte wohl was überlegen für sein einziges Kind. Da trat eines Tages der Preuße in die Wirtsstube ›Zum bunten Vogel‹, keck verlangte er ein Kännchen Bier, seine Knöpfe blinkerten, die hohe Binde schnürte ihm fast den Hals zu, er hielt sich so gerade, als hätte er einen Zaunstecken verschluckt und – weg war die Trina, ganz verschossen.
Ne, das hatte keine Art: ein Preuß’, ein Soldat, ein Ketzer! Wenn Düsseldorf nun auch schon leider Gottes seit über ein Dutzend Jahr’ zum Preußenstaat gerechnet wurde, man würde sich selber nie daran gewöhnen. Und so ein Preuße, so ein unverfälschter Berliner, der eben erst vor vier Wochen hier hereingerochen hatte, der sollte die Tochter aus dem ›Bunten Vogel‹ freien?! Die ganze Ratingerstraße geriet darüber in Aufregung. Und konnte man es dem Zillges verdenken, daß er herumging wie ein Ungewitter, und daß Mutter Zillges den teilnehmenden Nachbarinnen ihr bekümmertes Herz ausschüttete? Wer hätte gedacht, daß die Trina so eine halsstarrige Frauensperson wäre?! Sie war doch immer so mollig, so schnuckelig, so ein bißchen bequem gewesen, und nun wollte sie auf einmal in den Rhein springen, wenn die Eltern ihr nicht den Feldwebel gäben. Sie weinte sich die Augen rot, sie verlor förmlich von ihrer Völligkeit, nie mehr vertieften sich die Grübchen in ihren Backen; sie ließ sich gar nicht mehr unten in der Wirtsstube sehen, saß immer oben am Kammerfenster hinter ihren vertrockneten Blumenstöcken und reckte nur den Hals, wenn ein soldatischer Tritt auf dem Pflaster dröhnte, und groß und stramm der Feldwebel vorbeimarschierte, allein oder mit der Wache, die zum Burgplatz zog. Stolz ging er, den Schnauzbart gewichst – ein stattlicher Kerl, das mußte ihm der Neid lassen! Mußte auch sein Handwerk verstehen, denn ›Feldwebel‹, das war doch mehr als ein gewöhnlicher Soldat; und alt war er auch noch lange nicht, vielleicht an die dreißig!
Die Dauwenspeck wußte jetzt nicht mehr, wie es gekommen, daß ihr Herz sich nach und nach für den Preußen erweicht hatte; denn daß er ihr eines Abends, als sie ratlos vor dem die Ratingerstraße halb überschwemmenden Rinnstein stand und sehnsüchtig nach ihrer Haustür hinstarrte, über’s Wasser half, das war doch nur selbstverständlich! Ach, hätte sie lieber nicht bei Mutter Zillges ein gutes Wort für den Preußen geredet, denn – die Alte starrte nachdenklich auf das in ihrem Schoß jetzt sanft schlummernde Kind – war die Trina glücklich geworden?!
Erst schien sie es freilich. Das war eine Glückseligkeit, als der Zillges den Preußen aufgefordert, näher zu treten. Trina hatte kein Wort dazu gesagt, aber den schönen Soldaten immer angesehen mit verschämtem Erröten, die blinkernden Knöpfe hielten sie gebannt; und als er sich verabschiedet, hatte sie ihm das Geleit gegeben auf den Hausflur, bis an die Haustür, und als er dort eben mal den Arm um ihre Taille legte, hatte sie den Kopf an seine Brust fallen lassen und war so eine ganze Weile verblieben.
Oha, die Dauwenspeck wußte das alles ganz genau, nicht umsonst wohnte sie dem ›Bunten Vogel‹ gerade gegenüber. Sie hatte fleißig beobachtet, deutlich gesehen, wenn’s auch schon dämmerte, und was da etwa fehlte, konnte sie sich leicht hinzudenken; man war doch nicht unerfahren. Tagtäglich war er gekommen. Kein Wunder, so ein povrer Preuße, der nichts hatte als seine paar Pfennig Löhnung – die Infanteristen waren doch die allererbärmlichsten, die Husaren in der Neustadt hatten wenigstens ein Pferd – der ließ sich’s wohl sein im fetten Bürgerhaus! Die Frau Zillges kochte vorzüglich, war sie doch guter Leute Kind, eine Tochter aus der ›Stadt Venlo‹ in der Ritterstraße, wo der berühmte Mostrich herkam. Eine Mostertsauce zum fetten Rindfleisch verstand sie zu rühren, so lecker, daß auch ein andrer als der hungerleiderige Preuße wohl schlecken mochte! Und ›Stühl und Bänk‹*[2] kochte ihr keiner nach. Es dauerte nicht lange, und der Brautschleier wurde in Auswahl genommen, und die goldenen Ringe wurden bestellt bei Schmitz im ›Blumenkörbchen‹. Bald danach trug Zuckerbäcker Troost aus dem ›Heiligen Apollinarius‹ in der Altestadt den Hochzeitskuchen in den ›Bunten Vogel‹, und ein Rudel Kinder lief hinterdrein, um den Krokantaufsatz mit dem Amörchen im Taubenwägelchen auf der Torte anzustaunen.
Die Trina war eine strahlende Braut gewesen. Ihr Gesicht glühte, als sie neben ihrem Feldwebel in die Kirche trat. Der stand stramm in der Paradeuniform. Aber Peter Zillges schien grauer geworden, und Frau Josefine Cordula duckte den Kopf; wie die armen Sünder schlichen die beiden Eltern hinterdrein. Ja, das war nicht so leicht, das einzige Kind, auf das sie elf lange Ehejahre geharrt hatten, zur Trauung gehen zu sehen, denn weder die Glocken von Lambertus läuteten, noch von St. Andreas, noch von der Jesuiterkirche, noch von der Maxpfarre – die Trina hatte eingewilligt, ihre Kinder ›lutherisch‹ werden zu lassen! ›Denn‹, hatte der Preuße gesagt und dabei die Faust fest auf den Tisch gestemmt, ›Soldatenkinder müssen beten, wie ihr König betet.‹ Darauf bestand er, da halfen keine Vorstellungen. Herr jemine, hatte der Zillges geschimpft – die Kinder Ketzer – nie! Aber, ›na, denn nich‹, hatte der Preuße gesagt, ›denn wird aber auch nicht geheiratet.‹ Was sollte der Zillges machen? Die Trina schrie und fing wieder an, mit dem Rhein zu drohen, sie wollte schon aus der Tür laufen, der Vater kriegte sie noch gerade beim Arm zu fassen; und die Mutter weinte mit ihr. Das war eine Tränenflut zum Versaufen.
Ein kleiner Trost war’s, daß die Garnisonkirche, in der die Trauung stattfand, ›Sankt Anna‹ hieß; da wurde auch gut katholisch drin gebetet, sie diente beiden Konfessionen. Und das mit den Kindern – ei, kommt Zeit, kommt Rat, vorderhand wollte man sich nun darüber nicht mehr grämen.
So waren Feldwebel Friedrich Rinke und Jungfer Kathrina Zillges zusammengesprochen worden ohne Weihrauch, ohne Gesang – gar keine richtige Trauung, und doch war heute prompt, wie es sich gehörte, das erste Kind einpassiert.
»Du arm Ditzke!« Mitleidig schlug Frau Dauwenspeck ein Kreuz über Stirn und Brust des Neugeborenen. Das schöne Kind, Sünde und Schande, wenn seine Seele dereinst nicht selig werden sollte!
Ein schwerer Tritt drückte die Holzstiege nieder, die zur Feldwebelwohnung emporführte, man hörte das Knarren – aha, nun kam er! Die Dauwenspeck setzte sich in Positur. ›No‹, wollte sie zu ihm sagen, ›endlich!‹ Bah, vor dem hatte sie noch lang keine Angst! Mutter Zillges hatte immer eine dumme Scheu vor dem Schwiegersohn. I, warum nicht gar? Ein richtiges rheinisches Mundwerk ist so einer Berliner Schnauze noch lange gewachsen. Der sollte sich nur mal trauen, sie schief anzugucken! ›Seid Ehr jeck?‹ würde sie dann sofort sagen, ja, das würde sie – ›Ehr seid ja je – ‹
Sie fuhr zusammen; schon war er eingetreten. Mit einem großen Schritt stand er neben ihr. Ohne weiteres nahm er ihr das Kind aus dem Arm, hielt es vor sich und betrachtete es lange, ohne Wort. Ein Freudenglanz breitete sich über sein Gesicht, weich wurden seine strengen Züge.
Die Dauwenspeck sah ganz verdutzt drein, sie hätte es nicht für möglich gehalten: war das ein verliebter Vater!
»Ein Prachtbengel«, sagte er endlich, und in stolzem Glück leuchteten seine Augen, »ein Prachtbengel!«
»En Prachtmädche, met Verlöw«, sagte die Dauwenspeck. Aber sie sagte es nicht ohne Besorgnis – der würde ihr wohl bald den Kopf abreißen!
Sie hatte sich geirrt. Wohl flog’s erst wie Enttäuschung über sein Gesicht, aber er faßte sich rasch: »Na, wenn schon! Denn also: ein Prachtmädel! Sie wird Preußen wackre Soldaten schenken.«
Und er bückte sich und küßte sein kleines Mädchen.
Draußen fingen die Glocken an zu läuten, von St. Lambertus, von St. Andreas und wie die Kirchen alle heißen.
»Wat läuten se denn eso?« fragte die junge Frau, jäh aus dem Schlummer auffahrend.
Ihr Mann trat an’s Bett; sich über sie beugend, nahm er ihre Hand in die seine. »Na, Käthe«, sagte er gut gelaunt und klopfte ihre bleiche Wange – »na, Mutterchen?!«
»Wat – läuten – se – so?« wiederholte sie wie im Fieber.
»Na, Mittag!«
Mit einem Seufzer schloß die Müde wieder die Augen.
*
Und die Glocken der Stadt läuteten weiter. Zur Hochzeit des Feldwebels hatte keine einzige geläutet; jetzt riefen sie alle mit schallender Stimme, von all den vielen Kirchen und Kapellen, hoch und hell, voll und tief, über Straßen und Dächer, über Höfe und Gärten, in lautem, vielstimmigem Chor.
Sie begrüßten mit Freuden des Feldwebels Tochter: ein rheinisches Kind.
[1] Mädchen
[2] Alt-Düsseldorfer Gericht, bestehend aus weißen Bohnen, Mohrrüben und Kartoffeln.
II
Vierzehn Tage später, an einem August-Sonntag 1830, wurde Josefine Rinke getauft.
Der Feldwebel hätte seine Erstgeborene gern Luise genannt, nach Preußens geliebtester Königin, aber es wurde als ganz selbstverständlich angenommen, das Kind mußte einen Namen von Großmutter Zillges führen; und so wollte er seinem erst eben genesenen Weib, das ohnehin leicht flennte, diesen Kummer nicht auch noch antun. War es Trina doch Kummer genug, daß sie die Taufe nicht mit einem Fest feiern sollte, wie sie es gewohnt war bei weit geringeren Anlässen. Im ›Bunten Vogel‹ hatte man gern gefeiert; es gab so viel Heiligentage, so viel fröhliche Gelegenheiten. Und wenn man sich nur einen ›Spaß‹ machte, Bratäpfel und Kastanien schmauste, sobald der erste Schnee fiel, oder singend über flackernde Lichtstümpfchen hüpfte.
Nun sollte nicht einmal die Taufe der kleinen Josefine mit einem Essen begangen werden, zu dem man Gevattern und Freunde einlud! Ein größerer Gefangenentransport war nach der Festung Wesel zu eskortieren; statt des plötzlich erkrankten Offiziers hatte man Rinke das Kommando angeboten, und er hatte es angenommen. Hätte er’s nicht ebensogut ablehnen können, die Taufe seines Kindes war doch Grund genug?! Aber nein – Frau Trina war außer sich – annehmen mußte er’s, aus purer Eitelkeit! Und wenn’s denn schon sein mußte, so hätte man ja doch die Taufe verschieben können, um ein, zwei Tage bloß; aber nein, auch das nicht, der einmal festgesetzte Termin mußte innegehalten werden. Weil der Garnisonspfarrer am Sonntag nach der evangelischen Kirche ein halb Dutzend Soldatenkinder zusammen taufte, mußte das Finchen auch ’ran. Das arme Finchen, das kriegte ja gar keine richtige Tauf’!
›Wenigstens en Tass’ Kaffee mit Bollebäuskes und Rodon,‹ hatte sie schluchzend ihren Mann gebeten, ›un nachher e Jläsche Wein! Un nur en paar jute Bekannte derzu! Dat können mer doch auch ohne dich, da brauchst du ja jar nit bei zu sein!‹
›Ob ich ›bei‹ bin oder nicht,‹ hatte er gesagt, ärgerlich ihre Sprechweise nachahmend, ›ich will den Sums nicht! Schlicht getauft, weiter was ist nich nötig!‹ Die Feldwebelin hatte sich bitter bei ihrer Mutter beklagt.
Schmerzlich bewegt schritt Frau Zillges heute mit der Tochter und der getreuen Dauwenspeck, die den Täufling trug, zur Kirche. Sie kamen ein wenig zu früh, aber sie standen lieber draußen vor der Tür und warteten, als daß sie eingetreten wären, wozu der Küster sie leise aufforderte.
Es fing an zu regnen, ein kühler Gewitternachregen war’s; das Pflaster der Kasernenstraße trat sich unangenehm schlüpfrig. Die junge Frau trippelte blaß und fröstelnd hin und her, ihre blauen Augen irrten verdrossen die Straße auf und ab: ach, gar nichts zu sehen! Nur ein paar Soldaten in Drillichjacken guckten gelangweilt aus den Fenstern rechts und links von Sankt Anna.
Die Dauwenspeck schlug einen Zipfel ihrer Mantille über den Täufling und drückte sich, so sehr sie konnte, auf der Schwelle der Kirche unter die etwas vorspringende Eingangsbedachung.
Mutter Zillges stand unbeweglich und schien des Regens nicht zu achten, der ihre Haube näßte; sie war in Gedanken versunken. Für eine, die schon einige Jahre die Fünfzig hinter sich hatte, war ihr Gesicht merkwürdig glatt geblieben, dies freundliche, behagliche, zufriedene Gesicht. Heut sah man doch, daß es auch schon Runzeln hatte. War’s denn nicht auch zu traurig? Solch eine Taufe! Der Vater nicht zugegen, der Großvater nicht zugegen – was sollten die Leute wohl denken, daß der Zillges nicht gekommen war? Jemand Fremdes zu Gevatter zu bitten, hatte man ja ohnehin bei so einer Taufe gar nicht gewagt. Frau Josefine Cordula fühlte sich heut wirklich unglücklich, sie konnte sich nicht erinnern, je in ihrem Leben unglücklicher gewesen zu sein, nicht einmal, als ihre Eltern starben. Da hatte der Weihrauch die ›Stadt Venlo‹ durchweht wie ein sanft tröstender Hauch des Himmels. Heut aber, hier auf der regenfeuchten Straße, angesichts einer Taufe, die eigentlich gar keine war, versagte ihre Fassung. Hatte ihr zu alledem doch noch Zillges heute morgen erklärt, als er das bedrohliche Wetter sah, sie solle nur allein zu der ›Ketzerei‹ laufen, er ginge nicht mit. Sie hatte ihn ›bequem‹ gescholten, sogar mit ihm gebrummt, was selten vorkam, aber der sonst so gemütliche Peter blieb dickköpfig. Nein, wenn der nicht wollte, dann wollte er nun mal nicht. Überdies hätte er Leibschmerzen, sagte er.
Wenn Frau Zillges es recht bedachte, verdenken konnte sie ihrem Peter sein Fernbleiben eigentlich nicht, der Rinke hatte ihn doch zu sehr geärgert. Freilich hatte die dumme Trina in der ersten Verliebtheit jedes Zugeständnis gemacht, aber nun hätte Rinke doch auch ein bißchen mit sich reden lassen können: wenigstens halb und halb – die Mädchens nach der Mutter, die Jungens nach dem Vater! Mutter Zillges hatte die ganzen vierzehn Tage seit der Geburt der Kleinen gehofft, der Feldwebel werde sich besinnen und das Kind durch eine heilige Taufe den wahren Gläubigen zugesellen.
Sie hatte ihre Tochter, die ja immer ein bißchen lässig war und gern Unangenehmem aus dem Weg ging, beschworen, ihrem Mann ernstliche Vorstellungen zu machen.
Trina behauptete auch, das getan zu haben: aber ›er is doch nu ens so,‹ hatte sie gejammert, ›ich krieg ihn nit derzu. Wat soll ich dabei machen? Laßt mich zufrieden!‹
Ach, ach, es war aber auch alles zu ärgerlich! Frau Zillges biß sich auf die Lippen; sie wurde nicht gleich so grob wie ihr Mann, aber wenn sie den Rinke jetzt hier gehabt hätte, glaubte sie sich imstande, ihm ordentlich den Text zu lesen. Jedes harmlose Pläsier verdarb einem der Preuße!
Während der ganzen ersten Hälfte der Ansprache, die der Pastor hielt, dachte sie darüber nach, warum sie eigentlich für einen so betrüblichen Tag einen so großen Zwetschgenkuchen gebacken hatte und einen so leckeren Platz mit Korinthen. Wie konnte man denn essen, wenn man so traurig war? Aber sie wußte selbst nicht, wie ihr geschah, war es der Anblick des Kindchens, das, ganz so rund und blond wie die Mutter, brav schlummerte, die kleinen Hände zu Fäustchen geballt? Das nicht einmal aufzuckte, als die kalten Wassertropfen den zarten Flaum seines Köpfchens besprengten? Sie bekam freundlichere Gedanken.
Und hier der Hochaltar von Marmorstein, den man von den frommen Cölestinerinnen hergebracht – und da der heilige Johannes Nepomuk und dort in der Nische die heilige Anna! Nein, noch war nicht alles verloren! Ihre Stirn glättete sich; sie sah nieder: ei, so ein klein lecker Stümpken! Akkurat so hatte ihr einst das eigne Kind, die kleine Trina, im Arm gelegen, wie hatte da ihr Herz vor Freuden geklopft! Und nun war sie Großmutter! Ihr Herz klopfte wieder, gerade so innig, nein, fast noch mehr! Warm fühlte sie’s in sich aufwallen. Ja, sie wollte es lieb haben, und was an ihr lag, das wollte sie wohl tun, der Preuße sollte nicht die Oberhand kriegen; am Rhein war es geboren, ein rheinisch Kind sollte das Finchen bleiben!
Sie mußte an sich halten, um dem Enkelkind nicht einen schallenden Kuß aufzudrücken.
Der Geistliche sprach den Segen über die Täuflinge; es beruhigte die Großmutter, daß er dabei wenigstens ein Kreuz machte. Durch das Glas der Kirchenfenster fielen bunte Strahlen. Draußen schien wieder die Sonne – ei, das war gut, da sah sich alles noch einmal so freundlich an!
Als sie dem Ausgang der Kirche zuschritten, hatte Frau Zillges wieder ihr gewohntes behagliches Gesicht.
»Et hat noch jut jejangen,« flüsterte sie und nickte der Tochter zu. Diese gähnte, war abgespannt und hatte Lust auf ein Gläschen Wein; aber sie hatte keinen Viertelschoppen zu Hause, das fiel ihr ein, und darum seufzte sie. Plötzlich fuhr sie zusammen, als die Mutter einen Laut der Überraschung ausstieß.
Hinter dem letzten Pfeiler trat Vater Zillges auf sie zu. Er schmunzelte über’s ganze Gesicht, zugleich ein bißchen pfiffig und ein bißchen verlegen; da hatte er die ganze Zeit über versteckt gestanden und zugesehen.
»No, Zillges,« flüsterte Frau Josefine Cordula und gab ihrem Mann einen kleinen Puff in die Seite, »du bis aber einen!« Sie wollte ärgerlich tun, aber sie brachte es nicht fertig. »Warum biste dann nit wenigstens vornehin jekommen?!«
Er faßte sie unter den Arm und flüsterte zurück unter noch stärkerem Schmunzeln: »Dat war mich nit möjelich, wahrhaftijens Jott nit – du weißt doch – dat Bukping!« Und dabei knibbelte er mit dem Auge.
In guter Laune traten sie aus dem Portal. Es war wunderschönes Wetter geworden; Damen mit Parasols und blumengeschmückten Kiepenhüten bauschten ihre sommerlich hellen Gewänder.
»Wohin dann?« fragte Zillges, als sich Trina jetzt nach links wendete. Die Infanteriekaserne dehnte sich lang, nahm die ganze eine Seite der Straße ein, und die Feldwebelwohnung lag im Hof I, im äußersten linken Flügel. »No, wat dann, wohin jehste?«
»Nach Haus,« murmelte Frau Trina mit zuckenden Lippen; es wurde ihr doch gar schwer, wenn sie daran dachte, daß sie an dem schönen Sonntag, der noch dazu der Tauftag ihres Kindes war, so mutterseelenallein in der öden Kaserne sitzen sollte. Die Eltern würden ja nicht zu ihr kommen, die hatten in dem ganzen Jahr kaum einmal die Feldwebelwohnung betreten; und wenn auch der Rinke nicht da war, das taten sie doch nicht. Überdies war am Sonntagnachmittag immer viel Zuspruch im ›Bunten Vogel‹. »Och Jott, och Jott!« seufzte sie; sie fühlte sich doch noch recht schwach.
Als hätte der Vater ihre Gedanken erraten, so sagte er jetzt: »No Huus?! Biste jeck? Du wirst doch net e so trübselig allein sitzen?! Komm du nur bei uns, Tring!«
»Un dat Finken kömmt auch mit bei sein Jroßmamma,« rief Mutter Zillges und lächelte zärtlich ihr Enkelkind an.
Die junge Frau war zögernd stehengeblieben und wurde abwechselnd rot und blaß. Ach ja, sie wollte sehr gern mitgehen, aber hatte ihr Mann ihr nicht befohlen, sich ruhig zu Haus zu halten? Unschlüssig sah sie vom Vater zur Mutter und auch zur kleinen Josefine hin, sie wußte sich keinen Rat; ihr grauste vor den getünchten Kasernenwänden und der Einsamkeit. Wieviel besser war’s in der getäfelten Wirtsstube des ›Bunten Vogel‹, und nebenan im kleinen Comptörchen, wo der große Lederstuhl am Fenster zum Ruhen einlud, und das erst kürzlich angebrachte Spiönchen die Straße aufwärts und abwärts in seinem Glas spiegelte. O, da war’s gut sein! Aber hatte Rinke nicht gesagt: ›Du bist noch schwach, leg dich lieber ein paar Stunden hin, schon wegen der Josefine!‹ Schwach, schwach?! Ne, sie war ganz kräftig!
Die Dauwenspeck gab den Ausschlag. »No, Madam Rinke,« mahnte sie, »steht hie nit e so lang erum, dat es Euch nit jut. Zeit for ’t Mittagessen es et auch als. Un et Finken hat auch als Appetit. Madam Zillges, seid e so freundlich, dragt dat Finken e Stücksken, et es mech als janz schwer.«
Und nun schwenkte die kleine Karawane, als sei es so ganz selbstverständlich, statt nach links, nach rechts ab, in der der Feldwebelwohnung entgegengesetzten Richtung. –
Wer hätte gedacht, daß das heute noch so ein vergnügter Tag werden würde! Mutter Zillges hatte ein gutes Mittagessen vorbereitet gehabt, und alle taten ihrer Kochkunst Ehre an. Die Dauwenspeck versicherte, sie könne sich tot essen an den gestovten Saubohnen und dem frischgekochten durchwachsenen Speck; einen leckreren Zwetschgenkuchen verstand überhaupt keiner zu backen, er schmeckte so ›herzlich‹. Auch dem Düsseldorfer Obergärigen wurde wacker zugesprochen, und zuletzt stieß man mit einem Gläschen Rheinwein auf das Wohl des Täuflings an.
Es herrschte ein ungemeines Behagen in der um diese Zeit noch leeren Wirtsstube, an deren altertümlichen Wänden, zwischen ausgestopften Vögeln und Schmetterlingskästen, verschiedene Lithographien des Kaisers Napoleon hingen. Auf der einen stand er einsam, im kleinen Hütchen, die Hand im Busen; auf der andern lag er zu St. Helena auf dem Sterbebett.
Peter Zillges bildete sich etwas darauf ein, daß er den Napoleon gut gekannt. Hatte er dem Kaiser doch dazumal, anno elf, bei seinem Einzug in Düsseldorf, so nahe gestanden, daß er ihn hätte am Rockschoß greifen können. Auf dem Hügel am neuen Hafen war’s gewesen, da hatte Napoleon einen Augenblick verweilt. Die Bürgergarde bildete Spalier, Tücher wurden geschwenkt, Kinder und Jungfrauen streuten Blumen, Musik spielte, Trommeln wirbelten, vom Boulevard Napoleon und der Rue l’Empereur her wehten Fahnen, eine Ehrenpforte war gebaut am Ratinger Tor, eine schaulustige Menge drängte sich, es gab ihrer genug, die da schrieen: »Vive l’empereur!« Aber finster hatte jener gestanden, die Arme über der Brust gekreuzt, und hinausgestarrt auf den Rhein, der unruhig seine schweren, herbstgrauen Wogen vorbeirollte. Der arme Kaiser, dem ahnte wohl schon Unheil!
Zillges erzählte das gern und anschaulich; er konnte sich nie eines gewissen Bedauerns dabei erwehren. Man kannte den Napoleon doch von Angesicht zu Angesicht, man war lange genug französisch gewesen, und die Kurpfälzer und Österreicher, die vordem in der Stadt gelegen, hatten übermütiger gehaust wie die Truppen der Division Lefebvre. Und wem hatte die Stadt denn den neuen Hafen und die schönen Anlagen des Hofgartens, in denen der Bürger sich mit Weib und Kind ergehen konnte, und den Ananasberg und den Napoleonsberg und die breite Alleestraße zu verdanken? Nur den Napoleon! Ohne den säße man noch in der engen Festung und hätte Gott weiß was für Einquartierung auf dem Hals.
Ja, der Napoleon, das war einer gewesen – Gott hab’ ihn selig!
Ganz bescheiden nahm sich der Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. zwischen den beiden großen Lithographien aus.
Man saß noch hinter’m Tisch, als ein paar Gäste im ›Bunten Vogel‹ erschienen, gute Bekannte, die Mutter Zillges gleich zum Kaffee einlud. Nun fuhr sie ihren Korinthenplatz auf.
Trina saß da mit hochgeröteten Wangen; sie hatte ihr Kind an der Brust und ließ sich’s selber auch wohl sein. Ihre Augen glänzten; die Freunde bewunderten das »staatse« Kind – und dann war so viel zu hören und zu erzählen! Sie hatte sich lange nicht so recht ausgesprochen. Gedankenlos aß und trank sie in sich hinein; der Nachmittag verflog im Umsehen.
Es kamen der Gäste noch mehr, heut schenkte Peter Zillges gratis ein – das erste Enkelkind, da wollte er sich doch nicht lumpen lassen. Die Fröhlichkeit wurde laut, durch die offenen Fenster schallten die Stimmen weit hinab die Ratingerstraße. Mancher Bürger, der vorüberging, trat, angelockt durch das lustige Getön, in den ›Bunten Vogel‹ ein und blieb drinnen. Der Kreis vergrößerte sich bedeutend; auch junge Leute waren da, die mit der Trina einst ›Dopp‹ auf der Straße geschlagen und um den alten Jan Willem auf dem Markt ›Nachläufches‹ gespielt. Sie neckten sie alle mit ihrem Preuß’; aber die Neckerei war gutmütig, und so lachte sie mit, daß sie sich schüttelte.
Nun fing man an zu singen. Die jungen Männer gehörten zum Gesellenverein und hielten ihre Übungen zu allen kirchlichen Feiern; mit einem langgezogenen, choralartigen Lied begannen sie denn auch erst, aber bald folgten leichtere Weisen. Der Tenor legte sich ordentlich in’s Zeug, donnernd fiel der Baß ein; zuletzt freilich ging der Gesang etwas auseinander.
Es war heiß geworden, die Luft in der Wirtsstube stickig, von Pfeifenqualm erfüllt. Die kleine Josefine quäkte unruhig. Frau Dauwenspeck hatte sie der jungen Mutter abgenommen, schaukelte sie hin und her und gab ab und zu ein beruhigendes Kläpschen auf die Rückseite des fest zugebündelten Stechkissens.
Einer der jungen Männer, der Schnakenbergs Hendrich aus der ›Windmühl‹, pfiff der Kleinen freundlich etwas vor, ein Rheinländer war’s – hei, fuhr der allen in die Beine! Man stand auf und fing an zu schleifen. Der Zillges war ein rechter Schalk, ehe seine Josefine Cordula sich dessen versah, hatte er sie um die Taille gefaßt: vier Schritt nach links, vier nach rechts, schwenkt euch rund, immer rund! Weiß Gott, der tanzte seine rheinische Polka noch wie ein Junger.
Trina war auch von der Bank aufgesprungen, sie stellte sich auf die Zehen und reckte sich hinterm Tisch, um Großvater und Großmutter tanzen zu sehen, und lachte unbändig. Rosig und hübsch sah sie aus. Wie lange nicht, vertieften sich die Lachgrübchen in ihren runden Wangen, ihre Augen glitzerten vor Vergnügen; nun streckte sie den Finger aus und kreischte laut auf. Sie hatte einen ganz kleinen Schwips.
Der schwarze Hendrich, der früher schon immer ein Auge auf sie gehabt, voltigierte hinter den Tisch und zog sie vor. Ob sie sich auch kichernd sträubte, er drehte sie ein paarmal herum, nur ein paarmal; sie waren noch kaum vom Tisch weggekommen, da stockte ihr der Atem – jemand war eingetreten, ein strammer Langer, in Uniform – da – da – der Feldwebel!
Mitten in der Stube stand er und sah sie an mit einem bösen Gesicht.
Es war eine unangenehme Überraschung für beide Teile. Frau Trina wurde noch glühender rot, des Feldwebels gebräuntes Gesicht wurde fahl.
Aha, da war er ja gerade zur rechten Zeit gekommen! Also darum hatte es ihn innerlich so getrieben, daß er sich in Wesel, nachdem er in später Nacht seine Gefangenen eingebracht und den Ablieferungsschein erhalten, nur wenige Stunden Rast gegönnt und im Morgengrauen bereits wieder die Rückfahrt angetreten?! In Kaiserswerth hatte er seine Mannschaft hinter sich gelassen und war auf einem ausgespannten Gaul heimgeritten, so rasch der müde Klepper laufen konnte.
Nur nach Haus! Eine Sehnsucht hatte ihn plötzlich ergriffen, noch heimzukommen am Tauftag seines Kindes. Ganz wollte er doch nicht fehlen; auch die Käthe würde sich freuen, wenn er noch kam.
Er hatte von seinem Vater einen Siegestaler von anno 13 ererbt – eine Öse war schon daran – da sollte die Käthe gleich ein Schnürchen durchziehen, und er wollte ihn seiner Tochter heute um den Hals hängen als einen Talisman. Er war ganz glücklich in dieser Idee.
Was der Wachtmeister Rinke wohl sagen würde, wenn er wüßte, daß sich sein Enkelkind an seinem Siegestaler einmal die Zähnchen durchbeißen könnte?! Freuen täte der sich.
Lebhaft gedachte der Feldwebel in dieser Stunde seiner Eltern. Nun er selber Vater war, fühlte er sich ihnen näher, obgleich er die Stelle, wo sein Vater in der Erde ruhte, nicht kannte. Der Alte lag wohl in irgendeinem Massengrab bei Waterloo. Und die Mutter? Die war schon begraben worden anno 13, als der Vater noch unter’m alten Blücher im Kriege focht.
Die Mutter! Ach ja, die hatte bitter Not gelitten in ihrer Todkrankheit; die Nachbarn im armen märkischen Nest hatten auch nichts, er, der Zwölfjährige, war ihre einzige Stütze. Rinke erinnerte sich deutlich der kalten Winternacht, in der er, ohne Strümpfe, die nackten, mit Lappen umwickelten Beine in die zerrissenen Schuhe gesteckt, zum Flüßchen hinabgelaufen war, um Eis zu hacken, damit sie ihren Durst löschen sollte. Die Axt war ihm abgeglitten und hatte seinen Fuß getroffen, er hatte dessen nicht geachtet und war in fliegendem Lauf zu der Fiebernden zurückgeeilt. Da hatte er gelernt, die Zähne zusammenzubeißen. Es gehörte Mut dazu, die einsame, lange Winternacht hinzubringen in der kalten Kammer, an deren klapperndem Fenster der Wind rüttelte. Die Sterbende suchte bei ihm Wärme in ihrer Todeskälte; selbst frierend, preßte er sie in seine Kinderarme. So hatten sie einander umklammert, der Sohn der Mutter Schutz gebend und doch zugleich noch Schutz bei ihr suchend.
Friedrich Rinke hatte kein Glück, wenn er seiner Frau von der Vergangenheit erzählen wollte. Das erste Mal, als sie eben verheiratet gewesen, hatte sie zwar mitleidig geweint, aber als er noch einmal darauf zu sprechen kam, sagte sie: »Och, laß dat!« Es machte sie graulen und verdarb ihr die gute Laune. Aber seiner Tochter wollte er früh davon erzählen, das nahm er sich vor. –
Immer rascher trieb er sein Pferd an. Schaum stand dem Tier auf den Flanken, als er in den Kasernenhof sprengte. Mit steifen Beinen stolperte er die Holzstiege zu seiner Wohnung hinan; er lachte in sich hinein – ob die kleine Josefine wohl schlief? Es war drinnen ganz still. Die Hand auf die Klinke legend, drückte er sie behutsam nieder. – Was, verschlossen?! Donnerwetter, hatte die Käthe sich eingesperrt?!
Er klopfte, erst mit dem Finger, dann mit der Faust. Er rief: »Käthe, Käthe!« Und immer grollender: »Frau!« Keine Antwort. Sie war nicht da. Aber das Kind mußte doch drinnen sein. Er horchte: auch von dem kein Tönchen!
Was war denn das für eine Zucht?! Einen Fluch ausstoßend, polterte er die Stiege wieder hinunter. Wo steckten sie?
Ein paar Soldaten, die auf der Bank vor der Tür ihres Blocks rauchend den Sonntag verdruselten, standen stramm: Die Frau Feldwebel war gegen Mittag mit dem Kind und dem alten Weibsbild fortgegangen; bis jetzt hatten sie sie nicht wiederkommen sehen.
»Blinde Hessen!«
Fort stürzte der Feldwebel. – – –
Also hier fand er sein Weib?! Auf Rinkes Stirn schwoll die Zornesader; mit einem Blick, der alles durchbohren zu wollen schien, maß er die lustige Gesellschaft.
Eine augenblickliche Verlegenheit entstand. Der schwarze Hendrich machte einen Kratzfuß und ließ die Frau Feldwebelin schleunigst auf die Bank niedersitzen. Trina wurde so blaß, wie sie vorher rot gewesen; der fröhliche Rausch verflog, sie war plötzlich ernüchtert, ihr Herzschlag stockte.
Nur Peter Zillges, in seiner glücklichen Harmlosigkeit, nahm des Feldwebels seltsame Miene nicht krumm. Am frohen Fest allen Groll vergessend, schlug er ihn freundschaftlich auf die Schulter: »No, Herr Schwiejersohn, wat es jefällig? Bier oder e Jläsche Wein? Ja, heut hat de Pitter Zillges de Spendierbuxen an. Dat Finchen soll leben, un sein Eltern derneben! Hoch, hoch, hoch!«
Sie riefen alle: »Hoch, hoch, hoch!« Aber der Preuße verzog keine Miene und blieb frostig. ›Steif wie ein Zaunstecken,‹ mäkelten die Gäste hernach.
Auch als die Schwiegermutter, die einem etwaigen Ungewitter vorbeugen wollte, sich betulich um Rinke mühte, hatte sie kein Glück. Was sie auch anbot an Speise und Trank, schlug er aus; sie hatte Mühe genug, daß sie ihn zum Sitzen bekam. Ihre Erklärungen: die Trina habe sich ohne ihn so einsam gefühlt, darum hätten sie sie mitgenommen in den ›Bunten Vogel‹ – die Gäste seien nur ein paar Nachbarn, die sich zufällig eingefunden – bei der Taufe sei das Finchen sehr brav gewesen, es sei ein gar zu lecker Tierchen und seinem Vater schon ähnlich – all das beantwortete er mit keiner Silbe. Nach wenigen Minuten erhob er sich wieder:
»Komm, Käthe!«
Auf solchen Ton gab’s kein Widerstreben; Frau Trina stand sofort auf. Hastig band sie sich den Hut zu und warf die weite Mantille mit der Seidenfladrusche um; es fröstelte sie plötzlich. So sehr drängte er zum Aufbruch, daß sie kaum ein Nicken für die Freunde fand und ein kurzes: »Adjüs zusammen!«
Die Mutter war mit herausgelaufen; nun stand sie in der Haustür und schaute dem Paar nach. Trina hatte das Kind tragen wollen, er es ihr aber fortgenommen. Jetzt machte er so große Schritte, daß die Frau kaum nach konnte; ein paar Ellen war er immer voraus. Seufzend und mit bekümmertem Gesicht sah Mutter Zillges hinter den beiden drein – ach Gott, ach Gott, das gab ein böses Donnerwetter!
Nie war Trina der Weg von der Ratinger- bis zur Kasernenstraße so lang geworden trotz des schnellen Rennens; sonst ging sie ihn in einer guten Viertelstunde, heut dauerte er ewig. Die Knie zitterten, die Füße versagten, ihr war schwindlig und schlecht zu Mut; aber sowie sie einen Augenblick stehen blieb, um nach Luft zu ringen, rief ihr Mann: »Komm!« Sie wagte nicht, zurückzubleiben, sondern hastete sich ab, daß ihr der Schweiß auf der Stirn perlte. Es war ihr nie geheuer, wenn er sie so stumm ansah, nur knapp ein Wort sagte; war er erst am Schimpfen, dann war’s nicht mehr so schlimm, da kam sie ganz gut gegen an, ihr Züngelchen konnte sich flink rühren. Aber heut hätte sie sich kein Wort getraut.
Atemlos tappte sie die Stiege hinauf; er wartete längst oben und sah sie an mit einem Blick, als ob er sie durchbohren wollte. Als sie den Schlüssel mit zitternder Hand aus ihrer Tasche vorholte, entfiel er ihr; sie bückten sich beide zugleich danach und pufften die Köpfe gegeneinander. Da wagte sie, obgleich ihr der Schädel brummte, ein kleines Lachen; aber ihr Mann ging nicht darauf ein, sah sie gar nicht an, entriß ihr den Schlüssel und stieß ihn heftig in’s Schloß.
Sie traten ein, und plötzlich, wie mit einer Riesenlast, fiel es der jungen Frau auf die Seele: wie dürftig, wie häßlich war’s hier! Getünchte Wände ohne Schmuck, keine Bilder, nackte Dielen, unbequeme Holzschemel, nebenan in der Kammer die schmalen, eisernen Bettstellen mit den groben, härenen Decken und des Feldwebels tannener Kleiderkasten. Ach, und zu Haus alles so hübsch, so behaglich! O, daß sie auch nicht dagegen protestiert, als der Bräutigam alles überflüssig fand! So ein Soldat, was weiß der von Behagen! Jetzt hätte sie sich prügeln mögen. Wenigstens ein Bett mit einem Himmel hätten sie doch haben müssen, ein Muttergötteschen und eine traulich glimmende ewige Lampe! Ganz verzweifelt fuhren ihre Blicke umher; noch nie hatte sie so den Unterschied zwischen dem ›Bunten Vogel‹ und der povren Soldatenstube gesehen wie heut. Das Herz sank ihr, sie fing an zu weinen und setzte sich in einen Winkel.
Der Feldwebel brachte selber sein Kind zur Ruhe; kaum daß Trina sich traute, als er draußen in der Küche nach einem Stück Brot suchte, das Kleine aus der Wiege zu nehmen und an die Brust zu legen. Der Kopf war ihr schwer, der Magen tat ihr weh, sie weinte in einem fort. Weinend kroch sie in’s Bett, noch weinend schlief sie ein.
In der Nacht erwachte sie jäh – das Kind schrie durchdringend. Ganz entsetzt sprang sie auf. Ihr Mann stand schon bei der Wiege; er hatte das Öllämpchen angezündet und leuchtete damit in’s Bettchen nieder, in dem er das Kind aufgebündelt. Die kleine Josefine zog krampfhaft die Beinchen hoch an den Leib, jämmerliche Schmerzenschreie ausstoßend.
»Jesus, wat hat et nur, warum weint et dann?« fragte Trina erschrocken.
Er gab ihr keine Antwort; finster blickend raffte er die Decke von seinem Bett und wickelte das Kind hinein. So trug er’s im Zimmer auf und ab, immer auf und ab, rastlos hin und wieder.
Sie wollte es ihm abnehmen.
»Zu Bett!« herrschte er sie an.
Ängstlich verkroch sie sich wieder unter ihre Decke und blinzelte nur verstohlen zu ihm hin.
Mitternacht war längst vorüber, schon dämmerte ein bleicher Schein über’m Exerzierplatz. Noch immer wanderte Rinke auf und ab, hin und wieder, und noch immer wimmerte das Kind. Sie konnte es nicht länger mehr aushalten, an Schlafen war doch nicht zu denken; die Decke abwerfend, lief sie zu ihm hin.
»Is et krank? Och Jott, och Jott!« rief sie angstvoll und rannte neben ihrem Mann her, bleich und fröstelnd. Sie klammerte sich an seinen Arm. »Och, Jesus Maria, Rinke, sag ens, wat hat et dann?«
»Bauchweh!« stieß er kurz heraus. »Und du bist schuld dran!« Und als sie ihn betroffen, ganz verdutzt ansah mit ihren müden, verschwiemelten Augen, hob er zornig die Hand und gab ihr einen Backenstreich.
III
Der erste Weg, den Josefine lernte allein zurückzulegen, war der zu den Großeltern. Munter und großäugig blickend, trippelte die Kleine über Hof I der Kaserne. Ein mit einem Lämmchen besticktes Perlentäschchen trug sie umgehängt, da hinein steckte ihr die Großmutter immer etwas Leckeres.
Feldwebel Rinke war nicht für die Verwöhnung; ob es regnete oder windete oder fror, Josefine mußte heraus, nur daß sie dann statt des runden Hutes mit Bändern, der ihr ewig im Nacken hing, ein Kapüzchen trug und um den bloßen Speckhals ein Radmäntelchen. Frau Trina war weniger für die Abhärtung, die Fina war ja noch so jung: sie wird den Husten kriegen, sie kommt noch zu Unglück! Aber im Grunde war sie doch ganz froh, einmal für eine Weile ein Kind los zu sein, sie hatte ja noch den knapp um ein Jahr jüngeren Wilhelm und ein ganz Kleines in der Wiege. Zwischen Wilhelm und dem Kleinsten war eins gestorben, ein Mariechen. No, das war ja nur drei Wochen alt geworden, und zu warten hatte sie auch so noch genug! Die Eltern hielten ihr zwar jetzt ein Mädchen für die Tagesstunden, aber das war fast selber noch ein Kind, eben erst zur heiligen Kommunion gegangen.
Das Kasernentor war die einzige ernste Schwierigkeit auf Josefines Weg zur Ratingerstraße, den schweren Torflügel konnte sie nicht heben; und stand keine Spalte offen, um durchzuschlüpfen, mußte sie Hilfe rufen. Hell schallte die Kinderstimme über den Hof, die Soldaten spitzten die Ohren, wie bei einem Trompetenstoß. Nur rasch, sonst schrie die kleine Blage*[3] sämtliche Spottnamen der Kompanie! Die wußte sie ja alle; und die Soldaten wollten sich darüber totlachen. Jeder von ihnen kannte die Feldwebelstochter.
Wurde auf dem großen Platz exerziert, stand die Kleine gewiß oben in der Wohnung auf dem Fensterbrett, den einen Arm um’s Fensterkreuz geschlungen, den andern zum Schutz vor die geblendeten Augen gelegt. Wurde in Hof I gedrillt, hockte sie sicher in der Nähe, auf dem Pumpentrog, auf irgendeiner Treppenstufe und folgte mit aufmerksamem Blick jedem Griff, jeder Wendung.
Feldwebel Rinke freute sich seiner Tochter; er war nicht wenig stolz auf sie. Abends, wenn er sich die Pfeife anzündete – die einzige, die er sich überhaupt gönnte – rief er: »Antreten!« Und Josefine, die schon lange auf diesen Ruf gelauert, war mit einem Sprung zur Stelle. Einen zugestutzten Haselstock trug sie im Arm.
»Achtung!« Der Vater kommandierte. Hei, da wurden Griffe geübt, geschmeidig klammerten sich die kleinen Finger um das Stockgewehr.
»Faßt das Gewehrr – an! Gewehrr – ab! Faßt das Gewehrr–an! Ladestock im Lauf! Gewehrr – hoch! Spannt den Hahn!«
Der Feldwebel schmunzelte: ja, die beschämte manchen Rekruten! Und die wichtige Miene dabei, das Gesicht ganz erfüllt vom Ernst des Augenblicks!
Nun wurde Stellung geübt, und Wendungen auf der Stelle, und Marsch.
»Bataillon – Marsch! Kurz getreten! Frei – weg! Halt!«
Kein Großer konnte exakter den Kommandos folgen, schneller die Beine werfen.
Dann folgte theoretischer Unterricht. Sie mußte lernen: Meldungen machen, – ›richtig und kurz‹, das war die Hauptsache – die verschiedenen militärischen Grade aufsagen vom Feldmarschall an bis herab zum Gefreiten, die verschiedenen Truppen unterscheiden nach den Waffen. Und wurde ihr das alles auch noch schwer, so schwer, daß sich ihre Augen oft mit Tränen füllten, ihre Instruktionsstunde hätte sie nicht hergegeben, selbst für eine ganze Tüte voll ›Klümpches‹ nicht.
Und fragte der Vater ernst und gemessen: »Wie viel Elemente haben wir?«
»Fünf!«
»Wie heißen sie?«
So antwortete sie mit leuchtenden Augen: »Treue, Tapferkeit, Gehorsam, Pflichtgefühl und Ehre!«
Frau Trina schüttelte wohl den Kopfüber diese ›Dummheiten‹, aber sie sagte nichts – wenn es ihnen nur Spaß machte! ›Jedet Dierken hat sein Pläsierken,‹ dachte sie.
Die blonde Feldwebelin war in den sieben Jahren ihrer Ehe recht auseinandergegangen; ihr blühendes Fleisch war Fett geworden, sie machte sich nicht viel Bewegung. Die Wochentage brachte sie meist in Unterrock und loser Jacke oben in ihren paar Stuben zu, schluffte vom Herd zur Wiege und wohl auch von der Wiege zum Fenster. Da sah sie auf dem, im Sommer staubigen, im Winter grundlosen Platz das tägliche Schauspiel des Exerzierens, und, wenn’s hoch kam, jenseits des Kanals Arbeiter Erde und Steine karren. Dort wurde eine Promenade angelegt über’m Graben, und schöne Kastanien wurden gepflanzt; Bauplätze waren auch schon feil. Da würde es einmal angenehm zu spazieren sein!
»Och Jesus!« seufzte sie dann wohl, schlich wiederum zur Wiege zurück und schaukelte das greinende Kind. Ein alter Reim fiel ihr ein:
›Wenn andre Leut’ spazieren gehn,
Muß ich an der Wiege stehn,
Muß da machen: knick, knick, knack,
Schlaf, du kleiner Habersack!‹
Und dann trübten sich ihre blauen Augen.
Der Wilhelm machte ihr viel zu schaffen, mehr als das Kleinste; er war ein kränkliches Kind und für seine fünf Jahre schwach auf den Beinen. Bald hatte er einen Husten, bald einen Ausschlag, der Vater wurde schon ganz ungeduldig – das sollte ein Soldatenjunge sein?! Hing ewig an der Mutter Rock und flennte wie ein altes Weib, wenn die Josefine mit ihm exerzieren wollte! Wenn die Schwester ihn prügelte, prügelte er nicht wieder – das Hasenherz!
Bei jeder solchen Gelegenheit äußerte sich des Feldwebels Unwillen – der Junge würde nun und nimmer ein Soldat! Und Rinke nahm das als eine persönliche Beleidigung; ohne daß er es wußte, wurde sein Ton barscher, wenn er mit dem Knaben sprach. War es da nicht natürlich, daß die Mutter sich gerade dieses Kindes besonders annahm?
Auch Josefine liebte den Bruder; sie schlug ihn nur, wenn er beim Exerzieren den Stock verkehrt hielt und die Beine nicht stramm stellte. –
Heute führte sie ihn sorglich wie eine kleine Mutter an der Hand. Es war Sonntag, und die Geschwister trippelten vor den Eltern her über die Kasernenstraße, während Stina, das noch kindliche Stundenmädchen, den Kleinsten im blaugestrichenen Holzwägelchen hintennach zog.
Die Familie rückte zum Sonntagnachmittagsspaziergang aus; es war das einzige Vergnügen, das Frau Trina hatte, und dies ließ sie sich auch so leicht nicht nehmen.
Dann holte sie einmal ihren Putz hervor und zeigte sich, am Arm ihres Feldwebels, als gute Bürgerstochter, die mehr Geschmack hat, als eine gewöhnliche Soldatenfrau. Die Schnürbrust ließ sich freilich so eng nicht mehr zusammenziehen, aber der Rock setzte sich modisch mit vielen Falten unter dem runden Leibchen an, die Ärmel bauschten mächtig bis zum Ellenbogen, und reichlich gesteifte und wattierte Unterröcke gaben dem Rock einen schönen Fall.
Frau Trina war heut nicht ganz zufrieden mit dem Ziel des Ausflugs, sie hätte ihren Staat lieber mehr sehen lassen und selber gern welchen gesehen im Kaffeegarten ›Zum Stockkämpchen‹ oder in der ›Petersburg‹ auf dem Flingersteinweg, wo man beim Gläschen Wein und Bier Musik von der Estrade des großen Saals zu hören bekam und nachher auch ein Tänzchen machen konnte. Aber ihr Mann, der war ja zu geizig für so etwas, der ging am liebsten nur jenseits der Schiffbrücke, nach der ›andern Seite‹, wo man im Grasgarten des Bauernwirtshauses Bauernbrot und dicke Milch aß.
Schon hatte man den alten Jan Willem am Marktplatz erreicht und spazierte, das eherne Reiterbild, auf dessen mächtigem Haupt Scharen unverschämter, schirpender Spatzen saßen, zur Rechten lassend, herunter zum Zolltor. Und sieh da – der Rhein, der Rhein!
Josefine stieß einen hellen Jubelschrei aus. Ja, da war er! Ein heiteres Sonnenlicht küßte seine breite, schleppende, lichtgrüne Flut. Langsam ziehend und lautlos glitt Welle auf Welle am Brückenkopf vorbei.
Mit lautem Jauchzen stürmte Josefine voran; es machte ihr ein unsägliches Vergnügen, die Planken der langen Schiffbrücke unter ihren Füßen leis schwanken zu fühlen und durch die Ritzen das Wasser unter sich strömen zu sehen. Sie rannte dahin, als hätte der Rheinduft sie berauscht, dieser köstliche Geruch nach Tang und Teer und durchfeuchtetem Holz. Den Kopf zurückgeworfen, die Flügel der kleinen Stumpfnase gebläht, die Arme ausgebreitet, lief sie dem Rheinwind entgegen, helle Glücksschreie ausstoßend. Und der Wind pustete sie an, daß ihre Bäckchen leuchtender strahlten in einem warmen, weichen Rot.
Auch Frau Trinas Gesicht war heiter geworden; jetzt war man drüben, und der Blick zurück auf die Stadtseite war gar zu schön. Weiß zeigten sich die Häuser an der Werft, in ihren Fenstern blitzte der Sonnenglanz und machte sie zu blendenden Spiegeln; stolz ragten dahinter die Türme der Kirchen, und mächtig und klotzig erhob sich das alte Schloß. Seine rötlichen Mauern standen hart am lichtgrünen Strom, mit vielen Fensteraugen blickte es rheinauf und rheinab.
Stolz wies die Düsseldorferin hinüber: »Kuck ens, Rinke!« Er meinte zwar, die Spree gäbe dem Rhein an Breite nicht viel nach, auch könne sich der alte Rumpelkasten da mit dem Königsschloß zu Berlin nicht messen; aber er betonte heut doch nicht mit gleicher Schärfe, wie sonst bei jeder Gelegenheit, sein Preußentum. Sein Hauptinteresse war bei Josefine.
Gleich einem Vogel auf eiligem Flug durchflatterte sie das satte Grün der Wiesen. »Krieg’ mich, krieg’ mich!« Oft verschwand sie ganz im fetten Gras, um dann plötzlich aufzutauchen mit dem schrillen, zwitschernden Schrei der Schwalbe, die den Äther durchschießt. Langgestielter, blauer Salbei, goldäugige, weiße Sternblumen, brennend roter Mohn nickten um sie. Mit beiden Händen griff sie hinein in die Blütenpracht, in ausgelassener Lust raufte sie aus, und, sich hintenüber in’s Gras werfend, goß sie all ihre Blumen wie einen Sommerregen über sich.
Der kleine Wilhelm hatte sich längst zu dem Rock der Mutter geflüchtet, er hing sich an und zockelte so nach. Vergebens ermunterte ihn der Vater, der Schwester zu folgen, nur fester klammerte er sich an die Falte; als der Vater ihm die Finger lösen wollte, erhub er ein jämmerlich Geschrei.
Da begann die Mutter, den Arm ihres Mannes fahren lassend, auf die wilde Josefine zu schelten. »Kömmste hiehin! Wie siehste nu als wieder aus? Du Blage! Lauter Jraßflecken!« Sie hob die Hand zum Schlag. »Wat machste dann?«
Glühend vom Tollen, bebend vor Atemlosigkeit, sah Josefine der Mutter in’s Gesicht. »Ich freu’ mich,« sagte sie und nahm den Schlag hin, ohne mit der Wimper zu zucken; doch dann senkte sie tief den Kopf, weh getan hatte ihr die Ohrfeige nicht, aber sie schämte sich.
Der Feldwebel biß sich auf die Lippen; er ärgerte sich über seine Frau. Aber: famoses Mädel, die Josefine, wie sie dastand und sich das Weinen verkniff und den Kopf hängen ließ, daß man ihr nicht in’s Gesicht sehen sollte! Die hatte Ehrgefühl, Gott sei Dank! Die Ehre, die Ehre, nicht früh genug hält man die hoch. Ja, seine Tochter – die war Blut von seinem Blut! Ein mißbilligender Blick traf den noch immer heulenden Wilhelm.
Als Rinke über ein Weilchen nach Josefine umschaute – er mußte doch sehen, ob sie noch immer trauerte – da sah er hinter einem Busch zwei langbehoste, kleine Beine in der Luft zappeln. Josefine schlug Purzelbäume.
Der Spaziergang auf die ›andre Seite‹ war für den Feldwebel immer der Anlaß zu allerhand militärischen Betrachtungen: hier hatten einst die Soldaten des General Bernadotte den Freiheitsbaum mit der Jakobinermütze aufgepflanzt und von dem Rasenwall aus die Stadt Düsseldorf beschossen. Jetzt standen freilich harmlose Brettertische und Bänke an gleicher Stelle, und zwischen zwei starken Weidenbäumen quietschte eine Schaukel.
Es war Friede, stiller, eintöniger, schläfriger Friede. Der Feldwebel sagte sich nicht ohne Bitterkeit: er war ein Jahrzehnt zu spät auf die Welt gekommen; die großen Befreiungskämpfe waren ohne ihn ausgefochten, ihm war es wohl nur beschieden, in der Kaserne zu hocken und statt des Pulverdampfes den Staub des Exerzierplatzes zu schlucken.
Heut waren alle Tische und Bänke vor dem bäuerlichen Wirtshaus besetzt, selbst die im verstecktesten Eckchen; nur ein schöner Tisch, so recht am besten Platz, war merkwürdigerweise noch frei.
Mit schwenkendem Rock und frohem Lachen stapelte Frau Trina darauf los, die Ihren durch lauten Zuruf ermunternd, doch ja recht rasch Besitz zu ergreifen. Die Kinder erkletterten denn auch schon die Bank, als der Feldwebel in peinlicher Überraschung stutzte. Donnerwetter, da am Nebentisch, ganz dicht, saß ja sein Hauptmann, der Herr von Clermont, den erkannte er schon vom Rücken! Rinke hielt seine Frau zurück und winkte den Kindern, aber Trina sagte ziemlich laut: »No, wat dann?! Dadrum sollen wir uns nit dahin setzen?!« Sie ärgerte sich über die Devotion ihres Mannes. »Wenn de zu vornehm is, da braucht de ja nit derhinzujehn, wo die Bürjer jehn. Ich setz’ mich!«
In diesem Augenblick wendete sich der Hauptmann herum, und der Feldwebel stand stramm. Herr von Clermont winkte ab und machte dann seine Frau lächelnd auf die kleine Josefine aufmerksam, die auf den Wink ihres Vaters von der Bank herabgeglitten war und nun, den Finger an den Lippen, halb scheu, halb dreist den ihr bekannten Vorgesetzten anstarrte.
Inzwischen hatte Frau Trina Platz genommen; nicht ohne Absicht sprach sie recht hörbar und lachte ungeniert, keiner der Umsitzenden sollte denken, daß sie sich wegen des Vorgesetzten ihres Mannes auch nur die geringste Gêne antat. Das Kindermädchen mußte ihr sogar den Kleinsten reichen, und sie legte ihm eine frische Windel unter.
Rinke war wütend auf seine Frau; aber sie schien seine stummberedten Blicke nicht zu bemerken, fröhlich nickte sie ein paar Bekannten zu: »Tag zusammen!« und schöpfte mit Geklapper und Ausrufen des Entzückens die dicke Milch aus der irdenen Schüssel.
»Schrei nich so!« flüsterte er. Sie hörte nicht, und deutlicher wagte er nicht zu werden, am Nebentisch konnte man ja jedes Wort verstehen. Er saß wie auf Nadeln.
Josefine starrte noch immer mit großen Augen, sie hielt ordentlich den Atem an – da saß neben der Dame des Herrn Hauptmann ein Mädchen, das war so klein wie sie, aber lange, dunkle, gedrehte Locken fielen auf dessen Schultern, und neben dem Mädchen saß einer, ein – ja, nur ein Junge war’s, aber er hatte schon Uniform an! Eine ganze, richtige, wirkliche Uniform! Ihre Blicke waren gebannt.
Hauptmann von Clermont wurde aufmerksam: »He, du Kleine, was gibt’s denn hier zu sehen?«
Sie wurde rot wie eine Rose; krampfhaft das Fingerchen streckend, ganz aufgeregt, ganz glückselig bewundernd, stammelte sie: »Der – och, der da – der kleine Soldat!«
Alles lachte. Herr von Clermont winkte sie zu sich heran; dreist kam sie bis an sein Knie, aber ihre Augen verließen den Jungen nicht.
»Der kleine Soldat da,« sagte der Hauptmann amüsiert, »das ist ein Kadett, verstehst du? Ein Kadett!«
Sie nickte stumm-strahlend.
Der Kadett war auch ganz rot geworden, die großen Blicke des kleinen Mädchens genierten ihn sehr. Er drehte den Kopf weg.
»Feldwebel, hat Er schon gesehn? Mein Sohn!« Der Hauptmann wendete sich zu Rinke. Dieser stand wie vorhin stramm, aber leutselig winkte der Vorgesetzte wieder ab: »Bitte bequem.« Und fuhr dann fort: »Großer Junge, was? Erst elf. Habe ihn schon drei Jahre im Korps in Bensberg, ist in den Ferien hier. Kommt bald nach Potsdam. Ich denke, wird mal einen ganz netten Leutnant Seiner Majestät abgeben; hoffe, wenn’s Glück gut ist, bei Seiner Majestät Garde. Viktor, sitz gerade! Kopf hoch, daß du wächst!«
Der Junge reckte sich. Auch Josefine reckte sich unwillkürlich. Die Blicke beider Kinder begegneten sich. Der Kadett lächelte ein wenig spöttisch, ein wenig von oben herab und zugleich doch geschmeichelt.
»Möchtest du vielleicht mit dem kleinen Mädchen spielen, Cäcilie?« fragte jetzt die Frau Hauptmann zu ihrem Töchterchen, und das blasse, vornehme Gesicht dem blonden Kind zuwendend, fragte sie gütig: »Wie heißt du?«
»Zu Befehl: Josefine!«
Wieder lächelte der Hauptmann, der Kadett aber prustete laut heraus. Da wurde Josefines freier Blick unsicher, es zuckte um ihren Mund; hastig nach der Hand der kleinen Schwarzhaarigen, die sich ihr schüchtern genähert hatte, greifend, riß sie die mit sich fort, weg von den Tischen, hinein in die Wiese.
Die beiden Mädchen, sich an der Hand haltend, liefen rasch immer weiter hinein in das hohe, blumige Gras.
Da stand der Kadett auf, drehte sich erst noch ein wenig in der Nähe der Tische herum, pfiff, schleuderte ein Steinchen, schüttelte an einem Baum, besah seine Stiefel und ging dann langsam, mit gemessenem Schritt, den beiden Kindern nach in die Wiese. –
Von diesem Sonntag an war Josefine zur Gespielin des kleinen Fräulein von Clermont erkoren; der Hauptmann hatte seinem Feldwebel allerhand Freundliches über das frische, blonde Kind gesagt.
Rinke bemühte sich, seiner Frau nicht zu zeigen, wie stolz er auf die Ehre war, die seiner Tochter widerfuhr; die Käthe hatte ja doch gar kein richtiges Verständnis dafür. »Du lieber Jott, wat is dat dann?!« sagte sie. Der Großvater brummte auch. »Wat soll dat Kind da? Wir sin Düsseldorfer Börjer, mir scheren ons en Dreck om de ›Vons‹!« Die Großmutter war ebenfalls wenig erbaut: die Clermonts waren evangelisch, aus Thüringen sollten sie sein, daher, wo man den Luther auf der Burg versteckt gehalten. Die alte Frau war sich über ihre Gefühle nicht ganz klar, aber ihr bangte für ihr Finchen; allerlei Reden führte sie vor dem Kind, die es nicht verstehen konnte, jedoch es fühlte heraus, Großeltern und Mutter freuten sich nicht über die Einladung. Aber der Vater!
Es war ein großer Moment für beide, als Josefine an des Feldwebels Hand nach der Bilkerstraße hüpfte. Dort wohnten die Clermonts. Sie war in ihrem besten Kleid, weiß hingen ihr die Höschen unter dem Röckchen vor bis an die Knöchel. Ihr Herz klopfte vor Erwartung: hatte der kleine Soldat nicht gesagt, er würde vielleicht auch einmal mit ihr spielen? Exerzieren – ach ja, das wollten sie!
Ehe der Vater an der Klingel zog, ermahnte er noch: »Mach mir Ehre, Josefine, und wenn dir auch was gegen den Strich geht, nich gemuckt, hörste?«
»Aber – wenn se mich hauen?« fragte sie und warf trotzig den Kopf zurück.
»Dann hauste nich wieder – untersteh dich!«
Das Kind machte große Augen – heute verstand es seinen Vater nicht.
*
Die Clermonts waren nicht reich, der Hauptmann hatte nicht mehr als seine Gage und jährlich ein paar hundert Taler Zuschuß aus dem Erbe seiner Frau. Sie mußten sich sehr einschränken, aber die Welt merkte nichts davon. Die Frau Hauptmann trug, wenn sie ausging, ein seidenes Kleid und Armbänder, aus den Haaren ihrer Eltern und Kinder geflochten, mit goldenen Schlößchen daran; und die hübsche Cäcilie sah aus wie ein englischer Kupfer, mit ihren langen gedrehten Locken, in den zarten, bandgegürteten Kleidchen.