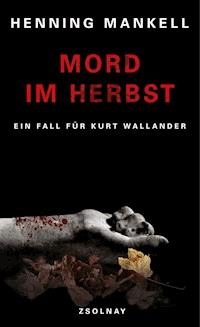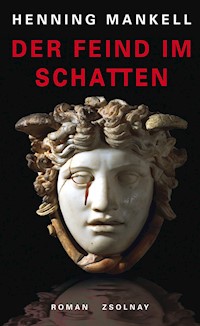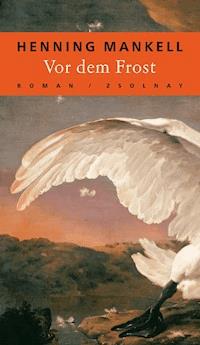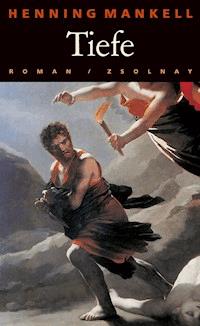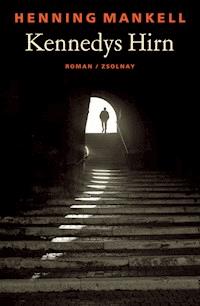Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Alles beginnt mit dem Verschwinden einer schwedischen Immobilienmaklerin - doch schon bald weisen immer mehr Details auf ein teuflisches Komplott von internationalen Dimensionen hin. Kommissar Wallander stößt bei seinen Ermittlungen unter anderem auf die Spur einer südafrikanischen Geheimorganisation und weiß bald, dass das Schicksal von Hunderttausenden auf dem Spiel steht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 800
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Zsolnay eBook
Henning Mankell
Die weiße Löwin
Kriminalroman
Aus dem Schwedischen von Erik Gloßmann
Paul Zsolnay Verlag
Die Originalausgabe erschien erstmals 1993 unter dem Titel Den vita lejoninnan bei Ordfront in Stockholm. ISBN 978-3-552-05613-8© Henning Mankell 1993Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe© Paul Zsolnay Verlag Wien 2002/2012Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de. Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke.
Für meine Freunde in Mosambik
»Solange wir fortfahren, die Menschen in unserem Land aufgrund ihrer Hautfarbe unterschiedlich zu bewerten, werden wir an dem leiden, was Sokrates die Lüge in der Tiefe unserer Seele nennt.«
Jan Hofmeyr
Stellvertretender Premierminister Südafrikas, 1946
»Angurumapo simba, mcheza nani?«
»Wer wagt zu spielen, wenn der Löwe brüllt?«
Afrikanisches Sprichwort
Prolog
Südafrika 1918
Am späten Nachmittag des 21.April 1918 trafen sich drei junge Männer in einem unscheinbaren Café im Johannesburger Stadtteil Kensington. Der jüngste, Werner van der Merwe, hatte gerade seinen neunzehnten Geburtstag hinter sich. Der älteste, Henning Klopper, war zweiundzwanzig. Der dritte Mann in der Gruppe, Hans du Pleiss, würde in wenigen Wochen zweiundzwanzig werden. An diesem Tag hatten sie sich zusammengefunden, um seine Geburtstagsfeier zu planen. Keiner der drei ahnte auch nur im entferntesten, daß ihr Treffen im Café in Kensington historische Bedeutung erlangen sollte. Hans du Pleiss’ Geburtstagsfeier kam an diesem Nachmittag gar nicht zur Sprache. Nicht einmal Henning Klopper, der jenen Vorschlag machte, der letztendlich die südafrikanische Gesellschaft verändern würde, hatte eine Vorstellung von der Reichweite oder von den Konsequenzen seiner noch nicht ausgereiften Gedanken.
Sie waren junge Männer, die sich in Charakter und Temperament sehr unterschieden. Etwas aber hatten sie gemeinsam. Etwas ganz Entscheidendes. Sie waren Buren. Alle drei stammten aus Familien, deren Vorfahren mit einer der ersten großen Einwanderungswellen heimatloser holländischer Hugenotten in den achtziger Jahren des 17.Jahrhunderts nach Südafrika gekommen waren. Als der englische Einfluß in Südafrika wuchs und schließlich die Form offener Unterdrückung annahm, hatten sich die Buren mit Ochsenwagen auf ihre lange Fahrt in das Innere des Landes begeben, zu den unendlichen Ebenen in Transvaal und Orange. Für diese drei jungen Männer, wie für alle Buren, waren Freiheit und Unabhängigkeit die Voraussetzung, um ihre Sprache und Kultur am Leben zu erhalten. Die Freiheit garantierte, daß keine unerwünschte Verschmelzung mit der verhaßten englischstämmigen Bevölkerung erfolgte oder gar mit den Schwarzen oder der indischen Minderheit, die sich vor allem vom Handel in Küstenstädten wie Durban, Port Elizabeth und Kapstadt ernährte.
Henning Klopper, Werner van der Merwe und Hans du Pleiss waren Buren. Das war eine Tatsache, die sie nie vergessen oder verdrängen konnten. Das war vor allem etwas, worauf sie stolz waren. Von frühester Kindheit an hatten sie gelernt, daß sie zu einem auserwählten Volk gehörten. Aber gleichzeitig waren das Selbstverständlichkeiten, die sie selten erwähnten, wenn sie sich täglich in dem kleinen Café trafen. Das Bewußtsein ihrer Herkunft existierte einfach, als eine unsichtbare Voraussetzung ihrer Freundschaft und Vertrautheit, ihrer Gedanken und Gefühle.
Sie trafen sich nach Feierabend in dem kleinen Café, wenn sie ihr Tagewerk als Büroangestellte bei der Südafrikanischen Eisenbahngesellschaft abgeschlossen hatten. Meist sprachen sie über Mädchen, über Zukunftsträume, über den großen Krieg, der in Europa seinen Höhepunkt erreicht hatte. Aber gerade an diesem Tag saß Henning Klopper in gedankenvolles Schweigen versunken. Die anderen sahen ihn verwundert an, denn sonst war er immer am gesprächigsten.
»Bist du krank?« fragte Hans du Pleiss. »Hast du Malaria?«
Henning Klopper schüttelte nur abwesend den Kopf.
Hans du Pleiss zuckte die Schultern und wandte sich Werner van der Merwe zu.
»Er denkt nach«, sagte Werner. »Er überlegt, wie er es anstellen muß, damit sein Gehalt schon in diesem Jahr von vier auf sechs Pfund im Monat erhöht wird.« Die Frage, wie sie ihre unwilligen Chefs davon überzeugen konnten, ihre mageren Bezüge aufzubessern, gehörte zu ihren ständig wiederkehrenden Gesprächsthemen. Keiner von ihnen zweifelte daran, daß ihre Karriere bei der Südafrikanischen Eisenbahngesellschaft sie früher oder später auf eine Spitzenposition bringen würde. Alle drei verfügten über ein gesundes Selbstvertrauen, waren intelligent und energisch. Ihr Problem war, daß es unerträglich lange dauerte, bis sie erreichten, was ihnen ihrer Auffassung nach zustand.
Henning Klopper nahm einen Schluck aus seiner Kaffeetasse. Mit den Fingerspitzen prüfte er, ob sein hoher weißer Kragen richtig saß. Dann strich er sich langsam über das ordentlich gekämmte, in der Mitte gescheitelte Haar. »Ich möchte euch etwas erzählen, was sich vor vierzig Jahren zugetragen hat«, sagte er bedeutsam.
Werner van der Merwe starrte ihn durch seine randlosen Brillengläser an. »Du bist zu jung, Henning«, sagte er. »In achtzehn Jahren kannst du uns erzählen, was sich vor vierzig Jahren zugetragen hat. Aber jetzt noch nicht.«
Henning Klopper schüttelte den Kopf. »Es geht nicht um meine Erinnerung«, erwiderte er. »Es geht weder um mich noch um meine Familie. Ich rede von einem englischen Sergeanten namens George Stratton.«
Hans du Pleiss unterbrach seinen Versuch, ein Zigarillo anzuzünden. »Seit wann interessierst du dich für Engländer?« fragte er. »Ein guter Engländer ist ein toter Engländer, egal ob Sergeant, Politiker oder Grubenaufseher.«
»Er ist tot«, sagte Henning Klopper. »Sergeant George Stratton ist tot. Du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Gerade von seinem Tod will ich ja erzählen. Er starb vor vierzig Jahren.« Hans du Pleiss öffnete den Mund, um einen weiteren Einwand vorzubringen, aber Werner van der Merwe legte ihm schnell die Hand auf die Schulter. »Warte«, sagte er. »Laß Henning erzählen.«
Henning Klopper trank noch einen Schluck Kaffee und tupfte sich den Mund und den dünnen, hellen Schnurrbart sorgfältig mit einer Serviette ab. »Es war im April 1878«, begann er. »Während des britischen Krieges gegen die aufrührerischen afrikanischen Stämme.«
»Der Krieg, den sie verloren haben«, sagte Hans du Pleiss. »Nur die Engländer können einen Krieg gegen Wilde verlieren. Bei Isandlwana und Rorke’s Drift zeigte die englische Armee, wozu sie in Wahrheit taugt. Nämlich dazu, sich von Wilden massakrieren zu lassen.«
»Laß ihn doch weiterreden«, sagte Werner van der Merwe. »Unterbrich doch nicht immer.«
»Was ich erzählen will, geschah irgendwo in der Nähe des Buffalo River«, fuhr Henning Klopper fort. »Die Eingeborenen nennen den Fluß Gongqo. Die Abteilung Mounted Rifles, für die Stratton verantwortlich war, hatte auf einem freien Feld unweit des Flusses ihr Lager aufgeschlagen und war in Stellung gegangen. Vor ihnen lag ein Höhenzug, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere. Hinter dem Berg jedoch wartete eine Gruppe Xhosakrieger. Es waren nicht viele, und sie waren schlecht ausgerüstet. Strattons Soldaten hatten keinen Grund zur Beunruhigung. Ausgesandte Späher versicherten, daß das Heer der Xhosa schlecht organisiert war und einen Rückzug vorzubereiten schien. Außerdem erwarteten Stratton und seine Offiziere an diesem Tag Verstärkung durch mindestens ein Bataillon.
Aber plötzlich geschah etwas mit Sergeant Stratton, der sonst bekannt dafür war, daß er nie die Ruhe verlor. Er begann umherzulaufen und sich von seinen Soldaten zu verabschieden. Alle, die ihn sahen, berichteten, daß er den Eindruck machte, plötzlich von Fieber befallen zu sein. Dann zog er seine Pistole und schoß sich in den Kopf, vor seinen Soldaten. Er war sechsundzwanzig Jahre alt, als er am Buffalo River starb. Vier Jahre älter, als ich heute bin.«
Henning Klopper verstummte abrupt, als ob das Ende der Geschichte auch ihn überrascht hätte. Hans du Pleiss formte aus dem Rauch seines Zigarillos einen Ring und schien eine Fortsetzung zu erwarten. Werner van der Merwe schnipste mit den Fingern nach dem schwarzen Servierer, der in einem anderen Winkel des Lokals einen Tisch abwischte.
»War das alles?« fragte Hans du Pleiss.
»Ja«, antwortete Henning Klopper. »Reicht das nicht?«
»Ich glaube, wir brauchen mehr Kaffee«, sagte Werner van der Merwe.
Der schwarze Servierer, der auf einem Bein hinkte, nahm die Bestellung mit einer Verbeugung entgegen und verschwand durch die Schwingtür zur Küche.
»Warum erzählst du von einem englischen Sergeanten, der einen Sonnenstich bekommen hat und sich erschießt?« fragte Hans du Pleiss.
Henning Klopper betrachtete seine Freunde erstaunt. »Versteht ihr nicht? Versteht ihr wirklich nicht?«
Seine Verwunderung war echt, da gab es nichts Gespieltes oder Aufgesetztes. Als er die Geschichte über Sergeant Stratton zufällig in einer Zeitschrift in seinem Elternhaus entdeckt hatte, war ihm sofort klargeworden, daß sie ihm etwas bedeutete. Es schien ihm, als könne er in Sergeant Strattons Schicksal sein eigenes voraussehen. Der Gedanke hatte ihn anfangs verwirrt, weil er so unwahrscheinlich war. Was konnte er mit einem Sergeanten der englischen Armee, der ganz offensichtlich wahnsinnig geworden war und die Revolvermündung auf die Stirn gerichtet und abgedrückt hatte, gemeinsam haben?
Eigentlich war es nicht die Beschreibung von Strattons Schicksal, die seine Aufmerksamkeit gefesselt hatte. Es waren die letzten Zeilen des Artikels. Ein einfacher Soldat, ein Zeuge des Vorfalls, hatte viel später berichtet, Sergeant Stratton habe an seinem letzten Tag pausenlos einige Worte vor sich hin gemurmelt, immer wieder, als handle es sich um eine Beschwörung. Lieber begehe ich Selbstmord, als lebend in die Hände der Xhosakrieger zu fallen.
Genau so konnte Henning Klopper seine eigene Situation als Bure in einem mehr und mehr von den Engländern dominierten Südafrika verstehen.
Es war, als müßte er plötzlich erkennen, daß auch er vor Sergeant Strattons Wahl stand.
Unterwerfung, hatte er gedacht. Nichts kann schlimmer sein, als unter Verhältnissen zu leben, die man selbst nicht beeinflussen kann. Mein Geschlecht, mein Volk, wird gezwungen, unter englischen Gesetzen, englischer Anmaßung, englischer Verachtung zu leben. Überall wird unsere Kultur bedroht und planmäßiger Erniedrigung ausgesetzt. Die Engländer werden systematisch versuchen, uns in die Knie zu zwingen. Die größte Gefahr an der Unterwerfung ist, daß sie zur Gewohnheit wird, zur Resignation, die sich wie ein lähmendes Gift ins Blut schleicht, vielleicht sogar unmerklich für den Betroffenen. Dann ist die Unterwerfung abgeschlossen. Die letzte Bastion ist gefallen, das Bewußtsein ist getrübt und stirbt langsam ab.
Bisher hatte er noch nie mit Hans du Pleiss und Werner van der Merwe über seine Gedanken gesprochen. Aber er hatte registriert, daß sie in ihren Gesprächen immer öfter in bittere und ironische Kommentare verfielen, wenn es um Untaten der Engländer ging. Der Zorn, der nur allzu natürlich gewesen wäre, der einst seinen Vater in den Krieg gegen die Engländer gezwungen hatte, war verpufft.
Das hatte ihm angst gemacht. Wer, wenn nicht seine Generation, sollte den Engländern in Zukunft Widerstand entgegensetzen? Wer, wenn nicht er, würde die Rechte der Buren verteidigen? Oder Hans du Pleiss oder Werner van der Merwe?
Die Geschichte von Sergeant Stratton hatte ihm etwas klargemacht, was er bereits wußte. Aber es war, als ob er seiner Einsicht nicht länger entkommen konnte.
Lieber begehe ich Selbstmord, als mich zu unterwerfen. Weil ich aber leben will, müssen die Ursachen, die zur Unterwerfung führen können, beseitigt werden.
So einfach und so schwer, aber so eindeutig war die Alternative.
Er wußte selbst nicht, warum er gerade diesen Tag gewählt hatte, um seinen Freunden von Sergeant Stratton zu erzählen. Plötzlich hatte er gefühlt, daß er nicht länger warten konnte. Die Zeit war reif, lange genug hatten sie sich mit Zukunftsträumen und Plänen für Geburtstagsfeiern beschäftigt, wenn sie ihre Nachmittage und Abende im Stammcafé verbrachten. Es gab etwas, was wichtiger war als alles andere, etwas, was eine Voraussetzung für die Zukunft überhaupt war. Engländer, denen es in Südafrika nicht gefiel, konnten in ihr Mutterland zurückkehren oder sich andere Vorposten im scheinbar unendlichen britischen Imperium suchen. Aber für Henning Klopper und andere Buren gab es nichts anderes als Südafrika. Einst, vor fast 250Jahren, hatten sie alle Brücken hinter sich abgebrochen, waren den religiösen Verfolgungen entkommen und hatten Südafrika als das verlorene Paradies gefunden. Ihre Entbehrungen hatten das Gefühl in ihnen wachsen lassen, ein auserwähltes Volk zu sein. Hier, im äußersten Süden des afrikanischen Kontinents, lag ihre Zukunft. Entweder diese oder eine Unterwerfung, die eine langsame, aber unerbittliche Vernichtung bedeutete.
Der alte Servierer hinkte mit einem Kaffeetablett heran. Mit zitternden Händen räumte er das benutzte Geschirr ab und stellte neue Tassen und eine Kanne Kaffee auf den Tisch.
Henning Klopper zündete eine Zigarette an und sah seine Freunde an. »Versteht ihr nicht?« sagte er noch einmal. »Begreift ihr nicht, daß wir auch vor der Wahl stehen, die Sergeant Stratton in den Selbstmord trieb?«
Werner van der Merwe nahm seine Brille ab und putzte sie mit einem Taschentuch.
»Ich muß dich deutlich sehen, Henning Klopper«, sagte er. »Ich muß sichergehen, daß wirklich du es bist, der mir gegenübersitzt.«
Henning Klopper wurde plötzlich wütend. Warum verstanden sie nicht, was er sagen wollte? Konnte es wirklich möglich sein, daß er so allein war mit seinen Gedanken? »Seht ihr nicht, was rund um uns geschieht?« fragte er. »Wenn wir nicht bereit sind, unser Recht, Buren zu sein, zu verteidigen, wer sonst wird es tun? Soll unser ganzes Volk zum Schluß so niedergedrückt und schwach sein, daß George Strattons Weg als die einzige Möglichkeit übrigbleibt?«
Werner van der Merwe schüttelte langsam den Kopf. Henning Klopper meinte einen entschuldigenden Unterton herauszuhören, als er den Freund antworten hörte. »Wir haben den großen Krieg verloren. Wir sind zu wenige, und wir haben zugelassen, daß die Engländer zu viele wurden in diesem Land, das einmal unser Land war. Wir werden gezwungen sein zu versuchen, in irgendeiner Form von Gemeinschaft mit den Engländern zu leben. Alles andere ist unmöglich. Wir sind zu wenige, und wir werden zu wenige bleiben. Selbst wenn unsere Frauen nichts anderes mehr täten, als Kinder zu gebären.«
»Es geht nicht darum, wie viele wir sind«, antwortete Henning Klopper aufgebracht. »Es geht um Glauben. Um Verantwortung.«
»Nicht nur«, sagte Werner van der Merwe. »Jetzt verstehe ich, was du mit deiner Geschichte sagen wolltest. Und ich denke, du hast recht. Sogar ich muß daran erinnert werden, wer ich bin. Aber du bist ein Träumer, Henning Klopper. Die Wirklichkeit ist nun einmal, wie sie ist. Daran können auch deine toten Sergeanten nichts ändern.«
Hans du Pleiss hatte aufmerksam zugehört, während er rauchte. Nun legte er sein Zigarillo im Aschenbecher ab und sah Henning Klopper an. »Du denkst an etwas Bestimmtes«, stellte er fest. »Was sollen wir deiner Meinung nach tun? Uns wie die Kommunisten in Rußland bewaffnen und als Partisanen auf die Drakensberge steigen? Du vergißt außerdem, daß nicht nur die Engländer zu zahlreich in diesem Lande vertreten sind. Die große Bedrohung für unsere Art zu leben geht von den Eingeborenen aus, den Schwarzen.«
»Die werden nie etwas zu bedeuten haben«, gab Henning Klopper zurück. »Die sind uns so unterlegen, daß sie immer tun werden, was wir sagen, und denken, was wir wollen. In Zukunft geht es um den Kampf, den wir gegen den englischen Einfluß führen. Um nichts anderes.«
Hans du Pleiss trank seinen Kaffee aus und rief nach dem alten Servierer, der regungslos an der Tür zur Küche wartete. Sie waren fast allein im Café, von einigen älteren Männern abgesehen, die ganz in eine ausgedehnte Schachpartie vertieft waren.
»Du hast nicht auf meine Frage geantwortet«, stellte Hans du Pleiss fest. »Du denkst an etwas Bestimmtes?«
»Henning Klopper hat immer gute Ideen«, sagte Werner van der Merwe. »Vor allem, wenn es um die Verbesserung der Rangierbahnhöfe der Südafrikanischen Eisenbahngesellschaft oder um das Anquatschen hübscher Frauen geht.«
»Vielleicht«, antwortete Henning Klopper und lächelte. Es schien, als hätten seine Freunde endlich begonnen zuzuhören. Obwohl seine Gedanken noch unfertig und verschwommen waren, beschloß er zu berichten, worüber er so lange nachgegrübelt hatte.
Der alte Servierer war an den Tisch getreten.
»Drei Glas Portwein«, befahl Hans du Pleiss. »Es widerstrebt einem ja, etwas zu trinken, was die Engländer so mögen. Aber es ist immerhin ein Wein, der in Portugal hergestellt wird.«
»Den Engländern gehören viele der größten portugiesischen Portweindestillationen«, wandte Werner van der Merwe ein. »Die sind überall, diese verdammten Engländer. Überall.«
Der Servierer hatte begonnen, die Kaffeetassen vom Tisch zu räumen. Als Werner van der Merwe über die Engländer sprach, stieß der alte Mann gegen den Tisch. Ein Sahnekännchen kippte um und bespritzte das Hemd des jungen Eisenbahnangestellten.
Um den Tisch herum wurde es still. Werner van der Merwe starrte den Servierer an. Dann sprang er hastig auf, packte den alten Mann am Ohr und schüttelte ihn brutal. »Du hast mein Hemd bekleckert«, rief er.
Dann gab er dem Servierer eine Ohrfeige. Der Mann taumelte, so kräftig war der Schlag. Aber er sagte nichts, sondern beeilte sich, den Portwein aus der Küche zu holen.
Werner van der Merwe setzte sich und tupfte sein Hemd mit einem Taschentuch ab. »Afrika könnte ein Paradies sein«, sagte er. »Wenn es die Engländer nicht gäbe. Und wenn die Eingeborenen nur in so großer Zahl da wären, wie wir sie gebrauchen können.«
»Wir werden Südafrika in ein Paradies verwandeln«, sagte Henning Klopper. »Wir werden führende Männer bei der Eisenbahn sein, aber auch führende Buren. Wir werden alle unserer Generation daran erinnern, was von uns erwartet wird. Wir müssen unseren Stolz wiedergewinnen. Die Engländer müssen einsehen, daß wir uns niemals unterwerfen. Wir sind nicht wie George Stratton, wir fliehen nicht.«
Er unterbrach seine Rede, als der Servierer drei Gläser und eine halbe Flasche Portwein auf den Tisch stellte.
»Du hast nicht um Verzeihung gebeten, Kaffer«, sagte Werner van der Merwe.
»Ich bitte um Entschuldigung für meine Ungeschicklichkeit«, antwortete der Servierer auf englisch.
»In Zukunft wirst du lernen, afrikaans zu sprechen«, sagte Werner van der Merwe. »Jeder Kaffer, der englisch spricht, wird vor ein Standgericht gestellt und wie ein Hund erschossen. Geh jetzt. Verschwinde!«
»Soll er uns doch zum Portwein einladen«, schlug Hans du Pleiss vor. »Er hat dein Hemd bespritzt. Da ist es doch nur gerecht, wenn er den Portwein von seinem Lohn bezahlt.«
Werner van der Merwe nickte. »Hast du verstanden, Kaffer?« fragte er.
»Ich werde natürlich den Wein bezahlen«, antwortete der Servierer.
»Mit Vergnügen«, fügte Werner van der Merwe hinzu.
»Mit Vergnügen werde ich den Wein bezahlen«, wiederholte der Servierer.
Als sie wieder unter sich waren, kehrte Henning Klopper zum Thema zurück. Die Episode mit dem Servierer war bereits vergessen.
»Ich dachte mir, wir sollten einen Verband gründen, oder vielleicht einen Klub. Natürlich nur für Buren. Da können wir diskutieren und mehr über unsere eigene Geschichte lernen. In diesem Klub darf niemals Englisch gesprochen werden, nur unsere eigene Sprache. Dort werden wir unsere eigenen Lieder singen, unsere eigenen Schriftsteller lesen, unsere eigenen Speisen zu uns nehmen. Wenn wir hier in Kensington, in Johannesburg, beginnen, wird sich die Idee vielleicht ausbreiten. Nach Pretoria, Bloemfontein, King William’s Town, Pietermaritzburg, Kapstadt, überallhin. Was notwendig ist, ist eine Erweckungsbewegung. Eine Erinnerung daran, daß Buren sich niemals unterwerfen, ihre Seelen sich niemals besiegen lassen, mag der Körper auch sterben. Ich glaube, daß viele nur darauf warten, daß etwas geschieht.«
Sie erhoben ihre Gläser.
»Deine Idee ist ausgezeichnet«, sagte Hans du Pleiss. »Aber ich hoffe, daß wir trotzdem noch ein wenig Zeit erübrigen, um ab und zu hübsche Frauen zu treffen.«
»Natürlich«, erwiderte Henning Klopper. »Daran wird sich nichts ändern. Aber wir fügen etwas hinzu, was wir verdrängt haben. Etwas, was unserem Leben einen ganz neuen Inhalt geben wird.«
Henning Klopper spürte, daß seine Worte feierlich, vielleicht pathetisch klangen. Aber gerade jetzt erschien ihm das ganz richtig. Hinter den Worten standen große Gedanken, stand eine Entscheidung für die Zukunft des ganzen Burenvolkes. Warum sollte er da nicht feierlich gestimmt sein?
»Meinst du, daß auch Frauen dabeisein sollten?« fragte Werner van der Merwe vorsichtig.
Henning Klopper schüttelte den Kopf. »Das ist nur für Männer«, antwortete er. »Unsere Frauen sollen nicht zu Versammlungen rennen. Das war niemals unsere Tradition.«
Sie stießen an, Henning Klopper wurde plötzlich klar, daß sich seine beiden Freunde bereits benahmen, als sei es ihre Idee gewesen, etwas von dem wiederaufleben zu lassen, was im Krieg vor sechzehn Jahren verlorengegangen war. Es irritierte ihn nicht. Im Gegenteil, er fühlte eine gewisse Erleichterung. Seine Gedanken waren also nicht ganz abwegig.
»Ein Name«, sagte Hans du Pleiss. »Statuten, Aufnahmeregeln, Versammlungsformen. Du hast dir doch sicher schon alles ausgedacht.«
»Es ist noch zu früh«, antwortete Henning Klopper. »Wir müssen gemeinsam überlegen. Gerade heute, wo es Zeit wird, das Selbstgefühl der Buren wieder aufzurichten, ist es wichtig, Geduld zu haben. Wenn wir zu schnell vorgehen, kann alles mißlingen. Und wir dürfen nicht scheitern. Ein Verband junger Buren wird die Engländer irritieren. Sie werden alles tun, um uns zu hindern, zu stören, abzuschrecken. Wir müssen gut gerüstet sein. Laßt uns lieber übereinkommen, daß wir innerhalb von drei Monaten einen Beschluß fassen. Während dieser Zeit werden wir unsere Gespräche fortsetzen. Wir treffen uns ja jeden Tag hier. Wir können Freunde dazu einladen und ihre Meinungen hören. Aber vor allem müssen wir uns selbst überprüfen. Bin ich bereit, das zu tun? Bin ich bereit, mich für mein Volk zu opfern?«
Henning Klopper verstummte. Sein Blick wanderte von einem Freund zum anderen. »Es wird langsam spät«, sagte er. »Ich bin hungrig und will nach Hause, zu Abend essen. Laßt uns das Gespräch morgen fortsetzen.«
Hans du Pleiss leerte den Rest des Portweins in die drei Gläser. Dann erhob er sich. »Trinken wir auf Sergeant George Stratton«, sagte er. »Laßt uns die unüberwindliche Stärke der Buren dadurch feiern, daß wir auf einen toten Engländer trinken.«
Die anderen standen auf und hoben ihre Gläser.
Im Dunkeln vor der Küchentür stand der alte Afrikaner und beobachtete die drei jungen Männer. Der bohrende Schmerz über das erlittene Unrecht rumorte in seinem Kopf. Aber er wußte, daß das vorübergehen würde. Zumindest würde es dem Vergessen anheimfallen, das alle Sorgen betäubt. Am Tag darauf würde er den jungen Männern wiederum ihren Kaffee servieren.
Gut einen Monat später, am 5.Juni 1918, gründete Henning Klopper zusammen mit Hans du Pleiss, Werner van der Merwe und weiteren Freunden einen Verband, den sie Das junge Südafrika zu nennen beschlossen.
Einige Jahre später, als die Mitgliederzahl erheblich gestiegen war, schlug Henning Klopper vor, den Verband in Zukunft Broederbond, Bruderschaft, zu nennen. Jetzt war es auch nicht mehr nur Männern unter fünfundzwanzig Jahren vorbehalten, sich anzuschließen. Frauen hingegen sollten niemals zu Mitgliedern werden können.
Die wichtigste Änderung aber erfolgte in einem Konferenzraum des Hotels »Carlton« in Johannesburg, und zwar am späten Abend des 26.August 1921.Es wurde beschlossen, daß die Bruderschaft zum Geheimbund werden sollte, mit Initiationsriten und dem Gebot an seine Mitglieder, den wichtigsten Zielen des Verbandes unverbrüchliche Treue zu halten: die Rechte der Buren, des auserwählten Volkes, zu verteidigen, in Südafrika, dem Heimatland, über das man eines Tages wieder uneingeschränkt herrschen würde. Die Bruderschaft sollte von einer Mauer des Schweigens umgeben sein, ihre Mitglieder würden im verborgenen wirken.
Dreißig Jahre später übte die Bruderschaft auf die wichtigsten Teile der südafrikanischen Gesellschaft einen nahezu totalen Einfluß aus. Niemand konnte Präsident im Land werden, ohne Mitglied der Bruderschaft zu sein oder deren Wohlwollen zu besitzen. Niemand konnte der Regierung angehören oder einflußreiche Positionen in der Gesellschaft bekleiden, ohne daß die Bruderschaft hinter der Ernennung oder Beförderung stand. Priester, Richter, Professoren, Zeitungsverleger, Geschäftsleute: alle Männer von Einfluß und Macht waren Mitglied der Bruderschaft, alle hatten Treue geschworen und den Eid abgelegt zu schweigen, angesichts der großen Aufgabe, das auserwählte Volk zu schützen.
Ohne diesen Verband hätten die Apartheidgesetze, die 1948 angenommen wurden, niemals verwirklicht werden können. Aber Präsident Jan Smuts und seine United Party brauchten nicht zu zögern. Mit der Bruderschaft im Rücken konnte die Trennung in sogenannte niedere Rassen und das weiße Herrenvolk durch ein aggressives System von Gesetzen und Verordnungen geregelt werden, das ein für allemal garantieren sollte, daß sich Südafrika so entwickelte, wie die Buren es wünschten. Es konnte nur ein auserwähltes Volk geben. Das war und blieb der Ausgangspunkt für alles weitere.
1968 wurde in aller Heimlichkeit das fünfzigjährige Jubiläum der Bruderschaft gefeiert. Henning Klopper, der einzige Überlebende der Gründer von 1918, hielt eine Rede, die mit den Worten schloß: »Verstehen wir wirklich, in der Tiefe unseres Bewußtseins, welche unerhörten Kräfte heute abend hier in diesen vier Wänden versammelt sind? Zeigt mir eine Organisation mit größerem Einfluß in Afrika. Zeigt mir eine Organisation mit größerem Einfluß irgendwo auf der Welt!«
Ende der siebziger Jahre verringerte sich der Einfluß der Bruderschaft auf die südafrikanische Politik dramatisch. Das Gerüst des Apartheidsystems, das sich auf die planmäßige Unterdrückung der Schwarzen und Farbigen im Lande stützte, begann aufgrund der ihm innewohnenden Unsinnigkeit zu verwittern. Liberale Weiße wollten oder konnten angesichts der nahenden Katastrophe nicht länger untätig bleiben und protestierten immer energischer.
Aber vor allem die schwarze und farbige Mehrheit hatte genug. Das unerträgliche Apartheidsystem hatte die letzte Grenze überschritten. Der Widerstand wurde immer stärker, die Konfrontation rückte immer näher.
Inzwischen orientierten sich jedoch schon andere Kräfte unter den Buren in Richtung Zukunft.
Das auserwählte Volk würde sich niemals unterwerfen. Lieber sterben, als sich irgendwann mit einem Afrikaner oder einem Farbigen an einen Tisch zu setzen und eine Mahlzeit mit ihm zu teilen, das war ihr Grundsatz. Die fanatische Botschaft war trotz der geminderten Bedeutung der Bruderschaft nicht untergegangen.
1990 wurde Nelson Mandela von Robben Island freigelassen, wo er fast dreißig Jahre als politischer Gefangener inhaftiert gewesen war.
Während die Welt jubelte, betrachteten viele Buren Nelson Mandelas Freilassung als eine unsichtbar ausgestellte und unterschriebene Kriegserklärung. Präsident de Klerk wurde zum gehaßten Verräter.
In äußerster Heimlichkeit traf sich zu diesem Zeitpunkt eine Anzahl Männer, um die Zukunft der Buren in die Hand zu nehmen. Es waren schonungslose Männer. Aber sie waren der Meinung, ihren Auftrag von Gott erhalten zu haben. Sie würden sich niemals unterwerfen. Aber sie würden auch nicht handeln wie Sergeant George Stratton.
Sie waren bereit, das Recht, das sie für heilig ansahen, mit allen verfügbaren Mitteln zu verteidigen.
Heimlich trafen sie sich und faßten einen Beschluß. Sie würden einen Bürgerkrieg provozieren, der nur auf eine Weise enden konnte. In einem vernichtenden Blutbad.
Im selben Jahr starb Henning Klopper, vierundneunzig Jahre alt. In der letzten Zeit seines Lebens hatte er immer wieder geträumt, mit Sergeant George Stratton zu verschmelzen. Jedesmal, wenn er im Traum die Mündung der Pistole gegen seine Stirn richtete, schreckte er schweißgebadet auf und saß zitternd im Dunkeln. Auch wenn er alt war und nicht mehr in allen Einzelheiten verfolgen konnte, was um ihn herum geschah, war ihm doch klar, daß in Südafrika eine neue Zeit angebrochen war. Eine Zeit, in der er sich niemals heimisch fühlen konnte. Er starrte an die Decke und versuchte sich vorzustellen, wie die Zukunft aussehen würde. Aber er sah keinen Lichtblick und fühlte eine große Unruhe in sich wachsen. Wie in einem fernen Traum sah er sich mit Hans du Pleiss und Werner van der Merwe in dem kleinen Café in Kensington sitzen, und er konnte seine eigene Stimme hören, die über Verantwortung für die Zukunft der Buren sprach, ihre Verantwortung.
Irgendwo, dachte er, sitzen auch heute junge Männer, junge Buren, an Caféhaustischen und reden darüber, wie die Zukunft erobert und verteidigt werden wird. Das auserwählte Volk wird sich niemals unterwerfen, sich aber auch niemals selbst aufgeben.
Trotz der Unruhe, die ihn nachts in seinem Schlafzimmer bedrängte, starb Henning Klopper in der Gewißheit, daß seine Nachkommen niemals wie Sergeant George Stratton handeln würden, damals am Flußbett des Gongqo an einem Tag im April 1878.
Das Volk der Buren würde sich niemals unterwerfen.
Die Frau aus Ystad
1
Die Immobilienmaklerin Louise Åkerblom verließ die Bankfiliale in Skurup am Freitag, dem 24.April, kurz nach drei Uhr. Sie blieb einen Augenblick auf dem Bürgersteig stehen und sog frische Luft in die Lungen, während sie darüber nachdachte, was sie tun sollte. Am liebsten hätte sie den Arbeitstag jetzt schon abgebrochen und wäre direkt heim nach Ystad gefahren. Aber sie hatte am Vormittag den Anruf einer Witwe bekommen und versprochen, bei einem Haus vorbeizufahren, das die Frau verkaufen wollte. Sie überlegte, wieviel Zeit das in Anspruch nehmen würde. Eine Stunde vielleicht, entschied sie. Kaum mehr. Dann mußte sie Brot kaufen. Für gewöhnlich buk ihr Mann Robert Brot selbst, aber in dieser Woche hatte er es nicht geschafft. Sie überquerte den Marktplatz und hielt sich links, wo die Bäckerei lag. Eine Glocke bimmelte, als sie die Tür öffnete. Sie war die einzige Kundin im Geschäft, und die Frau hinter dem Ladentisch, Elsa Person, würde sich später daran erinnern, daß Louise Åkerblom gut gelaunt zu sein schien und davon gesprochen hatte, wie schön es sei, daß der Frühling endlich käme.
Sie kaufte ein Roggenbrot und beschloß, die Familie zum Nachtisch mit Blätterteigtörtchen zu überraschen. Dann ging sie zur Bank zurück, wo sie auf dem rückwärtigen Parkplatz ihren Wagen abgestellt hatte. Unterwegs traf sie das junge Paar aus Malmö, dem sie gerade ein Haus verkauft hatte. Die beiden waren noch in der Bank geblieben, hatten den Abschluß perfekt gemacht, den Verkäufer bezahlt sowie die Kauf- und Kreditverträge unterzeichnet. Sie verstand die Freude der jungen Leute über das eigene Haus gut. Gleichzeitig aber machte sie sich Gedanken. Würden sie mit der Tilgung des Kredits und mit den Zinszahlungen klarkommen? Es waren harte Zeiten, kaum ein Arbeitsplatz war mehr sicher. Was würde geschehen, wenn er seinen Job verlor? Sie hatte die wirtschaftliche Situation des jungen Paares akribisch studiert. Im Unterschied zu vielen anderen hatten sie eine Verschuldung durch gedankenlose Kreditkartenkäufe vermieden. Und die junge Hausfrau schien zu den sparsamen zu gehören. Die beiden würden schon durchkommen. Wenn nicht, stünde das Haus bald wieder zum Verkauf. Vielleicht würde sie selbst oder Robert die Sache dann übernehmen. Es war gar nicht mehr so ungewöhnlich, daß sie im Verlauf weniger Jahre dasselbe Haus zwei- oder dreimal verkaufte.
Sie schloß das Auto auf und wählte am Funktelefon die Nummer des Büros in Ystad. Aber Robert war bereits nach Hause gegangen. Sie lauschte seiner Stimme vom Anrufbeantworter, die mitteilte, daß Åkerbloms Immobilienvermittlung über das Wochenende geschlossen bleibe, am Montag morgen um acht aber wieder öffne.
Zunächst wunderte sie sich darüber, daß Robert so zeitig nach Hause gegangen war. Aber dann fiel ihr ein, daß er sich an diesem Nachmittag mit ihrem Wirtschaftsprüfer treffen wollte. Sie sprach auf das Band: »Hej, ich schau mir nur noch ein Haus bei Krageholm an, dann fahre ich nach Ystad. Es ist jetzt Viertel nach drei. Um fünf bin ich zu Hause.« Dann klemmte sie das Mobiltelefon wieder in die Halterung. Es war ja möglich, daß Robert nach seinem Gespräch mit dem Wirtschaftsprüfer noch einmal ins Büro zurückging.
Sie nahm eine Plastikmappe vom Sitz und suchte die Geländeskizze heraus, die sie nach der Beschreibung der Witwe angefertigt hatte. Das Haus lag an einer Abzweigung zwischen Krageholm und Vollsjö. Es würde etwa eine Stunde dauern, hinauszufahren, Haus und Grundstück zu besichtigen und dann nach Hause zu kommen.
Sie überdachte ihren Entschluß noch einmal. Das kann warten, sagte sie sich. Ich nehme die Küstenstraße für die Heimfahrt, halte irgendwo und genieße die Aussicht aufs Meer. Ich habe heute schon ein Haus verkauft. Das muß reichen.
Sie summte den Anfang eines Psalms, ließ den Motor an und fuhr aus Skurup heraus. Als sie zur Abfahrt nach Trelleborg kam, änderte sie ihren Entschluß jedoch noch einmal. Weder am Montag noch am Dienstag würde sie dazu kommen, das Haus der Witwe zu besichtigen. Vielleicht wurde die Dame wütend und bot ihr Eigentum einem anderen Makler an? Das konnten sie sich nicht leisten. Die Zeiten waren schon schwer genug. Die Konkurrenz wurde immer härter. Keiner konnte auf angebotene Objekte verzichten, wenn eine Vermittlung nicht gerade völlig aussichtslos erschien. Sie seufzte und bog in die andere Richtung ab. Die Küstenstraße und der Strand mußten warten. Dann und wann schielte sie auf die Skizze. In der nächsten Woche würde sie einen Kartenhalter kaufen, damit sie nicht immer zur Seite schauen mußte, wenn sie die Fahrtroute überprüfte. Aber das Haus der Witwe konnte nicht so schwer zu finden sein, auch wenn sie die Abzweigung, die die Frau beschrieben hatte, noch nicht gefahren war. Die Gegend jedoch kannte sie in- und auswendig. Im kommenden Jahr würden sie und Robert das zehnte Jubiläum ihres Unternehmens feiern können.
Sie erschrak bei dem Gedanken. Schon zehn Jahre. Die Zeit war so schnell vergangen, allzu schnell. In diesen zehn Jahren hatte sie zwei Kinder geboren und zusammen mit Robert hart daran gearbeitet, das Immobilienbüro zu etablieren. Als sie anfingen, herrschten günstige Zeiten, das war ihr klar. Heute wäre es ihnen nicht mehr gelungen, auf den Markt zu kommen. Sie konnte zufrieden sein. Gott hatte es mit ihr und ihrer Familie gut gemeint. Sie würde noch einmal mit Robert darüber reden, ob sie nicht ihre Spenden für »Rettet die Kinder« erhöhen sollten. Natürlich würde er zögern, er sorgte sich mehr um ihre Finanzen als sie. Aber schließlich würde sie ihn überzeugen, wie immer.
Plötzlich merkte sie, daß sie sich verfahren hatte, und bremste. Die Gedanken an die Familie und die zehn vergangenen Jahre hatten bewirkt, daß sie die erste Abzweigung verpaßt hatte. Sie lachte, schüttelte den Kopf und schaute sich um, bevor sie wendete und denselben Weg zurückfuhr, den sie gekommen war.
Schonen ist eine schöne Landschaft, dachte sie. Weit und schön. Aber auch geheimnisvoll. Alles, was im ersten Augenblick so eben wirkte, konnte sich schnell in tiefe Senken verwandeln, in denen Häuser und Höfe wie isolierte Inseln lagen. Sie hörte niemals auf, sich darüber zu wundern, wie sich die Landschaft veränderte, wenn sie umherfuhr, um Häuser zu besichtigen oder möglichen Käufern zu zeigen.
Als sie Erikslund passiert hatte, fuhr sie auf den Seitenstreifen und kontrollierte die Wegbeschreibung der Witwe. Sie stellte fest, daß sie richtig gefahren war. Sie bog nach links ab, in die hügelige Straße nach Krageholm, die sich anmutig durch den Wald schlängelte. Durch die Laubbäume glitzerte der See. Sie war diesen Weg viele Male gefahren, aber er würde ihr niemals langweilig werden.
Nach ungefähr sieben Kilometern begann sie, nach der letzten Abzweigung Ausschau zu halten. Die Witwe hatte sie als einen Traktorweg beschrieben, ohne Schotterbelag, aber voll befahrbar. Sie bremste, als sie die Abfahrt erreicht hatte, und bog rechts ab. Das Haus sollte nach etwa einem Kilometer zur Linken liegen.
Nach drei Kilometern endete der Weg plötzlich, und ihr wurde bewußt, daß sie sich doch verfahren hatte. Für einen Augenblick war sie wieder versucht, direkt nach Hause zu fahren. Aber sie verwarf den Gedanken und wendete, um zur Straße nach Krageholm zurückzukehren. Ungefähr fünfhundert Meter weiter nördlich bog sie erneut nach rechts ab. Aber auch hier fand sich kein Haus, auf das die Beschreibung paßte. Sie seufzte, wendete und beschloß, sich nach dem Weg zu erkundigen. Kurz zuvor war sie an einem Haus vorbeigekommen, das hinter einer dichten Baumgruppe lag.
Sie hielt an, schaltete den Motor ab und stieg aus. Die Bäume rochen frisch. Sie ging auf das Haus zu, eines vom schonischen Typ, weiß gestrichen. Es hatte jedoch nur einen Giebel. Mitten auf dem Hof stand ein Brunnen mit einer schwarzgestrichenen Pumpe. Sie zögerte. Das Haus wirkte völlig verlassen. Vielleicht sollte sie doch lieber nach Hause fahren und hoffen, daß die Witwe es nicht übelnahm.
Ich kann wenigstens anklopfen, dachte sie. Das kostet nichts.
Bevor sie das Haus erreichte, kam sie an einem großen, rotgestrichenen Nebengebäude vorbei. Sie konnte der Versuchung nicht widerstehen, einen Blick durch die halb geöffneten hohen Türen zu werfen.
Was sie sah, wunderte sie. In dem Gebäude standen zwei Autos. Sie kannte sich in dieser Beziehung nicht besonders gut aus. Aber zweifellos handelte es sich um einen äußerst teuren Mercedes und einen nicht minder wertvollen BMW.
Jemand ist also zu Hause, dachte sie und setzte ihren Weg fort, hinauf zu dem weißgekalkten Haus.
Jemand, der eine Menge Geld haben muß.
Sie klopfte an die Tür, aber nichts geschah. Sie klopfte noch einmal, diesmal etwas lauter, erhielt jedoch wiederum keine Antwort. Sie versuchte, durch ein Fenster neben der Tür in das Haus hineinzuschauen, aber die Gardinen waren zugezogen. Sie klopfte ein drittes Mal, bevor sie um das Haus herumging, um festzustellen, ob es eine Hintertür gab.
Sie kam in einen verwilderten Obstgarten. Die Apfelbäume waren gewiß zwanzig, dreißig Jahre nicht mehr geschnitten worden. Unter einem Birnbaum standen einige halbverrottete Gartenmöbel. Eine Elster flatterte auf. Sie sah keine Tür und kehrte zur Frontseite des Hauses zurück.
Einmal klopfe ich noch, dachte sie. Wenn keiner aufmacht, fahr ich nach Ystad zurück. Ich habe immer noch Zeit, ein Weilchen am Meer zu verbringen, bevor ich nach Hause muß, um das Abendessen vorzubereiten.
Sie wummerte kräftig gegen die Tür.
Wieder keine Antwort.
Sie hörte nicht, sie ahnte nur, daß jemand den Hof hinter ihr betreten hatte. Hastig drehte sie sich um.
Der Mann war ungefähr fünf Meter von ihr entfernt. Er stand regungslos und beobachtete sie. Er hatte eine Narbe auf der Stirn.
Plötzlich bekam sie Angst.
Woher war er gekommen? Warum hatte sie ihn nicht gehört? Der Hof war mit Schotter ausgelegt. Hatte er sich herangeschlichen?
Sie ging ihm einige Schritte entgegen und versuchte, ganz normal zu klingen. »Entschuldigung, wenn ich störe«, sagte sie. »Ich bin Immobilienmaklerin und habe mich verfahren. Ich wollte nur nach dem Weg fragen.«
Der Mann antwortete nicht.
Vielleicht war er kein Schwede, vielleicht verstand er nicht, was sie sagte. Etwas Fremdes war in seinem Aussehen, er konnte wirklich Ausländer sein.
Plötzlich war ihr klar, daß sie in Gefahr war. Der regungslose Mann mit seinen kalten Augen machte ihr angst.
»Ich will nicht länger stören«, sagte sie. »Entschuldigung, daß ich hier so eingedrungen bin.«
Sie wollte loslaufen, blieb aber sofort wieder stehen. Der regungslose Mann war plötzlich lebendig geworden. Er zog etwas aus seiner Jackentasche. Zuerst konnte sie nicht erkennen, was es war. Dann sah sie, daß es eine Pistole war.
Langsam nahm er die Waffe hoch und zielte auf ihren Kopf.
Lieber Gott, konnte sie noch denken.
Lieber Gott, hilf mir. Er will mich umbringen. Lieber Gott, hilf mir.
Es war Viertel vor vier am Nachmittag des 24.April 1992.
2
Als Kriminalkommissar Kurt Wallander am Morgen des 27.April, einem Montag, ins Polizeigebäude von Ystad kam, war er wütend. Er konnte sich nicht erinnern, wann er zuletzt so schlechte Laune gehabt hatte. Die Wut hatte sogar Spuren in seinem Gesicht hinterlassen, in Form eines Pflasters auf einer Wange, wo er sich beim Rasieren geschnitten hatte.
Mürrisch antwortete er den Kollegen, die ihm einen guten Morgen wünschten. Als er sein Zimmer erreicht hatte, warf er die Tür hinter sich zu, legte den Telefonhörer neben den Apparat und setzte sich, um aus dem Fenster zu starren.
Kurt Wallander war vierundvierzig Jahre alt. Man hielt ihn für einen fähigen Polizisten, hartnäckig und durchaus scharfsinnig. An diesem Morgen aber fühlte er nur Wut und einen wachsenden Mißmut. Den Sonntag würde er am liebsten völlig vergessen.
Eine der Ursachen war sein Vater, der allein in einem Haus im Flachland vor Löderup wohnte. Wallanders Verhältnis zu ihm war immer kompliziert gewesen. Daran hatten die Jahre nichts geändert, weil der Sohn mit wachsendem Unbehagen erkennen mußte, daß er dem Vater immer mehr zu ähneln begann. Er versuchte, sich sein eigenes Alter wie das des Vaters vorzustellen, und der Gedanke verdarb ihm die Laune. Sollte auch er sein Leben als ein mürrischer und unberechenbarer Greis beschließen? Der plötzlich etwas tun konnte, was reineweg verrückt war?
Am Sonntag nachmittag hatte Kurt Wallander ihn wie gewöhnlich besucht. Sie hatten Karten gespielt und dann draußen auf der Veranda in der Frühlingssonne gesessen und Kaffee getrunken. Ohne Vorwarnung hatte der Vater mitgeteilt, daß er heiraten würde.
Kurt Wallander glaubte zunächst, sich verhört zu haben. »Nein«, hatte er gesagt. »Ich will nicht heiraten.«
»Ich spreche nicht von dir«, antwortete der Vater. »Ich spreche von mir.«
Kurt Wallander hatte ihn mißtrauisch angesehen. »Du bist fast achtzig Jahre alt. Du kannst nicht heiraten.«
»Ich bin noch nicht tot«, unterbrach ihn der Vater. »Ich mache, was ich will. Frag lieber, wen ich heirate.«
Kurt Wallander gehorchte. »Wen?«
»Kannst du dir doch selbst ausrechnen«, sagte der Vater. »Ich dachte immer, die Polizei wird dafür bezahlt, Schlußfolgerungen zu ziehen.«
»Du kennst doch gar keine Gleichaltrige. Du bist doch fast immer allein.«
»Ich kenne eine«, berichtigte der Vater. »Und wer sagt denn, daß man eine Gleichaltrige heiraten muß?«
Plötzlich wußte Kurt Wallander, daß es nur eine Möglichkeit gab: Gertrud Anderson, die fünfzigjährige Frau, die dreimal in der Woche kam und für den Vater saubermachte und seine Wäsche wusch.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!