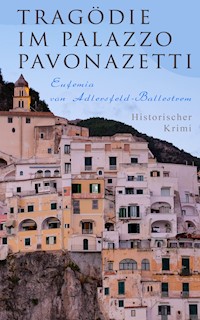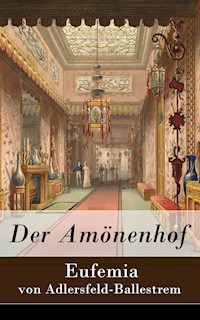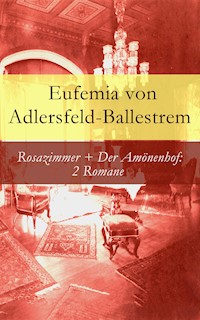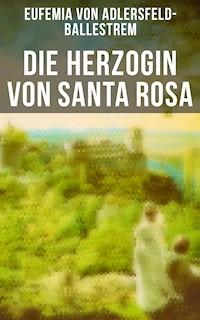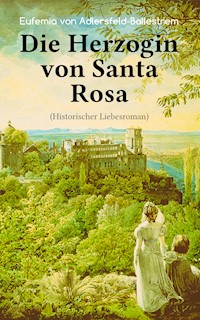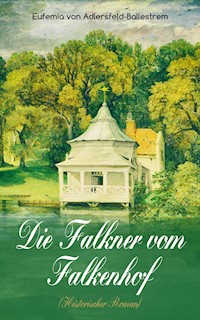Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Der Roman Die weißen Rosen von Ravensberg zeigt die große Erzählkunst der Bestsellerautorin Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem. Der Kriminalroman aus dem Adelsmilieu wurde erstmals 1896 veröffentlicht. Der Schlossherr von Ravensberg wird ermordet aufgefunden. Der Verdacht fällt schnell auf die Gräfin. Sie wird zu lebenslanger Haft verurteilt. 18 Jahre später werden neue Indizien entdeckt. Der Fall wird erneut aufgerollt. Die Ermittlungen bringen sehr überraschende Neuigkeiten ans Licht. Der Bestseller Die weißen Rosen von Ravensberg wurde zweimal erfolgreich verfilmt. Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem (geb. 1854 in Ratibor, gest. 1941 in München) war eine deutsche Bestsellerautorin. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zählte Adlersfeld-Ballestrem zu den beliebtesten deutschen Schriftstellerinnen. Ihre Inspiration bezog sie aus langen Reisen nach Italien. Der Roman Die weißen Rosen von Ravensberg ist eines der erfolgreichsten Werke von Adlersfeld-Ballestrem.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 621
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die weißen Rosen von Ravensberg
Die weißen Rosen von Ravensberg: Ein AdelskrimiEinleitungErster TeilZweiter TeilImpressumDie weißen Rosen von Ravensberg: Ein Adelskrimi
Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem
Einleitung
Es ist ein großes, weites, schmuckloses Haus, ein Haus mit stark vergitterten Fenstern und Toren, die einer Festung hätten angehören können – dennoch ist aber dies Haus kein Kastell, dem Feinde Trotz zu bieten, sondern nur ein Gefängnis mit vielen, vielen Zellen für Einzelhaft. Und in einer dieser Zellen stand ein junges Weib an dem schmalen, vergitterten Fenster und ließ die Luft über ihr lichtes, blondes Haupt hinwegstreichen und sah mit trocknen, traumverlorenen Augen hinaus auf das Fleckchen blauen Himmels, das sich dort zeigte, wo die hohe, graue Gefängnismauer endlich aufhörte – diese furchtbare Mauer, die in den Himmel zu wachsen schien.
Und das junge Weib schaute zur Höhe, bis die Augen sie schmerzten und sie den Blick herabsenken musste bis zu der Stelle, wo man Wilden Wein gepflanzt hatte, die graue Mauer zu verkleiden mit den Reizen einer immer schmückenden Natur. Dicht kletterten die Ranken empor an dem kahlen Gemäuer, und da es Herbst wurde, hatte sich das einst dunkle Grün der Blätter rot gefärbt.
„Wie mit Blut überrieselt“, sagte sie erschauernd und wandte sich ab. Doch nichts Freundlicheres als jene liebreich verhüllenden Ranken fand hier ihr Auge: kahle, weiß getünchte Wände, ein niederes, schmales und hartes Bett mit sauberem, aber grobem Linnen zeug, Becken und Krug auf einem Schemel, und in der Mitte der engen Zelle ein Tisch und ein Stuhl davor, und auf dem Tisch ein Tintenfass, Federn und ein paar Bogen billigen Papieres – das war alles.
Und in dieser Umgebung die Gestalt dieser Frau! Groß, schlank, gebietend, wie eine Königin, nicht wie eine Gefangene stand sie in dem engen Raume und schien ihn zu erhellen durch den Glanz ihrer Augen und den metallischen Schimmer ihres lichten Haares. Ihr schönes Gesicht war wohl schmäler geworden und blass durch die lange Haft, aber vielleicht darum noch schöner, und die Hände, welche sie jetzt mit einer heftigen Gebärde der Ungeduld zusammenschlug, waren lilienschlank, wohlgepflegt und edel geformt – es waren die Hände einer vornehmen Dame, die in ihrem Dasein vielleicht nie härtere Arbeit damit getan als höchstens in Gold und Seide gestickt, Spitzen geklöppelt oder Klavier gespielt. Wie aber kam diese Frau in die Zelle eines Gefängnisses für Einzelhaft?
„Es ist unerträglich!“, stöhnte sie.
Dann warf sie sich auf den Stuhl vor dem Tische und begann nervös mit dem Federhalter zu spielen.
Dabei fiel ihr Blick auf das Papier.
„Schreiben!“, murmelte sie verächtlich. „Sie wollen mich durch diese unerträgliche Einsamkeit und Langeweile zum Schreiben zwingen. Als ob ich mich jemals durch eine Zeile kompromittiert hätte! Schlafen ist besser!“
Und sie stand auf, um sich sofort wieder auf das Bett niederzuwerfen. Aber der Schlaf kam nicht am hellen Tage – kam er doch selten genug des Nachts zu ihr, wenn sie mit brennenden Augen und fieberndem Blut auf dem harten Lager lag und nicht einmal Licht machen konnte, um die Gedanken damit zu verjagen oder ihnen eine andere Richtung zu geben.
Die Gedanken!
„Wenn ich nur nicht denken müsste“, ächzte sie, setzte sich in ihrer Rastlosigkeit wieder auf und wühlte mit den schlanken, weißen Fingern in der üppigen, welligen Fülle ihres lichten Blondhaares. „Denken, immer denken, immer dasselbe denken! Dasselbe – –! Werde ich denn immer das eine nur denken müssen? Auch wenn ich heraus sein werde aus diesem Schreckensort von Gefängnis, wenn ich wieder frei sein werde, gefeiert, umworben, verwöhnt wie früher? Nein, nein, dann werde ich es vergessen haben. Ach! wenn ich doch heut schon vergessen könnte!“
Und wieder sank sie, das Gesicht mit den Händen bedeckt, auf das harte Pfühl zurück, den schönen Leib durchschauert wie von einem namenlosen Entsetzen.
Draußen auf den Steinfliesen des Korridors erschollen Schritte, Schlüssel rasselten, und die Tür der Zelle ward geöffnet. Doch die Gefangene sah nicht auf. Wer konnte es anders sein als der Aufseher, der ihr das spartanisch-einfache Mahl brachte oder die Frau hereinließ, die Wasser trug und frische Wäsche brachte? Und dennoch war es keine dieser Personen, sondern ein Priester mit weißem Haar, ein ehrwürdiger Mann, aus dessen Antlitz eine Milde und Güte leuchtete, wie die Kinder dieser Welt sie nur selten besitzen und noch seltener üben. In seiner Hand trug er ein kleines, schwarz gebundenes Buch und einen kleinen Strauß weißer Moosrosen, wie sie der Herbst noch so schön spendet – beides sollten Liebesgaben bedeuten, denn das Buch, das er jetzt leise und geöffnet auf den Tisch legte, war ein Andachtsbuch, und die weißen Rosen legte er auf die offenen Seiten, nicht als einen Gruß aus der Welt, der die Gefangene entrückt war, sondern als einen beredten Hinweis auf Gottes Größe, Güte und Allmacht. Über Buch und Blumen deckte er einen der auf dem Tisch liegenden Papierbogen.
Das leise Knistern des Papieres aber machte die Gefangene aufhorchen – das war nicht ihr Kerkermeister, der die Zelle betreten hatte! Unwillkürlich richtete sie sich empor, aufgestört aus ihrer dumpfen Träumerei, und stand Aug' in Aug' dem Priester gegenüber. Da richtete sie sich hoch auf, ein seltsamer Zug, gemischt aus Hochmut, Spott und Zorn, flog um ihren schönen, stolzen Mund, und ihre Augen sprühten.
„Wer hat Sie zu mir geschickt?“, fragte sie mit verletzender Kühle, „ich habe Sie nicht rufen lassen!“
Aber ein Gefängnisgeistlicher besucht die Zellen für Einzelhaft nicht in der Hoffnung auf höfliche Reden und demütiges Entgegenkommen; – Demut und Reue sind die Gaben, die er mitbringt, um sie in die Herzen zu pflanzen, welche hier an diesem Ort oft hoffnungslos versteint und verstockt zu finden sind. Und darum nickte der Priester auch nur zu den kalten Worten.
„Nein, meine Tochter, Sie haben mich nicht rufen lassen“, sagte er dann mild, „aber ich habe auf Ihren Ruf gewartet, Sehnsucht im Herzen, und ich habe Ihren Ruf unter heißen Gebeten erfleht – vergebens!“
„So scheint es“, erwiderte sie noch um einen Hauch kühler und unnahbarer.
Da trat er einen Schritt näher an sie heran. „Wenn ich trotzdem zu Ihnen komme, meine Tochter“, sagte er, „so geschieht es, weil ich als verordneter Priester dazu verpflichtet bin, weil mein Gewissen und mein Herz mich zu Ihnen treiben. Und als Priester ist es meine heilige Pflicht, vor Sie hinzutreten und Sie zu mahnen an die letzten Dinge, deren wir stets gewärtig sein sollen –“
„Ich danke Ihnen“, unterbrach sie ihn kalt und mit der Kopfbewegung einer Königin, die einen Untertan entlässt. „Sobald ich das Bedürfnis nach geistlichem Zuspruch empfinden sollte, werde ich Sie rufen lassen, Herr Pfarrer. Ich fürchte nur“, setzte sie spöttisch hinzu, „dass ich dann diesem Hause und mithin auch Ihnen schon weit entrückt sein werde.“
„Das fürchte ich auch“, erwiderte der Priester ernst und traurig. „Dennoch aber, meine Tochter, muss ich versuchen, Ihr Herz dem Ewigen zuzuwenden, wie Gott es von uns fordert zur ewigen Seligkeit unserer unsterblichen Seele. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Heile gereichen, sagt der Prophet. Nun denn, meine Tochter, öffnen Sie Ihr Herz, damit es sich zu Gott wende, und auch Ihnen kann noch zum Heile gereichen, was Ihrem kurzsichtigen, irdischen Auge als der Gipfel des Elends erscheint. Denn Sie dürfen nicht vergessen, dass die irdische Gerechtigkeit Sie zum Tode verurteilt hat!“
„Eine bloße Form, Herr Pfarrer“, erwiderte sie kühl und unbewegt, „eine Form, welche in ihrer plumpen Machart gut und wirksam sein mag für jene Gefangenen, deren Bildung nicht so weit reicht, um unter der Hülle des Fürchtemachers das harmlose Geschöpf zu erkennen. Mich aber kann diese Form aus dem Apparat juristischen Humbugs weder erschrecken noch täuschen. Mein Verteidiger war ein Schwachkopf, und der Staatsanwalt schmetterte ihn daher mit seinen Gemeinplätzen als öffentlicher Ankläger einfach nieder – aber wer hat mich bei dieser Rede zittern oder erbleichen sehen? Ich habe nur dazu gelächelt!“
„Leider, meine Tochter, leider taten Sie's!“
„Leider?“
„Ja, denn es hat Ihre Sache sehr verschlimmert.“
Jetzt lachte die Gefangene wirklich – ein leises, melodisches Lachen, das aber nicht von Herzen kam.
„Ah, Sie meinen, weil der Staatsanwalt es bemerkte und deshalb in seine Rede einen schwungvollen Satz über meine Verstocktheit, die ein Beweis meiner Schuld sein sollte, einflocht? Und das sollte mich erschrecken?“
Mit einem unsäglich traurigen Blick sah der alte Priester auf das schöne junge Weib.
„Ich verlasse Sie wieder, meine Tochter“, sagte er dann seufzend, „denn Sie würden in dem jetzigen Zustand Ihres Herzens nicht nur allein nicht auf mich hören, sondern meinen Worten auch jenen kühlen Trotz entgegenstellen, der Ihrer Sache vor dem irdischen Richter so geschadet hat, dass ein Gnadenspruch wohl kaum für Sie zu erwarten ist. Ich gehe deshalb jetzt wieder und lasse Ihnen ein Buch zurück, dessen Inhalt Ihr Herz vielleicht mehr bewegen wird als mein gesprochenes, armes Wort. Wollen Sie mir versprechen, in diesem Buche zu lesen, was ich für Sie darin aufgeschlagen habe.“
„Vielleicht tue ich's nicht, vielleicht aber doch“, erwiderte sie nachlässig.
„Wohl, so sei es, denn Sie wissen nicht, wie oft Sie die Nacht noch kommen sehen werden, der bisher stets ein Morgen folgte!“, rief der Priester ernst. „Schon steht die Sonne tiefer, und schnell verrinnt Stunde um Stunde. Wenn dann die ewige Nacht für Sie gekommen ist, dann ist es zu spät, zu bereuen und Gottes Barmherzigkeit zu erbitten. Halt – nicht dieses überlegene Lächeln, meine Tochter“, fuhr er mit erhobener Stimme und abwehrender Hand fort, als sie, die Achsel zuckend, den lieblichen Mund zu schrecklicher Lustigkeit verzog, „nicht dies überlegene Lächeln, das Ihre Waffe ist gegen die Schmerzen Ihrer Seele, gegen die Todesangst des Weltkindes, gegen die irdische Gerechtigkeit! Aber Sie täuschen mich nicht damit, denn ich bin's geübt, die Hieroglyphen zu entziffern, die das menschliche Antlitz mir in meinem schweren Berufe zu raten gibt. Und ich lese auch in Ihrem Auge Schuld und Todesfurcht – Schuld, trotz Ihres nicht einen Moment schwankenden Leugnens, und Todesfurcht trotz Ihrer gemachten Gleichgültigkeit gegen ein Urteil, das schon starke Männer zu Boden geschmettert und bezwungen hat.“
„Feiglinge“, warf sie ein, unbewegt, ruhig, als spräche sie über das Gleichgültigste. „Ich kann Sie, Herr Pfarrer, nicht verhindern, in meinen Zügen zu lesen, was Ihnen beliebt, aber Sie fangen mich nicht in dieser Schlinge, wie ich mich in keiner anderen habe fangen lassen. Die ganze Anklage gegen mich ist absurd, das Urteil noch mehr, und es kann jeden Augenblick der mich auf freien Fuß stellende Gnadenerlass des Königs eintreffen, bei dem mein Name hoch angeschrieben steht. Wozu also die Aufregung?“
Da wandte der Priester sich ab.
„Gott sende Ihnen sein Licht“, sagte er, „denn Sie sind noch nicht reif, sein Wort zu hören. Lesen Sie, was ich Ihnen bezeichnet habe, dort in jenem Buch – vielleicht, ehe es ganz Abend wird, bin ich wieder bei Ihnen, und Sie sehen durch die zerrissenen Nebel der Weltlust einen Strahl des Lichtes, das auch dem Sünder verheißen ist, wenn er Buße tut.“
Und damit wendete er sich ab und pochte an die Tür, die alsbald für ihn aufgeschlossen wurde; doch kaum hatte der Priester noch die Schwelle überschritten, so ward auch schon wieder ein anderer eingelassen, den der Direktor des Gefängnisses selbst bis an die Tür der Zelle geleitet hatte. Dieser andere war ein noch junger Mann, um zehn Jahre älter vielleicht als die Gefangene und ihr so ähnlich, wie eben nur Geschwister sich ähnlich sehen können. Er war als Mann fast ebenso schön wie sie als Weib, und beide trugen die Zeichen einer edlen Geburt unverkennbar in ihren Zügen und ihrem Wesen ausgeprägt. Blass vor innerer Erregung betrat er die Zelle, und wie sie ihn erblickte, flog die Gefangene ihm mit einem Jauchzen der Freude entgegen.
„Bruder Ludwig! Bruder Ludwig!“, lachte sie glückselig, mit geöffneten Armen und jenem Tonfall der Stimme, der auf eine zur Unerträglichkeit gesteigerte Spannung der Nerven deutet. „Kommst du endlich? Bringst du mir die Freiheit?“
Was auch seine Antwort sein mochte, sie wurde ihm erspart. Denn als die Gefangene ihm entgegentrat, die wenigen Schritte bis zur Tür in fliegender Eile zurücklegend, stieß sie an den Bogen Papier, den der Priester über die Seite des Buches gebreitet, die er für sie aufgeschlagen und mit dem Zartgefühl seines warmen Hirtenherzens mit Rosen bedeckt hatte. Und als das Papier von ihrer schnellen Bewegung herab flog, wandte sie unwillkürlich den Blick auf das Buch und die Blumen – da überzog Leichenblässe ihre Wangen, und mit entsetztem Blick streckte sie beide Hände aus wie abwehrend gegen die zarten, stark duftenden Blüten.
„Die weißen Rosen von Ravensberg!“, schrie sie auf, dass es gellte, und dann, mit einem scheuen, heiseren Flüstern, wiederholte sie: „Die weißen Rosen von Ravensberg! Und die Sage geht, dass weiße Rosen den Männern, Frauen, Töchtern und Söhnen aus dem Hause der Ravensberg den nahen Tod ankündigen. Wie kamen die weißen Rosen auf seine Decke, als – als er starb? Sie waren dort, ich habe sie gesehen – er griff nach ihnen im letzten Augenblicke. Es war im Mai. Und jetzt will's Herbst werden – –“
Mit kalter, bebender Hand, scheu und doch wie magnetisch angezogen griff sie nach den schneeweißen Moosrosen und las mechanisch die ersten Worte der aufgeschlagenen Seite: „Die Gebete für einen Sterbenden. Der 110. Psalm: ›Aus der Tiefe rufe ich zu dir; Herr, erhöre meine Stimme‹ –“
Sie brach jäh ab und wandte ihr blasses Antlitz mit den weit geöffneten starren Augen dem Manne zu, der schweigend und traurig hinter ihr stand, den sie so Freude jauchzend begrüßt und urplötzlich vergessen hatte – um ein paar weißer Rosen willen.
„Muss ich wirklich sterben, Ludwig?“, fragte sie leise, herzzerreißenden Jammer in der Stimme, mit gerungenen Händen.
Der Mann seufzte tief auf und trat nahe zu ihr heran. „Ja“, sagte er mit Überwindung, aber fest. „Es ist alles vorbei, jede Hoffnung dahin. Der König macht von seinem Rechte, Gnade zu üben, keinen Gebrauch und lässt der Gerechtigkeit freien Lauf.“
Da sank das schöne, stolze Weib, das noch vor einer Viertelstunde so trotzig auf ihre Überlegenheit gepocht, so fest an eine andere Lösung geglaubt, wie gefällt in die Knie und rang die Hände über ihrem Haupt.
„Sterben, sterben! Und ich bin noch so jung!“, stöhnte sie.
„Auch dein Gatte war es“, sagte er leise, so leise wie ein Hauch, aber sie hatte es doch verstanden. Wie getroffen fuhr sie empor und trat einige Schritte zurück.
„Ich tat es nicht“, flüsterte sie heiser, aber mit schrecklicher Deutlichkeit.
Der Mann trocknete sich mit dem Tuche den kalten Schweiß von der Stirn. „Denk an die Ewigkeit, Marie! In wenig Stunden wirst du vor Gott stehen, und –“
„Sterben?“, unterbrach sie ihn entsetzt. „Wirklich sterben, und so bald schon? So bald –“
„Es ist eine besondere königliche Gnade, dass ich es dir vor der Bekanntmachung der Resolution des Monarchen mitteilen durfte, um dich vorzubereiten. Meine Mission – die schwerste meines Lebens – den König um Gnade für dich zu bitten, ist gescheitert. Zwar hat mein Name mir die Privataudienz verschafft, um die ich bat, und Seine Majestät waren gnädig wie nur je und gütig wie ein Vater und hat jedes Einzelne mit mir beraten und besprochen – doch in dem einen Punkte blieb er fest: Die Gerechtigkeit soll nicht behindert werden, die Schuldige zu treffen. Hättest du freimütig deine Schuld bekannt, so war alles bereit, für eine Verirrung deinerseits einzutreten; du aber leugnetest mit solch verstocktem Herzen, zeigtest dich so fühllos, so oft dein Opfer genannt wurde, und trotz der erdrückenden Wucht der Zeugenaussagen leugnetest du mit solch dreister Stirn, dass deine Richter und die öffentliche Meinung sich empört von dir abwendeten als von einem Ungeheuer in menschlicher Gestalt. Hier Gnade zu üben vermochte der König nicht, denn sein Volk hätte ihn, sehr mit Recht, einer Parteinahme für den Adel bezichtigt, der durch dich ein Brandmal erhalten hat, das nur dein Tod auszulöschen vermag – ja, deine Begnadigung hätte das Murren des Volkes erweckt. Und so ist alles vorbei! Ich komme, Abschied von dir zu nehmen, Marie!“
Er reichte ihr seine Hand. Aber sie sah diese Hand nicht. Stieren Blickes rang sie die schmalen, weißen, durchsichtigen Hände ineinander, und über ihre Lippen zitterte es kaum hörbar: „Sterben! Sterben! Oh, die weißen Rosen von Ravensberg!“ Da trat der Mann hart vor sie hin.
„Ja, sterben“, wiederholte er mit starker Stimme. „Marie, zeige, dass du eine Tochter unseres Stammes, dass du eine Erlenstein bist. Denn es hat noch niemals ein Erlenstein vor dem Tode gezittert, und keiner ist mutlos durch die dunkle Pforte in die Ewigkeit getreten. Gott ist ein strenger Richter, aber er ist auch unendlich gütig und mild, er wird aus deinem Herzen die Goldkörner heben, die wir Menschen mit unserem schwachen Auge nicht gefunden haben und die dennoch für dich das Mittel werden können zum ewigen Leben. Es bleibt dir noch Zeit genug, zu bekennen und zu bereuen. Und vergiss auch nicht, dass es auf Erden noch ein Band für dich gibt, das zu lösen ist: dein Kind!“
Sie fuhr auf, wie getroffen.
„Mein Kind!“, rief sie, „wo ist mein Kind?“
Es war das erste Mal, dass sie nach ihrem Kinde rief, seit sie gefangen war.
„Dein Kind ist wohlgeborgen“, sagte er traurig. „Ich habe wohl daran gedacht, es dir zu bringen zum letzten Lebewohl, aber ich wollte das zarte Geschöpf den Gefahren einer langen Reise nicht aussetzen – solch ein leise flackerndes Lebenslicht ist leicht verlöscht. Und so sage ich dir denn zum Trost für den Moment, wo dein Herz sich um das Kind beunruhigen könnte – es ist in meiner Obhut und wird als mein Kind gelten. Es wird durch die Gnade des Königs meinen Namen tragen, damit sein unschuldiges Dasein nicht von Kindheit an mit dem Kainszeichen gebrandmarkt werde und das junge Leben vergifte. Meine Frau und ich verlassen Deutschland für Jahre – im Süden soll unser Kind geboren werden, und dann wird das deine sein erstes Lebensjahr überschritten haben. Wir werden dann ein Zwillingspaar haben, denn unten kennt uns kein Mensch, und wenn wir zurückkehren, wird der Unterschied des einen Jahres nicht bemerkbar sein. So ist unser Plan, und wir haben uns gelobt, dem Kinde liebende, pflichtgetreue Eltern zu sein, als ob es unser eigen Fleisch und Blut wäre, und es zu vergessen, welches unser eigenes und welches dein Kind ist. Und es soll nie erfahren, wer seine Mutter war, wenn auch der ehrliche, fleckenlose Name seines Vaters dabei mit versinken muss in das Meer ewigen Vergessens. Und wenn nichts dein Herz berührt, Marie, so muss das es treffen wie ein zweischneidiges Schwert: dass dein Kind den Namen seines liebenswerten Vaters nicht kennen darf – um deinetwillen. Und nun leb wohl!“
„Leb wohl“, wiederholte sie mechanisch, den Blick auf den weißen Rosen, als seien diese ein Magnet, der alle ihre geistigen Kräfte im Bann hielte.
Doch ehe er an die Tür klopfte, trat er noch einmal vor sie hin.
„Und du hast mir nichts, wirklich nichts zu sagen, Marie?“
„Ich tat es nicht!“, sagte sie hastig und ohne aufzusehen.
„Bedenk es, Marie! Es ist vergebens, zu leugnen, denn jede Hoffnung ist dahin für dich. Nichts kann dich mehr retten, nichts, nichts! Und morgen früh, wenn die Sonne aufgeht, bist du schon jenseits ihres ewigen Lichtes.“
„Morgen schon?“, schrie sie auf, und ein trostloser, gehetzter Blick aus ihren Augen irrte zu dem Fenster. „Die Sonne ist am Untergehen – und nur noch eine Nacht?“
„Nur noch eine Nacht, deine letzte“, wiederholte er.
Nervös tasteten ihre Hände nach den weißen Rosen.
„Die Todesrosen von Ravensberg“, flüsterte sie. „Nein, es ist keine Hoffnung mehr. Alles dahin, alles! Unschuld, Reinheit, Ehre, Liebe – nichts ist geblieben.“
Und sie sprang auf und drückte die Hände gegen die pochende Schläfe und irrte umher in der engen Zelle.
„Nichts!“, wiederholte sie, „nichts als Nacht und Grauen und Todesangst. Und das ist das Ende! Wie soll es geschehen?“, fragte sie scheu und tonlos, plötzlich vor dem Bruder stehen bleibend. Und er verstand sie und wendete sich erschüttert ab. Doch auch sie hatte verstanden.
„Also so?“, fragte sie kaum hörbar. Und dann sprach sie laut und gleichgültig: „Ja, ich habe davon gelesen und im Theater immer weinen müssen, wenn Schillers Maria Stuart zur Hinrichtung ging und Leicester oben alles mit anhörte. Und wer wird bei mir weinen? Leicester wohl nicht, trotzdem er mich in den Tod getrieben! Erst Samt und Seide und Zobel und Juwelen, und jetzt –? Ein Block und ein Beil und ein Armesündersarg! Und ich bin immer noch so jung! Werdet ihr mich in eine Gruft legen oder muss ich hinter der Kirchhofsmauer schlafen?“
„Marie! Marie!“, bat er leise. „Du musst nicht so irre reden. Fasse dich! die Zeit verrinnt!“
„Ja, die Sonne will untergehen“, erwiderte sie und trat an den Tisch, um wieder die weißen Rosen aufzunehmen. „Noch eine kurze Stunde, und es ist Nacht – ewige Nacht. Ob es ein Jenseits gibt?“
„Es ist uns verheißen worden vom Heiland selbst, Marie!“
„Aber man hat keinen Begriff davon. Ist es ein neues Leben, in dem es keine Schuld, kein Elend und kein Ende gibt? Und werden wir dort alle die wiedersehen, die vorangingen durch die dunkle Pforte? Und werde ich ihm dort begegnen, und wird er als Ankläger wider mich auftreten?“
„Es bedarf vor Gott keines Anklägers. Er hat deine Tat gesehen.“
„Meine Tat!“, wiederholte sie. „Wer sagt mir, ob mein Tod diese Tat sühnt?“
„Wenn du sie bereuest – gewiss!“
„Reue! Was ist Reue? Oh, ich weiß, das Bedauern über eine begangene Sünde. Dann habe ich keine Reue. Und Gewissensbisse? Ich bin zu all diesen Gefühlen noch nicht gekommen, weil ich gewartet habe, gewartet auf die Stunde der Erlösung und der Freiheit – umsonst, umsonst. Kannst du mir nicht zur Flucht verhelfen?“, fügte sie flüsternd, heimlich hinzu mit stockendem Atem und blitzenden Augen.
„Flucht?“, lächelte er mitleidig. „Flucht aus diesen Mauern? O Schwester, unmöglich!“
„Unmöglich für dich – ich glaube es“, fuhr sie erregt fort, „aber er, er hätte es für mich tun können, und er hätte mich befreien müssen, denn ich habe es doch für ihn getan, um ihn! Und kein Wort von ihm diese ganze lange Zeit, keine Zeile, keine Botschaft –“
„Marie, Marie – so ist es wahr, was der Ankläger als wahrscheinlich hinstellte – dass du um einen anderen die dunkle Tat vollbrachtest?“
„Das hab' ich nicht verraten – nicht einen Moment, nicht mit einem Atemzuge“, fiel sie rasch ein.
„Nein, du hast seinen Namen wohl zu verschweigen gewusst –“
„Freilich, jetzt könnte ich mich rächen und diesen Namen nachträglich durch den Schmutz schleifen!“, rief sie heftig, doch schnell erlosch dieses Feuer wieder in ihren Augen. „Es würde nicht viel helfen, denn man würde ihm nichts beweisen können. Er ist schuldlos – denn was kann er dafür, dass er mir unbewusst zum Versucher wurde? Nein – dieser Name wird begraben mit mir in dem Armensündersarg –“
Ein Geräusch an der Tür mahnte den Mann zum Abschiede.
„Leb wohl, Marie“, sagte er. „Möge Gott dir ein gnädiger Richter sein.“
„Bleib!“, schrie sie auf, „lass mich nicht allein – die Sonne geht unter, und es wird finster – und dort, dort in der dunkeln Ecke im Bett, dort liegt er mit dem blassen Totengesicht. Bleib – ich fürchte mich vor ihm. Siehst du das kleine, blutige Mal dort an seiner Schläfe?“, flüsterte sie scheu. „Von diesem blutigen Male habe ich Nacht für Nacht träumen müssen. Ist das Reue? Bleib – o Gott im Himmel, bleib!“
Doch schon ward die Tür geöffnet – noch ein letzter Blick, und erschüttert, verhüllten Angesichts verließ der Graf von Erlenstein seine unglückliche Schwester, die noch vor Monden so viel gefeierte und umworbene Freifrau von Ravensberg, die jetzt in ihrer engen Zelle unter der furchtbarsten Anklage zum ersten Mal zusammenbrach – jung und schön, und blühend wie eine Maienrose, trotz monatelanger Kerkerhaft.
Und der Mond, der in stiller Nacht emporstieg am sternenhellen Himmel, er sah auch hinein in die enge Zelle, wo ein greiser Priester vor einem schluchzenden jungen Weibe stand und ihr von Gottes Gnade und Allgüte sprach, unermüdlich, voll Milde, Mitleid und heiligen Feuers. –
Des Mondes sanftes Licht verblich allmählich in der opalbleichen Dämmerung des neuen Tages; und als ein siegender Lichtstrahl im Osten die Ankunft der Sonne verkündete, da begann ein Glöckchen leise, klagend zu läuten, und in der Zelle droben hob der Priester an, die Gebete für Sterbende zu beten.
Mond und Sterne waren ganz verblasst. Das Frührot tauchte die grauen Gefängnismauern wie in Purpur und Gold. Die Sonne war emporgestiegen, einen glorreichen Tag verheißend. Das Glöckchen war verstummt. Und als die Tageskönigin leuchtend zur Höhe stieg und über die graue Mauer ihr siegendes Licht warf, da trug man auf einer Bahre einen schwarz getünchten, schmucklosen Sarg hinweg. Drinnen in der Zelle nahm der Graf von Erlenstein in Empfang, was man ihm jetzt bedingungslos aushändigte: einen Brief, ein Spitzentuch, das sie zuletzt über dem blonden Haar getragen, dies schöne, seidenweiche Haar selbst, eine kleine Schatulle, mit Gerichtssiegeln verschlossen, die die Preziosen enthielt, die seine Schwester bei ihrer Verhaftung getragen, und – einen kleinen Strauß weißer Moosrosen, die sie bis zuletzt in den Händen gehalten und in Purpurrosen verwandelt hatte.
Der Priester aber berichtete aufs Tiefste bewegt, wie sie gestorben war – reuig und gefasst, ohne Todesfurcht, aber demütig und ergeben – ein Sühnopfer für schwere Schuld.
„Requiescat in pace“, schloss er, und wie er es sagte, hob das Glöcklein noch einmal an und zitterte seine leisen, klagenden und wimmernden Klänge in die Morgenluft des goldigen Herbsttages hinein, läutete einen kurzen Puls und verstummte dann.
Das war die Mahnung zur Fürbitte für die arme Seele, die jetzt schuldbeladen vor Gottes Throne stand.
Verdorben und gestorben – – –
Erster Teil
Hoch im Norden Deutschlands, dicht am Meer, liegt Schloss Hochwald. Seinen Hintergrund bilden herrlich bestandene, wildreiche Wälder von gemischten Hölzern, meist Eichen und Buchen, während die dunklen Föhren, vereinzelt oder gruppenweise darin verteilt, nur dazu da zu sein scheinen, um den Schattierungen des Waldes einen besonderen Reiz zu verleihen. Die Ausläufer dieser Wälder sind sehr geschickt zum Schlosspark umgewandelt worden, und in der Tat, einen Naturpark von großartigerer Schönheit als Schloss Hochwald besitzt wohl kein zweiter Herrensitz im ganzen Deutschen Reiche. Man hat dem Wald- und Heideboden vor der Parkfront des Schlosses einen herrlichen smaragdgrünen Rasenplatz abgewonnen, in dessen Mitte eine der gewaltigsten Eichen, mit Runenschriften in der brüchigen Rinde, sich erhebt, während eine tief dunkelgrüne Föhre mit breitem Geäst, kerzengerade gewachsen, dicht vor dem Schlosse einen köstlichen Tannenduft verbreitet, der sich mit dem Rosenflor, welcher hier besonders gepflegt wird, auf das angenehmste vermischt.
Das Schloss selbst hat so viele Stile in seinem Bau aufzuweisen, dass man es einfach stillos nennen kann. Vielen Leuten ist das lieber als das langweilig und regelmäßig Stilvolle, mit dem heutzutage so viel Unfug getrieben wird. Kurz Schloss Hochwald war ein vielgetürmter und beerkerter Bau dessen älteste Teile aus dem 13. Jahrhundert stammten und nur noch einen Flügel bildeten, während der Mittelbau aus dem 16. Jahrhundert die spitzen, schiefergedeckten Mansardendächer mit den gleichfalls zugespitzten Türmen der Schlösser von Fontainebleau und St. Germain zeigte. Dass sich zwischen diesem eigentlichen Hauptbau und einem überreich mit Stuck dekorierten heitern Rokokopavillon ein Bankettsaal im reinsten Tudorstil der englischen Gotik drängte, mit spitzenartig durchbrochenen Strebe- und Dachpfeilern, erfüllte Sachverständige zwar mit Kopfschütteln, Missbilligung und Entrüstung, sah aber trotzdem sehr malerisch aus.
Auf der Seeseite spülten die Wellen direkt an die schräg abfallenden Mauern des Schlosses, doch brach die Brandung sich schon an den spitz aus dem Wasser ragenden Felsenriffen, während nach rechts das Terrain sich verflachte. Eine breite Terrasse, mit direkt ins Meer führender Treppe an der Nordseite des Schlosses, gab für sonnige Sommertage einen köstlich-kühlen Aufenthalt mit dem Blick auf die unendliche Fläche, deren Wellen im immerwährenden Einerlei kamen, sich rauschend und zischend an den Riffen und an der weißen Marmortreppe brachen und ihren Gischt oft heraufschleuderten bis zu den Füßen derer, die oben saßen und sich nicht sattsehen konnten an dem einzigen Schauspiel und dabei wohlig die kühle, klare und reine Seeluft einatmeten.
Das Geschlecht, das auf dem Schlosse erblühte, waren die Grafen von Hochwald, auch die Seegrafen genannt, denn sie hatten als Dynasten an der Küste gesessen seit undenklichen Zeiten und den Wechsel der Tage sattsam durchgemacht. Die kleine Souveränität, die ihrem Ahn vorzeiten der böse König Abel von Dänemark verliehen, weil er ihm geholfen hatte, den König Erik Plochpenning, seinen Bruder, zu erschlagen, war natürlich nur ein leerer Begriff, von dem der Besitzer auch nichts weiter hatte als eine eigene Münze. Später war ein Hochwald so klug, seine Souveränität gegen großes Gelände zu vertauschen, ehe er ohne dieses mediatisiert wurde, und in neuester Zeit, bei Gelegenheit einer Thronbesteigung und in Anbetracht dessen, dass die Hochwalds trotz ihrer unzweifelhaft bestandenen Souveränität vermöge ihres Tauschvertrages es verscherzt hatten, jemals in die Zahl der Reichsunmittelbaren und Ebenbürtigen aufgenommen zu werden, ward ihrem Hause der Fürstentitel nach dem Rechte der Erstgeburt nebst einer Hofcharge verliehen. Das war alles ganz schön und gut für den ersten Fürsten und Vater des jetzigen, der auch beständig in der Residenz lebte und seine Revenuen nicht nur voll, sondern übervoll verzehrte. Dadurch hatte das Haus Hochwald einmal eine kritische Zeit durchzumachen. Aber die schlimme Zeit ging vorüber, man sagte, durch Vorschüsse aus der königlichen Schatulle, kurz, als der alte Fürst nach mehreren Jahren völliger Zurückgezogenheit starb, waren die finanziellen Angelegenheiten Hochwalds so geordnet als je zuvor.
Der Sohn des ersten Fürsten von Hochwald hatte seine Laufbahn sehr jung im Heer, und zwar bei der Leibgarde, begonnen und galt nicht nur für einen geistig bedeutenden und wahrhaft herzgewinnenden, liebenswürdigen jungen Mann, sondern auch für äußerlich schön und für einen flotten, schneidigen und guten Kavallerieoffizier, der sich in den höchsten und hohen Kreisen der Residenz einer wohlverdienten Beliebtheit erfreute. Und in der Tat hatte er etwas so Sonniges im Wesen, das die Herzen zu ihm hinzog; selbst wenn er auch ohne Titel schlichtweg Marcell Hochwald geheißen hätte, seine Gesinnungen, seine freie, offene und ehrliche Natur würden ihn doch zum vornehmen Mann gestempelt haben.
Als er sein Erbe dann antrat und dennoch erklärte, der Armee treu bleiben zu wollen, begrüßte man diesen Entschluss mit freudiger Genugtuung: umso größer ward daher das Erstaunen, Bedauern und Kopfschütteln, als er kurz darauf plötzlich ernst und zurückhaltend wurde, als es sich wie ein schwarzer Schleier auf sein sonniges Wesen legte und er ein paar Monate später den weißen Koller auszog und den Adlerhelm einpackte – kurz, den Abschied nahm. Über die Gründe, die ihn dazu bewogen, sprach er sich nur im Allgemeinen aus, selbst seine nächsten Bekannten und Verwandten erfuhren nichts Bestimmtes, nichts Einleuchtendes, denn die Antwort des Fürsten auf die an ihn heranstürmenden Fragen, dass er sich vollständig dem Landleben und genealogisch-heraldischen Studien, die ihn stets sehr angezogen, widmen wolle, fanden nur ungläubiges Kopfschütteln, weil der Entschluss zu schnell, die Wandlung seines Wesens zu plötzlich gekommen war.
Aber jedes Staunen nimmt ein Ende, wie alles in der Welt. Die Leute beruhigten sich nach und nach über „die Verrücktheit des Fürsten Hochwald“, weil andere Dinge passierten, die ihr Interesse in Anspruch nahmen und ihre Zungen in Bewegung setzten, und nach Jahr und Tag wunderte man sich höchstens über das Einsiedlerleben des jungen Magnaten, der nur einige Male im Jahre ein paar intime Bekannte zur Jagd in seinen herrlichen Wäldern einlud, und nur dann in der Residenz gesehen wurde, wenn fremder fürstlicher Besuch bei Hofe seine Anwesenheit dort erforderte, um seines Erbamtes als Oberstjägermeister seiner Provinz zu warten. Den bald nach seinem Ausscheiden aus der Armee ausgebrochenen Krieg hatte er bei seinem früheren Regiment mitgemacht und dabei eine nicht gewöhnliche, fast an Todesverachtung grenzende Tapferkeit bewiesen, die andere, sehr tapfere Offiziere für unvernünftig und zwecklos erklärten, während sie beim gemeinen Mann Begeisterung und Nachahmung erregte. Ein Säbelhieb im Gefecht streckte ihn wochenlang auf das Krankenbett, doch auch im größten Wundfieber verriet sein Mund nichts, was über die Wandlung seines Wesens Aufklärung geben konnte, und nach dem Feldzuge zog er, geschmückt mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse, in sein Schloss am Meere zurück, stiller, ernster denn je; doch verhinderte seine glücklich angelegte, sonnige Natur, dass er hart wurde und schroff und wunderlich in seiner Einsamkeit.
Fürst Hochwald hatte nun schon zwanzig Jahre sein stilles Leben geführt, unterbrochen von weiten, einsamen Reisen, die ihn monatelang fernhielten von der nordischen, meerumspülten Heimat. Er war jetzt fast fünfundvierzig Jahre alt – ein Mann in den besten Jahren, aber allein.
Es war im zeitigen Frühjahr. Am Meere hoch im Norden rasten die eisigen Stürme noch durch das Laubholz und umpfiffen unheimlich das einsame Schloss. Diesem Kampf des Winters mit dem Frühling war, wie fast alljährlich, Fürst Marcell Hochwald entflohen, und er weilte die Monate Februar, März und April meist im Süden – in Spanien, Tunis, Kairo oder Italien, je nachdem es ihm gerade einfiel, nur gefolgt von seinem Kammerdiener, der vor vierundzwanzig Jahren Bursche bei ihm gewesen in der schönen, lustigen Leutnantszeit und vier Jahre jünger als sein Herr war, mit ihm kapituliert hatte und dann mit ihm gezogen war. Sie hatten beide diese Unzertrennlichkeit nicht zu bereuen gehabt, denn der Fürst war ein gütiger, wenn auch strenger, so doch gerechter Herr, und Rataiczak, der trotz der Jahre sein gebrochenes Deutsch aus den Rekrutentagen nicht verbessert hatte, war eine goldehrliche und goldtreue Seele. Freilich hatte auch Rataiczak seine Eigentümlichkeiten, welche man bei langjährigen Dienern findet – im Übrigen war er wie sein Herr, eine Hünengestalt mit blitzenden schwarzen Augen und gewichstem Schnurrbart, dem die kleidsame Jägerlivree, die er stets auf Reisen trug und nur daheim mit dem schwarzen Frack, kurzen Beinkleidern, Strümpfen und Schnallenschuhen vertauschte, vortrefflich, und für die Herzensruhe von Spanierinnen, Italienerinnen und Nubierinnen gleich gefährlich, stand.
Ganz allein, wie er es liebte, war Fürst Hochwald an einem köstlich warmen Märztage durch die engsten Gassen von Florenz geschlendert, um gelegentlich aus den finsteren Höhlen der Trödelbuden Perlen zu fischen für seine Sammlungen – alte Majoliken, Gläser, Stoffe, Möbel – kurz Antiquitäten. Und sein sicheres Auge trog ihn selten: Oft schon hatte er unter dem gräulichsten Wuste von allen möglichen und unmöglichen Dingen Gegenstände gefunden, welche der Verkäufer gar nicht achtete, und noch heimlich lachte, wenn der verrückte „Inglese“, unter welchem Sammelnamen der Italiener alle zahlungsfähigen Leute versteht, mit einem Lumpen, einem zerschletterten Stuhl oder einer runden, bemalten Tonscherbe abzog und dafür auch noch einen anständigen Preis gezahlt hatte.
Jetzt eben trat er aus einer Seitengasse der Via Maggio, in der Rocktasche sorgsam eine kleine Dose von Sevresporzellan mit dem Bilde und dem Fabrikzeichen der Pompadour bergend, die er in einer nach Zwiebeln riechenden Spelunke von Laden herausgestöbert hatte. Mit dem Taschentuch den gratis mitgebrachten Staub von den Kleidern klopfend, wandte sich Fürst Hochwald nach dem Arno zu, überschritt Ponte San Trinita, unter dessen Pfeilern der Arno seine gelb gefärbten Fluten majestätisch durchwälzte – schwankte dann einen Moment, ob er rechts zu den Uffizien oder links nach den Caseinen den Lungarno hinabgehen sollte, und schritt schließlich geradeaus, um an dem gezinnten Palazzo Spini vorbei die Via Tornabuoni mit ihrem reichen Ladenschmuck zu betreten. Eigentlich wollte er nur sehen, ob Brogi, der berühmte Fotograf und Kunsthändler, Neues in seinem Laden habe, um dann nach dem San-Marco-Kloster zu schlendern, wo ein Maler die berühmte Krönung Mariä von Fiesole für ihn auf Elfenbein kopierte.
Wer weiß, wie alles gekommen wäre, hätte er sich für den sonnigen Lungarno entschieden! Aber ahnungslos überschritt Fürst Hochwald die Straße und stand sehr bald vor dem Schaufenster von Brogi, wo im schweren, reich geschnitzten Goldrahmen eine vorzügliche Kopie der berühmten Tizianschen Königin von Zypern seine Aufmerksamkeit erregte. Und wie er noch so stand und das Bild betrachtete und sich überlegte, ob er nicht als Pendant zur „Bella“ eigentlich auch die schöne Catarina Cornaro besitzen müsse, trat aus der Ladentür eine sehr starke, hübsche, ältliche Dame, gefolgt von einer jüngeren, die im Gegensatz zur ersteren sehr schlank und durchaus nicht hübsch mit ihrem gelben Kalmückengesicht und schwarzem, krausem Negerhaar war. Die ältere Dame, deren schneeweißes Haar ihrem noch sehr frischen Teint wohl zustatten kam, blinzelte beim Heraustreten, geblendet von dem grellen Sonnenlichte, mit den Augen und wollte sich eben den Schirm aufspannen, als ihr Blick nach rechts fiel.
„Nein!“, sagte sie erstaunt, und dann: „Marcell, bist du's denn wirklich?“
Auf die Nennung seines Namens hin wandte sich Fürst Hochwald rasch um.
„Olga!“, rief er überrascht. „Wie kommst du hierher? Ich glaubte dich in Petersburg!“
Die Dame war die einzige Schwester des Fürsten und das junge Mädchen mit dem Kalmückengesicht ihre Tochter. Olga Hochwald war ein sehr hübsches Mädchen gewesen, aber, wie so viele Majoratstöchter, mittellos im Vergleich zu den Ansprüchen, in denen sie meist erzogen werden. Eine reiche Heirat war also auch eine Notwendigkeit für die verwöhnte und allerorten gern gesehene Komtesse, die indes nur die Herzen solcher zu besiegen verstand, die so viel hatten wie sie selbst – also zu viel zum Verhungern und zu wenig zum Leben, wenigstens indem von Olga Hochwald gewöhnten großen Stil. Da lernte sie in Karlsbad, wohin sie ihre Eltern begleitet hatte, durch Vermittlung eines Herrn der russischen Botschaft einen alten Stockrussen mit einem Kalmückengesicht kennen, den steinreichen General Chrysopras, der trotz seiner sechzig Jahre sein Herz an ihr entzündete und ihr seine Schätze nebst seiner Hand zu Füßen legte. Nach kurzem Schwanken nahm sie beides an, denn wenn der Adel des Generals auch nur allerneuesten Datums und mit einer seiner Ordensdekorationen verknüpft war, so war er dafür sehr reich und sie fünfundzwanzig Jahre alt und nur im Besitz eines hübschen, frischen Gesichtes und des Trousseaus, den das Majorat den Töchtern der Hochwalds aus einem besonderen Fonds bewilligte.
General Chrysopras lebte noch zehn Jahre, und seine Frau blieb als eine recht lebenslustige Witwe im Vollbesitz ihres ererbten Vermögens und mit zwei Kindern zurück, von denen der „süße“ Boris die hübschen Züge seiner Mutter und die „arme“ Sascha leider die Kalmückenphysiognomie ihres Vaters geerbt hatte. Als Sascha dann heranwuchs und „ausgeführt“ werden sollte, machte dieser Umstand der Generalin vielen Kummer, denn, nachdem sie, um ihrer Mutterrolle ein besonderes Relief zu geben, ihr zum Ergrauen neigendes Haar mit Eau de Cologne und Poudre de rix zu der schneeigen Weiße gezwungen hatte, die ihr so gut stand, und sie sich eingestehen musste, dass sie wirklich immer noch viel hübscher war als ihre Tochter, da sank ihr oft das Herz.
„Wie soll ich sie mit dem Gesicht verheiraten?“, pflegte sie zu sagen. „Hätte nicht Boris lieber seinem Vater ähnlich sehen können? Bei Männern verdeckt der Bart so viel.“
Und Sascha war nun auch schon fünfundzwanzig Jahre alt, ohne dass sie auch nur einen Korb ausgeteilt hätte, trotz ihres Geldes, trotzdem der persönliche Adel ihres Vaters in Erbadel umgewandelt worden war, trotz der gesicherten und angenehmen gesellschaftlichen Stellung, die ihre Mutter in Petersburg einnahm, trotzdem ihr Bruder in der diplomatischen Karriere reüssierte und trotz des jährlichen Besuches aller Weltbäder, gegen das unausrottbare Übel, eine alte Jungfer zu werden. Da hatte die Generalin Chrysopras eine Idee: Sie versuchte es mit den großen Städten Italiens, wo alle Welt sich Rendezvous gibt und wo vornehme italienische Granden mit alten Namen schon so oft reiche Erbinnen gegen ihre zerrütteten Vermögensverhältnisse gesucht und gefunden hatten. Vielleicht, vielleicht fand Sascha auch solch einen Marchese oder Duca oder Conte. Das war aber trotz allen darin liegenden Chancen ein Rechenfehler, denn der Italiener mit seinem angeborenen Schönheitssinn muss schon sehr gedrängt sein, wenn er trotz seiner Liebe zum Gelde eine hässliche Frau damit kauft, denn Stumpfnasen, hohe Backenknochen und Schlitzaugen rechnet er absolut zu den Hässlichkeiten, während der Kalmückenstamm wiederum edel geformte Nasen und große Augen für unannehmbar erklärt.
Aus diesem Grunde traf also Fürst Hochwald mit seiner Schwester und seiner Nichte in Florenz am Schaufenster von Brogi in der Via Tornabuoni an jenem schönen, warmen Märztage zusammen.
„Ich glaubte dich in Petersburg“, hatte er im ersten Erstaunen gesagt.
Die Generalin machte ein entsetzliches Gesicht.
„Ich bitte dich, Marcell, das wäre ja gar nicht schick!“, rief sie. „Wenn die Fastenzeit beginnt, kann man ja eigentlich in Petersburg nicht bleiben, denn als gute Russin muss man da in Sack und Asche gehen. Ist das amüsant? Nicht? Also – ich reise schon den dritten Winter nach dem Süden. Voriges Jahr waren wir in Rom – jetzt wollen wir erst zu Ostern dorthin. Es ist hier in Florenz eigentlich viel mehr Verkehr, die richtige Winterstadt. Man kann sich einen ganz internationalen Salon konstruieren, sage ich dir, und besonders jetzt, wo mein süßer Boris in Rom der Botschaft attachiert ist –“
„Boris in Rom! Davon wusste ich auch nichts“, unterbrach der Fürst den Redestrom.
„Seit zwei Monaten“, nickte die Generalin stolz, und indem ein Blick ihre Tochter streifte, setzte sie mechanisch hinzu: „Sascha, halt dich gerade!“
„Und weil Boris in Rom ist, bist du in Florenz?“, fragte der Fürst lächelnd.
„Wir gehen auch hin“, entgegnete die Generalin, „denn siehst du, Boris hat einen Monat Urlaub und ist auch in Florenz –“
Sie brach kurz ab und seufzte.
„Nun und –?“
„Sascha, halt dich gerade“, ermahnte Madame Chrysopras, indem sie ihrem Bruder den Arm reichte und mit ihm dem Lungarno zuschlenderte, gefolgt von Sascha, die gelangweilt aussah und mürrisch wie ein Landregentag. „Entre nous, Marcell – Boris hat Feuer gefangen und seinen Urlaub nach hier genommen, bloß weil die betreffende Familie auch hier ist.“
„Das scheint dich nicht sehr zu entzücken, Olga.“
„Oh – eine deutsche Komtesse wäre mir ja keine unwillkommene Schwiegertochter, siehst du, aber sie hat zu wenig, ich weiß es aus bester Quelle.“
„Was braucht Boris danach zu fragen!“, warf der Fürst ein.
„Ah, er hat viel verbraucht“, flüsterte die Generalin. „Siehst du, Marcell, er hat eben sein Leben genießen wollen, der arme Junge, nun, und – und da ist sein väterliches Erbteil fast ganz dahin! Was sagst du dazu?“
„Dass ein jeder so liegen muss, wie er sich bettet „, meinte der Fürst trocken.
„Nein, dass er eine gute Partie machen muss, sage ich“, ereiferte sich die Generalin. „Und er war auch ganz überzeugt davon, bis er dieses blonde Komtesschen sah – oh, Marcell, ich habe wirklich großen Kummer – bin eine arme, unglückliche Witwe!“
„Unsinn, Olga“, tröstete der Fürst. „Dass Boris mit seinem Erbteil fertig geworden ist, ist ja tragisch genug –“
„Ja aber, soll denn der arme Junge wie ein Kartäuser leben?“, unterbrach ihn Madame Chrysopras empört. „Warum soll mein Boris, mein süßer Boris sich um Rubel und Kopeken kümmern? Er, der sich in den höchsten Kreisen bewegt, soll dabei ein Leben führen, das ihn einfach vom high life ausschließen würde? Mein Boris hat ein Recht an das Leben, und er soll's genießen!“
„Es scheint ja, als ob er es redlich täte“, erwiderte der Fürst.
„Nun, und wenn auch? Wen geht es etwas an? Niemand!“
„Richtig, liebe Olga. Also um auf das abgebrochene Thema zurückzukommen – dass Boris sein Erbteil verbraucht hat, ist für dich zwar eine wesentliche Beruhigung und Freude –“
„Nein, Marcell, du bist zu schlecht!“, rief die Generalin ernstlich böse.
„Also auch nicht“, meinte der Fürst resigniert, und begann abermals: „Dass Boris sein Erbteil auf den Kopf geschlagen hat, ist zwar sehr lobenswert –“
Ein unterdrücktes Lachen von der hinter ihnen gehenden Sascha belehrte den Fürsten, dass er in der Tat die Achillesferse der Schwester getroffen und sich aufs Glatteis begeben habe.
„Sascha, was ist da zu lachen – halt dich gerade!“, rief die Generalin scharf verweisend über die Schulter zurück. Aber Sascha benutzte das betäubende Geräusch eines vorüberfahrenden Lastwagens, um dem Fürsten warnend zuzurufen: „Onkel, du stichst in ein Wespennest! Was Boris tut, ist wohlgetan!“
„Also du begreifst, dass Boris eine reiche Partie machen muss“, fuhr die Generalin fort, als der Wagen vorüber war, „denn mein Geld kann ich ihm nicht geben, wenn ich einigermaßen ein Haus machen will, und Saschas Erbteil – ja, wenn Sascha überhaupt heiraten soll, muss sie wenigstens Geld haben, da ihr die äußere Attraktion fehlt –“
Erschrocken über die Rücksichtslosigkeit der Schwester sah der Fürst sich nach seiner Nichte unwillkürlich um. Doch diese nickte ihm zu und zeigte lachend ihre spitzen, weißen Zähne.
„Wenn's mir Mama nicht sagt, so erzählt mir's der Spiegel, dass ich hässlich bin“, sagte sie gleichmütig.
„Sie ist dem guten, seligen Chrysopras so ähnlich“, murmelte die Generalin seufzend. „Und Boris ähnelt mir – so soll's ja eigentlich Glück bringen, aber mir wär's umgekehrt lieber, denn Hässlichkeit –“
„Hässlichkeit entstellet immer, selbst das schönste Frauenzimmer“, deklamierte Sascha ohne Bitterkeit, aber mit so viel Humor, dass es dem Fürsten ganz warm ums Herz wurde.
„Sascha, unterbrich mich nicht!“, rief die Generalin scharf. „Halt dich gerade und lass mich endlich ausreden. Was wollt' ich denn eigentlich sagen? Ja – Hässlichkeit ist solch ein Fluch für ein Mädchen. Also muss sie wenigstens Geld haben, und dieses Geld ist nebenbei auch noch so sichergestellt, dass es für Boris gar nicht zu erlangen ist.“
„Sonst wär's auch schon fort“, tuschelte Sascha an des Fürsten Seite.
„Und nun dieser Unsinn mit der kleinen Komtesse – es ist zum Weinen!“
„Hm“, machte der Fürst. „Und wie heißt diese Angebetete?“
„Sie ist die Tochter von dem Erlenstein, der seiner Frau wegen erst so lange in Kairo lebte und sich jetzt hier ganz ansässig gemacht hat, weil die Frau das deutsche Klima nicht vertrug.“
„So so! Und erwidert die junge Gräfin diese Gefühle von Boris?“
„Das kann weder er noch sein bester Freund behaupten“, meinte Sascha.
„Was redest du da für Unsinn?“, fuhr die Generalin auf. „Gefühle? Was sind Gefühle? Natürlich wird sie nach Boris mit beiden Händen greifen, denn erstens ist er ein sehr schöner Mensch – er sieht mir ähnlich – und zweitens ist er eine brillante Partie.“
„Du sagtest aber doch eben, dass er sein Erbteil verbraucht habe“, fiel der Fürst trocken ein.
„Er ist auch, abgesehen davon, eine brillante Partie vermöge seiner Talente und Begabungen.“
„Er soll unter anderem einen wundervollen Tempel legen können“, stimmte die unverbesserliche Sascha ein.
Boris muss in den letzten Jahren eine Perle geworden sein, dachte der Fürst, der sich jetzt auch der Affenliebe, die seine Schwester stets für den Knaben gehegt, erinnerte. Er war daher eigentlich froh, wie Madame Chrysopras nach dem letzten Einwurf Saschas etwas unvermittelt das Thema fallen ließ und ihrem Redestrom eine andere Richtung gab, indem sie plötzlich frug: „Wie lange bist du denn eigentlich schon hier, Marcell? – Seit vierzehn Tagen? Großer Gott, was hätte man in dieser Zeit nicht alles unternehmen können – Landpartien, Picknicks, Galeriebesuche – entre nous, Galerien sind das sträflich Langweiligste, was es gibt, aber es gehört nun einmal zum guten Ton, sie zu besuchen. Italien ohne Galerien wäre ein Eldorado, Marcell! Dabei fällt mir ein, Sascha nimmt hier Unterricht im Pastellmalen – das ist fabelhaft schick, und sie war so vernünftig, es selbst zu wollen, trotzdem sie sich sonst allem widersetzt, was Mode ist. Sascha, halt dich gerade und rede nicht, es ist so“, warf sie mit einem Blick nach rückwärts ein, obgleich Sascha gar nichts gesagt hatte. „Warum wolltest du voriges Jahr nicht die Geige spielen lernen?“
„Weil ich kein Gehör habe, Mama, kein Talent zur Musik!“ „Gehör! Talent! Welcher Unsinn! Was ist Talent? Ein dummes, landläufiges Wort. Man nimmt einen Lehrer, bezahlt ihn und macht ihm alles nach. Das kann jeder Affe!“
Nun aber lachte der Fürst laut auf.
„O Olga, du hast dich entsetzlich russifiziert!“, rief er, „so sehr, dass alles schon bei dir per Muss gehen muss. Sogar das Talent. Arme Sascha, musst du Pastellmalerei durch die Knute lernen, nur weil es Mode ist?“
„Du wirst's ja sehen, Onkel“, erwiderte Sascha im gleichen Tone.
„Pastell ist eine Kunst, die vor Ölmalerei zwar den Vorteil hat, dass sie geruchlos ist und die Bilder gleich fertig sind“, plauderte die Generalin, die mitgelacht hatte, weiter, „aber ich kann nie dabei sein, wenn Sascha malt, weil der Ton, den die trockenen Stifte auf dem rauen Papier hervorbringen, und das schreckliche Geräusch des Wischens mir entsetzlich auf die Nerven gehen. Aber Saschas Kunst ist ein Erfolg, sage ich dir, Marcell! Sie malt jetzt die beiden Erlensteins – deliziös!“
„Beide Erlensteins?“, fragte der Fürst. „Es sind also zwei Töchter da? Und welche betet Boris an, die ältere oder die jüngere?“
„Das weiß er selbst nicht, Onkel“, rief Sascha, „denn einmal sind die beiden Schwestern Zwillinge, und dann schwankt sein Herz noch zwischen beiden hin und her, wie – wie – nun, du kennst ja das Sprichwort von dem Esel mit den beiden Heubündeln.“
„Sascha, welche Vergleiche! Ich bin entsetzt!“, rief Madame Chrysopras; doch als sie ihren Bruder harmlos genug lachen sah, lachte sie mit. Urplötzlich blieb sie aber stehen. „Ich habe eine Idee“, sagte sie, förmlich atemlos vor innerer Erregung.
„Oh, die musst du uns auch zum Besten geben, Olga“, meinte der Fürst amüsiert.
„Nein, du darfst nicht lachen“, sagte sie, und da man inzwischen an den Caseinen, dem herrlichen, öffentlichen Park von Florenz, angelangt war, deutete sie auf eine Bank unter einer mächtigen Steineiche. „Wir wollen hier einen Moment ruhen, Marcell – indes sieht Sascha, ob der Wagen uns langsam gefolgt ist, denn leider wohnen wir nicht vor Porta del Prato, sondern in der Viale Regina Margherita, dort haben wir eine Villa gemietet, dicht an der Piazza Cavour!“
„Wie konntest du, Olga!“, meinte der Fürst vorwurfsvoll. „Moderne Straßen und Häuser kannst du überall haben. Aber wenn man nach Italien kommt, da sucht man sich einen alten Palazzo aus, möglichst nah an den Galerien und möglichst historisch.“
„Larifari“, sagte die Generalin, sich erschöpft setzend, „was gehen mich die alten Spelunken an und all der historische Unfug, den ihr Archäologen treibt! Ich fühle mich in Italien erst wohl in den neuen Häusern an der Piazza Cavour, wo man sich wenigstens einheizen lassen kann, wenn man friert. Doch davon ein andermal. Was ich sagen wollte – ist Sascha weit genug? Sie spottet immer über meine Pläne, ach! und wenn sie doch dem seligen Chrysopras nicht so ähnlich sehen möchte! Doch was ich sagen wollte – Marcell, ich will dir nicht mit Einleitungen und Gemeinplätzen kommen, ich will dir auch keine Vorwürfe darüber machen, dass du noch Junggeselle bist – – Marcell, du wirst dieses Jahr fünfundvierzig Jahre alt, und Krähenfüße bekommst du auch schon um die Augen, und graue Haare gewiss auch, nur dass man sie bei dieser Frisur nicht sieht – – sage, Marcell, weißt du denn nicht, dass du verpflichtet bist, dich zu verheiraten?“
„Man sagt so“, erwiderte der Fürst lächelnd, „aber das, liebe Olga, ist nicht gut zu befehlen und nicht gut zu untersagen. In dieser Beziehung bin ich Lessings Meinung: Kein Mensch muss müssen, wenigstens in gewissen Dingen.“ –
„Und die Erbfolge in Hochwald? Soll sie an die jüngere Linie fallen? Das fehlte noch!“, sagte die Generalin, ihren Sonnenschirm energisch in den Sand stoßend.
„Was geht mich die Erbfolge an? Die soll mir keine grauen Haare machen, denn bei der jüngeren Linie gibt's Söhne genug. Man muss anderen Leuten auch etwas gönnen“, meinte der Fürst ruhig lächelnd.
„Nein, das kann dein Ernst nicht sein, Marcell!“, rief die Generalin mit ungeheucheltem Entsetzen.
„Er ist's im Wortlaut und gewissermaßen auch im Sinne“, entgegnete er ruhig; „aber“, fügte er träumerisch hinzu, „du hast ja ganz recht. Hochwald hat sich seit Jahrhunderten vom Vater auf den Sohn vererbt, und in die jüngere Linie ist viel Blut gekommen, das den Stamm nicht veredelt hat. Doch meine Zeit habe ich versäumt. Ich fange an, alt zu werden. Aus Liebe wird ein junges Mädchen mir nicht zum Bunde fürs Leben die Hand reichen, und um mich wegen des Fürstentitels heiraten zu lassen, dazu fehlt mir jede Neigung. Also wird die jüngere Linie doch wohl die Erbfolge antreten.“
„Nous verrons, nous verrons“, meinte die Generalin mit geheimnisvoller Miene, und da Sascha mit dem Wagen erschien, setzte sie hinzu: „Wir besprechen das wohl noch einmal, Marcell, nicht wahr? Denn dein letztes Wort war das doch nicht? Einstweilen musst du mir versprechen, heute Abend mein Gast zu sein. Es ist mein jour fixe, und du sollst sehen, über welch interessanten internationalen Salon ich verfüge.“
„Also das ist immer noch dein Ideal, diese kosmopolitische Gesellschaft?“
„Aber ich bitte dich, was gibt es Interessanteres! Es kommt auch ein Liebhaber alten Plunders, wie du, ein Mr. Marstone.“
„Ist er Herren- oder Damenschneider?“, fragte der Fürst. „Man kann das bei diesen ›innocents abroad‹ niemals wissen.“
„Oh, du bist so schlecht, Marcell!“, rief die Generalin mit Überzeugung. „Also du kommst? Au revoir!“
Und dann rollte sie mit Sascha in ihrem gemieteten Landauer die Via del' Re Umberto hinauf.
„Also ein Teil meiner schönen persönlichen Freiheit wäre verkauft und dahin“, murmelte der Fürst seufzend, als er den Lungarno wieder herabzuschreiten begann. „Nur Rom oder Venedig kann mich jetzt von den internationalen Salons der guten Olga retten. Da wird Rataiczak wohl bald wieder packen müssen! Und mein schöner, alter Palazzo in der Via Maggio – ja – es gibt keine reine Freude in der Welt!“ Angelangt an der Piazza Manin, überlegte er, ob er nun doch noch nach dem San-Marco-Kloster fahren oder ob er den fast ganz verlorenen Morgen lieber im nahen Palazzo Corsini beschließen sollte. Er wusste dort eine Madonna von Filippino Lippi und Soustermansche Porträts, die einen schon trösten konnten über verlorene Stunden in Florenz. Und während er stillstand, um in seiner Brieftasche die Eintrittskarte zu suchen, die ihm den Palazzo Corsini sogar um Mitternacht geöffnet hätte, sagte plötzlich jemand dicht an seinem Ellenbogen: „Fürst Hochwald, wenn ich nicht irre!“
Überrascht wandte sich der Angeredete um und sah neben sich einen jungen Mann stehen, groß gewachsen und hübsch von Angesicht, aber durch den „pschüttesten“ aller „pschütten“ Anzüge bis zur Möglichkeit karikiert. Alles war an diesem jungen Manne kariert, von dem merkwürdig geschnittenen Anzug an, den man, hätte ihn ein armer Gymnasiast getragen, dürftig genannt hätte. Aber hier waren die Karos noch klein, während sie sich auf dem sackförmigen und viel zu kurzen Überzieher zu fabelhafter Größe erweiterten. Den Hut hintenüber gesetzt, an den Füßen gelbe, rindlederne Schnabelschuhe, aufgekrempelte, maßlos weite Unaussprechliche, rot gefüttert, und blaue Strümpfe mit aufgedruckten Sportemblemen, mit leuchtend zimtfarbenen Handschuhen bekleideten Händen, über die Manschetten mit Riesenknöpfen fielen, ein Stöckchen wie für einen dreijährigen Jungen: So stand das wandelnde Modell eines verrückten Pariser Schneiders vor dem erstaunten Fürsten.
Dieser verbeugte sich leicht.
„Allerdings“, sagte er, „ich weiß aber nicht, mit wem ich die Ehre habe –“
Doch bevor er ausgeredet hatte, war ihm das karierte und karikierte Wesen schon um den Hals gefallen und applizierte ihm auf offener Straße einen Kuss.
„Aber Onkel, kennst du mich nicht mehr? Ich bin ja Boris – Boris Wassilijewitsch Chrysopras, dein Neffe!“
„Nun eben“, war alles, was der Fürst in den Armen dieses Neffen hervorbringen konnte, und als dieser endlich seinen verwandtschaftlichen Gefühlen genug getan hatte, steckte er resigniert seine Karte für den Palazzo Corsini wieder ein und besah sich den Sohn seiner Schwester.
„Du also bist Boris, die Perle des Hauses“, sagte er. „Hm! schön angezogen bist du jedenfalls.“
„Alles Pariser Modelle, Onkel!“
„Scheint so. Habe eben deine Mutter und Schwester verlassen, nachdem wir uns aus Zufall getroffen.“
„Lebst du inkognito hier, Onkel?“
„Nicht doch. Ich schreibe mich in die Fremdenbücher M. F. Hochwald ein. Das ist mein ganzes Inkognito, denn ich werde auf die zwei mystischen Lettern M. F. hin meist für einen Reisenden in irgendeiner Branche geschätzt von Oberkellner und Portier. Und da Rataiczak nicht plaudert und ich mir meine Briefe stets poste restante bestelle, so entgehe ich meist der mir so widerlichen Servilität und dem ewigen ›Durchlaucht‹, für das ich so teuer bezahlen muss.“
„Merkwürdig!“, sagte Boris Chrysopras in seiner Ahnungslosigkeit, dass Leute mit Titeln im Gegensatz zu Titellosen sich's meist nur mit dem Bewusstsein genügen lassen, dieselben zu besitzen, während jene anderen ängstlich hervorsuchen, wie sie sich nennen könnten. Aber Grübeln über menschliche Schwachheiten und andere Probleme, Grübeln und Sinnen überhaupt war nicht die Sache von Boris Chrysopras. Er sagte also erstaunt über seines Oheims Sonderbarkeit: „Merkwürdig!“, und setzte sogleich hinzu: „Ich habe einen scheußlichen Hunger, Onkel – Gemütsbewegungen machen mir immer Hunger und wirken auf Leere des Magens. Merkwürdige Konstitution, was? Du hast doch auch Hunger, Onkel? Es ist auch fast Lunchzeit, und ehe wir so langsam bis zu Doney schlendern – was meinst du dazu?“
„Einverstanden“, sagte der Fürst gut gelaunt; denn nach dem seine erste schwere Enttäuschung, den Besuch des Markusklosters betreffend, überwunden war, fand er sich in die zweite, die ihm den Besuch der Galerie Corsini entrückte, schon leichter, umso mehr, als sein Neffe mit seinem Pschütt entschieden den sehr starken Sinn für Humor in ihm weckte. Er legte also seinen sehr unauffällig bekleideten Arm in den in allen Farben spielenden des jungen Diplomaten, und beide schlenderten zurück nach der Via Tornabuoni, zu dem vornehmsten Restaurant von Florenz, wo man für hohe Preise vorzüglich speisen kann.
Sie saßen auch sehr bald an einem Tische des eleganten Restaurants und sahen hinab auf die Straße mit ihrem bewegten Treiben, mit ihren einander drängenden Passanten, ihren Equipagen, ihren strahlenden Juwelen-, Mosaik- und Kunstläden – und siehe da, da kam auch eines der „Wunder“ von Florenz, der ältliche Amerikaner, der von einem turmhohen Wagen herab vierundzwanzig paarweise davor gespannte Pferde mit vierundzwanzig Leinen kutschiert und den Schaden, den er durch diese sonderbare und unbequeme Passion täglich anrichtet, dem Magistrat durch Vereinbarung monatlich bezahlt.
„Donnerwetter, wer so viel Geld hätte wie dieser Kerl!“, seufzte Boris Chrysopras über seiner Tasse Beeftea aux Truffes.
„Nun, dein Vater konnte es sich seinerzeit auch wohl gestatten, mit sechsundneunzig Pferdebeinen spazieren zu fahren“, erwiderte der Fürst.
„Papa? O ja. Aber erstens ist sein Geld in drei Teile gegangen für Mama, Sascha und mich – na, und ich –“
Er vollendete nicht, denn der Kellner kam und setzte eine kleine Terrine Straßburger Gänseleberpasteten auf den Tisch und eine Flasche Steinberger Kabinett.
„Ja, es ist so unangenehm, dass das Geld rund ist“, meinte der Fürst, indem er einschenkte.
„Scheußliche Eigenschaft“, murmelte der junge Diplomat. „Mama wird dir natürlich schon vorgejammert haben“, setzte er misstrauisch hinzu, und als der Fürst hierauf nichts erwiderte, meinte er tröstend: „Na, eine Weile hält es schon noch vor, und dann werden wir ja Rat schaffen. Kolossal reiche Partie in petto – fürchte nur, dass die unseren Stammbaum nicht gerade mit Edelreisern okulieren wird.“
„So?“, machte der Fürst. „Deine Mutter sprach doch aber von einer deutschen, jungen Gräfin, die – –“
Boris Chrysopras wehrte mit der Linken lebhaft ab, während die Rechte den Rest der Pasteten auf seinen Teller legte.
„Siehst du, Onkel, das ist mir ja ebenso auf den Magen gegangen, hat mir diesen unnatürlichen Hunger gemacht! Gemütsbewegungen vertrage ich einmal nicht!“
„Nein?“, fragte der Fürst, amüsiert der verschwindenden Pastete nachsehend.
„Nein“, bestätigte der junge Russe mit tragischem Kopfschütteln, „denke dir meine Lage, Onkel! Hier – ein immer mehr schwindendes Vermögen – – habe scheußliches Pech gehabt im Spiel und auf dem Turf – und die Aussicht, nächstens brichst du nieder. Dort – eine äußerst pikante Amerikanerin mit blödsinnigem Mammon, und dazwischen eine blonde Elfe, die nichts, oder doch zu wenig für mich hat. Nun stell dir das mal vor, und stelle dir vor, dass ich diese blonde Elfe gerade lieben muss!“
„Ja, ja, es ist schrecklich“, sagte der Fürst, insgeheim lächelnd, indem er an Saschas drastischen Vergleich von dem Esel zwischen den Heubündeln dachte. „Ich glaube gern, dass dieses Dilemma dich aufregt.“
„Ah, du weißt noch nicht alles“, unterbrach ihn Boris, dem Kellner zusehend, der eben delikat aussehende Hammelkoteletten a la Maintenon servierte nebst einer staubbedeckten Flasche alten Burgunders. „Onkel, diese Koteletten kann dein Koch nicht besser machen – sie sind einfach in der Perfektion. Und diese Haricots vert flageolets dazu werden nach meinem Rezept bereitet, denn vom Gemüsekochen haben diese elenden Italiener keine Ahnung.“
Er zerlegte eines der saftigen, talergroßen, aber dicken Koteletten in ihrer Panade von Parmesankäse und aß mit Kennermiene.
„Gut“, sagte er, indem er langsam ein paar Schluck des alten Burgunders schlürfte. „Also Onkel“, fuhr er fort, „ich sage dir, du weißt noch nicht alles. Stelle dir vor, dass ich, alle pekuniären Bedenken beiseite schiebend, nur meinem Herzen folgen will und mich heut früh entscheide. Geld hin, Geld her – die oder keine andere, sage ich mir. Und da ich weiß, dass die Erlensteins heute früh nach den Uffizien wollen, gehe ich auch dahin, rase durch alle Säle wie ein Besessener, sehe den Vater mit der anderen Tochter natürlich erst im Niobidensaal, und wie ich mich in die leere Sala del Baroccio zurück konzentriere, um einen Kriegsplan zu entwerfen, wer, meinst du wohl, steht an dem schönen Mosaiktisch in der Mitte und zeichnet sich ein Ornament davon ab in ein kleines Skizzenbuch – Sie! Sie! Sie!“
„Woraus man ersieht, dass ein junger Mensch Glück haben muss“, meinte der Fürst ernsthaft. „Und was tatest du?“
„Ich?“ Boris Chrysopras sah tiefsinnig zu, wie der Kellner nach raschem, geräuschlosem Tellerwechsel erst eine Flasche Roederer, extra dry, in Eis vergraben in silbernem Kübel auf bronzenem Gestell herbeibrachte und dann einen zarten gebratenen Fasan mit Kaviar-Beilage servierte, begleitet von ausgesuchtem Endiviensalat und Kompott von grünen Mandeln. „Siehst du, Onkel, der Kaviar ist recht gut hier – das Beste vielleicht, was ins Ausland kommt, aber Kaviar, wie wir ihn essen, ist es nicht: grau, großkörnig, perlend und mild – kurz, Kaiserkaviar. Aber auch dieser ist, wie gesagt, passabel und meiner Ansicht nach die beste Beilage zum Fasan, obgleich viele Sauerkraut in Sekt gekocht mit Austern darin vorziehen. Das ist nicht meine Passion. Ich weiß ja nicht, wie du über diesen Punkt denkst, aber –“
Er zuckte bezeichnend mit den Achseln.
„Ich finde deinen Geschmack gut“, erwiderte der Fürst, mit Anstrengung ernsthaft bleibend. Und indem er seinem Neffen zutrank, sagte er: „Also du fandest ›Sie‹ in der Sala del Baroccio?“
„Ja, ein Ornament kopierend“, begeisterte sich Boris für seine „jungen Leiden“ wieder, nachdem er den schwachen Leib gestärkt. „Wir schüttelten uns die Hand, besprachen den Mosaiktisch, wurden ganz darüber einig, dass die ›Magdalena‹ von Carlo Dolci widerlich süßlich sei und fanden beide Rubens zweite Frau schöner als die erste. Und während wir noch verglichen, fasste ich mir ein Herz, schoss mit einer Liebeserklärung los und bot ihr Herz und Hand.“
„Nun, und ›Sie‹?“, fragte der Fürst, als Boris sich von Neuem mit einem Glase Sekt stärkte, ein Fasanenbruststück dick mit Kaviar bestrich und es in seinen Mund schob.
„Sie?“ kam es dumpf zurück, weniger aus Herzensqual, als weil er seinen Mund voll hatte. „Sie?“ wiederholte er dann mit hellerer Stimme, „nun, sie gab mir einen klippklaren, unverzuckerten und unzweideutigen Korb!“
„Ah –“ machte der Fürst überrascht. Dann erhob er das Glas. „Cheer up, old boy „, sagte er, „es lebe die Amerikanerin.“
„Noch nicht, Onkel“, erwiderte Boris wiederum dumpf aus naheliegenden Gründen. „Wie ich also so stehe, bildlich genommen, mit offenem Munde über die unglaubliche Geschmacksverwirrung dieser blonden Borste von einem kleinen Satan, wer tritt in den Saal? Der Papa mit seiner anderen Tochter. Und wie die über die Schwelle tritt, da bricht die furchtbare Erkenntnis über mich herein, dass ich nicht die Korbspenderin, sondern deren Zwillingsschwester liebe!“
„Mein Gott, das ist ja ein Stoff für Ibsen!“, rief der Fürst überrascht. „Doch ich sage dir noch einmal, alter Junge: Cheer up, denn Schlimmeres kann dir dabei ja gar nicht passieren, als dass du dir noch einen Korb holst, den Zwillingskorb.“
„Onkel, spotte nicht“, erwiderte Boris mit Pathos, der ihn aber nicht verhinderte, eine eben aufgetragene, köstlich nach Aprikosen duftende Schaumtorte, wie sie eben nur in Florenz gebacken werden kann, einer näheren Betrachtung zu würdigen. „Ich sagte dir schon, solche Gemütsbewegungen gehen mir nah zu Herzen.“
„Ich dachte, sie machten dir Hunger?“, unterbrach ihn der Fürst, „denn ich sehe, dass du trotz unseres reichlichen Frühstücks diese Torte allein zu verzehren gedenkst.“
„Sie ist aber auch köstlich!“ gestand Boris, eine zweite Schnitte des aromatischen süßen Gebäcks auf seinen Teller schiebend, „ich meine die Torte, denn die Erlensteinschen Zwillinge sind mehr elfenhaft als überwältigend. Ach, und ich musste mich stärken nach dieser Offenbarung meines Herzens, Onkel, und darum erlaubte ich mir, die eben servierten Speisen auszuwählen als Stammgast dieses Lokals – –“
Als dann die Reste der Torte abgetragen waren und der Kellner Butter, Pumpernickel, Radieschen, Selleriestängel, Stracchino und Roquefort brachte und schon die Mokkatassen zu einem Zuge des wahrhaft vollkommenen Doneyschen Kaffees hinstellte, da fragte der Fürst noch einmal: „Nun, Boris, und die Amerikanerin?“
„Klotzig reich, sehr pikant“, brummte Boris achselzuckend. „Manchem zu ausländisch, zu sehr ›free country girl‹. Wirst sie ja heut bei Mama sehen, Onkel, denn dass du nicht in dem internationalen Salon eingefangen sein solltest, ist doch nicht anzunehmen.“
„Nein, leider richtig erraten“, sagte der Fürst seufzend.
„Na, ja eben“, meinte Boris mit bezeichnender Handbewegung, „scheußliche Erfindung, Mamas Routs. Allerdings wird Sie auch da sein –“
„Ah so – die neu entdeckte ›Sie‹ deines Herzens?“
„Und die Korbspenderin auch. Sie stehen alle nicht in so großer Gunst bei Mama wie die pikante Miss ›l reckon‹, wie ihr Spitzname ist, aus ›N'York‹. Mag wohl noch ein Tropfen Negerblut in ihr sein. Der Vater war jedenfalls Schweinehändler, der Großvater Schweinetreiber.“
Fürst Hochwald fiel's unwillkürlich ein, dass der Großvater seines Neffen, des „guten, seligen Chrysopras“ Vater, Schneider gewesen sein sollte – aber „mein Himmel!“, das war ja am Ende der alte Derfflinger auch vor grauen Jahren.
Nachdem Boris noch seinen Kaffee geschlürft, der nach seiner Angabe „heiß wie die Hölle, schwarz wie die Nacht und süß wie die Liebe“ sein musste, um gut zu sein, verließen die Herren Doneys Restaurant und trennten sich unten auf der Straße, Boris, um in seinem Hotel Siesta zu halten, der Fürst, um sich einen Wagen zu nehmen und hinaufzufahren nach Fiesole, wo er im Garten des alten Franziskanerklosters auf der Höhe ein paar Stunden verträumte. Er hatte sich die wenigen Mönche, die das zypressenbekränzte, malerische alte Kloster bewohnen, zu Freunden gemacht, und sie ließen den signore tedesco gern hinein in den Klostergarten mit seinem schwermütigen Haine von Zypressen, Lorbeer und Steineichen, mit seinem Fernblicke in den grandiosen Bergkessel des Apennin. Von dieser Stätte geht die Sage, dass Atlas sie errichtete für solche, die die Ruhe des Geistes und die Heiterkeit des Herzens verloren haben.
Die Sonne neigte sich schon, als Fürst Hochwald sich von dem Block von Pietra Serena erhob, der zu Füßen des Kreuzes liegt, von dem aus man in die großartige Bergschlucht hinabschaut. Nur schwer trennte er sich von der Aussicht in die Tiefe, in der schon dunkelviolette Schatten lagerten und aus der es anfing, eisig kalt emporzusteigen. Langsam durchschritt er den Hain, dessen Laubkronen schwermütig flüsterten und rauschten, dessen Zauber sein Herz stets neu umspann und ihm zu sagen schien: Bleib hier, denn hier wohnt der Friede!
Der Friede – ein anderer, tieferer Friede noch als in seinem Schloss am Meer, wo die Wogen unablässig rauschten und brandeten – wie sein eigenes Herz – der Friede der Entsagung, der Friede der Ergebung und der Erwartung eines besseren Lebens, in dem das Herz nicht mehr irrt und nicht mehr zu bereuen braucht.
Reue! Oh, die schwere Kette; die, im Feuer der Seelenqual geschmiedet, nimmer nachlässt, wenn auch der Dichter sagt:
„Kummer und Reue,
Alles zerstiebt,
Es vergisst selbst die Treue,
Wie treu sie geliebt.“