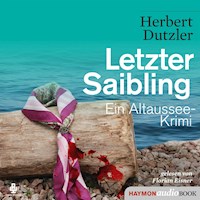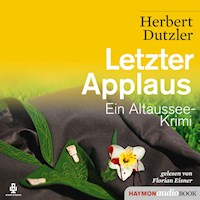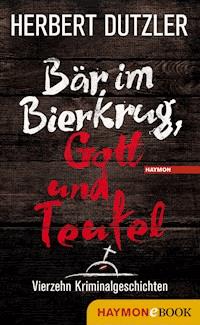Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
FRÜHER WAR ALLES ... WIE DENN EIGENTLICH? KOMMT MIT UNS AUF ZEITREISE! Ein Blick durch Kinderaugen: Fahr im Autobus nach Italien, spür die Hornbrille auf deiner Nase und schmeck die Limo von damals! Er trägt eine dicke Brille, steckt seine Nase am allerliebsten in Romane von Karl May und wenn er groß ist, will er Astronaut werden: Siegfried. Es ist 1968, er hat gerade die Volksschule beendet und freut sich aufs Gymnasium. Vorher geht es aber noch auf große Fahrt: mit dem Autobus nach Italien. Da werden die Nachbarn schauen! Oft wundert sich Sigi über die Erwachsenen in der Familie, die sich immer so viele Sorgen darüber machen, was andere Leute denken – vor allem, wenn der Bub ein besonderes Interesse für Kochrezepte entwickelt und beim Versuch, Pizza zu backen, fast das Haus in Brand steckt … Das Abenteuer wartet gleich hinterm Haus Siegfried lebt in einer Welt, in der Computerspiele noch leise Zukunftsmusik sind: Es gibt viel zu erleben auf am Bach hinterm Haus oder auf der Zugfahrt nach der Schule, seine Lieblingsspeise kommt nicht per Online-Bestellung, sondern direkt aus Mamas Küche. So weit, so idyllisch. Aber nicht alles, an das Siegfried sich als Erwachsener erinnern wird, ist schön: Eingefahrene Rollenbilder belasten sowohl die Mutter als auch den Vater, der Umgangston im Gymnasium ist rau und der Spott der anderen Kinder kann – gerade, wenn man ein guter Schüler ist und ein paar Kilos mehr auf den Rippen hat – gnadenlos sein. Herbert Dutzler nimmt dich mit in die Welt seiner Kindheit Herbert Dutzler entführt diesmal nicht ins Revier des Altausseer Polizisten Franz Gasperlmaier, sondern in die Zeit seiner eigenen Kindheit. Die Welt seines Protagonisten Siegfried kennt der Bestseller-Autor ganz genau: Auch er ist in den 60er Jahren aufgewachsen, hat Kracherl geschlürft und sich mit Winnetou davongeträumt. Herbert Dutzler gewährt dir einen kindlichen und erfrischend anderen Blick zurück in jenes Früher, in dem nicht wirklich alles besser war, aber an das wir uns doch so gern erinnern. "Herbert Dutzler nimmt uns mit auf eine besondere Reise. Gleich nach wenigen Seiten bekommt man das Gefühl, den Erlebnissen eines alten Freundes beizuwohnen. Man lächelt, man staunt und erinnert sich an Vergangenes wie an liebgewonnene Gefährten. Ein wahrer Lesegenuss!" Beate Maxian
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herbert Dutzler
Die Welt war eine Murmel
1 Die Reise nach Italien
Immer wieder fiel ihm etwas in die Hände, das ihn daran hinderte, mit dem Ausräumen von Mamas Wohnung zügig weiterzukommen. Er hatte sich nicht dazu überwinden können, das Auflösen ihres Haushalts einer professionellen Entrümpelungsfirma zu übergeben. Einer der Kartons am Dachboden war voll mit Urlaubserinnerungen, ein Beweis, wie wichtig ihr die Italienurlaube mit der Familie gewesen waren. Was zählte heute schon eine Woche an der oberen Adria? Für seine Mutter war es ein unvergessliches Erlebnis gewesen. Da war zum Beispiel das Fotoalbum, an das er sich noch gut erinnern konnte. Es war immer wieder herumgereicht worden, wenn Besuch gekommen war. Man musste ja schließlich alle darüber aufklären, dass man sich eine Reise nach Italien leisten konnte.
Verblasst waren die Bilder, und einen rosa Stich hatten sie alle. Auf den Fotos vom Strand waren hauptsächlich dicke Menschen in altmodischen Badeanzügen zu sehen, die meisten davon kannte er nicht einmal. Auf einigen Seiten fanden sich dann aber auch Familienfotos. Uschi im Tretboot, er selbst – mit dicker Brille – im Liegestuhl, das unvermeidliche Winnetou-Buch auf dem Schoß. Besser gesagt, auf dem Bauch, der damals schon viel zu dick gewesen war. Er ertrug es nur schwer, Fotos von sich selbst aus dieser Zeit zu sehen. Mama im Bikini. Eine der wenigen Frauen, die damals so etwas gewagt hatten. Sehr freizügig waren aber auch Bikinis damals nicht gewesen, er hatte den Eindruck, als seien die Körbchen aus festem, dichtem Stoff viel zu groß für die kleinen Brüste seiner Mutter. Dafür stellten Uschi und Mama üppig mit Blütenranken dekorierte Badehauben zur Schau. Papa war auf keinem der Bilder, er hatte offenbar immer fotografiert. Es war ihre erste Urlaubsreise gewesen, die in diesem Album dokumentiert war. Sie waren mit dem Bus gefahren. Eine untergegangene Welt, dachte er seufzend. Und anstatt zügig weiter auszumisten, setzte er sich auf Mamas altes, abgewetztes Sofa und hing Erinnerungen nach.
Morgen fahren wir nach Caorle. Es wird mein erstes Mal am Meer sein. Ich bin unglaublich aufgeregt, denn ich war überhaupt noch nie im Ausland, bin noch nie über die Grenzen Österreichs hinausgekommen.
Wir werden mit einer ganzen Gesellschaft von Kastenkirchenern mit dem Bus reisen. Ja, mit dem Bus. Wir haben nämlich kein Auto. Etwas Besonderes ist das nicht, denn von den 36 Buben in meiner Volksschulklasse verfügen nur drei über Eltern, die ein Auto besitzen.
Wir, das sind ich, Siegfried, zehn Jahre alt und etwas übergewichtig. Man nennt das bei uns „gut beieinander“. Dann meine Schwester Uschi, die ist acht Jahre alt und spindeldürr, sowie mein Vater Adolf und meine Mutter Edeltraud. Ja, ich weiß, dass der Name meines Vaters ein wenig bedenklich stimmt. Aber davon später. Ich muss ja jetzt sehen, dass diese Geschichte auch wirklich weitergeht.
Ich darf meinen eigenen Koffer packen. Der ist braun, aus verstärkter Pappe hergestellt, und hat an den Ecken Lederstücke aufgenäht. Der Griff ist aus hartem Kunststoff und schneidet beim Tragen schmerzhaft in die Handflächen.
Natürlich musste man seine Koffer mühsam per Hand schleppen und konnte sie weder rollen noch auf den Rücken schnallen. Was hatte er sich abgeschleppt, bis er endlich im passenden Alter für Rucksackreisen gewesen war! Danach war man ja direkt in die Ära der Rollkoffer übergegangen.
Ich packe hauptsächlich Bücher ein, denn wenn wir eine Woche in Italien bleiben, muss ich mich als Erstes darum kümmern, dass mir der Lesestoff nicht ausgeht. Zwei, nein, drei Karl-May-Bücher. Karl May hat unglaublich viele Abenteuergeschichten geschrieben. Soviel ich weiß, war er ein Verrückter, der sich jede Menge Indianergeschichten ausgedacht hat. Wüstengeschichten aus Nordafrika hat er auch geschrieben. Alle voller wilder Abenteuer. Karl hat im 19. Jahrhundert gelebt, und von Amerika und seinen Indianern hat er höchstens Kupferstiche gesehen. Vielleicht hat er auch ein paar Bücher gelesen, von Abenteurern, die Expeditionen nach Amerika oder Afrika unternommen haben. Der Karl, der hat jede Menge Fantasie gehabt. Und ich lese so viel, damit ich auch so viel Fantasie bekomme wie der Karl, weil ich nämlich Schriftsteller werden möchte. Meine Schulkollegen kennen teilweise nicht einmal dieses Wort. Schriftsteller. Ich muss ihnen dann erklären, dass das ein Kerl ist, der Bücher schreibt. „Bücher schreibt?“, haben manche mit aufgerissenen Augen den Kopf geschüttelt.
Dann kommen noch Donald-Duck-Bücher hinein. Zur Entspannung. Man kann schließlich nicht immer Indianer- und Wüstengeschichten lesen. Die muss ich vor meiner Mutter verstecken, weil sie der Meinung ist, dass das Schundhefte sind. Sie glaubt, wenn man Donald-Duck-Bücher liest, verblödet man und wird gewalttätig. Weil in den Geschichten hie und da einmal geprügelt wird. Mama kriegt schon Zustände, wenn einmal „WUMMS!“ neben einem Bild steht, auf dem einer mit der geballten Faust zuschlägt. Und aus dem Kopf zischen kleine Blitze. Das Gleiche gilt, zumindest der Meinung meiner Mama nach, auch für das Fernsehen. Fernsehserien, in denen geschossen wird, dürfen wir auf keinen Fall sehen. Anscheinend glaubt sie, dass wir, sobald wir erwachsen sind, sofort in einen Waffenladen rennen, uns mit Schusswaffen eindecken und gleich vor der Ladentür damit herumzuballern beginnen, wenn sie uns erlaubt, „Bonanza“ anzusehen. Das ist eine Westernserie, in der geschossen wird. Manchmal.
Die Donald-Duck-Bücher verstecke ich also am besten unter meinem gestreiften Pyjama. Sicherheitshalber stopfe ich auch noch einen warmen Winterpullover in den Koffer. Man weiß ja nie. Die italienischen Hotels, munkelt man, haben überhaupt keine Heizung. Und im Fernsehen heißt es im Wetterbericht immer wieder, ein Mittelmeertief sei im Anzug. Wäre mir sowieso lieber, ehrlich gesagt. Ich könnte dann im Hotel in meinem Bett liegen bleiben und lesen. Und müsste nicht an den doofen Strand hinaus. Ich war noch nie an einem Strand, aber angeblich gibt es da Krabben, die einen in die Zehen zwicken, und Quallen mit langen Tentakeln, die fürchterlich brennen, wenn man sie berührt. Und das Essen, habe ich gehört, soll auch ziemlich seltsam sein. Hat Hansi gesagt. Der war voriges Jahr schon in Caorle. Fürchterlich angegeben hat er damit. Er war nämlich in der vierten Klasse der Einzige, der schon am Meer war. Aber heuer! Da wird er kleinlaut sein, wenn wir wieder einen Aufsatz über das aufregendste Ferienerlebnis schreiben müssen. Wenn man so etwas im Gymnasium überhaupt macht. Im Herbst komme ich nämlich ins Gymnasium. Gleich nach dem Urlaub. Wir fahren natürlich in der letzten Ferienwoche – da ist schon Nachsaison und alles viel billiger, sagt Papa. Mama rümpft über die Nachsaison die Nase, möglicherweise ist ihr die nicht fein genug.
Mein Kopf ist hochrot, als ich den Koffer die Stiege hinuntergeschleppt habe. Wegen der vielen Bücher ist er sehr schwer geworden. „Aber Siegfried!“, schreit meine Mama. „Du bist ja ganz heiß im Gesicht! Du wirst mir doch nicht etwa Fieber bekommen!“ Mama ist schon eine ganze Woche lang total nervös, weil wir ans Meer auf Urlaub fahren. Es ist auch ihr erstes Mal. Bisher war sie höchstens in Kärnten bei Verwandten. Noch nicht einmal in Wien ist sie gewesen, ehrlich nicht.
Heute konnte sich kein Mensch vorstellen, dass ein erwachsener Mensch noch nie in Wien gewesen war, aber so war das damals eben. Er konnte sich noch vage an die erste Reise nach Wien erinnern, er musste etwa zwölf gewesen sein, sie waren in einen weiß-blau bemalten Zug gestiegen, der „Transalpin“ genannt wurde. Und sie hatten bei einer entfernten Tante übernachtet, die sehr dick war und in deren Wohnung es schlecht roch.
Ein Urlaub in Italien ist ein echtes Highlight. Etwas ganz Besonderes. Meine Oma, die ist bis jetzt nie weiter als bis nach Bad Aussee gekommen. Papa hat ihr versprochen, dass wir einmal auf den Großglockner fahren zu ihrem Geburtstag, aber da wird die Oma wohl noch ein Weilchen warten müssen.
Mama ist übrigens die Einzige, die mich „Siegfried“ nennt. Denn das Abkürzen von Vornamen, das findet Mama unfein. Und was meine Mama am liebsten möchte, ist fein zu sein. Eine „feine Dame“. Das ist eine Wunschvorstellung von vielen Frauen, „feine Damen“ zu sein. Die Illustrierten sind voll davon. Eine Mindestanforderung dafür scheint mir, dass man in einem teuren Kostüm mit weißen Handschühchen mit Spitzen daran auf einer Seeterrasse Tee schlürft und dabei den kleinen Finger wegstreckt, wenn man die Tasse anfasst. Also, hörbar schlürfen darf man dabei wohl nicht, denn das wäre wieder unfein. Leider streiten meine Eltern oft wegen der Feine-Damen-Geschichte, zum Beispiel dann, wenn mich mein Papa „Friedl“ nennt und meine Schwester „Sigi“ zu mir sagt. Ich finde „Friedl“ auch ziemlich blöd, weil ich eine Großtante habe, die Elfriede heißt, und die nennen auch alle „Friedl“. Papa wollte mich „Friedrich“ nennen, das klingt eigentlich genauso blöd wie Siegfried. Papa ist dafür immer ein bisschen peinlich berührt, wenn die Mama „Adolf!“ schreit. Das hat etwas mit Politik zu tun, habe ich schon mitbekommen, aber was genau, das muss ich noch herausfinden. Vielleicht hat auch der Kaiser „Adolf“ geheißen, von dem die Mama immer schwärmt. Seine Frau jedenfalls, die hat Sissi geheißen, und das ist ja auch ein abgekürzter Name. Für Elisabeth. Aber wenn der Papa das meiner Mama erklärt, gibt es meistens Streit. Von royalen Angelegenheiten, meint Mama dann, verstehe Papa nun wirklich nichts. Mama kennt sich mit royalen Angelegenheiten aus, weil sie immer die „Bunte Illustrierte“ liest.
Uschi und ich werden um acht Uhr ins Bett geschickt. Der Gutenachtkuss von Mama fällt heute ein wenig zerstreut aus, sie ist anscheinend zu nervös für eine innige Zärtlichkeit. Unser Bus fährt um fünf Uhr früh ab, weshalb wir um halb vier Uhr morgens aufstehen müssen. Trotzdem sollen wir erst um fünf Uhr nachmittags in Caorle ankommen. Das liegt daran, dass nach Italien keine Autobahn führt, ganz im Gegenteil, wir müssen über mehrere Gebirgspässe und durch enge Täler. Das dauert seine Zeit, denn wir werden nicht die Einzigen sein, die unterwegs sind.
Heute konnte man Kinder nicht so einfach abends ins Bett schicken, wenn man früh loswollte. Und wenn, dann würden sie unter der Bettdecke ihr Handy hervorholen und darauf herumspielen. Zum Beispiel den Mitschülern gehässige Nachrichten zukommen lassen oder niederträchtige Gerüchte über sie verbreiten, damit ihnen nicht fad wurde. In seinem Zimmer damals war das einzige elektrische Gerät eine Nachttischlampe gewesen. Keine Musik, keine Stöpsel in den Ohren.
Papa wollte gerne sein Kofferradio mit nach Italien nehmen, aber Mama hat es ihm ausgeredet. „Im Bus kannst du es sowieso nicht aufdrehen, und unten verstehst du kein Wort, weil sie keine deutschen Sender haben.“ „Unten“ ist übrigens Italien. Ein kleiner Hinweis darauf, wie wir über Italiener denken: Sie sind „unten“, während wir natürlich „oben“ wohnen. Mein Vater hat sich kürzlich ein sündteures Kofferradio gekauft, leider aber ist es Mama nicht fein genug. Es hat vier Kilo und ist so groß wie eine Schuhschachtel. Papa stellt es auf eine Fensterbank, wenn er sich mit einer Flasche Bier in der Hand in seinen Gartensessel setzt, und hört sich das Wunschkonzert an. Das ist eine Sendung, wo man sich ein Musikstück wünschen kann, indem man vorher eine Postkarte mit seinem Musikwunsch an den Radiosender schickt. Postkarte deswegen, weil viele Leute kein Telefon haben, auch wir nicht. Noch nicht. Papa hat uns zwar angemeldet, aber angeblich dauert es ein halbes Jahr, bis wir einen Viertelanschluss bekommen. Deshalb die Postkarten. Eine Postkarte ist übrigens ein kleiner Pappkarton, auf dem schon eine Marke aufgedruckt ist und auf die man Nachrichten schreibt, die dann per Post zugestellt werden. So ähnlich wie eine Ansichtskarte, nur ohne Bild.
Papa hat schon mehrere Postkarten geschickt, aber sie haben ihm seinen Musikwunsch noch nicht gespielt. Den „Bauernkasten“ von Fritz Edtmeier hat er sich gewünscht. Natürlich, den „Bauernkasten“, den spielen sie jedes Mal. Aber eben nicht für Adi Niedermayr aus Kastenkirchen. Und genau das will Papa, dass der „Bauernkasten“ für ihn ganz allein gespielt wird. Und er selber nennt sich, wie ich jetzt schon verraten habe, lieber Adi als Adolf. Leider ist beides nicht fein, der „Bauernkasten“ nicht und der Adi auch nicht. Das führt auch gelegentlich zum Streit zwischen unseren Eltern, denn unterhalb von Opernmusik ist Mama nichts fein genug. Vielleicht noch Operette. Höchstens. Man möchte es nicht glauben, aber der unterschiedliche Musikgeschmack meiner Eltern führt nicht selten zu mittelgroßen Ehekrisen. Wenn Papa die Opernmusik ab- und den Bauernkasten aufdreht. „Müssen ja nicht alle Nachbarn hören, was du dir unter Musik vorstellst!“, schimpft Mama dann.
Ja, und der Viertelanschluss. Du kriegst ein Telefon, aber sozusagen mit drei anderen gemeinsam. Die anderen drei Telefone stehen in anderen Häusern oder Wohnungen. Wenn einer von denen telefoniert, ist bei dir Pause. Und wenn du das Pech hast, dass du mit einem Dauertelefonierer zusammengeschlossen bist, dann kannst du es dir sogar abschminken, die Rettung zu rufen, wenn du dir einen Finger abgehackt hast. Dann geht nämlich gar nichts.
Ich kann einfach nicht schlafen, ich bin viel zu aufgeregt. Was, wenn ich verschlafe, und sie fahren ohne mich? Dann werde ich vielleicht nie das Meer sehen. Irgendwann fallen mir dann doch die Augen zu, aber ich habe fürchterliche Träume, immer vergesse ich irgendwas, und als meine Eltern mit den Koffern vor der Haustür stehen, merke ich plötzlich, dass ich nur eine Unterhose und Schwimmflossen anhabe. Ich fahre immer wieder schweißgebadet hoch. Schließlich bin ich sogar froh, als meine Mama mich in stockfinsterer Nacht aufweckt.
Ich ziehe meine Sachen, die mir Mama gestern herausgelegt hat, vom Stuhl und schlüpfe hinein. Die kurze Hose kneift ein wenig. Möglicherweise habe ich schon wieder zugenommen. Das ist unangenehm, denn die Mode ist eng. Man trägt die Sachen auf Haut geschnitten. Bei einem, der ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hat, sieht das nicht gerade vorteilhaft aus. Bauch und Oberschenkel tendieren zum Hervorquellen. Dazu gibt es ein geringeltes Leibchen. Da es Sommer ist, werden weiße Socken und Sandalen getragen. Das ist völlig normal – Kinder tragen die Sandalen mit weißen Socken, Pensionisten mit schwarzen. Dazwischen sind auch geringelte und braune erlaubt. Bei uns in Österreich heißen Sandalen übrigens Klapperl. Wahrscheinlich, weil sie beim Gehen klappern, wenn sie schlecht sitzen. Und sie sitzen immer schlecht. Meine sind mir zu lang, gleichzeitig aber zu schmal.
Mama flattert aufgeregt um uns herum. Während wir alle frühstücken, muss sie nämlich die Jause herrichten. Das ist so üblich, dass Frauen für alles zuständig sind, was Verpflegung betrifft. Vor kurzem ist im Fernsehen ein Bericht gelaufen, in dem es darum ging, dass sich Männer und Frauen den Haushalt teilen sollten. Man hat einen Mann beim Kochen und beim Wäscheaufhängen gesehen und die Frau ist mit dem Auto gefahren. Papa hat nur verächtlich gezischt und den Kopf geschüttelt. Solche Ideen, hat er gemeint, kann sich die Mama gleich aus dem Kopf schlagen. Alles, was mein Vater in der Küche tut, ist, sich ein Bier aus dem Kühlschrank zu holen. Ich glaube, er hat noch nicht einmal eine Semmel entzweigeschnitten, seit er mit meiner Mutter verheiratet ist. Ich persönlich interessiere mich für das Kochen und Backen, aber ich fürchte, es würde Papas Vorstellung von der Welt völlig erschüttern, wenn ich mich darin ernsthaft versuchen würde. Wahrscheinlich würde er mich einen „warmen Bruder“ schimpfen. Wie die entsprechende Bezeichnung für die Schwestern heißt, weiß ich leider nicht. Kann man ja auch nirgends nachschlagen. Das einzige Buch, das ich bei uns zu Hause zum Thema Sexualität gefunden habe, stammt von der katholischen Kirche. Das haben meine Eltern zur Hochzeit bekommen, es steht vorne drin. Obwohl meine Mama es im Nachtkästchen versteckt, habe ich es gründlich gelesen. Die wesentlichen Teile halt. Und Homosexuelle kommen da nur vor, wenn es darum geht, wie man sie heilen könnte. Im Eheratgeber kommen sie dann natürlich überhaupt nicht mehr vor. Was aber drinnen steht, ist, dass beim ehelichen Beiwohnen vor allem molligen Frauen ein Polster unter das Gesäß geschoben werden sollte. Ich meine, ich sitze auf der Küchenbank auch gerne auf einem Polster, aber was hat das mit dem Eheleben zu tun?
Sexualität war wohl jenes Gebiet, auf dem sich seit seiner Kindheit am meisten verändert hatte. Über Homosexualität wurde damals überhaupt nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen, und die Kirche wie die Volkspartei waren sich darin einig, dass Schwule entweder zu heilen waren oder hinter Gitter zu wandern hatten. So war es natürlich verständlich, dass Eltern große Angst davor hatten, dass ihre Kinder homosexuell sein könnten.
Mama schneidet also zwölf Semmeln entzwei und legt Wurst auf die jeweils untere Hälfte, in neun davon kommen noch Essiggurkenscheiben hinein, denn die Uschi mag keine Essiggurken. Dann werden die Semmeln zusammengeklappt. In Windeseile, denn wir müssen bald zum Bus.
Dann muss sie auch noch die Küche blitzblank putzen, denn wie sieht denn das aus, wenn die Küche nicht aufgeräumt ist, und es ist niemand zu Hause. Da könnte ja dann die Frau Weichselbaumer, die uns die Blumen gießt, herumerzählen, dass die Niedermayrs nach Italien gefahren sind, ohne dass die Frau Niedermayr die Küche ordentlich aufgeräumt hat. Und wenn jemand etwas Unangenehmes über einen herumerzählt, das ist so ziemlich die größte Katastrophe, die man sich vorstellen kann. Nicht, dass sich meine Eltern dabei zurückhalten würden, Schlechtes über andere herumzuerzählen. Sogar über die Frau Weichselbaumer. Die soll ja, so meine Mama, das Unkraut in ihrem Gemüsebeet wild wuchern lassen, sodass sie Schädlinge, die dann unser Gemüse auffressen, geradezu züchtet. Außer Lästern gibt es wenig Möglichkeiten zur eigenen Unterhaltung.
Mama wickelt die Semmeln in Butterbrotpapier und stopft sie in den alten, leinenen Rucksack, den die Eltern vom Opa geerbt haben. Er sieht so aus wie der Rucksack, den der Jäger auf dem uralten Gemälde mit dem röhrenden Hirsch auf dem Rücken trägt. Es hängt oben bei Oma über dem Bett. Dazu packt Mama ein bisschen Saft in alten Feldflaschen aus Blech.
Plastikflaschen gab es damals nicht. Überhaupt keine. Das Wasser trank man von der Leitung. Kein Mensch kaufte Mineralwasser, denn es war sehr teuer. Nur Opa bekam welches, weil es der Arzt empfohlen hatte. Und das wurde in Glasflaschen verkauft, wie auch alle anderen Getränke, sogar die Milch. Seltsam war das. Er konnte sich an keinerlei Kunststoffverpackungen erinnern. Sogar das Yoghurt war in braune Glasflaschen gefüllt worden.
Den Rucksack muss Papa tragen. Als wir schon auf der Straße sind, kehrt Mama noch einmal um, weil sie sich nicht sicher ist, ob sie den Herd abgeschaltet und die Haustür zugesperrt hat. „Jetzt tu einmal weiter!“, schimpft Papa. Mich wetzt meine kurze Hose jetzt schon, im Schritt und überall. Am liebsten hätte ich meine Lederhose angezogen, die hat man mir mit genug Reserve zum Hineinwachsen gekauft. Aber Mama war dagegen. Für Italien, hat sie gesagt, ist eine Lederhose auf keinen Fall fein genug. Ob ich denn aussehen will wie ein Bauernstoffel.
Fast im Laufschritt geht es zur Abfahrtsstelle unseres Busses. Es ist immer noch stockfinster, und in unserer Straße gibt es nur eine dürftige Beleuchtung, die flackert. Jetzt beginnt es noch dazu zu regnen. „Wären wir doch daheim geblieben!“, jammert Mama. Das macht Papa immer wütend, wenn Mama so zu jammern anfängt. Vor allem über Sachen, die längst schon vorbei oder gar nicht mehr zu ändern sind. „Jetzt reiß dich einmal zusammen, Traudi!“, schimpft er. „Eine Woche Vollpension, das ist doch was! Andere fahren zelten, da müssen die Frauen auch in den Ferien drei Mahlzeiten auf den Tisch bringen! Du weißt gar nicht, wie schön du es hast!“ Mama ist verschnupft, weil er schon wieder vergessen hat, dass sie „Edeltraud“ genannt werden möchte.
Vollpension war mittlerweile schon fast in Vergessenheit geraten. Das hieß, man setzte sich zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen in den Speisesaal des Hotels und bekam das Essen vorgesetzt. Aussuchen konnte man sich dabei wenig, man musste nehmen, was der Küche recht war. Mit dem heute gefragten „all inclusive“, wo man Berge von Delikatessen einfach von einem Buffet auf den eigenen Teller türmt, konnte die Vollpension naturgemäß nicht mithalten. Aber keiner in seiner Familie hatte damals je in seinem Leben ein All-you-can-eat erlebt, und so war für jemanden wie ihn, der gerne aß, so eine Vollpension eigentlich der Himmel auf Erden.
Als wir in den Bus einsteigen, gibt es leider wieder Ärger. Mama und Papa haben die Plätze auf der Achse bekommen, direkt über den Hinterrädern. „Da setz ich mich auf keinen Fall hin, da wird man durchgeschüttelt und mir wird schlecht!“ Mama wirkt leicht hysterisch. „Hast du das etwa beim Bestellen nicht dazugesagt, dass wir gute Plätze haben wollen?“ Papa zuckt mit den Schultern und zischt ihr irgendwas ins Ohr. Vor lauter Aufregung stößt Mama mit dem Kopf gegen das Gepäcksnetz über den Sitzen, wovon ihre auftoupierte Frisur eine leichte Delle bekommt, die sie noch mehr aufregt. „Ich will wieder hinaus!“, jammert sie. „Warum kaufst du uns auch kein eigenes Auto! Das ist ja eine Zumutung hier!“ Ich mache mich auf meinem Platz eine Reihe weiter vorne ganz klein, damit niemand merkt, dass ich zu dieser Familie gehöre. Auftoupiert heißt übrigens, dass man Haarsträhnen hochzieht und sie dann mit Haarspray versteift. So entsteht eine Art Helm, der hochmodern, aber sehr empfindlich gegen das Zerzausen ist. Mama kann daher ihren Kopf auch nicht an die Rückenlehne des Sitzes lehnen.
Irgendwie schafft Papa es, Mama zu beruhigen. Sie hat auch überhaupt keine Gelegenheit für Debatten mehr, denn der Bus ist schon losgefahren. Dicke Rauchschwaden ziehen über mich hinweg, denn nach der Abfahrt haben sich fast alle Passagiere – sozusagen zur Feier des Tages – Zigaretten angezündet. So etwas wie Rauchverbot, das gibt es nicht. Geraucht wird ständig und überall. Es gibt zwar Gerüchte, dass Rauchen ungesund sei, aber niemand glaubt ernsthaft, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Lungenkrebs, an dem die Hälfte aller Männer stirbt, und dem Rauchen geben könnte. „Mein Großvater“, sagt Papa zum Beispiel, „ist 83 geworden und hat bis zum letzten Tag geraucht!“ Das genügt ihm als Beweis dafür, dass er sich keine Sorgen zu machen braucht. Rauchen gilt sogar als fein, deshalb raucht auch meine Mama. Lange, schmale Zigaretten, die ein bisschen nach Pfefferminz riechen. Man sieht auch überall an den Plakatwänden ganz edel gekleidete Menschen, die sich im Zigarettennebel wohlfühlen.
Ganz vorne hat einer ungeniert seine Pfeife angezündet, und wenn mich nicht alles täuscht, hat sich der Busfahrer eine Zigarre in den Mundwinkel gesteckt. Niemanden stört das. Man kann jetzt wohl einwenden, dass ja dann am Ende der Reise in Caorle alle ganz fürchterlich nach Tabak stinken müssen. Das ist zwar richtig, aber egal. Überall stinken alle nach Tabak, sodass das niemandem auffällt. Auch wir Kinder stinken natürlich, denn wir werden ja mit eingenebelt.
Langsam wird es hell, und auf dem ersten Pass, der zu überqueren ist, dem Pyhrnpass, gibt es schon die erste Pause. Weil von dem Geschaukel im Bus und der schlechten Luft vielen übel geworden ist. Die müssen jetzt alle aussteigen und kotzen. Mama will auch aussteigen. „Kommt, wir vertreten uns ein bisschen die Beine!“, lockt sie uns. Als ich aus dem Bus steige, merke ich, wie kalt es hier oben ist. Ich friere erbärmlich in meiner kurzen Hose. Uschi jammert. „Marlene ist kalt!“ Sie legt einen Fetzen um die kleine, schwarzhaarige Puppe, die sie immer bei sich hat. Dauernd redet sie von ihr, als wäre sie ein wirklicher Mensch. Manchmal frage ich mich, ob sie ganz richtig im Kopf ist, aber meinen Eltern ist anscheinend noch nichts aufgefallen.
Papa zündet sich eine Zigarette an und wirft einen skeptischen Blick auf die fast leere Packung. „Ich muss mir vor der Grenze noch welche kaufen. Wer weiß, was die Katzelmacher da unten für ein Zeug rauchen.“ Katzelmacher, das ist die inoffizielle Bezeichnung für Italiener. Meine Eltern machen kein Hehl daraus, dass sie die Italiener für faule, primitive Menschen halten. Ich habe noch nie jemandem zugehört, der anders denkt, und niemand macht meinen Eltern deswegen den Vorwurf, sie seien Rassisten. Vor allem mein Opa nicht. Der ist, sagt Mama, ein alter Nazi und schimpft auf alles, was nicht deutsch und blond ist. Das geht vor allem dann los, wenn man ihn vor die Fernsehnachrichten setzt. Kaum hat eine Meldung begonnen, gibt er schon lautstarke Kommentare zu allem und jedem ab. Meist, dass alle Deppen und Trottel sind, und Kommunisten obendrein. Ich habe noch nicht herausgefunden, was Nazis und Kommunisten sind, weil es mich, ehrlich gesagt, wesentlich weniger interessiert als meine Karl-May-Bücher. Aber irgendwann muss ich das auch wissen.
Um halb zehn Uhr kommen wir in einen kleinen Ort, der schon in der Steiermark liegt. Dort wird vor einem Wirtshaus angehalten. „Jetzt gibt’s ein kleines Gulasch! Zur Stärkung!“, ruft der Busfahrer ins Mikrophon. Ich würde lieber nach Italien weiterfahren. Mama holt den Rucksack aus dem Gepäcksnetz, aber Papa winkt ab. „Wenn alle ein Gulasch essen, dann tun wir das auch. Urlaub ist nur einmal im Jahr, und da kann man sich auch ein bisschen was leisten!“ Wenig später sitzen wir in der völlig verrauchten Wirtsstube und trinken Kracherl. Zumindest Uschi und ich. Kracherl, das ist das geläufige Wort für Limonade mit Bläschen drinnen. Wir kriegen es nur im Gasthaus und sind deswegen begeistert davon. Uschi hat ein Himbeerkracherl, das natürlich tiefrot ist, und ich ein Libella, ein Orangenkracherl in einer braunen Flasche. Auf das Gulasch verzichte ich lieber, weil ich mich schon auf die Wurstsemmeln freue.
Es dauert geraume Zeit, bis weitergefahren werden kann, und dann geht es auf die zweite Passstraße, den Triebener Tauern. Der Bus heult laut auf, kriecht aber nur im Schneckentempo die steile Rampe empor. Ich esse zwei Wurstsemmeln, die leider schon weich und klebrig geworden sind. Uschi eine halbe. Es dauert mindestens eine halbe Stunde, bis wir oben sind, und dann müssen wir auch gleich wieder stehen bleiben, weil viele erstens wegen dem Bier aufs Klo müssen und ihnen zweitens vom Gulasch, der Schaukelei und dem vielen Rauch schon wieder schlecht geworden ist. Mama geht es auch nicht gut. „Wären wir doch nur nicht da mitgefahren. Ich sag’s dir, wir kommen nie an! Nie!“ Papa winkt ab. Nachdem wir ausgestiegen sind, sieht sich Papa nach einer Tabaktrafik um, während Mama in den Grasstreifen am Straßenrand kotzt.
Ich sitze jetzt am Fenster neben Papa, Uschi hat die ganze Zeit gejammert, dass sie zu Mama möchte. Jetzt schläft sie mit dem Kopf auf ihrem Schoß. Ich habe inzwischen weitere zwei Wurstsemmeln gegessen und ungefähr hundert Seiten in „Winnetou II“ gelesen. Ich lese es zum dritten Mal. Mir wird zum Glück nicht schlecht, Papa auch nicht. Zu Mittag kommen wir schließlich in Kärnten an, wo, natürlich, wieder ein Wirtshaus auf uns hungrige und durstige Urlauber wartet. Mama braucht frische Luft und setzt sich mit Uschi auf eine Bank im Friedhof neben der Kirche, der gleich neben dem Gasthaus ist. „Das Letzte, was ich jetzt will, ist, dass ich mich schon wieder in eine so verrauchte Wirtsstube setze!“ Mamas Ton ist der, den sie verwendet, wenn sie klarmachen möchte, dass etwas auf keinen Fall fein ist. „Sollen wir euch schon was bestellen?“, fragt Papa. Mama schüttelt nur den Kopf. „Magst du ein Schnitzel?“, fragt mich Papa. „In Italien kriegst du so etwas nämlich nicht!“ Ich bin überzeugt. Im Gasthaus esse ich sogar den Salat zum Schnitzel, weil es eine Verschwendung ist, etwas übrig zu lassen, für das man bezahlt hat. Zu Hause lasse ich den Salat lieber stehen. Manche unserer Mitreisenden sind schon äußerst gut gelaunt, an einem Tisch wird gesungen und geschunkelt. „Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer!“, singen sie. Wenn Erwachsene zu viel getrunken haben, beginnen sie zu singen, haken sich an den Armen unter und schwanken mit dem Oberkörper im Takt zur Musik hin und her. Das heißt Schunkeln und gilt als äußerst unterhaltsam. Mama schunkelt nicht, denn es ist nicht … na, das muss ich nicht extra erklären. „Ich muss …“ Papa drängt zum Zahlen und Aufbrechen. Es ist die letzte Rast vor der Grenze, und er hat immer noch keine Zigaretten bekommen. Gegenüber vom Wirtshaus erspäht er Gott sei Dank eine Trafik und kauft sich eine Stange Smart Export. Zehn Packungen. „Hoffentlich“, meint er, „komme ich damit aus. Sonst ist der ganze Urlaub …“ Er erklärt mir nicht, was der ganze Urlaub dann wäre.
Im Bus wird es nach der Mittagsrast ruhiger, anscheinend hat das Rauchen, Trinken, Essen und Singen unsere Mitreisenden so erschöpft, dass viele davon eingeschlafen sind. Es wird allerdings immer heißer, und ich fange an zu schwitzen. Zum Fenster scheint die Sonne herein. Klimaanlagen kennen wir nur aus amerikanischen Filmen, deswegen beginnt der Schweiß bereits über mein Gesicht und den Rücken hinunterzulaufen. Papa stöhnt. Zur Erleichterung zündet er sich eine Zigarette an. Ich versuche es mit zwei Wurstsemmeln. Ich fühle mich dann zwar wohler, aber mir ist immer noch heiß. Fünf Semmeln sind noch da, ich habe sechs gegessen, Uschi und Mama je eine halbe und Papa gar keine. Ihm haben das Gulasch und das Schnitzel gereicht.
Plötzlich hält der Bus an. „Grenze!“, schreit der Fahrer, und zumindest die, die wach sind, beginnen hektisch in ihren Handtaschen und Rucksäcken nach den Pässen zu suchen. Papa zieht lässig seinen Reisepass aus der hinteren Hosentasche. „Allzeit bereit!“, sagt er grinsend. Ich habe keinen Pass, denn ich bin in Papas Pass eingetragen, genau wie Uschi. Es ist das allererste Mal, dass ich über eine Staatsgrenze fahre, und ich bin gespannt, was da auf uns zukommen wird. Mama hält ihren Reisepass auch schon in der Hand und schaut nervös über die Sitzlehne zu uns zurück. „Ob wir streng kontrolliert werden?“, fragt sie. Papa winkt lässig ab. „Die Katzelmacher sind ja froh, dass wir kommen und ihnen unser ganzes Geld dalassen!“, sagt er.
„Die Carabinieri kommen!“, ruft der Busfahrer. „Pässe!“ Ich habe keine Ahnung, was Carabinieri sind. Plötzlich öffnet sich die Bustür mit einem lauten Zischen und ein Mann in einer prächtigen Uniform steigt ein, der laut „Passaporti!“ ruft. Der Uniformierte ist der erste Mensch in meinem Leben, der nicht Deutsch spricht. Ich rutsche nervös auf meinem Sitz hin und her. Papa zuckt zusammen, obwohl er vorher noch so lässig war. Ich stehe auf, um einen Blick nach vorn zu erhaschen. Der Offizier bewegt sich langsam durch die Reihen, nimmt den einen oder anderen Reisepass in die Hand, blättert sogar gelegentlich darin herum. Schließlich gibt er die Pässe mit einer arroganten Geste den Besitzern zurück. Papa zieht mich auf den Sitz. „Nicht auffallen!“, zischt er mir zu. Als der Carabinieri zur Reihe vor uns kommt, lächelt er Mama zu. „Bella signora!“, sagt er. Mama lächelt zurück und sagt „Grazie!“, während Papa leise, aber deutlich wahrnehmbar schnaubt. „Buon viaggio!“, sagt der Offizier, als er Mama den Pass zurückgibt. Er verbeugt sich sogar ein klein wenig.
Mit einer ziemlich herrischen Geste fordert der Mann danach Papas Reisepass und blättert ihn durch. „Ah, Adolf!“, grinst er. Dann streckt er die rechte Hand nach oben und schreit „Meine Fuhrer!“. Grinsend gibt er den Pass zurück, während Papa in seinem Sitz zu versinken scheint. Ich habe keine Ahnung, was das ganze Theater zu bedeuten hat, nehme mir aber vor, Papa danach zu fragen, wenn er wieder besser gelaunt ist. Momentan ist Feuer am Dach, denn kaum ist der Mann draußen und der Bus losgefahren, wirft Papa Mama vor, mit dem Italiener geschäkert zu haben. „Das kann ja lustig werden“, flüstert er nach vorne, „wenn du schon auf den ersten Papagallo hereinfällst, der uns begegnet!“ „Mach dich nicht lächerlich!“, kontert Mama. „Ich war lediglich höflich. Und dass ich ein paar Worte Italienisch gelernt habe, das wird uns sicherlich nützlich sein!“ Papa sagt nichts mehr, schmollt aber weiter.
Was ein Papagallo ist, das muss ich auch noch herausfinden. Es ist schrecklich heiß im Bus. Obwohl ich immer heftiger schwitze, finde ich die Reise schön langsam interessant. Man lernt viel Neues kennen. Ein paar dicke Frauen haben sich bereits so weit ausgezogen, dass ich befürchte, dass das, was sie noch am Leib haben, eher als Unterwäsche einzustufen ist. Sie wedeln sich mit ihren Klatschmagazinen frische Luft zu. So weit so etwas in unserem Bus überhaupt verfügbar ist. Der Bus fährt immer langsamer, gelegentlich kommt er sogar zum Stillstand. Es scheint sich ein Stau gebildet zu haben. „Urlauberschichtwechsel“, erklärt Papa wissend. „Am Samstag. Da fahren alle hinunter. Kanaltal.“
„Intermezzo!“, schreit der Busfahrer und fährt auf einen Parkplatz. Es ist aber nicht nur ein Parkplatz, es gibt da auch ein langgestrecktes Betongebäude, das aussieht, als wäre es nicht fertig geworden, bevor man es in Betrieb genommen hat. Es gibt nämlich keine Türen und Fenster, trotzdem aber überall Geschäfte und Marktstände. „FABRIK BILLIGER JAKOB“ steht in großen Lettern auf dem Beton. Unsere Mitreisenden drängen sich hastig aus dem Bus. Als ich aussteige, erschlägt mich die Hitze fast. So heiß, kommt mir vor, ist es bei uns zu Hause nie. „Wir schauen uns ein bisschen um!“, sagt Mama. Uschi nimmt gleich ihre Hand. „Ich geh mit!“ Papa zuckt mit den Schultern und schließt sich einer Gruppe von Männern aus unserem Bus an, die auf ein paar schattige Tische an einer Bude zusteuern, an der anscheinend Getränke verkauft werden. Ich merke Papa an, dass er unsicher ist, als er zu der Bude hintritt. „Birra!“, sagt er, und „Limonade!“ Der Mann in der Bude stellt zwei Flaschen vor ihn hin. „Quattrocento“, sagt er. Papa sieht ihn ratlos an. Der Mann grinst so breit, dass sich seine Schnurrbartspitzen heben. „Nix Italiano? Deitsch?“ Papa nickt. „Viereunderte“, sagt der Mann und streckt vier Finger hoch. Papa sieht ihn ratlos an. „Vierhundert?“, frage ich erstaunt nach. „So viel?“ Papa sucht in seiner Geldbörse. Er hat sich noch nicht mit dem italienischen Geld vertraut gemacht und legt schließlich einen Tausender auf den Tresen.
„Teuer ist das Bier!“, sagt Papa, als wir schließlich an einem Tischchen Platz genommen haben. „Und das Kracherl erst!“ Meine Flasche heißt „Lemonsoda“, ist giftgelb und schmeckt sehr künstlich. Ich vermisse unser österreichisches Kracherl. Ob ich mich mit dem italienischen anfreunden kann, weiß ich noch nicht. „Und warm ist es, und schmecken tut es auch nicht!“, schimpft Papa. „Da haben wir uns was angefangen! Aber es hat ja unbedingt Italien sein müssen!“
„Ich muss aufs Klo!“, erkläre ich. „Wie heißt denn das auf Italienisch?“ Papa zuckt mit den Schultern. „Ich finde das aber alleine nicht!“ Seufzend trinkt Papa sein Bier aus. Gott sei Dank finden wir ziemlich schnell zwei Türen, die mit passenden Symbolen gekennzeichnet sind. Als ich allerdings in die Toilettenkabine trete, erstarre ich vor Schreck. Da ist nur ein Loch im Boden. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Oben hängt ein Spülkasten mit einer Kette daran, und auch eine Rolle Klopapier liegt auf einem Brett an der Wand. Fliegen summen. Ich muss plötzlich nicht mehr und verlasse die unangenehm riechende Kabine.
Als wir wieder in den Bus steigen, klebe ich mit den Oberschenkeln fast auf den glühend heißen Plastiksitzen fest. Zuerst überlege ich, ob ich meine Erfahrungen mit einem italienischen Klo mit meiner Familie teilen soll, dann tröste ich mich stattdessen mit einer Wurstsemmel. Die ist inzwischen badewannenwasserwarm und batzweich geworden, und sie schmeckt auch schon etwas komisch. Mit dem „Winnetou“ in der Hand dämmere ich ein wenig weg. Am liebsten wäre ich jetzt wieder daheim in meinem Zimmer. Wenn ich das Fenster aufmache, weht kühle Luft aus dem Garten herein … „Aufwachen!“, ruft Mama. „Wir sind da-ha!“ Schlaftrunken blinzle ich aus dem Fenster. Der Bus fährt noch. „Die Ortstafel ist schon vorbei!“, informiert mich Papa.
Es dauert noch geraume Zeit, bis sich der Bus durch die engen Straßen zum Hotel gewunden hat. Fast alle sind vor Aufregung aufgesprungen und starren aus den Fenstern. „Da ist schon das Hotel Marco Polo!“, ruft eine der dicken Frauen vor mir. „Und da das Miramare! Nur noch zwei Häuser weiter!“ Sie scheint sich hier schon auszukennen. Schließlich kommt der Bus rumpelnd zum Stehen.
2 Das Hotel
Papa hatte auch das Hotel fotografiert, allerdings nur von außen. Es lag direkt an einer Straßenkreuzung, trotzdem konnte er sich nicht erinnern, unter dem Lärm gelitten zu haben. Als Kind schlief man wohl tief und fest, ohne dass einem Umwelteinflüsse dabei viel ausmachten. Eine schmale Fassade, noch schmälere Balkone, und er war sich ganz sicher, dass die Zimmer damals lediglich über ein Waschbecken, nicht aber über WC und Dusche verfügt hatten. Papa hatte zwar nicht das Zimmer, aber die Aussicht auf die Straße fotografiert. Einige Mopeds konnte man verschwommen erkennen, die Markise des Cafés gegenüber dafür deutlich. Sie war blau-weiß gestreift und trug den Schriftzug „Spumante“. Er erinnerte sich, dass seine Eltern gern von diesem – selbst für ihre Verhältnisse extrem billigen – Schaumwein getrunken hatten.
Das Ausladen der Koffer auf dem schmalen Gehsteig wird zum Chaos, und drinnen im engen Vorraum ist es nicht viel besser. Hinter der Rezeption steht ein hagerer Mann, der seine schwarzen Haare zurückgegelt über den Kopf gelegt hat. In seinem Mundwinkel baumelt eine Zigarette, während er unsere Namen auf einer Liste sucht. Es dauert, so kommt es mir zumindest vor, eine Ewigkeit, bis er „Nedermahere“ oder so etwas Ähnliches sagt. Papa reagiert zunächst nicht. „Das sind wir“, zischt Mama. Papa langt nach dem Schlüssel. Unser Zimmer ist im dritten Stock, und wir quälen uns zu viert samt unseren Koffern in den engen Lift. Dort ist es bei weitem heißer als draußen in der Rezeption, und es stinkt noch ärger nach Tabak. Kein Wunder, denn an der Wand des Lifts ist ein bereits überquellender Aschenbecher befestigt.
Als Papa die Zimmertür aufsperrt, starren wir zunächst ins Dunkel. Irgendwie riecht es muffig. „Da gehört einmal ordentlich gelüftet!“, sagt Mama. Sie schlüpft zwischen den ziemlich eng stehenden Betten durch und schiebt den hölzernen Fensterladen zur Seite. Eigentlich ist es ein Türladen, denn es gibt kein Fenster, sondern nur eine Tür zum winzigen Balkon. Kaum hat sie ihn aufgestoßen, dringen laute Straßengeräusche herein. „Das kann ja lustig werden!“, sagt Mama und stemmt die Hände in die Hüften, während sie vom Balkon hinunter auf die Straße schaut. Ich inspiziere das Zimmer. Gegenüber dem Doppelbett für die Eltern stehen hintereinander zwei schmale Betten an der Wand, die offensichtlich für Uschi und mich gedacht sind. Im Zimmer ist es drückend heiß. Papa lässt sich auf das Bett fallen. Es quietscht und hängt durch. „Hast du das gesehen, Traudi? Nur eine Bettdecke!“ Papa zieht erstaunt an der dünnen Decke herum. „Wie soll denn das gehen?“ Ich nehme das Bett, das gleich am Waschbecken steht.
Ja, Waschbecken. Es ist nämlich so, dass unser Hotelzimmer kein eigenes Bad und Klo hat. Dusche und Toilette, das ist alles auf dem Gang, und man muss es sich mit den anderen Bewohnern des Stockwerks teilen. Das ist ganz normal und überrascht unsere Eltern auch nicht. Unsere Tante Hermi in St. Edelgund vermietet auch zwei Privatzimmer an Fremde, die müssen sich das Klo und das Bad mit der Familie teilen. Und nach dem ersten Wannenbad ist meistens das warme Wasser aus, obwohl die Tante Hermi ein Schild am Haus hat, das „fließendes Kalt- und Warmwasser“ anpreist.
Dass es keinen Fernseher gibt, brauche ich eigentlich gar nicht zu erwähnen. Mama sagt, die Italiener haben nicht einmal zu Hause einen Fernseher stehen. Die meisten von ihnen zumindest nicht. Außerdem gibt es im Ausland sowieso kein deutsches oder österreichisches Fernsehen. Nur italienisches. Behauptet zumindest Papa. Und dieses Gequassel, so meint er, kann ohnehin kein Mensch verstehen.
Seufzend wuchtet Mama die Koffer auf die Betten und gibt ihr Bestes beim Versuch, alle unsere Sachen in die beiden wackeligen Schränke zu räumen. „Meinen Koffer brauchst du nicht ausräumen!“, erkläre ich. „Den schiebe ich unters Bett.“ Mama muss nicht unbedingt sofort herausfinden, wie viele Donald-Duck-Bücher ich in meinen Koffer gepackt habe. Unter dem Bett ist es ziemlich staubig. Hoffentlich merkt Mama das nicht, denn da ist sie ein bisschen empfindlich. Staub unter den Betten, das geht gar nicht.
Mama seufzt. „Ob wir es hier eine Woche aushalten? Da fragt man sich wirklich, wozu man überhaupt auf Urlaub fährt. Erholung wird das jedenfalls keine.“ „Aber wir erleben was! Die Kinder haben was zu erzählen! Und sie lernen endlich das Meer kennen!“ Papa versucht, sie aufzumuntern. Plötzlich fällt mir ein, dass ich das Meer überhaupt noch nicht gesehen habe. Es müsste aber, das haben die Leute im Bus gesagt, gleich hinter dem Hotel sein. „Gehen wir das Meer anschauen?“, frage ich.
„Ich muss mich jetzt erst einmal frisch machen“, erklärt Mama. Papa hat es sich auf dem Bett gemütlich gemacht und raucht eine Zigarette. „Wir könnten ja alleine gehen“, schlage ich vor. Mama zischt durch die Zähne. „Damit ihr gleich von einem dieser wahnsinnigen Mopedfahrer über den Haufen gefahren werdet!“ „Lass sie doch!“, sagt Papa. „Ihr passt auf, oder?“ Ich nicke. „Ich will auch das Meer sehen, Papa!“ Uschi ist aufgesprungen. Und so nehmen wir beide den Lift, der schlingert und klappert, und fahren ins Erdgeschoß hinunter. Dort steht der Hotelbesitzer hinter der Rezeption und hat immer noch oder schon wieder eine Zigarette im Mundwinkel. „Bambini!“, grinst er. Ich nicke, grinse zurück und nehme Uschi an der Hand. Gemeinsam treten wir auf die Straße. Es ist heiß und laut. Gegenüber vom Hotel sitzen Leute in einem Café unter einer Markise und essen Eis. Darauf hätte ich jetzt auch Lust, aber Papa hat mir keine Lire gegeben. So heißt das italienische Geld. Ich ziehe Uschi hinter mir her. Da, gleich um die Ecke, da ist ein hoher Damm, und dahinter muss das Meer sein. Wir steigen die Stufen hinauf, und oben weht uns gleich eine erfrischende Brise ins Gesicht. Vor unseren Augen erstreckt sich ein breiter Strand, der mit Liegestühlen vollgestellt ist, die nicht so wie bei uns ganz durcheinander, sondern in Reih und Glied stehen. Dazwischen sind Wege angelegt, die zum Meer führen. Und auf den Wegen liegen Plastikmatten.