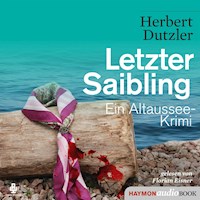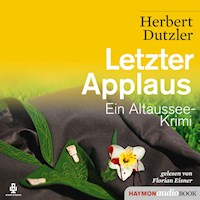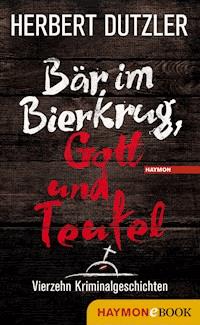Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Kind mit Wissensdurst und Erwachsene in Erklärungsnot Ich habe doch nur gefragt! Siegfried ist ein Junge, der viele Fragen an die Welt hat, die ihn umgibt. Anstatt sein Interesse wertzuschätzen, schelten ihn seine Lehrer für die Neugierde und nennen ihn frech. "Warum müssen wir die Erbsünde immer noch büßen?" oder "Was ist ein Nazi" sind Fragen, die mit einer Verwarnung oder einem Eintrag ins Klassenbuch bestraft werden. Er kann nicht nachvollziehen, wieso seine Mama unbedingt arbeiten gehen und den Führerschein machen will und wieso Papa nicht im Haushalt hilft. Wieso die Erwachsenen grundsätzlich immer sagen "das verstehst du noch nicht", wenn er es doch so gerne verstehen würde. Über das Hinterfragen von Geschlechterrollen und alteingesessenen Traditionen Siegfried wächst im Österreich der 1960er auf. In einer Zeit, wo Langhaarfrisuren wie die von den Beatles von den Maturanten in Siegfrieds Schule getragen, aber noch kritisch beäugt werden. In einer Zeit, in der Jungen wie Siegfried nicht mit der Oma zusammen kochen, Brötchen künstlerisch belegen oder Abenteuerromane lesen, sondern Fußball spielen sollen. In der sich die Frau um den Haushalt kümmert und der Mann entscheidet, ob sie arbeiten gehen darf. In der die Kriegszeit noch so präsent ist, dass nicht viel darüber gesprochen wird – besonders nicht darüber, dass ehemalige Mitglieder der Nationalsozialisten im Lehrerkollegium sitzen. Ein nostalgisch-kritischer Blick in die Vergangenheit Herbert Dutzler nimmt uns nach "Die Welt war eine Murmel" erneut mit auf eine Reise in eine Vergangenheit, die noch gar nicht so lange her zu sein scheint. Durch die Augen des Buben schwelgen wir in Erinnerungen an die ersten Erfahrungen im Gymnasium, die magischen Weihnachtsfeiertage als Kind. Gleichzeitig erleben wir Diskussionen der Eltern, den Druck gesellschaftlicher Erwartungen und Momente der Trauer. Doch gemeinsam mit dem erwachsenen Siegfried von heute erkennen wir, dass sich seitdem – glücklicherweise – einiges geändert hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Siegfried ist ein Bub, der viele Fragen an die Welt hat, die ihn umgibt. Anstatt das Interesse wertzuschätzen, schelten ihn seine Lehrer für die Neugierde und nennen ihn frech. Er versteht nicht ganz, wieso seine Mama unbedingt arbeiten gehen und den Führerschein machen will und warum es Papa so wichtig ist, der Herr im Haus zu sein. Statt Erklärungen bekommt Siegfried hohle Phrasen zu hören: „Das gehört sich so“ und „Das haben wir immer so gemacht“.
Herbert Dutzler nimmt uns nach „Die Welt war eine Murmel“ erneut mit auf eine Reise in eine Vergangenheit, die noch gar nicht so lange her zu sein scheint. Durch die Augen Siegfrieds schwelgen wir in Erinnerungen an Kindheitsjahre, teils unbeschwert und teils besorgt. Und so schön vieles auch war, erkennen wir doch gemeinsam mit dem Siegfried von heute, dass sich seitdem – glücklicherweise – einiges geändert hat.
Herbert Dutzler
Die Welt war voller Fragen
Roman
Für meine Enkel Gregor und Laurin. Eure Welt wird anders sein als die, die in diesem Buch beschrieben ist. Ich hoffe, besser. Trotzdem wünsche ich mir, dass ihr dieses Buch mit Neugier auf die Welt eures Opas lest.
1 Weihnachten in Kastenkirchen
Seltsam, fast bedrückend war es, auf das tote Haus zuzugehen. Ja, genau das war das Gefühl, das ihn beschlichen hatte, als er ein, zwei Wochen nach dem Tod seiner Mutter erstmals wieder hierhergekommen war. Das Haus war zwar voller Gerümpel, aber kalt und still. Es lebte nicht mehr.
Das Ausräumen würde wohl länger dauern, als er es sich vorgestellt hatte. Seine Frau hatte ohnehin gemeint, es wäre besser, eine Firma mit der Entrümpelung zu beauftragen. Er selbst hatte zunächst davon fantasiert, alles selbst zu machen, womöglich das Haus auch noch zu renovieren, bevor man es auf den Markt warf. Ein Kompromiss war herausgekommen – er hatte sich einen Monat ausbedungen, um aus- und aufzuräumen. Jetzt, nach einer Woche, war er noch nicht einmal mit den Fotoalben durch.
Er schloss die Tür auf und musste angesichts des Klingelschildes lächeln. „Edeltraud Niedermayr“ stand drauf. Seine Mutter hatte zeit ihres Lebens darauf bestanden, dass Vornamen vollständig auszusprechen und auszuschreiben waren, Spitznamen oder Abkürzungen hatte sie nie geduldet. So war er also Siegfried gewesen, seine Schwester Ursula, der Papa – leider – Adolf und sie selbst eben Edeltraud. Papa und auch alle anderen Familienmitglieder hatten die Namen abgekürzt – Traudi, Adi, Sigi und Uschi – und das war ein ewiges Streitthema zwischen den Eltern gewesen.
Er stieg die Treppen nach oben. Im ersten Stock des alten Bauernhauses hatten die Großeltern gewohnt, Papas Eltern, im Erdgeschoß er selbst mit den Eltern und seiner jüngeren Schwester Uschi. Die zweite Treppe, aus Holz und reichlich abgetreten, führte in die Dachschräge, die als Kind sein Reich gewesen war. Heute würde man so einen Raum, in dem kaum Platz war, aufrecht zu stehen, keinem Kind mehr zumuten. Er aber war hier glücklich gewesen, sein eigenes Reich, zwei Treppen hoch über einer stets fordernden Mutter, die wenig Verständnis dafür gehabt hatte, dass man in einem Buch für Stunden versinken konnte und es absolut unmöglich war, zwischendurch einmal hinunterzukommen, um den Müll auszuleeren oder Eier aus dem Hühnerstall zu holen.
Das eiserne Stockbett stand noch in seiner Dachkammer, die Matratzen hatte wohl irgendjemand schon vor Jahrzehnten entsorgt. Von seinen Besitztümern war nichts mehr da, vieles hatte er in sein neues Zuhause mitgenommen, anderes war unwiederbringlich verschwunden, verloren gegangen. Er öffnete die knarrenden Türen des schmalen Schranks, der neben dem Bett noch Platz gefunden hatte, und traute seinen Augen nicht. Da lag ein alter Lego-Karton. Villa mit Sportwagen. Den hatte er irgendwann zu Weihnachten bekommen, das musste wohl in den späten sechziger Jahren gewesen sein. Er hob den verstaubten Karton auf, schüttelte ihn. Leer. Mit seinen Legosteinen war er nicht sonderlich sorgfältig umgegangen, meist hatte er sie beim Zerlegen eines Bauwerks unsortiert in eine alte Schuhschachtel geworfen. Es war nicht unwahrscheinlich, dass die Steine heute in einer Kiste seiner Kinder verstaubten, die auch längst nicht mehr mit Lego spielten.
Damals war ein solcher Bausatz ein Schatz gewesen. Seine Eltern hatten ihr Geld gut einteilen müssen, es war ihnen sicher nicht leichtgefallen, ihm diesen Wunsch zu erfüllen.
So etwa um halb neun am Heiligen Abend gelingt es mir, das Wohnzimmer mit meinen Geschenken unauffällig zu verlassen und in meine Dachschräge zu flüchten, nachdem ich die Platte mit den Weihnachtskeksen einer gründlichen Verkostung unterzogen habe. Papa ist mit seiner dritten Flasche Weihnachtsbock glücklich, Opa ist schon eingeschlafen und Mama und Oma sind mit Uschi beschäftigt, die getröstet werden muss, weil der neuen Puppe schon ein Arm abgefallen ist.
Der Lego-Bausatz mit der Villa mit Sportwagen ist leider allzu schnell aufgebaut. Nachdem ich den Wagen ein paarmal in die Garage und wieder herausgefahren habe, merke ich, dass das Haus doch recht klein ausgefallen ist. Eigentlich hätte ich für meinen Lego-Stadtplan ein größeres gebraucht. Aber vielleicht lässt sich das Gebäude ja mit meiner bestehenden Legosammlung erweitern.
Bevor ich aber den Lego-Stadtplan hervorhole, muss ich mir die drei Bücher anschauen, die ich noch bekommen habe. Das von Oma, sehe ich gleich, ist ein altes, gebrauchtes. Aber es ist in Leinen gebunden, noch gut erhalten und heißt „Huckleberry Finn“. Ich bin ein wenig enttäuscht, denn „Tom Sawyer und Huckleberry Finn“ ist an den Adventwochenenden schon in vier Teilen im Fernsehen gelaufen. Es war unglaublich spannend und ich kenne die Geschichte jetzt schon. Aber wer weiß, vielleicht steht im Buch mehr drin, als man im Film sehen konnte, das ist ja oft so. Zumindest war es bei den „Winnetou“Filmen so, die habe ich schon gesehen, und die haben fast gar nichts mit dem Buch zu tun gehabt. Im zweiten Packerl sind zwei neue Karl-May-Bände drinnen, „Im Lande des Mahdi I“ und „Old Surehand III“. Da werde ich mit dem „Old Surehand“ anfangen, die Wildwestgeschichten sind mir lieber.
Kaum habe ich die erste Seite aufgeschlagen, ruft mich Mama. Ich weiß schon, sie duldet es nicht, dass man sich am Heiligen Abend zurückzieht und sich mit seinen eigenen Geschenken beschäftigt, da muss die Familie harmonisch miteinander feiern. Und damit es so richtig einträchtig und gemütlich wird, gibt es spätabends am Heiligen Abend immer noch ein paar belegte Brötchen. Denn wer isst, kann bekanntlich nicht streiten. „Du kannst mir gleich den Kren reiben für die Schinkenbrötchen!“, empfängt mich Mama. Ich seufze zwar so laut und ausgiebig, dass sie es bestimmt nicht überhören kann, aber ich hole mir Kren und Reibe und beginne meine tränenreiche Arbeit.
An dieser Stelle muss man vielleicht erklären, dass wir keine normale Familie sind. In einer normalen Familie helfen die Mädchen in der Küche und die Buben gehen mit den Vätern und Opas auf den Fußballplatz oder an den Fischweiher. Das alles funktioniert bei uns nicht, denn Fußball und Fischen sind mir ein Gräuel, Papa hat es mit mir schon probiert, aber es hat nicht funktioniert. Dazu kommt, dass ich seit unserem Caorle-Urlaub im September meine Liebe zum Kochen entdeckt habe. Der Grund dafür war, dass ich in Italien zum ersten Mal in meinem Leben Pizza gegessen habe. Und weil es die bei uns nicht gibt, habe ich selbst eine gebacken. Sogar Papa hat sie gegessen. Die Liebe zum Essen, die war allerdings schon viel früher da, was man mir leider ansieht. Ich bin froh, dass wir in meiner Klasse wenigstens noch den dicken Holzinger haben, denn sonst wäre ich der Dickste von allen. Mir reicht die Brille, ich habe keinen Bedarf an weiteren Gründen, von den anderen ausgelacht zu werden.
Uschi ist für Hilfestellungen in der Küche überhaupt nicht zu gebrauchen, die kann man nicht einmal zum Umrühren einteilen, im Sommer hat sie sogar die Marillenmarmelade anbrennen lassen. Vielleicht probiert Papa es bei ihr einmal mit Fußball und Fischen, aber ich glaube nicht, dass er sich das traut. Die Stärke von Uschi liegt in der Musik, sie lernt Blockflöte, und ihre Lehrerin ist angeblich ganz hingerissen von ihrem Talent.
Seit bekannt geworden ist, dass ich koche und backe, hat Papa sich immer wieder darüber beschwert, dass ihm seine Freunde prophezeien, dass aus mir einmal ein warmer Bruder werden wird. Papa fürchtet das zwar auch, sagt dann aber immer zu seiner Verteidigung, „den geben wir in die Lehre zum Kirchenwirt, da kocht auch ein Mann, und das ist auch kein warmer Bruder“. Aber so einer werde ich sowieso nicht, denn die Gehbauer Ulli, die in die zweite Klasse geht, die fährt immer im Zug mit mir nach Seeklausen ins Gymnasium. Und die Ulli hat schon einen Busen, ich glaube sogar, dass er von September bis Weihnachten um ein gutes Stück größer geworden ist. Immer, wenn ich die Ulli sehe, bekomme ich ein seltsames Gefühl und mir wird ganz warm. Bei meinem besten Freund dagegen, dem Herbert, bleibt dieses seltsame Gefühl völlig aus.
Den Herbert, den werde ich übrigens über die Weihnachtstage nicht oft sehen, denn der ist in den vergangenen Sommerferien plötzlich fromm geworden und hält sich am liebsten in der Kirche oder in der Sakristei auf. Ich glaube, der kommt aus seinem Ministrantengewand gar nicht mehr heraus. Einmal hat er mich mitgenommen, zum Ministranten-Schnuppern, und als wir in der Sakristei gestanden sind, da hat er die Luft tief eingesogen, laut „Ah!“ gemacht und danach irgendwie entrückt gewirkt. Auf mich hat die Sakristei-Luft keine Wirkung gehabt, ich hab nur die muffigen Ministrantenkittel gerochen. Aber bitte, wenn ihn das euphorisch macht, soll es sein. In unserem Lexikon habe ich gelesen, dass Weihrauch beruhigend, aber auch anregend auf das Gehirn wirkt. Vielleicht ist es das, was den Herbert so entrückt gemacht hat. Aber in der Sakristei hat es eher nach Mottenpulver gerochen, ich muss einmal nachschauen, ob man davon auch rauschig werden kann.
Mama überlässt es mittlerweile auch gerne mir, den weißen Wecken aufzuschneiden, weil ich mich mehrmals beschwert habe, dass sie Scheiben zu hastig herunterschneidet, sodass sie zerfleddert aussehen. Zum Brotschneiden braucht man Geduld, ein gutes Augenmaß und ein scharfes Messer, und meine Scheiben sind mustergültig.
Schließlich trage ich eine der beiden Platten mit Brötchen ins Wohnzimmer, sie sind mit Schinken, Leberstreichwurst und kaltem Schweinsbraten belegt. Weißbrot gibt es bei uns nur zu besonderen Feiertagen, sonst essen wir gewöhnliches Hausbrot, das von einem großen Wecken heruntergeschnitten wird. Und im Wohnzimmer gegessen wird überhaupt nur zu Weihnachten, sonst nie.
Uschi hat sich mittlerweile beruhigt, weil es Papa gelungen ist, den Arm wieder an die Puppe dranzumachen. Was mich wundert, denn er hat sicherlich keine allzu ruhige Hand mehr. „Ah!“, freut er sich über die belegten Brötchen, steht aber gleich wieder auf, weil er sich noch eine Flasche Weihnachtsbock von der Terrasse holen muss. Das Bier steht deswegen draußen, weil zu Weihnachten der Kühlschrank randvoll mit Vorräten ist, sodass Getränke keinen Platz mehr darin haben.
„Adolf!“, schüttelt Mama den Kopf, als Papa das Bier direkt aus der Flasche trinkt. „Wenigstens zu Weihnachten könntest du ein Glas nehmen! Wir sind ja nicht bei den Barbaren!“ Papa winkt ab. „Musst du nachher nur unnötig Geschirr abwaschen!“ Opa beißt in ein Schinkenbrötchen. Mit vollem Mund murmelt er: „Dass da unbedingt der Bub in der Küche helfen muss? Kann das nicht das Mädel machen?“ Er nickt mit dem Kinn in Richtung Uschi, die auf dem Boden hockt und gerade dabei ist, die Puppe am zuvor ausgerissenen Arm hochzunehmen. „Hab ich dir nicht gesagt, dass du das nicht machen sollst, du dumme Gurken!“, schimpft Papa lautstark. Wenn er getrunken hat, wird er oft ein bisschen grantig, da macht er wegen Weihnachten keine Ausnahme. Uschi fängt sofort wieder zu heulen an und flüchtet in Mamas Arme.
Opa nimmt sich ein Brot mit Schweinsbraten und murmelt mit vollem Mund: „Damals haben wir nichts gehabt, im Krieg. Und danach auch nicht. Höchstens, dass wir eine Brotsuppe gekriegt haben, zu Weihnachten. Und dann hat uns die Mutter vielleicht ein kleines Stück Geselchtes hineingetan, ein so kleines Stück!“ Er deutet es mit den Fingern an, wie klein das Stück gewesen ist. „Nicht einmal einen warmen Mantel hab ich gehabt, für den Winter! Nur eine Strickjacke, und die war noch dazu löchrig. Weil sie vor mir schon meinen älteren Brüdern gehört hat!“ Wenn das so losgeht, kann es gut sein, dass der Vortrag vom Opa eine halbe Stunde dauert, dabei wissen wir schon längst alles, weil er es uns mindestens einmal in der Woche erzählt, dass er nichts gehabt hat und wir heutzutage viel zu sehr verwöhnt werden.
„Es reicht schon, Opa, wir wissen’s eh! Magst nicht dann einmal ins Bett gehen?“ Gut, dass Oma der Tirade von Opa ein Ende macht, denn sonst hätte er bestimmt noch erzählt, dass sie nur ein Plumpsklo draußen im Hof gehabt haben und dass man sich dort den Hintern mit Zeitungspapier wischen musste und dass es im ersten Krieg nicht einmal das gegeben hat, da haben sie die Blätter vom Ahornbaum vor dem Haus nehmen müssen. Was sie dann im Winter gemacht haben, wenn der Ahorn keine Blätter hat, das hat uns Opa noch nicht verraten. Und ich mag das alles bei Himbeersaft und Schinkenbrot auch wirklich nicht hören.
„Früher, da sind wir wenigstens noch in die Mette gegangen!“, setzt nun Oma mit ihren Jugenderinnerungen da fort, wo sie Opa gerade zum Schweigen gebracht hat. „Aber heute gilt ja die Religion nichts mehr. Eine Schande ist das. Alle denken nur an Geschenke, Geschenke! An die Geburt unseres Herrn Jesu, an die denkt niemand!“ „Ist schon gut, Oma. Du kannst eh morgen mit den Kindern in die Kirche gehen. Der Adolf, der geht auch mit. Aber ich hab keine Zeit, ich muss ja das Essen herrichten für alle!“
„Wir haben nicht einmal Schuhe gehabt, wir haben mit den Holzschlapfen in die Mette gehen müssen! Durch den meterhohen Schnee!“, raunzt Opa.
„Das musst du dann aber beichten!“, belehrt Uschi Mama. „Wenn man an einem hohen Feiertag nicht in die Kirche geht, dann ist das eine Sünde! Die muss man beichten!“ Papa holt mit dem Arm hinter die Schulter aus. „Halt doch deine vorlaute Pappen!“ Uschi verzieht sofort das Gesicht, bevor Mama sie in die Arme schließen kann. „Adolf, du bist immer so grob!“, schimpft sie. „Vor allem, wenn du zu viel Bier getrunken hast! Heute keinen Bock mehr, hörst du!“ „Ist ja wahr!“, murmelt er, schon wieder besänftigt. „Das haben wir aber in der Schule gelernt!“, heult Uschi. Sie nimmt es mit der Religion ein wenig genauer als ich und versteht jedes Wort, das die Religionslehrerin sagt, eben – wörtlich. Dabei ist sie sonst gar nicht so hell auf der Platte, kommt mir vor, ich wundere mich, dass sie das ganze Zeug, das ihre Religionslehrerin erzählt, überhaupt behält. Ich selber habe es nicht so mit der Religion und habe mich schon in der Volksschule immer vor der Beichte gedrückt. Und überhaupt, seit unsere Astronauten ins All fliegen, sind mir noch mehr Zweifel gekommen. Wo soll sich denn da ein Gott verstecken? Und wenn es so viele Sterne und Galaxien gibt, wie ich in der „Bunten“ gelesen habe, dann sind wir für Gott so wichtig wie eine Fichtennadel in einem Ameisenhaufen. Denn er hat ja das ganze Universum, um das er sich kümmern muss, da hat er wahrscheinlich höchstens einmal eine halbe Stunde im Monat für uns auf der Erde. Aber sowas Kompliziertes, das kann man Uschi nicht erklären.
Irgendwie bin ich nach vier Broten doch fast satt, aber weil Uschi vor lauter Heulen aufs Essen vergessen hat, bleibt ein einsames Schweinsbratenbrot auf der Platte zurück, das ja schließlich auch jemand essen muss. Und auf der Keksplatte ist noch ein Kokosbusserl übriggeblieben, für das ich mich opfere, obwohl die Kokosbusserl nicht zu meinen Lieblingsweihnachtskeksen gehören.
„Und morgen geht’s schon wieder los!“, seufzt Mama. Am ersten Weihnachtsfeiertag kommen nämlich die Neustädter Omi und der Neustädter Opi, denn die wollen auch Geschenke bekommen und verteilen, und zu essen brauchen sie auch was. Mama macht am ersten Feiertag immer einen Rindsbraten, das ist auch etwas ganz Besonderes, denn Rindfleisch gibt es bei uns überhaupt nur einmal im Jahr. Dafür braucht sie am zweiten Feiertag nicht kochen, denn da fahren wir nach Kreuzstetten zu Mamas Schwester Hertha. Die ist mit dem dicken Onkel Alfons verheiratet und muss dann für einen ganzen Haufen Leute kochen.
Ich gähne lautstark, um große Müdigkeit vorzutäuschen, damit ich endlich zu meinem „Old Surehand“ komme. „Wird eh Zeit, dass die Kinder ins Bett kommen! Die Uschi ist schon so lästig die ganze Zeit!“ Oma unterstützt mich in meinem Vorhaben, ich gähne neuerlich, leider ohne vorgehaltene Hand, was mir einen Rüffel von Mama einbringt. „Nächstes Jahr kriegst du ein Benimmbuch zu Weihnachten, dass du’s nur weißt!“, droht sie. Dennoch halte ich mich für entlassen. „Gute Nacht!“, sage ich und höre vom Vorhaus aus, wie Uschi winselt, dass sie jetzt noch nicht ins Bett gehen mag.
Leider ist der „Old Surehand“ von Anfang an gleich sehr spannend. Ich kann nicht aufhören zu lesen, weil zuerst will ich wissen, ob es Winnetou und Old Shatterhand gelingt, den Verräter Old Wabble und den Osagenhäuptling Sieben Bären gefangen zu nehmen. Und dann wird es aber wieder gleich spannend, wie Old Shatterhand in das Camp der Osagen eindringt, um Apanatschka, den Häuptling der Komantschen, zu befreien.
Der Karl May kann es oft nicht lassen, recht ausführliche moralische Überlegungen in seine Geschichten einfließen zu lassen, Gott sei Dank nicht dort, wo es gerade spannend wird. Aber ganz am Anfang, da ist eine Stelle, wo er behauptet, dass es genügt, ein einziges unsittliches Bild anzuschauen, und die ganze Erziehungsmühe der Eltern löst sich in Rauch auf, und man geht in Fäulnis über. Das erinnert mich an das Heft mit den Bildern von nackten Frauen unter meiner Matratze. Es ist ja nicht so, dass ich mir das selber besorgt habe, Papa hat es mir gegeben, weil er glaubt, durch das Anschauen von solchen Bildern werde ich ein richtiger Mann. Ich weiß auch nicht genau, was er damit meint. Aber dass ich dadurch gleich in Fäulnis übergehe, das hat er wahrscheinlich nicht gewusst.
Es ist nämlich schon so, dass sich bei mir manchmal ein etwas unangenehmer Geruch breitmacht, wenn ich meine Hose hinunterlasse, denn wir baden nur einmal in der Woche. Dazwischen werden bloß Hände, Gesicht und Ohren gewaschen. Besonders wichtig scheinen die Ohren zu sein, obwohl die eh immer an der frischen Luft sind und dadurch selten zu stinken anfangen. Aber unten herum und unter den Achseln, da kann man die Fäulnis nicht gänzlich abstreiten.
Um halb elf höre ich, wie die Großeltern die Stiege heraufkommen und in ihrer Wohnung verschwinden. Opa schnauft heftig, es strengt ihn schon sehr an, die steile Stiege hinaufzuklettern.
Ich beschließe, das Heft in den Mist zu werfen und den Bildern darin keinesfalls mehr einen Blick zu schenken, weil ich dem Karl May doch vertraue, sogar in moralischen Angelegenheiten. Allerdings, wie und wo ich das Heft loswerden kann, das ist eine schwierige Frage. Ich kann es nicht einfach bei uns zu Hause in den Mist werfen, denn da würde es dann die ganze Familie sehen. Also muss ich es aus dem Haus schmuggeln und irgendwo in einem öffentlichen Mistkübel ablegen, wobei ich auf keinen Fall beobachtet werden darf.
Etwas, das er sich heute kaum mehr vorstellen konnte. Der gesamte Müll wurde in einem einzigen Kübel entsorgt, man machte keinen Unterschied zwischen Papier, Metall, Glas oder Plastik. Allerdings, wenn er sich zurückerinnerte – Plastikmüll hatte es damals kaum gegeben, in den Geschäften war alles entweder unverpackt oder steckte in Kartons. Die Wurst wurde in Wachspapier gewickelt. Beiihm zu Hause hatte es noch den Sautrankkübel gegeben, in den man alle pflanzlichen Abfälle und Essensreste warf. Den musste mindestens einmal in der Woche jemand zum Nachbarn hinübertragen und im Schweinestall in die Futterrinne leeren. Die Schweine stürzten sich geradezu darauf, aber er hatte diese Arbeit gehasst, weil der Kübel meist furchtbar gestunken hatte.
Um halb eins ungefähr lege ich den „Old Surehand“ zur Seite, nehme meine Brille ab und bemühe mich, einzuschlafen, obwohl die Brötchen in meinem Magen doch ein wenig drücken. Oder sind es die vielen Weihnachtskekse?
Irgendwie freue ich mich schon auf das Familientreffen am Stefanitag. Auf morgen nicht so sehr, denn die Neustädter Omi ist eine, die alles ganz genau nimmt. „Gutes Benehmen immer gefragt!“, sagt sie ständig, wenn sich jemand danebenbenimmt, und das tun wir in ihren Augen anscheinend alle. Zuletzt habe ich sie zu Allerheiligen gesehen, da habe ich versehentlich mein Hosentürl offengelassen, als ich vom Klo gekommen bin. „Gutes Benehmen immer gefragt!“, hat Omi gesagt und auf mein Hosentürl gezeigt. Und wenn Papa nach einem Schluck Bier rülpst oder Uschi wieder einmal erklärt, dass sie dies oder das nicht essen will: „Gutes Benehmen immer gefragt!“ Ich kann mich fast nicht daran erinnern, dass Omi irgendwann etwas anderes gesagt hat. Der Neustädter Opi ist ein gemütlicher Mann, er redet nicht viel, weil er sagt, er hat eh als Beamter auf der Bezirkshauptmannschaft in seinem Leben genug reden müssen, da ist es ihm ganz recht, wenn er sich das jetzt sparen kann.
In der Früh werde ich von Mamas Geschrei munter. „Siegfried! Tisch decken! Frühstück!“ Wir müssen in die Kirche. „Und ja nicht vergessen!“, ruft sie noch die Stiege herauf. „Hals und Ohren waschen!“ „Ja, ja!“, rufe ich zurück und mache mich, noch im Pyjama, auf den Weg nach unten. Papa sitzt am Tisch und hat den Kopf in die Handfläche gestützt. Er sieht sehr verschlafen aus, so, als ob man auch ihn unter Zwang aus dem Bett geholt hätte. „So, hol den Butter und die Marmelade aus dem Kühlschrank, den Schinken auch, heute ist ein Feiertag!“ Normalerweise gibt es bei uns nur Brot mit Butter und Marmelade oder Honig zum Frühstück. An einem Feiertag wie heute gibt es zusätzlich noch einen Briochewecken und, weil Weihnachten ist, auch Schinken. „Adolf, du machst bitte den Kaffee. Das wirst du ja wohl noch zusammenbringen!“ Papa stöhnt. Er erledigt niemals auch nur einen Handgriff in der Küche. „Du musst nur das kochende Wasser in den Filter schütten. Zuerst einmal wenig, dass alles feucht ist, und dann den Rest.“ „Ja, aber, wie soll ich denn den Häfen angreifen? Der ist ja brennheiß!“ Er stellt sich absichtlich blöd, das kennen wir schon. Ich hole einen Topflappen vom Haken und drücke ihm den in die Hand. Trotzdem flucht er, weil er ein paar Spritzer heißes Wasser abbekommt.
Als er sich wieder hinsetzt, schnauft er heftig. Das ist meistens so, wenn er am Abend zuvor zu viel Bier getrunken hat. Oft verstehe ich die Erwachsenen nicht. Warum trinken sie so viel, wenn sie doch wissen, dass sie am nächsten Morgen davon Kopfweh bekommen oder sogar speiben müssen? Rein wegen dem Durst kann das doch nicht sein?
Mama hat nicht einmal Zeit zum Frühstücken. „Ich trink nur schnell einen Kaffee im Stehen. Der Braten muss ja in die Röhre!“ Ich beobachte sie beim Gemüseschneiden. Sie macht es nicht so, wie der Fernsehkoch es erklärt hat. Man setzt die Messerspitze auf und vollführt danach sachte Wiegebewegungen, wobei die Finger zu einer Klaue geformt sind, dass das Messer an den Fingerknöcheln hinabgleitet und man sich nicht schneiden kann. Mama hackt einfach drauflos, aber ich hüte mich davor, ihr zu erklären, wie man das besser macht. Das hört sie nicht so gern. Sie wirkt schon wieder sehr gestresst. Dabei würde ich mir für den Briochewecken gerne mehr Zeit nehmen, aber ihrer üblen Laune möchte ich mich nicht länger aussetzen als unbedingt nötig. „Und dass ihr mir nicht vergesst, nach der Kirche meine Eltern vom Bahnhof abzuholen!“, ruft sie mir noch hinterher, als ich mich, das letzte Stück Brioche mit Marillenmarmelade noch in der Hand, verdrücken will.
Die Kastenkirchen-Oma steht schon mit aufgespanntem Schirm in der Haustür, als wir drei endlich fertig gewaschen, frisiert und angezogen sind. Papa hat seinen Steireranzug angezogen, aber der Krawattenknoten ist gründlich missglückt, weil Mama keine Zeit gehabt hat, ihn zu binden. Oma straft ihn mit missbilligenden Blicken. Ich hab einen Selbstbinder, den man vorne am Hemd einfach anklipsen kann. Das ist aus zwei Gründen recht praktisch. Erstens braucht man keinen Knoten zu binden, und zweitens kann man nicht gewürgt werden, wenn einen irgendein Feind daran zieht.
In Kastenkirchen hab ich zwar eh keine Feinde, aber einen Selbstbinder muss man auch bei den Schulmessen tragen, und da hab ich schon ein paar Feinde, obwohl der Schlimmste von allen schon vom Gymnasium geflogen ist. Aber es wär ja ein Wunder, wenn ich nicht gleich wieder einen neuen Feind angelernt hätte, das ist der Walter Zöbinger, einer von den Repetenten in der Klasse. So heißen die, die sitzengeblieben sind. Im Gymnasium nennt man nämlich vieles, ähnlich wie in der Kirche, mit lateinischen Wörtern. Damit wir uns gleich daran gewöhnen. Und der Zöbinger hat mir bei der Weihnachtsmesse den Selbstbinder heruntergerissen, dann aber wenig Freude daran gehabt und ihn einfach auf den Boden geworfen. Mama hat sich über den Dreck auf dem Selbstbinder gewundert und mich peinlich dazu befragt. Als ich erklärt habe, ich wäre hingefallen, hat sie mich gefragt, warum dann mein Hemd und meine Hose ganz sauber sind. Gott sei Dank hat sie auf mein Schulterzucken hin nicht weiter nachgebohrt, aber beim nächsten Mal werde ich darauf achten, auch den Rest der Kleidung ordentlich mit Dreck zu panieren, um einen Sturz glaubwürdiger darstellen zu können.
Uschi hat einen rosa Schirm, Papa und ich kommen mit einem Hut aus. „Hört eh gleich auf!“, erklärt Papa und marschiert mit finsterem Gesicht los.
In der Kirche ist es fast so fad wie immer, nur wenn der Kirchenchor Weihnachtslieder anstimmt, dann fühle ich auch so etwas wie Andacht. Der Herbert steht vorne und darf den Weihrauchkessel schwenken, wahrscheinlich ist er trunken vor Euphorie, weil er ihn in der Hand hält, seit er aus der Sakristei gekommen ist. Warum man allerdings ein Weihnachtslied singt, das davon handelt, dass ein Ross entsprungen ist, das bleibt mir, trotz Weihrauchschwaden, unklar. Weil, in der Krippe, da stehen ein Ochs und ein Esel, von einem Pferd ist gar nirgends die Rede.
Der Pfarrer predigt von Demut und ebenso wie Oma davon, dass viel zu wenige Leute an Christi Geburt denken, wenn sie Weihnachten feiern, sondern nur an Geschenke, an das Fressen und das Saufen. Das donnert er förmlich von der Kanzel, und Oma nickt beifällig. „Sag ich ja immer!“, flüstert sie. Papa sitzt nicht mit uns in der Kirchenbank, er steht, wie die meisten Männer, ganz hinten, damit er sich nach der Wandlung rasch davonmachen kann. Das ist in Kastenkirchen so üblich, denn die Männer müssen nach der Kirche noch schnell zum Frühschoppen. Damit sich vor dem Mittagessen noch zwei, drei Bier ausgehen, da muss man sich beeilen und die Messe ein wenig abkürzen. Heute allerdings hat Papa keinen Grund zur Eile, denn zu Weihnachten hat sogar unser Kirchenwirt geschlossen. Das, was der Pfarrer predigt, ist den Männern dennoch wurst.
Als wir dann zum Bahnhof pilgern, immer noch in strömendem Regen, denn es hat nicht aufgehört, wie Papa prophezeit hat, erinnere ich mich daran, dass ich Mama voriges Jahr gefragt habe, warum wir zu Weihnachten nicht einfach später oder gar am Abend essen, wenn es sich so schwer ausgeht mit der Messe und mit den Großeltern. „Weil sich das so gehört!“, war die Antwort. „Und weil das die Großeltern so gewohnt sind!“ Und dann ist mir noch beschieden worden, dass ich in Zukunft nicht so blöd fragen soll. Mittlerweile weiß ich, dass die meisten Fragen, die ich stelle, so beantwortet werden: Entweder gehört es sich so, oder wir haben das immer schon so gemacht. Meistens beides. Darüber hinaus gehende Erklärungen sind rar.
Die Neustädter Omi kommt in ihrem Pelzmantel kaum über die Treppe vom Waggon herunter. „Gott, wie ich mich freu!“, ruft sie schon, noch bevor sie uns überhaupt die Hand reichen kann. „Gutes Benehmen immer gefragt!“, sagt sie dann und schiebt den Koffer in Papas Richtung. Die Großeltern bleiben nämlich über Nacht bei uns. Erst morgen geht es weiter zu Onkel Alfons und Tante Hertha. Gott sei Dank hat es zu regnen aufgehört, denn wahrscheinlich würde Omi unter dem Gewicht des Mantels zusammenbrechen, wenn er nass werden würde. Außerdem riecht er schon trocken etwas merkwürdig. So ähnlich wie die Ministrantenkittel in der Sakristei. Ich strecke Omi die Hand hin, aber das reicht ihr nicht. Sie umarmt mich und drückt mich, sodass mein Gesicht fest in ihren Mantel gepresst wird. „Bist du aber gewachsen!“, jubelt sie, während ich um Luft ringe. Seit Allerheiligen, das habe ich selber gemessen, bin ich genau um einen halben Zentimeter gewachsen. Beim Gürtel allerdings um ein ganzes Loch.
„Servus, Rübezahl!“ Opi schlägt mir auf die Schulter. Im Mundwinkel hat er eine lange, dünne Zigarre hängen, die ganz enorm stinkt. Ich habe keine Ahnung, warum er mich immer „Rübezahl“ nennt. Ich kenne natürlich die Sagen über den legendären Riesen aus dem Erzgebirge, aber wenn man denen Glauben schenken darf, habe ich rein gar nichts mit ihm gemein. „Wieder einmal Weihnachten!“, seufzt der Neustädter Opi noch, dann machen wir uns auf den Weg nach Hause. Papa bleibt ein wenig zurück, er kommt mit dem Koffer ganz schön ins Schwitzen, fürchte ich.
Mama legt hastig ihre Schürze ab, als ich in die Küche platze und rufe: „Wir sind da!“ Omi umarmt auch Mama, etwas, das bei uns Niedermayrs nicht üblich ist. Wir beschränken uns auf das Händeschütteln, nur Omi ist so überschwänglich. „Der Braten ist gleich fertig. In einer halben Stunde! Setzt euch derweil ins Wohnzimmer!“, sagt Mama in einem Tonfall, dass man meinen müsste, sie entschuldige sich. „Aber wegen uns brauchst du dir doch keine solchen Umstände zu machen!“, flötet Omi. „Wer’s glaubt!“, murmelt Papa, der den schweren Koffer ins Wohnzimmer wuchten muss. Das kenne ich schon, „keine Umstände machen“. Anstatt dass man sich bedankt, ist es üblich, den Gastgeber oder die Gastgeberin darauf hinzuweisen, dass die Anstrengungen überflüssig sind. Falls aber der Gastgeber sich entscheidet, tatsächlich keine Umstände zu machen, dann ist man tödlich beleidigt und erzählt das auch überall herum. Die Erwachsenen sind manchmal kompliziert.
Dass es kulturell Unterschiede gibt zwischen uns und den Großeltern aus Neustadt, zeigt sich bald. Papa schenkt Rotwein aus einer Doppelliterflasche ein. „Zum Rindsbraten gehört ein guter Roter!“, erklärt er lächelnd. Anscheinend hat er sich von seinem Kater schon ein wenig erholt. Omi rümpft die Nase. „Wir trinken halt meistens einen Wein aus der Bouteille, nicht wahr, Alois?“ Opi nickt. „Der ist sicher auch in Ordnung!“ Omi zieht die Stirn in Falten, sagt aber nichts mehr, als Mama den Braten auf einer Platte hereinträgt.
Ich habe natürlich schon mitbekommen, dass teurer Wein meistens in kleine Flaschen gefüllt wird, die Oma „Bouteille“ nennt. Billiger Wein kommt im Doppelliter. Der Mann von der Himmelreicher Heidi, der verkauft Wein von seinem Cousin aus Niederösterreich in solchen Flaschen. Das macht er, sagt Papa, genau so schwarz, wie die Himmelreicher Heidi selber den Frauen die Haare macht. Schwarz heißt, dass man kein Gewerbe angemeldet hat und keine Steuern zahlt. Bei uns kann man fast alle Dienstleistungen schwarz in Anspruch nehmen, denn das Erste, was der Installateur fragt, wenn er zu einer Reparatur ins Haus kommt, ist: „Brauchen S’ eine Rechnung?“ Wenn man keine braucht, wird die Reparatur schwarz erledigt. Und wir brauchen nie eine.
Damit mir nicht fad wird, hole ich mir den „Huckleberry Finn“ herunter und will ein wenig lesen. Aber Opi nimmt mir das Buch gleich aus der Hand. „Ah!“, sagt er. „Wir lessen schon die Klassiker! Bist du nicht noch ein bisschen jung für sowas?“ Ich schüttle den Kopf. „Ich bin meinem Alter voraus. Beim Lesen.“ Opi tätschelt mir den Kopf. „War mein Lieblingsbuch, damals. Hat mir die Welt eröffnet!“ Ich bin gespannt, ob das auch bei mir so sein wird.
Die Neustädter Omi lobt den Braten zunächst überschwänglich. Mir schmeckt er auch hervorragend, ich brauche sehr viel Preiselbeermarmelade, Nudeln und Soße dazu. Leider bin ich der Erste an der Nudelschüssel und Omi warnt mit erhobenem Zeigefinger: „Gutes Benehmen immer gefragt!“ Die Erwachsenen bekommen Kartoffelkroketten, die anscheinend so schwierig herzustellen waren, dass Mama mehrmals fluchen musste und den Tränen nahe war. „Ich mach ihn halt immer mit Rotweinsoße!“, bemerkt Omi etwas dann spitz, ein klares Signal an Mama, dass die Soße nicht ihrem erlesenen Geschmack entspricht. „Für uns ist die Soße gut genug!“, steckt die Kastenkirchener Oma die Fronten ab. „Und Papierservietten hätten es auch getan!“ Demonstrativ legt sie die Stoffserviette beiseite, ohne sie zu benutzen.
Voriges Jahr hat es nämlich eine Debatte über Servietten gegeben, Omi hat gemeint, bei einem festlichen Essen gehören Stoffservietten unbedingt dazu, und Mama und Papa hätten doch zur Hochzeit von ihnen so wunderbare bekommen, aus Leinen, warum man die nicht verwende. Um auf ein anderes Thema zu lenken, schaltet Papa die Beleuchtung der venezianischen Gondel ein, die auf dem Fernseher thront. Die hat Mama zu Weihnachten bekommen, weil wir doch im Sommer in Italien auf Urlaub waren. Seither träumt Mama von einer Reise nach Venedig. „Na, was sagt ihr?“, fragt er hoffnungsvoll. „Ich war von vornherein dagegen, dass sie zu den Katzel- machern hinunterfahren!“, mault Opa. „Wem’s gefällt“, kommentiert Omi schulterzuckend.
Ich würde am liebsten wieder zu meinem Legoplan und zu „Old Surehand“, aber es muss auf den Nachtisch gewartet werden, den es auch nur zu hohen Feiertagen gibt. Bis es so weit ist, übe ich mich in einer Tugend, über die der Karl May oft und gerne schreibt. Man redet nicht viel, vor allem nichts Unnötiges, stattdessen soll man lieber nachdenken, da klärt sich vieles auch. Omi allerdings versucht mich in ein Gespräch zu ziehen. „Na, seid ihr schon gespannt, was das Neustädter Christkind euch heuer bringt?“ Gott sei Dank beginnt Uschi sofort loszuplappern und erklärt, für ihre Puppen bräuchte sie dringend einen Puppenwagen, dann ein Ausgehkleid für ihre neue Puppe und womöglich noch ein Kosmetikset mit Spiegel und Haarbürste. Ich kann mir schon denken, dass ich von den Neustädter Großeltern etwas Praktisches bekomme, was ich gar nicht brauchen kann. Das ist meistens so. „Für die Zukunft!“, sagt Omi dann immer, wenn ich beim Auspacken ein dementsprechendes Gesicht ziehe.
Leider wird vor der Nachspeise noch das Wohnzimmer vollgeraucht. Papa raucht eine Zigarette, Opa gibt zur Pfeife ein Hustkonzert und Opi zündet sich wieder eine dieser langen, dünnen Zigarren an. Endlich ist der Obstsalat mit Schlagobers serviert. Die meisten der Früchte kommen natürlich aus der Dose, weil es zu Weihnachten kein frisches Obst gibt. Ich wundere mich ein wenig, dass Omi am Dosenobst nichts auszusetzen hat. Als ich beim Austrinken des Saftes aus der Obstsalatschüssel schlürfe, gibt es doch wieder den erhobenen Zeigefinger. „Gutes Benehmen immer gefragt!“ Mama stöhnt, denn sie fasst das natürlich als Kritik an ihrer Erziehung auf, weil sie und Papa es offenbar verabsäumt haben, uns ordentliche Manieren beizubringen.
Die Bescherung hält, was ich mir von ihr versprochen habe. Ich packe einen Kugelschreiber aus und starre ihn etwas ratlos an. Omi erklärt: „Das ist ein ganz besonders exklusives Modell, den darfst du auf keinen Fall verlieren! Die Minen kann man sogar austauschen, eine Ersatzmine liegt bei.“ Ich quetsche ein Dankeschön heraus, obwohl wir in der Schule nur Bleistift und Füllfeder verwenden dürfen. Aber vielleicht kann ich den Kugelschreiber für meine schriftstellerische Arbeit brauchen. Omi tippt mit dem Finger gegen ihre Wange, was bedeutet, dass ein Küsschen fällig ist. Ich versuche, ihre Haut möglichst nicht zu berühren, dafür aber umso lauter zu schmatzen. Wider Erwarten bleibt die übliche Ermahnung aus. Uschi hat Möbel für ein Puppenhaus bekommen und kreischt vor Entzücken, während Omi erklärt, dass es sich um besonders hochwertige, auf keinen Fall billige Möbel handle, die sorgfältiger Handhabung und Pflege bedürfen. Wenn Uschi noch zu ungeschickt sei, um damit pfleglich umzugehen, möge man sie wieder in Seidenpapier wickeln und sie ihr später überreichen, wenn sie reif genug dafür sei.
Ich habe noch ein zweites Päckchen bekommen, in dem offensichtlich ein Buch steckt. Halleluja! Endlich etwas Vernünftiges! Mit dem „Old Surehand“ bin ich nämlich spätestens morgen durch, und die Bibliothek hat über die Feiertage geschlossen. Als ich das Buch aber ausgepackt habe, bin ich etwas ratlos. „Der neue Elmayer“ heißt das Buch, und darunter steht: „Gutes Benehmen immer gefragt“. Ob das ein spannender Roman ist? Ich öffne das Buch, aber Omi erklärt schon: „Jetzt, wo du ins Gymnasium gehst, musst du wissen, wie man sich anständig benimmt. Und da steht alles drinnen, was man für das Leben in der Gesellschaft braucht!“ Mama steht auf. „Heißt das, wir wissen nicht, wie man sich ordentlich benimmt?“ Ihre Stimme ist schrill, sie wirft ihre Stoffserviette auf den Tisch und knallt beim Hinausgehen die Tür hinter sich zu, dass die Glasscheiben zittern. „Tss, tss!“, macht Omi und schüttelt den Kopf. „Gutes Benehmen immer gefragt!“ Papa schenkt allen Männern noch Rotwein ein, die Doppelliterflasche ist jetzt leer.
Viel Zeit zum Schmollen hat Mama nicht, denn nach dem Abwaschen und Aufräumen der Küche muss sie für Kaffee und Kuchen sorgen, wobei Oma ihr hilft. Omi bleibt lieber im verrauchten Wohnzimmer. Und als dann der Kaffee getrunken ist und ich die letzten Kaffeehäferl in die Küche trage, sitzt Mama heulend auf der Küchenbank und schnieft: „Schon wieder eine Ladung Abwasch! Und dann geht es gleich mit der Jause weiter. Weil die Herrschaften natürlich auch ein Abendessen wünschen!“ Ich habe das Gefühl, dass das Verhältnis zwischen Mama und ihrer Mutter während des heutigen Tages nicht gerade herzlicher geworden ist. „Ich trockne ab!“, biete ich an. „Und zum Abendessen könnte ich Brote herrichten!“ Mama lächelt. „Im Ernst? Kannst du das denn?“ Ich nicke eifrig und lasse gleich einmal heißes Wasser in die Abwasch laufen. Irgendwer muss schließlich dafür sorgen, dass Mama auch ein bisschen was von Weihnachten hat.
Bei den Brötchen habe ich vor, etwas Besonderes zu bieten. Man sieht sich ja nicht umsonst Kochsendungen im Fernsehen an. Und da habe ich gesehen, wie der Koch für belegte Brötchen Käsestücke mit einem Keksausstecher ausgestochen hat. Die Ausstecher sind von der Weihnachtsbäckerei noch ganz oben in der Schublade, ich nehme einen Tannenbaum, einen Stern und einen Kometen. Unter den Käse kommt, was ich eben so finde, Butter, Wurst, kalter Schweinsbraten, Geselchtes und so weiter. Damit ein wenig Farbe ins Spiel kommt, lege ich auch Scheiben von Essiggurken darauf. Dann muss ich sehen, was ich in der Speisekammer noch finde. Sehr gut. Da sind roter Paprikasalat, gelbe Maiskölbchen und silberne Perlzwiebeln. Das wird alles sorgsam auf die Brote drapiert.
„Heiliges End!“, ruft Mama, als sie einmal nachsehen kommt, was ich so treibe. „Du hast alles aufgemacht, was ich schon für Silvester eingekauft habe!“ Ich halte inne und schweige, denn ich erinnere mich an die alte KarlMay-Tugend: Wenn es nichts zu sagen gibt, dann besser den Mund halten!
Plötzlich aber reagiert Mama völlig anders, als ich es erwartet habe. Sie umarmt mich und fängt zu schluchzen an. Ich werde ein wenig steif, weil ich nicht weiß, was das zu bedeuten hat. Sie streicht mir übers Haar. „Du guter Bub!“, flüstert sie. „Der Einzige, der mir hilft, und ich schnauz dich auch noch an! Noch nie hab ich so schöne Brote gesehen, noch nie! Wie bist du denn auf die Idee gekommen?“ „Fernsehkoch!“, antworte ich wahrheitsgemäß. Mama schiebt mich an den Schultern weg von sich, ihr Lächeln ist noch tränennass. „Ich bin richtig stolz auf dich, weißt du das? Gutes Benehmen ist, wenn man hilft, wenn Hilfe gebraucht wird, oder? Und wir haben ja Omi noch gar nichts von deinem Sieg beim Aufsatzwettbewerb erzählt!“
Und schon stecke ich wieder in einem Schlamassel. Ich habe nämlich, als Mama beim Friseur war, die Omi – trotz strengsten Verbotes wegen des teuren Ferngesprächs – angerufen und ihr erzählt, dass ich bei einem Aufsatzwettbewerb gewonnen habe und mein Aufsatz im Seeklausener Boten abgedruckt ist. Am besten ist, reinen Tisch zu machen, solange Mama gütig gestimmt ist. „Ich hab’s ihr schon erzählt. Ich hab telefoniert. Ich weiß, ich hätt nicht dürfen, aber …“ Es gelingt mir, betreten zu schauen, und Mama streicht mir abermals übers Haar. „Versteh ich doch!“, sagt sie. Als wir wieder ins Wohnzimmer kommen, werden die Brötchenplatten ausgiebig bestaunt, sogar Omi verschlägt es die Sprache. Papa ist gerade draußen auf der Terrasse, ein paar Flaschen Bockbier hereinholen, und Opa sagt: „Ganz normal ist er aber nicht, der Bub!“
2 Der Opel vom Onkel Alfons
Als er das Zimmer verlassen wollte, stieß er gegen irgendwas, das halb unter dem Bett gelegen sein musste. Es schepperte. Er kniete sich hin, um nachzusehen. Unter dem Bett lag eine dicke Staubschicht, doch er musste bergen, was er da erahnte. Das musste … ja, genau! Es war eines seiner alten Spielzeugautos. Stöhnend richtete er sich wieder auf und klopfte den Staub von seinen Ärmeln. Das Modell war ein amerikanischer Straßenkreuzer, ein Oldsmobile mit Federung und vier Türen, die man alle öffnen konnte. Die Türen waren noch da, aber das Dach war abgerissen. Er erinnerte sich, dass bei etwas wilderen Spielen auf der Terrasse das Dach angeknackst war, und er hatte dann aus dem Oldsmobile ein Cabrio gemacht. Er hatte ziemlich viele Spielzeugautos gehabt, die meisten Geschenke von Eltern, Tanten und Onkeln zu den verschiedensten Anlässen, und er hatte auch gern damit gespielt. Meistens alleine, denn Spielen hatte ihm immer dann am meisten Spaß gemacht, wenn ihm niemand dreinredete. Und bei einem Rennen auf der Terrasse musste das Unglück mit dem Dach des Oldsmobiles passiert sein. Es war oft genug vorgekommen, dass sich Autos auf den unebenen Terrassenfliesen überschlagen hatten, sogar solche mit Federung.
Am zweiten Weihnachtsfeiertag werde ich leider schon vor acht Uhr geweckt. Diesmal ist es Uschi, die ohne anzuklopfen hereinplatzt. „Du sollst zum Frühstück kommen. Und wenn du nicht in fünf Minuten unten bist, dann kriegst du eine Strafe!“ Im Arm hält Uschi ihre neue Puppe, deren rechter Arm schon wieder gefährlich lose im Gelenk baumelt. „Halt die Klappe!“, sage ich. „Und wenn ich eine Strafe bekomme, dann spül ich den Arm von deiner Puppe im Klo hinunter!“ Uschi kreischt und flüchtet aus meinem Zimmer. Ständig wartet sie darauf, dass ich für irgendwas eine Strafe bekomme, es ist nicht auszuhalten mit dieser Schwester. Ich weiß wirklich nicht, warum sie sich andauernd Strafen für mich herbeiwünscht, was hat sie denn davon?
Gestern Nacht habe ich noch den „Old Surehand“ ausgelesen, deswegen bin ich noch nicht ganz wach. Wie erwartet sind Winnetou und Old Shatterhand auch diesmal mit dem Leben davongekommen, die Bösewichte wurden ihrer gerechten Strafe zugeführt.
Im Buch von Omi habe ich auch schon ein wenig geblättert. Es ist zwar keine spannende Geschichte, dennoch aber nicht uninteressant. Ein Mensch muss pünktlich sein, steht darin, seiner Meinung sicher Ausdruck geben und Geschmack zeigen. Da tauchen, meiner Meinung nach, schon die ersten Schwierigkeiten auf. Das mit der Pünktlichkeit ist für mich kein Problem, außer ich bin gerade mitten in einem spannenden Buch. Aber wenn ich meiner Meinung sicher Ausdruck gebe, heißt es zu Hause, Kinder hätten gar nichts zu wollen oder mitzureden, und in der Schule kriege ich dafür eine Betragensnote. Anscheinend gibt es für Kinder ein eigenes gutes Benehmen. Ich bin gespannt, ob auch darüber in dem Buch was steht.
Heute gibt es eine große Ausnahme vom üblichen Tagesablauf: Es wird nicht zu Mittag gekocht! Mama muss sich nur um das Frühstück kümmern, zu Mittag gibt es einen Imbiss aus Resten, und dann geht es los zu Onkel Alfons und Tante Hertha nach Kreuzstetten. Dort trifft sich die ganze Familie meiner Mutter, die Kastenkirchener Großeltern bleiben zu Hause. Ihnen wäre dort eh zu viel Wirbel, sagt Oma. In Wirklichkeit kann sie die Verwandten in Kreuzstetten nicht ausstehen, die Tante Hertha ist eine heuchlerische Schlange, sagt sie, und der Alfons ein unverfrorener Angeber.
Was den Angeber betrifft, sollte Oma recht behalten. Während des Frühstücks läutet nämlich das Telefon. Ich schaffe es, vor Uschi am Hörer zu sein. „Niedermayr!“, rufe ich hinein, „Siegfried am Apparat!“ „Ah, der Sigi!“, schnauft Onkel Alfons ins Telefon. „Geh, richtest deinen Eltern aus, wir holen die Großeltern mit unserem neuen Auto ab.“ „Ihr habt ein Auto?“, rufe ich, und plötzlich wird es still in der Küche. „Ja, freilich!“, sagt der Alfons. „Und damit die Großeltern es schön bequem haben, holen wir sie mit dem Opel ab. Um halb eins, sag’s ihnen, dass sie sich richten. Und Essen gibt’s bei uns!“ „Und was ist mit uns?“, frage ich. Am anderen Ende pfeift und röchelt es. Der Alfons ist sehr stark übergewichtig und hat’s mit der Lunge. „Ja, ihr müsst schon mit dem Zug fahren. Für so viele Leute ist nicht Platz in unserem Auto! Ich hab ja keinen Bus gekauft!“ Noch einmal versucht er ein Lachen, das aber in einem Hustenanfall endet. „Gib einmal her!“ Mama steht neben mir und streckt die Hand nach dem Telefonhörer aus, aber Onkel Alfons hat schon aufgelegt.
Mama steht schwer atmend in der Küche. „Hast du das gehört, Adolf? Meine Schwester hat ein Auto. Bald sind wir die Einzigen in der Familie, die keines haben!“ „Also, ich finde das schon sehr nett vom Alfons, dass er uns abholt!“, gießt Omi Öl ins Feuer. „Ein Auto, ein Auto!“, kreischt Uschi. „Ich will mitfahren! Ich will mitfahren!“ Omi nimmt Uschi auf den Schoß. „Für dich wird schon noch Platz sein!“ Sie streicht Uschi über den Kopf. „Ja!“ Papa schaut auf die Uhr. „Dann müssen wir wohl den früheren Zug nehmen, nicht wahr!“ Er steht auf und verschwindet aus der Küche, bevor Mama ihm noch mehr Vorwürfe machen oder Omi weitere spitze Bemerkungen fallen lassen kann. Ich höre noch, wie er im Wohnzimmer die Glasvitrine öffnet, dann klirrt es leise. Papa hat sich zur Bewältigung der Krise selber einen Schnaps verordnet.
Es bleibt nicht mehr viel Zeit, denn mit dem Zug brauchen wir um eine halbe Stunde länger nach Kreuzstetten, also müssen wir aufbrechen, noch bevor Onkel Alfons angekommen ist, wenn wir gleichzeitig ankommen wollen. Ich lese vor dem Anziehen noch schnell einen Abschnitt über die Schule im Benimmbuch, aber da steht leider nur was über Lehrer, wie sich Schüler richtig benehmen, ist anscheinend nicht so wichtig, dass man in einem Buch darüber schreiben würde.