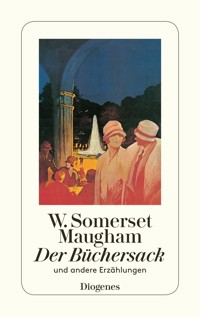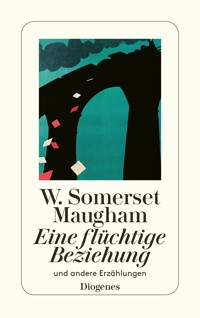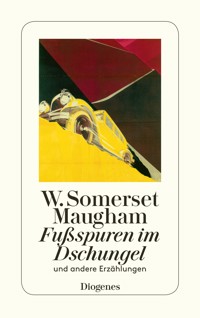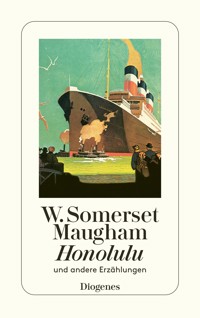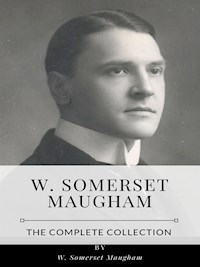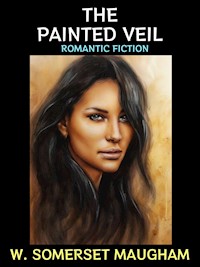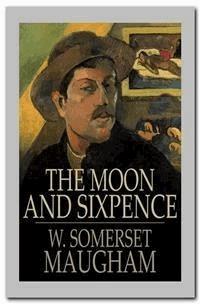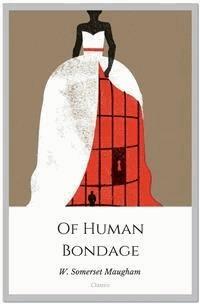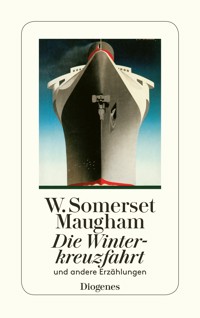
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jedes Jahr schließt Miss Reid im Winter ihre Teestube in einem berühmten englischen Erholungsort und geht auf Winterkreuzfahrt. Diesmal reist sie auf der ›Friedrich Weber‹, einem Frachtschiff, das auch einige Passagiere mitnimmt, und das Ziel ist Cartagena. Die geschwätzige Engländerin ist nach einer Weile die einzige Frau an Bord.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
W. Somerset Maugham
Die Winterkreuzfahrt
und andere Erzählungen
Diogenes
{7}Schein und Wirklichkeit
Ich möchte mich nicht für die Wahrheit dieser Geschichte verbürgen, aber ein Professor für französische Literatur an einer englischen Universität hat sie mir erzählt, und er war, glaube ich, ein Mann von zu lauterer Gesinnung, als daß er sie mir erzählt hätte, wenn sie nicht wahr gewesen wäre. Er hatte die Gewohnheit, die Aufmerksamkeit seiner Studenten auf drei französische Schriftsteller zu lenken, die seiner Meinung nach alle Eigenschaften vereinigten, die als Hauptzüge des französischen Charakters gelten können. Er sagte, durch ihre Lektüre könne man so viel über das französische Volk erfahren, daß er, wenn er die Macht dazu hätte, den Mitgliedern unserer Regierung, die mit der französischen Nation zu tun haben, nicht gestatten würde, ihre Ämter anzutreten, bevor sie nicht eine recht strenge Prüfung über die Werke dieser Schriftsteller bestanden hätten. Er meinte Rabelais mit seiner gauloiserie, eine Art von Derbheit, die die Dinge gern beim rechten Namen nennt; La Fontaine mit seinem bon sens, der einfach gesunder Menschenverstand ist; und schließlich Corneille mit seinem panache. Dies wird in den Wörterbüchern mit Federbusch übersetzt – der Federbusch, den der gewappnete Ritter auf dem Helm trug; bildlich gesprochen bedeutet es anscheinend Würde und Prahlerei, Pomp und Heldentum, Hoffart und Stolz. Es war panache, der die französischen Herren in {8}Fontenoy zu den Offizieren von König George II. sagen ließ: »Schießen Sie zuerst, meine Herren«; es war panache, der den zynischen Lippen Cambronnes bei Waterloo den Ausspruch entlockte: »Die Garde stirbt, aber sie ergibt sich nicht«, und es ist panache, der einen bedürftigen französischen Dichter dazu treibt, den ihm zuerkannten Nobelpreis mit einer großartigen Geste zu verschenken. Der Professor, von dem ich sprach, war kein frivoler Mensch, und seiner Meinung nach zeigte die Geschichte, die ich jetzt erzählen will, so deutlich die drei Haupteigenschaften der Franzosen, daß sie einen hohen Bildungswert besitzt.
Ich habe ihr den Titel ›Schein und Wirklichkeit‹ gegeben. Das ist der Titel des, wie ich wohl annehmen darf, bedeutendsten philosophischen Werkes, das mein Land (mit Recht oder Unrecht) im neunzehnten Jahrhundert hervorgebracht hat. Es ist schwer, aber anregend zu lesen. Es ist in ausgezeichnetem Englisch geschrieben, mit einem beträchtlichen Maß an Humor, und wenn der Laie auch vielen seiner sehr spitzfindigen Behauptungen kaum mit Verständnis folgen kann, hat er immerhin das erregende Gefühl, auf einem geistigen Seil über einem metaphysischen Abgrund zu balancieren, und er beendet die Lektüre des Buches mit dem beruhigenden Eindruck, daß im Grunde alles gleichgültig ist. Es gibt keine andere Entschuldigung dafür, daß ich von dem Titel eines so berühmten Buches Gebrauch mache, als daß er so hervorragend zu meiner Geschichte paßt. Obwohl Lisette nur eine Philosophin in dem Sinn war, wie wir alle Philosophen sind, und sie ihren Verstand dazu benützte, mit den Problemen des Daseins fertig zu werden, so war ihr Sinn für die Wirklichkeit doch so stark und ihre Sympathie für {9}den Schein so ursprünglich, daß sie beinahe beanspruchen konnte, den Ausgleich von Unvereinbarkeiten erreicht zu haben, den die Philosophen so viele Jahrhunderte hindurch angestrebt haben. Lisette war Französin, und sie verbrachte mehrere Stunden jedes Arbeitstages damit, sich in einem der teuersten und feinsten Modehäuser von Paris an- und auszukleiden. Eine angenehme Beschäftigung für eine junge Frau, die sich ihrer entzückenden Figur wohl bewußt ist. Sie war, kurz gesagt, ein Mannequin. Sie war hochgewachsen genug, um eine Schleppe mit Eleganz vorzuführen, und ihre Hüften waren so schmal, daß sie in Sportkleidung den Duft von Heidekraut hervorzuzaubern vermochte. Ihre langen Beine gestatteten ihr, Pyjamas mit Vornehmheit zu tragen, und ihre schlanke Taille, ihre kleinen Brüste ließen den einfachsten Badeanzug hinreißend erscheinen. Sie konnte alles tragen. Sie konnte sich so in einen Chinchillamantel hüllen, daß die vernünftigsten Leute zugeben mußten, Chinchilla sei doch den Preis wert, der dafür verlangt wurde. Dicke Frauen, plumpe Frauen, untersetzte Frauen, knochige Frauen, alte Frauen, unattraktive Frauen saßen in den breiten Sesseln, und weil Lisette so süß aussah, kauften sie die Kleider, die ihr so glänzend standen. Sie hatte große braune Augen, einen großen roten Mund und eine sehr klare Haut, trotz einiger Sommersprossen. Es fiel ihr schwer, diese hochmütige, verdrossene und kühl gleichgültige Haltung zu bewahren, die anscheinend eine Voraussetzung für das Mannequin ist, wenn es gelassenen Schrittes hereinschwebt, sich langsam dreht und mit einem Ausdruck der Verachtung für das Universum, wie er sonst nur vom Kamel erreicht wird, wieder hinausschwebt. Es lag ein verstecktes Funkeln in Lisettes {10}großen braunen Augen, und ihre roten Lippen schienen zu beben, als könnte sich bei der geringsten Veranlassung ein Lächeln auf ihnen ausbreiten. Es war dieses Funkeln, das die Aufmerksamkeit von Monsieur Raymond Le Sueur erregte.
Er saß auf einem unechten Louis-XVI.-Stuhl neben seiner Gattin (auf einem ebensolchen), die ihn überredet hatte, sie zu begleiten, um die Privatvorführung der Frühjahrsmoden anzusehen. Dies war ein Beweis für Monsieur Le Sueurs liebenswürdige Veranlagung, denn er war ein äußerst beschäftigter Mann, der vermutlich weit wichtigere Dinge zu erledigen hatte, als eine Stunde lang dazusitzen und einem Dutzend schöner junger Frauen zuzusehen, wie sie verwirrend verschiedenartige Kleider vorführten. Er konnte nicht erwartet haben, daß irgendeines von ihnen aus seiner Frau etwas anderes machen würde als das, was sie war: eine große, knochige Frau von fünfzig Jahren, mit übergroßen Gesichtszügen. Er hatte sie wirklich nicht ihres Aussehens wegen geheiratet, und sie hatte das nicht einmal in den ersten berauschenden Tagen ihrer Flitterwochen angenommen. Er hatte sie geheiratet, um die blühenden Stahlwerke, deren Erbin sie war, mit seiner ebenso blühenden Lokomotivfabrik zu vereinigen. Die Ehe war gut ausgefallen. Sie hatte ihm einen Sohn geschenkt, der fast so gut Tennis spielte wie ein Berufsspieler, genauso gut tanzte wie ein Gigolo und sich beim Bridge mit allen Experten messen konnte; und eine Tochter, die er mit einer genügend großen Mitgift hatte ausstatten können, um sie mit einem beinahe verbürgt echten Prinzen zu verheiraten. Er hatte Grund, auf seine Kinder stolz zu sein. Durch Beharrlichkeit und angemessene Seriosität war es ihm gelungen, die Aktienmehrheit in einer {11}Zuckerraffinerie, einer Filmgesellschaft, einer Firma, die Autos herstellte, und einer Zeitung zu erwerben; und schließlich hatte er genug Geld auszugeben vermocht, um die freie und unabhängige Wählerschaft eines bestimmten Bezirkes dazu zu bewegen, ihn in den Senat zu entsenden. Er war ein Mann von würdevoller Erscheinung, von sympathischer Wohlbeleibtheit und frischer Gesichtsfarbe, mit einem gepflegten, eckig geschnittenen Bart, einer Glatze und einem Fettwulst im Nacken. Man brauchte nicht auf die rote Rosette, die seinen schwarzen Rock schmückte, zu sehen, um sicher zu sein, daß man eine Persönlichkeit von Bedeutung vor sich hatte. Er war ein Mann von raschen Entschlüssen, und als seine Frau den Damenschneider verließ, um Bridge zu spielen, trennte er sich von ihr und sagte, er wolle sich etwas Bewegung verschaffen und zu Fuß zum Senat gehen, wohin ihn seine Vaterlandspflicht rief. Er ging jedoch nicht so weit, sondern begnügte sich damit, sich in einer Seitenstraße die Füße zu vertreten, in der, wie er richtig vermutete, die jungen Damen des Modehauses bei Geschäftsschluß auftauchen würden. Er hatte kaum eine Viertelstunde gewartet, als das Erscheinen einer Anzahl von Frauen in Gruppen, einige jung und hübsch, andere nicht so jung und durchaus nicht hübsch, ihm anzeigte, daß der Moment gekommen war, und in zwei oder drei Minuten trippelte Lisette auf die Straße. Der Senator war sich wohl bewußt, daß sein Aussehen und sein Alter nicht von vornherein anziehend auf junge Frauen wirken mochte, aber er hatte die Erfahrung gemacht, daß sein Reichtum und seine Stellung diese Nachteile ausglichen. Lisette hatte eine Begleiterin bei sich, was einen Mann von geringerer Bedeutung vielleicht abgehalten hätte, den {12}Senator aber keinen Augenblick zögern ließ; er ging auf sie zu, nahm seinen Hut höflich ab, jedoch nicht so weit, daß man sehen konnte, wie kahlköpfig er war, und wünschte ihr einen guten Abend.
»Bonsoir, Mademoiselle«, sagte er mit einem verbindlichen Lächeln.
Sie warf ihm einen flüchtigen Blick zu, und ihre vollen roten Lippen, auf denen ein leichtes Lächeln lag, erstarrten; sie wandte den Kopf ab, fing ein lebhaftes Gespräch mit ihrer Freundin an und ging weiter, indem sie sich den sehr gelungenen Anschein höchster Gleichgültigkeit gab. Keineswegs dadurch aus der Fassung gebracht, kehrte der Senator um und folgte den beiden Mädchen in einer Entfernung von einigen Metern. Sie gingen die kleine Seitengasse entlang, kamen dann auf den Boulevard und nahmen an der Place de la Madeleine einen Bus. Der Senator war sehr zufrieden. Er hatte eine Anzahl korrekter Schlüsse gezogen. Die Tatsache, daß sie augenscheinlich mit einer Freundin nach Hause ging, bewies, daß sie keinen offiziellen Verehrer hatte. Die Tatsache, daß sie sich abgewandt hatte, als er sie anredete, zeigte, daß sie besonnen und bescheiden und gut erzogen war, was er bei hübschen jungen Frauen schätzte; und ihr Kostüm, der einfache schwarze Hut und ihre kunstseidenen Strümpfe deuteten an, daß sie arm und darum tugendhaft war. In dieser Kleidung sah sie genauso reizvoll aus wie in den prächtigen Gewändern, in denen er sie vorher gesehen hatte. Er hatte ein seltsames kleines Gefühl in seinem Herzen. Er hatte diese merkwürdige Empfindung, die erfreulich und doch auch schmerzlich war, seit mehreren Jahren nicht mehr gehabt, aber er erkannte sie sofort.
{13}»Das ist Liebe, weiß der Himmel«, murmelte er.
Er hatte solche Gefühle nicht mehr erwartet, und mit gestrafften Schultern schritt er zuversichtlich aus. Er ging zum Büro eines Privatdetektivs und hinterließ dort den Auftrag, daß Auskünfte eingeholt werden sollten über eine junge Person mit Namen Lisette, die als Mannequin in der und der Firma angestellt sei; und dann erinnerte er sich, daß im Senat die amerikanische Staatsverschuldung auf der Tagesordnung stand, worauf er sich von einem Taxi zu dem imponierenden Gebäude fahren ließ, dort in die Bibliothek ging, wo ein Lehnstuhl stand, den er sehr gern hatte, und wo er ein angenehmes Schläfchen hielt. Die Auskunft, die er verlangt hatte, erreichte ihn drei Tage später. Sie war ihr Geld wert. Mademoiselle Lisette Larion lebte bei einer verwitweten Tante in einer Zweizimmerwohnung im Pariser Viertel Batignolles. Ihr Vater, ein verwundeter Held des Weltkrieges, besaß ein bureau de tabac in einem Städtchen im Südwesten Frankreichs. Die Miete für die Wohnung betrug zweitausend Francs. Sie führte ein regelmäßiges Leben, ging aber gern ins Kino, hatte anscheinend keinen Liebhaber und war neunzehn Jahre alt. Die Concierge des Mietshauses äußerte sich günstig über sie, und ihre Kolleginnen im Geschäft hatten sie gern. Offenbar war sie ein sehr anständiges junges Mädchen, und der Senator konnte nicht umhin zu finden, daß sie hervorragend geeignet war, die freien Stunden eines Mannes angenehm auszufüllen, der eine Entspannung von den Staatsgeschäften und dem harten Druck der großen Finanztransaktionen suchte.
Es erübrigt sich, im einzelnen zu erzählen, welche Schritte Monsieur Le Sueur unternahm, um das ihm {14}vorschwebende Ziel zu erreichen. Er war zu bedeutend und zu beschäftigt, um sich selber mit der Sache zu befassen; aber er hatte einen Privatsekretär, der sehr geschickt mit noch unentschlossenen Wählern umzugehen wußte und der es unbedingt verstand, einem jungen Mädchen, das anständig, aber arm war, die möglichen Vorteile einer solchen Freundschaft auszumalen. Der Privatsekretär machte einen Besuch bei der verwitweten Tante, Madame Saladin, und setzte ihr auseinander, daß Monsieur Le Sueur, immer seiner Zeit voraus, sich neuerdings für Filme interessiere und tatsächlich im Begriff sei, einen solchen zu produzieren. (Dies zeigt, wie ein kluger Kopf eine Sache verwerten kann, die ein gewöhnlicher Mensch als unbedeutend übergangen hätte.) Mademoiselle Lisettes Erscheinung in jenem Modehaus und ihre blendende Art, die Kleider zu tragen, seien Monsieur Le Sueur aufgefallen, und es sei ihm der Gedanke gekommen, daß sie für eine Rolle, die er ihr zugedacht hatte, sehr geeignet sein müßte. (Wie alle intelligenten Leute blieb der Senator immer möglichst nahe an der Wahrheit.) Der Privatsekretär lud dann Madame Saladin und ihre Nichte zu einem Diner ein, bei dem sie sich näher kennenlernen würden und der Senator beurteilen könnte, ob Mademoiselle Lisette die von ihm vermutete Eignung für die Leinwand wirklich besitze. Madame Saladin sagte, sie wolle ihre Nichte fragen, schien aber den Vorschlag durchaus annehmbar zu finden.
Als Madame Saladin die Einladung übermittelte und den Rang, die Würde und Bedeutung ihres großzügigen Gastgebers hervorhob, zuckte diese junge Person verächtlich ihre hübschen Schultern. »Cette vieille carpe«, sagte sie, was mit ›So ein alter Karpfen‹ zu übersetzen wäre.
{15}»Was macht das, wenn er ›ein alter Karpfen‹ ist, sofern er dir eine Rolle verschafft?« sagte Madame Saladin.
»Et ta sœur«, sagte Lisette.
Diese Redensart, die natürlich heißt: ›Und deine Schwester‹ und harmlos genug und sogar sinnlos klingt, ist ein wenig ordinär und wird, glaube ich, von guterzogenen jungen Mädchen nur gebraucht, wenn sie Ärgernis erregen wollen. Sie drückt den äußersten Unglauben aus, und die einzig richtige Übersetzung in die volkstümliche Sprache ist zu gemein für meine keusche Feder.
»Auf alle Fälle bekämen wir ein fabelhaftes Essen«, sagte Madame Saladin. »Du bist immerhin kein Kind mehr.«
»Hat er gesagt, wo wir soupieren würden?«
»Im Château de Madrid. Jedermann weiß, daß es das teuerste Lokal der Welt ist.«
»Dagegen ist nichts einzuwenden. Das Essen ist sehr gut, der Keller berühmt, und seine Lage macht es an einem schönen Abend im Frühsommer zu einem bezaubernden Ort.« Ein reizendes Grübchen erschien in Lisettes Wange und ein Lächeln auf ihrem großen roten Mund. Sie hatte tadellose Zähne.
»Ich könnte ein Kleid vom Geschäft leihen«, murmelte sie.
Einige Tage später holte der Privatsekretär des Senators sie mit einem Taxi ab und brachte Madame Saladin und ihre anziehende Nichte zum Bois de Boulogne. Lisette sah entzückend aus in einem der erfolgreichsten Modelle der Firma, und Madame Saladin äußerst achtbar in ihrem eigenen Schwarzseidenen und einem Hut, den Lisette für diese Gelegenheit gemacht hatte. Der Sekretär stellte die Damen {16}Monsieur Le Sueur vor; er empfing sie mit der milden Würde eines Politikers, der die Gattin und Tochter eines geschätzten Wählers liebenswürdig begrüßt: in seiner schlauen Art nahm er an, daß die Leute an den Nachbartischen, die ihn kannten, genau dies über seine Gäste denken würden. Das Diner verlief sehr angenehm, und kaum einen Monat später zog Lisette in eine reizende kleine Wohnung, die in praktischer Entfernung sowohl von ihrer Arbeitsstätte wie auch vom Senat lag und von einem modernen Innenarchitekten eingerichtet worden war. Monsieur Le Sueur wünschte, daß Lisette weiterarbeiten sollte. Es paßte ihm sehr gut, daß sie während der Stunden, die er den Geschäften widmen mußte, etwas zu tun hatte, denn das bewahrte sie vor Torheiten, und er wußte sehr wohl, daß eine Frau, die den ganzen Tag nichts zu tun hat, viel mehr Geld ausgibt als eine, die beschäftigt ist. Ein kluger Mann denkt an solche Dinge.
Verschwendungssucht war jedoch ein Laster, das Lisette fernlag. Der Senator war zärtlich und freigebig. Es war ihm eine Quelle der Befriedigung, daß Lisette sehr bald anfing, Geld zu sparen. Sie führte ihren Haushalt wirtschaftlich und kaufte ihre Kleider zum Nettopreis, und jeden Monat schickte sie eine gewisse Summe nach Hause an ihren Heldenvater, der damit kleine Grundstücke erwarb. Sie fuhr fort, ein ruhiges und bescheidenes Leben zu führen, und Monsieur Le Sueur freute sich, von der Concierge, die ihren Sohn gern in einem Regierungsbüro untergebracht hätte, zu erfahren, daß Lisettes einzige Besucher ihre Tante und ein oder zwei Mädchen aus dem Geschäft waren.
Der Senator war in seinem ganzen Leben noch nie so glücklich gewesen. Es befriedigte ihn sehr zu denken, daß {17}selbst in dieser Welt eine gute Tat belohnt wurde, denn hatte er nicht aus reiner Güte an jenem Nachmittag, da sie im Senat die amerikanische Staatsverschuldung behandelten, seine Frau zum Damenschneider begleitet und auf diese Weise zum erstenmal die reizende Lisette gesehen? Je näher er sie kennenlernte, desto vertrauter war er mit ihr. Sie war eine höchst angenehme Gefährtin. Sie war heiter und gutmütig. Ihre Intelligenz war beachtlich, und sie konnte klug zuhören, wenn er geschäftliche Dinge oder Staatsangelegenheiten mit ihr besprach. Sie schenkte ihm Erholung, wenn er müde war, und munterte ihn auf, wenn er niedergedrückt war. Sie freute sich, wenn er kam – und er kam oft, meistens von fünf bis sieben –, und war betrübt, wenn er wegging. Sie erweckte den Eindruck in ihm, daß er nicht nur ihr Geliebter, sondern auch ihr Freund war. Manchmal aßen sie zusammen in ihrer Wohnung zu Abend, und die gut zusammengestellte Mahlzeit, die freundliche Behaglichkeit ließ ihn den Reiz der Häuslichkeit lebhaft schätzen. Seine Freunde erklärten dem Senator, er sähe zwanzig Jahre jünger aus. Er fühlte sich auch so. Er war sich seines Glückes bewußt. Er konnte aber auch nicht umhin zu finden, daß ihm das nach einem Leben ehrlicher Anstrengungen und öffentlicher Dienstleistung durchaus zustand.
So bedeutete es für ihn, nachdem sich alles fast zwei Jahre lang so angenehm entwickelt hatte, einen Schlag, als er in der Frühe eines Sonntagmorgens von einem Besuch in seinem Wahlkreis, der über das Wochenende hätte dauern sollen, unerwartet nach Paris zurückkam. Er öffnete die Wohnungstür mit seinem Schlüssel, in der Erwartung, an diesem Ruhetag Lisette im Bett vorzufinden, und überraschte sie {18}beim Frühstück in ihrem Schlafzimmer, im tête-à-tête mit einem jungen Herrn, den er nie zuvor gesehen hatte und der seinen (des Senators) nagelneuen Schlafanzug trug. Lisette war überrascht, ihn zu sehen. Sie fuhr sogar merklich zusammen.
»Tiens«, sagte sie. »Wo kommst du denn her? Ich habe dich nicht vor morgen erwartet.«
»Das Ministerium ist gestürzt«, erwiderte er automatisch. »Man hat nach mir geschickt. Man will mir das Innenministerium anbieten.« Aber das war gar nicht das, was er sagen wollte. Er warf dem Herrn, der seinen Schlafanzug trug, einen wütenden Blick zu.
»Wer ist dieser junge Mann?« rief er.
Lisettes großer roter Mund öffnete sich zu einem höchst verführerischen Lächeln.
»Mein Liebhaber«, antwortete sie.
»Hältst du mich für einen Idioten?« schrie der Senator. »Das sehe ich, daß es dein Liebhaber ist.«
»Warum fragst du dann?«
Monsieur Le Sueur war ein Mann der Tat. Er ging geradewegs zu Lisette hin und schlug sie mit seiner linken Hand kräftig auf ihre rechte Wange, und dann schlug er sie mit seiner rechten Hand kräftig auf ihre linke Wange.
»Scheusal!« rief Lisette.
Er wandte sich dann zu dem jungen Mann, der diesem Akt der Gewalt mit einiger Verlegenheit zugesehen hatte, und indem er sich zu seiner vollen Größe aufrichtete, schleuderte er seinen Arm nach vorn und deutete mit einem dramatischen Finger auf die Tür.
»Hinaus«, rief er, »hinaus!«
{19}Man hätte annehmen können – so gebieterisch war der Anblick dieses Mannes, der gewohnt war, eine Versammlung ärgerlicher Steuerzahler zu zähmen und mit einem Stirnrunzeln die jährliche Hauptversammlung enttäuschter Aktionäre zu leiten –, daß der junge Mann zur Tür gestürzt wäre; aber er blieb an seinem Platz, unentschlossen zwar, aber er blieb; er warf Lisette einen beschwörenden Blick zu und zuckte leicht mit den Schultern.
»Worauf warten Sie noch?« schrie der Senator. »Wollen Sie, daß ich Gewalt anwende?«
»Er kann nicht in seinem Schlafanzug weggehen«, sagte Lisette.
»Das ist nicht sein Schlafanzug, sondern mein Schlafanzug.«
»Er wartet auf seine Kleider.«
Monsieur Le Sueur sah sich im Zimmer um und entdeckte auf dem Stuhl hinter ihm, unordentlich hingeworfen, eine Auswahl männlicher Kleidungsstücke. Der Senator heftete einen verächtlichen Blick auf den jungen Mann.
»Nehmen Sie Ihre Kleider, Monsieur«, sagte er mit kalter Geringschätzung.
Der junge Mann raffte sie in seinen Armen zusammen, hob die Schuhe auf, die auf dem Boden lagen, und verließ rasch das Zimmer. Monsieur Le Sueur hatte eine bedeutende Redebegabung. Noch nie hatte er sie zu einem besseren Zweck angewandt. Er erklärte Lisette, was er von ihr hielt. Es war nicht schmeichelhaft. Er schilderte ihre Undankbarkeit in den schwärzesten Farben. Er durchforstete ein umfangreiches Vokabular nach schimpflichen Bezeichnungen für sie. Er rief alle himmlischen Mächte als Zeugen an, daß {20}noch nie eine Frau mit so grobem Betrug das in sie gesetzte Vertrauen eines ehrlichen Mannes vergolten hatte. Kurzum, er sagte alles, was Ärger, verletzte Eitelkeit und Enttäuschung ihm eingaben. Lisette machte keine Verteidigungsversuche. Sie hörte schweigend, mit gesenkten Augen zu, während sie das Brötchen, das sie durch das Erscheinen des Senators nicht hatte fertig essen können, mechanisch zerkrümelte. Er warf einen gereizten Blick auf ihren Teller.
»Ich war so darauf bedacht, daß du zuallererst meine große Neuigkeit hören solltest. Darum bin ich gleich vom Bahnhof hierhergekommen. Ich hatte damit gerechnet, mein petit déjeuner am Fußende deines Bettes einzunehmen.«
»Mein armer Liebling, hast du noch nicht gefrühstückt? Ich bestelle sofort frischen Kaffee für dich.«
»Ich will keinen.«
»Unsinn. Bei der großen Verantwortung, die du auf dich nehmen sollst, mußt du bei Kräften bleiben.«
Sie klingelte, und als das Mädchen erschien, bestellte sie heißen Kaffee. Er wurde gebracht, und Lisette schenkte ihn ein. Er rührte ihn nicht an. Sie bestrich ein Brötchen mit Butter. Er zuckte mit den Schultern und begann zu essen. Dazwischen machte er einige Bemerkungen über die Falschheit der Frauen. Sie blieb stumm.
»Immerhin ist es schon etwas«, sagte er, »daß du nicht die Unverschämtheit hast, einen Versuch zu deiner Verteidigung zu machen. Du weißt, daß ich nicht der Mann bin, den man ungestraft schlecht behandelt. Ich bin der Inbegriff von Großzügigkeit, wenn Leute sich mir gegenüber gut benehmen, aber wenn sie sich schlecht benehmen, bin ich {21}unerbittlich. Sobald ich meinen Kaffee getrunken habe, werde ich diese Wohnung für immer verlassen.«
Lisette seufzte.
»Ich will dir jetzt sagen, daß ich eine Überraschung für dich vorbereitet hatte. Ich hatte beschlossen, den zweiten Jahrestag unserer Freundschaft damit zu feiern, daß ich eine Geldsumme für dich aussetze, um dir eine bescheidene Unabhängigkeit zu sichern, für den Fall, daß mir etwas zustoßen sollte.«
»Wieviel?« fragte Lisette düster.
»Eine Million Francs.«
Sie seufzte wieder. Plötzlich traf den Senator etwas Weiches am Hinterkopf, und er zuckte zusammen.
»Was ist das?« rief er.
»Er gibt dir deinen Schlafanzug zurück.«
Der junge Mann hatte die Tür aufgemacht, den Schlafanzug dem Senator rasch an den Kopf geworfen und sie gleich wieder geschlossen. Der Senator befreite sich von den seidenen Beinkleidern, die ihm um den Hals hingen.
»Was für eine Art, ihn zurückzugeben! Dein Freund hat kein Benehmen.«
»Natürlich hat er nicht deine Vornehmheit«, murmelte Lisette.
»Und vielleicht meine Intelligenz?«
»Oh, nein.«
»Ist er reich?«
»Er hat keinen Sou.«
»Was in aller Welt siehst du dann in ihm?«
»Er ist jung«, sagte Lisette lächelnd.
Der Senator schaute auf seinen Teller, und eine Träne stieg {22}ihm ins Auge und rollte die Wange hinunter in den Kaffee. Lisette sah ihn freundlich an.
»Mein armer Freund, man kann nicht alles im Leben haben«, sagte sie.
»Ich wußte, daß ich nicht jung bin. Aber meine Stellung, mein Vermögen, meine Vitalität! Ich dachte, das sei ein Ausgleich. Es gibt Frauen, die nur Männer in einem gewissen Alter mögen. Es gibt berühmte Schauspielerinnen, die es als Ehre betrachten, die kleine Freundin eines Ministers zu sein. Ich bin zu wohlerzogen, um dir deine Herkunft vorzuwerfen, aber die Tatsache bleibt bestehen, daß du ein Mannequin bist und daß ich dich aus einer Wohnung herausgeholt habe, deren Miete nur zweitausend Francs im Jahr beträgt. Es war für dich ein Aufstieg.«
»Als Tochter armer, aber ehrlicher Eltern habe ich keinen Grund, mich meiner Herkunft zu schämen, und du darfst mir keine Vorwürfe machen, weil ich meinen Unterhalt auf bescheidene Art verdient habe.«
»Liebst du diesen Jungen?«
»Ja.«
»Und mich nicht?«
»Dich auch. Ich liebe euch beide, aber auf verschiedene Weise. Ich liebe dich, weil du so vornehm bist und weil deine Konversation lehrreich und interessant ist. Ich liebe dich, weil du gütig und großzügig bist. Ich liebe ihn, weil seine Augen so groß sind und sein Haar gewellt ist, und weil er himmlisch tanzt. Das ist ganz natürlich.«
»Du weißt, daß ich dich meiner Stellung wegen nicht in Tanzlokale führen kann, und vermutlich wird er, wenn er in meinem Alter ist, auch nicht mehr Haare haben als ich.«
{23}»Das mag wohl stimmen«, gab Lisette zu, aber sie fand das belanglos.
»Was wird deine Tante dazu sagen, wenn sie erfährt, was du getan hast?«
»Es wird nicht gerade eine Überraschung für sie sein.«
»Willst du damit sagen, daß diese ehrenwerte Frau dein Verhalten billigt? O tempora, o mores! Wie lange dauert das denn schon?«
»Seitdem ich ins Geschäft gehe. Er reist für ein großes Seidenhaus in Lyon. Er kam eines Tages mit seinen Mustern herein. Wir gefielen einander.«
»Aber deine Tante war doch da, um dich von den Versuchungen, denen ein junges Mädchen in Paris ausgesetzt ist, zu bewahren. Sie hätte dir nie erlauben dürfen, etwas mit dem jungen Mann zu tun zu haben.«
»Ich habe sie nicht um Erlaubnis gefragt.«
»Es genügt, um deinen armen alten Vater ins Grab zu bringen. Hast du gar nicht an die Wunden dieses Helden gedacht, dessen Verdienste um das Vaterland mit der Lizenz für Tabakverkauf belohnt wurden? Denkst du nicht daran, daß diese Abteilung mir als Innenminister untersteht? Ich befände mich im Recht, wenn ich die Lizenz wegen deiner offenbaren Unmoral aufheben würde.«
»Ich weiß, daß du viel zu sehr Gentleman bist, um etwas so Heimtückisches zu tun.«
Er machte eine eindrucksvolle, wenn auch vielleicht etwas zu dramatische Geste. »Befürchte nichts. Ich werde mich nie so weit erniedrigen, mich an einem Mann, dem das Vaterland Dank schuldet, für die Missetaten eines Geschöpfes zu rächen, das zu verachten meine Würde mir gebietet.«
{24}Er widmete sich wieder seinem unterbrochenen Frühstück. Lisette sagte nichts, und es lag ein Schweigen zwischen ihnen. Aber nach Befriedigung seines Appetits schlug seine Stimmung um: Er begann, eher sich selbst zu bedauern, als böse auf sie zu sein, und mit einer merkwürdigen Ahnungslosigkeit in bezug auf das weibliche Herz glaubte er Lisettes Reue dadurch zu erwecken, daß er sich als ein Objekt des Mitleids hinstellte.
»Es ist schwer, eine vertraut gewordene Gewohnheit aufzugeben. Es war eine Entspannung und ein Trost für mich hierherzukommen, wenn ich bei meinen vielen Beschäftigungen einen Augenblick erübrigen konnte. Wirst du mich ein wenig vermissen, Lisette?«
»Natürlich.«
Er seufzte tief auf.
»Ich hätte dir nie zugetraut, daß du mich so hintergehst.«
»Es ist das Hintergangensein, das nagt«, murmelte sie nachdenklich. »Männer sind in dieser Hinsicht komisch. Sie können es nicht verzeihen, zum Narren gehalten zu werden. Das kommt daher, daß sie so eitel sind. Sie messen Dingen Bedeutung zu, die ganz unwichtig sind.«
»Nennst du es ganz unwichtig, daß ich dich beim Frühstück mit einem jungen Mann überrasche, der meinen Schlafanzug trägt?«
»Wenn er mein Mann wäre und du mein Liebhaber, würdest du es für ganz selbstverständlich halten.«
»Allerdings. Denn dann würde ich ihn hintergehen, und meine Ehre wäre gewahrt.«
»Kurz gesagt, ich brauche ihn nur zu heiraten, um die Situation ganz in Ordnung zu bringen.«
{25}Einen Augenblick lang verstand er nicht. Dann schoß der Sinn ihrer Bemerkung durch seinen klugen Kopf, und er warf ihr einen raschen Blick zu. Ihre schönen Augen hatten das Funkeln, das er immer so verführerisch fand, und auf ihrem großen roten Mund lag die Andeutung eines schelmischen Lächelns.
»Vergiß nicht, daß ich als Mitglied des Senats nach allen Traditionen der Republik die autorisierte Hauptstütze der Moral und der guten Sitten bin.«
»Wiegt das schwer für dich?«
Er strich sich mit einer beherrschten und würdevollen Bewegung über seinen schönen eckigen Bart.
»Nicht die Bohne«, erwiderte er, aber der Ausdruck, den er gebrauchte, hatte eine gallische Derbheit, die vielleicht seine eher konservativen Anhänger peinlich berührt hätte.
»Würde er dich heiraten?« fragte er.
»Er betet mich an. Natürlich würde er mich heiraten. Wenn ich ihm sage, daß ich eine Million Francs Mitgift habe, würde er sich nichts Besseres wünschen.«
Monsieur Le Sueur warf ihr wieder einen Blick zu. Als er ihr in einem Moment der Wut gesagt hatte, daß es seine Absicht gewesen sei, ihr eine Million Francs auszusetzen, hatte er ziemlich stark übertrieben, weil er ihr zeigen wollte, wieviel ihr Verrat sie kostete. Aber er war nicht der Mann, der zurückruderte, wenn es um seine Würde ging.
»Es ist viel mehr, als ein junger Mann in seiner Lebensstellung beanspruchen könnte. Aber wenn er dich anbetet, würde er dauernd an deiner Seite sein.«
»Habe ich dir nicht gesagt, daß er Geschäftsreisender ist? Er kann nur über das Wochenende nach Paris kommen.«
{26}»Das ist natürlich eine ganz andere Sache«, sagte der Senator. »Es würde ihm selbstverständlich eine Befriedigung bedeuten zu wissen, daß ich während seiner Abwesenheit da wäre, um dich im Auge zu behalten.«
»Eine beträchtliche Befriedigung«, sagte Lisette.
Um das Gespräch zu erleichtern, erhob sie sich von ihrem Sitz und machte es sich auf den Knien des Senators bequem. Er drückte ihre Hand zärtlich.
»Ich habe dich sehr gern, Lisette«, sagte er. »Ich möchte nicht, daß dir ein Fehler unterläuft. Bist du sicher, daß er dich glücklich machen wird?«
»Ich glaube es.«
»Ich werde sorgfältige Erkundigungen einziehen. Ich würde dir nie gestatten, jemanden zu heiraten, der nicht von musterhaftem Charakter und einwandfreier Moral wäre. In unser aller Interesse müssen wir über diesen jungen Mann, den wir in unser Leben bringen, genau Bescheid wissen.«
Lisette erhob keinen Einspruch. Sie war sich klar darüber, daß der Senator alles gerne ordentlich und methodisch in Angriff nahm. Er schickte sich jetzt an zu gehen. Er wollte seine wichtige Neuigkeit Madame Le Sueur mitteilen, und er mußte sich mit verschiedenen Mitgliedern seiner Fraktion in Verbindung setzen.
»Es ist nur noch eins«, sagte er, als er sich von Lisette liebevoll verabschiedete, »wenn du dich verheiratest, muß ich darauf bestehen, daß du deine Arbeit aufgibst. Der Platz für die Frau ist das Heim, und es verstößt gegen alle meine Prinzipien, daß eine verheiratete Frau einem Mann die Arbeit wegnimmt.«
Lisette überlegte, daß ein kräftiger junger Mann ziemlich {27}komisch aussehen würde, wenn er mit wiegenden Hüften über den Steg schritte, um die letzten Modelle vorzuführen, aber sie respektierte die Prinzipien des Senators.
»Es soll so geschehen, wie du es wünschst, Liebling«, sagte sie.
Die Erkundigungen, die er einholte, waren zufriedenstellend, und die Heirat fand an einem Samstagvormittag statt, sobald die gesetzlichen Formalitäten erledigt waren. Monsieur Le Sueur, Innenminister, und Madame Saladin waren Zeugen. Der Bräutigam war ein schlanker junger Mann mit einer geraden Nase, schönen Augen und schwarzem welligem Haar, das von der Stirn zurückgebürstet war. Er sah eher aus wie ein Tennisspieler als wie ein Reisender in Seide. Der Bürgermeister, durch die erhabene Anwesenheit des Innenministers beeindruckt, hielt nach französischer Gepflogenheit eine Rede. Er begann damit, dem jungen Paar zu sagen, was sie vermutlich schon wußten. Er teilte dem Bräutigam mit, daß er der Sohn ehrenwerter Eltern sei und einen geachteten Beruf ausübe. Er beglückwünschte ihn, daß er den Bund der Ehe in einem Alter schließe, in dem viele junge Männer nur an ihr Vergnügen dächten. Er erinnerte die Braut daran, daß ihr Vater ein Held des großen Krieges sei, dessen glorreiche Wunden durch die Lizenz für einen Tabakladen belohnt worden seien, und er sagte ihr, daß sie auf anständige Weise ihren Unterhalt verdient habe, seit sie nach Paris gekommen sei, in einer Firma, die ein Ruhmesblatt für französischen Geschmack und Luxus darstelle. Der Bürgermeister hatte eine literarische Ader, und er erwähnte kurz verschiedene berühmte Liebespaare der Dichtung: Romeo und Julia, deren kurze, aber legitime Verbindung durch ein {28}bedauerliches Mißverständnis unterbrochen wurde, Paul und Virginie, welch letztere lieber ihren Tod in den Wellen fand, als durch Abwerfen der Kleider ihre Sittsamkeit zu verletzen, und schließlich Daphnis und Chloë, die ihre Heirat nicht vollzogen hatten, bevor sie von der legitimen Behörde sanktioniert worden war. Er sprach so rührend, daß Lisette ein paar Tränen vergoß. Er machte Madame Saladin ein Kompliment, daß sie durch ihr Beispiel und ihre Vorschriften ihre junge und schöne Nichte vor den Gefahren, die einem jungen Mädchen in einer großen Stadt drohten, bewahrt habe, und endlich gratulierte er dem glücklichen Paar zu der Ehre, die der Herr Innenminister ihnen erwiesen habe, indem er als Trauzeuge erschienen sei. Es sei ein Beweis für ihre eigene Redlichkeit, daß dieser Industriekapitän und bedeutende Staatsmann Zeit gefunden habe, Leuten in ihrer einfachen Lebenslage einen solchen Dienst anzubieten, und es beweise nicht nur die Vortrefflichkeit seines Herzens, sondern auch sein lebhaftes Pflichtgefühl. Seine Handlungsweise zeige, daß er den Wert früher Eheschließung schätze, die Sicherheit der Familie bekräftige und die wichtige Bedeutung von Nachwuchs betone, um die Macht, den Einfluß und die Bedeutung des schönen Landes Frankreich zu erhöhen. Es war in der Tat eine sehr gute Rede.
Das Hochzeitsfrühstück fand im Château de Madrid statt, das für Monsieur Le Sueur eine sentimentale Bedeutung besaß. Es ist schon erwähnt worden, daß sich unter den vielen Beteiligungen des Ministers (wie wir ihn jetzt nennen müssen) unter anderem auch eine Autofabrik befand. Sein Hochzeitsgeschenk für den Bräutigam war ein sehr hübscher Zweisitzer eigenen Fabrikats, und in diesem begab sich {29}das junge Paar nach dem Essen auf die Hochzeitsreise. Diese konnte sich nur über das Wochenende erstrecken, da der junge Mann an seine Arbeit zurückkehren mußte, die ihn nach Marseille, Toulon und Nizza führte. Lisette küßte ihre Tante, und sie küßte Monsieur Le Sueur.
»Montag um fünf Uhr«, flüsterte sie ihm zu.
»Ich werde kommen«, erwiderte er.
Sie fuhren davon, und einen Augenblick schauten Monsieur Le Sueur und Madame Saladin dem flotten gelben Wagen nach.
»Wenn er sie nur glücklich macht«, seufzte Madame Saladin, die an Champagner mittags nicht gewöhnt war und sich unvernünftig melancholisch fühlte.
»Wenn er sie nicht glücklich macht, wird er mit mir zu rechnen haben«, sagte Monsieur Le Sueur eindrucksvoll.
Sein Wagen fuhr vor.
»Au revoir, chère Madame. Sie werden an der Avenue de Neuilly einen Bus bekommen.«
Er stieg in seinen Wagen, und als er an die Staatsangelegenheiten dachte, die auf ihn warteten, seufzte er zufrieden. Es war entschieden seiner Stellung viel angemessener, daß seine Mätresse nicht ein kleines Mannequin in einem Modehaus war, sondern eine anständige verheiratete Frau.
{30}Der Lunch
Ich entdeckte sie während der Vorstellung, und da sie mir zuwinkte, ging ich in der Pause hinüber und setzte mich neben sie. Es war lange her, daß ich sie zuletzt gesehen hatte, und hätte nicht jemand ihren Namen erwähnt, so glaube ich kaum, daß ich sie erkannt hätte. Lebhaft sprach sie mich an.
»Ja – das ist viele Jahre her, daß wir uns kennengelernt haben. Wie doch die Zeit vergeht! Jünger werden wir alle nicht. Wissen Sie noch, als ich Sie zum erstenmal sah? Sie haben mich zum Lunch eingeladen.«
Und ob ich das noch wußte!
Es war vor zwanzig Jahren, und ich lebte in Paris. Ich hatte im Quartier Latin ein winziges Appartement, von wo man auf einen Friedhof hinaussah, und ich verdiente kaum genug Geld, um Leib und Seele zusammenzuhalten. Sie hatte ein Buch von mir gelesen und mir darüber geschrieben. Ich antwortete und dankte ihr, und sogleich bekam ich einen weiteren Brief von ihr, der ankündigte, daß sie in Paris auf der Durchreise sei und sich gern mit mir unterhalten wollte; sie habe aber wenig Zeit, und nur am kommenden Donnerstag sei sie ein Weilchen frei; den Vormittag über sei sie im Jardin du Luxembourg, und ob ich ihr anschließend einen kleinen Imbiß bei Foyot spendieren wolle? Foyot ist ein Restaurant, wo die französischen Senatoren speisen, und ich konnte es mir so wenig leisten, daß es mir noch nicht {31}einmal im Traum eingefallen wäre, dorthin zu gehen. Aber ich fühlte mich geschmeichelt, und ich war zu jung, um schon gelernt zu haben, daß man einer Frau etwas abschlagen kann. (Wenige Männer, darf ich hinzufügen, lernen das rechtzeitig, bis sie zu alt sind, als daß ihre Antwort noch irgendeine Bedeutung für die Frau hätte.) Ich hatte achtzig Francs (Goldfranken), die mir bis zum Ende des Monats reichen mußten, und ein bescheidener Lunch konnte nicht mehr als fünfzehn kosten. Wenn ich die nächsten beiden Wochen auf den Kaffee verzichtete, würde ich ganz gut auskommen.
Ich antwortete, daß ich meine Brieffreundin am Donnerstag um halb eins bei Foyot erwarten werde. Sie war nicht so jung, wie ich gedacht hatte, und eher eine imposante als eine anziehende Erscheinung. Sie war nämlich eine Frau von vierzig Jahren (ein bezauberndes Alter, das jedoch kaum eine plötzliche, verheerende Liebe auf den ersten Blick erweckt), und ich hatte den Eindruck, daß sie mehr Zähne – weiße, große, regelmäßige Zahne – besaß als für irgendeinen praktischen Zweck nötig. Sie war etwas geschwätzig, aber da sie über mich zu sprechen geneigt schien, war ich willens, ein aufmerksamer Zuhörer zu sein.
Ich erschrak, als die Speisekarte gebracht wurde, denn die Preise waren bei weitem höher, als ich angenommen hatte. Aber sie beruhigte mich.
»Ich esse mittags nie etwas«, sagte sie.
»Oh, sagen Sie doch das nicht!« antwortete ich großzügig.
»Ich esse nie mehr als nur ein Gericht. Ich finde, die Leute essen heutzutage viel zuviel. Ein bißchen Fisch vielleicht. Ob sie wohl Lachs haben?«
Nun war es früh im Jahr für Lachs, und auf der {32}Speisekarte stand er nicht, aber ich fragte den Kellner, ob sie welchen hätten. Ja, ein wunderbarer Lachs sei gerade eingetroffen, der erste, den sie hereinbekommen hätten. Ich bestellte ihn für meinen Gast. Der Kellner fragte sie, ob sie etwas zu sich nehmen wolle, während der Lachs zubereitet wurde.
»Nein«, antwortete sie, »ich esse nie mehr als ein Gericht. Wenn Sie nicht ein wenig Kaviar haben. Gegen Kaviar habe ich nie etwas.«
Mir wurde etwas mulmig. Ich wußte, daß ich mir Kaviar nicht leisten konnte, aber ich konnte es ihr nicht gut sagen. Ich trug dem Kellner auf, selbstverständlich Kaviar zu bringen. Für mich selbst wählte ich das billigste Gericht aus der Karte, und das war ein Hammelkotelett.
»Ich finde es unklug von Ihnen, Fleisch zu essen«, sagte sie. »Wie wollen Sie denn arbeiten, nachdem Sie so schwere Sachen wie Koteletts gegessen haben? Ich halte nichts davon, mir den Magen zu überladen.«
Dann kam die Getränkefrage.
»Ich trinke zu Mittag nie etwas«, sagte sie.
»Ich auch nicht«, antwortete ich prompt.
»Außer Weißwein«, fuhr sie fort, als ob ich nichts gesagt hätte. »Diese französischen Weißweine sind so leicht. Sie sind vorzüglich für die Verdauung.«
»Was möchten Sie?« fragte ich, immer noch gastfreundlich, aber nicht in übertriebenem Maße.
Mit ihren weißen Zähnen blitzte sie mich fröhlich und freundschaftlich an.
»Mein Arzt erlaubt mir nichts als Champagner.«
Ich glaube, ich wurde etwas blaß. Ich bestellte eine halbe {33}Flasche. Beiläufig bemerkte ich, daß mein Arzt mir Champagner strikt verboten habe.
»Was werden Sie denn trinken?«
»Wasser.«
Sie aß den Kaviar, und sie aß den Lachs. Sie plauderte vergnügt über Kunst und Literatur und Musik. Aber ich überlegte, wie hoch die Rechnung sein würde. Als mein Hammelrippchen kam, machte sie mir recht ernste Vorhaltungen.
»Ich sehe, Sie sind gewöhnt, einen schweren Lunch zu essen. Ich bin überzeugt, daß das verkehrt ist. Warum folgen Sie nicht meinem Beispiel und essen nur ein Gericht? Sie würden sich sicherlich dabei viel wohler fühlen.«
»Aber ich esse nicht mehr als ein Gericht«, sagte ich, als der Kellner wieder mit der Karte kam.
Sie winkte ihm mit leichter Geste ab.
»Nein, nein, ich esse nie was zum Lunch. Nur einen Happen, mehr will ich nie, und den esse ich mehr zur Gesellschaft als aus sonst einem Grunde. Ich könnte unmöglich noch etwas essen – es sei denn, sie hätten ein paar von diesen Riesenspargeln. Es täte mir leid, Paris zu verlassen, ohne ein paar davon gegessen zu haben.«
Mir fiel das Herz in die Hose. Ich hatte sie in den Läden gesehen und wußte, daß sie furchtbar teuer waren. Oft war mir bei ihrem Anblick das Wasser im Munde zusammengelaufen.
»Madame möchte wissen, ob Sie diese Riesenspargel haben«, fragte ich den Kellner.
Mit ganzer Willenskraft versuchte ich, ihm zu suggerieren, daß er nein sagte. Ein glückliches Lächeln zerfloß auf seinem breiten, priesterlichen Gesicht, und er versicherte {34}mir, sie hätten welche, so riesengroß, so herrlich, so zart, daß es ein wahres Wunder sei.
»Ich bin überhaupt nicht hungrig«, seufzte mein Gast, »aber wenn Sie darauf bestehen, dann meinetwegen ein paar Spargel.«
Ich bestellte sie.
»Essen Sie keine?«
»Nein, ich esse nie Spargel.«
»Ich weiß, es gibt Leute, die sie nicht mögen. Es liegt daran, daß Sie sich den Gaumen ruinieren mit all dem Fleisch, das Sie essen.«
Wir warteten, während der Spargel zubereitet wurde. Panik ergriff mich. Jetzt war es nicht mehr die Frage, wieviel Geld mir für den Rest des Monats übrigblieb, sondern ob ich genug hatte, um die Rechnung zu bezahlen. Es würde eine fürchterliche Blamage sein, wenn sich herausstellte, daß ich zehn Francs zu wenig hatte und meinen Gast anpumpen mußte. Das konnte ich nicht über mich bringen. Ich wußte genau, wieviel ich hatte, und wenn die Rechnung höher war, so war ich entschlossen, die Hand in die Tasche zu stecken, mit einem dramatischen Aufschrei hochzufahren und zu behaupten, ein Taschendieb habe mein Geld gestohlen. Natürlich wäre es dumm, wenn auch sie nicht genug hätte, die Rechnung zu bezahlen. Dann gäbe es nur die eine Möglichkeit, meine Uhr dazulassen und zu sagen, daß ich später wiederkommen und zahlen würde.
Der Spargel kam. Es waren riesige, saftige und verlockende Stangen. Der Duft der geschmolzenen Butter kitzelte meine Nasenlöcher, wie das Brandopfer der frommen Semiten die Nasenlöcher Jehovas kitzelte. Ich sah zu, wie das {35}liederliche Weib sie in großen, gierigen Bissen die Kehle hinunterschlang, und auf meine höfliche Art plauderte ich über die Entwicklungsstufe des Dramas bei den Balkanvölkern. Endlich war sie fertig.
»Kaffee?« fragte ich.
»Ja, nur ein Eis und Kaffee«, antwortete sie.
Jetzt war mir schon alles egal, also bestellte ich Kaffee für mich und ein Eis und Kaffee für sie.
»Wissen Sie, an eine Regel halte ich mich eisern«, sagte sie, während sie das Eis aß. »Man sollte immer von einer Mahlzeit aufstehen, wenn man spürt, daß man noch ein bißchen mehr essen könnte.«
»Sind Sie noch hungrig?« fragte ich schwach.
»O nein, ich bin nicht hungrig; sehen Sie, ich esse nie zu Mittag. Morgens eine Tasse Kaffee und dann abends Dinner, aber zum Lunch esse ich nie mehr als ein Gericht. Ich sprach von Ihnen.«
»Ah, ich verstehe!«
Dann passierte etwas Schreckliches. Während wir auf den Kaffee warteten, kam der Oberkellner mit einem einladenden Lächeln auf seinem scheinheiligen Gesicht zu uns heran und trug einen großen Korb voll ungeheurer Pfirsiche. Sie waren so rosig wie ein unschuldiges Mädchen; sie hatten den warmen Farbton einer italienischen Landschaft. Aber sicherlich war es doch für Pfirsiche noch nicht die Jahreszeit? Der Himmel wußte, was sie kosteten. Ich wußte es auch – nur etwas später, denn mein Gast nahm mitten im Weiterplaudern zerstreut einen aus dem Korb.
»Sehen Sie, Sie haben sich den Magen mit einem Haufen Fleisch überladen« – mein eines, elendes, kleines Kotelett! – {36}»und können nichts mehr essen. Aber ich habe nur eine Kleinigkeit gegessen und lasse mir einen Pfirsich schmecken.«
Die Rechnung kam, und als ich bezahlte, stellte ich fest, daß ich nur für ein ganz unzureichendes Trinkgeld noch genug hatte. Sie warf einen Blick auf die drei Francs, die ich für den Kellner hingelegt hatte, und ich wußte, daß sie mich für geizig hielt. Aber als ich das Restaurant verließ, hatte ich den ganzen Monat vor mir und nicht einen Sou in der Tasche.
»Folgen Sie meinem Beispiel«, sagte sie, als wir uns die Hand gaben, »und essen Sie nie mehr als nur ein Gericht zum Lunch.«
»Ich werde es übertreffen«, gab ich zurück. »Ich werde heute abend nicht dinieren.«
»Humorist!« rief sie fröhlich und hopste in ein Taxi. »Sie sind ein echter Humorist!«
Aber nun hatte ich endlich meine Rache. Ich glaube nicht, daß ich ein rachsüchtiger Mensch bin, aber wenn die unsterblichen Götter selbst sich einmischen, so ist es verzeihlich, wenn man sich mit Behagen das Resultat ansieht. Heute wiegt sie hundertdreißig Kilo.
{37}Unbesiegt
Er kam in die Küche zurück. Der Mann lag noch immer auf dem Boden, dort, wo er ihn niedergeschlagen hatte, sein Gesicht war blutig, und er stöhnte. Die Frau stand gegen die Wand gelehnt, ihren vor Schreck geweiteten Blick auf Willi gerichtet. Als Hans eintrat, riß sie den Mund auf und begann laut zu schluchzen. Willi saß am Tisch, den Revolver in der Hand, ein noch halbvolles Weinglas vor sich. Hans trat hinzu, goß sich ein Glas voll und leerte es in einem Zug.
»Sieht aus, als hättest du Ärger gehabt, mein Junge«, sagte Willi grinsend.
Auf Hans’ blutverschmiertem Gesicht waren deutlich die Spuren scharfer Fingernägel zu sehen. Vorsichtig betastete er seine Wange.
»Die hätte mir die Augen ausgekratzt, wenn sie gekonnt hätte, das Luder. Ich werde mir etwas Jod drauftun müssen. Aber jetzt wird sie keine Schwierigkeiten mehr machen. Geh nur hinein zu ihr. Du bist dran.«
»Soll ich? Ich weiß nicht recht. Es wird spät.«
»Red nicht so dumm daher. Dann wird’s eben spät. Wir haben uns verirrt. Bist du ein Mann oder nicht?«
Die Strahlen der untergehenden Sonne fielen schräg in die Küche des Bauernhauses. Willi zögerte. Er war von kleinem Wuchs, dunkelhaarig, eine dürftige Erscheinung, {38}Modezeichner von Beruf. Er wollte nicht, daß Hans ihn für einen Schlappschwanz hielt. Er erhob sich und ging auf die Tür zu, durch die Hans hereingekommen war.
Die Frau schien zu ahnen, was er vorhatte. Sie stieß einen Schrei aus und sprang ihm in den Weg.
»Non, non!« rief sie.
Mit einem Satz war Hans bei ihr, packte sie an den Schultern und schleuderte sie zurück. Sie strauchelte und fiel hin. Hans nahm Willis Revolver.
»Immer mit der Ruhe!« Sein Französisch hatte einen schweren deutschen Akzent. »Geh jetzt.« Er nickte in Richtung Tür. »Ich paß auf die beiden hier auf.«
Willi verließ den Raum, kam aber sofort wieder.
»Sie ist bewußtlos.«
»Na wenn schon.«
»Ich kann nicht. Es hat keinen Sinn.«
»Ein Idiot bist du. Ein Weibsbild.«
Willi errötete.
»Wir sollten uns besser auf den Weg machen.«
Hans zuckte geringschätzig die Achseln.
»Ich trink noch die Flasche aus. Dann gehen wir.«
Er fühlte sich entspannt und wäre gerne noch ein wenig geblieben. Wenn man seit dem frühen Morgen im Einsatz ist und viele Stunden auf dem Motorrad hinter sich hat, spürt man seine Gliedmaßen. Zum Glück war’s nicht mehr weit nach Soissons, höchstens fünfzehn Kilometer. Ob es ihm heute endlich gelingen würde, in einem anständigen Bett zu schlafen?
Natürlich wäre das alles nicht passiert, wenn das Mädchen vernünftig gewesen wäre. Sie hatten sich verirrt, er und Willi, und hatten einen Feldarbeiter nach dem Weg gefragt. Der {39}gab ihnen mit Absicht eine falsche Richtung an, so daß sie auf eine Nebenstraße gerieten. An diesem Bauernhaus hier hatten sie haltgemacht und abermals um Auskunft gebeten, sehr höflich, denn laut Armeebefehl war die französische Bevölkerung höflich zu behandeln, solange sie keinen Widerstand leistete. Das Mädchen hatte die Tür geöffnet und behauptet, den Weg nach Soissons nicht zu wissen. Sie drangen ins Haus ein, und die Mutter des Mädchens erklärte ihnen den Weg. Die Familie – der Bauer, seine Frau und seine Tochter – schien gerade das Abendessen beendet zu haben. Die Weinflasche, die auf dem Tisch stand, erinnerte Hans daran, daß er seit dem Mittag dieses sehr heißen Tages nichts mehr getrunken hatte. Er wollte seinen Durst stillen. Als er um eine Flasche Wein bat, fügte Willi sofort hinzu, daß man selbstverständlich dafür bezahlen würde. Willi war ein guter Junge, nur leider etwas schlapp. Man hatte ja schließlich den Krieg gewonnen, oder? Wo war denn die französische Armee? Geflohen war sie, Hals über Kopf geflohen. Und die Engländer? Die hatten sich gar nicht schnell genug auf ihre Insel zurückziehen können. Also durfte man sich als Sieger doch wohl nehmen, was man brauchte? Klar, daß man das durfte. Aber dieser Willi – er hatte zwei Jahre in einem Pariser Modesalon gearbeitet, sprach fließend Französisch und wurde eben darum als Kundschafter verwendet –, nun ja: der lange Aufenthalt in Frankreich war an Willi nicht spurlos vorübergegangen. Ein dekadentes Volk, die Franzosen. Es tut einem Deutschen nicht gut, unter ihnen zu leben.
Die Bauersfrau stellte zwei Flaschen Wein auf den Tisch. Willi gab ihr zwanzig Francs. Sie bedankte sich nicht einmal.
{40}Hans sprach nicht so gut Französisch wie Willi, aber er konnte sich verständlich machen. Er zog Willi möglichst oft zu Sprachübungen heran und ließ sich von ihm die Fehler verbessern. Weil Willi ihm so nützlich war, hatte er Freundschaft mit ihm geschlossen. Er wußte, daß Willi ihn bewunderte, alles an ihm: seine hohe breitschultrige Gestalt, sein blondes lockiges Haar, seine blauen Augen.
Auch jetzt versuchte Hans, die Gelegenheit auszunutzen, um sich in französischer Konversation zu üben, aber die drei Bauersleute zeigten keinerlei Entgegenkommen. Er erzählte ihnen, daß er selbst ein Bauernsohn sei und nach dem Krieg wieder auf den väterlichen Hof zurückkehren würde; daß seine Mutter ihn nach München auf die Handelsschule geschickt habe, weil sie einen Geschäftsmann aus ihm machen wollte, und daß er statt dessen eine landwirtschaftliche Lehranstalt besucht habe.
Das Mädchen unterbrach ihn:
»Sie sind hergekommen, um nach dem Weg zu fragen. Jetzt wissen Sie ihn. Trinken Sie Ihren Wein aus, und gehen Sie.«
Hans hatte sie davor kaum angesehen. Sie war nicht hübsch, aber die dunklen Augen in ihrem blassen Gesicht und ihre bei aller Einfachheit geschmackvolle Kleidung gaben ihr ein Aussehen, das nicht in diese Umgebung zu passen schien, fast eine gewisse Vornehmheit. Hans hatte seit Kriegsbeginn alles mögliche über die französischen Mädchen gehört. Angeblich besaßen sie etwas, das den deutschen Mädchen fehlte. Willi nannte es ›Chic‹, aber auf die Frage, was das nun eigentlich bedeute, wußte er nichts Klügeres zu sagen, als daß man das nur spüren könne. Natürlich hatte Hans auch schon {41}andere Urteile über die Französinnen zu hören bekommen, und weit weniger schmeichelhafte. Nun, das würde er ja bald genug selbst herausfinden. Spätestens in einer Woche, wenn man nach Paris käme. Das Oberkommando, so hieß es, hatte diesbezüglich schon Vorsorge für seine tapferen Soldaten getroffen und entsprechende Häuser eingerichtet.
»Trink den Wein aus«, sagte Willi. »Wir gehen.«
Aber Hans wollte sich nicht drängen lassen. Er wandte sich an das Mädchen:
»Sie sehen nicht aus wie eine Bauerntochter.«
»Möglich«, antwortete sie.
»Sie ist Lehrerin«, sagte ihre Mutter.
»Also ein Mädchen mit guter Erziehung«, fuhr Hans in seinem schlechten Französisch unbekümmert fort. »Dann werden Sie ja begreifen, daß das französische Volk soeben eine der größten Stunden seiner Geschichte erlebt. Wir haben diesen Krieg nicht gewollt. Ihr habt uns den Krieg erklärt. Jetzt haben wir gewonnen, und jetzt werden wir aus Frankreich ein anständiges Land machen. Wir werden Ordnung in euer Durcheinander bringen. Wir werden euch beibringen, wie man arbeitet. Ihr werdet Gehorsam und Disziplin lernen.«
Sie ballte ihre Fäuste und sah ihn an, die Augen schwarz vor Haß. Aber sie blieb stumm.
»Du bist betrunken, Hans«, sagte Willi.
»Ich bin stocknüchtern. Ich sage ihnen nur die Wahrheit. So etwas schadet nie.«
»Ihr Freund hat recht!« Das Mädchen konnte nicht länger an sich halten. »Sie sind betrunken. Gehen Sie endlich. Gehen Sie!«
{42}»Ach, Sie verstehen Deutsch? Schön, ich gehe. Und zum Abschied bekomme ich einen Kuß von Ihnen.«
Sie wollte zurückweichen, aber er hielt sie am Handgelenk fest.
»Vater!« rief sie. »Vater!«
Als der Bauer sich auf ihn warf, ließ Hans das Mädchen los und schlug ihn mit solcher Kraft ins Gesicht, daß der Mann zu Boden stürzte. Dann packte Hans das Mädchen aufs neue. Sie versetzte ihm eine schallende Ohrfeige, die er lachend einsteckte.
»Ist das ein Benehmen, wenn ein deutscher Soldat einen Kuß haben will? Na warte!«
Er war stark genug, mit dem einen Arm das Mädchen festzuhalten und mit dem andern die Mutter, die ihn wegzerren wollte, gegen die Wand zu stoßen.
»Hans!« rief Willi. »Hans!«
»Halt’s Maul, zum Teufel!«
Er hielt dem Mädchen den Mund zu, damit sie nicht schreien konnte, und zerrte sie hinüber ins Nebenzimmer.
So kam’s, und so hatte es kommen müssen. War sie nicht selber schuld daran? Sie hätte ihn nicht ins Gesicht schlagen dürfen. Wenn sie ihm den verlangten Abschiedskuß gegeben hätte, wäre er friedlich gegangen. Er blickte zu dem Bauer, der immer noch auf dem Boden lag, und fast mußte er über seine komische Miene lachen. Belustigt sah er die Frau an, die sich zitternd gegen die Wand drückte. Fürchtete sie, daß sie als nächste drankam? Wohl kaum. Er erinnerte sich an ein französisches Sprichwort.
»C’est le premier pas qui coûte. Nur keine Angst, alte Hexe.« Er zog seine Brieftasche hervor. »Hier sind hundert {43}Francs, damit sich Mademoiselle ein neues Kleid kaufen kann. Das alte taugt nichts mehr.« Er legte die Banknote auf den Tisch und stülpte den Helm über seinen Kopf. »Gehen wir.«
Sie knallten die Tür zu und bestiegen ihre Motorräder.
Die Bäuerin ging ins Nebenzimmer. Ihre Tochter lag auf dem Sofa. Sie lag noch genauso da, wie er sie zurückgelassen hatte, und wurde von wildem Schluchzen geschüttelt.
Drei Monate später kam Hans wieder nach Soissons. Er war mit der siegreichen deutschen Armee in Paris eingezogen, war auf seinem Motorrad unter dem Arc de Triomphe durchgefahren und dann weiter mit der Armee nach Tours und bis nach Bordeaux, ohne an irgendwelchen Kampfhandlungen teilzunehmen. Die einzigen französischen Soldaten, die er gesehen hatte, waren Gefangene. Es war ein Feldzug, wie er ihn sich grandioser nicht hätte vorstellen können.
Nach Abschluß des Waffenstillstands verbrachte er einen Monat in Paris, schrieb Ansichtskarten an seine Familie nach Bayern und kaufte Geschenke. Willi blieb, weil er die Stadt wie seine Westentasche kannte, noch in Paris, doch er selbst und der Rest seiner Einheit wurden nach Soissons verlegt, um die Armee dort zu unterstützen. Es war eine nette kleine Stadt, und er war recht annehmbar untergebracht. Es gab viel und gut zu essen, und eine Flasche echten Champagners kostete weniger als eine deutsche Mark.
Ihm fiel ein, daß es doch eigentlich ein großer Spaß sein müßte, dieses Mädchen wiederzusehen. Er würde ihr ein Paar Seidenstrümpfe mitbringen, um ihr seine Versöhnlichkeit zu beweisen. Er besaß einen guten Orientierungssinn {44}und meinte, er müßte den Bauernhof ohne Schwierigkeiten wiederfinden können. Also steckte er eines Nachmittags, als er nichts zu tun hatte, die Seidenstrümpfe in seine Tasche und bestieg seine Maschine. Es war ein herrlicher Herbsttag mit kaum einer Wolke am Himmel, und er fuhr durch die hübsche hügelige Landschaft. Das Wetter war so lange trocken und schön gewesen, daß selbst die rastlosen Pappeln, obwohl es September war, nicht erkennen ließen, daß der Sommer seinem Ende zuneigte. Er nahm eine falsche Abzweigung, was ihn etwas aufhielt, dennoch erreichte er den Ort, den er suchte, in weniger als einer halben Stunde. Ein Köter kläffte ihn an, als er auf das Tor zuging. Er trat ein, ohne zu klopfen.
In der Küche saß das Mädchen und schälte Kartoffeln. Beim Anblick der Uniform sprang sie auf.
»Was wollen Sie?« Dann erkannte sie ihn und wich zurück, das Messer in der Hand. »Sie sind es! Cochon.«