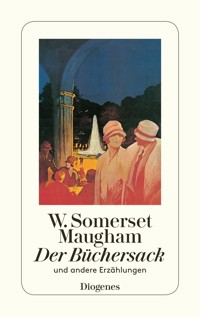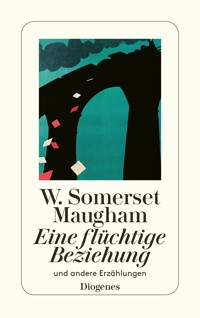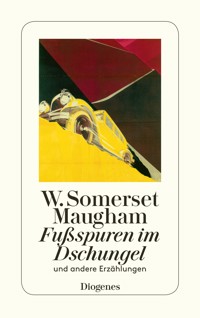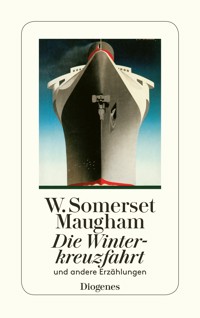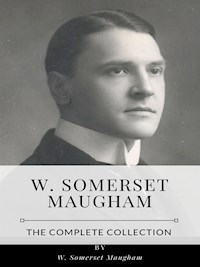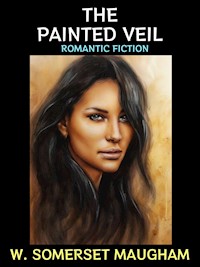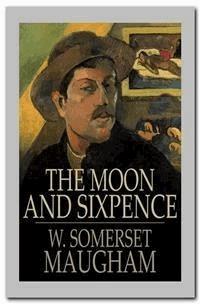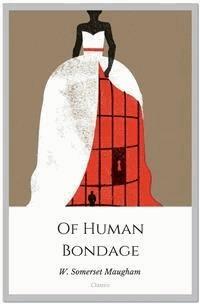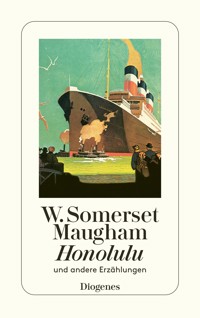
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kapitän Butler, der mit einem alten Schoner zwischen den Hawaiianischen Inseln hin und her tuckert, ist ein zufriedener Mann. Die Geschäfte laufen ganz gut, und er hat ein Mädchen auf dem Schiff, das genauso in ihn vernarrt ist wie er in sie. Doch als sein eingeborener Maat sich auch in sie verliebt, unterschätzt der Kapitän zunächst, was für einen gefährlichen Feind er sich zugezogen hat. In ›Honolulu‹ treffen Ost und West, moderne Zivilisation und archaische Magie aufeinander.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
W. Somerset Maugham
Honolulu
und andere Erzählungen
Diogenes
{7}Regen
Es war schon fast Zeit zum Schlafengehen, und beim nächsten Erwachen sollte Land in Sicht sein. Dr. Macphail zündete seine Pfeife an, beugte sich über die Reling und suchte am Himmel nach dem Kreuz des Südens. Nach zwei Jahren an der Front und einer Wunde, die länger zum Heilen brauchte, als sie sollte, war er froh, sich für mindestens zwölf Monate ruhig in Apia niederlassen zu können, und fühlte sich schon während der Reise bedeutend besser. Da einige Passagiere am nächsten Morgen in Pago-Pago das Schiff verlassen würden, war an Bord ein kleiner Tanzabend veranstaltet worden, und in seinen Ohren hämmerten immer noch die rauhen Töne des automatischen Klaviers. Aber auf Deck war es jetzt ganz ruhig. Ein Stückchen weiter hinten sah er seine Frau in einem Liegestuhl; sie sprach mit den Davidsons. Er ging hinüber. Als er sich unter das Licht setzte und den Hut abnahm, sah man, daß er, abgesehen von einer kahlen Stelle auf dem Schädel, sehr rote Haare hatte und jene rötliche, sommersprossige Haut, die für Rothaarige typisch ist. Er war ein Vierziger, sehr dünn, mit einem hageren Gesicht, ein umständlicher und recht pedantischer Mensch. Er sprach leise und ruhig und mit deutlich schottischem Akzent.
Zwischen den Macphails und den Davidsons, die Missionare waren, hatte sich an Bord eine gewisse Vertrautheit {8}entwickelt, die mehr der täglichen Nähe als irgendeiner inneren Zusammengehörigkeit zuzuschreiben war. Was sie am meisten verband, war die gemeinsame Mißbilligung, die sie denen entgegenbrachten, die ihre Tage und Nächte im Rauchsalon bei Poker, Bridge und Alkohol verbrachten. Mrs. Macphail fühlte sich nicht wenig geschmeichelt, daß sie und ihr Gatte die einzigen an Bord waren, mit denen die Davidsons sich gerne unterhielten, und selbst der Doktor, der zwar schüchtern, aber kein Dummkopf war, sah das unbewußt als ein Kompliment an. Und nur weil er von polemischer Natur war, erlaubte er sich, nachts in der Kabine darüber zu spotten.
»Mrs. Davidson sagte heute, sie wisse nicht, wie sie diese Reise ohne uns überstanden hätte«, sagte Mrs. Macphail, während sie ihre Perücke sorgfältig ausbürstete. »Sie sagte, wir seien die einzigen Leute auf dem Schiff, deren Bekanntschaft ihnen etwas bedeute.«
»Ich hätte nicht gedacht, daß ein Missionar so ein großes Tier ist, sich solche Extralaunen zu leisten.«
»Das sind keine Launen. Ich verstehe sehr gut, was sie meint. Es wäre für die Davidsons nicht sehr angenehm gewesen, sich unter die recht gewöhnlichen Leute im Rauchsalon mischen zu müssen.«
»Der Gründer ihrer Religion war nicht so exklusiv«, bemerkte Mr. Macphail kichernd.
»Ich muß dich wieder einmal bitten, nicht über religiöse Dinge zu spotten«, antwortete seine Frau. »Ich bin froh, daß ich nicht deinen Charakter habe, Alec. Du suchst nie nach dem Guten im Menschen.«
Er warf ihr aus seinen blaßblauen Augen einen Seitenblick zu, erwiderte aber nichts. Nach so manchen Ehejahren {9}hatte er gelernt, daß es dem Frieden zuträglicher war, seiner Frau das letzte Wort zu lassen. Er hatte sich bereits ausgezogen und kletterte in die obere Koje, um sich dort in den Schlaf zu lesen.
Am nächsten Morgen, als er auf Deck kam, befand man sich wirklich schon nahe an Land. Mit gierigen Augen schaute er hinüber. Ein dünner Streifen silbrigen Strandes ging rasch in Hügel über, die bis zum Kamm mit üppiger Vegetation bewachsen waren. Die dichten grünen Kokospalmen reichten fast bis zum Wasserrand; dazwischen sah man die Strohhäuser der Samoaner und hie und da weiß aufleuchtend eine kleine Kirche. Mrs. Davidson näherte sich und blieb neben ihm stehen. Sie war in Schwarz gekleidet und trug um den Hals eine goldene Kette, an der ein kleines Kreuz baumelte. Sie war eine kleine Frau mit braunem, mattem, kunstvoll frisiertem Haar und hervorstehenden blauen Augen hinter einem winzigen Kneifer, hatte ein langes Schafsgesicht, doch wirkte sie keineswegs dumm, sondern außerordentlich wach, und sie bewegte sich rasch wie ein Vogel. Das Bemerkenswerteste an ihr aber war ihre hohe, metallische Stimme ohne jede Modulation. Ihre harte Monotonie stach in die Ohren und reizte die Nerven wie das erbarmungslose Kreischen eines Preßluftbohrers.
»Dies muß Ihnen doch schon ganz heimatlich vorkommen«, sagte Dr. Macphail mit seinem schmalen, sonderbaren Lächeln.
»Unsere Inseln sind flacher, wissen Sie, nicht wie diese hier. Es sind Koralleninseln. Diese hier sind vulkanisch. Noch zehn Tage müssen wir fahren, ehe wir ankommen.«
{10}»Hier bedeutet das soviel wie ein Sprung in die Nachbarstraße zu Hause«, meinte Dr. Macphail scherzend.
»Nun, das ist etwas übertrieben ausgedrückt, aber man denkt in der Südsee anders über Entfernungen. Insofern haben Sie recht.«
Dr. Macphail seufzte leicht.
»Ich bin froh, daß wir nicht hier stationiert sind«, fuhr sie fort. »Wir hörten, es sei sehr schwierig, hier zu arbeiten. Der Dampferverkehr macht die Leute unruhig; und dann ist hier auch eine Flottenbasis, das ist immer schlecht für die Eingeborenen. In unserem Distrikt haben wir nicht mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen. Natürlich gibt es ein oder zwei Händler, aber wir sorgen dafür, daß sie sich anständig benehmen, und wenn sie das nicht tun, machen wir ihnen den Boden so heiß, daß sie freiwillig wegziehen.«
Sie rückte den Kneifer auf der Nase zurecht und starrte mit unbarmherzigem Blick auf die grüne Insel.
»Es ist eine fast hoffnungslose Aufgabe für einen Missionar hier. Wir können gar nicht dankbar genug sein, daß uns wenigstens das erspart geblieben ist.«
Davidsons Distrikt bestand aus einer Gruppe von Inseln im Norden von Samoa; sie lagen so weit auseinander, daß er oft große Strecken im Kanu zurückzulegen hatte. Dann blieb seine Frau allein auf dem Hauptsitz und leitete die Mission. Dr. Macphails Herz sank, wenn er daran dachte, mit welcher Tüchtigkeit sie das gewiß tat. Sie sprach von der Gottlosigkeit der Eingeborenen mit einer Stimme, die sich durch nichts dämpfen ließ, aber von salbungsvollem Entsetzen troff. Ihr Taktgefühl war von besonderer Art. Am Anfang ihrer Bekanntschaft hatte sie zu ihm gesagt:
{11}»Wissen Sie, als wir auf die Inseln kamen, waren die Heiratsbräuche dort derart abstoßend, daß ich sie Ihnen unmöglich beschreiben kann. Aber ich werde sie Mrs. Macphail erzählen, und sie kann sie Ihnen schildern.«
Dann hatte er seine Frau und Mrs. Davidson, auf nahe zusammengerückten Deckstühlen liegend, in ernster, über zwei Stunden dauernder Unterhaltung gesehen. Er war hinter ihnen, um sich Bewegung zu machen, auf und ab gegangen und hatte Mrs. Davidsons erregtes Geflüster wie das ferne Rauschen eines Wildbachs vernommen und beobachtet, wie seine Frau sich offenen Mundes und bleichen Gesichts an den erschreckenden Mitteilungen delektierte. Nachts in ihrer Kabine wiederholte sie ihm mit flatterndem Atem alles, was sie erfahren hatte.
»Nun, was habe ich Ihnen gesagt?« rief Mrs. Davidson am nächsten Morgen frohlockend. »Haben Sie jemals etwas so Schreckliches gehört? Jetzt wundern Sie sich nicht mehr, warum ich es Ihnen nicht selbst erzählen konnte, obgleich Sie Arzt sind.«
Mrs. Davidson schaute ihm prüfend und mit dramatischem Eifer ins Gesicht, um zu sehen, ob sie die erwünschte Wirkung erzielt habe.
»Kann es Sie wundern, daß uns anfangs fast der Mut verließ? Sie werden mir wohl kaum glauben, wenn ich Ihnen sage, daß es völlig unmöglich war, auch nur ein einziges gutes Mädchen in einem der Dörfer zu finden.«
Sie benutzte das Wort ›gut‹ als festen technischen Ausdruck.
»Mr. Davidson und ich haben uns lange darüber beraten und uns schließlich geeinigt, als erstes das Tanzen zu {12}unterdrücken. Die Eingeborenen waren geradezu versessen aufs Tanzen.«
»Ich war selbst nicht dagegen, als ich noch zu den Jüngeren zählte«, sagte Dr. Macphail.
»Das habe ich mir gedacht, als ich Sie gestern Mrs. Macphail fragen hörte, ob sie nicht eine Runde drehen wolle. Ich finde im Grunde auch nicht viel dabei, wenn ein Mann mit seiner Frau tanzt, aber ich war doch erleichtert, als sie ablehnte. Unter diesen Umständen hier fand ich es doch besser, daß wir ganz für uns blieben.«
»Unter welchen Umständen?«
Mrs. Davidson warf ihm einen raschen Blick durch den Kneifer zu, beantwortete jedoch seine Frage nicht.
»Aber unter Weißen ist es nicht das gleiche«, fuhr sie fort. »Trotzdem stimme ich mit Mr. Davidson überein, der sagt, er begreife die Männer nicht, die dastehen und zusehen können, wie andere Männer ihre Frauen in den Arm nehmen. Was mich betrifft, ich habe nie mehr auch nur einen Schritt getanzt, seit ich verheiratet bin. Doch die Tänze der Eingeborenen sind etwas ganz anderes. Sie sind nicht nur selbst unmoralisch, sondern führen auch deutlich zur Unmoral. Nun, jedenfalls danken wir Gott, daß wir sie ausgerottet haben, und ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich sage, daß in unserem Distrikt seit acht Jahren niemand mehr getanzt hat.«
Jetzt gelangte man zur Hafeneinfahrt, und Mrs. Macphail trat zu ihnen. Das Schiff drehte scharf bei und glitt langsam hinein. Es war ein großer, geschützter Hafen, breit genug, eine Flotte von Kriegsschiffen aufzunehmen. Und ringsum erhoben sich hoch und steil die grünen Berge. Nahe der {13}Einfahrt, dem vollen Wind der See ausgesetzt, stand das Haus des Gouverneurs, von einem Garten umgeben. Das Sternenbanner baumelte schlaff an der Fahnenstange. An drei, vier schmucken Bungalows fuhr man vorbei, an einem Tennisplatz, und dann kam man zum Kai mit seinen Lagerhäusern. Mrs. Davidson deutete auf den Schoner, der drei- oder vierhundert Meter vom Ufer entfernt verankert war und sie nach Apia bringen sollte. Eine Menge eifriger, lärmender und fröhlicher Eingeborener war von allen Teilen der Insel gekommen. Manche aus Neugier, manche, um mit den Reisenden, die nach Sydney fuhren, Tauschhandel zu treiben. Sie brachten Ananas und riesige Stauden von Bananen, Tapa-Tücher, Halsketten aus Muscheln oder Haifischzähnen, Kawa-Schalen und kleine Nachbildungen von Kriegskanus. Amerikanische Matrosen, schmuck und sauber, glatt rasiert und mit offenen Gesichtern, schlenderten unter ihnen umher, und an einer Seite stand eine kleine Gruppe von Beamten. Während ihr Gepäck ausgeladen wurde, beobachteten die Macphails und die Davidsons das Menschengewühl. Dr. Macphail sah die Himbeerpocken, an denen die meisten Kinder und Jünglinge zu leiden schienen und die sich in entstellenden Wunden wie schlaffe Geschwüre zeigten. Sein professioneller Blick leuchtete auf, als er zum erstenmal leibhaftig Fälle von Elephantiasis erblickte, Männer mit einem riesigen, schweren Arm oder einem unförmig angeschwollenen Bein. Männer und Frauen trugen den Lava-Lava.
»Ein sehr unanständiges Kleidungsstück«, sagte Mrs. Davidson. »Mr. Davidson findet, es sollte von Rechts wegen verboten werden. Wie kann man von Menschen Moral {14}erwarten, die nichts anhaben als einen Streifen roter Baumwolle um die Lenden?«
»Es entspricht dem Klima«, entgegnete der Arzt und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
Hier an Land empfanden sie die Hitze drückend, obgleich es noch früh am Morgen war. Eingeschlossen von Bergen, lag Pago-Pago ohne einen Lufthauch da.
»Auf unseren Inseln«, fuhr Mrs. Davidson mit ihrer schrillen Stimme fort, »haben wir den Lava-Lava so gut wie ausgerottet. Ein paar alte Männer sieht man noch damit, und das ist alles. Die Frauen tragen alle ein Wickelkleid und die Männer Hosen und Unterhemd. Am Anfang unseres Aufenthaltes dort schrieb Mr. Davidson in einem seiner Berichte: ›Die Einwohner dieser Inseln werden erst dann christianisiert sein, wenn jeder Knabe über zehn richtige Hosen trägt.‹«
Mrs. Davidson hatte zwei-, dreimal rasche Vogelblicke zu den schweren grauen Wolken geworfen, die auf den Hafen zugesegelt kamen. Ein paar Tropfen fielen bereits.
»Wir sollten uns unterstellen«, sagte sie.
Sie flüchteten sich mit den übrigen unter ein großes Wellblechdach, und nun fiel der Regen schon in Strömen. Dort standen sie eine Weile, und schließlich kam auch Mr. Davidson zu ihnen. Während der Fahrt hatte er sich hie und da sehr höflich mit den Macphails unterhalten; doch er war nicht so gesellig wie seine Frau und hatte fast die ganze Zeit lesend zugebracht. Er war ein stiller, eigentlich mürrischer Mensch, und man spürte, daß Liebenswürdigkeit eine Pflicht für ihn bedeutete, die er sich christlich selbst auferlegt hatte. Von Natur aus war er reserviert und sogar finster. {15}Er war eine auffallende Erscheinung: sehr groß und dünn, mit langen, schlaksigen Gliedern, eingefallenen Wangen und seltsam hohen Backenknochen. Er sah so ausgezehrt aus, daß man überrascht war, wenn man seine vollen, sinnlichen Lippen bemerkte. Er trug sein Haar sehr lang. Seine dunklen, tiefliegenden Augen waren groß und voller Trauer, und seine Hände mit den langen, knochigen, edlen Fingern sahen nach Charakterstärke aus. Aber das Auffallendste an ihm war, daß man bei seinem Anblick an unterdrücktes Feuer denken mußte, was eindrucksvoll und leicht beunruhigend wirkte. Das war kein Mensch, mit dem man Vertraulichkeit pflegen konnte.
Er brachte unwillkommene Nachrichten. Eine Masernepidemie war auf der Insel ausgebrochen, bei den Eingeborenen eine ernste und oft tödliche Krankheit; und auch die Mannschaft des Schoners, mit dem sie fahren sollten, hatte einen Fall gemeldet. Der Mann war bereits an Land und in die Quarantäneabteilung des Krankenhauses gebracht worden, aber Apia hatte telegraphisch Weisung gegeben, der Schoner dürfe dort nicht anlaufen, ehe nicht mit Sicherheit festgestellt werden könne, daß kein weiteres Mitglied angesteckt sei.
»Das heißt, daß wir hier für mindestens zehn Tage bleiben müssen.«
»Aber ich werde dringend in Apia gebraucht«, sagte Doktor Macphail.
»Da ist nichts zu machen. Wenn sich kein weiterer Fall mehr auf dem Schoner zeigt, darf er mit weißen Passagieren abfahren, Eingeborene können erst in drei Monaten wieder reisen.«
{16}»Gibt es hier ein Hotel?« fragte Mrs. Macphail.
Davidson lachte leise auf.
»Ausgeschlossen.«
»Was sollen wir tun?«
»Ich habe mit dem Gouverneur gesprochen. Am Kai wohnt ein Kaufmann, der Zimmer vermietet. Ich schlage vor, sobald der Regen aufhört, dort hinzugehen und zu sehen, was zu machen ist. Aber erwarten Sie keinen Komfort! Wir können froh und dankbar sein, wenn wir ein Bett zum Schlafen und ein Dach über dem Kopf haben.«
Aber der Regen zeigte keine Neigung aufzuhören, und schließlich machten sie sich mit Schirmen und Regenmänteln auf den Weg. Es gab keine richtige Stadt hier, nur ein paar offizielle Gebäude, ein, zwei Läden und im Hintergrund zwischen Kokospalmen und Bananenstauden einige wenige Eingeborenenhütten. Das Haus, das sie suchten, lag etwa fünf Minuten vom Hafen entfernt, ein zweistöckiger Holzbau mit breiten Veranden auf beiden Etagen und einem Wellblechdach. Der Besitzer war ein Mischling namens Horn, der eine Eingeborene zur Frau hatte, die von kleinen braunen Kindern umringt wurde. Im unteren Stock führte er einen Laden, in dem er Konserven und Baumwolle verkaufte. Die Zimmer, die er ihnen zeigte, waren fast unmöbliert. In dem, das die Macphails nahmen, stand nichts als ein altes, abgenutztes Bett mit einem zerfetzten Moskitonetz, ein wackeliger Stuhl und ein Waschtisch. Sie blickten sich bestürzt um. Der Regen strömte pausenlos nieder.
»Ich werde nicht mehr auspacken, als wir unbedingt brauchen«, sagte Mrs. Macphail.
Als sie gerade einen Handkoffer aufschloß, kam {17}Mrs. Davidson zu ihnen ins Zimmer. Sie war frisch und munter. Die freudlose Umgebung hatte keinerlei Wirkung auf sie.
»Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, so nehmen Sie schnell Nadel und Faden und fangen an, Ihr Moskitonetz zu reparieren«, sagte sie, »sonst werden Sie heute nacht kein Auge zutun.«
»Ist es so schlimm?« fragte Dr. Macphail.
»Es ist die Jahreszeit. Wenn man Sie in Apia ins Haus des Gouverneurs einlädt, werden Sie bemerken, daß alle Damen eine Art Kissenbezug erhalten, in den sie ihre … ihre unteren Extremitäten stecken.«
»Wenn nur der Regen für einen Augenblick aufhören wollte!« klagte Mrs. Macphail. »Ich könnte den Raum bei Sonnenschein viel behaglicher machen.«
»Oh, wenn Sie darauf warten, müssen Sie noch lange Geduld haben«, entgegnete Mrs. Davidson. »Pago-Pago ist wahrscheinlich der regenreichste Ort im ganzen Pazifischen Ozean. Sehen Sie, die Berge und die Bucht ziehen das Wasser an, und außerdem ist ohnehin gerade Regenzeit.«
Sie blickte von Macphail zu dessen Frau, die in verschiedenen Zimmerecken hilflos dastanden wie verlorene Seelen, und spitzte den Mund. Sie sah, daß sie sich ihrer annehmen mußte. Solche ratlosen Menschen machten sie ganz nervös, aber es kribbelte ihr in den Händen, alles in jene Ordnung zu bringen, die ihr so leichtfiel.
»Kommen Sie, geben Sie mir Nadel und Faden, dann will ich Ihr Netz reparieren, während Sie weiter auspacken. Um ein Uhr wird gegessen. Dr. Macphail, Sie würden gut daran tun, zum Hafen zu gehen und dafür zu sorgen, daß Ihr großes Gepäck an einen trockenen Ort kommt. Sie wissen, wie {18}diese Eingeborenen sind. Sie bringen es fertig, Ihre Sachen irgendwo aufzustellen, wo es die ganze Zeit über hineinregnet.«
Der Arzt zog seinen Regenmantel wieder an und ging hinunter. An der Tür stand Mr. Horn und unterhielt sich mit dem Quartiermeister des Schiffes, auf dem sie soeben angekommen waren, und einer Reisenden der zweiten Klasse, die Dr. Macphail mehrmals an Bord gesehen hatte. Der Quartiermeister, ein kleiner, verrunzelter, ungewöhnlich schmutziger Mann, nickte ihm zu, als er vorbeiging.
»Dumme Sache mit den Masern, Doc«, sagte er. »Ich sehe, Sie haben sich hier bereits niedergelassen.«
Dr. Macphail fand ihn ziemlich vertraulich in seiner Art, war aber ein schüchterner Mensch und nicht sehr leicht gekränkt.
»Ja, wir haben ein Zimmer oben.«
»Miss Thompson fährt auch nach Apia, deshalb habe ich sie hierhergebracht.«
Der Quartiermeister zeigte mit dem Daumen auf die Frau, die neben ihm stand. Sie war etwa siebenundzwanzig, drall, auf grobe Art hübsch und trug ein weißes Kleid und einen großen weißen Hut. Ihre prallen Waden in weißen Baumwollstrümpfen wölbten sich über den Rand ihrer weißen Glacélederstiefel. Sie schenkte Macphail ein einschmeichelndes Lächeln.
»Dieser Kerl versucht, mir anderthalb Dollar pro Tag für ein winziges Zimmer abzuknöpfen«, sagte sie mit heiserer Stimme.
»Ich sage dir, sie ist eine Freundin von mir, Jo«, drängte der Quartiermeister. »Sie kann nicht mehr als einen Dollar {19}zahlen, und du mußt sie einfach dafür bei dir wohnen lassen.«
Der Kaufmann war dick und glatt und lächelte ruhig.
»Nun, wenn es so ist, Mr. Swan, dann will ich sehen, was zu machen ist. Auf jeden Fall werde ich mit Mrs. Horn sprechen, und wenn eine Ermäßigung möglich ist, soll sie sie bekommen.«
»Fangen Sie gar nicht erst mit solchen Tricks bei mir an«, sagte Miss Thompson. »Die Sache muß gleich geregelt werden. Sie bekommen einen Dollar pro Tag für das Zimmer und keinen Cent mehr.«
Dr. Macphail lächelte. Er bewunderte die Unverschämtheit, mit der sie verhandelte. Er gehörte zu den Leuten, die immer bezahlten, was man von ihnen verlangte. Lieber ließ er sich übervorteilen, als daß er gefeilscht hätte. Der Kaufmann seufzte.
»Nun, Mr. Swan zuliebe will ich mich zufriedengeben.«
»So ist’s recht«, sagte Miss Thompson. »Kommen Sie gleich herein und trinken Sie bei mir einen Schluck Schnaps. Ich habe einen wirklich guten Korn in meiner Tasche, wenn Sie sie hereintragen wollen, Mr. Swan. Sie kommen auch mit, Doktor?«
»Oh, ich glaube nicht, vielen Dank!« antwortete er. »Ich will eben hinuntergehen und schauen, ob mit unserem Gepäck alles in Ordnung ist.«
Damit trat er hinaus in den Regen. Der fegte nur so daher von der Hafeneinfahrt, und der gegenüberliegende Strand war kaum zu sehen. Macphail begegnete einigen Eingeborenen, die nichts anhatten als den Lava-Lava und riesige Regenschirme über sich hielten. Sie hatten einen schönen {20}Gang, sehr aufrecht und mit gemächlichen Bewegungen; und sie lächelten und grüßten ihn in einer fremden Sprache, als sie an ihm vorüberkamen.
Es war fast Abendessenszeit, als er zurückkehrte. Im Wohnzimmer des Kaufmanns hatte man für sie gedeckt. Dieses Zimmer war nicht zum Wohnen eingerichtet, sondern nur für Prestigezwecke, und es herrschte eine dumpfe und melancholische Atmosphäre darin. Eine Garnitur aus gestanztem Plüsch stand an den Wänden, und von der Mitte der Decke hing, gegen die Fliegen durch gelbes Seidenpapier geschützt, ein vergoldeter Kronleuchter. Davidson war nicht gekommen.
»Er wollte dem Gouverneur einen Besuch abstatten«, sagte Mrs. Davidson, »und ich nehme an, er wurde zum Essen dabehalten.«
Ein kleines Eingeborenenmädchen brachte ihnen ein Gericht aus gehacktem Fleisch, und nach einer Weile kam der Kaufmann herein, um zu sehen, ob sie mit allem Nötigen versehen seien.
»Wir haben doch noch eine Mitbewohnerin, Mr. Horn«, sagte Dr. Macphail.
»Sie hat nur ein Zimmer genommen, das ist alles«, erwiderte der Kaufmann, »und bekommt ihr Essen dort.« Dabei schaute er die beiden Damen unterwürfig an.
»Ich habe sie im unteren Stockwerk einlogiert, damit sie Ihnen nicht im Wege ist. Sie wird Sie nicht belästigen.«
»Ist es jemand vom Schiff?« fragte Mrs. Macphail.
»Ja, Ma’am. Sie war in der zweiten Klasse. Sie reist nach Apia, wo sie als Kassiererin arbeiten wird.«
»Oh!«
{21}Als der Kaufmann gegangen war, sagte Macphail:
»Ich glaube, sie wird das nicht besonders lustig finden, allein auf ihrem Zimmer zu essen.«
»Wenn sie in der zweiten Klasse war, ist es besser so«, antwortete Mrs. Davidson. »Ich weiß nicht so recht, wer es sein kann.«
»Ich war zufällig dabei, als der Quartiermeister sie herbrachte. Sie heißt Thompson.«
»Es ist doch nicht etwa die Frau, die mit dem Quartiermeister gestern abend getanzt hat?« fragte Mrs. Davidson.
»Das muß sie wohl sein«, meinte Mrs. Macphail. »Ich fragte mich schon, was sie für eine ist. Sie schien mir ziemlich locker zu sein.«
»Kein guter Stil«, sagte Mrs. Davidson.
Dann sprachen sie über andere Dinge, und müde vom frühen Aufstehen, trennten sie sich nach dem Essen und gingen schlafen. Als sie aufwachten, regnete es nicht mehr, obwohl der Himmel immer noch grau war und die Wolken tief hingen. Sie machten einen Spaziergang auf der Landstraße, die längs der Bucht von den Amerikanern angelegt worden war.
Bei ihrer Rückkehr sahen sie, daß Davidson auch eben heimgekommen war.
»Vierzehn Tage lang werden wir hier sitzen müssen«, sagte er verärgert. »Ich habe mit dem Gouverneur hin und her verhandelt, aber er sagt, er könne nichts machen.«
»Mr. Davidson sehnt sich nur danach, zu seiner Arbeit zurückzukehren«, erklärte seine Frau mit einem unruhigen Blick auf ihn.
»Wir sind ein Jahr lang fortgewesen«, sagte er und ging auf {22}der Veranda hin und her. »Die Mission lag solange in den Händen eingeborener Missionare, und ich bin schrecklich nervös und fürchte, sie haben die Dinge schleifen lassen. Es sind gute Menschen, ich will nichts gegen sie sagen. Gottesfürchtig, ergeben und wahre Christen – ihre Christlichkeit könnte manchem sogenannten Christen zu Hause die Schamesröte ins Gesicht treiben –, aber sie haben jämmerlich wenig Energie. Sie können einmal hart bleiben, sie können es auch zweimal, aber sie können es nicht die ganze Zeit über. Wenn man einem eingeborenen Missionar, mag er noch so vertrauenswürdig scheinen, eine Mission überläßt, so werden sich immer wieder mit der Zeit Mißstände einschleichen.«
Mr. Davidson blieb stehen. Mit seiner hohen, dürren Gestalt und den großen Augen, die aus dem bleichen Gesicht blitzten, war er eine eindrucksvolle Erscheinung. In dem Feuer seiner Gebärden und der tiefen, klingenden Stimme lag absolute Aufrichtigkeit.
»Ich erwarte, daß ich mein ganzes Werk werde umformen müssen. Ich werde handeln müssen, und zwar sofort. Ist der Baum verfault, muß er gefällt und ins Feuer geworfen werden.«
Und am Abend nach dem Tee, der ihre letzte Mahlzeit war, sprach der Missionar, während die Damen mit Handarbeiten beschäftigt waren und Dr. Macphail eine Pfeife rauchte, von seiner Arbeit auf den Inseln.
»Als wir dort hinkamen, existierte für sie der Begriff der Sünde überhaupt noch nicht«, sagte er. »Sie verletzten die Gebote eines nach dem andern, ohne zu wissen, daß sie unrecht taten. Und ich glaube, das war der schwerste Teil meiner Arbeit, den Eingeborenen beizubringen, was Sünde ist.«
{23}Die Macphails wußten bereits, daß Davidson fünf Jahre lang auf den Salomoninseln gearbeitet hatte, ehe er seine Frau kennenlernte. Sie hatte als Missionarin in China gewirkt, und sie waren sich in Boston begegnet, wo sie einen Teil ihres Urlaubs verbrachten, um einem Missionskongreß beizuwohnen. Nach ihrer Heirat wurden sie zu den Inseln geschickt, auf denen sie sich seitdem betätigten.
Im Laufe der vielen Unterhaltungen, die sie mit Mrs. Davidson gehabt hatten, war eines klar zutage getreten, und zwar der unwandelbare Mut ihres Gatten. Als medizinisch geschulter Missionar mußte er immer darauf gefaßt sein, zu der einen oder anderen Insel der Gruppe gerufen zu werden. Selbst ein Walfänger ist während der Regenzeit kein sehr sicheres Transportmittel im stürmischen Pazifik, doch oft wurde er in einem Kanu geholt, und dann war die Gefahr groß. Bei Krankheits- oder Unglücksfällen zögerte er nie. Mehr als ein dutzendmal schwebte er nächtelang in Todesgefahr, und oft hatte Mrs. Davidson ihn schon verloren geglaubt.
»Ich flehe ihn manchmal an, nicht zu gehen«, sagte sie, »oder mindestens zu warten, bis das Wetter sich aufklärt, aber er hört nicht auf mich. Er ist halsstarrig; wenn er sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, kann nichts ihn davon abbringen.«
»Wie dürfte ich von den Eingeborenen fordern, auf den Herrn zu vertrauen, wenn ich selbst mich fürchtete, es zu tun?« rief Davidson. »Aber ich fürchte mich wahrhaftig nicht. Die Eingeborenen wissen, daß ich komme, sobald sie mich rufen, wenn es nur irgend menschenmöglich ist. Ja, glauben Sie denn, Gott würde mich verlassen, wenn ich in {24}Seinem Namen wirke? Der Wind weht, wenn Er es befiehlt, und die Wogen schäumen auf und wüten auf Sein Wort.«
Dr. Macphail war ein furchtsamer Mensch. Er hatte sich nie an das Heulen der Granaten über den Schützengräben gewöhnen können, und wenn er nahe der Front in einer Verbandsstation zu operieren hatte, brach ihm ständig bei der Bemühung, die zitternde Hand zu beherrschen, der Schweiß aus und trübte die Gläser seiner Brille. Ihn schauderte ein wenig beim Anblick des Missionars.
»Ich wünschte, ich könnte von mir sagen, ich hätte nie Angst gehabt«, murmelte er.
»Ich wünschte, Sie könnten sagen, daß Sie immer an Gott geglaubt haben«, entgegnete der andere.
Aber aus irgendeinem Grunde wandten sich an diesem Abend die Gedanken des Missionars immer wieder der ersten Zeit zu, die er und seine Frau auf den Inseln verbracht hatten.
»Manchmal schauten Mrs. Davidson und ich uns an, und die Tränen liefen uns über die Wangen. Wir arbeiteten ohne Unterlaß Tag und Nacht und schienen keinen Schritt weiterzukommen. Ich weiß nicht, was ich damals ohne sie gemacht hätte. Wenn mein Mut versagte, wenn ich der Verzweiflung nahe war, gab sie mir wieder Kraft und Hoffnung.«
Mrs. Davidson schaute auf ihre Handarbeit nieder, und eine leichte Röte stieg ihr in die Wangen. Ihre Hände zitterten ein wenig. Aus Angst, die Stimme werde ihr versagen, wagte sie nicht zu sprechen.
»Wir hatten keinen, der uns hätte helfen können. Wir waren allein, Tausende von Meilen fern von unseren eigenen Leuten und umgeben von Finsternis. Wenn ich entmutigt {25}und erschöpft war, legte sie ihre Arbeit beiseite, nahm die Bibel und las mir daraus vor, bis der Friede kam und sich auf mich senkte wie der Schlaf auf die Lider eines Kindes, und wenn sie schließlich das Buch schloß, sagte sie: ›Wir werden sie retten, auch wenn sie nicht wollen.‹ Und ich fühlte mich wieder stark im Herrn und antwortete: ›Ja, mit Gottes Hilfe werde ich sie retten. Ich muß sie retten.‹«
Er trat an den Tisch und stand ihnen gegenüber, als wollte er eine Vorlesung halten.
»Verstehen Sie, diese Menschen waren so von Natur aus verdorben, daß sie nicht dazu gebracht werden konnten, ihre Schlechtigkeit zu begreifen. Wir mußten sie lehren, Sünde in Handlungen zu sehen, die sie für ganz natürlich hielten. Wir mußten ihnen klarmachen, daß es Sünde sei, nicht nur die Ehe zu brechen oder zu lügen und zu stehlen, sondern auch den Leib zur Schau zu stellen, zu tanzen oder der Kirche fernzubleiben. Ich ließ die Frauen eine Sünde darin sehen, den Busen zu zeigen, und die Männer, keine Hosen zu tragen.«
»Wie brachten Sie das fertig?« fragte Dr. Macphail nicht ohne Neugier.
»Ich führte Geldstrafen ein. Offenbar ist die Strafe das einzige Mittel, durch das die Menschen einsehen lernen, daß eine Tat sündig ist. Ich strafte sie, wenn sie nicht zur Kirche kamen; ich strafte sie, wenn sie tanzten; ich strafte sie, wenn sie unzüchtig gekleidet waren. Ich habe einen Tarif ausgearbeitet, und jede Sünde mußte entweder mit Geld oder mit Arbeit gebüßt werden. Und schließlich habe ich sie so weit gebracht, daß sie es verstanden.«
»Haben sie sich denn nie geweigert zu bezahlen?«
{26}»Wie sollten sie?« fragte der Missionar.
»Es bedarf großer Tapferkeit, sich Mr. Davidson zu widersetzen«, sagte Mrs. Davidson mit ihren schmalen Lippen.
Dr. Macphail schaute Mr. Davidson erschrocken an. Was er hörte, empörte ihn, aber er wagte nicht, seine Mißbilligung laut zu äußern.
»Bedenken Sie, daß ich sie im schlimmsten Fall von der Kirchengemeinschaft ausschließen konnte.«
»Hätte ihnen das viel bedeutet?«
Davidson lächelte ein wenig und rieb sich die Hände.
»Dann hätten sie ihre Kopra nicht verkaufen können. Gingen die Männer fischen, bekamen sie ihren Anteil nicht. Es hieß soviel wie verhungern. O ja, es hätte ihnen schon etwas bedeutet.«
»Erzähle ihm von Fred Ohlson«, sagte Mrs. Davidson.
Der Missionar heftete seinen glühenden Blick auf Dr. Macphail.
»Fred Ohlson war ein dänischer Kaufmann, der seit vielen Jahren auf der Insel lebte. Er war ein ziemlich reicher Mann und nicht sehr erbaut von unserem Erscheinen. Sie verstehen, er hatte sich alles so eingerichtet, wie es ihm paßte, bezahlte den Eingeborenen für ihre Kopra, was er wollte, und zwar in Waren und Whisky. Er hatte eine Eingeborene zur Frau, die er aber dauernd betrog. Und er war ein Trinker. Ich gab ihm die Möglichkeit, sich zu bessern, aber er schlug sie in den Wind und lachte mich aus.«
Davidson sprach diese letzten Worte im tiefsten Baß und schwieg danach eine Zeitlang. Die Stille lastete schwer und drohend.
{27}»In zwei Jahren war er ein ruinierter Mann. Er verlor alles, was er sich in einem Vierteljahrhundert aufgebaut hatte. Und ich war es, der ihn zugrunde richtete und schließlich dazu zwang, zu mir zu kommen und mich um das Geld zur Rückreise nach Sydney anzuflehen.«
»Ich wünschte, Sie hätten ihn gesehen, als er zu Mr. Davidson kam«, sagte die Frau des Missionars. »Früher ein stattlicher, kräftiger Mann, gut gepflegt und mit einer lauten Stimme, war er plötzlich nur mehr halb so groß und ein alter Mann, der an allen Gliedern schlotterte.«
Mit abwesendem Blick schaute Davidson hinaus in die Nacht. Es regnete wieder.
Plötzlich kam ein Laut von unten; Davidson drehte sich um und sah seine Frau fragend an. Es war der rauhe, lärmige Laut eines Grammophons, das eine moderne Tanzplatte spielte.
»Was ist das?«
Mrs. Davidson rückte ihren Kneifer auf der Nase zurecht.
»Ein Passagier der zweiten Klasse hat ein Zimmer in diesem Haus. Ich nehme an, das Geräusch kommt von dort.«
Sie lauschten schweigend und vernahmen nun auch den Laut tanzender Schritte. Dann hörte die Musik auf, Pfropfen knallten, und Stimmen erhoben sich in animierter Unterhaltung.
»Ich glaube, sie gibt eine Abschiedsparty für ihre Freunde an Bord«, sagte Dr. Macphail. »Das Schiff fährt um zwölf Uhr ab, nicht wahr?«
Davidson bemerkte nichts dazu, schaute aber auf seine Uhr.
»Bist du fertig?« fragte er seine Frau.
{28}Sie stand auf und legte ihre Arbeit zusammen.
»Ja, gewiß«, antwortete sie.
»Ist es nicht zu früh, ins Bett zu gehen?« fragte der Arzt.
»Wir haben noch sehr viel zu lesen«, erklärte Mrs. Davidson. »Wo immer wir sind, lesen wir ein Kapitel aus der Bibel, ehe wir uns zur Nacht zurückziehen, und wir studieren es mit dem Kommentar, verstehen Sie, und sprechen es gründlich durch. Das ist eine wundervolle Geistesübung.«
Die beiden Paare sagten einander gute Nacht. Der Arzt und seine Frau blieben zurück. Drei oder vier Minuten lang sprach keiner von ihnen ein Wort.
»Ich gehe hinauf und hole die Karten«, sagte Dr. Macphail schließlich.
Mrs. Macphail schaute ihn zweifelnd an. Die Unterhaltung mit den Davidsons hatte sie ein wenig unsicher gemacht, aber sie wollte nicht gerne aussprechen, daß sie es für besser hielt, nicht Karten zu spielen, solange die Davidsons jeden Augenblick hereinkommen konnten.
Dr. Macphail brachte die Karten, und sie schaute zu, wenn auch mit einem leichten Schuldgefühl, während er seine Patience legte. Weiterhin hörte man, wie unten geräuschvoll gefeiert wurde.
Am nächsten Tag war das Wetter ganz gut, und die Macphails, zu zwei Wochen Nichtstun in Pago-Pago verurteilt, beschlossen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Sie gingen hinunter zum Kai und holten aus ihren Kisten eine Anzahl Bücher. Der Doktor suchte den Chefarzt des Marinehospitals auf und machte mit ihm einen Rundgang durch die Krankenzimmer. Beim Gouverneur gaben sie ihre Karte ab. Auf dem Weg begegneten sie Miss Thompson. {29}Dr. Macphail zog den Hut, und sie rief ihm mit lauter, fröhlicher Stimme »Guten Morgen, Doc!« zu. Sie trug wie am Tag zuvor ein weißes Kleid; ihre leuchtend weißen Stiefel mit den hohen Hacken und ihre sich wölbenden dicken Waden wirkten sonderbar in dieser exotischen Landschaft.
»Sie ist unpassend gekleidet, das muß ich sagen«, bemerkte Mrs. Macphail, »kommt mir überhaupt recht gewöhnlich vor.«
Als sie ins Haus zurückkamen, saß sie auf der Veranda und spielte mit einem der dunkelhäutigen Kinder des Kaufmanns.
»Rede ein paar Worte mit ihr«, flüsterte Dr. Macphail seiner Frau zu. »Sie ist allein hier, und es wäre ziemlich unhöflich, sie zu ignorieren.«
Mrs. Macphail war etwas scheu, hatte sich aber daran gewöhnt, zu tun, was ihr Mann von ihr verlangte.
»Ich glaube, wir sind Hausgenossen«, sagte sie ziemlich einfallslos.
»Schrecklich, nicht wahr, so zusammengepfercht zu werden?« antwortete Miss Thompson. »Und dabei sagt man mir, daß ich froh sein muß, überhaupt ein Zimmer zu haben. Ich möchte ja auch nicht bei den Eingeborenen wohnen, und manche wurden dort untergebracht. Ich verstehe nicht, warum es hier kein Hotel gibt.«
Sie wechselten noch ein paar Worte. Miss Thompson in ihrer lauten, geschwätzigen Art war sichtlich froh über eine kleine Plauderei, aber Mrs. Macphail hatte nur einen dürftigen Vorrat an fertigen Redewendungen und verabschiedete sich wieder.
»Nun, ich glaube, wir müssen jetzt hinaufgehen.«
{30}Am Abend, als sie sich zum Tee hinsetzten, kam Davidson herein und sagte:
»Diese Frau da unten hat offensichtlich ein paar Matrosen zu Besuch. Ich frage mich, wie sie mit ihnen bekannt geworden ist.«
»Sie kann nicht sehr wählerisch sein«, bemerkte Mrs. Davidson.
Sie waren alle ziemlich müde nach dem müßig verbrachten Tag.
»Wenn das noch zwei Wochen lang so weitergehen soll, weiß ich wirklich nicht, wie das enden wird«, sagte Dr. Macphail.
»Dagegen gibt es nur eines: den Tag genau einteilen«, antwortete der Missionar. »Ich nehme mir ein paar Stunden zum geistigen Studium, einige zur körperlichen Übung, ob das Wetter nun gut oder schlecht ist – in der Regenzeit können wir es uns nicht leisten, allzusehr darauf Rücksicht zu nehmen –, und eine gewisse Zeit zur Erholung.«
Dr. Macphail schaute seinen Gefährten besorgt an. Davidsons Programm bedrückte ihn. Wieder aßen sie Hackfleisch. Es schien das einzige Gericht zu sein, das die Köchin herstellen konnte. Unter ihnen begann das Grammophon zu spielen. Davidson schrak nervös zusammen, als er es hörte, sagte aber nichts. Männerstimmen drangen herauf. Miss Thompsons Gäste sangen ein bekanntes Lied, und auch ihre heisere, laute Stimme war zu hören. Außerdem wurde viel gebrüllt und gelacht. Die vier Menschen im oberen Stock versuchten Konversation zu machen und horchten doch gegen ihren Willen auf das Klirren der Gläser und das Scharren der Stühle. Offensichtlich waren noch mehr {31}Leute hinzugekommen. Miss Thompson gab eine Gesellschaft.
»Ich frage mich, wie sie alle unterbringt«, sagte Mrs. Macphail und unterbrach damit eine medizinische Unterhaltung zwischen dem Missionar und ihrem Mann.
Dies zeigte, wohin ihre Gedanken gewandert waren. Das Zucken in Davidsons Gesicht bewies, daß auch seine Aufmerksamkeit, obwohl er sich über wissenschaftliche Dinge ausließ, von der gleichen Sache abgelenkt wurde. Plötzlich, gerade als der Arzt ihm ziemlich langatmig von einer Erfahrung aus seiner Praxis an der Front von Flandern erzählte, sprang er mit einem Schrei in die Höhe.
»Was ist, Alfred?« fragte Mrs. Davidson.
»Natürlich! Daß mir das auch nicht gleich eingefallen ist! Sie ist aus Iwelei.«
»Unmöglich.«
»In Honolulu kam sie an Bord. Es ist klar. Und hier treibt sie ihr Gewerbe weiter. Hier!«
Die letzten Worte stieß er mit leidenschaftlicher Empörung hervor.
»Was ist Iwelei?« fragte Mrs. Macphail.
Er heftete seine düsteren Augen auf sie, und seine Stimme bebte vor Abscheu.
»Das verpestete Viertel von Honolulu. Der Distrikt der roten Lampen. Ein Schandfleck unserer Zivilisation.«
Iwelei befand sich am Rande der Stadt. Man ging durch dunkle Seitenstraßen am Hafen über eine baufällige Brücke, kam in eine verödete, holperige Straße voller Spurrillen und trat plötzlich hinaus ins Licht. Auf beiden Seiten der Straße waren Parkplätze für Autos, es gab glitzernde, hell {32}erleuchtete Restaurants, aus denen der Lärm mechanischer Klaviere drang, und es gab Friseurläden und Tabakgeschäfte.
Es lag Erregung in der Luft und eine Atmosphäre fröhlicher Erwartung. Man ging eine enge Gasse hinunter, entweder nach links oder nach rechts, denn die Straße teilte Iwelei in zwei Hälften, und man befand sich in jenem Distrikt. Kleine, schmucke, hübsch grün bemalte Bungalows standen dort in Reihen, und die Verbindungswege dazwischen waren breit und gerade. Das Ganze lag da wie eine Gartenstadt. Diese ehrbare Regelmäßigkeit, diese Ordnung und Sauberkeit jagten einem einen Schauer des Entsetzens über den Rücken. Wo hatte man je die Suche nach Liebe so systematisiert und geordnet? Auf den Verbindungswegen brannte hie und da eine Lampe, aber sie wären dunkel gewesen, hätten nicht die hellen Lichter aus den Bungalowfenstern sie zusätzlich erleuchtet. Männer wanderten herum und schauten die Frauen an, die lesend oder nähend an den Fenstern saßen und meistens keine Notiz von den Vorübergehenden nahmen. Wie die Frauen gehörten auch sie allen Nationen an. Da waren Amerikaner, Matrosen von den eingelaufenen Schiffen oder den Kanonenbooten, schwermütig betrunken, und Soldaten von den Regimentern, schwarze und weiße, die auf den Inseln einquartiert waren. Da waren Japaner, die zu zweit und zu dritt herumgingen, Hawaiianer, Chinesen in langen Kleidern und Filipinos mit verrückten Hüten. Schweigend und wie bedrückt schlenderten sie umher. Begierde ist etwas Trauriges.
»Es war die zum Himmel schreiende Schande des Pazifiks«, erklärte Davidson voller Heftigkeit. »Die Missionare haben sich schon seit Jahren dagegen gewandt, und schließlich hat sich die Presse damit befaßt. Die Polizei weigerte {33}sich einzuschreiten. Man kennt ihr Argument, Laster sei etwas Unvermeidliches, deshalb sei es das beste, es zu lokalisieren und unter Kontrolle zu halten. In Wirklichkeit aber war sie gekauft. Gekauft! Gekauft von den Restaurantbesitzern, den Zuhältern und den Frauen selbst. Aber schließlich wurden sie gezwungen wegzuziehen.«
»Ich habe etwas darüber in der Zeitung gelesen, die in Honolulu an Bord kam«, sagte Dr. Macphail.
»Iwelei mit seiner Sünde und Schande hörte am selben Tage zu existieren auf, als wir ankamen. Die ganze Bevölkerung wurde vor den Richter gebracht. Ich begreife einfach nicht, wieso ich nicht sogleich erkannt habe, was das für eine Frau ist.«
»Da Sie jetzt davon sprechen«, sagte Mrs. Macphail, »erinnere ich mich, daß ich sie nur wenige Minuten vor Abfahrt des Schiffes hatte an Bord kommen sehen. Ich dachte noch, die hat aber Glück gehabt.«
»Wie kann sie es wagen, hierherzukommen!« rief Davidson aufgebracht. »Ich werde es nicht dulden.«
Er schritt zur Tür.
»Was wollen Sie tun?« fragte Macphail.
»Was erwarten Sie von mir? Ich werde dies unterbinden. Ich lasse es nicht zu, daß dieses Haus herabsinkt zu einem, zu einem …«
Er suchte nach einem Wort, das die Ohren der Damen nicht beleidigte. Seine Augen blitzten, und sein bleiches Gesicht war vor Erregung noch bleicher geworden.
»Es klingt so, als seien mindestens drei, vier Männer dort unten«, sagte der Arzt. »Finden Sie es nicht ziemlich gewagt, gerade jetzt hineinzugehen?«
{34}Der Missionar warf ihm nur einen verachtungsvollen Blick zu und eilte wortlos aus dem Zimmer.
»Sie kennen Mr. Davidson schlecht, wenn Sie meinen, Angst vor persönlicher Gefahr könne ihn von der Ausübung seiner Pflicht abhalten«, sagte seine Frau.
Sie saß mit nervös gefalteten Händen da, zwei Flecken erschienen auf ihren hohen Backenknochen, und sie horchte angestrengt nach unten. Sie alle horchten, hörten ihn die Holztreppe hinuntersteigen und eine Tür aufstoßen. Das Singen verstummte plötzlich, aber das Grammophon fuhr fort, seine vulgäre Melodie hinauszuplärren. Sie vernahmen Mr. Davidsons Stimme und dann das Geräusch von etwas Schwerem, das niederfiel.
Die Musik hörte plötzlich auf. Er hatte anscheinend das Grammophon auf den Boden geschleudert. Abermals drang Davidsons Stimme, deren Worte sie aber nicht verstehen konnten, nach oben, dann die laute, schrille von Miss Thompson, danach ein wirrer Lärm, als brüllten mehrere Menschen gleichzeitig aus voller Kraft. Mrs. Davidson stieß einen kleinen Seufzer aus und schlang die Hände noch fester ineinander. Dr. Macphail blickte unsicher von ihr zu seiner Frau. Er hatte durchaus keine Lust, hinunterzugehen, fragte sich aber, ob sie es von ihm erwarteten. Dann kam etwas, was klang wie ein Handgemenge. Der Lärm wurde deutlicher. Wahrscheinlich waren sie dabei, Davidson hinauszuwerfen. Die Tür wurde zugeschlagen. Dann folgte eine Stille, und gleich darauf hörten sie Davidson die Treppe hinaufsteigen. Er ging weiter in sein Zimmer.
»Ich glaube, ich werde zu ihm gehen«, sagte Mrs. Davidson.
{35}Sie stand auf und verschwand.
»Sollten Sie mich brauchen, so rufen Sie mich!« rief Mrs. Macphail ihr nach, und als die andere gegangen war, sagte sie: »Ich hoffe, er wurde nicht verletzt.«
»Warum mischt er sich in fremde Angelegenheiten?« murmelte Dr. Macphail.
Schweigend saßen sie eine Zeitlang da und schraken gleichzeitig zusammen, denn das Grammophon begann wieder herausfordernd zu spielen, und höhnische Stimmen brüllten heiser den Text eines zotigen Liedes.
Am nächsten Tag war Mrs. Davidson bleich und müde. Sie klagte über Kopfweh und sah alt und runzelig aus. Sie erzählte Mrs. Macphail, der Missionar habe überhaupt nicht geschlafen, sondern die Nacht in entsetzlicher Erregung verbracht. Um fünf Uhr sei er aufgestanden und fortgegangen. Ein Glas Bier habe man über ihn ausgegossen, und seine Kleider seien fleckig und stänken. Aber ein düsteres Feuer glomm in Mrs. Davidsons Augen, wenn sie von Miss Thompson sprach.
»Sie wird den Tag, an dem sie Mr. Davidson verhöhnt hat, noch bitter bereuen«, sagte sie. »Mr. Davidson hat das beste Herz der Welt, und niemand, der in Not war, ist je zu ihm gekommen, ohne Trost von ihm zu empfangen, aber gegen die Sünde geht er gnadenlos vor, und wenn sein gerechter Zorn entfacht wird, ist er fürchterlich.«
»Was wird er tun?« fragte Mrs. Macphail.
»Ich weiß es nicht, aber ich möchte nicht in der Haut dieser Person stecken, um nichts in der Welt.«
Mrs. Macphail erschauerte. Etwas ernstlich Beunruhigendes lag in der triumphierenden Sicherheit dieser kleinen {36}Frau. Sie gingen an diesem Morgen zusammen aus und stiegen nebeneinander die Treppe hinunter. Miss Thompsons Tür stand offen, und sie sahen sie in einem fleckigen Morgenrock, wie sie sich etwas auf einem kleinen Kocher zubereitete.
»Guten Morgen!« rief sie heraus. »Geht es Mr. Davidson heute besser?«
Sie gingen mit emporgereckter Nase schweigend vorbei, als existierte sie nicht. Doch erröteten sie, als sie in eine Kaskade höhnischen Gelächters ausbrach. Plötzlich wandte Mrs. Davidson sich um.
»Wagen Sie es nicht, mich anzusprechen!« schrie sie. »Wenn Sie mich beleidigen, werde ich Sie aus dem Haus werfen lassen.«
»He, habe ich vielleicht Mr. Davidson gebeten, mich zu besuchen?«
»Antworten Sie ihr nicht«, flüsterte Mrs. Macphail hastig.
Wortlos gingen sie weiter, bis sie außer Hörweite waren.
»Sie ist schamlos, einfach schamlos«, zischte Mrs. Davidson.
Sie erstickte fast vor Wut.
Auf dem Heimweg begegneten sie ihr wieder, wie sie am Kai entlangschlenderte. Sie hatte ihren ganzen Putz angelegt. Ihr großer weißer Hut mit den billigen, auffallenden Blumen war direkt eine Herausforderung. Sie rief ihnen fröhlich etwas zu, und ein paar amerikanische Matrosen, die dort standen, grinsten, als die Damen mit eisigen Gesichtern vorübergingen.
Kurz bevor es wieder zu regnen begann, traten sie ins Haus.
{37}»Das wird ihr die feinen Kleider ruinieren«, bemerkte Mrs. Davidson mit bitterem Hohn.
Davidson kam erst herein, als sie das Essen schon zur Hälfte hinter sich hatten. Er war völlig durchnäßt, wollte sich aber nicht umkleiden. Er saß finster und schweigend da, aß nicht mehr als einige Bissen und starrte hinaus in den strömenden Regen. Als Mrs. Davidson ihm von ihren zwei Begegnungen erzählte, antwortete er nicht. Nur die tiefer werdenden Falten auf seiner Stirn zeigten an, daß er zugehört hatte.
»Glaubst du nicht, daß wir Mr. Horn veranlassen sollten, sie vor die Tür zu setzen?« fragte Mrs. Davidson. »Wir dürfen ihr nicht gestatten, uns zu beleidigen.«
»Es scheint aber kein anderes Haus zu geben, wohin sie gehen könnte«, bemerkte Dr. Macphail.
»Sie kann bei einem von den Eingeborenen wohnen.«
»Bei solchem Wetter müssen diese Hütten nicht sehr angenehm sein, um darin zu leben.«
»Ich habe jahrelang in einer gelebt«, sagte der Missionar.
Als das kleine Eingeborenenmädchen die gebackenen Bananen hereinbrachte, die ihr tägliches Dessert waren, wandte Davidson sich an sie.
»Frage Miss Thompson, wann es ihr passen würde, mich zu empfangen«, sagte er.
Das Mädchen nickte scheu und verschwand.
»Warum willst du sie besuchen, Alfred?« fragte Mrs. Davidson.
»Ich tue meine Pflicht. Ich will nicht gegen sie vorgehen, ehe ich ihr nicht jede Möglichkeit geboten habe.«
»Du weißt nicht, wie sie ist. Sie wird dich beleidigen.«
{38}»Sie soll mich ruhig beleidigen, sie soll mich anspeien. Aber sie hat eine unsterbliche Seele, und ich muß alles tun, was in meiner Macht steht, um sie zu retten.«
In Mrs. Davidsons Ohren hallte noch das höhnische Dirnengelächter.
»Sie ist zu weit gegangen.«
»Zu weit für die Gnade Gottes?« Seine Augen blitzten plötzlich, und seine Stimme wurde weich und sanft. »Niemals! Der Sünder mag im tiefsten Höllenschlund der Sünde stecken, die Liebe unseres Herrn Jesu kann ihn immer noch erreichen.«
Das Mädchen kam mit der Antwort zurück.
»Viele Grüße von Miss Thompson, und wenn Reverend Davidson nicht gerade in den Geschäftsstunden kommt, freut sie sich jederzeit, ihn zu empfangen.«
Die vier Leute nahmen diese Botschaft schweigend entgegen, und Dr. Macphail ließ schnell das Lächeln von seinen Lippen verschwinden, das dort entstanden war. Er wußte, seine Frau würde es übelnehmen, wenn er Miss Thompsons Unverschämtheit komisch fände.
Sie beendeten das Mahl wortlos. Dann erhoben sich die beiden Frauen und griffen zu ihren Handarbeiten; Mrs. Macphail strickte an einem der unzähligen Schals, die sie seit Ausbruch des Krieges angefertigt hatte, und der Arzt zündete sich eine Pfeife an. Aber Davidson blieb sitzen und starrte mit abwesendem Blick auf die Tischplatte. Schließlich erhob er sich und ging schweigend aus dem Zimmer. Sie hörten ihn hinuntergehen, und sie hörten Miss Thompsons herausforderndes »Herein!«, nachdem er an ihre Tür geklopft hatte. Eine geschlagene Stunde blieb er bei ihr. {39}Dr. Macphail schaute hinaus in den Regen, der anfing, ihm auf die Nerven zu gehen. Dieser Regen war nicht wie der englische, der sanft zur Erde fällt, sondern gnadenlos und irgendwie furchtbar; man spürte in ihm die Bosheit der primitiven Naturkräfte. Er rieselte nicht, er stürzte hernieder. Er kam wie die Sintflut und prasselte auf das Wellblechdach mit einer stetigen Hartnäckigkeit, die einen verrückt machen konnte. Voller Wut schien er dahinzurauschen. Und manchmal hatte man das Gefühl, schreien zu müssen, wenn das so weitergehen sollte, und gleich darauf fühlte man sich so kraftlos, als wären einem sämtliche Knochen weich geworden. Jämmerlich war einem zumute, und alle Hoffnung schwand.
Macphail drehte sich um, als der Missionar zurückkam. Die beiden Frauen blickten auf.
»Ich habe alles versucht. Ich habe sie ermahnt, zu bereuen. Sie ist eine böse Frau.«
Er hielt inne, und Dr. Macphail sah, wie seine Augen sich verdunkelten und sein Gesicht hart und finster wurde.
»Und jetzt werde ich die Peitsche nehmen, mit der unser Herr Jesus die Händler und Wechsler aus dem Tempel des Allerhöchsten verjagt hat.«
Er ging im Zimmer auf und ab. Seine Lippen preßten sich aufeinander, und seine schwarzen Brauen zogen sich dicht zusammen. »Und wenn sie in den fernsten Winkel der Erde flüchtete, ich würde sie auch dorthin verfolgen.«
Mit einer plötzlichen Bewegung wandte er sich um und ging aus dem Zimmer. Sie hörten ihn wieder hinuntergehen.
»Was wird er tun?« fragte Mrs. Macphail.
»Ich weiß es nicht.« Mrs. Davidson nahm ihren Kneifer {40}ab und reinigte ihn. »Wenn er im Namen des Herrn arbeitet, stelle ich ihm nie Fragen.«
Sie seufzte.
»Machen Sie sich Sorgen?«
»Er reibt sich auf. Er weiß nicht, was es heißt, seine Kräfte zu sparen.«
Dr. Macphail erfuhr die ersten Resultate der Missionarstätigkeit von dem Kaufmann, in dessen Haus sie wohnten. Mr. Horn winkte dem Arzt zu, als dieser am Laden vorüberging, kam heraus und sprach mit ihm auf der Schwelle. Sein dickes Gesicht zeigte einen besorgten Ausdruck.
»Reverend Davidson hat mir Vorhaltungen gemacht, weil ich Miss Thompson ein Zimmer vermietet habe«, sagte er, »aber ich wußte ja nicht, wer sie ist. Wenn jemand kommt und ein Zimmer mieten will, interessiert es mich nur, ob er auch Geld genug hat zum Bezahlen. Und sie hat mir für das ihre auf eine Woche im voraus bezahlt.«
Dr. Macphail wollte sich keine Blöße geben.
»Nun, wenn man es recht bedenkt, so ist das schließlich Ihr eigenes Haus, und wir können dankbar sein, daß Sie uns aufgenommen haben.«
Mr. Horn schaute ihn zweifelnd an. Er war nicht ganz sicher, wieweit Macphail auf der Seite des Missionars stand.
»Die Missionare halten alle zusammen«, sagte er zögernd. »Wenn sie einmal etwas gegen einen Kaufmann haben, dann kann er gleich einpacken.«
»Hat er verlangt, daß Sie ihr kündigen?«
»Nein, er sagte, solange sie sich anständig verhalte, könne er das nicht von mir fordern. Er sagte, er wolle auch gegen mich gerecht sein. Ich habe ihm versprochen, dafür zu {41}sorgen, daß sie keine Besucher mehr empfängt. Gerade habe ich es ihr gesagt.«
»Und wie hat sie es aufgenommen?«
»Sie hat mir die Hölle heiß gemacht.«
Der Kaufmann schrumpfte förmlich zusammen in seinem Leinenanzug. Miss Thompson war eine harte Nuß.
»Nun, ich glaube, sie wird von selbst ausziehen. Wahrscheinlich wird sie nicht in einem Haus bleiben wollen, wo sie keine Besuche empfangen darf«, sagte Dr. Macphail.
»Aber hier gibt es ja nichts, wohin sie gehen könnte, abgesehen von den Hütten der Eingeborenen. Doch jetzt, da sie sich die Missionare zu Feinden gemacht hat, wagt kein Eingeborener mehr, sie aufzunehmen.«
Dr. Macphail schaute in den fallenden Regen.
»Nun, ich glaube, es hat keinen Sinn, zu warten, bis es sich aufklärt. «
Als sie am Abend im Wohnzimmer saßen, erzählte Davidson ihnen von den vergangenen Tagen seiner Universitätszeit. Er war völlig mittellos gewesen und hatte sich durchkämpfen müssen, indem er merkwürdige Arbeiten während der Ferien übernahm. Unten war es mäuschenstill. Miss Thompson saß allein in ihrem kleinen Zimmer. Aber plötzlich begann das Grammophon zu spielen. Aus Trotz ließ sie es laufen, um sich über ihre Einsamkeit hinwegzutrösten, aber niemand war da, der hätte mitsingen können. Es klang recht traurig, ja es klang wie ein Hilfeschrei. Davidson nahm keine Notiz davon. Er war gerade mitten in einer langen Anekdote und fuhr fort, ohne den Ausdruck zu wechseln. Das Grammophon spielte weiter. Miss Thompson ließ eine Platte nach der anderen laufen, als ginge ihr die {42}Stille der Nacht auf die Nerven. Es war atemraubend und bedrückend. Als die Macphails zu Bett gegangen waren, konnten sie nicht schlafen. Sie lagen nebeneinander mit weitgeöffneten Augen und horchten auf das grausame Singen der Moskitos außerhalb des Netzes.
»Was ist das?« flüsterte Mrs. Macphail plötzlich.
Sie hörten eine Stimme durch die hölzerne Trennwand, Davidsons Stimme. Sie erklang mit monotoner, ernster Eindringlichkeit. Er betete laut. Er betete für Miss Thompsons Seele.
Zwei, drei Tage vergingen. Begegneten sie jetzt Miss Thompson auf der Straße, so grüßte sie nicht mehr mit ironischer Herzlichkeit und spöttischem Lächeln, sondern sie hob die Nase in die Luft, einen schmollenden Ausdruck im geschminkten Gesicht, und tat mit gerunzelter Stirn, als sähe sie sie nicht. Der Kaufmann erzählte Macphail, sie habe versucht, anderswo Unterkunft zu finden, was ihr aber mißlungen sei. Am Abend ließ sie wieder sämtliche Platten spielen, die sie besaß, doch jetzt war die geheuchelte Lustigkeit deutlich zu spüren. Der Ragtime hatte einen knarrenden, schwermütigen Rhythmus, als wäre er ein Verzweiflungstanz. Als sie auch am Sonntag zu spielen begann, schickte Davidson den Kaufmann zu ihr und ließ sie bitten, augenblicklich damit aufzuhören, denn es sei der Tag des Herrn. Die Platte wurde abgenommen, und kein Laut war im Haus zu vernehmen, abgesehen von dem ständigen Geprassel des Regens auf dem Wellblechdach.
»Ich glaube, sie wird langsam mürbe«, sagte der Kaufmann am nächsten Tag zu Macphail. »Sie weiß nicht, was Mr. Davidson vorhat, und das macht ihr angst.«
{43}Macphail konnte an diesem Morgen einen raschen Blick auf sie werfen, und es entging ihm nicht, daß der arrogante Ausdruck auf ihrem Gesicht verschwunden war. Sie hatte nun ein gehetztes Aussehen. Der Mischling schaute ihn von der Seite an.
»Ich glaube, Sie wissen auch nicht, was Mr. Davidson mit ihr macht«, wagte er zu fragen.
»Keine Ahnung.«
Sonderbar, daß Horn ihm diese Frage stellte, denn auch er hatte das Gefühl, der Missionar gehe auf geheimnisvolle Art zu Werke. Es war, als webe er sorgfältig und systematisch ein Netz um diese Frau und werde es, wenn es soweit sei, plötzlich zuziehen.
»Er hat mich gebeten, ihr zu sagen«, fuhr der Kaufmann fort, »sie brauche, wann immer sie ihn sehen wolle, nur nach ihm zu senden, er werde jederzeit kommen.«
»Was hat sie gesagt, als Sie ihr das ausgerichtet haben?«
»Gar nichts. Ich habe mich nicht lange aufgehalten, habe nur wiederholt, was er mir aufgetragen hat, und mich dann schnell verdrückt. Ich glaube, sie hat angefangen zu weinen.«
»Sicher geht ihr die Einsamkeit auf die Nerven«, sagte der Arzt, »und der Regen. Das genügt, um einen verrückt zu machen. Hört denn das nie mehr auf an diesem vermaledeiten Ort?« fügte er gereizt hinzu.
»In der Regenzeit dauert es eine ganze Weile, bis sich das Wetter ändert. Wir haben sieben, acht Meter Niederschlag im Jahr. Wissen Sie, das kommt von der Form unserer Bucht. Sie scheint den Regen vom ganzen Pazifik her anzuziehen.«
{44}»Der Teufel soll diese Bucht holen!« sagte der Arzt.
Er kratzte seine Moskitostiche und war schlechter Laune. Hörte der Regen auf und brach die Sonne hervor, so war es wie in einem Treibhaus, heiß, feucht, drückend, stickig, und man hatte das Gefühl, alles wachse mit wilder Heftigkeit. Die sonst so heiteren und unbekümmerten Eingeborenen schienen dann mit ihren Tätowierungen und dem gefärbten Haar etwas Finsteres an sich zu haben; und wenn sie dicht hinter einem hergingen mit ihren nackten Füßen, schaute man sich instinktiv um. Es war einem, als könnten sie sich jeden Augenblick heranschleichen und einem ein langes Messer zwischen die Rippen jagen. Man konnte nie wissen, was für schwarze Gedanken hinter ihrer Stirn lauerten. Sie sahen ein wenig so aus wie die alten, auf Tempelmauern abgebildeten Ägypter, und der Schauer des unermeßlich Alten umgab sie.
Der Missionar kam und ging. Er war äußerst beschäftigt, doch die Macphails wußten nicht, was er tat. Horn erzählte dem Arzt, Davidson besuche täglich den Gouverneur, und einmal sprach auch der Missionar selbst davon.
»Er sieht aus, als sei er voller Energie«, sagte er, »aber wenn es ernst wird, zeigt es sich, daß er kein Rückgrat hat.«
»Ich nehme an, das heißt, er will nicht so, wie Sie gern wollen«, warf der Arzt scherzhaft ein.
Der Missionar lächelte nicht.
»Ich verlange von ihm nur, daß er das Rechte tut. Es sollte nicht nötig sein, ihn davon überzeugen zu müssen.«
»Aber es kann ja auch Meinungsverschiedenheiten geben über das, was das Rechte ist.«
»Wenn ein Mann einen brandigen Fuß hat, wären Sie dann geduldig mit dem Arzt, der zögerte, ihn zu amputieren?«
{45}»Brand ist eine Tatsache.«
»Und das Laster?«
Bald stellte sich heraus, was Davidson getan hatte. Die vier hatten gerade ihr Mittagsmahl beendet und sich noch nicht getrennt für die Siesta, die die Hitze den beiden Damen und dem Arzt aufzwang. Davidson hatte wenig Sinn für solche Trägheit. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen, und Miss Thompson stürzte herein. Sie schaute sich im Zimmer um und trat dann vor Davidson.
»Sie hundsgemeiner Kerl, was haben Sie dem Gouverneur von mir erzählt?«
Sie sprühte vor Wut. Ein Augenblick der Stille trat ein. Dann zog der Missionar einen Stuhl heran.
»Wollen Sie sich nicht setzen, Miss Thompson? Ich habe längst auf eine weitere Unterhaltung mit Ihnen gehofft.«
»Sie niederträchtiger Schweinehund!«
Sie brach in eine Flut von wüsten und gemeinen Beschimpfungen aus. Davidson heftete seinen tiefernsten Blick auf sie.
»Mich berühren die Kränkungen nicht, die Sie meinen, auf mich ausschütten zu müssen, Miss Thompson«, sagte er, »aber ich muß Sie bitten, daran zu denken, daß zwei Damen zugegen sind.«
Jetzt kämpfte sie in ihrer Wut gegen Tränen an. Ihr Gesicht war rot und verschwollen, als sei sie am Ersticken.
»Was ist denn geschehen?« fragte Dr. Macphail.
»Ein Mann ist gerade gekommen und hat gesagt, ich soll mit dem nächsten Schiff von hier verschwinden.«
Flackerte es auf in den Augen des Missionars? Sein Gesicht blieb unbewegt.
{46}»Sie konnten doch kaum erwarten, daß der Gouverneur Sie unter diesen Umständen hierließe.«
»Das haben Sie mir eingebrockt!« schrie sie. »Mir können Sie nichts vormachen. Sie haben es getan.«
»Ich will Ihnen gar nichts vormachen. Gewiß, ich habe den Gouverneur gedrängt, den einzig möglichen Schritt zu tun, der mit seinen Pflichten im Einklang steht.«
»Warum können Sie mich denn nicht in Frieden lassen? Ich habe Ihnen nichts getan.«
»Und wenn Sie mir etwas getan hätten, so können Sie sicher sein, ich wäre der letzte, der es Ihnen übelnähme.«
»Glauben Sie denn, ich will ewig hierbleiben in diesem jämmerlichen Nest? Sehe ich aus wie ein Buschweib?«
»In diesem Fall begreife ich nicht, wieso Sie Ursache haben, sich zu beklagen«, antwortete er.
Da stieß sie einen unartikulierten Wutschrei aus und stürzte aus dem Zimmer. Eine kurze Stille folgte.
»Wie gut, zu wissen, daß der Gouverneur endlich gehandelt hat!« sagte Davidson schließlich. »Er ist ein schwacher Mensch und konnte sich nicht entschließen, er sagte, sie sei ohnehin nur auf zwei Wochen hier, und wenn sie nach Apia wolle, so habe das nichts mit ihm zu tun, da dies unter britischem Rechtsschutz stehe!«
Der Missionar sprang auf und durchschritt den Raum. »Es ist schrecklich, wie die Männer an der Spitze sich der Verantwortung zu entziehen versuchen. Sie reden, als höre das Übel, das außer Sehweite geschieht, auf, Übel zu sein. Die pure Existenz dieser Frau ist eine Schande, und nichts ist damit getan, wenn man sie auf eine andere Insel abschiebt. Schließlich mußte ich mit ihm frei von der Leber weg sprechen.«
{47}Davidsons Brauen senkten sich, und er schob sein festes Kinn vor.
Er sah grimmig und entschlossen drein.
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Unsere Mission ist nicht ganz ohne Einfluß in Washington. Ich deutete dem Gouverneur an, daß es ihm bestimmt nicht bekäme, wenn dort eine Beschwerde über die Art einliefe, mit der er die Dinge hier leitet.«
»Und wann soll sie nun von hier fort?« fragte der Arzt nach einer Pause.
»Das Schiff nach San Francisco kommt am nächsten Dienstag von Sydney hier an. Damit muß sie fahren.«
Fünf Tage lagen noch dazwischen. Am nächsten Mittag war es, als Macphail aus dem Krankenhaus kam, wo er aus Mangel an anderer Betätigung beinahe jeden Morgen verbrachte, daß Mr. Horn ihn anhielt, als er eben die Treppe hinaufgehen wollte.
»Entschuldigen Sie, Dr. Macphail, Miss Thompson ist krank. Wollen Sie auf einen Augenblick zu ihr hineinschauen?«
»Gewiß.«
Horn führte ihn zu ihrem Zimmer. Sie saß untätig auf einem Stuhl, las nicht, nähte nicht, sondern starrte nur vor sich hin. Sie trug ihr weißes Kleid und den großen Hut mit den Blumen. Macphail bemerkte, wie gelb und fleckig ihre Haut unter dem Puder war und wie schwermütig sie dreinschaute.
»Tut mir sehr leid zu hören, daß Sie sich nicht wohl fühlen«, sagte er.
»Ach, ich bin doch nicht wirklich krank. Ich habe nur so {48}getan, weil ich Sie sehen wollte. Ich muß mit dem Schiff reisen, das nach Frisco fährt.«
Sie schaute ihn an, und er sah, daß Entsetzen in ihrem Blick lag. Krampfhaft öffnete und ballte sie die Hände. Der Kaufmann stand an der Tür und hörte zu.
»Das hat man mir gesagt«, erwiderte der Arzt.
Sie schluckte.
»Es paßt mir aber nicht, jetzt nach Frisco zu gehen. Gestern nachmittag bin ich zum Gouverneur gegangen, wurde aber nicht vorgelassen. Ich hab nur mit dem Sekretär gesprochen, und der hat mir gesagt, ich müßte das Schiff nehmen, da sei nichts zu machen. Ich müßte mit dem Gouverneur selbst sprechen, und so habe ich heute morgen vor seinem Haus gewartet, und als er herauskam, habe ich mit ihm gesprochen. Er wollte nicht mit mir reden, aber ich habe mich nicht abschütteln lassen. Und schließlich hat er gesagt, er hätte nichts dagegen, wenn ich bis zum nächsten Schiff nach Sydney hierbliebe, vorausgesetzt daß Reverend Davidson damit einverstanden wäre.«
Sie hielt inne und schaute Dr. Macphail ängstlich an.
»Ich weiß nicht recht, was ich für Sie tun kann«, sagte er.
»Nun, ich dachte, Sie würden vielleicht so freundlich sein und ihn fragen. Ich schwöre zu Gott, ich werde hier nichts anfangen, wenn er mich nur bleiben läßt. Ich werde keinen Schritt vor die Tür tun, wenn ihm damit gedient ist. Es handelt sich ja nur um vierzehn Tage.«
»Ich werde ihn fragen.«
»Er wird nicht einverstanden sein«, sagte Horn. »Er will Sie am Dienstag los sein, Sie werden sich schon damit abfinden müssen. «
{49}»Sagen Sie ihm, daß ich in Sydney Arbeit bekommen kann, anständige Arbeit, meine ich. Ich verlange ja nicht viel.«
»Ich werde tun, was ich kann.«
»Und kommen Sie gleich danach zu mir, und sagen Sie mir, was Sie erreichen konnten, ja? Ich kann überhaupt nichts tun, ehe ich nicht weiß, was los ist.«