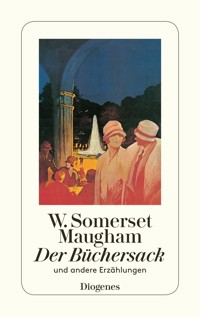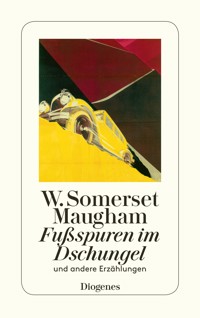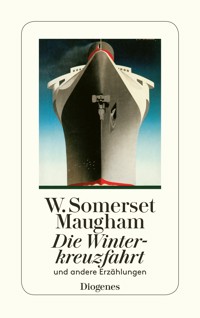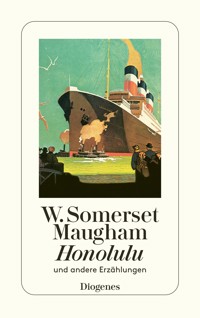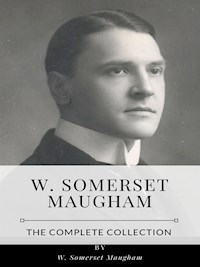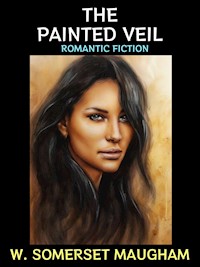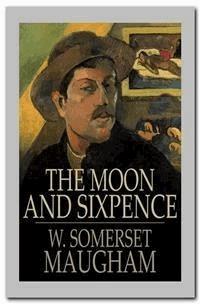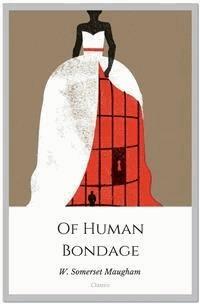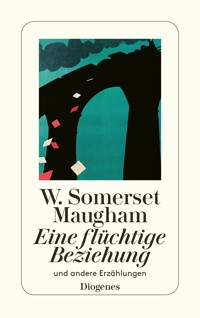
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein toter Engländer in einer Kleinstadt in Borneo, hingerafft von Tuberkulose und Opium. Ein goldenes Zigarettenetui. Und ein Packen Briefe, adressiert an eine schöne Frau: die ehrgeizige Lady Kastellan, ein Mittelpunkt der guten Londoner Gesellschaft. Was für Lady Kastellan vielleicht nur ›Eine flüchtige Beziehung‹ war, veränderte das Leben eines Mannes für immer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
W. Somerset Maugham
Eine flüchtige Beziehung
und andere Erzählungen
Diogenes
{7}Eine Frau von fünfzig Jahren
Mein Freund Wyman Holt ist Professor für englische Literatur an einer der kleineren Universitäten im Mittleren Westen, und als er hörte, daß ich in einer nahe gelegenen Stadt – nahe gelegen nach amerikanischen, weiträumigen Begriffen – reden würde, fragte er bei mir an, ob ich nicht seinen Schülern einen Vortrag halten wolle. Er schlug mir vor, einige Tage bei ihm zu wohnen, damit er mir etwas von der Umgebung zeigen könne. Ich nahm die Einladung an, teilte ihm aber mit, daß meine Verpflichtungen mir nicht gestatteten, mehr als zwei Nächte bei ihm zu verbringen. Er holte mich am Bahnhof ab, fuhr mit mir zu seinem Haus, und nachdem wir etwas getrunken hatten, gingen wir zum Campus hinüber. Ich war ein wenig bestürzt, so viele Menschen in der Aula vorzufinden, denn ich hatte höchstens zwanzig erwartet und war nicht darauf vorbereitet, eine feierliche Vorlesung zu halten, sondern nur eine zwanglose kleine Plauderei. Ich fühlte mich beträchtlich eingeschüchtert beim Anblick einer Reihe von Leuten in mittlerem und höherem Alter. Ich vermutete, daß einige von ihnen der Fakultät angehörten, und befürchtete, daß sie das, was ich vorzubringen hatte, sehr oberflächlich finden würden. Es blieb jedoch nichts anderes übrig als anzufangen, und das tat ich, nachdem Wyman mich dem Publikum auf eine Weise vorgestellt hatte, die mich vollends überzeugte, daß ich den {8}dadurch erweckten Erwartungen nicht entsprechen könnte. Ich sagte mein Sprüchlein her, beantwortete, so gut ich konnte, einige Fragen und zog mich dann mit Wyman in ein kleines Zimmer hinter dem Podium zurück.
Mehrere Leute kamen herein. Sie sagten die bei solchen Gelegenheiten üblichen freundlichen Worte zu mir, und ich gab die üblichen höflichen Antworten darauf. Ich hatte großes Verlangen nach etwas zu trinken. Dann kam eine Frau herein und streckte mir die Hand hin.
»Wie nett, Sie wiederzusehen«, sagte sie. »Es sind Jahre vergangen, seit wir uns zuletzt getroffen haben.«
Ich war ehrlich davon überzeugt, sie noch nie gesehen zu haben. Ich zwang mir ein verbindliches Lächeln auf die müden, trockenen Lippen, schüttelte ihr eifrig die dargebotene Hand und fragte mich, wer zum Teufel sie sein mochte. Der Professor mußte mir am Gesicht abgelesen haben, daß ich mich bemühte, sie unterzubringen, denn er sagte:
»Mrs. Greene ist mit einem Mitglied unserer Fakultät verheiratet, und sie gibt einen Kurs über die Renaissance und die italienische Literatur.«
»Ach«, sagte ich. »Das ist interessant.«
Ich war nicht klüger als zuvor.
»Hat Wyman Ihnen gesagt, daß Sie morgen abend zu uns zum Essen kommen?«
»Das freut mich sehr«, sagte ich.
»Es ist keine Gesellschaft. Nur mein Mann, sein Bruder und die Schwägerin. Florenz hat sich seit damals wohl sehr verändert, nicht wahr?«
›Florenz?‹ fragte ich mich. ›Florenz?‹
Offenbar hatte ich sie dort kennengelernt. Sie war eine {9}Frau von etwa fünfzig Jahren, mit grauen Haaren, schlicht frisiert und nicht zu auffallend onduliert. Sie war ein wenig zu dick, aber recht gut angezogen, wenn auch nicht distinguiert; ihr Kleid stammte vermutlich aus der Konfektionsabteilung eines Warenhauses. Ihre ziemlich großen Augen waren blaßblau, ihre Haut eher bleich; sie hatte kein Rouge und nur sparsam Lippenstift aufgelegt. Sie schien eine nette Person zu sein. Es lag etwas Mütterliches in ihrem Wesen, etwas Gelassenes und Erfülltes, das mich ansprach. Ich nahm an, daß ich sie bei einer meiner zahlreichen Reisen nach Florenz kennengelernt hatte, und da es vielleicht ihr einziger Aufenthalt dort gewesen war, hatte unsere Begegnung wohl auf sie mehr Eindruck gemacht als auf mich. Ich muß gestehen, daß ich nicht viele Frauen von Fakultätsmitgliedern kenne, aber sie entsprach genau der Vorstellung, die ich mir von der Gattin eines Professors machte. Und als ich mir ihr Dasein vorstellte, nützlich, aber ereignislos, mit bescheidenen Mitteln, kleinen geselligen Zusammenkünften, Zank und Klatsch und geschäftiger Langeweile, konnte ich mir schon denken, daß ihre Reise nach Florenz ihr als erregende und unvergeßliche Erfahrung im Gedächtnis haften mußte.
Auf dem Heimweg zu seinem Haus sagte Wyman:
»Jasper Greene wird dir gefallen. Er ist gescheit.«
»Was für eine Professur hat er?«
»Er ist kein Professor, er ist Dozent. Ein echter Gelehrter. Er ist ihr zweiter Mann. Sie war vorher mit einem Italiener verheiratet.«
»Ach?« Das paßte durchaus nicht zu meinen Gedankengängen. »Wie hieß sie da?«
{10}»Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber, die Ehe ging nicht besonders gut aus.« Wyman lachte vor sich hin. »Das ist nur eine Vermutung, auf die ich deshalb komme, weil sie kein einziges Stück im Haus hat, das auf einen Aufenthalt in Italien hinweist. Ich hätte erwartet, daß sie wenigstens einen Refektoriumstisch, ein paar alte Truhen und ein gesticktes Meßgewand mitgebracht hätte.«
Ich mußte lachen. Ich kannte jene etwas trostlosen Gegenstände, die man in Italien kauft: die vergoldeten, geschnitzten Leuchter, die venezianischen Spiegel und die unbequemen Stühle mit den hohen Lehnen. Sie wirken recht gut, wenn man sie in den überfüllten Antiquitätenläden sieht, aber wenn man sie in ein anderes Land mitnimmt, sind sie oft eine schwere Enttäuschung. Selbst wenn sie echt sind, was selten der Fall ist, sehen sie fehl am Platz und unbehaglich aus.
»Laura hat Geld«, fuhr Wyman fort. »Als sie heirateten, richtete sie das Haus vom Keller bis zum Speicher ein, alles aus Chicago. Es ist eine Sehenswürdigkeit: das reine Meisterstück an Scheußlichkeit und schlechtem Geschmack. Ich komme nie in das Wohnzimmer, ohne über die unbeirrbare Sicherheit zu staunen, mit der sie genau das ausgewählt hat, was man in Zimmern für Hochzeitsreisende in einem zweitrangigen Hotel in Atlantic City finden würde.«
Um diese Ironie zu erklären, muß ich erwähnen, daß Wymans Wohnzimmer ganz aus Chrom und Glas war, mit rauhen, modernen Stoffen, einem kühnen, kubistischen Teppich, und an den Wänden Drucke von Picasso und Zeichnungen von Tschelitschew. Immerhin aß ich bei ihm vorzüglich. Wir verbrachten den Abend in angenehmem Geplauder {11}über Dinge, die uns beide interessierten, und beendeten ihn mit ein paar Flaschen Bier. Dann begab ich mich in mein Zimmer, das von etwas aggressiver Modernität war. Ich las noch eine Weile im Bett, löschte dann das Licht und wartete darauf, daß ich einschlief.
›Laura?‹ fragte ich mich. ›Was ist das für eine Laura?‹
Ich bemühte mich zurückzudenken. Ich dachte an alle die Leute, die ich in Florenz gekannt hatte, und hoffte, daß mir durch irgendeine Assoziation einfiele, wann und wo ich Mrs. Greene begegnet war. Da ich zum Essen bei ihr eingeladen war, wollte ich gerne mit irgendeiner Erinnerung beweisen, daß ich sie nicht vergessen hatte. Die meisten Menschen empfinden es als Kränkung, wenn man sich nicht an sie erinnert. Vermutlich legen wir alle unserer eigenen Person eine gewisse Wichtigkeit bei, und es ist etwas demütigend zu erkennen, daß wir auf Leute, mit denen wir verkehrten, keinen Eindruck gemacht haben. Ich döste langsam ein, aber ehe ich in einen wohltuenden Tiefschlaf sank, belebte sich mein Unbewußtes, vermutlich von dem Zwang des Erinnerns befreit, und ich war plötzlich wieder hellwach, denn ich wußte nun, wer Laura Greene war. Kein Wunder, daß ich sie vergessen hatte; es waren fünfundzwanzig Jahre vergangen, seit ich sie hin und wieder gesehen hatte, als ich einen Monat in Florenz zubrachte.
Es war unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Sie war mit einem Mann verlobt gewesen, der gefallen war, und sie und ihre Mutter hatten es geschafft, nach Frankreich zu fahren und sein Grab aufzusuchen. Sie stammten aus San Francisco. Nachdem sie diese traurige Aufgabe erfüllt hatten, waren sie nach Italien gekommen, um den Winter in Florenz {12}zu verbringen. Zu jener Zeit gab es dort eine recht große Kolonie von Engländern und Amerikanern. Ich hatte amerikanische Freunde, einen Oberst Harding mit seiner Frau – Oberst, weil er beim Roten Kreuz einen wichtigen Posten bekleidet hatte –, die eine schöne Villa in der Via Bolognese besaßen, und sie luden mich ein, bei ihnen zu wohnen. Ich verbrachte die Vormittage meistens mit der Besichtigung von Sehenswürdigkeiten, und dann traf ich meine Freunde gegen zwölf Uhr zu einem Cocktail bei Doney in der Via Tornabuoni. Bei Doney trafen sich alle – Amerikaner, Engländer und die Italiener, die in ihrer Gesellschaft verkehrten. Dort hörte man den ganzen Stadtklatsch. Nachher versammelte man sich meistens irgendwo zum Lunch, entweder in einem Restaurant oder in einer der Villen mit ihren schönen, alten Gärten, zwei oder drei Kilometer vom Stadtinnern entfernt. Ich hatte eine Karte für den Florenz-Klub erhalten, und am Nachmittag pflegten Charley Harding und ich dorthin zu gehen, um Bridge zu spielen oder ein riskantes Poker mit zweiunddreißig Karten. Abends folgte dann wohl eine Einladung zum Dinner, mit weiterem Bridge und oft auch anschließendem Tanz. Man traf immer die gleichen Bekannten, aber der Kreis war groß genug und die Leute verschieden genug, daß keine Langeweile aufkam. Jedermann interessierte sich mehr oder weniger für Kunst, wie es sich in Florenz gehörte, so daß dieses augenscheinlich müßige Dasein doch nicht ganz frivol war.
Laura und ihre verwitwete Mutter, Mrs. Clayton, wohnten in einer der besseren Pensionen. Sie schienen in gesicherten Verhältnissen zu leben. Sie waren mit Empfehlungsschreiben nach Florenz gekommen und hatten bald viele {13}Freunde. Lauras Schicksal erweckte Teilnahme, und man bemühte sich deshalb, alles mögliche für die beiden Frauen zu tun, aber sie waren an sich sehr nett und um ihrer selbst willen beliebt. Häufig veranstalteten sie Einladungen zum Mittagessen in dem einen oder anderen Restaurant, wo man Pasta und die unvermeidlichen scaloppine aß und Chianti trank. Mrs. Clayton wirkte vielleicht ein wenig verloren in dieser kosmopolitischen Gesellschaft, in der man Dinge, die ihr fremd waren, ernsthaft oder heiter besprach, aber Laura fühlte sich bald ganz in ihrem Element. Sie engagierte eine Lehrerin, bei der sie Italienisch lernte, und las mit ihr schon bald das Inferno. Sie verschlang Bücher über die Kunst der Renaissance und über florentinische Geschichte, und zuweilen begegnete ich ihr, den Baedeker in der Hand, in den Uffizien oder in einer Kirche, lernbegierig in die Betrachtung der Kunstwerke vertieft.
Sie war damals vier- oder fünfundzwanzig, und ich war weit über vierzig, so daß wir, obwohl wir uns häufig trafen, nur eine herzliche Bekanntschaft, aber keine enge Freundschaft miteinander pflegten. Sie war keineswegs schön, aber auf eine ziemlich ungewöhnliche Art anziehend: Sie hatte ein ovales Gesicht, leuchtende blaue Augen und dunkles Haar, das sie sehr einfach frisiert trug, in der Mitte gescheitelt, über die Ohren gelegt und tief im Nacken zu einem Knoten zusammengefaßt. Sie hatte eine klare Haut und von Natur aus sehr frische Farben. Ihre Züge waren gut geschnitten, ohne bemerkenswert zu sein, und ihre Zähne gleichmäßig, klein und weiß. Aber ihr Hauptreiz lag in der gelösten Anmut ihrer Bewegungen, und ich war nicht überrascht, als man mir erzählte, daß sie ›himmlisch‹ tanze. Sie {14}hatte eine sehr gute Figur, etwas voller, als es zu der Zeit Mode war; und ich glaube, was ihre Erscheinung so anziehend machte, lag in der merkwürdigen Mischung von einer Madonna aus einem Altarbild der Spätrenaissance und einer Andeutung von Sinnlichkeit. Jedenfalls wirkte sie dadurch sehr verführerisch auf die Italiener, die sich am Vormittag bei Doney versammelten oder gelegentlich in die amerikanischen oder englischen Villen eingeladen wurden. Sie war augenscheinlich daran gewöhnt, mit verliebten jungen Männern umzugehen, denn trotz ihres charmanten, liebenswürdigen und freundschaftlichen Benehmens bewahrte sie ihnen gegenüber doch den Abstand. Sie entdeckte sehr bald, daß alle auf der Suche nach einer amerikanischen Erbin waren, die ihrem Familienvermögen aufhelfen würde, und sie gab ihnen mit versteckter Belustigung, die ich bewunderte, zu verstehen, daß sie keineswegs reich sei. Sie seufzten ein wenig und wandten dann ihre Aufmerksamkeiten bei Doney, ihrem glücklichen Jagdgefilde, anderen, vielversprechenderen Objekten zu. Sie tanzten und flirteten zwar sicherheitshalber weiter mit ihr, aber ihr Trachten richtete sich nicht mehr auf eine Heirat.
Nur ein junger Mann blieb beharrlich. Ich kannte ihn flüchtig, weil er einer der regelmäßigen Pokerspieler im Klub war, wo ich zuweilen spielte. Man konnte dort unmöglich gewinnen, und die verärgerten Ausländer pflegten zu sagen, daß die Italiener sich gegen uns zusammenrotteten, aber es mag auch sein, daß sie ihr besonderes Spiel besser kannten als wir. Lauras Verehrer, Tito di San Pietro, war ein kühner, sogar verwegener Spieler und verlor oft größere Summen, als er sich leisten konnte. (Das war nicht sein richtiger Name, {15}aber ich nenne ihn so, da sein eigener Name in der florentinischen Geschichte berühmt ist.) Er war ein hübscher junger Mann, weder groß noch klein, mit prachtvollen schwarzen Augen, dichtem schwarzem Haar, das von der Stirn zurückgebürstet war und von Öl glänzte, olivfarbener Haut und Zügen von klassischer Regelmäßigkeit. Er war mittellos und hatte irgendeine unklare Tätigkeit, die ihm aber anscheinend noch genug Zeit für seine Vergnügungen ließ, und er war immer sehr gut angezogen. Niemand wußte genau, wo er eigentlich wohnte, vielleicht in einem möblierten Zimmer oder in der Dachkammer eines Verwandten, und das einzige, was von den großen Besitzungen seiner Vorfahren übriggeblieben war, bestand in einer Villa aus dem sechzehnten Jahrhundert, etwa vierzig Kilometer außerhalb der Stadt. Ich habe sie nie gesehen, aber man erzählte mir, daß sie von erstaunlicher Schönheit sei, mit einem ausgedehnten, verwilderten Park voller Zypressen und Steineichen, wuchernden Buchseinfassungen, Terrassen, künstlichen Grotten und verfallenen Statuen. Sein verwitweter Vater, der Graf, wohnte dort allein und lebte von dem Ertrag seiner Weinreben und dem Öl von seinen Olivenbäumen. Er kam nur selten nach Florenz, darum habe ich ihn nie getroffen, aber Charley Harding kannte ihn recht gut.
»Er ist das vollendete Exemplar des toskanischen Edelmanns alter Schule«, sagte er. »Er war in seiner Jugend im diplomatischen Dienst, und er kennt die Welt. Er hat die besten Manieren und ein Auftreten, daß man es wie eine Gunst empfindet, wenn er einem guten Tag sagt. Er macht glänzende Konversation. Das Wenige, was er geerbt hat, hat er im Spiel und mit Frauen vergeudet, aber er trägt seine {16}Armut mit Würde. Er tut so, als ob das Geld seiner Beachtung nicht wert sei.«
»Wie alt ist er etwa?« fragte ich.
»Fünfzig, schätze ich, aber er ist noch immer der schönste Mann, den ich je gesehen habe.«
»Ach ja?«
»Beschreibe du ihn, Bessie. Als er zum erstenmal hierherkam, hat er Bessie Avancen gemacht. Ich habe nie herausbekommen können, wie weit es ging.«
»Sei nicht so töricht, Charley«, sagte Mrs. Harding lachend. Sie warf ihm einen Blick zu, wie eine Frau das tut, die mit ihrem Mann viele Jahre verheiratet und ganz zufrieden mit ihm ist.
»Er hat eine große Wirkung auf Frauen, und er weiß es«, sagte sie. »Wenn er mit einem spricht, hat man das Gefühl, als gäbe es für ihn keine andere Frau auf der Welt, und das ist natürlich schmeichelhaft. Aber es ist nur ein Spiel, und eine Frau müßte sehr dumm sein, wenn sie ihn ernst nähme. Er ist tatsächlich sehr schön. Groß und schlank, und er hält sich gut. Er hat große, dunkle, glänzende Augen, wie sein Sohn, sein Haar ist schneeweiß, aber noch sehr dicht, und der Gegensatz zu seinem gebräunten, jungen Gesicht ist wirklich atemberaubend. Er sieht mitgenommen, etwas verwüstet aus, zugleich aber so vornehm – es ist wirklich unglaublich romantisch.«
»Er hat seine großen, dunklen, glänzenden Augen aber auch auf seinen eigenen Vorteil gerichtet«, meinte Charley Harding trocken. »Und er wird Tito niemals ein Mädchen heiraten lassen, das nicht mehr Geld besitzt als Laura.«
»Sie hat etwa fünftausend Dollar eigenes Einkommen im {17}Jahr«, sagte Bessie. »Und wenn ihre Mutter stirbt, erhält sie noch einmal soviel.«
»Ihre Mutter kann noch dreißig Jahre leben, und fünftausend Dollar im Jahr würden nicht weit reichen, um einen Mann, einen Vater und zwei oder drei Kinder zu ernähren und eine heruntergekommene Villa, sozusagen ohne ein Möbelstück darin, instand zu setzen.«
»Ich glaube, der Junge ist rasend verliebt in sie.«
»Wie alt ist er?« fragte ich.
»Sechsundzwanzig.«
Einige Tage später, als Charley zum Essen nach Hause kam und wir ausnahmsweise einmal unter uns blieben, erzählte er mir, er sei Mrs. Clayton in der Via Tornabuoni begegnet und sie habe ihm gesagt, daß sie und Laura am Nachmittag mit Tito hinausfahren wollten, um seinen Vater zu besuchen und die Villa anzusehen.
»Was meinst du, was das bedeutet?« fragte Bessie.
»Ich glaube, Tito will Laura seinem Vater zur Begutachtung vorführen, und wenn diese günstig ausfällt, wird er ihr einen Heiratsantrag machen.«
»Und wird sie günstig ausfallen?« fragte Bessie.
»Ganz ausgeschlossen.«
Aber Charley irrte sich. Nachdem die beiden Damen das Haus besichtigt hatten, wurden sie durch den Park geführt. Ohne richtig zu wissen, wie es geschehen war, fand sich Mrs. Clayton in einer Allee allein mit dem alten Grafen. Sie konnte kein Italienisch, aber er war in London Attaché gewesen, und sein Englisch war nicht schlecht.
»Ihre Tochter ist reizend, Mrs. Clayton«, sagte er. »Ich wundere mich nicht, daß mein Tito sich in sie verliebt hat.«
{18}Mrs. Clayton war nicht dumm, und vielleicht hatte auch sie erraten, warum der junge Mann sie aufgefordert hatte, die Villa seiner Ahnen anzusehen.
»Junge Italiener sind sehr leicht entflammt. Laura ist vernünftig genug, ihre Aufmerksamkeiten nicht zu ernst zu nehmen.«
»Ich hatte gehofft, daß sie dem Jungen gegenüber nicht ganz gleichgültig wäre.«
»Ich habe keinen Grund anzunehmen, daß sie ihn lieber hat als irgendeinen der anderen Männer, die mit ihr tanzen«, erwiderte Mrs. Clayton ziemlich kühl. »Ich glaube, ich sollte Ihnen gleich sagen, daß meine Tochter nur ein sehr bescheidenes Einkommen hat, und vor meinem Tod wird sie auch nicht mehr haben.«
»Ich will Ihnen gegenüber ganz aufrichtig sein. Ich besitze nichts in der Welt als dieses Haus und etwas Land drum herum. Mein Sohn kann es sich eigentlich nicht leisten, ein mittelloses Mädchen zu heiraten, aber er ist kein Mitgiftjäger, und er liebt Ihre Tochter.«
Der Graf hatte nicht nur das große Auftreten, er besaß auch sehr viel Charme, und Mrs. Clayton war dafür nicht unempfänglich. Sie lenkte ein wenig ein.
»Das tut alles nichts zur Sache. In Amerika arrangieren wir die Ehen unserer Kinder nicht. Wenn Tito sie heiraten will, soll er sie fragen, und wenn sie dazu bereit ist, wird sie es vermutlich sagen.«
»Wenn ich mich nicht sehr täusche, ist er gerade dabei, sie zu fragen. Ich hoffe von ganzem Herzen, daß er Erfolg haben wird.«
Sie schlenderten weiter, und bald darauf sahen sie die {19}beiden jungen Leute ihnen Hand in Hand entgegenkommen. Es war nicht schwer zu erraten, was sich ereignet hatte. Tito küßte Mrs. Claytons Hand und seines Vaters Wangen.
»Mrs. Clayton, Papa, Laura hat eingewilligt, meine Frau zu werden.«
Die Verlobung erregte ein gewisses Aufsehen in der florentinischen Gesellschaft, und eine Reihe von Einladungen wurde für das junge Paar gegeben. Es war ganz klar, daß Tito sehr verliebt war; aus Lauras Verhalten ging das nicht so deutlich hervor. Er war hübsch, er betete sie an, er war temperamentvoll und heiter; es war anzunehmen, daß sie ihn liebte, aber sie war ein Mädchen, das seine Gefühle nicht zeigte, und sie verhielt sich genau wie bisher, ein wenig still, liebenswürdig, ernst, aber freundlich, und angenehm in der Unterhaltung. Ich fragte mich, bis zu welchem Grad sie bei der Annahme seines Antrages durch seinen großen Namen mit all den historischen Beziehungen beeinflußt worden war und durch den Anblick jenes schönen Hauses mit seiner wunderbaren Aussicht und dem romantischen Garten.
»Jedenfalls besteht kein Zweifel darüber, daß es von seiner Seite aus eine Liebesheirat ist«, sagte Bessie Harding, als wir darüber sprachen. »Mrs. Clayton hat mir erzählt, daß weder Tito noch sein Vater den geringsten Versuch gemacht haben, zu erfahren, wieviel Vermögen Laura besitzt.«
»Ich möchte eine Million Dollar wetten, daß sie auf den letzten Cent genau wissen, was sie hat, und daß sie sich ausgerechnet haben, wieviel das in Lire ist«, sagte Harding etwas bissig.
»Du bist ein garstiger alter Mann, Liebling«, antwortete sie.
{20}Bald darauf verließ ich Florenz. Die Hochzeit fand in Hardings Haus statt, und eine große Menge kam zum Essen und Champagnertrinken dorthin. Tito und seine Frau mieteten eine Wohnung am Lungarno, und der alte Graf kehrte in seine einsame Villa in den Hügeln zurück. Ich kam erst drei Jahre später wieder nach Florenz, und nur für eine Woche. Ich wohnte wieder bei den Hardings. Ich erkundigte mich nach meinen alten Freunden und erinnerte mich dann auch an Laura und ihre Mutter.
»Mrs. Clayton ist nach San Francisco zurückgekehrt«, sagte Bessie, »und Laura und Tito wohnen jetzt in der Villa mit dem Grafen. Sie sind sehr glücklich.«
»Haben sie Kinder?«
»Nein.«
»Erzähl weiter«, sagte Harding.
Bessie warf ihrem Mann einen Blick zu.
»Ich begreife gar nicht, warum ich seit dreißig Jahren mit einem Mann zusammenlebe, der mir so unsympathisch ist«, sagte sie. »Sie haben die Wohnung am Lungarno aufgegeben. Es hat Laura viel Geld gekostet, die Villa instand zu setzen, sie hat ein Badezimmer und Zentralheizung einrichten lassen, und sie mußte eine Menge Möbel kaufen, damit es wohnlich wurde, und dann verlor Tito ein kleines Vermögen beim Poker, und die arme Laura mußte es bezahlen.«
»Hatte er nicht irgendeine Tätigkeit?«
»Die brachte kaum etwas ein, und er verlor sie.«
»Bessie will damit sagen, daß man ihn davongejagt hat«, bemerkte Harding.
»Nun, um die Sache kurz zu machen, sie meinten, es {21}würde billiger sein, in der Villa zu wohnen, und Laura dachte, es würde Tito vor weiterem Unheil bewahren. Sie liebt den Garten und hat ihn wunderschön bepflanzt. Tito betet sie einfach an, und der alte Graf hat großen Gefallen an ihr gefunden. Also hat tatsächlich alles zu einem guten Ende gefunden.«
»Es wird dich interessieren zu hören, daß Tito am letzten Donnerstag in der Stadt war«, sagte Harding. »Er hat wie ein Wahnsinniger gespielt, und ich weiß nicht, wieviel er verloren hat.«
»Ach, Charley! Er hat Laura doch versprochen, daß er nie mehr spielen würde.«
»Als ob ein Spieler ein solches Versprechen jemals halten könnte! Es wird wieder so sein wie das letztemal. Er wird in Tränen ausbrechen und erklären, daß er sie liebe und daß es eine Ehrenschuld sei, und wenn er das Geld nicht auftreiben könne, werde er sich eine Kugel in den Kopf jagen. Und Laura wird bezahlen, wie sie es das letztemal getan hat.«
»Er ist schwach, der arme Kerl, aber das ist sein einziger Fehler. Im Gegensatz zu den meisten italienischen Männern ist er ihr absolut treu, und er ist die Güte in Person.« Sie schaute Harding mit einer Art von grimmigem Humor an. »Ich habe den vollkommenen Ehemann noch nicht entdecken können.«
»Dann mußt du aber bald auf die Suche danach gehen, meine Liebe, bevor es zu spät dafür ist«, erwiderte er lachend.
Ich verließ die Hardings und kehrte nach London zurück. Charley und ich korrespondierten ziemlich unregelmäßig miteinander, und nach etwa einem Jahr erhielt ich einen Brief von ihm. Er berichtete darin wie immer, was er in der {22}Zwischenzeit getan habe, und erwähnte, daß er zu einer Badekur in Montecatini und mit Bessie zu Besuch bei Freunden in Rom gewesen sei. Er schrieb von verschiedenen Leuten, die ich in Florenz kennengelernt hatte; der eine hatte gerade einen Bellini gekauft und Mrs. Soundso war nach Amerika gereist, um ihre Scheidung einzureichen. Dann fuhr er fort: »Ich nehme an, daß du über die San Pietros gehört hast. Es hat uns alle erschüttert, und wir können von nichts anderem reden. Laura ist ganz außer sich, das arme Ding, und sie erwartet ein Kind. Die Polizei verhört sie fortwährend, und das macht es nicht leichter für sie. Natürlich haben wir sie zu uns geholt. Tito wird nächsten Monat vor Gericht erscheinen.«
Ich hatte keine Ahnung, wovon die Rede war. Darum schrieb ich sofort an Harding und fragte, was das alles bedeute. Er antwortete mit einem langen Brief. Was er mir zu berichten hatte, war schrecklich. Ich will die nackten, brutalen Tatsachen so kurz wie möglich erzählen. Ich erfuhr sie zum Teil durch Hardings Schreiben, zum Teil durch das, was er und Bessie mir erzählten, als ich zwei Jahre später wieder bei ihnen war.
Der Graf und Laura waren sogleich voneinander eingenommen, und Tito freute sich, wie rasch sich zwischen ihnen eine warme Freundschaft entwickelte, denn er war seinem Vater ebenso zugetan, wie er in Laura verliebt war. Er war froh, daß sein Vater anfing, öfters nach Florenz hereinzukommen als früher. Sie hatten ein Gastzimmer in ihrer Wohnung, und gelegentlich verbrachte er zwei oder drei Nächte bei ihnen. Er und Laura pflegten dann die Antiquitätenläden zu durchstöbern und alte Stücke für die Villa zu {23}kaufen. Er besaß Geschmack und Kenntnisse, und allmählich verlor das Haus mit seinen großen Räumen und Marmorböden sein verlassenes Aussehen und wurde ein freundlicher Wohnsitz. Laura war eine leidenschaftliche Gärtnerin; sie und der Graf brachten viele Stunden damit zu, Pläne zu entwerfen und dann die Arbeiter zu beaufsichtigen, die den Gärten ihre alte, etwas pompöse Schönheit zurückgaben.
Laura nahm es leicht, als Titos finanzielle Schwierigkeiten sie zwangen, die Wohnung in Florenz aufzugeben. Sie hatte inzwischen genug von der florentinischen Gesellschaft und war nicht abgeneigt, künftig ganz in dem vornehmen Haus seiner Ahnen zu leben. Tito liebte die Stadt, und der Verlust bestürzte ihn, aber er durfte sich nicht darüber beklagen, da sein eigener Leichtsinn daran schuld war. Sie hatten noch ihr Auto, und er zerstreute sich damit, lange Fahrten zu machen, während Laura und sein Vater beschäftigt waren, und wenn sie mitbekamen, daß er hin und wieder nach Florenz fuhr und einen kleinen Abstecher in den Klub machte, so drückten sie ein Auge zu. Ein Jahr verging auf diese Weise. Dann, er wußte nicht recht, warum, wurde er von einem unbestimmten Zweifel erfüllt. Er konnte nichts nachweisen; er hatte das Gefühl, als ob Laura ihn nicht mehr so liebte wie am Anfang. Manchmal glaubte er, bei seinem Vater eine gewisse Ungeduld ihm gegenüber zu bemerken; die beiden schienen sich gegenseitig immer viel zu sagen zu haben, aber er gewann den Eindruck, daß sie ihn von ihrem Gespräch ausschließen wollten wie ein Kind, von dem man erwartet, daß es still dasitzt, während die Erwachsenen sich über seinen Kopf hinweg unterhalten. Es kam ihm so vor, als ob seine Gegenwart ihnen oft unwillkommen sei {24}und daß sie sich ohne ihn zwangloser fühlten. Er kannte seinen Vater und seinen Ruf, aber der Argwohn, der in ihm aufstieg, war so furchtbar, daß er ihn nicht in Erwägung ziehen wollte. Und doch fing er zuweilen einen Blick auf, den sie miteinander tauschten und der ihn beunruhigte: in den Augen seines Vaters lag dann eine besitzergreifende Zärtlichkeit, in denen Lauras ein sinnliches Behagen. Wenn er das bei anderen beobachtet hätte, so wäre er überzeugt gewesen, daß sie ein Liebesverhältnis miteinander hatten. Aber er konnte, er wollte es nicht glauben. Der Graf konnte es einfach nicht lassen, einer Frau den Hof zu machen, und es war durchaus begreiflich, daß Laura seine ungewöhnliche Anziehungskraft spürte, aber es war schamlos, auch nur einen Augenblick anzunehmen, daß sie, diese beiden Menschen, die er liebte, eine verbotene, eine beinahe blutschänderische Verbindung eingegangen seien. Tito war sicher, daß Laura niemals in ihren Gefühlen mehr empfinden könnte als die natürliche Zuneigung einer glücklich verheirateten jungen Frau für ihren Schwiegervater. Trotzdem hielt er es für besser, daß sie nicht diesem täglichen Verkehr mit seinem Vater ausgesetzt bliebe, und eines Tages schlug er vor, nach Florenz zurückzuziehen. Laura und der Graf waren erstaunt darüber und wollten nichts davon hören. Laura erklärte, nachdem sie so viel Geld für die Villa ausgegeben habe, könne sie es sich nicht leisten, eine weitere Wohnung einzurichten, und der Graf fand, es wäre töricht, die Villa zu verlassen, um in einer elenden Wohnung in der Stadt zu hausen. Es entspann sich ein Streit, und Tito wurde ziemlich erregt. Er legte eine Bemerkung Lauras dahin aus, daß sie in der Villa bleiben wolle, um ihn den Versuchungen {25}fernzuhalten. Diese Erwähnung seiner Verluste beim Pokerspiel brachte ihn auf.
»Du wirfst mir immer dein Geld ins Gesicht«, sagte er hitzig. »Wenn ich eine Geldheirat hätte eingehen wollen, so wäre ich vernünftig genug gewesen, eine Frau zu wählen, die viel mehr hätte als du.«
Laura wurde ganz blaß und warf dem Grafen einen Blick zu.
»Du hast kein Recht, so mit Laura zu sprechen«, sagte er. »Du bist ein ungehobelter Tölpel.«
»Ich spreche mit meiner Frau so, wie ich will.«
»Da irrst du dich. Solange du in meinem Hause bist, wirst du ihr mit der Achtung begegnen, die ihr zukommt und zu der du verpflichtet bist.«
»Wenn ich Anstandsunterricht von dir haben möchte, Vater, werde ich es dich wissen lassen.«
»Du bist sehr impertinent, Tito. Du wirst die Güte haben, das Zimmer zu verlassen.«
Er sah sehr streng und würdevoll aus. Tito war wütend, aber auch ein wenig eingeschüchtert. Er sprang auf die Füße, stapfte aus dem Zimmer und schlug die Türe hinter sich zu. Dann nahm er den Wagen und fuhr nach Florenz. An diesem Tag gewann er eine beträchtliche Summe (Glück im Spiel, Pech in der Liebe), und um diesen Gewinn zu feiern, betrank er sich gehörig. Er kehrte erst am nächsten Morgen in die Villa zurück. Laura war so freundlich und gelassen wie immer, aber sein Vater verhielt sich etwas kühl. Die vergangene Szene wurde nicht erwähnt. Doch von da an wurde es nur schlimmer. Tito war verstimmt und mürrisch, der Graf kritisch, und gelegentlich gab es einen scharfen {26}Wortwechsel zwischen ihnen. Laura mischte sich nicht ein, aber Tito gewann den Eindruck, daß sie nach einer besonders erbitterten Auseinandersetzung bei seinem Vater vermittelt habe, denn von da an gab es der Graf auf, sich zu ärgern, und begann Tito mit der nachsichtigen Geduld zu behandeln, mit der man einem widerspenstigen Kind begegnet. Er redete sich ein, daß sie sich abgesprochen hatten, und sein Mißtrauen wuchs. Es wurde noch stärker, als Laura in ihrer gutmütigen Art meinte, es müsse sehr langweilig für ihn sein, so viel auf dem Land zu leben, und ihn ermutigte, seine Freunde in Florenz häufiger zu besuchen. Er zog sofort den Schluß daraus, daß sie dies nur vorschlug, um ihn loszuwerden. Er fing an, beide zu beobachten. Er betrat oft unerwartet ein Zimmer, in dem sie sich befanden, in der Erwartung, sie in einer kompromittierenden Stellung zu erwischen, oder er folgte ihnen lautlos in einen abgelegenen Teil des Parkes. Sie plauderten arglos über gleichgültige Dinge. Laura begrüßte ihn mit einem freundlichen Lächeln. Er konnte keinen Anhaltspunkt für seine quälenden Zweifel entdecken. Er begann zu trinken. Er wurde nervös und reizbar. Er hatte keinen Beweis, nicht den geringsten Beweis dafür, und doch fühlte er bis in die Knochen, daß sie ihn gröblich und schamlos betrogen. Er brütete darüber nach, bis er den Verstand zu verlieren glaubte. Ein finsteres Feuer in seinem Innern verzehrte ihn. Bei einem seiner Besuche in Florenz kaufte er eine Pistole. Er beschloß, daß er sie beide töten würde, sobald er einen Beweis dafür hätte, was in seinem Herzen eine Gewißheit war.
Ich weiß nicht, was die Katastrophe letztlich auslöste. Bei der Gerichtsverhandlung kam lediglich heraus, daß Tito {27}eines Abends in das Zimmer seines Vaters ging, um die Sache mit ihm zu klären. Sein Vater spottete und lachte ihn aus. Sie hatten einen wütenden Streit, und Tito zog seine Pistole und erschoß den Grafen. Dann brach er zusammen und warf sich hysterisch weinend über die Leiche. Auf die wiederholten Schüsse stürzten Laura und die Dienstboten herein. Er sprang auf und ergriff die Pistole, um sich selber zu erschießen, wie er später sagte, aber er zögerte, oder sie waren zu rasch für ihn und rissen sie ihm aus der Hand. Man rief die Polizei. Im Gefängnis verbrachte er die meiste Zeit weinend; er wollte nichts essen und mußte dazu gezwungen werden. Dem Untersuchungsrichter erklärte er, daß er seinen Vater getötet habe, weil er der Liebhaber seiner Frau gewesen sei. Laura, die immer und immer wieder verhört wurde, schwor, daß zwischen ihr und dem Grafen weiter nichts als eine natürliche Zuneigung bestanden habe. Der Mord erfüllte die Öffentlichkeit in Florenz mit Entsetzen. Die Italiener waren von Lauras Schuld überzeugt, aber ihre englischen und amerikanischen Freunde hielten sie des Verbrechens, dessen man sie anklagte, nicht für fähig. Sie erklärten überall, daß Tito neurotisch und irrsinnig eifersüchtig gewesen sei und auf seine törichte Art ihr freies amerikanisches Benehmen mit einer verbrecherischen Leidenschaft verwechselt habe. Auf den ersten Blick wirkte Titos Anklage lächerlich. Carlo di San Pietro war fast dreißig Jahre älter als sie, ein alternder Mann mit weißem Haar; wie konnte man annehmen, daß eine ungehörige Beziehung zwischen ihr und ihrem Schwiegervater bestanden habe, zumal ihr Mann jung, hübsch und in sie verliebt war?
Harding war dabei, als Laura mit dem {28}Untersuchungsrichter sprach und mit den Anwälten, die Titos Verteidigung übernommen hatten. Sie waren übereingekommen, auf geistige Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Die Sachverständigen der Verteidigung untersuchten ihn und erklärten ihn für unzurechnungsfähig, die Sachverständigen der Anklage untersuchten ihn ebenfalls und erklärten ihn für normal. Die Tatsache, daß er drei Monate vor diesem schrecklichen Verbrechen eine Pistole gekauft hatte, galt als Beweis, daß er vorsätzlich gehandelt habe. Es stellte sich heraus, daß er schwer verschuldet war und daß seine Gläubiger ihn bedrängten; die einzige Möglichkeit, sie zu befriedigen, war für ihn der Verkauf der Villa, und durch den Tod seines Vaters gelangte sie in seinen Besitz. In Italien gibt es keine Todesstrafe, aber vorsätzlicher Mord wird mit lebenslänglicher Einzelhaft bestraft. Als der Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung näher rückte, kamen die Anwälte zu Laura und erklärten ihr die einzige Möglichkeit, Tito davor zu bewahren: Sie müsse vor Gericht zugeben, daß der Graf ihr Liebhaber gewesen sei. Laura wurde sehr blaß. Harding protestierte heftig. Er sagte, sie hätten kein Recht, einen Meineid von ihr zu verlangen und ihren guten Ruf zu ruinieren, um diesen haltlosen, trunksüchtigen Spieler, den sie unglücklicherweise geheiratet hatte, zu retten. Laura schwieg eine Weile.
»Gut«, sagte sie schließlich, »wenn das die einzige Möglichkeit ist, ihn zu retten, so werde ich es tun.«
Harding versuchte ihr davon abzuraten, aber sie war entschlossen.
»Ich hätte keine ruhige Stunde mehr, wenn ich wüßte, daß Tito den Rest seines Lebens allein in einer Gefängniszelle verbringen müßte.«
{29}Und so geschah es. Die Gerichtsverhandlung begann. Laura wurde aufgerufen und erklärte unter Eid, daß ihr Schwiegervater über ein Jahr lang ihr Liebhaber gewesen sei. Tito wurde als unzurechnungsfähig erklärt und in eine Nervenheilanstalt überwiesen. Laura wollte Florenz sofort verlassen, aber in Italien dauern die Vorverhandlungen für ein Gerichtsverfahren endlos, und dann rückte ihre Niederkunft näher. Die Hardings bestanden darauf, daß sie bis zur Geburt bei ihnen blieb. Das Kind wurde geboren, ein Knabe, aber er lebte nur vierundzwanzig Stunden. Ihr Plan war, nach San Francisco zurückzukehren und bei ihrer Mutter zu wohnen, bis sie eine Arbeit finden konnte, denn Titos Verschwendungssucht, die Ausgaben für die Villa und dann die Kosten des Gerichtsverfahrens hatten ihr Vermögen ernstlich verringert.
Harding hatte mir das meiste davon erzählt, aber eines Tages, als er im Klub war und ich mit Bessie Tee trank, sprachen wir wieder über diese tragischen Ereignisse, und sie sagte:
»Wissen Sie, Charley hat Ihnen nicht die ganze Geschichte erzählt, weil er nicht Bescheid weiß. Ich habe es ihm nie gesagt. Männer sind in mancher Hinsicht komisch; sie sind viel leichter schockiert als Frauen.«
Ich zog die Augenbrauen in die Höhe, sagte aber nichts.
»Kurz bevor Laura abreiste, hatten wir ein Gespräch. Sie war sehr niedergeschlagen, und ich dachte, sie trauere über den Verlust ihres Kindes. Ich wollte ihr etwas Tröstliches sagen. ›Du darfst den Tod deines Kindes nicht zu tragisch nehmen‹, sagte ich. ›So wie die Dinge liegen, ist es vielleicht besser, daß es gestorben ist.‹ ›Warum?‹ fragte sie. ›Denke nur an {30}die Zukunft des armen kleinen Geschöpfes, das einen Mörder zum Vater hatte.‹ Sie schaute mich einen Augenblick auf ihre eigentümliche, ruhige Art an. Und was meinen Sie, was sie dann sagte?«
»Ich habe keine Ahnung«, erwiderte ich.
»Sie sagte: ›Wie kommst du darauf, daß sein Vater ein Mörder war?‹ Ich fühlte, wie ich puterrot wurde. Ich konnte meinen Ohren kaum trauen. ›Laura, was meinst du nur?‹ sagte ich. ›Du warst doch im Gerichtssaal‹, sagte sie. ›Du hast mich sagen gehört, daß Carlo mein Liebhaber war.‹«
Bessie Harding starrte mich an, wie sie vermutlich Laura angestarrt hatte.
»Was haben Sie darauf geantwortet?« fragte ich.
»Was sollte ich dazu sagen? Ich sagte gar nichts. Ich war nicht so sehr entsetzt als vielmehr verwirrt. Laura sah mich an, und ob Sie es glauben oder nicht, ich bin überzeugt, daß ein Blinken in ihren Augen war. Ich kam mir vollkommen idiotisch vor.«
»Arme Bessie«, sagte ich lächelnd.
Arme Bessie, wiederholte ich mir jetzt selber, während ich über diese merkwürdige Geschichte nachdachte. Sie und Charley waren längst gestorben, und durch ihren Tod hatte ich gute Freunde verloren. Ich schlief dann ein, und am nächsten Tag machte Wyman Holt eine lange Ausfahrt mit mir.
Wir waren um sieben Uhr bei den Greenes eingeladen, und wir kamen auf die Minute vor ihrem Haus an. Jetzt, da ich mich an Laura erinnerte, war ich voller Neugierde, sie wiederzusehen. Wyman hatte in keiner Weise übertrieben. Das Wohnzimmer, in das wir kamen, war der Inbegriff von {31}Banalität. Es war recht behaglich, aber ohne jede persönliche Note. Es hätte gut auf Katalogbestellung durch ein Versandhaus geliefert worden sein können. Es wirkte so nüchtern wie ein Amtszimmer. Ich wurde zuerst meinem Gastgeber, Jasper Greene, vorgestellt und dann seinem Bruder Emery und dessen Frau Fanny. Jasper Greene war ein großer, schwerfälliger Mann mit einem Vollmondgesicht und einem schwarzen, groben, ungepflegten Haarschopf. Er trug große, in einem Zellulosegestell eingefaßte Gläser. Er konnte nicht weit über dreißig sein und war demnach fast zwanzig Jahre jünger als Laura. Sein Bruder Emery, Komponist und Lehrer an einer Musikschule in New York, mochte sieben- oder achtundzwanzig Jahre zählen. Seine Frau, ein hübsches kleines Ding, war Schauspielerin, zur Zeit ohne Engagement. Jasper Greene mischte uns einige recht gute Cocktails, abgesehen von einem zu reichlichen Schuß Wermut, und dann setzten wir uns zu Tisch. Die Unterhaltung war heiter, sogar ausgelassen. Jasper und sein Bruder hatten laute Stimmen, und alle drei, Jasper, Emery und Emerys Frau, redeten ausgiebig. Sie neckten sich gegenseitig, scherzten und lachten, sprachen über Kunst, Literatur, Musik und Theater. Wyman und ich beteiligten uns daran, wenn es uns gelang, was nicht sehr oft der Fall war; Laura versuchte es gar nicht. Sie saß oben am Tisch, ruhig, mit einem belustigten, nachsichtigen Lächeln auf den Lippen, während sie dem zusammenhanglosen Unsinn zuhörte. Es war kein törichter Unsinn, wohlverstanden. Er war gescheit und modern, aber trotz alledem eben doch Unsinn. Es lag etwas Mütterliches in ihrer Haltung, und sie erinnerte mich seltsam an eine glatte Dackelhündin, die ruhig in der Sonne liegt, während {32}sie träge und doch wachsam ihrem Wurf Welpen zuschaut, der um sie herumtollt. Ich fragte mich, ob ihr durch den Kopf ging, wie wenig all dieses Geplauder über Kunst bedeutete im Vergleich zu den Ereignissen von Blut und Leidenschaft in ihrer Vergangenheit. Aber erinnerte sie sich wirklich daran? Das war alles vor so langer Zeit geschehen, und vielleicht erschien es ihr nur noch wie ein böser Traum. Vielleicht gehörte diese alltägliche Umgebung zu ihrem Wunsch nach dem Vergessen, und die Gesellschaft dieser jungen Leute mochte eine geistige Entspannung für sie bedeuten. Vielleicht war ihr Jaspers gescheiter Unsinn ein Trost. Nach jener Tragödie war es wohl möglich, daß sie sich nach nichts anderem sehnte als nach der Sicherheit des alltäglichen Einerleis.
Da Wyman als Autorität auf dem Gebiet des Elisabethanischen Dramas galt, streifte das Gespräch diesen Stoff einen Augenblick. Ich hatte schon bemerkt, daß Jasper Greene geneigt war, über alles und jedes seine vorgefaßte Meinung zu äußern, und nun äußerte er sich folgendermaßen:
»Unser Theater ist auf dem absteigenden Ast, weil die Dramatiker unserer Tage davor zurückschrecken, die wilden Leidenschaften zu behandeln, die den wahren Gegenstand der Tragödie darstellen«, dozierte er. »Im sechzehnten Jahrhundert gab es eine Menge melodramatischer und blutiger Themen, die dafür geeignet waren, und darum brachten sie damals große Schauspiele zustande. Aber wo sollen unsere Bühnenschriftsteller nach solchen Themen suchen? Unser angelsächsisches Blut ist zu träge, zu untätig, um sie mit Material zu versorgen, aus dem sie etwas machen könnten, und darum sind sie dazu verurteilt, sich mit den Trivialitäten des gesellschaftlichen Verkehrs zu beschäftigen.«
{33}Ich fragte mich, was Laura hierüber denken mochte, aber ich vermied es, sie anzusehen. Sie hätte ihnen eine Geschichte erzählen können von verbotener Liebe, Eifersucht und Vatermord, die für einen Nachfolger Shakespeares eine Fundgrube gewesen wäre; aber hätte er den Stoff behandelt, so hätte er sich vermutlich verpflichtet gefühlt, das Drama mit wenigstens einer weiteren Leiche auf der Bühne zu beenden. Der Abschluß ihrer Geschichte, wie ich ihn jetzt kannte, war zwar überraschend, aber bedauerlich prosaisch und ein wenig grotesk. Das wirkliche Leben läßt die Dinge häufig sang- und klanglos enden. Ich fragte mich auch, warum sie sich bemüht hatte, unsere Bekanntschaft zu erneuern. Natürlich hatte sie keinen Grund anzunehmen, daß ich so viel wußte, wie es der Fall war. Vielleicht fühlte sie mit sicherem Instinkt, daß ich sie nicht verraten würde; vielleicht war es ihr auch gleichgültig. Ich warf ihr hin und wieder einen verstohlenen Blick zu, während sie ruhig dem angeregten Schwatzen der drei jungen Leute zuhörte, aber ihr freundliches, angenehmes Gesicht verriet nichts. Hätte ich es nicht anders gewußt, so hätte ich darauf geschworen, daß kein widriger Umstand jemals den Lauf ihres ereignislosen Daseins getrübt hatte.
Der Abend ging zu Ende, und dies ist auch das Ende meiner Geschichte, aber zum Spaß will ich noch ein kleines Erlebnis erzählen, das sich ereignete, nachdem Wyman und ich in sein Haus zurückgekommen waren. Wir beschlossen, vor dem Zubettgehen noch eine Flasche Bier zu trinken, und gingen in die Küche, um sie zu holen. Die Uhr in der Halle schlug elf, und in diesem Augenblick läutete das Telefon. Wyman ging hin und nahm den Hörer ab, und als er zurückkam, lachte er leise vor sich hin.
{34}»Was gibt es zu lachen?« fragte ich.
»Es war einer meiner Studenten. Sie sollen die Dozenten eigentlich nicht nach halb elf Uhr anrufen, aber er war ganz aufgelöst. Er fragte, wie das Böse in die Welt gekommen sei.«
»Und hast du es ihm gesagt?«
»Ich habe ihm gesagt, daß auch der heilige Thomas von Aquin schon ganz aufgelöst wegen dieser gleichen Frage gewesen sei, und er solle sich lieber selber um die Antwort bemühen. Ich sagte ihm, er solle mich anrufen, wenn er die Lösung gefunden habe, ganz gleich zu welcher Zeit. Um zwei Uhr morgens, wenn er wolle.«
»Ich glaube, du kannst ruhig damit rechnen, viele lange Nächte ungestört zu bleiben«, sagte ich.
»Ich will dir nicht verhehlen, daß ich zu einer ähnlichen Überzeugung gekommen bin«, sagte er grinsend.
{35}Der Mann mit der Narbe
Zuerst fiel er mir eigentlich nur durch seine Narbe auf, denn sie lief breit und rot in großem Bogen von seiner Schläfe bis zum Kinn. Sie mußte auf eine furchtbare Wunde zurückzuführen sein, und ich fragte mich, ob sie von einem Säbel oder einem Granatsplitter herrührte. Sie wirkte unerwartet auf diesem runden, fetten, gutmütigen Gesicht. Er hatte kleine und unbedeutende Züge und einen harmlosen Ausdruck. Sein Gesicht paßte nicht recht zu seinem korpulenten Körper. Er war ein mächtiger Mann von überdurchschnittlicher Größe. Ich sah ihn nie anders gekleidet als in einem sehr schäbigen grauen Anzug, einem Khakihemd und einem ramponierten alten Sombrero. Er sah eher schmuddelig aus. Er kam jeden Tag zur Cocktailstunde in das Palace-Hotel in Guatemala City und bot, lässig in der Bar umherschlendernd, Lotterielose feil. Wenn er auf diese Weise seinen Lebensunterhalt verdiente, dann mußte er ein kümmerliches Dasein führen, denn ich sah nie, daß ihm jemand etwas abkaufte; man bot ihm höchstens hin und wieder etwas zu trinken an. Er lehnte niemals ab. Er bahnte sich gemächlich seinen Weg durch das Lokal, als wäre er es gewohnt, weite Strecken zu Fuß zurückzulegen, blieb bei jedem Tisch stehen, sagte mit einem kleinen Lächeln die Nummern auf, die er zu verkaufen hatte, und ging weiter. Ich glaube, daß er meistens ein wenig angetrunken war.
{36}Eines Abends stand ich mit einem Bekannten an der Bar – es gab einen sehr guten trockenen Martini im Palace-Hotel –, als der Mann mit der Narbe herankam. Ich schüttelte den Kopf, als er mir zum zwanzigsten Mal seit meiner Ankunft seine Lotterielose zur Auswahl hinhielt. Aber mein Gefährte nickte liebenswürdig.
»Qué tal, general? Was macht das Leben?«
»Nicht schlecht. Das Geschäft blüht zwar nicht gerade, aber es könnte schlimmer sein.«
»Was nehmen Sie, General?«
»Einen Schnaps.«
Er trank ihn in einem Zug und stellte das Glas auf die Bar zurück. Er nickte meinem Bekannten zu.
»Gracias. Hasta luego.«
Dann wandte er sich ab und bot seine Lose den neben uns stehenden Leuten an.
»Wer ist das?« fragte ich. »Das ist ja eine furchtbare Narbe auf seinem Gesicht.«
»Sie trägt nicht gerade zu seiner Schönheit bei, wie? Er ist ein Verbannter aus Nicaragua. Ein Raufbold natürlich, und ein Bandit, aber kein schlechter Kerl. Ich gebe ihm hie und da ein paar Pesos. Er war ein revolutionärer General, und wenn ihm die Munition nicht ausgegangen wäre, würde er die Regierung gestürzt haben und heute Kriegsminister sein, anstatt in Guatemala Lotterielose zu verkaufen. Man hat ihn mit seinem ganzen Stab gefangengenommen und vor ein Kriegsgericht gestellt. Solche Dinge werden in diesen Ländern im Schnellverfahren erledigt, und er wurde dazu verurteilt, bei Morgengrauen erschossen zu werden. Wahrscheinlich wußte er schon, was ihm bevorstand, als er festgenommen wurde. {37}Er verbrachte die Nacht im Gefängnis, und er und die anderen – sie waren im ganzen fünf – spielten die ganze Nacht Poker. Sie benutzten Streichhölzer als Chips. Er erzählte mir, daß er nie im Leben solches Pech gehabt hatte. Als der Morgen anbrach und die Soldaten in die Zellen kamen, um die Verurteilten abzuholen, hatte er mehr Zündhölzer verloren, als ein vernünftiger Mensch zeit seines Lebens verbrauchen konnte.
Sie wurden in den Patio des Gefängnisses geführt und alle fünf an einer Mauer aufgestellt, der Vollstreckungskompanie gegenüber. Es trat eine Pause ein, und unser Freund fragte den diensthabenden Offizier, warum zum Teufel man sie warten lasse. Der Offizier antwortete, daß der kommandierende General der Regierungstruppen der Hinrichtung beizuwohnen wünsche und noch nicht eingetroffen sei.
›Dann habe ich ja Zeit, noch eine Zigarette zu rauchen‹, sagte unser Freund. ›Er war schon immer unpünktlich.‹
Aber er hatte sie kaum angezündet, als der General – es war übrigens San Ignacio, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennengelernt haben –, von seinem Adjutanten gefolgt, den Hof betrat. Nach den üblichen Formalitäten fragte San Ignacio die Verurteilten, ob sie vor ihrer Hinrichtung noch einen Wunsch hätten. Vier von den fünfen schüttelten den Kopf, aber unser Freund sagte:
›Ja, ich möchte von meiner Frau Abschied nehmen.‹
›Bueno‹, entgegnete der General. ›Ich habe nichts dagegen. Wo ist sie?‹
›Sie wartet vor dem Gefängnistor.‹
›Dann bedeutet es ja bloß eine kleine Verzögerung. Nicht mehr als fünf Minuten.‹
{38}›Allerhöchstens, Señor General‹, sagte unser Freund.
›Führt ihn weg!‹
Zwei Soldaten traten vor, nahmen den Verurteilten in die Mitte und führten ihn an den bezeichneten Platz. Der Offizier, der die Vollstreckungskompanie kommandierte, gab auf ein Zeichen des Generals einen Befehl: eine unregelmäßige Salve ertönte, und die vier Männer fielen. Sie fielen seltsam, nicht alle gleichzeitig, sondern einer nach dem andern, mit Bewegungen, die beinahe grotesk wirkten, wie Marionetten in einem Puppentheater. Der Offizier trat zu ihnen hin und schoß einem, der noch lebte, zwei Revolverladungen in den Leib.
Unser Freund rauchte seine Zigarette zu Ende und warf den Stummel fort.
Am Eingang entstand eine kleine Bewegung. Eine Frau kam in den Hof herein, mit raschen Schritten, und blieb, die Hand auf dem Herzen, plötzlich stehen. Sie stieß einen Schrei aus und stürzte dann mit offenen Armen vor.
›Caramba‹, sagte der General.
Sie war schwarz gekleidet, mit einem Schleier über dem Haar, und ihr Gesicht war totenbleich. Sie war fast noch ein Mädchen, ein schmales Geschöpf mit feinen, regelmäßigen Zügen und ungeheuren Augen. Doch in ihnen lag äußerste Verzweiflung. Der Anblick, den sie bot, während sie mit ihrem schönen, schmerzvollen Gesicht, den Mund leicht geöffnet, durch den Hof lief, war von solcher Lieblichkeit, daß den gleichgültigen Soldaten, die sie betrachteten, unwillkürlich ein Ruf des Erstaunens entfuhr.
Der Rebell kam ihr ein paar Schritte entgegen. Sie warf sich in seine Arme, und mit einem heiseren Aufschrei der {39}Leidenschaft, ›Alma de mi corazón‹, preßte er seine Lippen auf die ihren. Im gleichen Augenblick zog er ein Messer aus seinem zerrissenen Hemd – ich habe keine Ahnung, wie er es fertiggebracht hatte, es zu behalten – und stach es ihr in den Hals. Das Blut schoß aus der durchtrennten Ader hervor und färbte sein Hemd. Dann warf er seine Arme um sie und preßte noch einmal seine Lippen auf die ihren.