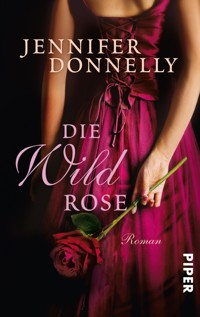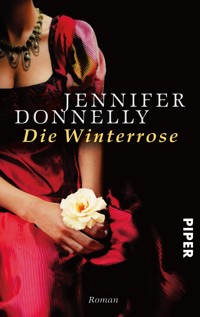
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
London, 1900: Die junge India Selwyn-Jones bewegt sich in den feinsten Kreisen. Bis sie als Ärztin im berüchtigten Viertel Whitechapel zu arbeiten beginnt – und dort in leidenschaftlicher Liebe zu dem gefürchteten Gangsterboss Sid Malone entbrennt … Voller Dramatik und Sinnlichkeit erzählt Jennifer Donnelly, die Autorin der international erfolgreichen »Teerose«, von ihrer unbeugsamen Heldin India.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1056
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
In Erinnerung an Fred Sage und das London, das er kannte
Übersetzung aus dem Englischen von Angelika Felenda
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
12. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95168-5
© 2006 Jennifer Donnelly Titel der amerikanischen Originalausgabe: »The Winter Rose«, HarperCollins, New York 2006 Published by Arrangement with Jennifer Donnelly Deutschsprachige Ausgabe: © 2007 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagfoto: HarperCollins Publishers / Jeff Cottenden Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhaltsverzeichnis
Cover & Impressum
Motto
Prolog: London, Mai 1900
Erster Teil: Mai 1900
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Zweiter Teil: London, September 1900
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Dritter Teil: London 1906
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Kapitel 109
Kapitel 110
Kapitel 111
Kapitel 112
Kapitel 113
Kapitel 114
Kapitel 115
Kapitel 116
Kapitel 117
Kapitel 118
Kapitel 119
Kapitel 120
Kapitel 121
Kapitel 122
Kapitel 123
Kapitel 124
Kapitel 125
Kapitel 126
Kapitel 127
Kapitel 128
Kapitel 129
Kapitel 130
Kapitel 131
Kapitel 132
Kapitel 133
Epilog: 1907, Kalifornien
Dank
Guide
Doctor, my eyes Cannot see the sky. Is this the prize For having learned how not to cry? Doktor, meine Augen Können den Himmel nicht sehen. Ist das der Preis dafür, Daß ich gelernt habe, nicht zu weinen? Jackson Browne
Prolog
London, Mai 1900
Einen Bullen konnte Frankie Betts schon von weitem riechen.
Bullen rochen nach Bier und Haarwasser und gingen, als ob ihre Schuhe drückten. In den Armenvierteln unter den vielen hungrigen Leuten nahmen sie sich besonders feist und fett aus, rausgemästet wie sie waren von all den kostenlosen Mahlzeiten, die sie sich zusammenschnorrten.
Bullen machten Frankie rasend. Sie brachten ihn dazu, daß er alles und jeden, der ihm in die Quere kam, niederknüppeln wollte. Und jetzt saß einer direkt neben ihm. Im Barkentine. In der Hochburg der Firma. Und tat so, als wäre er ein ganz normaler Gast. Trank, redete und bestellte Essen.
Was für eine gottverdammte Frechheit!
Frankie drückte seine Zigarette aus. Er schob seine Ärmel zurück, stand auf und wollte den Mann verprügeln, bis ihm das Licht ausging. Doch bevor er dazu kam, stand plötzlich ein frisches Bier auf der Theke. Desi, der Wirt, hatte es hingestellt.
»Du gehst doch noch nicht, Kumpel? Bist doch gerade erst gekommen.« Desis Stimme klang freundlich, aber seine Augen blinzelten warnend.
Frankie nickte. »Danke«, sagte er mit zusammengepreßten Lippen und setzte sich wieder.
Desi hatte gut daran getan, ihn aufzuhalten. Sid wäre sauer. Er würde sagen, er sei enttäuscht. Frankie war nicht so dumm, Sid zu enttäuschen. So dumm war keiner.
Er trank einen Schluck Bier, zündete eine weitere Zigarette an und schob den Fehler, den er fast begangen hätte, auf seine schlechten Nerven. Es war eine schwierige Zeit für die Firma. Eine gefährliche Zeit. Die Bullen jagten sie gnadenlos. Letzte Woche hatten sie einen Wagen mit Lohngeldern ausgeraubt und waren mit über tausend Pfund abgehauen, was Freddie Lytton, den hiesigen Parlamentsabgeordneten, dazu brachte, ihnen den Krieg zu erklären. Er ließ Sid festnehmen. Ronnie und Desi ebenfalls. Aber der Richter hatte sie wieder laufenlassen. Es stellte sich raus, daß es keine Zeugen gab. Zwei Männer und eine Frau hatten den Überfall gesehen, doch als sie hörten, daß sie gegen Sid Malone aussagen sollten, konnten sie sich plötzlich nicht mehr erinnern, wie die Räuber ausgesehen hatten.
»Die Polizei hat einen Fehler gemacht und den falschen Mann verhaftet«, sagte Sid auf den Stufen von Old Bailey zur Presse, nachdem er freigelassen worden war. »Ich bin kein Krimineller. Nur ein Geschäftsmann, der auf ehrliche Weise seinen Lebensunterhalt verdienen will.« Das war ein Satz, den er schon oft gebraucht hatte – wann immer die Polizei in seiner Werft oder in seinen Pubs Razzia machte. Er sagte ihn so oft, daß Alvin Donaldson, ein Kriminalinspektor, ihn den »Vorsitzenden« und seine Bande die »Firma« getauft hatte.
Lytton war außer sich gewesen. Er schwor, Sids Kopf auf einem Tablett zu servieren. Er schwor, er würde jemanden finden, einen ehrlichen Menschen, der keine Angst hatte, die Wahrheit zu sagen, der sich vor Malone und seiner Verbrecherbande nicht fürchtete, und wenn ihm das gelänge, würde er sie lebenslänglich hinter Gitter bringen.
»Der macht bloß Wind«, sagte Sid. »Will sein Bild in der Zeitung sehen. Schließlich sind bald Wahlen.«
Frankie hatte ihm geglaubt, aber jetzt saß dieser Bulle hier, frech wie Oskar, und er war sich nicht mehr so sicher, ob Sid recht hatte. Frankie sah den Mann an – nicht direkt, sondern im Spiegel über der Bar. Kam er von Lytton? Oder von jemand anderem? Warum hatte man ihn hergeschickt?
Wo es einen Bullen gab, gab es gewöhnlich noch ein Dutzend andere. Frankie ließ den Blick durch den Raum schweifen. Wenn je ein Pub den Namen Räuberhöhle verdiente, dachte er, dann das Bark. Der dunkle niedrige Bau in Limehouse war zwischen zwei Lagerhäuser am Nordufer der Themse gequetscht. Die Vorderseite lag an der Narrow Street, die baufällige Rückseite hing über den Fluß. Bei Flut konnte man die Themse gegen die Rückwand schwappen hören. Frankie kannte fast jedes Gesicht. Drei Kerle aus dem Viertel standen am Kamin und reichten Schmuckstücke hin und her, vier weitere spielten Karten, während ein fünfter Pfeile auf eine Dartscheibe warf. Andere saßen dicht gedrängt um wacklige Tische oder an der Bar, rauchten, tranken, redeten und lachten laut. Prahlten und stolzierten großspurig herum. Kleinkriminelle, alle zusammen.
Der Mann, hinter dem der Bulle her war, prahlte nicht, stolzierte nicht herum und hatte auch sonst nichts an sich, was auf eine geringe Stellung hingewiesen hätte. Er war einer der mächtigsten und am meisten gefürchteten Verbrecherbosse in London, und Frankie dachte, wenn dieser erbärmliche Bulle wüßte, was gut für ihn ist, würde er abhauen. Solange er noch konnte.
Noch während Frankie den Mann beobachtete, kam Lily, das Barmädchen, aus der Küche und knallte so heftig einen Teller vor ihn hin, daß die Brühe auf seine Zeitung schwappte.
»Einmal Limehouse-Eintopf«, sagte sie.
Der Mann starrte auf die dampfende Plörre. »Das ist Fisch«, sagte er ausdruckslos.
»Sie sind mir ein echter Sherlock Holmes. Was erwarten Sie? Lammkarree?«
»Schweinefleisch, dachte ich.«
»Wir sind hier in Limehouse. Nicht auf der grünen Wiese. Das macht zwei Pence.«
Der Mann schob eine Münze über die Bar, dann rührte er mit einem schmutzigen Löffel die graue Brühe um. Knochen und Hautstücke schwammen darin herum, ein Kartoffelschnitz und etwas Sellerie. Ein Brocken glitschiges weißes Fleisch kam nach oben, das schon ziemlich verdorben wirkte.
Karpfen, dachte Frankie. Die sah er oft bei Ebbe. Riesige Apparate mit trüben Augen, die hilflos im stinkenden Flußschlamm zappelten. Einen Bissen davon, Kumpel, dachte er, und du hast eine Woche lang die Scheißerei.
Desi kam herüber. »Irgendwas nicht in Ordnung mit Ihrem Essen?« fragte er. »Sie haben’s ja nicht mal angerührt.«
Der Fremde legte seinen Löffel weg. Er zögerte.
Sag lieber, daß es schmeckt, dachte Frankie.
»Ich krieg keinen Bissen runter, egal, wie sehr ich mich auch anstrenge«, sagte er schließlich. »Hab bloß von Porterbier gelebt. Sobald ich was anderes eß, dreht’s mir den Magen um.«
»Was? Sonst nichts?«
»Porridge. Milch. Manchmal ein Ei. Die Wachleute im Gefängnis sind schuld daran. Die Bauchtritte, die sie mir verpaßt haben. Davon hab’ ich mich nicht mehr erholt.«
Frankie hätte fast laut herausgelacht.
Desi jedoch nicht. Sein Gesichtsausdruck blieb ungerührt. »Sie waren im Knast?« fragte er.
»Ja. Einbruch. In einem Juwelierladen oben in Camden. Ich hatte ein Klappmesser in der Tasche, also sagten die Bullen, ich wär’ bewaffnet gewesen. Hab’ fünf Jahre gekriegt.«
»Und Sie sind gerade rausgekommen?«
Der Fremde nickte. Er nahm seine Mütze ab. Ein typischer Gefängnishaarschnitt kam zum Vorschein.
Desi grinste. »Du armer Teufel«, sagte er. »Wo hast du denn eingesessen? In Reading?«
»Petonville.«
»Da hab’ ich selbst mal ’ne Weile gesessen. Der Wärter ist ein übles Schwein. Willocks hieß er. Macht er noch immer allen das Leben zur Hölle?«
»O ja.«
Blödsinn, du dummer Hund, dachte Frankie. Hättest dich umhören sollen.
Es gab keinen Willocks in Petonville. Hatte nie einen gegeben.
Desi schenkte ein neues Glas Porter ein. »Hier, Alter. Geht aufs Haus.«
Als er wegging, um andere Gäste zu bedienen, tauschte er wieder einen Blick mit Frankie aus. Paß auf den auf, sollte das heißen.
Frankie wartete eine Weile, trank einen Schluck aus seinem Glas, rauchte und stieß dann den Mann am Arm an, so daß Bier auf dessen Zeitung schwappte.
»Tut mir leid, Kumpel«, entschuldigte er sich, als hätte es sich um ein Mißgeschick gehandelt. »Jetzt ist deine Zeitung naß.«
»Macht nichts«, sagte der Bulle lächelnd. »Das Schmierblatt taugt sowieso bloß zum Aufwischen.«
Frankie lachte. Der Mann nutzte seine gespielte gute Laune für einen Einstieg. Ganz wie er erwartet hatte.
»Michael Bennett«, stellte er sich vor. »Freut mich, dich kennenzulernen.«
»Roger Evans«, sagte Frankie. »Gleichfalls.«
»Hast du davon gehört?« fragte Bennett und deutete auf die Titelstory. »Es geht um einen Raub von Lohngeldern. Es heißt, Sid Malone sei’s gewesen. Er sei mit zehntausend Pfund abgehauen.«
Schön wär’s, dachte Frankie. Die Schmierblätter übertrieben immer.
Bennett schlug ein paarmal mit dem Handrücken auf Frankies Arm. »Ich hab’ gehört, Malone versteckt die Knete in einem Boot auf der Themse«, sagte er. »Und einen Teil in einem Warenlager mit Zucker.«
»Ach, wirklich?«
Bennett nickte. »Ich hab’ auch gehört, daß er einiges hier im Bark hat. Wir könnten direkt darauf sitzen«, fuhr er fort und trat mit dem Fuß gegen die Bodendielen. »Du hast nicht zufällig eine Brechstange in der Tasche, was?«
Frankie zwang sich erneut zu einem Lachen.
»Egal, wo er’s lagert, es muß ein großes Versteck sein. Die Firma gibt sich nicht mit Kleinkram ab. Ein Kerl hat mir gesteckt, allein der Raub von Goldbarren hätte ihnen Tausende eingebracht. Tausende! Mann, kannst du dir vorstellen, so viel Zaster zu haben?«
Frankie spürte, wie ihn erneut der Zorn packte. Es juckte ihn in den Fingern. Wie gern hätte er dem Mistkerl die Nase gebrochen. Das würde ihn lehren, sie nicht in die Angelegenheiten anderer Leute zu stecken.
»Benutz dein Hirn, Frankie, nicht deine Fäuste. Dein Hirn«, hörte er Sid sagen.
Bennett berührte wieder Frankies Arm. »Ich hab’ auch gehört, daß Malone regelmäßig in diesen Pub kommt«, sagte er. »Es soll sein Hauptquartier sein.«
»Das ist mir nicht bekannt«, antwortete Frankie.
Bennett beugte sich nahe heran. »Ich müßte mal mit ihm reden. Nur ganz kurz. Weißt du, wie ich ihn finden kann?«
Frankie schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, Kumpel.«
Bennett griff in die Tasche und legte eine Zehnpfundnote auf die Bar. Für die meisten Männer in Limehouse waren zehn Pfund ein Vermögen. Frankie tat so, als machte er dabei keine Ausnahme, und steckte sie schnell ein.
»Wir treffen uns hinter dem Pub«, sagte er. »In fünf Minuten.«
Er verließ das Bark durch die Eingangstür und ging durch die Kellertür wieder hinein. Rasch stieg er eine enge Holztreppe, die vom Keller in die Küche führte, und dann eine weitere ins obere Stockwerk hinauf. Er ging einen kleinen Gang hinunter und klopfte zweimal an eine verschlossene Tür.
Sie wurde von einem schlaksigen Mann in Hemdsärmeln und Weste geöffnet, der keine Anstalten machte, den Totschläger in seiner Hand zu verbergen. Hinter ihm, in der Mitte des Raums, saß ein anderer Mann an einem Tisch, der seelenruhig Zwanzigpfundnoten zählte. Er blickte mit seinen grünen Augen zu Frankie auf.
»Schwierigkeiten«, sagte Frankie. »Einer von Lytton. Ganz sicher. Behauptet, sein Name sei Bennett. In fünf Minuten ist er draußen hinterm Haus.«
Der Mann mit den grünen Augen nickte. »Halt ihn dort fest«, antwortete er und zählte weiter.
Frankie eilte die Treppe wieder hinunter und ging durch die Kellertür hinaus. Im Schankraum sah Michael Bennett auf die Uhr neben der Kasse. Es war fast zwei Uhr morgens. Er leerte sein Glas und ließ ein paar Münzen auf der Theke zurück.
»Gute Nacht, Kumpel«, sagte er und nickte dem Wirt zu.
Desi hob grüßend die Hand.
»Wo ist der Abtritt?« fragte Bennett.
»Was glaubst du, wo du bist? Im Buckingham-Palast?« fragte Desi. »Pinkel in den Fluß wie alle anderen auch.«
Bennett trat aus der Tür, ging um den Pub herum und stieg dann über ein paar Steinstufen zum Wasser hinab.
Frankie stand hinter einer dichten Reihe von Pfählen und beobachtete ihn, wie er die Hose aufknöpfte und lange pißte. Es herrschte gerade Ebbe. In der Dunkelheit konnte Frankie den Fluß kaum sehen, aber er konnte ihn hören – das Wasser, das gegen den Rumpf der vertäuten Lastkähne schwappte, an Leinen und Bojen zerrte und in kleinen Strudeln vorbeifloß. Als Bennett fertig war, trat Frankie zwischen den Pfeilern heraus.
»Mein Gott!« japste Bennett. »Hast du mich erschreckt. Hier unten ist’s stockdunkel. Wo ist Malone?«
»Auf dem Weg.«
»Bist du sicher?«
»Hab’ ich doch gesagt, oder?«
»Ich will mein Geld zurück, wenn er nicht auftaucht«, drohte Bennett.
Frankie schüttelte den Kopf und fand, daß er die Rolle des anständigen Kerls schon viel zu lange gespielt hatte. »Keine Sorge. Er kommt schon«, antwortete er.
Die beiden Männer warteten noch etwa zehn Minuten, dann wurde Bennett ungeduldig. Gerade als er sauer zu werden begann, flammte ein Streichholz hinter ihm auf. Er fuhr herum.
Frankie erblickte Sid und Desi. Sie standen am Fuß der Steintreppe. Desi zündete eine Laterne an.
»Michael Bennett?« fragte Sid.
Bennett starrte ihn an, gab aber keine Antwort.
»Mein Boß hat dir eine Frage gestellt«, sagte Frankie.
Bennett drehte sich zu ihm um. »Dein Boß? Aber ich dachte … du hast gesagt …«, stammelte er.
»Was willst du?« knurrte Frankie. »Wer hat dich geschickt?«
Bennett trat einen Schritt zurück, weg von Sid. »Ich will keine Schwierigkeiten machen«, sagte er. »Ich bin bloß hergekommen, um was auszurichten, das ist alles. Eine Bekannte von mir möchte Sid Malone treffen. Sie trifft sich zu jeder Zeit und an jedem Ort mit ihm, aber sie muß ihn unbedingt sprechen.«
»Bist du ein Bulle?« fragte Frankie. »Hat Lytton dich geschickt?«
Bennett schüttelte den Kopf. »Ich hab’ dir die Wahrheit gesagt. Ich bin Privatdetektiv.«
Malone reckte den Kopf und musterte Bennett.
»Sie müssen mir eine Antwort geben«, sagte Bennett zu ihm. »Sie kennen diese Frau nicht. Die läßt nicht locker. Sonst kommt sie noch selbst her.«
Malone hatte noch immer nichts gesagt, hörte jedoch zu, was Bennett zu ermutigen schien. Er wurde kühner.
»Mit einem Nein gibt die sich nicht zufrieden. Ihren Namen kann ich nicht nennen, den will sie nicht preisgeben. Aber sie weiß ziemlich genau, was sie will, das Miststück, das jedenfalls kann ich Ihnen sagen«, fügte er hinzu und lachte.
Später erinnerte sich Frankie, daß Sids Mund bei dem Wort »Miststück« gezuckt hatte. Und daß er gedacht hatte, er würde zu einem Lächeln ansetzen. Er erinnerte sich, wie Sid langsam und gelassen auf Bennett zuging, als wollte er ihm die Hand schütteln und für die Nachricht danken. Statt dessen packte er den Mann und brach ihm mit einer einzigen schnellen Bewegung den Unterarm. Der Schmerz ließ Bennett auf die Knie sinken, aber es war der Anblick seiner Knochen, die durch die Haut stachen, der ihn zum Schreien brachte.
Sid packte einen Büschel seiner Haare und riß seinen Kopf zurück. Bennett vestummte. »Hier ist meine Antwort. Laut und deutlich«, sagte er. »Du richtest Fiona Finnegan aus, daß der Mann, hinter dem sie her ist, tot ist. Genauso tot, wie du sein wirst, wenn du dich noch mal hier blicken läßt.«
Sid ließ ihn los, und Bennett sackte in den Schlamm. Dann drehte er sich um und ging weg. Frankie folgte ihm. Desi löschte die Laterne.
»Wer ist diese Frau, Boß?« fragte Frankie, verwundert über Bennetts Bitte und Sids Reaktion. »Kriegt sie ein Kind?«
Sid gab keine Antwort.
»Ist sie eine Verwandte?«
In der Dunkelheit konnte Frankie nur Sids Stimme hören, aber nicht sein Gesicht sehen. Andernfalls hätte er den tiefen, anhaltenden Schmerz darin erkannt, als er sagte: »Sie ist niemand, Frankie. Keine Verwandte. Sie bedeutet mir überhaupt nichts.«
Erster Teil
Mai 1900
1
Jones!«
India Selwyn-Jones drehte sich um, als sie ihren Namen hörte. Sie mußte die Augen zusammenkneifen, um zu sehen, wer da gerufen hatte. Maud hatte ihr die Brille weggenommen.
»Professor Fenwick!« rief sie schließlich zurück und strahlte den kahlen, bärtigen Mann an, der durch die vielen Studenten mit Doktorhüten auf dem Kopf auf sie zueilte.
»Jones, Sie schlaue kleine Katze! Ein Walker-Stipendium und den Dennis-Preis! Gibt’s irgendwas, das Sie nicht gewonnen haben?«
»Hatcher hat den Beaton gekriegt.«
»Der Beaton ist Humbug. Jeder Dummkopf kann sich Anatomie merken. Eine Ärztin braucht mehr als nur Wissen, sie muß es anwenden können. Hatcher kann kaum eine Aderpresse anlegen.«
»Pst, Professor! Sie steht direkt hinter Ihnen«, flüsterte India entrüstet.
Die Promotionszeremonie war vorbei. Die Studenten waren zu den Klängen eines flotten Marschs von der kleinen Bühne des Auditoriums hinabgezogen und posierten jetzt für Fotos oder plauderten mit Gratulanten.
Fenwick machte eine wegwerfende Handbewegung. Ihm war nichts peinlich. Er war ein Mann, der klar und offen seine Meinung sagte, gewöhnlich mit voller Lautstärke. India hatte seine Beleidigungen selbst erlebt. Oft genug hatten sie sich gegen sie gerichtet. Sie erinnerte sich an ihre erste Woche in seiner Klasse. Sie sollte einen Patienten mit Rippenfellentzündung befragen. Hinterher hatte Fenwick von ihr verlangt, anhand ihrer Notizen den Fall zu beschreiben. Noch immer hörte sie, wie er sie anschrie, weil sie mit den Worten »Ich glaube …« begann.
»Sie machen was? Sie glauben?« schrie er. »Aber ich habe das Gefühl …«, verteidigte sie sich. »Sie sind nicht in meiner Klasse, um zu glauben oder zu fühlen, Jones. Hier geht’s nicht um Theologie. Hier geht’s um Diagnosen, die Aufnahme von Fällen. Sie sind hier nur, um zu beobachten, weil Sie noch viel zu unwissend sind, um etwas anderes zu tun. Glaube und Gefühl vernebeln das Urteil. Was tun sie, Jones?«
»Sie vernebeln das Urteil, Sir«, antwortete India mit hochrotem Kopf.
»Richtig. Glauben und Gefühl bedeuten für Ihren Patienten nur, daß Sie ihm mit dummen Vorurteilen schaden. Sehen Sie ihn an, Jones … Sie sehen das Ödem des Herzkranken und wissen, daß es vom Versagen der Nieren herrührt … Sie sehen die Gallenkolik und wissen, daß sie durch Bleivergiftung hervorgerufen wurde … aber sehen Sie ihn an, Jones, klar und leidenschaftslos, und Sie werden ihn heilen.«
»Kommen Sie, kommen Sie, werfen wir einen Blick hinein«, sagte Fenwick jetzt und deutete ungeduldig auf die Ledermappe unter Indias Arm.
India öffnete sie, weil sie selbst noch einmal einen Blick darauf werfen wollte – auf das braune Dokument mit ihrem Namen in kupferner Prägeschrift und dem Datum 26. Mai 1900, dem Siegel der Londoner Medizinhochschule für Frauen und der Urkunde, daß sie ihr Diplom erhalten hatte. Daß sie jetzt Ärztin war.
»Doktor India Selwyn-Jones. Klingt gut, nicht?« sagte Fenwick.
»Das stimmt, und wenn ich es noch ein paarmal höre, glaube ich vielleicht selbst, daß es wahr ist.«
»Unsinn. Hier gibt’s einige, die einen schriftlichen Wisch brauchen, um zu glauben, daß sie Ärztinnen sind, aber zu denen gehören Sie nicht.«
»Professor Fenwick! Professor, hier drüben …«, rief eine schrille weibliche Stimme.
»Meine Güte«, sagte Fenwick. »Die Dekanin. Sieht aus, als hätte sie Broadmoor bei sich, den armen Teufel. Sie will, daß ich ihn überzeuge, ein paar von euch anzustellen. Sie haben verdammtes Glück gehabt, den Job bei Gifford zu ergattern.«
»Das weiß ich, Sir. Ich bin schon begierig anzufangen.«
Fenwick schnaubte. »Wirklich? Kennen Sie Whitechapel?«
»Ich habe eine Weile am London Hospital gearbeitet.«
»Mit Hausbesuchen?«
»Nein, Sir.«
»Hm, dann nehm’ ich’s zurück. Gifford hat Glück gehabt.«
India lächelte. »Wie schlimm kann es schon sein? Ich habe in anderen Armenvierteln Hausbesuche gemacht. In Camden, Paddington, Southwark …«
»Whitechapel ist einzigartig in London, Jones. Seien Sie darauf gefaßt. Sie werden dort eine Menge lernen, das steht fest, aber mit Ihrem Kopf, Ihren Fähigkeiten sollten Sie ein schönes Forschungsstipendium an einem Lehrkrankenhaus haben. Und Ihre eigene Praxis. Wie Hatcher. Eine Privatpraxis. Da gehören Sie hin.«
»Ich kann keine eigene Praxis eröffnen, Sir.«
Fenwick sah sie lange an. »Selbst wenn Sie’s könnten, bezweifle ich, daß Sie’s täten. Jemand könnte Ihnen die Schlüssel zu einer komplett eingerichteten Ordination in der Harley Street überreichen, und Sie würden sie zurückgeben und wieder in die Elendsviertel zurückrennen.«
India lachte. »Wahrscheinlich eher zurückgehen, Sir.«
»Immer noch Ihre Hirngespinste, was?«
»Ich ziehe es vor, sie als Ziele anzusehen, Sir.«
»Eine Klinik, nicht wahr?«
»Ja.«
»Für Frauen und Kinder.«
»Ganz richtig.«
Fenwick seufzte. »Ich kann mich erinnern, Hatcher und Sie haben darüber gesprochen, aber ich hätte nie gedacht, es sei Ihnen ernst damit.«
»Harriet nicht, mir schon.«
»Jones, haben Sie auch nur die leiseste Ahnung, was so etwas erfordert?«
»Durchaus.«
»Das Aufbringen der Mittel, die Suche nach einem geeigneten Ort … Allein bei den Regierungsvorschriften wird einem schwindlig. Sie brauchen Zeit, um eine Klinik aus dem Boden zu stampfen, eine Unmenge Zeit, und Sie werden keine freie Minute mehr haben. Sie werden sich schon bei Gifford zu Tode schuften. Wie wollen Sie das alles schaffen?«
»Ich werde einen Weg finden, Sir. Man muß das Außergewöhnliche versuchen«, sagte India entschieden.
Fenwick reckte den Kopf. »Das gleiche haben Sie mir vor sechs Jahren gesagt. Als Sie zum erstenmal hierherkamen. Ich habe allerdings nie verstanden, warum.«
»Warum?«
»Warum eine adelige junge Frau aus einer der reichsten Familien etwas Außergewöhnliches machen will.«
India wurde rot. »Sir, ich bin nicht … ich …«
»Professor! Professor Fenwick!« rief die Dekanin erneut.
»Ich muß gehen«, sagte Fenwick. Er schwieg einen Moment und sah auf seine Schuhe hinab, dann fügte er hinzu: »Ich scheue mich nicht, Ihnen zu sagen, daß ich Sie vermissen werde, Jones. Sie sind die beste Studentin, die ich je hatte. Rational, logisch, unemotional. Ein leuchtendes Beispiel für meine derzeitige Schar von Dummköpfen. Ich würde Ihnen auch gern sagen, daß der schwierige Teil hinter Ihnen liegt, aber er fängt erst an. Sie wollen etwas anders machen, die Welt verändern, aber vielleicht hat die Welt andere Vorstellungen. Sie wissen das, nicht wahr?«
»Ja, das weiß ich, Sir.«
»Gut. Dann merken Sie sich: Ganz egal, was dort draußen passiert, vergessen Sie nie, daß Sie Ärztin sind. Eine sehr gute. Das kann Ihnen niemand nehmen. Und nicht, weil es hier drin steht«, er tippte auf das Diplom, »sondern weil es hier drin ist.« Er tippte an Indias Stirn. »Vergessen Sie das nie.«
Jetzt war es India, die auf ihre Schuhe starrte. »Das werde ich nicht, Sir«, flüsterte sie.
Sie wollte ihm für alles danken, was er für sie getan hatte, daß er ein unwissendes Mädchen von achtzehn Jahren aufgenommen und eine Ärztin aus ihr gemacht hatte, aber sie wußte nicht, wie. Sechs Jahre hatte es gedauert. Sechs lange Jahre der Mühen, des Kampfes und der Zweifel. Sie hatte es nur seinetwegen geschafft. Wie konnte sie ihm dafür danken? Wo sollte sie bloß anfangen?
»Professor Fenwick …«, sagte sie, aber als sie aufsah, war er schon fort.
Ein Gefühl des Verlusts und der Einsamkeit überkam sie. Ihre Kommilitonen lachten und scherzten im Kreis ihrer Familien und Freunde, aber sie war allein. Bis auf Maud. Freddie war in Regierungsaufgaben unterwegs. Wish war in Amerika, ihre Eltern in Blackwood, Hunderte von Meilen entfernt. Aber selbst wenn sie neben der Hochschule gewohnt hätten, wären sie nicht gekommen. Das wußte sie.
Einen Augenblick lang dachte sie an die einzige Person, die gekommen wäre, wenn sie gekonnt hätte – ein Junge, der den ganzen Weg von Wales zu Fuß gegangen wäre, um heute bei ihr zu sein. Hugh. Sie sah ihn vor sich. Lachend rannte er Owen’s Hill hinauf, stand mit zurückgeworfenem Kopf auf Duffy’s Rock, die Arme in den wilden walisischen Himmel gestreckt. Sie versuchte, die Bilder zu verscheuchen, schaffte es aber nicht. Tränen brannten in ihren Augen. Hastig wischte sie sie weg, da sie wußte, daß Maud nach ihr suchen würde, um sie zum Tee auszuführen. Außerdem wußte sie, daß Maud wenig Geduld für Gefühlsverwirrungen aufbrachte.
»Hör auf damit, Jones«, tadelte sie sich. »Gefühle vernebeln das Urteilsvermögen.«
»Genau wie Champagner, altes Mädchen, aber deswegen mögen wir ihn!« dröhnte eine männliche Stimme, und sie zuckte zusammen.
India fuhr erstaunt herum. »Wish?« rief sie aus, als ihr Cousin sie auf die Wange küßte. »Was machst du hier? Ich dachte, du seist in den Staaten!«
»Bin gerade zurückgekommen. Gestern hat mein Schiff angelegt. Hab’ den Wagen ausladen lassen und bin wie der Teufel die ganze Nacht durchgefahren. Das hätte ich doch um nichts in der Welt verpassen wollen, Indy. Hast du mich nicht gesehen? Ich hab’ geklatscht wie ein Wahnsinniger. Bingham auch.«
»Bing, bist das wirklich du?« fragte India und sah zu ihrem anderen Cousin hinter Wish.
George Lytton, der zwölfte Earl von Bingham, stand hinter Wish. Scheu hob er die Hand zum Gruß. »Hallo, Indy«, sagte er. »Gratulation.«
»Das ist aber eine schöne Überraschung! Ich hab’ keinen von euch gesehen. Maud hat mir meine Brille weggenommen. Ach, laß dich anschauen, Wish! Wie gut du aussiehst und wie braun du bist. War deine Reise ein Erfolg? Bist du Millionär?«
»Noch nicht, altes Haus, aber bald«, erwiderte Wish lachend.
»Ach, um Himmels willen, Liebes, ermutige ihn nicht noch. Er ist schon eingebildet genug«, warf ihre Schwester ganz offensichtlich genervt ein.
»Maud! Gib mir meine Brille zurück«, forderte India.
»Bestimmt nicht. Sie ist scheußlich. Sie ruiniert die Fotos.«
»Aber ich kann sehen.«
Maud seufzte. »Wenn du darauf bestehst. Aber wirklich, India, wenn deine Gläser noch dicker werden, kannst du gleich ein Fernglas aufsetzen.« Sie rümpfte die Nase. »Können wir jetzt gehen? Hier stinkt’s.«
»Hör auf deine so viel ältere Schwester, Indy«, sagte Wish.
»Sehr komisch!« erwiderte Maud.
Bing lächelte, während India versuchte, ernst zu bleiben. Sie waren zusammen aufgewachsen und neigten dazu, in alte Gewohnheiten zu verfallen, sobald sie wieder zusammen waren. Sie beobachtete die anderen. Ihr plötzliches Auftauchen hatte sie ihre vorherige Traurigkeit vergessen lassen. Als Kinder waren sie unzertrennlich gewesen, aber jetzt sahen sie sich kaum noch. Maud neigte dazu, aus einer Laune heraus zu exotischen Zielen zu reisen. Wish startete ständig neue Unternehmungen. Aus dem Banker war ein Spekulant geworden, und er war bekannt dafür, innerhalb von Tagen ein Vermögen zu verdienen – und es genauso schnell wieder zu verlieren. Bingham verließ Longmarsh praktisch nie, weil er die stillen Wälder und Wiesen den lärmigen Straßen Londons vorzog. Und Freddie – Indias Verlobter und Binghams Bruder – wohnte praktisch im Unterhaus.
»Hört zu, wir sollten uns auf die Socken machen«, sagte Wish ungeduldig, »also pack deine Sachen, Indy, sonst kommst du zu spät zum Lunch. Wir haben eine Reservierung im Connaught um halb eins – eine kleine Feier für dich –, aber das schaffen wir nie, wenn wir nicht endlich aufbrechen.«
»Wish, du darfst nicht …«, begann India.
»Keine Sorge. Das hab’ ich nicht. Es geht auf Lytton.«
»Bing, du solltest nicht …«
»Hab’ ich nicht, sondern mein Bruder.«
»Freddie ist hier?« fragte India. »Wie? Wann? Er ist doch am Wochenende in Sachen Politik unterwegs.«
Wish zuckte die Achseln. »Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er sich losgemacht. Er kam gerade die Treppe runter, als ich bei ihm vorbeiging, also hab’ ich ihn mitgenommen.«
»Wo ist er jetzt?«
»Draußen. Bringt den Wagen her.«
»Nein, das tue ich nicht. Ich bin hier«, sagte ein junger blonder Mann. Er war groß und schlank und trug einen eleganten Cutaway. Ein Dutzend Frauen drehten sich bewundernd nach ihm um. Einige fragten sich vielleicht, wer er war, aber die meisten erkannten ihn. Er war ein Mitglied des Parlaments, eine emporstrebende Größe. Wegen seines kühnen Wechsels von den Konservativen zu den Liberalen tauchte sein Name ständig in den Zeitungen auf. Er war Binghams jüngerer Bruder – nur der zweitgeborene Sohn –, doch Bing, der scheu und zurückhaltend wirkte, verblaßte neben ihm.
»Freddie, was war denn los?« fragte Wish. »Ich hab’ mir Sorgen gemacht.«
»Ich bin gerührt, alter Junge. Wirklich.«
»Nicht deinetwegen. Wegen des Wagens.« Wishs Wagen, ein Daimler, war nagelneu.
»Hm. Ja. Ich hatte ein klitzekleines Problem mit dem Auto«, antwortete Freddie. »Ich bekam den verdammten Rückwärtsgang nicht rein. Den Leerlauf auch nicht. Konnte ihn auch nicht abstellen.«
»Freddie …«, setzte Wish an, aber der hörte ihn nicht. Er küßte gerade Indias Wange. »Gut gemacht, mein Schatz. Glückwunsch.«
»Freddie!« rief Wish. »Was soll das heißen, du konntest ihn nicht abstellen? Fährt er jetzt allein herum?«
»Natürlich nicht. Ich hab’ den Portier gebeten, ihn zu parken. Zuletzt hab’ ich ihn Richtung King’s Cross verschwinden sehen.«
Wish fluchte und rannte aus dem Auditorium. Bing folgte ihm.
Freddie grinste. »Der Wagen ist natürlich in Sicherheit. Steht draußen vor der Tür. Habt ihr Wishs Gesicht gesehen?«
»Freddie, das war scheußlich. Der arme Wish«, sagte India.
»Armer Wish, du meine Güte«, sagte Maud. »Geschieht ihm recht, diesem Autonarr. Können wir jetzt bitte gehen? Ich halte den Geruch von diesem Gebäude nicht mehr aus. Wirklich, Indy, es ist schrecklich. Was ist das eigentlich?«
India schnupperte in die Luft. »Ich rieche nichts.«
»Bist du erkältet? Das gibt’s doch nicht.«
Sie schnupperte noch einmal. Eine nahe gelegene Kirche betrieb eine Armenküche, und die Küchengerüche wehten herüber. »Ach das. Das ist Ko…«, doch noch bevor sie »Kohl« sagen konnte, schnitt Freddie ihr das Wort ab.
»Kadaver«, sagte er. »Indy hat mir davon erzählt. Die besten gehen ans Guy’s-and-Bart’s-Hospital. Die Hochschule für Frauen kriegt alle schon halb verwesten.«
Maud wurde blaß. Sie drückte die mit Juwelen geschmückte Hand an die Brust. »Tote Menschen?« flüsterte sie. »Du machst doch Witze, Freddie.«
»Diesmal nicht. Ich bin ganz ernst. Ich schwöre.«
»Gütiger Himmel. Mir wird schlecht. Ich warte draußen.«
Die Hand vor dem Mund, ging Maud hinaus. India wandte sich ihrem Verlobten zu. »Ganz ernst? Müssen wir denn immer wieder zu Zwölfjährigen werden, wenn wir zusammen sind?«
»Ja, das müssen wir«, antwortete Freddie. Er sah sie liebevoll an, und wie schon tausendmal zuvor dachte India, daß er der schönste Mann war, den sie je gesehen hatte.
»Du bist schrecklich, Freddie. Ehrlich.«
»Das gebe ich zu. Aber es war die einzige Möglichkeit, fünf Minuten mit dir allein zu sein«, sagte er und drückte ihre Hand. »Jetzt hol deine Sachen, wir fahren ins Connaught.«
»Wish hat’s mir schon gesagt. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen.«
»Aber ich möchte es gern. Schließlich wird man nicht jeden Tag Doktor, weißt du.«
»Das ist so herrlich. So unerwartet. Ich dachte, du wärst das ganze Wochenende bei Campell-Bannerman.«
Bei Henry Campell-Bannerman, dem Oppositionsführer. Es gab Gerüchte, daß Lord Salisbury, der britische Premierminister und Führer der amtierenden Konservativen, im Herbst Wahlen ausschreiben würde. Campell-Bannerman hatte sein Schattenkabinett einberufen, um die Vorgehensweise der Liberalen abzusprechen. Eine Handvoll prominenter Hinterbänkler einschließlich Freddie waren ebenfalls herbeizitiert worden.
»Der alte Knabe hat abgesagt«, erklärte Freddie. »Er fühlte sich nicht wohl.«
»Wann hast du das erfahren?«
»Vor zwei Tagen.«
»Warum hast du mir nichts gesagt?« fragte India eingeschnappt. Sie war so enttäuscht gewesen, als sie erfuhr, daß er bei der heutigen Verleihung nicht dabeisein könnte.
»Das wollte ich ja«, antwortete Freddie reumütig. «Und vielleicht hätte ich es auch tun sollen. Aber sobald ich erfahren habe, daß ich frei war, wollte ich dich mit einer Feier überraschen. Jetzt schau mich nicht so böse an, und hol deine Sachen.«
India war beschämt. Wie konnte sie ihn tadeln? Er war immer so aufmerksam. Sie führte ihn aus dem Auditorium durch einen engen Gang in einen Vorlesungsraum, wo sie und ihre Kommilitoninnen ihre Sachen aufbewahrten. Die Traurigkeit, die sie heute schon einmal verspürt hatte, überkam sie erneut. Sie ging zu Ponsonby, dem Skelett, hinüber und nahm seine leblose Hand.
»Ich kann nicht glauben, daß es vorbei ist, daß ich nie mehr hier sitzen werde«, sagte sie. »Dieser Ort … diese Schule … all die Jahre, die ich hier verbracht habe … das liegt jetzt alles hinter mir …«
Ihre Stimme brach ab, als die Erinnerungen zurückkamen. Sie sah sich wieder im Anatomiesaal, wie sie sich mit Harriet Hatcher über eine Leiche beugte. Sie zogen die Haut zurück, benannten und zeichneten, so schnell sie konnten, die Muskeln und Knochen, immer darauf bedacht, der Verwesung einen Schritt vorauszusein. Und sich nicht zu übergeben. Professor Fenwick war dabei und schalt sie in der einen Minute miserable Stümper, in der nächsten brachte er ihnen Bicarbonat und einen Kübel.
Wie ein rettender Engel war er plötzlich aufgetaucht, als eine Gruppe betrunkener Anfangssemester aus dem Guy’s sie und Harriet vor dem Schuleingang belästigt hatten. Die Männer hatten sich entblößt und verlangt, daß sie ihre Geschlechtsteile untersuchten. »Unglücklicherweise können meine Studentinnen der Bitte nicht nachkommen, meine Herren«, hatte er erklärt, »da ihnen nicht erlaubt ist, ihre Mikroskope mit nach draußen zu nehmen.«
Und Dr. Garrett Anderson, die Dekanin. Eine Legende schon zu Lebzeiten. Sie war die erste Frau in England, die ein Medizinstudium abgeschlossen hatte, und gehörte zu den Begründern der Hochschule. Mit ihrer Energie, Brillanz und ihrem eisernen Willen war sie India stets ein Vorbild gewesen und der lebende Beweis gegen jene, die behaupteten, Frauen seien zu schwach und zu dumm für den Arztberuf.
»Dieser Korken ist vielleicht ein Mist«, murmelte Freddie und riß India aus ihren Gedanken. »Ah, jetzt kommt er.«
Sie sah ihn an. Wie gern hätte sie ihm erklärt, was dieser Ort für sie bedeutete. »Freddie …«, begann sie. »Laß doch den Champagner …«
Es war zu spät. Freddie ließ den Korken knallen und klopfte auf den Stuhl neben sich. Als India saß, reichte er ihr ein Glas. »Auf Dr. India Selwyn-Jones«, sagte er. »Die klügste Frau in London. Ich bin so stolz auf dich, Liebling.« Er stieß mit ihr an und nahm einen kräftigen Schluck. »Hier«, fügte er dann hinzu und reichte ihr eine kleine Lederschatulle.
»Was ist das?«
»Mach’s auf und sieh nach.«
India öffnete den Deckel und hielt den Atem an, als sie sah, was darin lag – eine wundervoll gearbeitete goldene Taschenuhr mit Diamantzeigern. Freddie nahm sie heraus und drehte sie um. Denk an mich, war auf der Rückseite eingraviert.
India schüttelte den Kopf. »Freddie, sie ist wunderschön. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.«
»Sag, daß du mich heiraten willst.«
Sie lächelte ihn an. »Das habe ich doch schon gesagt.«
»Dann tu’s. Heirate mich morgen.«
»Aber ich fange nächste Woche bei Dr. Gifford an.«
»Zum Teufel mit Dr. Gifford.«
»Freddie! Scht!«
»Brenn mit mir durch. Heute abend.« Er beugte sich zu ihr hinüber und küßte ihren Nacken.
»Das kann ich nicht, du dummer Bengel. Du weißt, daß ich das nicht kann. Ich habe Arbeit. Wichtige Arbeit. Du weißt, wie hart ich um diese Stelle gekämpft habe. Und dann ist da noch die Klinik …«
Freddie hob den Kopf. Seine schönen braunen Augen hatten sich verdüstert. »Ich kann nicht ewig warten, India. Das werde ich nicht. Wir sind jetzt schon seit zwei Jahren verlobt.«
»Freddie, bitte … verdirb uns doch nicht den Tag.«
»Tu ich das? Verderbe ich dir den Tag?« fragte er sichtlich verletzt. »Ist es so schrecklich für dich, daß ich dich zur Frau haben will?«
»Natürlich nicht, es ist nur …«
»Dein Studium hat lange Zeit an erster Stelle gestanden, aber jetzt bist du fertig, und mehr Geduld kann ein Mann nicht aufbringen.« Er stellte sein Glas ab. Inzwischen war er sehr ernst geworden. »Wir könnten doch so viel zusammen erreichen. Du hast doch immer gesagt, du möchtest etwas bewegen. Wie kann dir das gelingen, wenn du für Gifford arbeitest? Oder in einer Klinik, die zuwenig finanzielle Mittel hat? Mach etwas Größeres, India. Etwas Großes und Wichtiges. Arbeite mit mir an der Gesundheitsreform. Berate mich. Gemeinsam schaffen wir dann das Bedeutsame. Etwas wirklich Bedeutsames. Nicht nur für Whitechapel oder London, sondern für England.« Er nahm ihre Hand und redete weiter, ohne ihr die Möglichkeit zu einer Antwort zu geben. Oder zu widersprechen. »Du bist eine erstaunliche Frau, und ich brauche dich. An meiner Seite.« Er zog sie an sich und küßte sie. »Und in meinem Bett«, flüsterte er.
India schloß die Augen und versuchte, seinen Kuß zu genießen. Das hatte sie immer versucht. Er war so gut und so liebevoll, und er liebte sie. Er war alles, was eine Frau sich wünschen konnte, und deshalb versuchte sie, sich seinen Küssen hinzugeben, aber seine Lippen waren so hart und fordernd. Ihre Brille fiel fast herunter bei seinen drängenden Zärtlichkeiten, und als seine Hand von ihrer Taille zu ihrem Busen hinaufglitt, machte sie sich von ihm los.
»Wir sollten gehen«, sagte sie. »Die anderen werden sich schon fragen, wo wir bleiben.«
»Sei nicht so abweisend. Ich begehre dich so.«
»Freddie, Liebling, hier ist kaum der Ort …«
»Ich möchte, daß wir ein Datum festsetzen, India. Ich möchte, daß wir Mann und Frau werden.«
»Das werden wir. Bald. Das verspreche ich.«
»Also gut. Kommst du?«
»Ich muß noch meine Sachen zusammensuchen«, antwortete sie. »Geh schon voraus. Ich komme gleich nach.«
Er bat sie, sich zu beeilen, und ging zu den anderen hinaus. India sah ihm nach. Er hat natürlich recht, dachte sie.
Es war zwei Jahre her, daß er in Longmarsh auf Knien um ihre Hand angehalten hatte. Sie müßte bald einen Hochzeitstermin festlegen, und sie wußte, was dann passieren würde – sie würden zu einer endlosen Reihe von Dinnergesellschaften und Partys eingeladen und müßten ein unablässiges Gerede über Kleider, Ringe und Aussteuer über sich ergehen lassen. Und er würde sie wieder drängen, ihre Hoffnungen auf eine Klinik aufzugeben und mit ihm an der Gesundheitsreform zu arbeiten – eine durchaus ehrenvolle Aufgabe, aber ihre Berufung war Heilen, nicht Komitee-Arbeiten, und das konnte sie genausowenig aufgeben, wie sie aufhören konnte zu atmen.
India runzelte die Stirn, verärgert über sich selbst. Freddie war so gut zu ihr und sie so ausgesprochen lieblos. Sie hätte sich schon längst auf ein Datum festlegen können. Das wäre doch nicht schwer gewesen. Irgendein schöner Samstag im Sommer.
Hätte. Wäre.
Wenn sie ihn nur lieben würde.
Sie saß noch eine Weile da, starrte auf die leere Türöffnung und zog dann ihren Talar aus. Die anderen warteten, sie durfte sie nicht länger aufhalten. Sie faltete den Talar zusammen, legte ihn neben sich auf den Stuhl und strich sich mit den Fingern durchs Haar. Es war ein Desaster. Ihre blonden Locken, die sie erst vor ein paar Stunden zu einem ordentlichen Knoten geschlungen hatte, hatten sich schon wieder selbständig gemacht. Sosehr sie sich auch bemühte, nie schaffte sie es, sie unter Kontrolle zu bringen. Sie begann, sie glattzustreichen, und hielt dann inne. Ihre Finger griffen nach dem juwelenbesetzten Kamm, den sie immer trug, und zog ihn heraus. Es war eine Tiffany-Libelle, die eigentlich zu einem Paar gehörte, und ein kleines Vermögen wert. Sie war aus Platin gefertigt, besetzt mit Dutzenden lupenreinen Steinen, und stand im völligen Gegensatz zu ihrer schlichten, unaufwendigen Kleidung: dem grauen Rock mit Weste und der frischen weißen Bluse.
Sie hatte den Kamm mitgenommen an dem Tag, an dem sie Blackwood verließ – an dem Tag, an dem sie ihrem Zuhause, ihren Eltern und deren gottverdammtem Geld den Rücken gekehrt hatte.
»Wenn du gehst, India, enterbe ich dich«, hatte ihre Mutter bleich vor Zorn gesagt.
»Ich will dein Geld nicht«, hatte sie geantwortet. »Ich will überhaupt nichts von dir.«
Auf der Unterseite des Kamms waren drei Initialen eingraviert, die sie mit dem Finger nachfuhr – ISJ, nicht die ihren, sondern die ihrer Mutter –, Isabelle Selwyn-Jones, Lady Burleigh. Ohne diesen Kamm wäre sie heute nicht hier. Wenn ihre Mutter ihn nicht in ihrer Kutsche vergessen hätte. Wenn Hugh ihn nicht genommen hätte. Wenn, wenn, wenn.
Sie schloß die Hand darum, drückte die Kammzinken in die Handfläche und versuchte, die Erinnerung zu verscheuchen. Hör auf, sagte sie sich, denk nicht an ihn. Vergiß ihn. Spür ihn nicht. Spür gar nichts. Aber sie spürte etwas. Weil Hugh ihr Gefühle eingeflößt hatte. Mehr als jeder andere Mann in ihrem ganzen Leben.
Sie sah ihn wieder vor sich, nur daß er diesmal nicht lachte. Er rannte mit seiner Schwester Bea im Arm das Flußufer hinauf. Beas Gesicht war bleich, ihr Rock rot vor Blut. Er wickelte sie in die Pferdedecke und sang für sie den ganzen Weg bis nach Cardiff. Ohne Unterbrechung. Selbst ohne zu stocken. Noch immer konnte sie seine wundervolle Stimme hören: Paid ag ofni, dim ond deilen, Gura, gura ar y ddor; Paid ag ofni, ton fach unig, Sua, sua ar lan y mor. Sie verstand genügend Walisisch, um zu wissen, was er sang. Sorg dich nicht, es ist nur ein Eichenblatt, das an die Türe schlägt. Sorg dich nicht, eine einsame Welle schlägt murmelnd an den Strand. Suo Gran, ein Wiegenlied.
India blickte noch immer auf den Kamm, sah ihn aber nicht. Sie sah nur Hugh, sein gramzerfurchtes Gesicht, als die Polizei kam, um ihn abzuführen.
»Du denkst an ihn, nicht wahr?« sagte plötzlich eine Stimme von der Tür her. Sie zuckte zusammen und drehte sich um. Es war Maud. »Arme Indy«, fuhr sie fort. »Du hast Hugh nicht retten können, also hast du beschlossen, statt dessen die Welt zu retten. Arme Welt. Sie weiß nicht, was ihr bevorsteht.«
India antwortete nicht. Sie wünschte sich, Maud könnte einmal über traurige Dinge reden, ohne sich darüber lustig zu machen. »Man hat mich in dieses Leichenhaus zurückgeschickt, um dich zu holen, damit du nicht ins Grübeln verfällst, sondern deine Sachen packst«, fuhr Maud fort. »Ich kann die Truppe nicht länger zusammenhalten. Oh, India, hast du geweint?«
»Natürlich nicht.«
»Deine Nase ist ganz rot. Und sieh dir dein Haar an. Es ist völlig zerzaust. Gib mir diesen Kamm.« Maud strich durch Indias blonde Mähne, nahm sie zusammen und steckte sie fest. Dann trat sie zurück, um ihr Werk zu begutachten. «Sehr hübsch«, sagte sie.
India lächelte und versuchte, die Geste gebührend zu würdigen. Dergleichen galt als Ausdruck von Zuneigung zwischen ihnen.
Mauds Blick glitt über Indias Kleidung. Sie runzelte die Stirn. »Willst du das wirklich fürs Connaught anbehalten?«
India glättete ihren Rock. »Was stimmt nicht damit?«
»Ich dachte, du hättest dir vielleicht was zum Umziehen mitgebracht. Diese Sachen sehen so … trübselig aus. Als wolltest du zu einer Beerdigung.«
»Du hörst dich genau an wie Mama.«
»Das tue ich nicht.«
»Doch.«
Während Maud weiterhin jede Ähnlichkeit mit ihrer Mutter bestritt, zog India ihre Jacke an und setzte ihren Hut auf. Dann nahm sie ihren schwarzen Talar und ihren Arztkoffer und folgte ihrer Schwester zur Treppe. An der Tür drehte sie sich ein letztes Mal um, um auf ihren Vorlesungssaal, die Bücher, die Schautafeln und Demonstrationsobjekte zu blicken und ein leises Lebewohl zu flüstern. Ihre Augen waren jetzt klar, ihr Gesichtsausdruck ruhig. Sie war wieder sie selbst. Kühl und gefaßt. Energisch und vernünftig. Alle Gefühle unter Kontrolle.
»Weiter so, Jones«, schien Ponsonby zu flüstern. »Vergiß nicht: Gefühle vernebeln das Urteil.«
Und so viel mehr, alter Junge, dachte India, und so viel mehr.
2
Joseph Bristow stieg die Stufen zum Grosvenor Square Num mer 94 hinauf, seinem riesigen Herrenhaus in Mayfair. Sein Zug war früh in King’s Cross eingetroffen. Es war Sonntag und erst ein Uhr. Die Köchin hatte vermutlich gerade erst das Essen hinaufgeschickt. Er hoffte, es gab Lammkeule oder Roastbeef mit Yorkshire-Pudding. Eine Woche lang war er in Brighton gewesen, um nach einem Ort für einen neuen Laden der Montague-Kette zu suchen. Dabei hatte er sein Zuhause und die heimische Küche sehr vermißt, doch am meisten seine Familie. Er konnte es kaum erwarten, Fiona und seine kleine Tochter Katie zu sehen. Gerade, als er die Hand heben wollte, um zu klingeln, wurde die Tür geöffnet.
»Willkommen zu Hause, Sir. Darf ich Ihnen Ihre Sachen abnehmen?« fragte Foster, der Butler.
»Hallo, Mr. Foster. Wie geht’s?«
»Sehr gut, Sir. Danke der Nachfrage.«
Joe wollte gerade fragen, wo Fiona sei, als zwei Foxterrier vorbeiflitzten. »Seit wann haben wir Hunde?« fragte er.
»Sie sind neu, Sir. Sie wurden im Park ausgesetzt und bettelten um Futter. Mrs. Bristow hat sie mit nach Hause genommen.«
»Warum überrascht mich das nicht?« sagte Joe und schüttelte den Kopf. »Haben sie Namen?«
»Lipton und Twining«, antwortete Foster. »Mrs. Bristow findet, sie sind wie ihre Konkurrenz. Hängen ihr immer an den Fersen.«
Joe lachte. Er beobachtete die Hunde, die raufend und bellend durch die Eingangshalle jagten.
»Wenn Sie mich entschuldigen wollen, Sir …«, bat Foster und eilte den Hunden hinterher.
»Wo ist meine Frau, Mr. Foster?« rief Joe ihm nach.
»Im Garten, Sir. Sie gibt eine Party.«
»Eine Party?«
»Ein Mittagessen, um Geld für die Toynbee-Mädchenschule zu sammeln.«
»Sie hat mir nichts von einer Party gesagt.«
»Mrs. Bristow hat auch erst vor drei Tagen davon erfahren. Der Reverend und Mrs. Barnett sind auf sie zugekommen. Wie es scheint, ist ein Teil des Schuldachs eingestürzt. Ein Wasserschaden, glaube ich.«
»Noch eine Unglücksgeschichte.«
»Die scheinen ihre Spezialität zu sein.«
»Irgendeine Chance, hier etwas zu essen zu kriegen?«
»Im Garten werden Erfrischungen gereicht, Sir.«
Joe machte sich auf den Weg zur Rückseite seines Hauses. Er ging in seinen sonnenbeschienenen Garten und rechnete damit, dort etwa zwanzig Leute vorzufinden. Entsprechend überrascht war er daher, daß es über hundert waren. Seltsamerweise waren alle mucksmäuschen still. Bald erkannte er, warum. Am anderen Ende des Gartens standen etwa vierzig Mädchen zwischen zehn und sechzehn Jahren, umgeben von einer atemberaubenden Blütenpracht roséfarbener Rosen, alle frisch gewaschen und gekämmt und in gebrauchte Röcke und Blusen gekleidet. Eine von ihnen begann zu singen, und der Rest stimmte ein. Sie trugen »Come into the Garden, Maud« vor. Einige der Zuhörer tupften sich die Augen.
»Fiona, Mädchen, du bist schamlos«, flüsterte Joe. Er suchte die Menschenmenge nach ihr ab. Er sah sie nicht sofort, entdeckte aber viele bekannte Gesichter. Industriekapitäne, adlige Damen, Politiker – Fiona brachte sie alle zusammen. Händler mischten sich unter Grafen, Schauspielerinnen unter Minister, Sozialisten unter Gesellschaftslöwen. Die Klatschpresse äußerte sich abfällig über Joes und Fionas Cockney-Mundart und machte sich darüber lustig, daß Grosvenor Square Nummer 94 das einzige Haus in Mayfair sei, wo der Butler besser Englisch sprach als seine Herrschaft. Trotzdem rissen sich alle um Einladungen zu Fionas Partys, denn sie galten als todschick.
Die Leute vergnügten sich in ihrem Haus. Man lachte, tratschte und diskutierte. Man bekam gutes Essen und den besten Wein, doch was selbst den hochnäsigsten Kritiker überzeugte, war Fiona selbst. Sie war direkt und entwaffnend und ging mit Scheuerfrauen genauso gelassen um wie mit Herzoginnen. Als Chefin eines internationalen Tee-Imperiums – und eine der reichsten Frauen der Welt – übte sie einen ganz besonderen Reiz aus. Ständig wurde über sie geredet: daß sie aus dem Nichts nach oben gekommen war. Daß man ihren Vater, einen Dockarbeiter, und ihre Mutter ermordet hatte. Wie sie aus London geflohen war und in New York die Aufmerksamkeit eines skrupellosen Kapitalisten erobert, aber einen Grafen geheiratet hatte. Er sei gestorben, aber sie trage immer noch seinen Diamanten. »Es gab keine Kinder, Liebste. Er war andersherum, verstehst du.« Und das Staunen wurde noch größer, wenn die Sprache auf die kühne Übernahme des Teegeschäfts ihres Konkurrenten kam. »Das hat sie aus Rache getan, meine Liebe. Der Mann hat ihren Vater ermordet und versucht, sie zu töten! Kannst du dir das vorstellen?«
Sargent bedrängte sie, sich von ihm malen zu lassen. Escoffier benannte ein Dessert nach ihr. Als Worth einen Rock und eine Jacke »Fiona-Ensemble« taufte, rannten die Damen zu ihren Schneiderinnen, um es kopieren zu lassen. Bei Tee und Kuchen in den Salons wurde geflüstert, sie trage kein Korsett. Bei Portwein und Stilton-Käse in Herrenclubs wurde lauthals verkündet, daß sie keines brauche, weil sie eigentlich ein Mann sei.
Joe entdeckte seine Frau schließlich am Rand des Gartens, wo sie auf einem Stuhl saß. Als die Mädchen mit ihrem Lied fertig waren, stand sie auf und wandte sich an ihre Gäste.
»Meine Damen und Herren«, begann sie. »Die schönen Stimmen, die Sie gerade gehört haben, gehören den Kindern der Toynbee-Mädchenschule. Jetzt bitte ich Sie, einer weniger lieblichen Stimme zu lauschen … meiner eigenen.« Es gab Gelächter und fröhliche Zwischenrufe. »Diese Mädchen kommen aus Familien mit weniger als einem Pfund Einkommen in der Woche. Stellen Sie sich eine Familie mit sechs Personen vor, die eine Woche lang von dem lebt, was einige von uns für Illustrierte oder Schokolade ausgeben. Wegen ihrer außerordentlichen Intelligenz wurden diese Mädchen an einer Schule aufgenommen, wo sie einen Beruf erlernen, der ihnen einen Weg aus der Armut eröffnet. Als der Reverend und Mrs. Barnett mir sagten, daß sich die Kinder aneinanderdrängen müssen, um dem Regen zu entgehen, der durch das beschädigte Dach dringt, wußte ich, daß jeder von Ihnen darüber genauso außer sich sein würde, wie ich es bin.« Sie machte erneut eine Pause. Rufe des Bedauerns wurden laut. »Es wird dringend ein neues Dach benötigt, aber das Dach ist erst der Anfang. Sobald wir es haben, brauchen wir mehr Schulbänke. Und Tafeln. Und Bücher. Wir brauchen mehr Lehrer und das Geld, sie zu bezahlen. Vor allem brauchen wir Sie. Wir sind auf Ihre beständige Hilfe und Großzügigkeit angewiesen, um die Anzahl und Art der Kurse zu erweitern. Wir haben Haushälterinnen, Erzieherinnen und Köchinnen ausgebildet. Jetzt müssen wir mehr tun. Wir müssen Ladenbesitzerinnen anstelle von Ladenmädchen hervorbringen, Unternehmensleiterinnen anstelle von Sekretärinnen, Firmenchefinnen anstelle der Stückarbeiterinnen. Vielleicht sogar die eine oder andere Teehändlerin, nicht wahr, Sir Tom?« sagte sie und zwinkerte Thomas Lipton zu.
»Gütiger Gott, nicht noch eine!« rief Lipton.
»Mathematik, Ökonomie, Rechnungswesen … ja, das sind ungewöhnliche Fächer für Mädchen, aber was sollen wir sie lehren? Warum erziehen wir sie? Damit sie in einem kalten Zimmer bei Kerzenlicht Shakespeare lesen können, nachdem irgendeine Knochenmühle geschlossen hat? Nein, wenn sie den Teufelskreis der Armut durchbrechen wollen, brauchen sie bessere Jobs, bessere Löhne, bessere Möglichkeiten …«
Joe betrachtete seine Frau, während sie sprach, und dachte – wie schon viele Male zuvor –, daß er nie eine faszinierendere Person gesehen hatte. Sie kannten sich seit ihrer Kindheit, und sie schien an Schönheit nichts einzubüßen, im Gegenteil. Sie trug eine weiße Bluse und eine himmelblaue Seidenjacke. Der dazu passende Rock war geschickt geschnitten, um ihren sich rundenden Bauch zu kaschieren. Sie war im dritten Monat mit ihrem zweiten Kind schwanger und strahlte vor Gesundheit. Ihr dichtes schwarzes Haar war nach oben gekämmt und mit Perlenkämmen festgesteckt. Ihr Teint leuchtete von dem sonnigen Tag, und ihre unvergleichlichen saphirblauen Augen blitzten vor Mitgefühl. Niemand plauderte oder rutschte unruhig herum, während sie sprach. Alle Blicke waren auf sie gerichtet.
Stolz überkam ihn, als er sie beobachtete, aber auch eine gewisse Sorge. Unter ihren blauen Auge lagen dunkle Ringe, und ihr hübsches Gesicht wirkte schmal. Sie mutet sich zuviel zu, dachte er. Sie hielt einen strapaziösen Stundenplan ein, stand um fünf Uhr auf, arbeitete in ihrem Arbeitszimmer bis um acht, frühstückte mit Katie und ihm und fuhr dann in ihr Büro in der Mincing Lane. Fast immer war sie rechtzeitig zu Katies Abendtee zurück und machte sich dann erneut bis um neun an die Arbeit, wonach sie und Joe sich zum Abendessen einfanden, ein Glas Wein tranken und Einzelheiten ihres Tages austauschten. Zudem fand sie irgendwie immer noch die Zeit, sich für ihre Wohltätigkeitsorganisation – die Ostlondoner Hilfsgesellschaft – einzusetzen und für die Schulen, Waisenhäuser und Suppenküchen, die sie unterstützte.
Oft sagte er ihr, daß die Probleme im Londoner Osten viel zu groß seien, um von einer einzelnen Frau gelöst zu werden, und daß alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein sei. Er erklärte ihr, daß wirkliche Hilfe von oben, von der Regierung, kommen müsse. Programme müßten aufgestellt werden, um den Armen zu helfen, und das Parlament müsse Gelder bewilligen, um sie zu finanzieren. Fiona pflegte dann einsichtig zu lächeln und sagte, er habe natürlich recht, aber bei irgendeiner Suppenküche habe sich eine Schlange gebildet, die die ganze Straße hinunterreiche, und ob er und seine Kollegen Gemüse und Obst spenden würden, wenn sie einen Wagen nach Covent Garden schicke? Dazu erklärte er sich immer bereit, und dann ermahnte er sie, nicht mehr soviel zu arbeiten oder zumindest ein wenig kürzer zu treten, aber sie hörte nie auf ihn.
Fiona beendete unter heftigem Beifall ihre Rede und wurde von Leuten umringt, die begierig einen Beitrag leisten wollten. Joe, der immer noch laut klatschte, spürte plötzlich eine Hand auf seinem Rücken.
»Alter Junge!«
Es war Freddie Lytton, der Abgeordnete für Tower Hamlets, ein Bezirk, der Whitechapel einschloß, wo die Schule der Mädchen lag. Joe fragte sich, was er hier machte, da er bezweifelte, daß Freddie spenden wollte. Fiona hatte ihn viele Male getroffen in der Hoffnung, Regierungsgelder für ihre verschiedenen Anliegen zu bekommen, war aber stets mit vagen Versprechungen abgespeist worden.
»Hallo, Freddie«, sagte Joe. »Freut mich, Sie zu sehen.«
»Toll gemacht«, erwiderte Freddie und nahm einen kräftigen Schluck Champagner. »Hab’ gehört, Fiona hat zweitausend eingesammelt. Phantastische Summe.«
Joe entschied, ihn gleich festzunageln. »Ein hübsches Sümmchen, nicht? Aber noch schöner wär’s, wenn die Regierung einsteigen würde. Besteht da irgendeine Chance?«
»Zufällig haben mich der Reverend und Mrs. Barnett ebenfalls aufgesucht. Ich hab’ im Unterhaus eine Eingabe gemacht – für fünfhundert Pfund – und mich verdammt stark gemacht dafür, wenn ich so sagen darf«, antwortete Freddie aalglatt. »Hab’ wirklich Druck gemacht. Ich erwarte jeden Tag eine Antwort.«
Joe ließ sich nicht so einfach abfertigen. Seiner Meinung nach setzte sich seine Frau für die Kinder von Whitechapel weitaus stärker ein als der gewählte Vertreter des Bezirks, und das ärgerte ihn.
»Die Morgenzeitungen schreiben, das Parlament habe gerade die Summe von vierzigtausend Pfund bewilligt, um die königlichen Stallungen zu renovieren«, sagte er. »Dann wird es doch wohl fünfhundert für eine Schule auftreiben. Sind Kinder weniger wichtig als Pferde?«
»Natürlich nicht.«
Joe sah ihn scharf an. »Nein, Kinder an sich nicht. Aber arme Kinder sind etwas anderes. Ihre Väter wählen nicht. Können nicht wählen, weil sie nicht genug Geld verdienen. Gott steh euch bei, wenn sie es können. Dann verliert ihr alle eure Jobs.«
»Es bedürfte eines weiteren Reformgesetzes, um die Wahlberechtigung auf die gesamte Arbeiterklasse auszudehnen. Und das wird nicht geschehen. Nicht, solange Salisbury ein Auge darauf hat«, erwiderte Freddie wegwerfend.
»Der Premierminister hält sich noch. Aber er bleibt uns nicht ewig erhalten, genausowenig wie seine veraltete Politik«, antwortete Joe, wütend über Freddies herablassenden Tonfall. »Vielleicht gesteht die Regierung eines Tages allen Bürgern eine Stimme zu. Den Armen wie den Reichen.«
»Die Regierungspolitik sollte denjenigen vorbehalten bleiben, die sie am besten verstehen«, sagte Freddie.
»Die Regierungspolitik sollte von denjenigen entschieden werden, die sie erleiden müssen, Kumpel.«
»Sie meinen also, daß jeder Mann – jeder hergelaufene Hohlkopf – in der Regierung eine Stimme haben sollte?«
»Warum nicht? Viele haben das doch schon.«
»Oh, touché, alter Junge. Touché«, sagte Freddie. Obwohl sein Mund lächelte, blitzte plötzlich etwas Hartes und Bedrohliches in seinen Augen auf, doch ebenso rasch war es wieder verschwunden, und Freddie war wieder genauso aalglatt und höflich wie immer.
»Hören Sie, Joe, wir stehen doch eigentlich auf derselben Seite.«
Joe schnaubte.
»Doch, das tun wir. Wir sorgen uns beide um den Londoner Osten, um seine Einwohner und seine Aussichten, oder?«
»Ja, aber …«
»Das wußte ich doch. Deshalb bin ich hier, Joe. Ich wollte mit Ihnen reden. Man spricht davon, daß es im September allgemeine Wahlen geben soll, wissen Sie …«
Ah, darum geht’s, dachte Joe. Er wußte, daß Freddie nicht gekommen war, um »Come into the Garden, Maud« zu hören.
»… und die Tories sind sicher, daß sie gewinnen. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich brauche Ihre Unterstützung, um in Tower Hamlets den Sitz für die Liberalen zu halten. Wir müssen wie ein Bollwerk gegen die Tories zusammenstehen.«
Joe zog eine Augenbraue hoch. »Wer ist wir?«
»Die Oberklasse.«
»Zählen Sie mich zu dieser Gruppe nicht dazu, Kumpel.«
»Zu welcher Gruppe soll man dich nicht zählen?« fragte eine weibliche Stimme. Fiona war zu ihnen getreten. Sie drückte Joes Hand und lächelte ihn strahlend an.
»Ihr Mann ist sehr bescheiden, Fiona – toller Auftritt übrigens –, ich habe ihm gerade gesagt, daß er jetzt ein Mitglied der Oberklasse ist. Einer der gesellschaftlichen Führer.«
»Freddie, ich bin kein …«, begann Joe.
»Doch, doch«, unterbrach Freddie ihn, als hätte er seine Gedanken gelesen. »Sie stammen zwar aus der Arbeiterklasse, sind aber kein Teil mehr von ihr. Sie haben es aus eigener Kraft zu etwas gebracht. Eigentümer der größten Ladenkette im Land und des größten Lebensmittelkonzerns gleichzeitig, und das alles aus eigenen Stücken.«
»Mein Gott, Freddie, steigen Sie doch von Ihrer Seifenkiste runter«, sagte Joe. »Was wollen Sie?«
»Ich möchte Ihre Unterstützung. Ihre und Fionas.«
»Meine? Aber ich kann doch nicht einmal wählen«, rief Fiona.
»Aber Sie haben Einfluß«, antwortete Freddie. »Sie haben Fabriken und Lagerhäuser im Osten von London, Sie beide. Sie beschäftigen dort Hunderte von Männern, von denen viele das Stimmrecht haben. Ich brauche diese Stimmen. Ich habe den Sitz als Konservativer gewonnen und dann die Seiten gewechselt. Die Tories wollen ihn zurück. Dickie Lambert ist ihr Mann, und der ist verdammt aggressiv. Er will mir einen echten Kampf liefern. Er geht schon auf Stimmenfang in den Pubs, obwohl es bislang noch ein Gerücht ist, daß es Wahlen geben soll.«
»Wie kommen Sie darauf, daß Arbeiter nicht Labour wählen?«
Freddie lachte auf Fionas Frage. »Sie machen wohl Scherze. Das ist doch bloß ein Haufen verrückter Marxisten! Die nimmt doch keiner ernst.«
»Ich denke, unsere Arbeiter können sich ihre Kandidaten selbst aussuchen«, sagte Joe. »Dazu brauchen sie uns nicht.«
»Aber sicher doch. Sie sind ein Vorbild für sie. Sie sehen zu Ihnen auf, möchten so sein wie Sie, das gleiche erreichen.«
»Und was werden Sie für sie tun?« fragte Fiona.
»Mit privaten Unternehmen zusammenarbeiten, um mehr Kapital in den Osten von London zu bringen. Mehr Raffinerien, Brauereien, Fabriken. Wir bieten Anreize für Geschäftsleute – Steuernachlässe zum Beispiel –, um sie dort anzusiedeln.«
»Das macht doch nur die Fabrikbesitzer reicher.«
»Darum geht’s doch nicht«, erwiderte Freddie ungeduldig. »Es wird mehr Fabriken geben, und das bedeutet mehr Jobs.«
Joe schüttelte erstaunt den Kopf. Freddies mangelndes Wissen über seine eigene Wählerschaft war verblüffend. Sogar beleidigend. »Ja, aber was für Jobs?« fragte er mit erhobener Stimme. »Die Marmeladefabrik, die Streichholzfabrik, die Färberei, die Docks – die zahlen doch nichts. Die armen Teufel, die solche Arbeit annehmen, schuften sechs Tage vom Morgengrauen bis in die Nacht und müssen sich immer noch fragen, ob sie lieber Kohle oder Essen kaufen sollen.«
Freddie sah Joe mitleidig an, als wäre er ein zurückgebliebenes Kind. »Es ist sicher nicht die Schuld der Regierung, wenn ein Mann sein Geld nicht einteilen kann.«
»Aber da gibt’s kein verdammtes Geld einzuteilen!« bellte Joe.
»Es gibt genügend Geld, um die Pubs am Laufen zu halten. Das ist eine Tatsache«, erwiderte Freddie. »Ich hab’ in dem Viertel die schlimmsten Auswüchse festgestellt. Und das ist ein Weiteres, was die Liberalen für das East End tun wollen – Recht und Ordnung durchsetzen. Ich persönlich werde mich darum kümmern, daß die Verbrechensrate sinkt. Damit habe ich bereits angefangen. Ich habe mehr Polizisten auf die Straßen geschickt und auch mit Flußpatrouillen begonnen. Außerdem setze ich mich für schärfere Strafen für Missetäter ein.«
»Das sagt jeder Politiker«, erwiderte Joe.
»Aber nicht jeder Politiker meint es auch. Ich bin hinter Sid Malone her, wissen Sie. Ja, Malone.«
Joe gab es einen Stich, als er den Namen hörte. Er warf einen verstohlenen Blick auf Fiona. Sie fing seinen Blick auf und bedeutete ihm, sich nichts anmerken zu lassen. Schnell sah er wieder zu Freddie. Falls dem etwas aufgefallen sein sollte, ließ er sich nichts anmerken.
»Ich hab’ ihn noch nicht erwischt«, fuhr er fort, »aber das werdeich. Ich werde an ihm ein Exempel statuieren. Er wird einen Fehler machen. Das machen sie alle. Er wird jemanden bei einem Raub verletzen oder jemanden töten, und dann laß ich ihn hängen. Darauf haben Sie mein Wort.«
Fiona war inzwischen so blaß geworden, daß Joe Angst um sie hatte. Er nahm ihren Arm und wollte sie zu einem Stuhl führen, als Foster plötzlich neben ihm auftauchte. Joe hörte ihn flüstern, daß Besuch für sie gekommen sei.
»Bitten Sie ihn, zu uns herauszukommen«, sagte sie.
»Lieber nicht, Madam«, antwortete Foster und deutete mit dem Kopf auf die Glaswand des Wintergartens.
Joe folgte seinem Blick und sah einen ihm unbekannten Mann dort stehen. Er trug einen schlechtsitzenden Anzug und hatte einen Arm in der Schlinge. Joe fand ihn sofort unsympathisch, doch als er Fiona fragen wollte, wer das sei, entschuldigte sie sich bereits.
»Etwas Geschäftliches«, sagte sie knapp. »Nur ganz kurz.«
Ein unangenehmes Gefühl beschlich Joe. Er war sehr fürsorglich, was seine Frau anbelangte – überfürsorglich, wie sie behauptete. Er hatte keine Ahnung, warum, aber er wollte Fiona aufhalten und wäre ihr fast nachgegangen, doch dann richtete Freddie das Wort an ihn. Er sah, wie Fiona die Hand des Fremden schüttelte.
»Tut mir leid, Freddie, was haben Sie gesagt?«
»Ich sagte, wenn Malone gehängt würde, wäre das ein starkes Signal an die Diebe und Mörder im Londoner Osten.«
»Recht und Ordnung sind gut und schön, aber nicht die wirkliche Lösung. Trunkenheit, Gewalt und Verbrechen … das rührt doch alles von einem her – der Armut. Beheben Sie die, dann lösen Sie auch sämtliche anderen Probleme.«
Freddie lachte. »Wissen Sie, alter Junge, Sie hören sich zunehmend an wie einer dieser verrückten Sozialisten. Wie soll denn die Regierung Ihrer Meinung nach die Armut beheben? Etwa die Tore der Königlichen Münzstätte öffnen und Guineen ausgeben?«
Aus Joes unterdrücktem Unbehagen wurde offene Wut. Er erin-nerte sich jedoch, daß Freddie Gast in seinem Haus war, und sagte: »Wie wär’s denn damit: Geben Sie den Arbeitern anständigen Lohn. Geben Sie ihnen eine Entschädigung, wenn sie sich bei der Arbeit verletzen, damit ihre Familien nicht hungern müssen. Bieten Sie ihren Kindern eine ordentliche Ausbildung, damit sie bessere Aussichten haben als die Schufterei in einer Fabrik oder in den Docks. Sie wollen diese Wahlen wirklich gewinnen, Freddie? Das ist einfach. Bieten Sie Ihren Wählern Hoffnung.«
Dann entschuldigte er sich und sah wieder zum Wintergarten hinüber. Fiona und ihr Besucher waren nirgendwo zu sehen. Seine Unruhe verwandelte sich in Furcht. Er ging ins Haus und rief Foster. »Wo ist Mrs. Bristow?« fragte er knapp.
»Mit dem Besuch im Arbeitszimmer, Sir.«
»Wer ist dieser Kerl? Was will er hier?«
»Sein Name ist Michael Bennett, Sir. Den Grund seines Besuchs hat er nicht genannt.«
Joe eilte zur Treppe. Die Sache gefiel ihm nicht. Kein anständiger Besucher zögerte, den Grund seines Besuchs anzugeben. Er nahm zwei Stufen auf einmal und wünschte, er wäre gleich seinem Instinkt gefolgt, statt mit Freddie zu streiten. Er klopfte an und öffnete die Tür, ohne auf eine Antwort zu warten. Fiona saß an ihrem Schreibtisch. Ihre Augen waren rot, und sie knüllte ein Taschentuch in der Hand. Michael Bennet saß ihr gegenüber.
»Fiona, was geht hier vor?« fragte Joe, und zu Bennett gewandt: »Wer zum Teufel sind Sie?«
»Schon gut«, sagte Fiona. »Das ist Michael Bennett. Er ist Privatdetektiv.«
»Ein Detektiv? Wozu brauchst du einen Detektiv?«
Fiona sah zur Seite und sagte dann: »Um Charlie zu finden.«
Joes Miene verhärtete sich. »Wieviel schulden wir Ihnen?« fragte er, an Bennett gewandt.