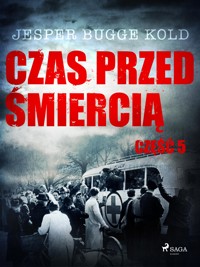Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Fünf Menschenschicksale im Zweiten Weltkrieg, spannend, tragisch und verstörend miteinander verbunden. Die Zeit vor dem Tod ist ein spannender Roman über einen dänischen Polizisten, einen englischen Fliegerbomber-Piloten, ein zwölfjähriges Mädchen und einen deutschen und einen russischen Soldaten, die schicksalhaft im Zweiten Weltkrieg miteinander verbunden sind. Alle kämpfen einen mutigen Kampf, um in den Wirren des Krieges überleben zu können – aber letzten Endes sind es simple Zufälle, die über ihr Schicksal bestimmen."Eine schreckliche, ans Herz gehende Geschichte über einen Krieg, den niemand vergessen darf." - Camilla Mader Laugesen"Ein seltenes Buch ... ein Meisterstück." - Fyens Stiftstidende-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Jesper Bugge Kold
Die Zeit vor dem Tod
Aus dem Dänischen von Patrick Zöller
Saga
Die Zeit vor dem TodCopyright © 2018, 2019 Jesper Bugge Kold and und SAGA EgmontAll rights reservedISBN: 9788726071306
1. Ebook-Auflage, 2019Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nachAbsprache mit SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk– a part of Egmont www.egmont.com
Teil 1
Sanft und mit behaglichem Schmatzen schwappt das Wasser gegen den Rumpf des Schiffes. Normalerweise beruhigt das Geräusch Axel, aber nicht heute. Sonst erinnert es ihn an Sonnenstrahlen im Sommer, an Opas Jolle, daran, wie sie zusammen Netze ausgelegt und zur Südspitze Schwedens, die man deutlich sehen konnte, rübergeschaut haben, wie sie ihre Lunchpakete gemampft und Zitronensaft dazu getrunken haben. Aber in Zukunft wird er etwas anderes mit dem Geräusch verbinden: Unsicherheit und Angst.
Er hätte es ahnen müssen. Poul, Keld und einige der anderen, die von den Nazis so begeistert sind, waren kurz vor dem Fliegeralarm aus dem Polizeipräsidium verschwunden. Im Nachhinein entpuppten sich ihre „dienstlichen Belange“ als faule Ausreden. Als die Sirenen losheulten, hörte Axel Explosionen, lautes Rufen und Schüsse. Jeder Widerstand war zwecklos, die Deutschen hatten das Präsidium umstellt und sie hatten Maschinengewehre und Panzerfäuste.
Ohne Rücksicht auf ihren polizeilichen Rang mussten sie sich in Reihen aufstellen. Axel stand hinter Inspektor Ruggård, aber in diesem Moment waren sie gleich. Der sonst so barsche Inspektor schien wie verwandelt. Mit krummem Rücken stand er da wie eine zusammengesunkene Marionette, und als einer der Soldaten einige Warnschüsse in die Luft abfeuerte, um für Ruhe zu sorgen, zuckte Ruggård zusammen wie ein verängstigtes Kind. In diesem Augenblick wurde allen klar, wie ernst ihre Lage war.
Sie wurden gefilzt und entwaffnet und stundenlang ließ man sie im kreisrunden Innenhof des Präsidiums stehen und warten. Dann wurden sie auf die Otto Mønsteds Gade gedrängt und auf Lastwagen gescheucht, die bereit standen. Auf den Ladeflächen empfingen deutsche Soldaten sie, mit entsicherten Maschinenpistolen im Anschlag.
Die Lastwagen setzten sich in Bewegung, rumpelten durch die Straßen der Kopenhagener Innenstadt, Vestre Boulevard, Nørre Voldgade, Østre Voldgade, an der Schwedischen Kirche vorbei. Die Stadt zog vor ihren Augen vorüber. Das Tor zum Freihafen. Am Ende des Langelinjekais lag ein Schiff, M/S Cometa konnte Axel am Achtersteven entziffern. Sie warteten darauf an Bord gelassen zu werden. Sie waren die Ladung.
Sie sind viel zu viele hier unten im Laderaum. Axel versucht, eine erträgliche Position zu finden, kann sich aber so gut wie nicht bewegen. Wie Jutesäcke werden sie gestapelt. Im Vorschiff ist sehr wenig Platz. Sie können nicht stehen, sie können nicht sitzen. Ihre Rücken stoßen aneinander, ihre Beine verhaken sich. Fast liegen sie übereinander.
Das Schiff befindet sich noch im Hafen. Es ist Abend und sie haben Angst. Einige meinen, man werde sie nach Bornholm bringen, einige meinen nach Deutschland. Wieder andere glauben, das Schiff werde auf offener See versenkt, mitsamt seiner Ladung. Mit ihnen.
Er denkt, dass der Meeresgrund immer noch besser ist als Deutschland. Alle haben die Gerüchte über die Konzentrationslager gehört und es sind zu viele, als dass es bloße Schauergeschichten sein könnten. Wenn sie dort landen, wird Axel wahrscheinlich nicht zurückkehren.
Er sieht Kamma vor sich. Sie lehnt sich gegen den Küchentisch. Eine Hand auf dem stetig wachsenden Bauch. Seine Hand auf ihrer Hand. Bald wird ihre kleine Wohnung Zuwachs bekommen. Der Gedanke, dass er heute nicht von der Arbeit nach Hause kommen wird, dass er nicht an seinem gewohnten Platz am Tisch sitzen und sein Abendessen zu sich nehmen wird, Kamma sich nicht an ihn schmiegen wird, brennt als beißender Schmerz in seiner Magengrube. Wann er sie wohl wiedersehen wird? Wird sie erfahren, was mit ihm geschehen ist? Und was wird mit ihm geschehen?
Die Ladeluken sind fest verschlossen. Nicht lange, und die Luft wird stickig. Sie hat kaum noch Energie in sich, ist warm und drückend. Es stinkt nach Motoröl und zusammengepferchten Menschen. Axel hält sich den Ärmel vor Mund und Nase. Neben ihm ringt Johannes nach Luft. Es dringt keinerlei frische Luft hier nach unten. Sie wird nur immer schwerer und schlechter. Einige werden ohnmächtig.
„Macht endlich die Luken auf, zum Teufel!“ Mit aller Kraft schlägt Axel gegen die Schiffswand. „Wir kriegen keine Luft.“
Johannes stöhnt und schnappt krampfhaft nach Luft.
„Helft mir“, sagt Axel.
Während Erik Johannes stützt, löst Axel die Krawatte des älteren Polizeihauptwachtmeisters und knöpft dessen Hemd auf. Johannes' Gesicht ist feuerrot. Seine Hände fuchteln, als wolle er sich irgendwo festhalten. Ein pfeifender Laut ist zu hören, jedes Mal wenn er versucht einzuatmen. Axel fasst seine Hand und Johannes drückt sie fest und lange. Er beruhigt sich ein wenig. Plötzlich folgt ein lauter, langgezogener Atemzug, dann ein Keuchen und der Körper bewegt sich nicht mehr. Johannes ist tot.
Lange sitzen sie da, zwischen sich den toten Polizeihauptwachtmeister. Er wird nur einer von vielen sein, denkt Axel. Wen wird es als Nächsten treffen?
Erik hat seine Uhr noch. Es ist Nacht, als ein paar Soldaten Johannes' Leiche wegschaffen. Die wenigen Momente, in denen die Ladeluke geöffnet ist, saugen alle gierig die Luft ein. Oben auf Deck sind Rufe zu hören und jemand schießt. Das Schiff schlägt gegen den Kai. Alle fallen durcheinander und Axel verkeilt sich mit Erik und einem jüngeren Kollegen. Das Schiff setzt sich in Bewegung. Dumpf vor sich hin hämmernd arbeitet der Motor und ein schwerer Geruch nach Öl breitet sich wieder im Laderaum aus.
Stoisch stampft das Schiff durch die Nacht. Niemand schläft und die Nacht ist unendlich lang. Erst am nächsten Vormittag bekommen sie etwas zu essen. Brot, ein wenig Wurst und Wasser. In kleinen Gruppen dürfen sie an Deck und frische Luft schnappen. Axel wartet den ganzen Tag lang. Als er an der Reihe ist, versinkt am Horizont gerade die Sonne. Es ist ein schöner Anblick.
Zurück im Laderaum versucht er vor Augen zu behalten, was er eben gesehen hat. Plötzlich werden die Luken geschlossen. Um sie herum ist alles stockdunkel. Er kann die Ankerkette hören, die rasselnd nach unten fällt, dann den Anker, der mit einem Platschen im Wasser versinkt. Nicht weit von ihm versucht jemand ein Schluchzen zu unterdrücken.
Noch eine Nacht vergeht, ohne Schlaf und quälend langsam. Dann das Geräusch des Ankerspills und das Schiff setzt sich in Bewegung. Ein paar Stunden später spürt er, wie der Rumpf an einem Kai andockt. Die Ladeluken werden geöffnet und sie dürfen nach oben ins Freie.
Axel tippt Erik auf die Schulter. Er soll fragen, denn er kann Deutsch. Erik will nicht, aber Axel überzeugt ihn davon, dass sie wissen müssen, wo sie sich befinden. Widerwillig wendet sein Kollege sich an einen jungen Matrosen.
„Wo sind wir?“
„Lübeck“, lautet die kurze Antwort.
Axels schlimmste Befürchtungen sind wahr geworden. Sie sind in Deutschland.
Die Lichtkegel der Scheinwerfer schneiden große Löcher in die Dunkelheit. Sie sind an den Gebäuden auf dem Kai angebracht, wie Augen, die sie überwachen. Dann treffen die Lichter Axel und bohren sich in ihn hinein, sodass es fast körperlich wehtut. Sie finden ihn unter den anderen und fixieren seine riesenhafte Gestalt auf den Deckplanken des Schiffs.
Der Kai ist mit mehreren Reihen Stacheldraht eingezäunt. Gänge und Wege führen hindurch wie in einem verwinkelten Dorf aus spitzem, scharfkantigen Metall. Wie angewurzelt steht er da, paralysiert von dem ungastlichen Empfang.
Überall sind Soldaten und sie sehen alle gleich aus: starrende Augen unter dem Rand eines Stahlhelms, Maschinenpistole an die Hüfte gedrückt, den Finger am Abzug. Die Scheinwerfer projizieren ein glänzendes Licht auf ihre Uniformen. Ihre Bewegungen sind schnell und fieberhaft, ein Ellbogen stößt Axel unnötig hart in den Rücken.
Die Gefangenen steigen die Leiter hinunter. Eine lange Reihe verstörter Männer. Axels Beine zittern. Er muss sich aufs Gehen konzentrieren. Die Schritte, die seit seiner Kindheit das Einfachste von der Welt zu sein schienen, verlangen ihm jetzt große Anstrengung ab. Aber die Uniformen zwingen ihn zu gehen. Sie brüllen ihn vorwärts.
Ein Hund knurrt ihn an, als er zögert, ein bissiges, gefährliches Knurren, und er gerät ins Stolpern und fällt. Gefletschte Zähne, von denen der Geifer tropft, direkt vor seinem Gesicht, ein Schlund, bereit, ihn in Stücke zu reißen. Auf den Knien zieht er sich zurück. Ein Soldat reißt energisch an der Hundeleine und wimmernd verschwindet der Schlund.
Der Soldat greift ihm unter den Arm und hilft ihm hoch. Überrascht von der plötzlichen Freundlichkeit, will er dem Soldaten zulächeln, doch der Mann ist schon zu weit weg.
Der Kai ist ein einziges Wirrwarr aus Soldaten und Gefangenen, die vorwärts getrieben werden. Die Soldaten brüllen Befehle nach links und rechts. „Los, los.“ Die Gefangenen sind stumm.
Die Beine bewegen sich automatisch vorwärts. Er vermeidet jeden Blickkontakt, blickt starr auf den Rücken vor sich. Es ist Eriks Rücken. Der Anblick seines Kollegen steigert seine Angst. Sie sind alle hier. Zu Hause sitzen ihre Frauen in Ungewissheit. Vielleicht haben die Zeitungen etwas geschrieben oder vielleicht wissen sie absolut nichts darüber, was mit ihren Männern passiert ist? Zu Hause wartet Kamma.
Ein Stück entfernt kann er undeutliche Konturen erahnen. Dunkle Rechtecke. Es sind Waggons, ein Zug, zu dem er und die anderen Gefangenen getrieben werden. Endlich wird er sich setzen können, vielleicht den Kopf an eine Scheibe lehnen und sich ausruhen können. Er wird an Kamma denken. An ihre Berührung, ihre Hand, die über seine Wange streichelt, die Fingerspitzen, die ihn am Ohr kitzeln. Er wird sie anschauen. Einen Schritt zurücktreten und sie betrachten. Ihren runden Bauch, die weichen Gesichtszüge, die Augen, die ihn ansehen, wie sonst niemand es kann.
Ohne es zu bemerken, ist er stehen geblieben. Der Gedanke ist es, der ihn dazu bringt. Nie zuvor war er von etwas so überzeugt, selten einmal hat etwas ihn mehr erfüllt: Er muss und er wird nach Hause zurückkehren. Dann spürt er den heftigen Stoß eines Gewehrkolbens im Rücken. Der Schmerz zieht wie ein elektrischer Schlag bis in seinen Kopf. Er muss sich an Erik festhalten um nicht zu stürzen. Eine heisere Stimme direkt an seinem Ohr brüllt das einzige Wort, das er gehört hat, seit sie aus dem Laderaum gestiegen sind. „Los!“
Die Waggons haben keine Fenster, nur Gitter, wie in einem Gefängnis. Sie sind nicht dazu gebaut, Menschen zu transportieren, sondern Tiere. Kurz darauf hocken alle Polizisten in den Viehwaggons, eng zusammengepfercht wie im Laderaum des Schiffs. Sie sind zu viele und die Luft ist zu schlecht. Ein strenger Geruch nach Tierexkrementen steigt vom Boden des Waggons auf. Eine stinkende Pfütze schwappt träge über die Bretter und wächst mit jedem Gefangenen, der nichts anders kann, als sich in eine Ecke zu schieben und Wasser zu lassen.
Mit lautem Krachen werden sämtliche Luken geschlossen. Der Waggon wird verriegelt und in einem Gefängnis auf Rädern setzen sie sich in Bewegung.
Die Wände sind aus Holz. Der Wind pfeift durch den Waggon und die Gefangenen, die vorne stehen, bilden unfreiwillig einen Schutzwall für die übrigen. Axel steht an eine der Seitenwände gedrängt und blickt durch die Ritzen zwischen den Bohlen. Die Landschaft zieht vorbei, zerstört und entstellt. Der Krieg hat seine eigene Heimat nicht verschont.
Plötzlich sieht er sich selbst, draußen, außerhalb des Waggons; ein neugieriges Kind, das nach jemanden oder nach etwas Ausschau hält. Er fühlt sich so hilflos wie das Kind, das er betrachtet. Wieder gehen seine Gedanken auf Wanderschaft, bewegen sich entgegen der Fahrtrichtung des Zuges nach Hause zu Kamma und dem Kleinen. Dem Ungeborenen.
Es ist erst September, aber winterlich kalt. Axels Körper ist steif, in den Beinen ein unangenehmes Kribbeln. Er versucht sich zu bewegen, doch es geht nicht, sie stehen zu dicht aneinander gedrückt. Jegliche Körperwärme ist durch die Ritzen in den Wänden verschwunden, die Männer frieren und klappern mit den Zähnen. Es ist viel zu wenig Platz, um sich die Arme um den Leib zu schlagen und so etwas aufzuwärmen. Es ist nur Platz für Gedanken. Und Angst.
Ein paar Mal hält der Zug an. Niemand weiß warum und niemand stellt mehr Vermutungen an. Andere Züge fahren vorbei. Zwischen den Bodenbrettern kann er die Bahnschwellen erahnen. Dann bewegt sich ihr Zug wieder. Das Geräusch der Räder auf den Schienenübergängen wirkt so friedlich, so ruhig und ungefährlich.
„Wo zum Teufel bringen sie uns hin?“, ruft eine heisere, vor Kälte zitternde Stimme.
Die Frage lässt einen von ihnen schluchzend zusammenbrechen. Die Umstehenden sprechen ihm Mut zu, sagen Dinge, an die sie selbst nicht glauben, dass alles schon wieder werden wird, dass es sicher nicht so schlimm werden wird. Ihre Worte helfen, obwohl er weiß, dass sie lügen. Der Kollege richtet sich auf und in der Dunkelheit erahnt Axel einen Anflug von Trotz in seinen Augen.
Wieder kommt der Zug zum Stehen und wieder späht Axel durch eine der Ritzen. Ein Mann schiebt eine Schubkarre den Bahnsteig entlang. Ein anderer hebt Pflastersteine auf und legt sie hinein. Soldaten kann Axel nicht entdecken.
„Mach schon“, sagt Axel. „Frag sie.“
Erik ruft ihnen etwas auf Deutsch zu. Zuerst vorsichtig, dann kräftiger. Er muss ein paar Mal durch eine der Ritzen rufen, bevor der eine reagiert. Der Mann hebt weiter Steine auf und nähert sich dabei ihrem Waggon.
„Habt ihr Zigaretten?“, fragt er.
„Wisst ihr, wo sie uns hinbringen?“
„Habt ihr Tabak? Her damit, sie nehmen ihn euch sowieso ab.“
„Wo bringen sie uns hin?“
„Sicher nach Neuengamme. Gebt uns euren Tabak.“
Der Name setzt sich wie ein Kloß in Axels Hals fest. Die Gerüchte gehen längst auch in Dänemark um. Neuengamme ist ein Konzentrationslager.
Sie fahren weiter. Er spürt etwas an seinem Oberschenkel, Zugwind oder eine Berührung. Es ist Eriks Hand. Sie tastet nach seiner. Wie zwei Geschwister auf dem Weg zur Schule halten sie sich an den Händen, während der Zug die Fahrt verlangsamt.
Als ihr Waggon endlich stillsteht, wird die Schiebetür aufgerissen. Licht blendet sie. Arme recken sich ihnen entgegen und reißen sie aus dem Waggon. Widerstrebend lässt Axel Eriks Hand los. Er versucht selbst nach unten zu klettern. Er muss sie überzeugen. Es ist ein Irrtum. Er sollte nicht hier sein, sondern zu Hause bei Kamma. Tatsächlich hatte er nicht einmal Dienst, als sie festgenommen wurden. Er hat nur die Schicht eines Kollegen übernommen. Das müssen sie doch verstehen. „Ich muss nach Hause. Meine Frau bekommt ein Kind“, ruft er verzweifelt. „Ich werde Vater.“
Ein ungeduldiger Soldat packt ihn am Arm und zieht. „Los!“, brüllt er ihn an. Axels Arme und Beine sind so steif, dass er sich nicht abstützen kann. Mit voller Wucht schlägt sein Kopf auf die Erde. Einen Augenblick lang ist es still, dann beginnt der Lärm in seinem Kopf. Ein anderer Däne landet auf ihm und Axels Kopf wird wieder auf den Boden gedrückt. Er öffnet die Augen und sieht einen blank polierten, schwarzen Stiefel, der auf ihn zuschnellt und ihn mitten ins Gesicht trifft.
Seine Lippe ist geschwollen und die Nase blutet, als er auf die Beine kommt. Er wird vorwärts gestoßen. Fieberhaft sucht sein Blick nach Erik.
Die Soldaten sind von der SS. Das verraten die Runen an ihren Kragen. Ihre Hunde kläffen ununterbrochen und schnappen nach den Gefangenen, in den Händen halten sie Reitgerten, die sie drohend heben, damit die Gefangenen sich beeilen. Sie zischen durch die Luft und verewigen sich auf den Rücken der Langsamen.
Ein Stück weiter vorne bleibt einer der etwas älteren Kollegen stehen und fragt in fehlerfreiem Deutsch, was man mit ihnen vorhat. Die Antwort besteht in einem Faustschlag und Blut spritzt nach allen Seiten und auf die Kleidung der Umstehenden. Der Kollege schüttelt sich nur kurz und richtet sich auf und Axel fällt ein, dass Marinus Boxer in der Polizeisportgruppe ist. Der Gedanke hat sich kaum geformt, als Marinus' Arm wie ein Katapult durch die Luft fährt. Der Schlag kommt von unten und trifft den völlig unvorbereiteten SSler am Kiefer. Ein unschönes Knacken ist zu hören, dann liegt der Stiefel, der Axel im Gesicht getroffen hat, am Fußende des bewusstlosen Soldaten auf dem Bahnsteig.
Andere Soldaten werfen sich auf Marinus. Reitgerten zischen durch die Luft, die plötzlich von zügelloser Brutalität erfüllt ist. In blinder Wut schlagen und treten sie auf den dänischen Polizisten ein. Ein Offizier hält sie schließlich zurück. Nicht, weil sie den Gefangenen nicht zusammenschlagen dürfen, sondern weil die anderen Gefangenen es nicht mitbekommen sollen.
Marinus' Kleidung ist blutdurchtränkt und ein Arm hängt in einem unnatürlichen Winkel von der Schulter herunter, als sie ihn von den anderen Gefangenen wegführen.
Vom Gleis, an dem es nicht mal einen Bahnsteig gibt, gehen die Gefangenen durch das Lager. Die Gefangenen, die sich schon im Lager befinden, sind mit Worten nicht zu beschreiben. Sie sind wie Protagonisten eines unvorstellbaren Albtraums und das Lager ist ein Kabinett des Grauens. Bisher hat Axel nicht für möglich gehalten, dass es Orte wie diesen auf der Welt gibt. Die Gestalten schleppen sich mit langsamen Schritten vorwärts und sehen aus wie Tote, die man schon vor Monaten unter die Erde gebracht und dann wieder ausgegraben hat. Sie sind abgemagert, ausgehungert, bewegen sich wie Invaliden. Ihre Haare erinnern an das Gefieder zerrupfter Hühner. Als Polizist hat Axel Menschen am Tiefpunkt ihres Lebens gesehen, Menschen, für die der Tod zum Alltag gehört und für die das Leben alles andere als ein Zuckerschlecken ist, speziell in den baufälligen Slums in der Adelgade und der Borgergade. Aber nichts ist mit dem hier zu vergleichen. Die Gerüchte, die in Dänemark kursieren, beschreiben Neuengamme nicht annähernd. In der Heimat haben sie keine Ahnung, wie schrecklich es ist.
Der Gestank ist unerträglich. Er liegt über dem Lager wie Morgennebel über einem Feld, ist überall, niemand kann ihm entkommen. Er bohrt sich in Nase, Hals und Brustkasten. Axel sieht, wie sich einige seiner Kollegen übergeben.
Die Dänen werden in den niedrigen Keller eines Steinhauses gebracht. Unter der gewölbten Decke steht Axel in einer kleinen Gruppe, die größer und größer wird. Immer mehr Gefangene werden in den Keller gezwängt. Schweiß läuft ihm übers Gesicht und er will ihn abwischen, kann aber den Arm nicht heben, weil der Mann neben ihm ohnmächtig geworden, aber nicht umgefallen ist. Axels Atem ist heiß und es kommt ihm vor, als habe die Luft, die er einatmet, allen anderen Lungen in diesem Keller bereits einen Besuch abgestattet. Jemand schreit, sie sollen vergast werden und Panik breitet sich aus. Alle schieben und drücken, aber es ist kein Platz, und so vergeuden sie sinnlos ihre Kräfte.
In kleinen Gruppen werden sie aus dem Keller herausgeführt. Die Luft hier unten macht Axel krank. Ihm wird übel, Kopfschmerzen und ein infernalischer Durst stellen sich ein. Stundenlang harren er und Erik aus. Sie sind unter den Letzten, die nach oben kommen.
Sie müssen alles abgeben, was sie bei sich haben. Gestenreich versucht Axel, dem ihm am nächsten stehenden Soldaten klar zu machen, dass er seinen Ehering nicht mehr abnehmen kann, dass sein Finger zu dick geworden ist.
„Sag es ihm, Erik. Sag ihm, dass ich bald Vater werde. Dass ich nach Hause muss.“
Axel weiß, dass es nichts nützt, aber er muss es wenigstens versuchen. Das ist er sich schuldig, das ist er Kamma und ihrem ungeborenen Kind schuldig.
Erik blickt nur ängstlich zu Boden.
Der Soldat lächelt bloß, nicht boshaft, aber doch hart. Mit einer kurzen Bewegung verdeutlicht er Axel, dass sie den Finger abschneiden werden, direkt am Handknochen. Plötzlich gleitet der Ring vom Finger und verabschiedet sich mit einem leise klirrenden Gruß, als er ihn in eine bereitstehende Schale legt.
Nur ihre Schuhe dürfen sie behalten, ihre abgetragenen, schmutzigen Schuhe, als würden sie ein besonderen Wert für sie darstellen. Jeder Gefangene bekommt eine kleine Plakette aus Blech. Sie haben keinen Namen mehr, sind nur noch eine Nummer. Sie duschen und werden danach entlaust. Wie dreckige Hunde. Anschließend wird ihnen die Kleidung ausgehändigt. Sie ist viel zu klein, ein Hemd, das allenfalls einem Kind passt, eine Hose, die ihm nur knapp über die Knie reicht. Die Sachen riechen streng und kratzen auf der Haut. Sie sehen sich an. Sie gleichen einer Ansammlung von verwahrlosten Kindern und Zirkusclowns. Jetzt sehen sie aus wie alle anderen Gefangenen, abgesehen davon, dass sie noch Muskeln und etwas Farbe im Gesicht haben. Aber das ist nur eine Frage der Zeit.
Die Baracke, in der sie untergebracht werden, ist marode, das Dach undicht. Aber sie ist ihr neues Zuhause. Mehrere hundert Männer werden in einem einzigen, großen Raum zusammengepfercht. Axel spürt eine stille Freude, als auch Erik seiner Baracke zugeteilt wird. Das Gefühl ist vollkommen unnatürlich, denn die Baracke ist kein Ort, an dem man Freude verspürt. Freude verdient sie nicht.
Die Ungewissheit hat Axels Körper in eine Art Ruhezustand versetzt. Es ist, als habe er sich selbst Fesseln angelegt und alle Bedürfnisse unterdrückt, um nicht zur Last zu werden, aber jetzt braucht er dringendst eine Toilette. Axel schiebt sich zwischen den anderen hindurch. Die Klos liegen hinter dem Waschraum. Sie bestehen nur aus Löchern in ein paar Holzbohlen. Er setzt die Arme ein, um sich durch das Gedränge und den Gestank bis zum Pissoir an der gegenüberliegenden Wand vorzuarbeiten. Er atmet in kurzen, flachen Zügen durch den Mund, während er sich erleichtert. Zurück in dem großen Raum hofft er, dass sein Körper die basalen Bedürfnisse wieder vergisst.
Ihr erstes Essen ist eine Kohlrabisuppe, eine saure, durchsichtige Brühe, die nicht viel anders riecht als die Toiletten. Erik hält ihm eine verbeulte Schale hin. Axel starrt auf die trübe Flüssigkeit und bemerkt, das etwas zurückstarrt. Sein Spiegelbild auf der fettigen Oberfläche sieht ihn mit tristem Blick an. Er hört Kammas Stimme mit dem feinen, singenden Bornholmer Akzent. „Iss, Axel, du magst Suppe doch so gerne.“ Er liebt Suppe, aber das hier ist keine Suppe. Er kann sich nicht überwinden zu essen, was in der Schale schwimmt, was es auch immer sein mag, und reicht sie weiter.
Im selben Moment übermannt ihn die Erschöpfung. Die Beine geben nach und zittern unkontrollierbar. Er stützt sich auf seinen Nachbarn, einen breitschultrigen Polizisten, der verzweifelt in seine Suppenschale glotzt. Als Axel ihn berührt, lässt er die Schale fallen, ist aber weder verärgert noch wütend auf ihn. Das Malheur scheint fast wie eine Befreiung zu sein; jetzt muss er sich nicht entscheiden, ob er den widerlichen Fraß zu sich nimmt.
Robert, ein Kollege, den Axel sehr schätzt, hilft ihm in die nächste Koje. Er hat Kinder, Axel kann es spüren, so behutsam, wie er mit ihm umgeht.
Kurz darauf sind alle Kojen belegt. Sie sind so eng, dass es nur eine Liegeposition gibt: auf der Seite. Er teilt sich eine Koje mit Robert, sie liegen dicht aneinander. Unter dem zusammengepressten Stroh, das als Matratze dienen soll, spürt er die harten Bretter. Er kann nicht einschlafen. Der Körper ist ausgelaugt, kann sich aber nicht entspannen. Niemals wird er hier schlafen können.
Sehr früh werden sie aus den Kojen gescheucht. Noch ist die Sonne nur eine schwache Nuance in der Dunkelheit, die überlegt, ob auch sie aufstehen soll. Axel hat nur gedöst und nicht das Gefühl, auch nur kurz geschlafen zu haben. Seine Beine sind steif, als er auf dem kalten Fußboden steht. Er kramt seine Schuhe aus der Koje und plötzlich ist ihr Anblick überwältigend. Er hat geschimpft und geflucht, dass sie alles sind, was sie behalten durften, aber jetzt weiß er ihren Wert zu schätzen. Sie schützen ihn gegen die Kälte, vor Verletzungen und Schnittwunden; vielleicht retten sie sogar sein Leben.
Vor den Waschbecken herrscht dichtes Gedränge. Alle hoffen, den Gestank der Baracke samt der Erlebnisse der letzten Tage abwaschen zu können. Sie geben sich alle Mühe, schrubben beinahe verzweifelt Hände, Gesicht und Achseln, aber der Gestank bleibt der gleiche, und was passiert ist, wird keiner von ihnen jemals vergessen.
Wieder steht Suppe auf der Speisekarte, doch es ist eine Schande, das Gericht Suppe zu nennen. An diesem Morgen isst niemand etwas. Axel und Robert kippen die Suppe vor der Baracke weg, um dem Gestank drinnen zu entfliehen.
Von seinem Standort aus kann Axel den Bottich sehen, aus dem die Suppe kommt, und er kann sehen, wie die anderen Gefangenen des Lagers sich gierig darauf stürzen. Ihr Verhalten hat etwas Rücksichtsloses und Beunruhigendes an sich. Sie sind wie ein Rudel Wölfe, das nach Monaten des Hungers gerade Beute gerissen hat. Nach und nach wird ihm klar, dass er vielleicht so enden wird wie sie.