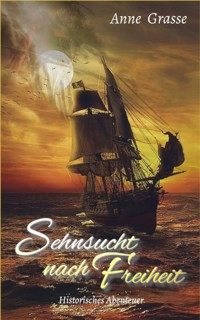3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im frühen 19. Jahrhundert durchstreift ein geheimnisvoller Indianer die Great Plains Nordamerikas. Niemand ahnt, dass er in Wirklichkeit ein Zeitreisender ist – und eine Frau, deren Körper mittels hochtechnologischer Methoden perfekt angepasst wurde. Nicht einmal Rica, ein junges, weißes Mädchen, das in ihm einen Bruder sieht, kennt seine wahre Identität und seinen Auftrag. Er allein weiß von der Gefahr, in der sie schwebt. Während er über sie und ihr Glück wacht, muss er immer wieder gegen seine verbotenen Gefühle für Rica ankämpfen. Als das lauernde Unheil schließlich zuschlägt, steht er vor der schwersten Entscheidung seines Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die Zeitagentin
Herzlichen Dank an Barbara Dier, die den Großteil des Buches Korrektur gelesen und sich damit sehr viel Mühe gegeben hat. Und ebenso Danke an Kathi Bloch, die als Betaleserin die überarbeitete Version von 2022 kritisch gelesen hat und mir viele Hinweise und Tipps zum Korrigieren gab.BookRix GmbH & Co. KG81371 München.
Die Zeitagentin
Ein Zeitreiseroman zwischen dem frühen 19. Jahrhundert in Nordamerika und einer fernen Zukunft
von
Anne Grasse
komplett überarbeitete Fassung (2022)
Ein herzliches Dankeschön an Kathi Bloch für ihre kritischen Anmerkungen
Gegenwart 1
Die große Schwingtür knallte gegen die graue Stahlwand und wurde von der jungen Frau gleich darauf mit einem Fußtritt ebenso lautstark wieder geschlossen. Mit langen Schritten lief sie den Gang entlang. Der bis weit auf den Rücken reichende Pferdeschwanz, zu dem sie die tiefschwarzen Haare gebunden hatte, wippte dabei ständig hin und her. In dem hellen Schein der Deckenbeleuchtung bildeten sich blauschimmernde Reflexe darauf.
Wie immer blieb sie an der großen Tür stehen, die in die Zeithalle führte. Beiläufig erwiderte sie den Gruß der Techniker, die an den unzähligen Geräten, Computern und Monitoren beschäftigt waren. Mit leuchtenden Augen sah sie hinüber zu der ovalen Plattform. Hier war der Ausgangspunkt für die faszinierenden Abenteuer ihrer Zeit, und schon bald würde sie wieder dort stehen. In dieser größten Forschungseinrichtung der Erde, wurden wissenschaftliche Untersuchungen über die Dimension Zeit vorgenommen. Vor allem war es das einzige Institut, das auch geschichtliche Recherchen in Form von Zeitreisen ausüben durfte. Von diesem Raum aus ließen sich die Zeitagenten in die Vergangenheit schicken, um genauere Daten über unzählige historische Ereignisse zu erfahren.
Lächelnd dachte Sharon Winslow daran, wie oft sie schon auf dieser Plattform gestanden hatte, obwohl sie mit ihren siebenundzwanzig Jahren noch recht jung für eine Zeitagentin war. Manche ihrer Kollegen scherzten immer wieder darüber, ob sie mehr in der Vergangenheit als in der Gegenwart lebte. Es störte sie nicht, im Gegenteil. Sie liebte ihren Beruf, und die Ausflüge in die Geschichte der Menschheit waren ihr Lebenselixier.
„Hallo Ms. Winslow, geht es wieder los?“ Der leitende Ingenieur riss sie mit seinen Worten aus ihren Gedanken.
„Morgen“, lachte sie, „ich muss mich erst anpassen lassen.“
„Bis dann.“
Sie ging weiter an vielen Türen vorbei, bis sie den Maskenraum erreichte. Dort erwartete sie schon Ronald Drummond. Mit einer Armbewegung bat er sie herein und zeigte auf das schmale Möbelstück mitten im Raum, das einem OP-Tisch täuschend ähnlich sah. Nur der dunkle, bequem aussehende Kunststoffbezug passte nicht dazu.
Sharon wusste, dass der Mann Unterhaltungen hasste. Deshalb nickte sie stumm, trat an die Liege und zog sich ohne jede Scheu aus. Nackt legte sie sich darauf und Drummond begann sein schwieriges Handwerk. Sharons Maske war eine der kompliziertesten, die er je entworfen hatte: Er musste aus ihr einen jungen Mann machen. Denn sie studierte die Epoche der Indianerkriege und in den dortigen Kulturen konnte sie nur so unauffällig agieren.
Da weder ihre Stimme noch die Körperstatur verändert werden konnten, hatte er eine ungewöhnliche Lösung gefunden. Sharons Körper wurde von der Schulter bis zu den Lenden mit künstlichem Gewebe bedeckt. Schicht für Schicht trug er dieses auf und wartete geduldig ab, bis es sich mit der echten, darunterliegenden Haut verband. Geschickt fügte Drummond Blutgefäße und Nerven ein, wobei er darauf achtete, dass Sharon bei Verletzungen weder viel Blut verlor noch allzu große Schmerzen spürte. Zumindest, wenn nur das künstliche Material beschädigt wurde.
Schließlich bedeckte das Gewebe wulstig sowie blau und rot verfärbt den ganzen Torso. Ihre Brüste waren darunter nicht mehr erkennbar. Sharon sah jetzt aus, als würden Oberkörper und Bauch nur aus alten Narben, tiefen Striemen und großflächig verbrannter Haut bestehen. Ein Anblick, der jeden erschaudern ließ, der dies zum ersten Mal sah. Besonderes Augenmerk legte Drummond auf die Leistengegend. Hier formte er aus dem künstllichen Fleisch verstümmelte Überreste männlicher Geschlechtsorgane. Sharon hatte diese unangenehme und langwierige Tortur schon oft über sich ergehen lassen, und so lag sie auch dieses Mal stumm und bewegungslos da, bis Ronald Drummond zufrieden knurrte.
Langsam richtete sie sich auf und sah grinsend an sich herab: „Hässlich wie die Nacht. Sie haben sich wieder einmal übertroffen.“
Drummond lächelte zufrieden, sagte aber nur ein einziges Wort: „Umdrehen!“
Sharon gehorchte und nun geschah das Gleiche auf ihrem Rücken. Bis hinunter zum Gesäß bekam sie wulstige, in bläulichen Farben schimmernde Striemen, braunschwarze Verbrennungen und tief vernarbte Schnitte aufgetragen. Erst nach insgesamt sieben Stunden war die Prozedur beendet.
„Gut. Rüber in den Trainingsraum!“, forderte Drummond sie auf.
Unter seinem kritischen Blick absolvierte Sharon die anstrengenden Belastungsübungen, die sicherstellen sollten, dass die Maske hielt.
„In Ordnung“, erklärte er schließlich.
Schweißgebadet richtete sie sich auf. Auf Drummonds Fingerzeig hin trabte sie unter die grellen Scheinwerfer in der Mitte des Raumes. Ihre Füße hinterließen feuchte Flecke auf dem Boden. Heftig atmend stand sie da, während der Maskenbildner noch einmal jeden Zentimeter ihres Körpers begutachtete.
Endlich erklärte er zufrieden: „Perfekt. Pause. Bis nachher.“
Sharon duschte, zog sich an und ging in die Kantine. Hester, ihre Freundin, erwartete sie schon. Sharon erwiderte die liebevolle Umarmung und küsste sie zärtlich. Wie die meisten Menschen ihrer Zeit, hatte sie schon seit früher Jugend intime Beziehungen zu beiden Geschlechtern. Die zwei jungen Frauen setzten sich und Sharon fiel ausgehungert über das Essen her. Hester sah ihr zu, immer wieder streichelte sie die Schulter der Freundin. Ihre Augen suchten Sharons Blick, doch zu deren Erleichterung blieb sie stumm.
Aufatmend schob Sharon schließlich den leeren Teller weg. „Das hat gut getan.“
Hester presste die Lippen zusammen, kämpfte mit sich und stieß dann doch hervor: „Du musst doch nicht gehen. Es ist nicht dringend, das hast du selbst gesagt. Warum bleibst du nicht hier?“
Bei Sharons genervtem Blick senkte sie schuldbewusst den Kopf. Die seufzte ein wenig. Diese Diskussion hatten sie in den letzten Tagen häufig geführt. Hester gefiel es überhaupt nicht, dass Sharon nach nur acht Wochen in der Gegenwart erneut in die Vergangenheit reisen wollte.
„Das ist meine Entscheidung, Hester“, antwortete sie. „Ich möchte zurück, die letzten Aufträge ließen mir nie Zeit, zur Farm zu reiten. Außerdem habe ich durchaus eine Aufgabe dort. Du wusstest von Anfang an, dass ich viel weg bin.“
Hester verzog beleidigt das Gesicht. „Aber nicht so oft. Du bist regelrecht besessen von deinen Aufträgen. Und ständig willst du zu diesem Mädchen. Dabei sind wir ein Paar. Abgesehen davon ist es dir ohnehin verboten, mit ihr zusammen sein.“
„Das bin ich auch nicht, sie ist dort meine Schwester. Außerdem weißt du, dass ich in der Vergangenheit zu einer anderen Person werde, die nichts mehr mit mir selbst zu tun hat. Himmel, Hester, ich bin dort quasi nur Zuschauer in einem stillen Eckchen meines Gehirns, selbst mein Körper ist anders. Du kannst mich gerne mal anschauen.“ Sharon begann das Shirt hochzuziehen.
„Will ich nicht“, lehnte Hester sofort ab.
Fast hätte Sharon bei ihrem Gesichtsausdruck gegrinst. Die Freundin hatte sich noch nie überwinden können, den künstlich verunstalteten Körper zu betrachten. Stattdessen blickte Hester sie missmutig an. Sharon wusste, dass sie ihr nicht glaubte. Nicht ihre Abwesenheit störte sie so sehr, sondern die Schwester, die sie in der Vergangenheit hatte. Hester war überzeugt davon, dass sie diese liebte und zwar nicht geschwisterlich. Sie war ganz einfach eifersüchtig auf das ihr völlig unbekannte Mädchen.
Sharon ahnte, dass sich Hester diesmal nicht mit netten Worten abspeisen lassen würde. In gewisser Hinsicht hatte die Freundin sogar recht. Ja, sie begehrte das junge Mädchen und sah in ihr tatsächlich mehr als eine Schwester. Doch dies verbarg sie tief in sich, gab es nicht einmal sich selbst zu, geschweige denn gegenüber Hester. Derartige Empfindungen waren ihr streng verboten. Sie wusste genau, welche Konsequenzen es hätte, wenn ihre heimlichen Sehnsüchte bekannt würden. Sie dürfte nie wieder in diese Zeit gehen und somit auch ihre junge Schwester dort verlieren. Das wollte sie auf keinen Fall. Ganz abgesehen von den verheerenden Folgen, die dies auf die Stabilität der Zeitdimension hätte.
„Was ich in der Vergangenheit mache, betrifft dich oder unsere Beziehung nicht“, versuchte Sharon, das hübsche, rothaarige Mädchen zu besänftigen. „Wenn ich wiederkomme, bleibe ich länger hier. Jerret Richmont verlangt, dass ich eine Pause einlegen soll.“
Sie sah ihrer Freundin an, dass sie mit dieser Antwort nicht zufrieden war. Sharon wurde traurig. Vermutlich würde diese Zeitreise ihre Verhältnis beenden. Aber das musste sie in Kauf nehmen. Ihr Leben in der Vergangenheit war ihr wichtig und zu schön, um auf eine Beziehung Rücksicht zu nehmen, die für sie in der Hauptsache sexueller Natur war.
Durstig trank sie noch ein Glas Wasser und verabschiedete sich: „Hester, ich muss gehen. Die Maske ist noch nicht fertig, und vorher kann ich nicht schlafen gehen. Morgen früh muss ich fit sein.“
Hester zuckte mit den Schultern: „Wozu rede ich überhaupt? Du tust ja doch, was du willst.“ Sie stand ebenfalls auf und erklärte wütend: „Ich glaube dir nicht. Ich weiß, dass du dieses Mädchen liebst und mit ihr schlafen willst. Und das ist gegen die Gesetze, die dir angeblich so wichtig sind. Du bist eine Heuchlerin.“ Brüsk wandte sie sich ab und hastete aus dem Raum.
Sharon blickte ihr nach. „Volltreffer“, murmelte sie vor sich hin, dann schüttelte sie den Kopf. Nein, der Vorwurf stimmte nicht ganz. Denn sie würde die Zeitgesetze niemals brechen, egal welche – verbotenen – Träume sie auch hatte.
Langsam und nachdenklich ging sie wieder zu Drummond zurück. Sie konnte es nicht ändern, auch diese Freundschaft würde zerbrechen. Obwohl sie es schon länger kommen sah, nagte diese Erkenntnis an ihr. Aber Zeitagenten hatten oftmals Probleme mit Beziehungen. Niemand mochte es, wenn der Partner immer wieder für viele Wochen verschwand. Denn im Gegensatz zu den meisten Sci-Fi-Geschichten verging die Zeitspanne, die sie in der Vergangenheit verbrachte, auch in der Gegenwart.
Resigniert seufzte Sharon in sich hinein und stieß derb die Tür zum Maskenraum auf, als ob diese schuld an ihrem Frust wäre. Diesmal setzte sie sich auf einen Stuhl und legte unaufgefordert den Kopf in den Nacken. Jetzt war ihr Gesicht an der Reihe. Es besaß die typische indigene Form und da sie Vollblutindianerin war, auch eine kräftige rotbraune Hautfarbe. Allerdings würde niemand glauben, dass sie ein Mann sei, dafür waren ihre Züge viel zu feminin. So bekam sie um die Augen herum kleine Schnitte und punktförmige Verbrennungen aufgetragen. Die Augenbrauen verschwanden unter großen Narbenwülsten. Die Nasenwurzel wurde zu einer schwärzlichen Brandwunde. Einige dieser hässlichen Schnitte reichten bis fast zum Mund hinunter. Viel weniger auffällig waren die dezenten Veränderungen an Kinn, Stirn und Wangen. Sie wurden nur etwas maskuliner gestaltet.
Als sie wieder in den Spiegel sehen durfte, blickte ihr ein geradezu groteskes Gesicht entgegen. Kinn, Mund und Stirn waren unversehrt. Hier glich sie einem gut aussehenden Halbwüchsigen oder sehr jungen Mann. Doch schon auf den Wangen zerstörten mehrere hässliche Narben den angenehmen Eindruck. Absolut grauenhaft allerdings wirkte die gesamte Augenpartie. Die Gegensätze zwischen Hübsch und Hässlich bildeten ein geradezu abschreckend unheimliches Gesicht.
Zufrieden bedankte sich Sharon bei Drummond und eilte ein Stockwerk tiefer. Hier lagen die Ausrüstungskammern und Schlafräume. Sie holte sich Kleidung, Waffen und sonstige Utensilien, die sie benötigte. Dann endlich setzte sie sich hundemüde aufs Bett. Sie freute sich auf den nächsten Morgen. Perfekt hergerichtet für ihre andere Identität würde sie in den riesigen Saal gehen, in dem der Zeitprojektor stand, und von dort in die Vergangenheit reisen.
Vergangenheit 1
Die weite, bis zum Horizont und darüber hinausreichende Gras- und Buschsteppe flimmerte in der Mittagshitze. Heiß brannte die Sonne aus dem tiefblauen, wolkenlosen Himmel herab. Die kräftige Stute fiel deshalb auch schnell aus dem kurzen Trab wieder in einen langsamen Schritt zurück und trug ihren Reiter mit hängendem Kopf weiter nach Süden. Das Lastpferd hinter ihr schnaubte und schüttelte den Kopf. Kurz spannte sich das Seil, das es mit der Stute verband, dann trottete es widerwillig weiter.
Der junge Indianer saß zusammengesunken auf dem sattellosen Pferderücken, doch seinen Augen, obwohl halbgeschlossen, entging nichts: Das schwarze Eichhörnchen sprang gerade noch rechtzeitig vor den Hufen der Tiere vorbei und verschwand unter den Ästen der dornigen Büsche. Das trockene Gras raschelte leise, als die kleine Mäusefamilie durch die Halme huschte. Ein kurzer Blick streifte den hoch im Himmel kreisenden Raubvogel, dann senkten sich die Lider des Reiters wieder. Die Sonne war einfach zu grell.
Er ritt den ganzen Tag mit wenigen Pausen, in denen die Pferde grasen konnten. In der Nacht lagerte er im Schutz einer kleinen Baumgruppe. Schläfrig blickte der Mann in den klaren, sternenübersäten Himmel. Er suchte die Sternbilder und gab ihnen ihre Namen, die indianischen ebenso wie die englischen. Hin und wieder blitzte eine Sternschnuppe auf. Irgendwann fielen ihm die Augen zu, und er schlief ungestört bis zum Morgengrauen. Als die Sonne sich gerade über den Horizont schob, wachte er auf, aß rasch etwas getrocknetes Fleisch und machte sich wieder auf den Weg.
Gegen Mittag brachte der Indianer sein Pferd Dorcat plötzlich zum Stehen. Er griff nach dem Gewehr und glitt gleichzeitig von der dicken, gewebten Satteldecke herab. Der Lastgaul tat noch ein, zwei Schritte, ehe er ebenfalls still stand.
Doch da kniete der Krieger bereits auf dem Boden und schob vorsichtig einige Grashalme beiseite. Gebückt ging er etwas weiter und untersuchte die schwach erkennbaren Spuren von Hufen. Suchend blickte er sich um und erkannte an einigen kleinen Büschen weitere Zeichen, dass vor kurzer Zeit Reiter vorbeigekommen waren. Die Spuren waren allerhöchstens einen halben Tag alt, eher weniger.
Es waren mehrere Tiere gewesen, drei oder vier vermutlich, beschlagene und unbeschlagene. Es gab wenige Indianer, die ihre Pferde beschlugen, und kaum Weiße, die Pferde ohne Eisen ritten. Also eine Gruppe aus hell- und rothäutigen Reitern? Der Krieger runzelte die Stirn. Es gab selten Freundschaften zwischen den roten Völkern und den Bleichgesichtern.
Gewandt sprang er zurück auf Dorcats Rücken und ritt weiter, allerdings weitaus vorsichtiger als bisher. Immer wieder blickte er forschend und aufmerksam weit über die Steppe bis zum Horizont. Schließlich kniff er die Augen zusammen und nahm eine schmale Baumgruppe ins Visier. Weitere größere Büsche wiesen daraufhin, dass es dort Wasser gab, einen kleinen Bachlauf vermutlich. Langsam ritt er darauf zu, die Bäume nicht mehr aus den Augen lassend. Dann nickte er zufrieden.
Da vorne brannte ein Feuer, rauchlos, doch die Luft flimmerte wegen der Hitze stärker. Das Gewehr quer über den Beinen näherte sich der Indianer der Lagerstelle. Jeder konnte daran erkennen, dass er zwar misstrauisch war, aber nicht als Angreifer kam.
Zuerst stand nur eine der Personen am Feuer auf. Er sagte einige Worte zu seinen Begleitern, die sich daraufhin ebenfalls erhoben. Der Krieger erkannte erst, als er näher kam, dass einer von ihnen ein Weißer war. Die anderen beiden waren Indianer wie er selbst, ein älterer und ein jüngerer. Ihre Kleidung wies sie als Nokomo-Comanchen aus, selbst die des Bleichgesichts war ähnlich gefertigt. Alle trugen Waffen in den Händen, deren Mündungen als Zeichen der Friedfertigkeit auf den Boden zeigten.
Gespannt und wachsam blickte der Reiter den drei Männern entgegen und ließ deren gründliche Musterung ohne irgendeine erkennbare Regung über sich ergehen. Ihre Blicke glitten langsam über sein Gesicht und wurden misstrauisch, als sie die Ledermaske bemerkten, die von Augenbrauen bis zu den hohen Wangenknochen hinunter reichte. Sie ließ nur die dunklen Augen selbst und die Lider frei. Drei hässliche Narben führten von dort bis fast zum Kinn. Jeder, der diese unter dem dunklen Leder verschwinden sah, fragte sich unwillkürlich, was es noch verdeckte. Dieser Eindruck wurde durch weitere dunkle Wundmale an den Rändern der Maske verstärkt.
Erst wenige Schritte vor den Fremden ließ der Reiter das Pferd stoppen. In der üblichen Grußgeste führte er seine Hand erst zum Herzen und streckte sie dann, mit der Handfläche nach unten, aus.
„Tse Kil Chtla grüßt die Krieger der Nokomo und den weißen Mann. Ich komme in Frieden.“
Alle drei starrten ihn überrascht an. Dies galt sowohl seiner hellen Knabenstimme als auch dem ungewöhnlichen Namen. Er stammte aus keiner der Sprachen, die von den Indianervölkern Amerikas gesprochen wurden. Der ältere Indianer konnte seine Verblüffung als Erster wieder verbergen, allerdings wanderte sein Blick sofort weiter über Tse Kil Chtlas Kleidung. Doch auch diese zeigte keine Hinweise auf seine Herkunft.
Der jüngere schaffte es bei Weitem nicht so gut, sich zu beherrschen. Offenes Erstaunen stand in seinen Augen. Dann wurde ihm das Ungehörige seines Verhaltens bewusst, und er senkte rasch den Kopf. Tse Kil Chtla ignorierte beides, sein Gesicht blieb völlig unbewegt.
„Tse Kil Chtla ist bekannt als ein Krieger des Friedens. Sei willkommen“, bekam er schließlich von dem älteren zur Antwort.
Erleichtert schwang sich der junge Krieger vom Pferd. Früher war er hin und wieder angegriffen oder verjagt worden, da man ihn wegen der fehlenden Zeichen auf eine Stammeszugehörigkeit als Paria, einen Ausgestoßenen, angesehen hatte. Im Lauf der letzten Jahre verbreiteten sich jedoch mehr und mehr Geschichten und Gerüchte über den geheimnisvollen Indianer, der sich Tse Kil Chtla nannte. Die Worte des Comanchekriegers zeigten ihm, dass sein Name inzwischen über weite Gebiete bekannt war. Denn bisher hatte er sich stets weiter im Westen aufgehalten.
Schweigend führte er die Pferde abseits zu den Büschen am Wasser und lud die Packen ab, damit die Tiere trinken konnten. Dann trat er an das Feuer. Erst jetzt nannte der ältere Krieger seinen Namen: Altscha Mano. Mit einer Handbewegung deutete er auf seinen jüngeren Gefährten. Tse Kil Chtla schätzte diesen auf knapp unter dreißig Sommer.
„Mein Sohn Tscha Minhau.“
Tse Kil Chtla neigte grüßend den Kopf und erwiderte die üblichen Willkommensworte.
Der Weiße, circa fünfunddreißig Jahre alt und im Gegensatz zu den Indianern dunkelblond, stellte sich selbst vor. Er reichte ihm die Hand, die Tse Kil Chtla auch ohne zu zögern ergriff. Freundlich lächelnd erklärte der Mann ebenfalls im Comanchedialekt: „Willkommen. Ich habe deinen Namen schon einige Male gehört. Ein guter Freund und ein gefährlicher Feind. Ich freue mich, dich kennenzulernen, Tse Kil Chtla. Mein Name ist Frank Mining.“
„Ich grüße dich, Frank Mining.“ Das Gesicht des jungen Kriegers blieb auch jetzt unbewegt, nur das kurze Aufleuchten in seinen Augen zeigte seine Freude über die offene, herzliche Begrüßung.
Alle vier setzten sich an das Feuer. Während sie aßen, unterhielten sie sich, immer noch etwas vorsichtig und formell höflich. Tse Kil Chtla blieb seinem Ruf treu. Er sprach freundlich und beantwortete die wenigen Fragen bereitwillig, blieb jedoch immer einsilbig, fast wortkarg. Der Mann, von dem niemand Näheres wusste, galt als extrem schweigsam. Damit verboten sich weitere Fragen, wie nach seiner Herkunft, von selbst. Es wäre mehr als ungehörig, fast beleidigend, jemanden ausforschen zu wollen, der derart deutlich machte, dass er nicht gewillt war, über sich zu reden.
Die drei Männer hatten schon einige Geschichten über Tse Kil Chtla gehört. Niemand wusste, woher er kam, und wo er lebte. Er tauchte an den verschiedensten Orten wie aus dem Nichts auf und verschwand nach einiger Zeit wieder ebenso. Ihre Neugier, etwas über diesen geheimnisvollen Mann zu erfahren, war dementsprechend groß. Doch auch sie stellten fest, wie alle anderen vor ihnen, dass der junge Indianer nichts von sich preisgab.
Frank Mining beobachtete ihn unauffällig. Die Maske wirkte düster und hässlich in dem ansonsten sehr jugendlich wirkenden Gesicht. Stirn und Mundpartie mit dem schmalen Kinn waren glatt wie bei einem Knaben, ebenfalls die Wangen – zumindest dort, wo sie nicht durch die Narben verunstaltet waren. Doch gerade diese gaben dem Gesicht, zusammen mit den dunklen Schatten um die Maske herum, ein unheimliches Aussehen. Und es gab viele Gerüchte über die Verletzungen, die unter dem Leder versteckt sein sollten.
Sein Alter war schwer zu schätzen, im Grunde genommen sah er aus wie allerhöchstens zwanzig. Nur der Ausdruck in seinen Augen passte nicht dazu, sie wirkten weitaus reifer und älter. Nach allem, was Frank über den geheimnisvollen Fremden gehört hatte, konnte er allerdings nicht mehr so jung sein.
Als sich herausstellte, dass sie alle nach Süden wollten, boten die drei Tse Kil Chtla an, mit ihnen zu reiten. Er nahm dies dankend an. Fast drei Tage ritten sie Meile um Meile zusammen. Selbst die beiden Comanchen, alles andere als redselig, waren über die Schweigsamkeit ihres Begleiters überrascht. Der Fremde blieb fast den ganzen Tag stumm, ohne dabei abweisend zu wirken. Sprachen sie ihn an, ging er freundlich darauf ein, seine Antworten waren jedoch immer kurz und einsilbig.
Die beiden Indianer akzeptierten dies sofort, doch Mining fühlte sich herausgefordert. Er wollte wissen, ob es nicht möglich war, diesen Mann zum Reden zu bringen. Immer wieder versuchte er, ihn aus seiner Schweigsamkeit zu locken, allerdings ohne Erfolg.
Als ihnen die Fleischvorräte ausgingen, richtete Frank richtete es ein, zusammen mit Tse Kil Chtla auf die Jagd zu gehen. Wie erwartet, war der junge Krieger sehr geschickt. Seinen Augen und Ohren entging nicht die geringste Kleinigkeit, und er tötete schnell und gezielt. Während sie das Tier ausweideten, meinte Mining scheinbar beiläufig: „Das war ein hervorragender Schuss. Du hast sicher sehr gute Lehrer gehabt.“
Tse Kil Chtla sah ihn kurz an und arbeitete dann schweigend weiter. In den dunklen Augen bemerkte Frank Mining jedoch wieder dieses kurze Aufblitzen, das er inzwischen als rasch unterdrücktes Lächeln erkannt hatte. Er schmunzelte, der Indianer hatte seine Absicht also erkannt, war aber nicht verärgert darüber. Obwohl sein Verhalten nach indianischen Regeln ungehörig war. Tse Kil Chtla besaß offensichtlich Humor, das machte ihn sehr sympathisch.
Als sie das Ufer des Flusses erreichten, den die Weißen Salt Fork Red River nannten, legten sie eine längere Rast ein. Die Pferde tranken gierig, auch die Menschen schöpften das kühle Nass und füllten ihre Wasserschläuche neu. Eine Weile ruhten sie sich aus. Schließlich stand Tse Kil Chtla auf und blickte konzentriert über das Wasser. Weiter flussabwärts existierte eine Furt. Er nickte, dann wandte er sich seinen Begleitern zu. Zum ersten Mal, seit er sich ihnen angeschlossen hatte, begann er von sich aus zu sprechen.
„Ich reite hier über den Fluss, weiter nach Südwesten. Wenn die Krieger und der weiße Jäger zu den Dörfern der Nokomo wollen, trennen sich hier unsere Wege.“
„Ist dein Ziel noch weit?“ Frank konnte sich die Frage nicht verkneifen.
Einen Atemzug lang ruhten ihre Blicke ineinander. Frank hatte Mühe, nicht in Lachen auszubrechen. Der schalkhafte Ausdruck in Tse Kil Chtlas Augen war unübersehbar. Gelassen zeigte der Indianer in die angegebene Richtung.
„Die Berge“, war die kurze, nichtssagende Antwort.
Jetzt schmunzelte Frank doch, der junge Mann war der neugierigen Frage wieder einmal ohne Schwierigkeiten ausgewichen. Er schüttelte ihm kräftig die Hand. „Ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann wieder begegnen.“
Ein kleines Lächeln spielte plötzlich um dessen Mundwinkel. „Auch ich werde mich freuen, den weißen Jäger wiederzusehen.“
Erfreut und geschmeichelt strahlte Frank. Diese kleine Geste war ein großer Sympathiebeweis. Im Allgemeinen blieb Tse Kil Chtla immer völlig unbewegt und ernst. Auch die beiden Indianer verabschiedeten sich mit herzlichen Gesten von ihm. Altscha Mano versicherte, dass er jederzeit in den Dörfern der Comanchen willkommen sei. Tse Kil Chtla dankte ihm aufrichtig, dann trieb er seine Pferde in den Fluss. Am anderen Ufer wandte er sich noch einmal um und hob den Arm. Drei Hände grüßten zurück.
Tse Kil Chtla zog stetig durch menschenleeres Land, das ständig trockener wurde. Doch er folgte trotzdem nicht dem vielfach gewundenen Flusslauf. Lieber überquerte er in möglichst gerader Linie die langsam höher werdenden Hügel. Er kannte das Land genug, um zu wissen, wo er immer wieder auf das lebensnotwendige Nass stoßen konnte. Mit jedem Tag wurden die Silhouetten der großen, schroffen Berge im Westen deutlicher.
Er hob abrupt den Kopf, der Wind trug einen eigenartigen Geruch heran, scharf und – Tse Kil Chtla runzelte die Stirn – gefährlich. Suchend blickte er sich um, seine Nasenflügel blähten sich, doch er sah nichts, was die Ursache sein konnte.
Stirnrunzelnd nahm er den Hügel vor sich in Augenschein und sprengte in schnellem Trab den Hang hinauf. Auf halber Höhe zog er die Zügel an, sprang ab und bedeutete Dorcat, hierzubleiben. Gebückt lief er weiter, bis er fast auf allen vieren den Gipfel erreichte. Hier ließ er sich in das spärliche Gras sinken, es würde zumindest etwas Deckung geben. Vorsichtig robbte er vor, die Gegend ständig mit den Augen absuchend.
Weit entfernt schimmerte das helle Band des Flusses und dahinter – Tse Kil Chtla kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Dort stieg dunkler Rauch auf, hin und wieder konnte er auch Flammenzungen erkennen. Viel zu groß für ein Lagerfeuer.
Der widerliche Geruch war hier oben stärker, er assoziierte ihn mit Leder, Holz – und Tod. Tse Kil Chtla stieß mehrere melodische Pfiffe aus. Dorcat hob den Kopf, stampfte einmal kurz auf, dann trabte sie zu ihm, das Lastpferd wie immer hinter sich herziehend. So schnell die Tiere den Abhang schafften, ritt er hinunter. Auf der Ebene trieb er sie zum Galopp an, bis er sich dem Fluss näherte. Die Flammen am gegenüberliegenden Ufer waren inzwischen niedergebrannt, doch den Boden bedeckten noch immer unzählige kleine Glutnester. Der Wind hatte das Feuer auf das Wasser zugetrieben und somit die weitere Ausbreitung verhindert.
Wie ein dichter Schleier lag der Rauch über dem Land. Tse Kil Chtla erkannte darin die verbrannten Überreste mehrerer Tipis, vermutlich circa zehn. Wie schwarze Lanzen ragten einzelne Holzstangen in die Luft. Stinkendes und verkohltes Leder lag in großen Haufen zu deren Füßen. Zu wenig für ein Dorf – mit Sicherheit war dies hier das Lager eines Jagdtrupps gewesen.
Tse Kil Chtla blickte am Ufer entlang. Camps wurden meist in der Nähe einer Furt aufgeschlagen, damit das Wasser bei Bedarf rasch überquert werden konnte. Wenige hundert Fuß flussabwärts entdeckte er sie. Auf der anderen Seite angekommen, wurde der Gestank ekelerregend. Dorcat begann widerwillig zu scheuen. Ihr Instinkt wehrte sich dagegen, weiter auf den Geruch des gefährlichen Feuers zuzugehen. Der junge Krieger schwang sich vom Pferd und befahl der Stute, in der Nähe zu bleiben. Sie trabte einige Schritte auf die Furt zu, dann begann sie zu grasen.
Hustend lief Tse Kil Chtla auf das Lager zu. Wachsam beobachtete er das Gelände, ohne die geringste Bewegung zu bemerken. Es war totenstill. Nur das leise Knistern der immer weniger werdenden Flammen und Glutnester und das Rauschen des Wassers waren zu hören. Die Tiere und Vögel würden frühestens morgen wiederkehren, selbst die Aasfresser mieden verbranntes Land.
Plötzlich stockte sein Schritt, entsetzt sah Tse Kil Chtla auf den unförmigen Klumpen, der bei den ihm am nächsten stehenden Holzstangen lag. Dann rannte er mit großen Sätzen hinüber und starrte auf den verkohlten, grauenhaft aussehenden Leichnam hinab. Doch nicht der Tote selbst erschreckte und erregte ihn so sehr, sondern die Stellung der Arme. Sie waren hinter seinem Rücken. Er war gefesselt gewesen, als die Flammen ihn ergriffen hatten.
Tse Kil Chtla schluckte und musterte erneut die Gegend. Nein, wer immer dieses Feuer gelegt hatte, war inzwischen verschwunden. Langsam, nur widerwillig, ging er von einem der zerstörten Zelte zum anderen. Überall lagen Tote, insgesamt zählte er elf verbrannte Leichen – und allen waren die Hände auf den Rücken gebunden worden.
Andere Dinge, wie Steinhaufen, Asche und Holzreste, bestätigten seine Vermutung eines Jagdlagers. Hier hatten Trockengestelle und Rauchfeuer gestanden, um das Fleisch haltbar zu machen. Elf Tote waren allerdings zu wenig für einen vollständigen Trupp. Das hieß, – und hier musste Tse Kil Chtla erst einmal kräftig seine Übelkeit hinunterwürgen – ein Großteil der Toten waren Frauen gewesen. Die Krieger befanden sich noch auf der Jagd. Sicher waren nur wenige zurückgeblieben, um das Camp und die wehrlosen Squaws zu schützen.
Er hoffte inständig, dass man sie getötet hatte, ehe das Feuer gelegt worden war. Doch er dachte lieber nicht darüber nach, was davor geschehen war. Dies war kein Überfall durch einen verfeindeten Stamm gewesen. Dann wären nur die Krieger umgebracht worden, die Frauen hätte man als willkommene Beute betrachtet. Und Indianer hätten die Toten auch nicht verbrannt, um ihre Spuren zu verwischen.
Nein, dies sah nach weißen Skalpjägern aus. Gewissenlose, menschenverachtende Männer, die grausam genug waren, um sogar Frauen zu ermorden. Weiter im Norden gab es Forts der Bleichgesichter. Dort konnten sie die Skalps für gutes Geld verkaufen.
Kalter, bitterer Zorn erfüllte ihn. Seine Hand umkrampfte hasserfüllt das Messer an seinem Gürtel. Als eine leise Stimme in seinem Hinterkopf erklang, hätte er sie am liebsten zum Schweigen gebracht. Doch das war nicht möglich, wie er genau wusste. Beschwichtigend flüsterte sie: ‚Du kannst nichts ändern. Dies ist nun einmal die Zeit der brutalen Kriege, in denen die roten Völker verzweifelt versuchen, sich gegen die weißen Eindringlinge zur Wehr zu setzen. Doch diese sind in der Überzahl, die indianischen Stämme werden nacheinander besiegt. Bleib ruhig, du hast nicht das Recht, darüber zu urteilen.‘
‚Es schmerzt!‘, dachte er wütend zurück. Die Stimme strahlte Verständnis aus, resignierend akzeptierte er ihren besänftigenden Einfluss auf ihn. Er wusste, dass er sich ihr beugen musste.
Langsam ging Tse Kil Chtla über den verbrannten Boden flussaufwärts, bis das Land wieder grün wurde. Hier begann er am Ufer mit der Suche nach Spuren. Fußbreit um Fußbreit untersuchte er den Boden, immer wieder strich er Gräser beiseite und hob Äste an, um zu erkennen, ob irgendwo Abdrücke von Pferdehufen oder menschlichen Stiefeln auf dem harten Boden zu finden waren.
Erst als er über zwei Drittel des Feuerkreises abgeschritten hatte, entdeckte er Hufspuren. Tse Kil Chtla folgte ihnen über hundert Schritt weit. Es waren zehn Pferde gewesen, vermutlich drei davon für das Gepäck. Also wahrscheinlich sieben Männer. Die Abdrücke zeigten eindeutig, dass die Tiere Hufeisen trugen. Das bestätigte seine Vermutung: Weiße hatten dieses Lager überfallen. Und er wusste, welche Last die Packpferde nun mit sich führten.
Mit zusammengepressten Lippen sah der Indianer in die Richtung, in die die Spuren zeigten. Es war sinnlos, ihnen zu folgen. Sie waren etwa zwei Stunden alt. Das hieß, die Mörder waren losgeritten, gleich nachdem sie den Brand gelegt hatten. Und sie würden sich beeilen, um einen ausreichenden Vorsprung vor den Jägern zu bekommen. Es würde zu viel Zeit kosten, ihre Spuren nicht zu verlieren. Er konnte sie nicht einholen. Dieses Mal würde ihr Verbrechen nicht geahndet werden – wie so oft, fügten seine Gedanken bitter hinzu.
Bedauernd wandte er sich ab und sah zum Fluss hinab. Egal, wie sehr ihn das entsetzliche Geschehen empörte, er durfte sich davon nicht berühren lassen. Seine Schritte wurden rascher. Er konnte hier nicht mehr helfen, also war es an der Zeit weiterzureiten und diesen Ort des Todes hinter sich zu lassen. Die zurückkehrenden Krieger des Trupps würden sich um die traurigen Überreste der Ermordeten kümmern.
Aus den Augenwinkeln bemerkte er eine Bewegung. Mit einem schnellen Satz warf Tse Kil Chtla sich seitwärts über einen Busch und rollte sofort weiter. Dann lag er still, das Gewehr schussbereit in der Hand. Nichts regte sich, doch er war sicher, irgendetwas – oder irgendjemand – war jenseits des Gestrüpps vor ihm. Vorsichtig kroch er über den Boden darauf zu.
Zuerst sah er nur die Umrisse eines Menschen, dann das Blut auf dem Lederkleid – eine Squaw! Er schob sich durch die Zweige und sah erschrocken auf den zusammengekrümmten Körper. Schulter, Arm und die ganze Seite waren blutig. Er kniete sich nieder, erleichtert sah er die Ader am Hals pochen. Sie lebte noch. Rasch löste Tse Kil Chtla die Wasserflasche vom Gürtel und schob vorsichtig die Hand unter den Kopf des Mädchens. Ein entsetztes Wimmern entrang sich ihr.
Leise und beruhigend sprach er auf Comanche auf sie ein: „Ruhig, dir geschieht nichts. Ich will dir helfen.“
Er hielt die Lederflasche an ihren Mund und flößte ihr etwas Wasser ein. Als sie die Lider hob, sah er den Schmerz in ihren Augen – und die Furcht, die sie ergriff, als sie sein Gesicht und die Maske sah.
„Hab keine Angst. Dir geschieht nichts“, wiederholte Tse Kil Chtla.
Erneut gab er ihr zu trinken. Dann schob er behutsam die Arme unter ihren Körper, hörte ihr schmerzhaftes Stöhnen und biss die Zähne zusammen, als es erstarb. Es war besser, wenn sie bewusstlos war. Mühsam stemmte er sich mit seiner Last empor. Er schaffte es kaum, sie zu tragen. Langsam ging er zum Wasser hinunter, darauf achtend, ja nicht zu straucheln.
Nicht weit vom Ufer entfernt legte er sie ins Gras, aber so, dass einige Büsche und kleine Bäume, die das Ufer säumten, den Blick auf das ehemalige Lager verdeckten. Sie rührte sich nicht. Mitleidig musterte er die Squaw: Sie war blutjung. Aber auf dem Kleid, wie auch auf dem Band, das ihr jetzt schmutziges und blutverkrustetes Haar aus der Stirn hielt, befanden sich Zeichen, dass sie die Frau eines Kriegers war.
Tse Kil Chtla holte einige Bündel vom Rücken des Lastpferdes und trug sie in ihre Nähe. Dann brachte er rasch ein kleines Feuer in Gang, füllte seinen Eisenkessel am Fluss und stellte ihn darüber. Mit einer weiteren Schale Wasser und einigen breiten Stofftüchern kniete er sich wieder neben die Frau.
Sie hatte inzwischen die Augen geöffnet und beobachtete stumm jede seiner Bewegungen. Als er sein Messer hob, kroch wieder die Furcht in ihre Augen. Er schüttelte den Kopf und erklärte: „Ich möchte nach deinen Wunden sehen.“
Er zerschnitt das Kleid über der Schulter und streifte den Stoff vorsichtig von ihrem Arm. Dann tauchte er ein Stofftuch in das Wasser und wusch sanft das Blut ab. Schließlich fand er die Verletzung. Knapp unter der Schulter sickerten dicke Blutstropfen hervor. Dennoch atmete Tse Kil Chtla auf. Es war eindeutig der Austritt der Kugel, das Blei steckte also nicht mehr im Körper. Behutsam tastete er die Wunde ab und hoffte, dass sie nicht nach innen blutete. Dann konnte er der Frau nicht mehr helfen. Allerdings wäre sie in diesem Fall wohl schon bewusstlos.
Wieder schob Tse Kil Chtla den Arm unter sie und richtete sie auf. Sie biss keuchend die Zähne aufeinander. Halbwegs sitzend lehnte er die Squaw an einen der großen Steine, die überall am Flussufer lagen – ohne darauf zu achten, dass das Kleid dabei herabrutschte und ihre Brust entblößte. Auch die Röte, die ihr dabei ins Gesicht stieg, ignorierte er. Dies war nicht die Zeit für Scham. Er kniete sich hinter sie und wusch hier ebenfalls das Blut ab, bis er die Eintrittswunde freigelegt hatte.
Aus den Packen holte er einige Lederbeutel und entnahm ihnen mehrere Handvoll verschiedener Kräuter und Blätter. Inzwischen kochte das Wasser in dem Kessel. Tse Kil Chtla stellte ihn beiseite, damit es wieder abkühlen konnte. Anschließend suchte er zwei größere, gut in der Hand liegende, flache Steine. Über einem sauberen Tuch zerquetschte er einen Teil der Blätter, die Kräuter zerkaute er.
Während der ganzen Zeit beobachtete die Frau ihn stumm und regungslos. Mit der gesunden Hand hielt sie dabei das Kleid fest, um ihre Blöße zu bedecken.
Schließlich schnitt er zwei Zweige von einem Baum. Einen sehr dünnen und einen, der so dick wie zwei Finger war. Er entrindete beide und glättete den dicken mit dem Messer. Der dünne wurde, so gut es ging, an der Spitze abgerundet. Er tauchte ihn in das noch immer heiße Wasser und rührte mehrmals darin hin und her.
Dann trat Tse Kil Chtla mit dem Pflanzenbrei in der einen und beiden Hölzern in der anderen Hand wieder zu der jungen Squaw. Er kniete sich vor sie. „Ich werde dir Schmerzen zufügen müssen, sonst stirbst du am Wundbrand.“
Angstvoll starrte sie ihn einen Moment an, dann nickte sie. Tse Kil Chtla hob den dicken Stab, wartete bis sie – langsam mit zitternden Lippen – den Mund öffnete, und schob ihn ihr zwischen die Zähne.
Er wollte hinter sie treten, als ihm etwas einfiel. Er eilte zum Feuer und holte zwei Lederbündel, die er ihr unter die Hände schob. Die Squaw umklammerte sie, ihr Blick wurde ruhiger. Er freute sich – anscheinend begann sie, ihm zu vertrauen. Hinter ihr sitzend umfasste er ihre Schultern so fest er konnte, ohne ihr Schmerzen zuzufügen. Dann schob er den dünnen Stab in die Schale mit dem scharfen Pflanzenbrei und drückte ihn in die Wunde.
Ihr Körper bäumte sich auf, sie warf mit geschlossenen Augen gequält den Kopf nach hinten. Ihre Finger krallten sich in das Leder. Doch obwohl trotz der fest zusammengebissenen Zähne tief in ihrer Kehle ein Schrei emporstieg, wehrte sie sich nicht gegen ihn. Immer wieder träufelte er den Saft möglichst tief in die Wunde, hörte ihr qualvolles Schluchzen und beeilte sich so sehr er konnte.
Schließlich war die Schale leer. Tse Kil Chtla griff hastig nach einem sauberen Tuch, tauchte es in das heiße Wasser und wrang es fest aus, auch wenn er sich dabei fast die Finger verbrannte. Er legte es der Frau über die Schulter auf beide Wunden. Wieder schrie sie auf, diesmal wegen der Hitze. Doch die Wärme würde die Heilung beschleunigen. Tse Kil Chtla legte noch einen leichten Verband an, dann lehnte er sie wieder zurück an den Stein.
Noch immer hielt die Squaw die Augen fest geschlossen. Keuchend vor Schmerz rang sie mit tränenüberströmten Wangen nach Luft. Mitleidig nahm der Indianer ein Tuch in die Hand, tunkte es in kaltes Wasser und wusch ihr das Gesicht ab. Er achtete darauf, sie dabei möglichst nicht zu berühren. Es würde sie viel zu sehr erschrecken. Schließlich wurde ihr Atem ruhiger, ihre Lider hoben sich wieder.
Er nahm das Messer und griff nach dem Kleid über ihren Brüsten. Sie zuckte zusammen und versuchte, seine Hand wegzuschieben.
„Nein!“, befahl er und schnitt ein Loch in den Stoff. Das Gleiche machte er auf dem Rücken und schob zwei schmale Lederriemen hindurch, damit sie das Kleid hielten und ihre Blöße bedeckten.
Ohne sie anzusehen, damit sie nicht noch verlegener wurde, stand Tse Kil Chtla auf. Kurz überlegte er, holte dann seine Decken und breitete sie neben der Frau aus. Behutsam half er ihr, sich darauf auszustrecken.
„Versuch zu schlafen. Du bist in Sicherheit.“
Endlich antwortete sie ihm: „Ich danke dir.“
Dann schlossen sich ihre Augen, und nur wenige Minuten später hörte er an ihrem gleichmäßigen Atem, dass sie schlief. Ihre Erschöpfung war größer als der Schmerz. Eine Weile beobachtete Tse Kil Chtla die junge Frau, doch sie blieb ruhig.
Mit dem warmen Wasser bereitete er einen Kräutersud und holte Fleisch, das er über dem Feuer briet und anschließend in kleine Stücke schnitt. Erst danach kümmerte er sich um die Pferde, lud alle anderen Packen ab und ließ sie weiter grasen. Anschließend suchte er das Ufer nach Heilpflanzen ab.
Kurz vor der Dämmerung, die Sonne berührte bereits den Horizont, wachte die Frau wieder auf. Mit klaren Augen sah sie ihn an. Tse Kil Chtla nickte zufrieden, Fieber hatte sie offensichtlich keines. Er nahm den Lederbecher, der neben ihm stand, und füllte ihn mit dem Kräutersud. Das kleingeschnittene Fleisch lag schon auf einem glatten Stück Holz.
Er half der Verletzten, sich aufzusetzen, und reichte ihr erst den Becher, dann das Fleisch. Sie griff gierig danach, doch er legte seine Hand über ihre: „Iss langsam, dein Magen verträgt es sonst nicht.“
Verlegen zog sie ihre Hand unter seiner hervor und senkte den Kopf. Langsam und ohne ihn anzuschauen kaute sie das Essen. Tse Kil Chtla seufzte gedanklich – wann würde sie ihm so weit vertrauen, dass er vernünftig mit ihr sprechen konnte? Vielleicht sollte er selbst etwas mehr reden, dann ging es vielleicht schneller. Er wartete, bis sie satt war.
„Lass mich nach deiner Verletzung sehen“, erklärte er freundlich und setzte sich neben sie. Vorsichtig öffnete er den Verband – hervorragend – die Wundränder waren nicht gerötet. „Sehr gut“, murmelte er. „Es sieht aus, als ob sich nichts entzündet hat. In einigen Tagen wird es dir bestimmt besser gehen.“
Irgendwie kam er sich albern vor, so unnötig daherzureden. Aber sie wirkte tatsächlich zuversichtlicher. Er holte die Pflanzen, die er, während sie schlief, gesucht und zu einem klebrigen Brei zerkleinert hatte. Sofort wurde ihr Blick wieder ängstlich.
„Nein“, beruhigte er sie, „dies wird dir keine Schmerzen bereiten. Es hilft bei der Heilung.“
Vorsichtig strich er den Brei auf die Haut, legte noch einmal warme Tücher darüber und befestigte den Verband wieder.
„Du bist sehr freundlich“, hörte er sie leise sagen.
Erfreut antwortete er: „Danke! Und du bist sehr tapfer.“
„Du bist ein Heilkundiger?“, erkundigte sie sich.
Tse Kil Chtla schüttelte den Kopf. „Nur ein wenig. Gerade genug, um einige Wunden versorgen zu können.“
Er sah sie an. Nun, da die junge Frau von sich aus mit ihm sprach, durfte er endlich offener mit ihr reden. Bis jetzt hatte er sich auf das Allernotwendigste beschränken müssen, um unpersönlich zu bleiben. Alles andere wäre gegen jede Sitte und Brauch gewesen.
„Mein Name ist Tse Kil Chtla. Willst du mir deinen sagen?“
„Oschu Nau Hun. Wie kann ich dir danken? Ich schulde dir mein Leben.“
„Gar nicht, junge Oschu Nau Hun. Ich bin froh, dass ich dich rechtzeitig gefunden habe.“
Er zögerte, durfte er sie jetzt schon fragen? Es würde sie daran erinnern, was geschehen war. Doch vermeiden konnte er dies sowieso nicht.
„Wann werden die Jäger zurückkehren?“
Ihr hübsches Gesicht wurde grau, sie warf einen schreckerfüllten Blick in die Richtung des zerstörten Lagers.
„Morgen, vielleicht erst übermorgen, je nachdem wie die Jagd verläuft.“
Nun gut, dann musste er eben so lange warten. Er konnte sie auf keinen Fall verletzt und hilflos alleine lassen. Da sie in der beginnenden Dunkelheit fröstelte, holte Tse Kil Chtla seine Ersatzjacke und legte sie ihr über die bloße Schulter. Wieder sah sie ihn dankbar an.
„Hast du große Schmerzen? Wirst du einschlafen können?“
„Nein, es geht. Ich bin auch schon wieder müde.“
Aufmunternd erklärte er: „Du hast viel Blut verloren, deshalb bist du so schnell erschöpft. Auch das wird sich in einigen Tagen bessern.“
Tse Kil Chtla deckte sie sorgfältig zu, dann legte er sich neben das Feuer. Diese Nacht würde er es durchbrennen lassen. Sicher fürchtete sie sich sonst. Ihr Blick ruhte auf ihm und fragend sah er zu ihr hinüber. „Brauchst du noch etwas?“
Verlegen schüttelte Oschu Nau Hun den Kopf. „Nein, aber du wirst frieren. Du hast mir deine Decken gegeben.“
Leicht schmunzelte er, allerdings so, dass sie es nicht sah. „Du brauchst sie dringender als ich. Ich habe schon kältere Nächte erlebt. Jetzt versuch zu schlafen!“
Gegen Morgen wurde es doch empfindlich kühl. Tse Kil Chtla stand deshalb vor Sonnenaufgang auf. Die Frau schlief tief, ihr Atem ging ruhig. Nachdem er das nur noch schwach glühende Feuer neu entfachte hatte, sah er nach den Pferden.
Er beschloss, die unfreiwillige Rast zu nutzen, um sich und seine Kleidung zu säubern. Dazu ging er ein gutes Stück flussabwärts, damit ihn die junge Squaw, wenn sie aufwachen sollte, garantiert nicht sehen konnte. Hier zog Tse Kil Chtla sich aus. Unter dem Lederhemd trug er, ungewöhnlich für einen Indianer, noch ein dünnes, dunkles Teil aus gewebtem Tuch. Es umschloss ärmellos seinen Körper bis hinab zu den Hüften. Irgendwann, in sehr viel späteren Zeiten, würde man es Shirt nennen.
Auch unter der Lederhose trug er eine zweite aus Stoff, die den Unterleib bis zu den Oberschenkeln bedeckte. Als er sich auch dieser Kleidung entledigte, wurde erkennbar, dass sein Körper von den Schultern bis über die Lenden hinab von schrecklichen Striemen, wulstigen Narben und großen Brandmalen bedeckt war. Selbst die Genitalien waren versengt und verstümmelt.
Die Unterwäsche verhinderte, dass diese Verletzungen bemerkt wurden, falls irgendwelche Umstände ihn zwangen, sich vor anderen auszuziehen. Er achtete allerdings sehr darauf, das zu vermeiden. Trotzdem existierten so einige Gerüchte über sein Aussehen.
Tse Kil Chtla wusch sich gründlich und reinigte auch seine Montur. Obwohl die Haut noch feucht war, zog er sofort neue Unterwäsche an. Erst dann wartete er in Ruhe ab, bis er in der Sonne trocken wurde und streifte dann seine Ersatzkleidung über – Lederhose und -hemd. Auch die Maske wurde durch eine saubere ersetzt, und hierbei gab er sich sehr viel Mühe, die seitlichen Bänder kunstvoll mit den langen, schwarzen Haaren zu verflechten, bevor er die Riemen hinter dem Kopf verknotete.
Als er zur Feuerstelle zurückkehrte, war die Frau wach und saß auf den Decken. Obwohl es ihr Schmerzen bereitete, versuchte sie sich aufzurichten. Eilig trat Tse Kil Chtla hinzu und stützte sie. Er konnte sich denken, warum es ihr so wichtig war, auf die Beine zu kommen. Ihm lag schon die Frage auf der Zunge, ob sie Hilfe benötigte. Er schluckte die Worte jedoch rasch hinunter, da er sie damit nur beschämen würde, und zeigte in die Richtung, die von dem verbrannten Camp wegführte. Er würde ihr garantiert nicht diesen Anblick zumuten. Den Fluss hinab wuchs genügend Buschwerk, hinter dem sie verschwinden konnte.
Hoffentlich überwand die junge Squaw ihre Verlegenheit und rief nach ihm, falls sie zu geschwächt war, um alleine wieder aufzustehen. Tse Kil Chtla wurde deshalb gerade unruhig, als sie mit kleinen, unsicheren Schritten zurückkehrte. Er sah ihr entgegen. Sie war immer noch voller Schmutz und getrocknetem Blut, eine gründliche Wäsche wäre dringend nötig. Aber als Fremder durfte er ihr dafür keine Hilfe anbieten, und selbst schaffte sie es in ihrem Zustand niemals, sich aus- und wieder anzuziehen.
Den Tag verbrachte Tse Kil Chtla damit, die Pferde zu versorgen und sein Gewehr zu reinigen. Mehrmals überprüfte er Oschu Nau Huns Wunde und war mit der Heilung sehr zufrieden. Am Nachmittag bemerkte er, dass sie immer wieder scheue Blicke in Richtung des Jagdlagers warf.
Leise fragte er: „Oschu Nau Hun? Kannst du mir berichten, was geschehen ist? Ich habe Spuren gefunden und wüsste gerne, ob ich sie richtig gedeutet habe.“
Sie wurde blass und schloss die Augen. Tonlos begann sie zu sprechen: „Es waren sechs Fremde, Bleichgesichter. Sie sprachen von Frieden, und dass sie nur eine kleine Rast einlegen wollten. Turan Lin Ainem und Hanschau Mil Kahu erlaubten es ihnen. Sie sahen harmlos aus. Dann –“
Oschu Nau Hun zögerte, aber nur kurz. „Dann fielen Schüsse. Ich sah, wie unsere Krieger fielen. Die Fremden rannten auf uns zu und verlangten, wir sollten uns auf den Boden setzen. Ich rief den anderen Frauen zu, sofort wegzulaufen. Nami Kimla –“, sie schluchzte, schluckte und erzählte dann leise weiter: „Ich riss sie mit mir. Einer der Männer griff nach ihr. Sie schrie, stolperte und fiel zu Boden. An ihrem Kopf war Blut und sie bewegte sich nicht mehr. Dann schossen die Fremden auf uns. Ich rannte weiter, spürte plötzlich einen furchtbaren Schlag und Schmerzen. Danach weiß ich nichts mehr. Als ich die Augen öffnete, sah ich dich.“
Weinend blickte sie zu ihm auf. „Sie – sie sind alle tot, nicht wahr? Die Bleichgesichter haben sie ermordet. Aber warum? Wir haben ihnen nichts getan.“
Tse Kil Chtla fluchte stumm. Sie wusste das Schlimmste nicht. Warum musste ausgerechnet er derjenige sein, der ihr sagen musste, was während ihrer Bewusstlosigkeit geschehen war?
Die junge Squaw sah forschend und fragend in sein steinernes Gesicht. Er versuchte Zeit zu schinden und blickte zu den Pferden, als habe etwas seine Aufmerksamkeit erregt.
„Bitte!“ Ganz kurz legte sie ihre Hand auf seinen Arm, was ihn verblüffte. Eine Squaw verhielt sich normalerweise zurückhaltender. „Du hast ein gutes Herz, das sehe ich. Auch wenn du – unheimlich wirkst. Bitte sage mir, was meinen Schwestern passiert ist.“
Fast wäre es ihm lieber, wenn sie sich, wie anfangs, noch vor ihm fürchtete. Dann könnte er schweigen. Er wandte sich ihr wieder zu. Ihre flehenden Augen ließ seine Selbstbeherrschung bröckeln. Sie riss erschrocken den Kopf hoch und er wusste, dass sie in seiner Miene die Trauer und Betroffenheit erkannte.
„Es tut mir leid, Oschu Nau Hun. Ja, deine Schwestern sind tot. Die Bleichgesichter – es waren Skalpjäger.“
Sie keuchte, erneut rannen die Tränen über ihre Wangen.
„Mussten – mussten sie leiden?“
„Ich hoffe nicht.“
„Du weißt es nicht?“
Tse Kil Chtla senkte den Kopf und schüttelte ihn leicht. „Die Bleichgesichter haben Feuer gelegt, bevor sie verschwanden.“
Wimmernd sank Oschu Nau Hun in sich zusammen. Erst leise, dann immer lauter erklangen ihre Klagerufe. Tse Kil Chtla starrte einen Moment hilflos auf sie herab, dann setzte er sich auf die andere Seite des Feuers. Er konnte ihr nicht beistehen, und die seit Jahrhunderten überlieferten Trauergesänge würden ihr helfen, mit ihrem Kummer fertig zu werden. Erst gegen Abend wurde sie ruhiger. Wortlos gab er ihr zu Essen und wechselte danach den Verband. Gleich darauf wickelte sie sich in die Decken und schien sofort einzuschlafen. Doch in der Nacht hörte er die junge Frau immer wieder leise weinen.
Am nächsten Vormittag wurden die Pferde unruhig. Tse Kil Chtla ging ans Ufer und suchte die Umgebung ab. Eine Gruppe Reiter kam in vollem Galopp auf das Wasser zu. Sie mussten das zerstörte Lager gesehen haben. Er erwartete sie an der Furt. Zu seiner Überraschung bemerkte er einen Weißen unter ihnen.
Ihr Anführer sprang vor ihm vom Pferd, mit dem Gewehr im Arm. Der Kotsoteka-Comanche war noch recht jung, feindselig herrschte er Tse Kil Chtla an: „Wer bist du? Was ist hier geschehen?“
Ruhig erwiderte der seinen Blick. „Ich sah das Feuer und den Rauch.“ Er deutete mit dem Kopf in Richtung des Jagdlagers. „Vor zwei Tagen. Ich kam zu spät.“
Mit einem Aufschrei sprengte das Bleichgesicht vor, rutschte von dem anscheinend recht temperamentvollen Hengst und sah ihm voller Entsetzen ins Gesicht.
„Oschu Nau Hun, sie ist – sie sind – wer war das?“, stieß er hervor und wollte zum Camp stürmen.
Rasch ergriff Tse Kil Chtla ihn am Arm. „Nein, weißer Jäger, bleib. Oschu Nau Hun lebt, ich entdeckte sie drüben in den Büschen. Sie ist verletzt. Sonst fand ich nur Tote. Sie – sie wurden verbrannt.“
Der junge Krieger neben dem Bleichgesicht riss den Kopf hoch. „Sie lebt?“
Sein Blick suchte den Ufergürtel ab, nur einen Moment spiegelten sich seine widerstreitenden Gefühle im Gesicht. Als er sich wieder Tse Kil Chtla zuwandte, war davon nichts mehr zu sehen. Der zollte ihm innerlich Respekt dafür. Sie schien ihm viel zu bedeuten. Aber als Anführer durfte der Mann sich jetzt noch nicht um eine Squaw kümmern, egal wie sehr er es ihn dazu drängte.
Erneut wurde Tse Kil Chtla von ihm intensiv gemustert, der Kotsoteka schien ihn nicht einschätzen zu können. Dennoch erklärte er nun, obwohl ihn die Maske sichtlich irritierte, wesentlich freundlicher: „Mein Name ist Munim Pla Han. Wir sind Jäger der Kotsoteka. Wer bist du?“
„Mein Name ist Tse Kil Chtla.“
Prompt zogen sich die Brauen des anderen zusammen. Tse Kil Chtla wartete angespannt. Gegen die ganze Gruppe hatte er keine Chance. Wenn sie ihn wegen der nicht vorhandenen Stammeszeichen als Ausgestoßenen ansehen würden, blieb ihm nur die Flucht. Aber Munim Pla Han wirkte nicht mehr feindselig, eher unsicher.
Einer der Jäger nickte beifällig. Auf den fragenden Blick seines Anführers teilte er leise mit: „Ich hörte von dem fremden Krieger mit dem Namen Tse Kil Chtla. Ein großer Jäger, der überall in Freundschaft kommt. Doch ein harter Kämpfer, wenn er auf Feindschaft stößt.“
Tse Kil Chtla nickte zustimmend. Jetzt wieder gelassen wartete er stumm auf die Entscheidung Munim Pla Hans. Der taxierte ihn noch immer, besonders die Maske. Fast konnte Tse Kil Chtla seine Gedanken hören: ‚Wieso verbirgt er sein Gesicht, wenn er als Freund kommt?‘
Doch dessen Stimme verriet keine Zweifel, sie klang fest und ruhig: „Sei willkommen in den Jagdgründen der Comanchen, Tse Kil Chtla. Du sagst, du bist vor zwei Tagen gekommen. Weißt du, was geschehen ist?“
Grimmig nickte er: „Weiße Skalpjäger. Ihre Spuren führten nach Norden.“
„Teufelsbrut. Verdammt sollen sie sein“, fluchte der hellhäutige Freund der Kotsoteka inständig.
Inzwischen waren alle Männer abgestiegen. Sie brauchten nicht mehr wachsam zu sein, da Tse Kil Chtla von ihrem Anführer anerkannt wurde und er offensichtlich nichts mit dem Überfall zu tun hatte.
Munim Pla Han bat leise: „Mein Bruder wird zu Oschu Nau Hun gehen? Ich komme später nach.“
Das Bleichgesicht nickte und wandte sich an Tse Kil Chtla: „Wo finde ich die junge Squaw? Oh, entschuldige, mein Name ist Thomas Mining.“
Tse Kil Chtla stutzte. „Vor einigen Tagen ritt ich mit zwei Kriegern der Nokomo-Comanchen. Bei ihnen war ein Weißer, sein Name lautete Frank Mining.“
„Du hast Frank getroffen? Er ist mein Bruder.“
Während die Indianer langsam in das zerstörte Lager gingen – Tse Kil Chtla hörte immer wieder ihre entsetzten und wütenden Ausrufe –, führte er den jungen Mann zu seinem Lagerfeuer.
Der stürzte sich fast auf die dort sitzende Frau. „Oschu Nau Hun, kleine Schwester! Du lebst, dem Himmel sei Dank.“ Er bemerkte den Verband. „Du bist verletzt!“
Vorsichtig kniete er neben ihr nieder. Freudig sah die Indianerin ihn an, während sie ihre Wange in seine Hand schmiegte.
„Thomas, ihr seid zurück. Ich bin so froh. Es war schrecklich.“
Zaghaft strich er mit einem Finger über ihre verletzte Schulter.
„Es ist nicht mehr schlimm. Der fremde Krieger fand mich und half mir.“
Der Weiße sah zu Tse Kil Chtla hoch: „Wie kann ich dir danken? Ich – Oschu Nau Hun ist meine Schwester. Ich stehe für immer in deiner Schuld.“
Der schüttelte den Kopf: „Ich fand eine hilflose, verletzte Squaw. Es wäre schändlich gewesen, nicht zu helfen. Du schuldest mir nichts.“
„Oh doch, und nicht nur ich. Auch für Frank ist sie eine Schwester. Und da du ihn getroffen hast, wirst du auch Altscha Mano kennen. Seinen Freund und Bruder.“
Tse Kil Chtla nickte. „Ich ritt zusammen mit ihm, seinem Sohn Tscha Minhau und deinem Bruder.“
Leise bekannte Thomas Mining: „Oschu Nau Hun ist Altscha Manos Tochter. Vor einem halben Jahr erst folgte sie Munim Pla Han in sein Dorf.“
Der Träger dieses Namens trat gerade an das Feuer heran. Sein Gesicht war grau. Auch er kniete neben der jungen Frau nieder, die zu ihm aufsah. In ihren Augen stand reine Liebe.
Munim Pla Han sagte nur zwei Worte: „Du lebst.“ Doch sie enthielten alles, was er fühlte. Seine Liebe zu ihr, seine Erleichterung, dass sie überlebt hatte – und den Schmerz darüber, dass alle anderen tot waren.
Auch er dankte Tse Kil Chtla bewegt und aufrichtig. Doch auch jetzt wehrte der alles ab. Dank bedeutete Verpflichtungen, und ihm durfte niemand verpflichtet sein. Ebenso wie er selbst keine gegenüber anderen einging. Stattdessen packte er seine Sachen zusammen.
Thomas Mining ging zu ihm. „Was hast du vor?“
„Es ist Zeit für mich, weiterzureiten.“
„Willst du nicht mit uns kommen? Wir werden zu den Dörfern der Nokomo gehen. Sie müssen erfahren, was geschehen ist. Altscha Mano wird den Retter seiner Tochter würdigen wollen.“
Tse Kil Chtla grauste es. So etwas war der Beginn einer freundschaftlichen Beziehung. Es gab nichts, was er weniger wollte. Zwischen ihm und anderen musste immer eine gewisse Distanz gewahrt bleiben.
Sein Gesicht blieb ruhig und ernst. Betont förmlich erklärte er: „Tse Kil Chtla lässt Altscha Mano und deinen Bruder grüßen. Doch mein Weg führt fort von hier.“
Er gab keinerlei Gründe an und schüttelte auf weitere Bitten stumm den Kopf. Kurz zeigte er den Kotsoteka noch die inzwischen kaum mehr erkennbaren Spuren der Skalpjäger, sprach aber auch dabei kaum ein Wort. Dann verabschiedete er sich.
Vergangenheit 2
Tag um Tag ritt Tse Kil Chtla weiter nach Südwesten. Die Hügel wurden höher, die schneebedeckten Berge dahinter kamen näher. Immer öfter kreisten die großen Totenvögel, die Geier, über ihm. Hier fanden sie ideale Lebensbedingungen. Die Hitze in dem kargen Land konnte schnell tödlich werden, sowohl für Menschen als auch für die Tiere.
Schließlich erreichte er die ersten tieferen Schluchten. Über Jahrtausende hinweg hatten sich Wildbäche, die zur Schneeschmelze zu reißenden Strömen wurden, in das Gestein gefressen. Anfangs konnte Tse Kil Chtla problemlos die Hänge hinabreiten und die zu dieser Jahreszeit flachen und schmalen Wasserläufe überqueren. Doch je weiter er kam, desto tiefer und schroffer wurden die Abhänge. Er musste stundenlang an deren Rand entlang reiten, bis er eine Stelle fand, an der er es schaffte hinunter zu gelangen. Dann folgte er den fast ausgetrockneten Bächen, bis er sich wieder mit den Pferden nach oben arbeiten konnte. Die Vegetation wurde spärlicher, der Boden war nur noch in Wassernähe fruchtbar. Ansonsten wuchsen in den Ritzen und Senken des felsigen Untergrundes lediglich vereinzelte spröde Grasbüschel oder kleine, oftmals halbvertrocknete Büsche.
Hin und wieder fand der einsame Reiter ein größeres Tal mit breiten, flachen Flüssen. Hier hielten sich gerne Tierherden auf. Den Boden bedeckte hohes, saftig grünes Gras, manchmal existierten sogar kleine Wäldchen. Diese Stellen nutzte Tse Kil Chtla meist für eine längere Ruhepause, ehe er die Täler wieder verließ und über die vor Hitze glühenden Felsen weiter in das Gebirge eindrang.
Schließlich, er folgte seit einem halben Tag dem Rand einer tiefen, steil abfallenden Schlucht, sah er vor sich einen einzelnen verkrüppelten Baum. Die überwiegend toten Äste ragten wie dürre Arme in die Luft, nur wenige trugen noch grüne Blätter. Langsam, den Kopf müde auf den Boden gerichtet, trottete Dorcat weiter. Um Tse Kil Chtlas Mund spielte ein leichtes Lächeln. Wie immer, wenn er hierherkam, erinnerte er sich an den Frühling vor fünf Sommern. Damals war er zum ersten Mal hier gewesen.
Tief in Gedanken war er entlang des Abhangs geritten. Verblüfft hatte er den Baum angestarrt – vor allem das Pony, welches darunter stand. Ansonsten gab es keinerlei Anzeichen für einen Menschen in der Nähe. Aber das Tier war gesattelt und mit einer langen Leine an dem untersten Ast angebunden.
Mit dem Gewehr in der Hand sah Tse Kil Chtla sich um. Der steinige Boden war denkbar ungeeignet, um Fußspuren zu erkennen. Doch vor und hinter sich konnte er das Land einigermaßen gut übersehen. Es war niemand da. Zur Linken ragten steile Felsen empor, die nur sehr mühsam zu erklettern waren – wenn überhaupt. Mit zusammengekniffenen Augen suchte er sie ab. Es schien keine versteckten Spalten zu geben, in denen sich jemand verbergen könnte. Und zu seiner Rechten fiel die Steilwand glatt und fast senkrecht ab bis zu dem schmalen Wasserlauf, dessen Rauschen hier oben nur ganz leise zu hören war.
Da erklang plötzlich eine hohe, angsterfüllte Stimme – aus der Schlucht heraus: „Hilfe – Hiiilfe! Ist da jemand? Bitte, ich bin hier unten. Hilfe!“ Einen Moment Pause, dann rief die unsichtbare Person erneut, diesmal jedoch auf Spanisch.
Tse Kil Chtla griff nach dem Lasso hinter sich. Noch während er vom Pferd sprang, wand er das Seil zu einer großen Schlinge und lief auf den Abhang zu. Wenige Schritte vor dem Rand ließ er sich zu Boden sinken und kroch vorsichtig weiter. Dann warf er einen Blick hinab und erschrak.
Etwa zwei Mannslängen unter ihm, auf einem schmalen Felsgrat und sich verzweifelt an dem dürren Gesträuch darüber festklammernd, stand – ein Kind! Ein Mädchen! Jedenfalls trug es ein Kleid. Tse Kil Chtla sog entsetzt die Luft ein.
Auf Englisch, die Kleine hatte zuerst diese Sprache benutzt, rief er ihr zu: „Warte bis das Seil bei dir ist, dann strecke deine Arme durch die Schlinge, langsam, erst einen, dann den anderen. Halte dich dabei weiter fest.“
Vorsichtig, damit es nirgends hängen blieb, ließ er das Lasso über dem Kind hinab. Voller Sorge beobachtete er, wie ihre kleine Faust nach der Schlaufe griff. Doch schließlich lag das Seil sicher um ihren Oberkörper.
„Warte, bis die Leine sich spannt“, erklärte er. „Dann versuche, dich von den Felsen abzustemmen, damit du dich nicht verletzt. Ich ziehe dich herauf.“
Das Mädchen starrte zu ihm hoch und nickte. Tse Kil Chtla robbte einige Schritte zurück, stand auf und befestigte das Seil sicherheitshalber an Dorcats Satteldecke. Dann stemmte er die Beine in den Boden und begann, langsam zu ziehen. Nach kurzer Zeit sah er zwei kleine Hände, dann erschien ein Köpfchen, und schließlich rollte sich der schmale Körper seitlich über den Rand und blieb heftig atmend liegen.
Der Indianer hob das Kind empor und trug es hinüber zum Baum. Hier gab es wenigstens etwas Schatten. Behutsam legte er es nieder und gab ihm Wasser. Durstig trank die Kleine, während er sie betrachtete. Er schätzte sie auf zehn oder elf Jahre. Goldbraunes Haar umgab das herzförmige Gesicht. Zwei lange Zöpfe, jetzt reichlich zerzaust, fielen ihr bis weit auf den Rücken. Die Unterarme waren unbedeckt und von der Sonne leicht gebräunt. Das blaugraue Kleid aus festem Stoff wies mehrere große Risse auf.
Sie gab ihm die Wasserflasche zurück und schaute ihn an. Tse Kil Chtla fand sich plötzlich in dem Blick dieser unglaublich großen, tiefblauen Augen gefangen. In ihnen lag weder Erschrecken noch Furcht – über die unheimliche, furchterregende Ledermaske, die er trug, oder die Tatsache, dass er ein Indianer war. Nein, stattdessen strahlten sie Vertrauen und Dankbarkeit aus, in einer Intensität, die ihn schlucken ließ.
Dann ergriff das Mädchen seine Hände: „Danke, vielen Dank. Ich hatte da unten solche Angst. Vielen Dank, dass du hier warst und mir geholfen hast.“
„Es war Zufall.“ Tse Kil Chtla bemerkte erst jetzt das Blut an ihren Fingern. „Du musst Schmerzen haben. Warte, ich helfe dir.“
„Ja, sie brennen.“ Sie verzog die Lippen, weinte aber nicht.