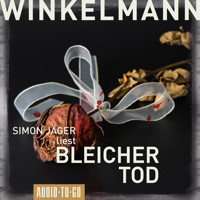9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach «Blinder Instinkt», «Wassermanns Zorn» und «Deathbook» der neue packende Thriller von Bestsellerautor Andreas Winkelmann. Nur fünf Minuten hat Helga Schwabe ihren Sohn aus den Augen gelassen. Einen unaufmerksamen Moment lang. Und in diesem Moment ist er verschwunden. Als fielen Hauptkommissar Henry Conroy die Ermittlungen in diesem Fall mutmaßlicher Kindesentführung nicht schon schwer genug, muss er sich auch noch mit einer neuen Kollegin herumschlagen. Vorlaut, frech, selbstbestimmt – das ist Manuela Sperling. Aber sie hat einen guten Riecher. Und bald stoßen die beiden auf eine Spur, die zu einem alten Gehöft im Niemandsland an der Grenze zu Tschechien führt, auf dem illegal Hunde gezüchtet werden. Hunde, die Fleisch brauchen, viel Fleisch. Und ihr Züchter besorgt es ihnen, koste es, was es wolle …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Andreas Winkelmann
Die Zucht
Thriller
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Nach «Blinder Instinkt», «Wassermanns Zorn» und «Deathbook» der neue packende Thriller von Bestsellerautor Andreas Winkelmann, für alle Fans von Sebastian Fitzek und Michael Robotham.
Nur fünf Minuten hat Helga Schwabe ihren Sohn aus den Augen gelassen. Einen unaufmerksamen Moment lang. Und in diesem Moment ist er verschwunden.
Als fielen Hauptkommissar Henry Conroy die Ermittlungen in diesem Fall mutmaßlicher Kindesentführung nicht schon schwer genug, muss er sich auch noch mit einer neuen Kollegin herumschlagen. Vorlaut, frech, selbstbestimmt – das ist Manuela Sperling. Aber sie hat einen guten Riecher. Und bald stoßen die beiden auf eine Spur, die zu einem alten Gehöft im Niemandsland an der Grenze zu Tschechien führt, auf dem illegal Hunde gezüchtet werden. Hunde, die Fleisch brauchen, viel Fleisch. Und ihr Züchter besorgt es ihnen, koste es, was es wolle …
Über Andreas Winkelmann
Andreas Winkelmann, geboren im Dezember 1968 in Niedersachsen, ist verheiratet und hat eine Tochter. Er lebt mit seiner Familie in einem einsamen Haus am Waldesrand nahe Bremen. Bei Wunderlich erschienen bisher seine sehr erfolgreichen Thriller «Wassermanns Zorn» und «Deathbook».
Inhaltsübersicht
Für Aylin, die Hunde liebt.
Teil 1
1
Der Hund hob den massigen Schädel, reckte die Nase in die Luft und nahm die Witterung auf. Eben noch hatte er friedlich in der Sonne gedöst, jetzt war er hellwach. Helga Schwabe erstarrte mit dem schweren Korb auf der Hüfte auf halbem Weg zwischen Haus und Wäscheplatz. Ihr Blick ging hinüber zu dem undurchdringlichen Maisfeld.
Hatte sie aus der Richtung gerade einen Ruf vernommen? Eine leise, lockende Stimme?
Komm zu mir … Komm zu mir …
Böiger Ostwind strich über das scheinbar endlose Maisfeld. Er ließ die Blätter rascheln, trug ihr geisterhaftes Raunen zu ihr herüber und fuhr in die weißen Laken auf der Leine. Flatternd fingen sie den Wind, bauschten sich spielerisch mit ihm auf, um einen Moment später leblos zu erschlaffen.
Nein, es war nur der Mais, wie immer, beruhigte Helga sich.
Auf den großen Feldern östlich ihres Grundstückes reckten sich die Pflanzen jetzt, Ende September, mehr als mannshoch auf und strotzten nur so vor Kraft. Fegte der Wind in dieses grüne Labyrinth, rieben die harten, scharfkantigen Blätter aneinander. Besonders nachts konnte das recht laut sein, und ein paarmal war Helga davon bereits aus dem Schlaf geschreckt. Sie mochte keine Maisfelder. Die Pflanzen sahen aus wie unheimliche, vielarmige Wesen, und zwischen ihnen herrschte diese eigentümliche, grünliche Dunkelheit. Außerdem erinnerte sich Helga noch gut an die Geschichte vom Bilgenschneider, von dem ihr ihre Großmutter flüsternd erzählt hatte. Mit seinem scharfen Sichelmesser wandelte er zwischen den Reihen, schnitt die Ähren vom Getreide und stahl sie den Bauern. Ab und an holte sich der Bilgenschneider ein menschliches Opfer, schnitt ihm den Kopf ab und tränkte mit dessen Blut den Boden.
Trotz des warmen Spätsommerwetters fror Helga. Auf ihren nackten Oberarmen bildete sich eine Gänsehaut. Von plötzlicher Sorge gepackt, sah sie zu Oleg hinüber. Ihr sechsjähriger Sohn spielte in der Sandkiste, die sein Vater erst im Frühjahr aufgestellt und mit weißem Maurersand gefüllt hatte. Oleg konnte sich stundenlang darin beschäftigen. Wenn er mit seinen bunten Formen einen Sandkuchen nach dem anderen buk, vergaß er vollkommen die Zeit. Perfekt und absolut gleichförmig mussten sie sein. Er verwandte viel Zeit darauf, auch kleinste Unebenheiten zu entfernen.
Pedro, der zwei Jahre alte Berner Sennenrüde, hatte seinen schattigen Platz neben der Sandkiste verlassen und sich zu voller Größe aufgerichtet. Er war eine ruhige und absolut treue Seele. Wenn er sich entscheiden musste, auf wen er aufpassen sollte, dann entschied er sich immer für Oleg. Bei diesen Temperaturen bewegte Pedro sich so wenig wie möglich, und es brauchte schon einen guten Grund, dass er seinen Platz neben Oleg verließ. Jetzt aber trottete er bis an die Grundstücksgrenze, blieb vor dem hüfthohen Maschendrahtzaun stehen und hielt abermals witternd die Nase in den Wind.
Helga stellte den Wäschekorb ab und folgte ihm.
«Was ist, Großer? Hast du etwas gehört?»
Auf dem Feldweg war nichts zu sehen. Und der Mais stand so dicht, dass man nur zwei Reihen tief hineinschauen konnte. Pedro bellte nicht, das tat er so gut wie nie, aber er machte einen wachsamen, konzentrierten Eindruck. Wahrscheinlich hatte er die Witterung eines Hasen in der Nase. Davon gab es hier viele, und Pedro liebte es, sie aufzuscheuchen.
Helga Schwabe war froh, dass sie sich gegen ihren Mann durchgesetzt hatte. Nach dem schrecklichen Tod ihres ersten Hundes hatte Arthur keinen neuen gewollt. Aber da sie hier draußen sehr einsam lebten, Arthur den ganzen Tag auf der Arbeit war und Helga vor allem und jedem Angst hatte, hatte Arthur irgendwann nachgegeben und sich sogar selbst um einen neuen Hofhund gekümmert.
Pedro auf dem Hof zu haben beruhigte sie, auch jetzt. Helga widmete sich wieder ihrer Wäsche. Immer wieder ging dabei ihr Blick zur Sandkiste hinüber.
In seiner angespannten Konzentration wirkte Oleg älter, als er war. Sie wünschte sich, er könnte immer sechs Jahre alt bleiben, aber irgendwann würde die Zeit ihn ihr entreißen. Diese Vorstellung machte sie schon jetzt ein wenig traurig. Arthur und sie hätten eigentlich überhaupt keine Kinder bekommen sollen, zumindest nicht nach Einschätzung der Ärzte. Und neun Jahre lang hatte es auch so ausgesehen, als würden sie recht behalten. Dann aber, als es beinahe schon zu spät gewesen war, hatte Gott sich eingemischt, und Helga dankte dem Schöpfer jeden Abend auf Knien für dieses kleine Wunder aus Fleisch und Blut, das dort im Sandkasten spielte.
Zehn Minuten später hatte sie das letzte Kleidungsstück aufgehängt und machte sich mit dem leeren Korb auf den Rückweg zum Haus. Pedro lag an seinem angestammten Platz neben der Sandkiste und döste.
«Oleg, ich bin drinnen», rief sie ihrem Sohn zu.
«Okay», antwortete er, ohne aufzublicken.
Sie zog die Tür auf und betrat das kühle Haus. Im Wirtschaftsraum stellte sie den Wäschekorb vor die Waschmaschine und bemerkte den leeren Hundenapf unter dem alten Waschbecken.
Das war es also, dachte sie mit einem Blick zur Uhr. Pedro war hungrig. Deshalb war er so unruhig. Seine Zeit ist ja auch längst vorbei.
Das Fünfzig-Kilo-Kalb brauchte pro Tag drei Mahlzeiten, um über die Runden zu kommen. Die letzte bekam er stets schon am späten Nachmittag.
Helga bereitete das Fressen zu, eine Mischung aus Nass- und Trockenfutter, und als sie den Löffel auf dem Rand des Metallnapfes abklopfte, tauchte Pedros massiger Schädel vor der verglasten Tür auf.
«Na komm, Vielfraß, sonst fällst du uns noch vom Fleisch.»
Sie ließ ihn herein, schloss die Tür und ging hinüber in die Küche, um mit den Vorbereitungen für das Abendessen zu beginnen. Sie hatte gerade mal fünf Kartoffeln geschält, da stieß Pedro einen dumpfen Laut aus. Kein richtiges Bellen und auch kein Knurren, sondern irgendwas dazwischen. Es klang bedrohlich.
Helga warf einen Blick aus dem Küchenfenster. Es ging auf den Hof hinaus, und wenn sie sich vorbeugte, konnte sie ein Stück der Straße sehen. Da war niemand. Trotzdem begann Pedro böse zu knurren.
Das kannte sie nicht von ihm. Helga ließ Kartoffel und Schälmesser fallen und eilte hinüber in den Wirtschaftsraum.
Pedro stand vor der Milchglasscheibe der Tür. Seine Rute wedelte nicht, sondern war zwischen den Hinterläufen eingeklemmt. Er warf Helga einen schnellen Blick zu, bevor er erneut die Tür anknurrte.
«Was hast du denn?», fragte Helga und öffnete sie.
Pedro schoss bellend davon, lief über die gepflasterte Terrasse auf den Rasen und verschwand zwischen den Bettlaken. Im selben Moment bauschte der Wind die Laken auf und gewährte Helga einen Blick auf den Sandkasten.
Er war leer.
2
Arthur Schwabe stieß die Autotür auf. Sofort drang wütendes, heiseres Hundegebell herein. Dazwischen schrie jemand immer wieder einen Namen.
Oleg.
Statt wie üblich das Haus durch die Vordertür zu betreten, lief Arthur Schwabe seitlich daran entlang. Pedro sprang aufgeregt am Zaun hin und her und kläffte in Richtung des Maisfeldes. Helga war nicht zu sehen. Arthur trat durch die Pforte im Zaun, schloss sie hinter sich, damit der Hund nicht weglaufen konnte, lief den abschüssigen Feldweg hinunter und entdeckte seine Frau auf halber Strecke zum Wald. Sie hatte ihm den Rücken zugewandt, beide Hände zu einem Trichter geformt an den Mund gelegt und rief nach Oleg.
«Helga», schrie Arthur.
Sie fuhr herum und rannte ihm entgegen. Ruderte dabei hysterisch mit den Armen. Arthur sah Tränen ihre roten Wangen hinabfließen. Die Haare standen ihr zu allen Seiten ab. Seine Frau wirkte auf ihn wie eine Verrückte.
«Arthur», schrie sie, «Gott sei Dank … Oleg, ich finde ihn nicht.»
Arthur packte seine Frau bei den Schultern.
«Was ist passiert? Wo ist der Junge?»
Er sprach viel zu laut, viel zu aggressiv, aber die Panik seiner Frau war auf ihn übergesprungen und erfüllte ihn. War dies der Tag, vor dem er sich schon so lange fürchtete?
«Er war im Sandkasten … ich habe nur Kartoffeln geschält …»
Ihre Augen zuckten hin und her. Sie roch nach Schweiß, ihr dünnes ärmelloses Sommerkleid klebte am dicken Körper unter der Küchenschürze.
«Seit wann ist er weg?»
«Ich weiß nicht … eben … vielleicht zehn Minuten … oh, großer Gott, tu doch etwas … mein Kind … der Bilgenschneider hat ihn geholt.»
«Beruhige dich», fuhr Arthur seine Frau an und schüttelte sie. Ihr Kopf wackelte wie bei einer Puppe hin und her. Nur mühsam widerstand er der Versuchung, sie zu schlagen. Er hasste es, dass sie immer noch an diese alten Märchen glaubte. War sie denn wirklich so dumm?
Er ließ sie los und sah sich um.
Was sollte er tun? Wo suchen? Wen alarmieren?
Pedro bellte wie verrückt, stand jetzt sogar mit den Vorderläufen auf dem Zaun und bog ihn mit seinem Gewicht weit hinunter. Wäre er nicht so schwerfällig, wäre er sicher längst hinübergesprungen.
Der Hund, schoss es Arthur durch den Kopf.
Er lief zur Pforte zurück und öffnete sie. Pedro kam herangeprescht. Arthur packte das breite Lederhalsband und hielt den Hund fest.
«Such», sagte Arthur. «Wo ist Oleg?»
Der massige schwarzbraune Hund drängte nach vorn und riss Arthur fast von den Füßen. Seine rechte Hand um das Halsband geklammert, stolperte er neben Pedro her. Ohne zu zögern lief der Hund den Feldweg in Richtung Wald hinunter. Je weiter sie sich von ihrem Grundstück entfernten, desto langsamer wurde er. Er schien eine Fährte aufzunehmen. Schließlich machte er einen Satz nach links auf das Maisfeld zu und wäre darin verschwunden, hätte Arthur ihn nicht mit einem kräftigen Ruck zurückgerissen.
«Nein. Sitz», schrie er.
Der Hund begann zu winseln.
Vor Arthur ragten dunkelgrüne Maispflanzen auf, die größer waren als er selbst. Bis in die zweite Reihe konnte er schauen, dahinter verschwamm alles zu einem grünen, wogenden Urwald.
Helga presste sich die zu Fäusten geballten Hände seitlich ans Gesicht. Sie weinte. Dieses Geflenne machte Arthur aggressiv.
«Ruf die Polizei», schrie er sie an.
«Aber …»
«Sofort.»
Dann wandte er sich wieder dem Maisfeld zu.
«Such, Pedro!»
Der Hund sprang vor und riss Arthur mit sich ins grüne Dickicht. Die scharfkantigen Blätter schlugen ihm ins Gesicht. Der schwere lehmige Boden war voller Furchen. Aber er musste weiter. Er musste Oleg finden, das allein zählte. Der Kleine war ein folgsamer Junge, der nicht einfach das Grundstück verließ. Und er würde auch niemals mit einem Fremden mitgehen. Dass er verschwunden war, konnte nur einen Grund haben: Jemand hatte ihn sich geholt. Und dieser Jemand war mit Oleg durch das Maisfeld geflüchtet. Hoffentlich war noch nicht allzu viel Zeit vergangen, hoffentlich kam er noch rechtzeitig! Er würde jeden töten, der seinem Sohn etwas antat, wenn es sein musste, auch mit bloßen Händen.
Pedro zog nach rechts, Arthur folgte ihm.
Mitten im Maisfeld waren einige Pflanzen umgeknickt. Die so entstandene Fläche war nicht größer als ein Meter im Quadrat. Es sah so aus, als hätte hier ein Kampf stattgefunden. Vielleicht hatte Oleg sich gewehrt.
Pedro schnüffelte hier und da. Er schien die Fährte verloren zu haben.
Arthur ließ das Halsband los. Er wollte sich aufrichten, um seinen schmerzenden Rücken zu entlasten. Da stieß Pedro ein dumpfes Bellen aus und stürmte davon.
«Nein, hier, komm hierher», schrie Arthur, doch es war zu spät.
Alles, was er von seinem Hund noch sah, waren umgeknickte Maispflanzen. Stolpernd folgte er ihm und kam auf eine breite Schneise. Sie verlief in Nord-Süd-Richtung, zerschnitt das große Feld in zwei Teile. Offenbar diente sie den Traktoren dazu, die Pflanzen während der Wachstumsphase mit Pestiziden einzusprühen, ohne sie zu beschädigen.
Schwer atmend blieb Arthur stehen und blickte sich um.
«Pedro», rief er. «Oleg!»
Der Hund bellte. Das kam von unten, wo das Feld gegen den Waldrand stieß. Arthur stürmte los. In der Schneise konnte er schneller laufen. Nach hundert Metern endete das Maisfeld an dem unbefestigten Weg, der am Waldrand entlangführte. Pedro befand sich jetzt links von ihm. Von weitem sah es so aus, als kämpfe er gegen einen unsichtbaren Feind.
Arthur erkannte dunkle, glänzende Flecken im Gras und an den Maisstängeln.
Der schwere, metallene Geruch von Blut erfüllte die Luft.
3
Henry Conroy stand unter der mächtigen Kastanie, die Einfahrt und Vorgarten des alten Resthofes beschattete. Rund um den Stamm hatten die Wurzeln das graue Pflaster aufgeworfen. Es sah aus, als würde sich etwas Gewaltiges aus dem Erdreich emporarbeiten. Nur noch eine hauchdünne Schicht hielt es zurück. Aber nicht mehr lange, der Ausbruch stand kurz bevor.
Henry legte den Kopf in den Nacken und sah in die Krone hinauf. Vereinzelt drang Sonnenlicht durch das dichte Laub. Die Blätter waren allesamt braun gefleckt, der Baum wirkte krank. Das alte, backsteinerne Haus wirkte krank. Alles hier wirkte kank, trotz der ländlichen Idylle und des guten Wetters. Hinter der pockennarbigen Fassade bürgerlichen Alltags lauerte dasselbe Virus, das den Rest der Welt befallen hatte.
Was vor kurzem hier geschehen war, bestätigte Henry Conroy nur in seiner Überzeugung, in einer kranken, nicht therapierbaren Welt zu leben. Was er tun konnte, war, hie und da ein Pflaster aufzukleben, mehr nicht. Aber sofort brachen an anderer Stelle neue Wunden auf. Ein Hoch auf die Arschlöcher dieser Welt, die seinen Arbeitsplatz sicherten.
Henry sah zu der schmalen Teerstraße hinüber, die aus der kleinen Ortschaft Hohberg hierherführte und neben dem Haus der Schwabes in einen Feldweg überging. In der Mitte des Feldweges stand eine hohe Grasnarbe. Die Fahrspuren rechts und links davon waren tief, der trockene Sand darin weich und von breiten Traktorreifen zermahlen. Der letzte Regen lag länger als eine Woche zurück. Die Sonne hatte den Boden ausgetrocknet, auf Reifenspuren brauchten sie also nicht zu hoffen.
Die Spurentechniker arbeiteten in zwei Gruppen. Eine kroch auf Knien durch den Garten der Schwabes, die andere suchte unten am Waldrand. Dort, so hatte ihm sein Kollege Jens Jagoda telefonisch berichtet, hatte der Vater Blutspuren gefunden, eventuell sogar Gewebestücke. Und natürlich war er drauf herumgetrampelt, bevor er die Polizei informiert hatte. Auch Henry würde dieser Anblick nicht erspart bleiben, aber vorher wollte er einen Blick auf das Grundstück werfen. Sollten die Jungs von der Spurensicherung die Leiche des Jungen im Wald finden, würde er es früh genug erfahren, seine Anwesenheit dort unten spielte keine entscheidende Rolle. Wichtiger war die Fahndung, die er sofort eingeleitet hatte. Jeder Polizist in diesem Bundesland – und auch im angrenzenden – musste darüber informiert werden, dass ein sechsjähriger Junge vermisste wurde. Sie würden jeden Pkw anhalten, in dem eine einzelne männliche Person saß. Vielleicht hatten sie Glück und fanden jemanden, an dessen Händen oder der Kleidung Blut klebte. Laien meinten immer, der Abschaum der Gesellschaft sei besonders intelligent, aber das stimmte nicht. Die meisten Straftäter waren saublöd.
Den Blutspuren nach zu urteilen, konnten sie dem Jungen nicht mehr helfen. Aber die Jagd nach dem Täter, die konnten sie noch gewinnen. Leider hatten die Schwabes eine halbe Stunde verstreichen lassen, ehe sie die Polizei gerufen hatten. Verständlich, jeder suchte erst einmal selbst nach seinem Kind. Für die Fahndung war es allerdings schlecht. In einer halben Stunde konnte man weit kommen. In etwas mehr als der doppelten Zeit ließ sich problemlos die Grenze nach Tschechien erreichen.
Henrys Magen grummelte und kniff. Er hatte wenig gegessen, aber daran lag es nicht allein. Es war dieser Fall. Er wollte ihn nicht, und sein Körper sträubte sich dagegen. Da er aber bereits seit drei Tagen nichts weiter getan hatte, als die Ablage zu bearbeiten, hatte der stellvertretende Polizeichef Nikolaus Sackstedt ihn eingeteilt. Natürlich. Henry dachte darüber nach, sich morgen krankzumelden und Jens Jagoda den Kram aufzubürden. Nur um Sackstedt eins auszuwischen.
Morgen. Vielleicht. Aber jetzt musste er ran. Und er durfte keine Fehler machen.
Henry folgte dem Feldweg bis zur Rückseite des Hauses und blieb vor einer Pforte im Maschendrahtzaun stehen. Ein Techniker in weißem Spezialanzug war damit beschäftigt, von dem metallenen Gestänge der Pforte Spuren zu extrahieren.
«Ist er hier durch?», fragte Henry ihn.
Der Mann nickte, ohne seine Arbeit zu unterbrechen.
«Wahrscheinlich. Das Tor stand offen, und die Mutter sagt, es hätte nicht offen stehen dürfen, schon allein wegen des Hundes nicht. Aber sie haben alle dran herumgegrabbelt. Die Mutter, der Vater …»
Henry besah sich den Garten. Von der Pforte bis zum Sandkasten, wo der kleine Oleg zuletzt gesehen worden war, waren es etwa fünf Meter. Das Maisfeld drängte sich bis auf drei Meter an das Grundstück heran. Aus der Sicht eines Entführers waren das geradezu ideale Bedingungen. Natürlich musste man dazu erst einmal wissen, dass hier ein Junge lebte. Der Hof lag einsam am Ende der Teerstraße. Selbst das Navigationssystem hatte Henry nicht wie gewohnt bis vor die Haustür geführt, sondern schon an der einzigen Kreuzung im Ort kapituliert – und von dort aus waren es noch einmal zweihundert Meter die Straße hinunter. Durchgangsverkehr gab es nicht. Hier fuhren nur Landwirte, Förster und Jäger, und die stammten vermutlich alle aus Hohberg oder der näheren Umgebung.
Henry zog das Diktiergerät aus seiner Hosentasche. Es war klein und verschwand fast in seiner Handfläche. Zugegebenermaßen hatte er große Handflächen. Pranken, wie Serena immer gesagt hatte.
«Täter kann das Haus der Schwabes nicht zufällig gefunden haben», sprach er ins Mikrophon. «Familienbeziehungen prüfen. Landwirte und Jäger aus Hohberg überprüfen.»
Er wandte sich an den Spurentechniker.
«Hat sich schon jemand im Maisfeld umgesehen?», fragte er.
«Nicht dass ich wüsste.»
«Der Täter wird den kürzesten Weg zwischen Pforte und Maisfeld gewählt haben. Außerdem wird er das Grundstück von dort aus beobachtet haben. Maispflanzen haben scharfe Blätter. Eventuell hat er Faserspuren oder sogar genetische Spuren hinterlassen. Kümmern Sie sich bitte darum.»
«Wird gemacht», sagte der Techniker und ließ Henry das Tor passieren.
Vor dem rechteckigen Sandkasten aus billigem Nadelholz blieb Henry stehen und betrachtete die Figuren darin. In nahezu exakten Abständen waren Dutzende vierblättrige Kleeblätter aufgereiht.
Sollen die nicht Glück bringen?, dachte er.
Dass dem nicht so war, davon zeugte der große Fußabdruck, der einige der Kleeblattsandkuchen zerstört hatte. Er war mit einem roten Fähnchen markiert und von einem Stützrand aus Kunststoff umgeben. Daneben lag ein Maßstab. Ein weiterer Spurentechniker hockte im Gras und bereitete eine Gipsmischung zu, mit der er den Eindruck ausgießen würde.
«Warum ist der Sand so feucht?», fragte Henry.
Der Techniker drehte sich zu ihm um, und Henry erkannte, dass in dem weißen Anzug eine junge Frau steckte.
«Der Vater sprüht ihn jeden Abend mit dem Wasserschlauch ein, damit er sich formen lässt», antwortete sie. «Wir können von Glück reden … das ist eine der besten Eindruckspuren, die ich je gesehen habe.»
«Glück ist für Menschen ohne Talent und Verstand», sagte Henry. «Zählen Sie sich dazu?»
«Zumindest zähle ich mich nicht zu den Menschen ohne Humor», erwiderte sie und schenkte ihm ein Lächeln.
Henrys Miene blieb unbewegt. Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte er Schlagfertigkeit respektiert. Heute nervte sie ihn nur noch. Die Leute sollten ihre Arbeit vernünftig machen, dann musste er auch nicht den Kotzbrocken spielen.
Serena war äußerst schlagfertig gewesen, und wenn sie gut drauf und hellwach gewesen war, hatte er von ihr sogar noch etwas lernen können. Er hatte ihre kleinen verbalen Spielchen geliebt, die für Außenstehende wie Streit gewirkt haben mochten. Sie auch. Es war schon komisch, dass er ausgerechnet jetzt an sie denken musste. Andererseits auch wieder nicht. Er dachte meistens in den abwegigsten Momenten an sie.
Die Spurentechnikerin hatte aber recht. Der Schuhabdruck konnte von großer Bedeutung sein. Vor Gericht zählten nur die Fakten, und dies hier war einer. Sie würden den Täter durch diesen Abdruck nicht finden, aber sie könnten später die Schuhe eines Tatverdächtigen damit vergleichen. Jeder Mensch nutzte die Sohlen seiner Schuhe auf eine ganz bestimmte Art und Weise ab.
«Welche Größe?», fragte er.
«Sechsundvierzig.»
«Irgendeine Besonderheit?»
Die Frau nickte, ließ von ihrem Gipsbrei ab, beugte sich über die Sandkiste und deutete auf den vorderen Bereich des Abdrucks, an dessen Ränder sich die Reste der sandigen Kleeblätter schmiegten.
«Sehen Sie hier … ein tiefer Riss. Die Sohle ist wohl ziemlich alt.»
Henry erkannte, was sie meinte.
«Alt bedeutet, der Täter könnte diese Schuhe mit der Absicht angezogen haben, sie später zu entsorgen.»
Die Frau schüttelte den Kopf und strich eine Haarsträhne unter die weiße Haube zurück.
«Glaube ich nicht. Vielleicht trägt er diese Schuhe einfach gern. Sie wissen doch, wie ungern sich Menschen von eingelaufenen Schuhen trennen.»
Wieder hatte sie recht. Menschen waren Gewohnheitstiere und als solche berechenbar. Selbst die, die sich für unberechenbar hielten. Aber Glück und Glaube hatten in der Ermittlungsarbeit nichts zu suchen, und Henry ärgerte sich über das Gebrauchsvokabular der jungen Frau.
Er ließ sie ihre Arbeit machen und entfernte sich von dem Sandkasten. Dabei sprach er abermals in sein Diktiergerät.
«Altkleidercontainer an den möglichen Fluchtrouten kontrollieren. Schuhe. Größe 46.»
Schließlich blieb er vor der Wäscheleine stehen. Daran hingen drei weiße, bereits getrocknete Bettlaken, die im Abendwind sanft hin und her schwangen. Henry konnte sich kaum einen friedlicheren, normaleren Anblick vorstellen.
Ihm fielen dunkle Schatten auf den Laken auf. Handabdrücke.
«Von wem stammen die?», fragte er die Spurentechnikerin.
Die hatte damit begonnen, den flüssigen Gips vorsichtig löffelweise in den Plastikrahmen zu füllen. Sie sah nur kurz zu ihm auf.
«Von der Mutter.»
Henry nickte und betrachtete den Wäscheplatz. So, wie die Leinen zwischen dem Sandkasten und dem Haus hingen, wurde die daran aufgehängte Wäsche zu einem Sichtschutz. Sowohl von der Pforte als auch von der rückwärtigen Seite der Grundstücksgrenze aus konnte man sich dem Sandkasten nähern, ohne aus dem Haus gesehen zu werden.
Die Mutter hängt nie wieder draußen Wäsche auf, dachte er.
Er schob die Laken auseinander und warf einen Blick auf die nächste Leine. Daran hingen zwei Unterhosen, die von der Größe her nur dem Jungen gehören konnten. Es waren altmodische weiße Feinripphosen mit Eingriff. Zwischen den beiden klaffte eine Lücke.
Henry hob das Diktiergerät an.
«Klären, wie viele Unterhosen auf der Leine waren. Fehlt eine?»
Kaum hatte er es weggesteckt, klingelte sein Handy.
Gruber war dran.
«Komm bitte zu uns, Henry. Das ist … unglaublich widerlich.»
4
Der Wald umgab sie wie ein schwarzer Ring, hinter dem alles Leben und alle Sicherheit zurückblieben, und das jagte Rieke Schneider Angst ein.
Anderthalb Stunden war sie gefahren, bevor sie ihren altersschwachen Berlingo rückwärts in einen schmalen Waldweg gesetzt hatte. Von dort aus war es noch einmal eine halbe Stunde Fußmarsch durch dichten Wald gewesen. Dass es eine derart menschenleere Gegend in Deutschland überhaupt noch gab, war schon erschreckend genug. Aber dass der merkwürdige Typ, dem sie einen Besuch abstatten wollte, hier lebte, machte es nur noch schlimmer. Aber gut, sie hatte gewusst, worauf sie sich einließ, und kneifen würde sie auf keinen Fall. Vielleicht wäre es aber doch angebracht gewesen, das alles ein bisschen besser zu planen.
Zwar hatte sie zu Hause auf dem Computer Notizen gemacht, einen Lageplan angelegt und anhand der schlechten Fotos, die sie während ihres ersten Besuchs hier draußen mit dem Handy geschossen hatte, überlegt, von wo sie sich am besten nähern könnte. Von einem geplanten Vorgehen konnte bei dieser Aktion aber trotzdem nicht die Rede sein. In der Vergangenheit war es gerade ihre Spontaneität gewesen, mit der ihre Gruppe die größten Erfolge erzielt hatte. Wenn alle anderen mit harten Bandagen kämpften, durfte man selbst nicht zimperlich sein. Aber heute erschien ihr das ganze Unternehmen irgendwie … gewagt.
Rieke Schneider sah zum Himmel hinauf. Noch gab es ein wenig Restlicht, einen rötlich-violett gefärbten, samtenen Schimmer, der unter anderen Umständen schön gewesen wäre und sie in atemloses Staunen versetzt hätte. Spätestens in einer halben Stunde würde es hier zwischen den Tannen vollkommen dunkel sein. Bis dahin musste sie noch abwarten, denn auf den letzten fünfzig Metern vom Waldrand bis zum Grundstück, das von einem einfachen, aber zwei Meter hohen Maschendrahtzaun umgeben war, gab es keinerlei Deckung.
Rieke hasste diese verflixte Warterei. Zu viel Zeit zum Nachdenken tat ihr nicht gut. Handeln war ihr Motto, nicht Zaudern und Zögern. Diese Einstellung hatte sie bereits das eine oder andere Mal in Schwierigkeiten und sogar eine Nacht in den Knast gebracht, aber richtig gefährlich geworden war es nie. Vielleicht wachte ja tatsächlich eine höhere Macht über sie, weil das, was sie tat, wichtig war.
«Du bist so unverschämt dreist, auf dich muss einfach ein Schutzengel aufpassen», hatte Lea einmal gesagt.
Lea war ihre beste Freundin, sie hätte sie von dieser Aktion abgehalten, und genau deshalb hatte sie ihr auch nichts erzählt. Sie war ja sowieso nur hier, um Infos zu sammeln, ein paar gute Fotos zu schießen und, na ja, vielleicht, wenn sich die Möglichkeit ergab, den einen oder anderen Verschlag zu öffnen.
Rieke hätte Lea gern dabeigehabt, aber die lange Autofahrt wäre nichts für ihre Freundin gewesen. Anderthalb Stunden hielt sie einfach nicht durch, sie war noch nicht so weit. Vielleicht würde sie es auch nie wieder sein. Den anderen Mitgliedern ihrer Gruppe hatte sie auch nichts gesagt, weil dann alles wieder nach dem üblichen Schema F abgelaufen wäre. Hintergrundrecherche am PC. Pläne schmieden. Die Rechtslage checken, jeden Beitrag ausdiskutieren und so weiter und so fort.
Das nervte.
Eigentlich war sie sowieso nur noch Lea zuliebe dabei. Vielleicht sollten sie beide eine eigene kleine, schlagkräftige Gruppe gründen und auf all die Angsthasen und Theoretiker pfeifen.
Ein Licht flammte in der grauschwarzen Ebene vor ihr auf.
Rieke zuckte zusammen und duckte sich tiefer ins Gras. Sie beobachtete das niedrige Stallgebäude, das wie ein zum Sprung geducktes Tier im Halbdunkel dalag. An dessen Giebelwand leuchtete jetzt eine Glühbirne. Niemand ließ sich blicken. Wahrscheinlich schaltete sich das Licht über einen Sensor selbsttätig ein, und der Typ war gar nicht da. Dafür sprach auch, dass Rieke sein Auto nicht entdecken konnte, aber das konnte ebenso gut in der großen Scheune parken.
Rieke hatte den Mann zum ersten Mal in dem Tierfachmarkt gesehen, in dem sie jobbte. An dem Tag hatte sie keinen Dienst gehabt, war aber im Laden gewesen, um mit Stefanie, der Inhaberin, zu quatschen. Stefanie machte hin und wieder bei ihrer Organisation mit. Schon beim Hereinkommen war der Mann Rieke aufgefallen. Er trug einen schmutzigen blauen Overall aus Baumwolle, der ihm zwei Nummern zu groß war und an seinem dünnen Körper herumschlackerte. Außerdem stank er nach einer Mischung aus altem Schweiß und Hundedreck. Seine Füße steckten in schweren Bauarbeiterschuhen, er bekam sie kaum vom Boden hoch und schlurfte bei jedem Schritt wie ein alter Mann, obwohl er sicher nicht älter war als vierzig. Er hatte sich auffallend lange zwischen den Regalreihen herumgedrückt. Rieke und Stefanie hatten ihn für einen Ladendieb gehalten und deshalb genau beobachtet. Schließlich war er aber nach vorn an die Kasse gekommen und hatte nach Würgehalsbändern gefragt. Nach diesen Dingern, die sich unter Zug um den Hals schlossen. War das zu fassen! Wie konnte jemand so dreist sein, danach zu fragen! Rieke hatte ihn sofort zur Rede gestellt, ihm vorgeworfen, dass das Tierquälerei sei und sie so etwas nicht verkauften. Sie hatte ihm angeboten, ihn gleich dort im Laden ein wenig zu strangulieren, damit er nachvollziehen könne, wie sich das für die Tiere anfühlte. Unter ihren wütenden Tiraden hatte er schleunigst den Laden verlassen. Rieke war ihm gefolgt. Der Typ war mit seinem alten blauen Transporter aus der Stadt hinaus in die Einsamkeit der umliegenden Wälder gefahren.
Die Verfolgung hatte sie zu diesem abseits gelegenen Gehöft geführt. Das war vor vier Tagen gewesen, und da hatte sie nicht näher heran gekonnt. Ihre Zeit war knapp geworden, weil sie um achtzehn Uhr ihren zweiten Nebenjob im Crossini antreten musste. Gesehen hatte sie so gut wie nichts. Aber gehört dafür umso mehr, nämlich das Kläffen von mindestens zwei Dutzend Hunden. Großen und kleinen. Sie meinte, sogar Welpen gehört zu haben. Allein das war Grund genug, um wiederzukommen. Einige von ihnen hatten so herzzerreißend geschrien, als würden sie just in dem Augenblick misshandelt.
Vielleicht war sie einem illegalen Züchter auf die Spur gekommen.
Der Blaumann aus dem Laden war jedenfalls nicht ganz koscher. Er hatte ausgesehen wie eins dieser verzogenen Muttersöhnchen, die ihre Aggressionen nur an Schwächeren auslebten: an Kindern oder Tieren. Man kannte sie ja, diese verschlagenen, hinterhältigen Feiglinge, die ständig geduckt durchs Leben liefen.
Und diesem hier würde Rieke persönlich den Kopf abreißen, sollte sie herausfinden, dass er Hunde quälte.
5
Der abgetrennte Kopf lag im dichten Unterholz, sechs Meter von dem Weg entfernt, auf dem Arthur Schwabe das erste Blut entdeckt hatte. Die Spurentechniker hatten bereits Trittplatten aus Kunststoff ausgelegt, auf denen man bis zu dem Fundort vordringen konnte, ohne Spuren zu zerstören oder den Boden zu kontaminieren. Als Henry Conroy dort eintraf, waren zwei Männer in weißen Anzügen damit beschäftigt, Scheinwerfer auf Stativmasten zu montieren. Der Tag schwand dahin, und im Unterholz lauerten bereits die ersten Schatten.
Henry bückte sich unter den Ästen der Bäume und Büsche hindurch. Auf halber Strecke stand ein Spurentechniker vor einem Baum und kratzte etwas aus der Rinde.
«Was ist das?», fragte Henry.
«Blut und Gewebe. Wahrscheinlich wurde der Kopf vom Weg aus in den Wald geworfen, ist gegen diesen Stamm geprallt und bis dort hinübergeflogen.»
Der ältere Mann deutete mit einer Kopfbewegung zu einem Bereich, der mit rot-weißem Flatterband abgetrennt war. Dort hockte Rolf Gruber auf den Knien. Neben ihm stand einer seiner Assistenten und leuchtete mit einer leistungsstarken Taschenlampe den Waldboden vor ihm aus.
Der Gerichtsmediziner verdeckte alles mit seinem breiten Rücken. Henry versuchte sich auf den Anblick vorzubereiten, sofern das überhaupt möglich war. Er war jetzt einundvierzig Jahre alt und hatte in seiner Zeit bei der Kripo einiges gesehen, einen abgetrennten Kopf bisher aber nicht.
«Habt ihr nur den Kopf gefunden?», fragte er und hörte selbst, wie belegt seine Stimme klang.
«Der Körper liegt acht Meter weiter rechts im Dickicht», antwortete Gruber.
Henry sah in die Richtung. Er konnte ein paar Gestalten erkennen, die sich im Unterholz bewegten.
«Wie ist er denn abgetrennt worden, kannst du das schon sagen, Gruber?», fragte er.
«Mit einem scharfen Gegenstand, was dich nicht überraschen dürfte.»
«Warum ist auf dem Weg vorn denn nur so wenig Blut? Wenn der Kopf dort abgetrennt wurde, müsste doch viel mehr davon da sein.»
«Nicht bei einem so kleinen Körper. Bei durchschnittlich achtzig bis neunzig Milliliter Blut pro Kilo Körpergewicht kann nicht mehr als ein Liter Blut in dem Körper gewesen sein … und es bleibt ja auch immer etwas drin.»
«Häh?», machte Henry, der sich jählings in einer Situation wiederfand, die er nicht ausstehen konnte: Er begriff nicht, wovon Gruber sprach.
«Ein West-Highland-Terrier, du weißt schon, diese kleinen Wadenbeißer. Die wiegen kaum mehr als zehn Kilo. Da ist nicht viel Blut drin.»
Gruber erhob sich und sah ihn durch seine dicken Brillengläser hindurch an.
«Willst du mich verarschen?», fuhr Henry ihn an.
«Den brillanten Henry Conroy so konsterniert zu sehen, rettet mir diesen miserablen Tag», sagte Gruber und grinste.
Henry schob sich etwas näher an den Gerichtsmediziner heran und setzte den bösesten Blick auf, zu dem er sich fähig glaubte.
«Gruber, es geht hier um ein Kind. Einen kleinen Jungen. Da verstehe ich keinen Spaß. Also klär mich besser auf, bevor ich dir den Hals umdrehe.»
«Spiel dich nicht so auf. Du verstehst nie Spaß, egal, um was es geht. Das da unten», er zeigte auf den Waldboden, «ist der Kopf eines Terriers, und der passende Körper dazu liegt da drüben. Das Blut vorn auf dem Weg stammt mit großer Wahrscheinlichkeit von dem Hund, genau kann ich das aber erst nach der Laboranalyse sagen. Der Junge ist nicht getötet worden … zumindest nicht hier.»
«Ein Hund», sagte Henry überflüssigerweise und ärgerte sich, weil sein Hirn diesen Umstand einfach nicht begreifen wollte. Nachdem Gruber ihn angerufen und ihm vom Fund eines Kopfes berichtet hatte, war er davon ausgegangen, dass es sich dabei um den Kopf des kleinen Oleg handelte. Was auch sonst. Wie passte jetzt dieser Hund in das Bild?
Gar nicht. Jedenfalls nicht auf den ersten Blick.
«Das hättest du mir am Telefon sagen können», warf er Gruber vor.
«Ich habe gesagt, wir haben einen Kopf gefunden. Du hast daraus voreilige Schlüsse gezogen, also gib nicht mir die Schuld.»
«Du bist ein Arschloch.»
«Danke, gleichfalls. Wenn du sonst keine Fragen mehr hast, würde ich hier gern weitermachen.»
Henry nickte, wandte sich ab und ging über die Trittplatten zurück zum Waldrand. Er war sauer auf Gruber. Dessen merkwürdiger Humor trieb mitunter absonderliche Blüten. Anfangs hatte Henry gedacht, man müsse so sein, wenn man sich tagtäglich mit Leichen umgab. Nach einer Weile war ihm aber klar geworden, dass Gruber schon immer so gewesen war. Wahrscheinlich schon als Kind.
Als er den Weg am Waldrand erreichte, waren Henrys Gedanken wieder auf den Fall fokussiert.
Der Entführer des Jungen musste nicht zwangsläufig auch den Hund getötet haben, aber das frische Blut zeugte davon, dass beides vermutlich in einem kurzen zeitlichen Abstand zueinander geschehen war. Es war unwahrscheinlich, dass hier zwei Personen unabhängig voneinander agiert hatten.
Er zog das Diktiergerät hervor.
«Warum tötet er einen Hund? Will er uns damit provozieren? Ist es eine Nachricht, die wie nur noch nicht verstehen? Überprüfen, wo in den letzten Tagen ein Hund dieser Rasse abhanden gekommen ist oder verkauft wurde.»
Er steckte das Gerät weg und sah nach vorn.
Der Weg zwischen Waldrand und Maisfeld war kaum drei Meter breit. Durch die langen, belaubten Äste der Eichen entstand ein Tunnel, in dem man vor Blicken geschützt war. Dass der Weg nur selten benutzt wurde, davon zeugte das grüne Gras, das sogar die Fahrrinnen überwucherte. Eine deutlich zu sehende Doppelspur von Autoreifen zog sich bis zum Ende des Weges, wo er in eine Asphaltstraße mündete.
Offenbar war der Täter mit einem Fahrzeug in diesen grünen Tunnel gefahren, hatte es hier abgestellt, sich im Schutz des Maisfeldes dem Haus der Schwabes genähert, den Jungen entführt, ihn hierhergebracht, einen Hund getötet, den Jungen in den Wagen gesteckt und war dann geflüchtet.
Henry starrte den Weg an, als könne der ihn zu dem Jungen führen. Dann hob er abermals das Diktiergerät an seine Lippen, drückte den Aufnahmeknopf, verharrte, dachte nach und ließ es schließlich wieder sinken.
Ihm fehlten die Worte.
6
Seit auf dem weitläufigen Grundstück die Lampe angegangen war, hatte sich nichts mehr verändert. Einzig das schwache Licht verhinderte den Eindruck, auf ein unbewohntes Gebäude zu starren – und das Bellen der Hunde. Hin und wieder konnte Rieke sie hinter den dicken Mauern der Stallungen hören. Kläglich klangen sie, verängstigt und einsam, und dieses Gejaule ließ in Rieke die Wut hochkochen. Es würde niemals aufhören. Menschen liebten Macht, und wer sonst keine hatte, der übte sie eben über Tiere aus. Das war simpel und feige, im Sinne der Tierquäler aber effizient und befriedigend. Kaum jemand scherte sich um ein paar Hunde, die irgendwo auf der Welt – oder auch vor der eigenen Haustür – gequält wurden. Nicht bei dem, was sonst noch alles geschah in dieser rohen Gesellschaft. Zum Glück gab es ein paar Aufrechte, die wussten, dass Mensch und Tier dieselben Rechte zustanden. Dass nicht einer über dem anderen stehen durfte.
Sie war eine dieser Aufrechten. Und diesem Arschloch da unten würde sie zeigen, was sie draufhatte.
Im Wohnhaus waren nach wie vor alle Fenster dunkel. Es war sicher niemand zu Hause, Rieke lief los. Tau hatte sich in der vergangenen Stunde auf dem langen Gras niedergeschlagen, es war feucht und rutschig, und sie musste aufpassen, damit sie nicht ausrutschte.
In der Hand hielt sie eine Taschenlampe, um den Hals trug sie die teure Digitalkamera, die sie von ihren Eltern zu Weihnachten bekommen hatte. Sie hatte ihnen erzählt, eventuell doch ihren alten Traum von der Tierfotografie wahr machen zu wollen, und dabei immer wieder eingeflochten, wie unglaublich teuer heutzutage gute Kameras waren. Gelogen war das nicht. Immerhin machte sie wirklich Tierfotos damit. Nur etwas andere, als ihre Eltern sich vorstellten.
Sie erreichte den hohen Maschendrahtzaun, der das große Grundstück komplett umschloss. Die Metallpfosten waren teilweise verrostet und der Draht an vielen Stellen verbogen. Er war in die Erde eingelassen, sodass Rieke nicht einfach darunter hindurchkriechen konnte. Sie hatte zwar eine Kneifzange eingesteckt, die sie in dem kleinen Rucksack auf dem Rücken trug, wollte es aber erst einmal ohne Sachbeschädigung versuchen. Sonst würde sich dieser Wichser womöglich noch auf ihre Kosten einen neuen Zaun gönnen, wenn sie erwischt wurde.
Rieke schlich am Zaun entlang und behielt dabei das Haus im Auge. Es war eine alte landwirtschaftliche Anlage, mit großem, langgestrecktem Haupthaus und einigen Nebengebäuden. Das Areal war unübersichtlich, die Büsche und Tannen auf dem Grundstück waren lange nicht zurückgeschnitten worden. Sie wollte jedoch nur zum Stallgebäude. Es hatte kleine Fenster, durch die sie hineinschauen und, falls sie keine offene Tür fand, auch hindurch fotografieren konnte. Sie hoffte aber, eine Möglichkeit zu finden, in die Stallungen hineinzukommen. Dann könnte sie schon heute ein paar der armen Tiere in die Freiheit entlassen.
Der Gedanke spornte sie erneut an.
Und sie hatte Glück. Sie fand eine niedergedrückte Stelle im Zaun, auf die eine Fichte gestürzt war. Die eine Hälfte des Stamms war mit einer Kettensäge zerteilt worden und lag auf dem Grundstück. Die andere Hälfte mit der Wurzel ragte auf ihrer Seite des Zauns schräg aus dem Boden. Das Maschendrahtgeflecht war nur notdürftig wieder aufgerichtet worden, stand aber nicht mehr unter Spannung, sondern war weich und nachgiebig wie alte Haut.
Rieke krabbelte auf den Rest des abgetrennten Stammes bis nach vorn, richtete sich auf, balancierte ihr Gleichgewicht aus und sprang. Sie bekam die Füße nicht hoch genug und berührte den Zaun. Es klapperte. Das Geräusch war in der stillen Nacht geradezu ohrenbetäubend.
Rieke kam auf der anderen Seite auf dem Boden auf, machte sich ganz klein und beobachtete mit angehaltenem Atem das Haus. Ein paar Hunde hatten das Geräusch gehört und bellten. Andere fielen mit ein, und im Nu entwickelte sich lautes Gekläffe.
Das war nicht gut. Andererseits: Wenn jetzt kein Licht anging in dem Wohnhaus, dann war wirklich niemand daheim. Und wenn doch, könnte sie problemlos abbrechen und flüchten.
Also wartete Rieke ein paar Minuten in der unbequemen Stellung ab. Sie spitzte die Ohren, lauschte nach anderen Geräuschen zwischen dem Hundegebell. Es gab keine. Nach und nach beruhigten sich auch die Hunde wieder, und die Stille kehrte zurück.
Mit gebeugten Knien und gekrümmtem Rücken schlich Rieke über den ungepflegten Rasen auf das Stallgebäude zu. Das Licht der Glühlampe zog sie geradezu an, obwohl sie es doch eher meiden sollte. Sie drückte sich an einer dunklen Stelle mit dem Rücken an die Wand.
Kaum hatte sie durchgeatmet, hörte und spürte sie schon, wie es drinnen an der Wand kratzte und schabte. Die Hunde. Sie hatten sie bemerkt. Vielleicht ahnten sie, dass Hilfe unterwegs war. Wahrscheinlich bekamen sie aber einfach nicht genug zu fressen und kratzten den Putz und die Farbe von den Wänden, um wenigstens irgendetwas im Magen zu haben. Halbverhungerte Hunde hatte Rieke schon oft gesehen. Jedes Mal hatte der Anblick ihr fast das Herz gebrochen.
Rieke kratzte ebenfalls mit den Nägeln an der Außenwand und stellte sich vor, die Hunde drinnen würden ihr Zeichen verstehen. Es war ein schönes, ein erhebendes Gefühl, und es besaß die Macht, alle Angst und alle Bedenken beiseite zu fegen.
Von einer Sekunde auf die andere war Rieke wieder voller Adrenalin.
Jetzt oder nie.
Sie nahm die Kamera in beide Hände, klappte den Objektivdeckel ab und schaltete sie ein. Dann schob sie sich an der Wand entlang weiter bis zum nächsten Fenster. Die Fensterbank aus rauem Beton befand sich genau auf Höhe ihres Kinns. Sie musste sich strecken, um in den Stall sehen zu können. Darin war es dunkel. Sie konnte nichts erkennen, aber dieses Problem würde das Blitzlicht lösen.
Bevor sie mit dem hellen Licht ihre Anwesenheit verriet, wollte sie jedoch erst die beiden Holztüren in der Giebelwand des Stalls überprüfen. Sie schlich dorthin und stellte fest, dass sie mit Vorhängeschlössern gesichert waren. Es waren zwar nur kleine Bügelschlösser, aber selbst die würde sie nicht aufbrechen können.
Also doch nur fotografieren.
Zurück vor dem Fenster, schob sie sich auf Zehenspitzen empor, hielt das Objektiv direkt vors Glas und drückte den Auslöser. Obwohl sie die Augen dabei geschlossen hielt, blendete der Blitz sie durch die Lider hindurch. Halb blind lief sie zum nächsten Fenster und wiederholte die Prozedur. Um das dritte Fenster zu erreichen, musste sie um die Ecke des Gebäudes gehen.
Dort stieß sie mit einem gewaltigen Hindernis aus Fleisch und Blut zusammen.
7
Die schwarze Kontur einer großen Gestalt hob sich von dem rasch dunkler werdenden Abendhimmel ab. Henry erkannte sie schon von weitem, während er den Weg zum Haus der Schwabes hinaufstapfte. Seine Laune verschlechterte sich dramatisch.
Kein Ermittler wünschte sich einen Fall von Kindsentführung, denn leider gingen die in den seltensten Fällen gut, ja nicht einmal glimpflich aus. Am Ende war man nur der Überbringer entsetzlicher Nachrichten, und Henry wusste von Kollegen, dass immer auch ein bisschen was beim Ermittler hängen blieb. Nicht gerade Schuld, aber doch die Ungewissheit, ob man alles richtig gemacht hatte. Ob ein anderes Verhalten das entführte Kind eventuell gerettet hätte.
In diesem Fall konnte Henry nicht auf seine Erfahrung vertrauen, er hatte keine. Mit Mord und Totschlag kam er zurecht. Vergewaltigungen hatte er fast ein Dutzend aufgeklärt, auch die Entführung einer wohlhabenden Unternehmersgattin, aber ein Kind … Es war nicht Angst, was sein sonst so präzises Denken einschränkte, aber er war verunsichert. Ein verschwundener sechsjähriger Junge, ein enthaupteter Hund – das war alles rätselhaft.
Und jetzt musste er sich auch noch mit seinem direkten Vorgesetzten herumplagen: dem stellvertretenden Polizeichef Nikolaus Sackstedt. Sackstedt war eins achtzig groß, leicht übergewichtig und hielt seinen Oberkörper stets etwas nach vorn gebeugt, so als müsse er ein Ungleichgewicht austarieren. Sein Haar begann dünner zu werden, oben am Schädel hatte sich bereits eine Lichtung gebildet. Breitbeinig, die Hände in Politikerpose lässig in den Taschen der Anzughose, stand er da und erwartete ihn.
Als Henry ihn erreichte, bemerkte er eine zweite Person, die aus dem Schatten des Hauses trat.
«Hauptkommissar Conroy», begrüßte Sackstedt ihn und deutete auf die junge Frau. «Ich möchte Ihnen die neue Kollegin vorstellen, Manuela Sperling. Obwohl sie offiziell erst ab kommenden Montag im Dienst ist, hat Frau Sperling sich spontan bereit erklärt, Sie schon jetzt zu unterstützen. Ich finde, das macht Sinn. So ist sie von Beginn an in den Fall involviert.»
Sie war verdammt jung, das war alles, was Henry wahrnahm. Beiläufig schüttelte er ihr die Hand. Er hatte weder Zeit noch Lust, sich mit neuem Personal zu beschäftigen. Um Unterstützung gebeten hatte er auch nicht. Sackstedt mischte sich in seine Ermittlungen ein, wieder einmal, und Henry spürte erneut Abneigung in sich hochkochen.
«In einem solchen Fall können wir jede Hilfe gebrauchen», sagte Sackstedt, als könnte er Henrys Gedanken lesen. «Ein verschwundener sechsjähriger Junge, mein Gott.»
Dinge verschwinden, aber kleine Jungen werden entführt, dachte Henry, hielt sich jedoch zurück.
«Wir wollten uns gerade auf den Weg zu Ihnen machen. Gibt es etwas Neues?», sagte Sackstedt.
Henry setzte ihn ins Bild.
«Ein enthaupteter Hund», wiederholte Sackstedt. «Ich muss sagen, ich bin einigermaßen froh, dass es nicht der Junge ist. Aber so etwas hatten wir auch noch nicht. Vielleicht stammt der Köter aus dem Dorf, lief frei herum und hat den Täter angekläfft.»
«Und der schneidet ihm den Kopf ab, weil man das eben so macht, oder was?»
«Er könnte sich durch den Lärm gestört gefühlt haben. Hat vielleicht befürchtet, entdeckt zu werden.»
«Ein halbwegs normaler Mensch hätte einem so kleinen Hund einen Tritt verpasst, dann wäre der schon abgezogen. Zumal der Täter mit dem Jungen beschäftigt war. Ich denke, ganz so einfach ist die Erklärung nicht.»
«Nun, Sie als einer unserer erfahrensten Ermittler sind sicher schon einen Schritt weiter, nicht wahr?», fragte Sackstedt und sah ihn mit diesem Blick an, den Henry von Anfang an nicht hatte leiden können. Es lag etwas Herablassendes darin. Sackstedt trat einen Schritt auf ihn zu, und Henry befürchtete, er würde ihm eine Hand auf die Schulter legen. Jovialität konnte Henry noch weniger leiden.
«Schon möglich, aber zu diesem Zeitpunkt ist das reine Spekulation. Was wir brauchen, sind Hinweise, deshalb würde ich jetzt gern mit den Eltern sprechen.»
«Ich war gerade bei ihnen», sagte die neue Kollegin. «Herr und Frau Schwabe stehen unter Schock und sind eigentlich nicht in der Lage, Fragen zu beantworten.»
«Ist mir egal», rutschte es Henry etwas heftiger heraus als beabsichtigt. Er fühlte sich von den beiden bedrängt.
«Ich werde mit den Eltern reden, egal, wie es ihnen geht. Ihrem Sohn geht es nämlich wahrscheinlich noch schlechter, und seine Rettung hat für mich oberste Priorität, nicht das Seelenheil der Eltern. Außerdem sollten Sie wissen, dass in neunzig Prozent solcher Fälle der oder die Täter innerhalb der Familie zu finden sind, Frau Rabe.»
«Sperling, ich heiße Sperling», verbesserte sie ihn.
«Bitte», mischte sich Sackstedt ein. «Das hat doch keinen Sinn. Ich finde, wir …»
«Ich habe jetzt keine Zeit für diesen Kinderkram», unterbrach Henry seinen Vorgesetzten, schob sich an der neuen Kollegin vorbei und schritt über den kurzen Plattenweg auf das Haus zu.
«Conroy», rief Sackstedt ihm hinterher. «So geht das nicht. Sie haben sich genauso wie alle anderen an meine …»
Den Rest des Satzes schnitt die zugeworfene Haustür ab. In der Stille des Flures wurde Henry sofort klar, dass er sich nicht besonders geschickt verhalten hatte. Ein wenig Diplomatie wäre angebracht gewesen, aber genau die war nicht seine Stärke. Musste es auch nicht sein, er war schließlich Polizist, kein Politiker.
Henry hatte schon von der neuen Kollegin gehört. Solche Personalien beschäftigten den Flurfunk schon Wochen vorher. Vor allem, weil die Planstelle auch intern hätte besetzt werden können. Auf Sackstedts Betreiben hin war jedoch jemand von außerhalb eingestellt worden. Und jetzt, da Henry die neue Kollegin gesehen hatte, vermutete er stark, dass Sackstedt bei seiner Auswahl nach einem hübschen Gesicht gesucht hatte, das er hin und wieder in den Medien präsentieren konnte. Vielleicht fand er ja, die Öffentlichkeit hätte genug von bärbeißig dreinblickenden Ermittlern wie ihm. Jung sollten sie sein heutzutage. Jung, erfahren, äußerst einfühlsam und gleichzeitig belastbar. Als ob es so jemanden gäbe.
Die Tür zum Wohnzimmer stand einen Spaltbreit offen. Licht sickerte auf den Flur. Durch den Spalt sah Henry Arthur Schwabe auf und ab gehen. Er klopfte, drückte die Tür auf und trat ein. Sofort flogen ihm ihre Blicke zu. Helga Schwabe saß in angespannter Haltung auf der Couch, ihre Hände kneteten ein Stofftaschentuch. Ihre Augen waren rot geweint, ihr Haar zerzaust. Sie war eine kleine schwere Frau mit pausbäckigem Gesicht und groben Händen. Arthur Schwabe hingegen war dünn. Er trug eine braune Cordhose und ein langärmliges Karohemd. Henry vermutete, dass er ein zäher und kräftiger Mann war, der eine Menge aushalten konnte. Sein Gesicht sah danach aus. Es wirkte vom Leben gezeichnet.
«Henry Conroy», stellte er sich vor. «Ich bin hier, um ihren Sohn zu finden.»
Die korpulente Helga Schwabe war erstaunlich flink auf den Beinen.
«Oh mein Gott», rief sie. «Sie werden ihn finden, meinen Oleg … Sie bringen mir meinen Oleg zurück, nicht wahr?»
Henry fiel auf, dass die Frau von «ihrem» Kind sprach, nicht von «unserem».
«Was ist mit dem Blut?», fragte Arthur Schwabe und drängte sich zwischen seine Frau und Henry. Er sprach langsam, mit leichtem osteuropäischem Akzent. «Da war alles voller Blut unten am Maisfeld.»
Tatsächlich war es nur wenig Blut gewesen, aber für einen verängstigten Vater, der auf der Suche nach seinem Kind war, musste es ganz anders ausgesehen haben.
«Es stammt von einem Hund. Auf gar keinen Fall von Ihrem Sohn. Ihr Sohn lebt. Er wurde entführt, jemand hat ihn in seiner Gewalt, aber er lebt.»
«Von einem Hund? Was für ein Hund?», fragte Arthur Schwabe. Bevor Henry darauf eingehen konnte, drückte Helga Schwabe sich an ihrem Mann vorbei, schob ihn beiseite und ergriff Henrys Hand. Ihre rauen Hände waren ganz feucht.
«Wo ist er? Wo ist mein kleiner Oleg? Sagen Sie es mir bitte.»
«Das kann ich nicht, noch nicht. Aber der Täter hat Spuren hinterlassen, und ich werde ihn finden. Aber dazu brauche ich Ihre Hilfe. Sie müssen mir einige Fragen beantworten.»
«Was für Fragen?», sagte Arthur Schwabe. Er war sofort in eine defensive Haltung gefallen. Seine Schultern sackten nach vorn, er wurde kleiner, nahm nicht mehr so viel Raum ein. Es waren immer nur Kleinigkeiten in der Körpersprache, die das meiste über das Gefühlsleben eines Menschen verrieten. Schließlich lief mehr als die Hälfte der zwischenmenschlichen Kommunikation auf dieser Ebene ab.
«Setzen wir uns», sagte er. «Wenn Sie Ihren Sohn wiederhaben wollen, müssen Sie meine Fragen beantworten. Anders geht es nicht.»
Also setzten sie sich. Herr und Frau Schwabe nebeneinander, Henry ihnen gegenüber. Er holte sein Diktiergerät hervor und legte es auf den Tisch.
Arthur Schwabe betrachtete es misstrauisch. Unter dem Tisch hindurch konnte Henry dessen Füße sehen. Eine Fußspitze zeigte zu ihm, die anderen in Richtung der Terrassentür. Ein oder zwei Fragen später würden sie beide zur Tür zeigen. Ein Zeichen dafür, dass der Mann sich in Henrys Gegenwart unwohl fühlte und den Raum lieber verlassen würde. Aber warum?
Henry wandte sich zuerst an seine Frau.
«Frau Schwabe … ich weiß, es ist schwer, aber können Sie mir bitte genau berichten, was geschehen ist?»
Sie starrte ihn verängstigt an und wrang mit aller Kraft das Stofftaschentuch in ihren Händen.
«Pedro und ich … wir haben es gespürt, vorher schon … da war etwas im Mais … etwas Böses. Der Bilgenschneider.»
8
Eine sichelförmige Klinge schwebte über ihr, fast wie der kleine Bruder des Mondes. Rieke erstarrte vor Schreck, und da ihr Finger noch auf dem Auslöser lag, betätigte sie automatisch die Digitalkamera. Grell zuckend riss das Blitzlicht ein wahrhaftes Monster aus der Schwärze. Groß war es, geradezu gewaltig, die Zähne gebleckt, die Augen weit aufgerissen. Mit den Augen stimmte etwas nicht. Sie waren viel zu groß und viel zu … Ja was? … Blutunterlaufen? Das Weiß dieser Augen war gar nicht weiß, sondern rot, und Rieke konnte erkennen, dass ein feinverzweigtes Gespinst rot pulsierender Äderchen diesen Eindruck erzeugte. In der hocherhobenen Hand hielt das Monster das Messer mit der gebogenen Klinge. Das Blitzlicht zuckte an dem scharfen Metall hinauf und warf an der Spitze einen sternförmigen Reflex zurück.
Die Kamera verschaffte Rieke eine wertvolle Sekunde. Das Monster war geblendet, und der Hieb mit dem Messer ging daneben. Rieke spürte die Klinge durch die Luft sausen, nah an ihrer linken Schulter vorbei. Einer weiteren Aufforderung bedurfte es nicht. Sie schnellte herum und rannte los. Was auch immer sie hier aufgeschreckt hatte, es würde sie nicht lebend entkommen lassen.
Renn um dein Leben, schrie eine Stimme in ihrem Kopf.
Und das tat sie.
Hinter sich hörte sie ein wütendes Geräusch. Es klang wahrhaftig, als spucke jemand Gift und Galle. Rieke rannte den Weg zurück, den sie gekommen war. Sie hoffte, in der Dunkelheit die Stelle wiederzufinden, wo der Maschendrahtzaun heruntergedrückt war, denn sonst saß sie jetzt in der Falle.
Die Kamera schwang vor ihrer Brust hin und her und schlug ihr schmerzhaft gegen die Rippen. Der leichte Rucksack federte bei jedem Schritt auf ihrem Rücken. Sie gab alles, und sie war schnell. Sport hatte sie immer gemocht und für solche Fälle sogar extra trainiert, kurze Strecken zu sprinten, aber es war ein Unterschied, ob man gegen eine Stoppuhr lief oder ob einem bei völliger Dunkelheit in einem abgelegenen Tal im Wald ein Monster im Nacken saß, dessen Augen bluteten.
Rieke musste sich zwingen, sich nicht umzuschauen. Das hätte zu viel Zeit gekostet, vielleicht wäre sie sogar gestolpert. Es war auch nicht nötig, denn sie konnte ihn hören. Stampfende Schritte und wütendes Grunzen, dicht hinter ihr.
Der Zaun, wo war der verdammte Zaun?
Die Taschenlampe in ihrer Hand fiel ihr wieder ein. Sie schaltete sie ein, riss sie hoch und leuchtete nach vorn. Der Lichtkegel war nur schmal, aber dafür lang. An seinem Ende erkannte sie den Zaun, höchstens zwanzig Meter entfernt. Leider würde es von dieser Seite ungleich schwieriger werden, hinüberzukommen. Und sie hatte nur einen Versuch.
Wie groß war ihr Vorsprung?
Rieke hielt es nicht mehr aus, sie musste sich umschauen. Der Lichtstrahl erfasste den Koloss. Er schaukelte wie eine alte Pferdekutsche, sein Oberkörper schien nicht richtig fest auf dem Becken zu sitzen, er ruderte mit den Armen, als müsse er irgendwelche Hindernisse beiseitefegen. Sie konnte sich täuschen in dem schlechten Licht, aber es sah aus, als trüge er einen blauen Overall.
Er war deutlich zurückgefallen. Wenn da nicht der Zaun gewesen wäre, Rieke hätte ihn ohne weiteres abgehängt.
Sie schätzte die Entfernung erneut.
Ja, es müsste reichen. Selbst wenn sie es beim ersten Versuch nicht über den Zaun schaffte, hatte sie noch genug Zeit, sich aufzurappeln und die Flucht fortzusetzen. Vielleicht gab es ja noch eine andere Möglichkeit, dem Grundstück zu entkommen.
Rieke legte noch an Tempo zu und bereitete sich auf den Absprung vor. Der Zaun hatte an dieser Stelle eine Höhe von vielleicht einen Meter zwanzig. Sie war sicher, es aus vollem Lauf heraus in einem Satz zu schaffen.
Noch drei, noch zwei, noch einen Schritt.
Abstoßen. Jetzt.
Ihre Oberschenkelmuskeln explodierten förmlich und katapultierten sie in die Luft. Sie zog die Beine an, aber im selben Moment schlug ihr die Digitalkamera mit voller Wucht gegen den Unterkiefer und Mund. Sie spürte die Lippe aufplatzen, dann einen scharfen Schmerz, konzentrierte sich nicht mehr auf den Sprung und blieb mit dem linken Fuß an dem lockeren Zaungeflecht hängen.
Der Draht griff nach ihr wie eine Hand und ließ sie nicht wieder los. Sie stürzte, fiel auf den Zaun, drückte ihn herunter, wurde von ihm zurückgeschleudert, aber da sich ihr Fuß darin verfangen hatte, kam sie nicht von ihm los. In einem halben Meter Höhe hing ihr Oberkörper jenseits des Zauns, während ihre Beine sich noch auf dem Grundstück befanden.
Rieke zappelte und schrie, kämpfte mit aller Kraft, bekam ihren Fuß aber nicht los. Sie konnte nicht sehen, womit sie sich in den Metallmaschen verfangen hatte. Vielleicht waren es die Schnürsenkel, vielleicht der ganze Fuß. Die Taschenlampe war ihr entglitten. Sie lag auf dem Boden und leuchtete Richtung Wald. Richtung Freiheit.
Der Koloss war heran.
Er schnaufte und grunzte.
Rieke schrie so laut sie konnte um Hilfe und trat immer wieder mit dem rechten Fuß gegen den Draht. Es schepperte laut, die Hunde kläfften. Niemand würde es hier draußen hören.
Schließlich verließ sie die Kraft.
«Lass mich bloß in Ruhe», rief sie ihrem Verfolger zu. «Die Polizei ist auf dem Weg hierher.»
Rieke konnte es nicht mit Sicherheit sagen, aber sie hatte den Eindruck, das Monster würde den Kopf schief legen, so wie es Hunde taten. Dann trat es einen Schritt vor und riss den Arm nach oben. Die gebogene Klinge blitzte auf, und im nächsten Moment war Riekes Fuß frei.
Sie fiel über den Zaun.
Nach drüben, in Richtung Freiheit.
Jetzt nichts wie weg.
Schmerz und Erkenntnis fielen mit Verspätung über sie her. Ihr linkes Bein knickte einfach so unter ihr weg, und sie fiel hin. Ein grausames Feuer schoss bis in ihre Hüfte hinauf. Rieke drehte sich herum, packte ihr Bein mit beiden Händen, richtete den Oberkörper ein Stück auf – und wollte nicht glauben, was sie sah.
Ihr Fuß … Er hatte ihn abgehackt!
9
Es war still geworden auf dem Hof der Schwabes. Seit ein paar Minuten saß Henry auf dem Rand der Sandkiste, in der Oleg Schwabe am späten Nachmittag noch Kleeblattsandkuchen gebacken hatte. Die Spurensicherung hatte sie freigegeben. Ausgerechnet Kleeblätter, Glückssymbole.
Er glaubte nicht an solchen Mist. Schon lange nicht mehr.
Henry zog an seiner Zigarette. Der bittere Qualm flutete seinen Körper, und er spürte wieder dieses Ziehen und Zerren, irgendwo tief drinnen. Er wusste, es war nichts Organisches, er war fit. In Momenten wie diesem, wenn er an sich und seiner Umwelt zweifelte, wenn er sich an einen anderen Ort wünschte, war das Ziehen immer besonders stark. Eines Tages würde ein letzter Halt in seinem Inneren zerreißen, und dann würde es nicht mehr länger nur ein Wunsch sein. Dann würde er aufstehen und einfach weggehen und nie zurückkehren.
Aber noch nicht. Noch gab es hier etwas zu tun. Vielleicht war dies sogar der wichtigste Tag der vergangenen Jahre. Sackstedt hatte ihm den Fall aufgebürdet, um ihn scheitern zu sehen. Aber den Gefallen würde er ihm nicht tun. Denn neben dem Ziehen und Zerren spürte Henry noch etwas anderes. Etwas, das er schon lange nicht mehr gespürt hatte: echtes Interesse.
Ein Kind. Ein sechsjähriger Junge. Aus dem Sandkasten vor dem Elternhaus verschwunden, während die Mutter drinnen Kartoffeln schälte. Und als würde das nicht reichen, zusätzlich ein geköpfter Hund. Für Henry sah das Ganze einerseits wie eine sorgsam geplante Entführung aus, andererseits aber auch wieder nicht. Was sollte das mit dem Hund? Und was, wenn der Vater nur zehn Minuten früher nach Haus gekommen wäre? Entweder hätte die Familie dann bereits zusammen in der Küche beim Abendessen gesessen, oder aber der Vater wäre just im Moment der Entführung auf dem Hof aufgetaucht und hätte sie verhindert.
Arthur Schwabe war zu Beginn der Vernehmung sehr nervös gewesen, hatte sich aber in der halben Stunde, die sie gedauert hatte, beruhigt. Er hatte sich einige Male nach dem toten Hund erkundigt und wissen wollen, welche Rasse es war und woher er stammte. Auf konkrete Nachfragen von Henry hatte er abweisend reagiert. Er mochte die Polizei nicht, und er mochte keine Fragen zu seinem Privatleben, so viel stand fest. Möglicherweise war er streng in der Erziehung, vielleicht war er sogar einer von den Typen, denen hin und wieder die Hand ausrutschte, aber der Entführer seines Sohnes war er sicher nicht. Henry hatte das überprüfen lassen. Eine halbe Stunde vor der Tat hatte Arthur Schwabe in seiner Firma, einem Getränkeabfüller, ausgestempelt und war von dort auf direktem Weg nach Haus gefahren.