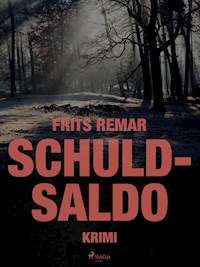Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Ofenwart eines Krematoriums macht eine atemberaubende Entdeckung: Es liegt doch tatsächlich eine Leiche zu viel im Sarg... Der Kriminalkommissar Jens Holst kommt dem Rätsel nur sehr langsam auf die Schliche... Frits Remar erzählt in diesem spannenden Krimi auf humorvolle und fesselnde Weise über Fähigkeiten eines Kriminalkommissars. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frits Remar
Die zweite Leiche
Ein Bergh-Krimi
Saga
Die zweite Leiche
Aus dem Danish von Ursula von Wiese
Originaltitel: Det parallelle lig © 1968 Frits Remar
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711513002
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Der Ofenwart eines Krematoriums macht eine unheimliche Entdeckung: Es liegt eine Leiche zuviel im Sarg. Ein weiterer (kopfloser) Toter bringt Kriminalkommissar Jens Holst auf eine Spur, auf der er sich mühsam an des Rätsels Lösung herantastet. Diesem humorvollen, menschlichen Kriminalkommissar gehört die Liebe des Lesers (der übrigens immer ein wenig mehr weiß als der Fahnder).
Ein spannendes Drama, und spannend ist auch der Weg bis zur Lösung.
Erster Teil
Wer anderen eine Grube gräbt
Montag, den 5. Juni, bis Donnerstag, den 14. September 1967
1
Montag, den 5. Juni 1967
Man glaubt es mir oft nicht, aber es ist wahr: Ich bin Ofenwart im Krematorium. Städtischer Angestellter. Meine Mutter hätte sich nichts Besseres für mich wünschen können. Nun ja, vielleicht doch lieber Straßenbahner oder Lokführer, aber ich gehöre der Stadtverwaltung an, und das ist gut so. Ob es unheimlich ist? Ja, anfangs war es wohl unheimlich, doch man gewöhnt sich an die Arbeit, sie wird schließlich ebenso langweilig wie jede andere auch.
Vor einiger Zeit stand in einer Zeitung, Ofenwarte seien zuverlässige Menschen, die ihrer geregelten Arbeit nachgehen. Es geschähen dabei keine besonderen Dinge. Ich will gleich bekennen, daß es bei uns doch der Fall ist. Larsen und ich haben ein ausgezeichnetes kleines Geschäft. Wenn wir nur eine Bestattung haben – übrigens meistens, denn wir arbeiten in einer Vorstadtgemeinde, wo größtenteils jüngere Leute wohnen –, bringt er den Leichenwagen her und läßt den Schlüssel stecken. Wir leeren den Sarg und verladen ihn in den Wagen. Niemand kann uns sehen. Der Friedhof liegt in einem Villenviertel und ist von hohen Mauern umschlossen. Es kommt selten jemand auf den Friedhof. In der Regel tun wir es abends nach der Verbrennung. Und wer würde schon zwei Männer, die einen Sarg aufladen, fragen, wohin sie damit wollen? Nein, das Geschäft ist wasserdicht.
Für jeden Sarg bekommen wir zweihundert Kronen. Der Leichenbestatter schlägt bei jedem Sarg mindestens hundert Kronen heraus. Larsen und ich teilen die Einnahme. Alle sind zufrieden. Dem einzigen, dem wir etwas wegnehmen, ist es gleichgültig. Wenn man schon stiehlt, so kann es nichts Humaneres geben, als es den Toten zu nehmen und es den Lebenden zukommen zu lassen.
Larsen weiß nicht, daß ich mir auch manchmal ein Schmuckstück aneigne, wenn er nachmittags nicht da ist. Den Schmuck verkaufe ich einem Goldschmied. Er schmilzt das Gold ein, und die Steine werden umgeschliffen. Er fragt nie, woher ich die Sachen habe; aber da er mir nur ein Drittel vom Marktpreis dafür gibt, dürfte er sich wohl darüber klar sein, daß ich ihm nicht Großmutters Firlefanz anbringe. Ich habe gehört, daß man in anderen Ländern auch die Goldfüllungen aus den Zähnen entfernt, doch da ziehe ich eine Grenze. Was zuviel ist, ist zuviel.
Heute nachmittag soll eine vornehme ältere Dame ihre letzte Fahrt im Aufzug machen. Eine stille Trauerfeier im engsten Familienkreis. Der schöne Eichensarg steht schon seit vorigem Samstag in der Kapelle. Dafür müßten wir eigentlich mehr als 200 Kronen bekommen, denn er hat beim Einkauf mindestens 600 gekostet; aber wir haben einen Einheitspreis abgemacht. So geht alles leichter.
Ich ging schon mittags um zwei zur Kapelle. Larsen rief mich vormittags an und sagte, er könnte nicht kommen. Es war wieder seine Magensäure. Er hat nicht die richtigen Nerven für all das. Er ist mein einziges Sicherheitsrisiko. Ich sagte ihm, ich könnte es allein erledigen, und er hängte erleichtert ein.
Als ich die Kapellentür aufschließen wollte, sah ich, daß jemand daran herumgefingert hatte. Herumfingern ist milde gesagt, die Tür war nämlich mit einem Stemmeisen aufgebrochen worden. Ich ging rasch hinein und schaute mich um, um festzustellen, ob etwas abhanden gekommen war. Wirklich eine Frechheit, in eine Kapelle einzubrechen. Es fehlten nur zwei große Messingleuchter auf dem Altar. Das war nicht weiter schlimm, da wir im Keller Ersatz haben. Als ich die beiden anderen holte, fiel mir ein, daß ich die Polizei von dem Diebstahl verständigen mußte.
Der Beamte, mit dem ich sprach, schrieb umständlich meine Meldung nieder und sagte, es werde jemand kommen und sich die Sache ansehen. Ich machte ihn darauf aufmerksam, daß am Nachmittag eine Trauerfeier stattfinden würde und daß ich danach meine Arbeit zu verrichten hätte. Wir vereinbarten, daß ich morgen um zehn in der Kapelle zur Verfügung stehen würde.
Kurz nach diesem Telefongespräch kam der Pfarrer mit dem Küster. Beide regten sich über den Einbruch sehr auf, and wir sprachen eine Weile darüber. Dann arrangierten der Küster und ich die Blumen und Kränze. Das dauerte nicht lange, weil es nicht viele waren. Der Pfarrer zog sich derweil in seiner kleinen Kammer um, und als er in seinem schwarzen Talar wieder auftauchte, versammelten sich draußen auf dem Friedhof gerade die ersten Trauergäste.
Der Pfarrer war in einer schwarzen Stimmung, in seiner Begräbnisstimmung. Er ist wie ein Chamäleon. Er nimmt die Farben seiner Umgebung an. Schwarz und düster bei Bestattungen. Heiter und munter bei Trauungen. Feierlich bei der Konfirmation. Hellrot und leutselig bei der Taufe. Streng und gottesfürchtig bei Gemeinderatssitzungen. Mild und nachsichtig beim Zusammensein mit anderen Menschen. Ich kenne keinen, der so in seinem Beruf aufgeht wie er. Nur Gott mag wissen, wie er in Wirklichkeit ist. Der Küster ist immer derselbe. Grau, trist und säuerlich, als ob er eingewachsene Zehennägel hätte. Er äußert selten etwas anderes als Psalmenverse; er kann sie, glaube ich, fast alle auswendig.
Als die kleine Trauergemeinde vollzählig versammelt war, zog ich mich dorthin zurück, wo ich hingehörte – in den Keller. Dort unten ist es ganz gemütlich. Saubere, weißgekalkte Wände. Kein grelles Tageslicht. Die Fensterscheiben sind aus Mattglas, aber zwei Neonröhren geben alles Licht, das man im Bedarfsfall braucht. Unten endet auch der Aufzug. Für die Toten. Die Lebenden müssen die Treppe benutzen.
Ich hängte meinen Rock in den Garderobeschrank und zog meinen Kittel an. Dann machte ich das Feuer an. Seit es Ölfeuerung gibt, ist es keine große Sache mehr, im Krematorium Ofenwart zu sein. Früher, als man noch mit Kohle feuerte, war es eine höllische Plackerei. Außerdem schmutzig. Jetzt drückt man auf einen Knopf, und die Feuerung ist automatisch in Gang. Es geht leichter und schneller, wenn der Ofen vorgewärmt ist.
Danach setzte ich mich hin und wartete. Ich zündete mir eine Zigarette an und blätterte in meiner Zeitung. Orgelmusik und der kühle Psalmengesang klangen schwach zu mir herunter. Die Orgel ließ die Luft vibrieren. Der Organist tremolierte ein wenig. Danach sprach der Geistliche. Ihn konnte ich zum Glück nicht hören. Ich schaute auf meine Uhr. Es war Viertel nach drei. Es dauerte also noch eine Viertelstunde. Ich konnte noch gut ein Bier trinken. Das tat ich denn auch. Im Raum begann es recht warm zu werden. Im Winter ist das sehr angenehm, aber jetzt haben wir ja Juni, und da ist es eher unbehaglich. Das Bier half dagegen. Ich stellte die leere Flasche weg und wartete auf das Glockenzeichen des Küsters.
Wenn er oben auf einen Knopf drückt, klingelt hier unten eine Glocke, nur schwach. Dann setze ich den Aufzug in Bewegung.
Die fernen Töne von »Nun bringen wir den Leib zur Ruh« drangen zu mir herunter, und die Glocke bimmelte. Ich stand auf und setzte den Aufzug in Bewegung. Er war gut geölt und lautlos. Ganz langsam sank der Katafalk mit dem Sarg, Blumenschmuck und allem übrigen zu mir herab, bis der Aufzug automatisch stehenblieb. Der Sarg stand auf Rädern – winzig kleinen Rädern – auf dem Katafalk, und ich brauchte nicht viel Kraft anzuwenden, um ihn auf den Eisenschlitten zu schieben, der in den Ofen führte.
Danach ließ ich den Aufzug mit dem Katafalk wieder in die Höhe, damit sich das Loch im Boden der Kapelle schloß. Ich wartete eine Weile, bis ich ganz sicher war, daß die Leute die Kapelle verlassen hatten. Ich ging hinauf und half dem Küster, die Gesangbücher an ihren Platz zu legen und die übrigen Blumen und Kränze, die oben geblieben waren, auf den Friedhof zu tragen. Wir legten sie aufs Familiengrab, wo die Urne beigesetzt werden sollte. Der Küster ging mit einem Nicken.
»Auf Wiedersehen und vielen Dank für die Hilfe«, sagte ich.
Die Ironie erfaßte er gar nicht. Die Aufräumungsarbeiten in der Kapelle waren ja seine Sache, aber Larsen und ich hatten es uns angewöhnt, ihm dabei zur Hand zu gehen, damit wir rascher unter uns waren.
Ich war nun allein. Der Pfarrer war längst gegangen. Ich trank noch ein Bier, bevor ich mich im Ernst an die Arbeit machte. Ich nahm die Blumen vom Sarg und warf sie in den Ofen. Sie zischten nicht lange. Also wieder einmal nicht frisch. Hundert Kronen für den Gärtner Svendsen. Schenkt mir Blumen, während ich lebe. Wenn ich tot bin, freut sich nur der Blumenhändler. Ich nahm den großen Schraubenzieher zur Hand und schraubte den Sargdeckel ab. Er war verdammt schwer. Ich würde Qualen ausstehen, wenn ich den Sarg allein auf den Leichenwagen verladen mußte.
Sie sah sehr adrett aus, die Frau, die darin lag. Ein bißchen gelb im Gesicht, aber im übrigen so friedlich wie die meisten alten Leute. An der rechten Hand hatte sie einen schmalen Siegelring, den ich nicht anzurühren wagte. Aber an der linken saß ein Ring mit einem großen hellblauen Stein. Er schien mir wertvoll zu sein, deshalb wollte ich ihn haben. Da ich den Ring nicht abbekam, holte ich die Kneifzange. Der Reif interessierte mich nicht, um so mehr der Stein.‘
Ich beugte mich über den Sarg und hielt mit der linken Hand ihre kalten Finger fest. Ich brauchte mich nicht sehr weit vornüber zu bücken, denn sie lag erhöht im Sarg. Worauf eigentlich? Mit schnellem Zwacken durchtrennte ich den dünnen Goldreif, und da stieg mir das Herz in die Kehle, und mein Verstand rutschte in die Hose. Ja, vor Schrecken machte ich in die Hose. Während ich den Reif durchzwickte, glitt die Frau langsam auf mich zu und fiel zur Seite, als ob sie sich im Schlaf umdrehte. Das weiße Tuch unter ihr zog sie mit, und es kam ein langes, schlankes Bein in Nylonstrumpf zum Vorschein.
In dem Sarg lag noch eine Leiche.
Ich war ein paar Schritte zurückgetaumelt und starrte schwer atmend darauf. Die Kneifzange war in den Sarg gefallen, und den Ring hatte ich nicht abbekommen. Ich wurde von Panik erfaßt. Ich wollte schon den Deckel wieder auflegen, kam jedoch zur Besinnung. Das ging nicht. Der Leichenbitter erwartete mich mit einem Sarg. Viele Fragen müßte ich beantworten, wenn ich nicht käme. Im Lügen hatte ich mich nie ausgezeichnet. Die Wahrheit vertuschen, ja, das konnte ich, aber eine richtige Lügengeschichte erfinden, dazu war ich nicht imstande.
Ich legte den Deckel wieder hin und trat zum Sarg. Schnell nahm ich die Kneifzange an mich und eignete mir den Ring an. Er hinterließ einen Riß am Finger der Frau. Ich tat die Zange an ihren Platz und steckte den Ring ein. Dann führte ich mir ein Bier zu Gemüte. Was sollte ich bloß machen? Ich ging wieder zum Sarg. Ich mußte sehen, wer unter der alten Dame lag. Ich hob sie samt dem weißen Tuch heraus und legte sie zwischen die Schienen, die zum Ofen führten. Hierauf nahm ich den zweiten Leichnam in Augenschein.
Es war ein junges Mädchen. Ihr Rock war hinaufgerutscht, und irgend etwas veranlaßte mich, ihn hinunterzuziehen. Sie war wohlgestaltet und sah im ganzen reizend aus. Vielleicht hätte man sie nicht schön nennen können, aber attraktiv. Als ich mich über sie beugte, sah ich die blutunterlaufenen Stellen an ihrem Hals. Deutliche Spuren von Fingern und Händen. Sie war erwürgt worden.
Zuerst wunderte ich mich, daß ihr Gesicht nicht verfärbt und die Augen geschlossen waren. Doch als ich feststellte, daß die Würgespuren nur an den Seiten des Halses zu sehen waren, begriff ich, daß der Mörder sie nicht erstickt, sondern nur ein paar Minuten lang die Blutzufuhr zum Gehirn abgeschnitten hatte, bis sie tot war. Das erforderte nicht viel Kraft. Sie tat mir leid.
Ich mußte wieder die Polizei anrufen. Ja, natürlich, der Einbruch. Der Mörder war in die Kapelle eingebrochen, um die Leiche loszuwerden. Zum Schein hatte er die beiden Leuchter mitgenommen, um uns glauben zu machen, ein gewöhnlicher kleiner Kirchendieb sei eingedrungen. Ich war schon auf dem Weg zum Telefon, das in der Umkleidekammer des Pfarrers steht – sie dient auch sozusagen als Büro –, als mir plötzlich heiß und kalt wurde.
Warum hatte ich den Sarg geöffnet?
Das würde mich die Polizei als erstes fragen.
Ich ging die Treppe wieder hinunter.
Zum Glück war noch eine Flasche Bier da. Diesmal leerte ich sie langsam, wobei ich mich bemühte, mir eine Geschichte auszudenken. Ich überlegte verschiedene Möglichkeiten, aber nur eine fand ich einleuchtend.
Mir war ja aufgefallen, daß der Sarg ungewöhnlich schwer war, mochte er auch aus Eichenholz sein.
›Ausgezeichnet beobachtet, mein guter Mann. Das soll in unserer Mitteilung an die Presse erwähnt werden, als Beispiel dafür, wie der Bürger den Hütern des Gesetzes beistehen kann.‹
Konnte ich wirklich etwas gemerkt haben? Nein. Die Räder liefen ja in Präzisionskugellagern, so daß es kein nennenswerter Unterschied war, ob man 50 oder 125 Kilo zu schieben hatte. Aber das wußte die Polizei sicher nicht, und sie würde andere Dinge zu untersuchen haben.
Ich war schon auf halbem Weg die Treppe hinauf, als ich zufällig die Hand in die Tasche steckte und den Ring zu fassen bekam. Im ersten Augenblick wußte ich nicht, was ich da fühlte; doch als es mir aufging, trat ich den Rückweg an.
Nicht nur hatte die alte Dame einen Eindruck rings um den Finger, sondern ich hatte ihr beim Abstreifen auch einen Riß beigefügt.
Ich saß in der Patsche. Was sollte ich machen?
Ich bin gewiß kein leuchtendes Beispiel für die Ehrsamkeit hierzulande, aber bei Mord ziehe ich die Grenze. Andererseits stand mir allerlei bevor, wenn sich die Polizei einmischte. Ich würde mindestens ein Jahr Gefängnis bekommen und meine Stellung verlieren. Und was hat ein Mann anfangs der Fünfziger noch zu erwarten, wenn er aus dem Knast kommt? Außerdem wurden Larsen, der Leichenbestatter und der Goldschmied mit hineingerissen.
Es blieb mir keine Wahl.
Ich setzte mich und zündete mir eine Zigarette an. Ich mußte beide Leichen verbrennen und tun, als ob nichts geschehen wäre. Ein Glück, daß ich gerade an diesem Tag allein war. Larsen wäre zusammengeklappt. Er war wie so viele große Männer, die mit den Jahren verfetten, ein Waschlappen. Ich bin klein und mager. Zäh, seelisch zäh. Oder vielleicht gefühlskalt?
Ich fröstelte, aber das Bullern des Ofens sagte mir, daß es nicht an der Temperatur lag.
Sollte der Kerl, der ein so hübsches junges Mädchen ermordet hatte, wirklich ungestraft davonkommen? Wahrscheinlich hatte er sie vergewaltigt und sie dann in Panik umgebracht. Bis morgen zitterte er sicher, aber wenn in den Zeitungen nichts von dem Leichenfund stand, atmete er natürlich erleichtert auf. Selbstverständlich wurde das Mädchen früher oder später vermißt, aber das hatte nichts zu besagen, wenn sie spurlos verschwunden war.
Spurlos.
In meinem Kopf regte sich etwas.
Ich ging wieder zu dem Sarg. Diesmal untersuchte ich das junge Mädchen gründlich. Von einer Vergewaltigung war nichts zu merken. Ihre Kleidung war weder zerrissen noch über Gebühr zerknittert. Das leichte Sommerkleid hatte keine Taschen. Ich fand keinerlei Hinweis auf ihre Identität.
Um den Hals hatte sie ein dünnes Goldkettchen mit einem Medaillon und an der linken Hand einen Ring mit dunkelrotem Stein.
Ich prägte mir ihr Aussehen ein, um sie wiederzuerkennen, wenn im Zuge der Nachforschungen ein Bild von ihr veröffentlicht wurde. Ich zog sogar die Lider in die Höhe, um ihre Augenfarbe festzustellen.
Sie hatte hellblaue Augen.
Ich schätzte ihre Größe auf einsfünfundsechzig, ihr Gewicht auf 55 Kilo. Sie mochte etwa 22 Jahre alt gewesen sein, aber das war nicht so wichtig. Ich werde ihr Gesicht nie vergessen.
Die hellblonden Haare waren zu einer knabenhaften Kurzhaarfrisur geschnitten. Die Backenknochen traten vor, der Mund war ziemlich groß. Die Ohren lagen eng an dem runden Kopf. Das Kinn wirkte energisch; die regelmäßigen Zähne waren gepflegt. Ich griff nach dem Ring, ließ ihn aber sogleich los und schämte mich.
Schließlich beschäftigte ich mich mit dem Medaillon. Es schien mir aus alter Zeit zu sein – meine Mutter hatte ein ähnliches gehabt. Darin hatte sie ein Bild meines Vaters gehabt, aber als der Schuft mit einer Kellnerin verduftete, ohne sein Reiseziel anzugeben, warf sie das Bild weg und steckte statt dessen einen Zettel mit ihrer Krankenkassennummer hinein, die sie sonst immer vergaß.
Ob das Medaillon des Mädchens wohl etwas enthielt? Ich öffnete es, und da hatte ich das Bild eines Mannes vor mir. Er war in meinem Alter, vielleicht ein wenig jünger, um gerecht zu sein. Ihr Vater vielleicht? Aber nein. Er hatte zwar graugesprenkelte Schläfen, aber man sah, daß die Haare kohlschwarz waren. Konnte er eine so hellblonde Tochter haben? Ich untersuchte bei ihr den Haaransatz. Die Haare waren durch und durch blond, es sei denn, sie hätte sie gestern oder vorgestern färben lassen.
Der Mann konnte nicht ihr Vater sein. Wer aber war er? Möglich, daß es aus den Presseberichten in Zusammenhang mit den Nachforschungen hervorging. Sie mußte ja in ihn verliebt gewesen sein, sonst hätte sie sein Bild nicht mit sich herumgetragen. Sicher kannten ihre Angehörigen ihn, so daß die Presse ihn erwähnen würde.
Ich nahm das Medaillon an mich und nach kurzem Bedenken auch den Ring. Vielleicht war es notwendig, ihn zu besitzen, wenn es um die Identifizierung ging. Ich hatte nämlich einen Entschluß gefaßt. Ich wollte herausfinden, wer der Mörder war. Die Ergebnisse der polizeilichen Nachforschungen wurden sicher laufend veröffentlicht, und ich wußte ja etwas, wovon die Polizei nichts in Erfahrung bringen konnte, so daß ich imstande war, mir zwei und zwei zusammenzureimen.
Dann wollte ich – ich schäme mich nicht, es zu sagen – von dem Menschen so viel Geld erpressen, daß er auf die Knie gezwungen wurde. Eine schlimmere Strafe als zwölf Jahre Gefängnis. Das wollte ich nämlich tun, solange ich lebte. Wenn ich mich vorsah, konnte ich noch gut zwanzig bis fünfundzwanzig Jahre hinter mich bringen. Der Mörder bekam seine gerechte Strafe, und für mich fiel etwas ab. Eine angenehme Entschädigung für die überstandene Aufregung.
Die Ruhe des Entschlossenen befiel mich, und ich führte automatisch die notwendigen Handgriffe aus, um jede Spur von den beiden Frauen zu vertilgen. Ich nahm das Mädchen aus dem Sarg, und nachdem ich die Ofentür geöffnet und die beiden Leichen ihrem barmherzigen, läuternden Schicksal überlassen hatte, wie der Pfarrer zu sagen pflegte, ließ ich den Katafalk wieder zu mir herunter. Ich schob den Sarg darauf und schickte den Katafalk abermals nach oben, während ich selbst die Treppe hinaufging und den Karren holte, auf dem wir die Särge immer beförderten, wenn sie zu schwer waren.
Der Karren hatte dieselbe Höhe wie der Katafalk, so daß es keine große Sache war, den Sarg darauf zu verladen. Schwieriger war es, den Karren durch den Mittelgang der Kapelle zur Tür zu ziehen. Ich ging flott hinaus. Es hatte keinen Zweck, verstohlen zu wirken. So kann man derartige Dinge nicht bei Tageslicht erledigen. Es war erst drei Uhr nachmittags, und die Sonne stand noch hoch, aber der Friedhof war wie gewöhnlich menschenleer. Ich holte das Auto von der anderen Seite der Kapelle und fuhr rückwärts zur Tür. Dann machte ich die Doppeltür weit auf und hakte sie fest, damit sie nicht zuschlug. Die Rampe des Leichenwagens hatte ich schon heruntergeklappt.
Es dauerte keine zwei Minuten, den Sarg in den Wagen zu schaffen, die Vorhänge zuzuziehen, zum Parkplatz zu fahren, die Kapellentür zu schließen und den Karren an seinen Platz zu bringen.
Ich kehrte in den Keller zurück und blickte in den Ofen. Alles verlief normal. In einer Stunde war alles überstanden. Ich legte die drei leeren Bierflaschen in meine alte Ledermappe und besorgte mir im Laden um die Ecke neue Stärkung. In fünf Minuten war man dort, aber ich ließ mir Zeit. Auch zu einem kleinen Schwatz mit dem Verkäufer. In einer kritischen Situation sollte er nicht aussagen können, ich wäre an dem Tage anders gewesen als sonst.
Als ich wieder im Keller war, sah ich abermals im Ofen nach. Dann setzte ich mich mit meinem Bier hin und versuchte, in Ruhe alles zu überlegen. Ja, ich versuchte es, denn das war gar nicht so leicht. Ich hatte unterwegs an den Händen geschwitzt, und im Laden hatten mir die Beine gezittert. Ich mußte tief durchatmen, damit mein Herz zu galoppieren aufhörte. Die verdammten Nerven. Was könnte man nicht alles ausrichten, wenn sie nicht wären!
Es blieb mir nur ein Weg. Vorwärts. Ich hatte die Brücke hinter mir verbrannt ... nein, abgerissen, und jetzt blieben mir bloß zwei Möglichkeiten – entweder alles gut sein lassen oder den Mörder finden, um ihn auf klassische Weise zu erpressen. Ich hatte noch nie einen Menschen erpreßt, aber das konnte ja nicht viel schwieriger sein als alle die kleineren oder größeren Spitzbübereien, an denen ich mich früher versucht hatte. Bisher war mir das Glück immer hold gewesen. Ich war nie ertappt worden und hatte nie gesessen. Meine Papiere waren fleckenfrei. Sonst hätte ich ja meine Stellung hier nicht bekommen. Immerhin fand ich mein Vorhaben gefährlich. Ich bekam es ja mit einem Mann zu tun, der einen Mord begangen hatte. Man sagt doch, es sei leichter, zum zweitenmal zu morden ...
Ich mußte ihm weismachen, wenn ich in 24 Stunden nichts von ihm hörte, hätte mein Anwalt den Auftrag, einen versiegelten Umschlag mit gewissen Papieren und Gegenständen der Polizei auszuliefern. Er solle sich also lieber zur Bezahlung bequemen und mich ungeschoren gehen lassen.
Ob ich diese Drohungen wohl so vorbringen konnte, daß sie echt klangen? Nein, ein solches Vorgehen war zu gefährlich. Ich mußte mich damit begnügen, mit ihm schriftlich in Verbindung zu treten. Komisch, die ganze Zeit schwebte mir ein Mann vor. Es konnte aber nur ein Mann sein. Eine Frau hätte für derartige Machenschaften sicher nicht die erforderlichen Kräfte und Nerven gehabt. Übrigens auch die meisten Männer nicht. Außerdem beruhte meine Vermutung auf dem Bild in dem Medaillon. Nun, zuerst mußte ja der Abgebildete ermittelt werden. Bis dahin würde mir wohl ein wasserdichtes Vorgehen einfallen.
Abends halb sieben war die Verbrennung beendet, und ich ließ den Eisenschlitten aus dem Ofen ausfahren. Nun kam die unangenehmste Arbeit. Ich schaufelte die Asche heraus. Es war eine ziemliche Menge. Gewöhnlich betrug das Gewicht drei bis vier Kilo; diesmal waren es mindestens sechs Kilo. Ich mußte sie zweimal durch den Aschebehandlungsapparat gehen lassen. Ich ließ sie ein Weilchen zur Abkühlung stehen, bevor ich sie einschüttete. Die Kontrollnummer, die aus gebranntem Ton besteht, legte ich zuunterst in die Auffangurne; dann stellte ich den Motor und den Staubsauger an. Gleichzeitig gingen die beiden elektrischen Birnen in dem Apparat an, so daß ich durch die Glasscheibe beobachten konnte, ob der Apparat richtig arbeitete. Die Asche lief durch zwei rotierende Walzen, die sie zerrieben, bevor sie auf das Förderband fiel, das sie über eine Magnettrommel führte.
Durch den Magnet werden alle Eisenteile aus der Asche entfernt, Sargnägel und -schrauben, Griffe, Scharniere und dergleichen. Den Staub, der beim Niederfallen der Asche in der Urne aufgewirbelt wird, fängt die Staubsauganlage auf.
Das Ganze dauerte eine halbe Stunde; dann stand die verschlossene Urne an ihrem Platz, bis die Beisetzung stattfinden würde. Irgendwann in der nächsten Woche. Inzwischen hatte sich der Ofen so weit abgekühlt, daß ich ihn ausräumen und reinigen konnte. Ich stellte die Geräte weg, zog mich um und ging zum wer weiß wievielten Male an diesem Tage die Treppe hinauf.
Schnell und ohne viel Worte wickelte sich das Geschäft beim Leichenbestatter ab. Ich erhielt meine hundert Kronen und auch Larsens Anteil. Seine hundert Kronen verstaute ich in dem verschließbaren Fach meiner Brieftasche, um nicht in Versuchung zu geraten; denn ich wußte nicht, wie lang diese Nacht werden würde.
2
Dienstag, den 6. Juni, bis Donnerstag, den 22. Juni 1967
Die folgenden zehn Tage vergingen, ohne daß sich etwas ereignete. Besonders der Dienstag war höllisch zu durchstehen. Ich war erst um vier Uhr morgens nach Hause gekommen und mußte ja um zehn mit dem Polizeibeamten wegen des Einbruchs in der Kapelle sprechen. Diese Vereinbarung konnte ich nicht rückgängig machen, und ich mußte ganz normal erscheinen. Natürlich nicht körperlich. Auch ein Krematoriumsangestellter darf sich in seiner Freizeit einmal vollaufen lassen. Ich meine, ich konnte es mir nicht leisten, den geringsten Zweifel an meiner seelischen Verfassung aufkommen zu lassen.
Die Montagnacht hatte ich richtig durchsumpft. Ich aß in einer kleinen Wirtschaft an der Svärtegade und blieb an einem Stammtisch hängen. Später machte ich mit Johansen die Runde, der zufällig Geld hatte, was mir gut paßte, da ich ebenfalls bei Kasse war.
An sich mache ich mir nicht viel aus Johansen. Er ist Vertreter irgendeiner Firma, die der Industrie Farben und Lacke liefert. Seine Einkünfte sind unregelmäßig, so daß es für mich ein Glück war, daß er gerade einen seiner guten Tage hatte. Er könnte ein flotter Bursche sein, wenn seine zwanzigjährige ungezügelte Lebensweise nicht ihre Spuren in seinem Gesicht hinterlassen und seinen Ehrgeiz nicht untergraben hätte. Er kleidet sich elegant, und die ausholenden Bewegungen sind ihm angeboren. Er wäre gern eine große Kanone geworden, hat es aber nur zu einer kleinen Büchse gebracht.
Als wir gegen elf Uhr abends in einem Restaurant an der Vesterbrogade saßen, sagte Johansen unvermittelt, er müsse im Hauptbahnhof seinen Koffer holen. Da ich nichts anderes zu tun hatte, ging ich mit. Es war kein besonders großer Koffer, denn er war in einem der Schließfächer aufbewahrt, in die man eine Krone steckt, die für 24 Stunden gültig ist. Johansen holte sich seinen Koffer, und wir zogen weiter.
Mit Mühe und Not gelang es mir, die Vereinbarung am Dienstag um zehn einzuhalten. Aber ich war sogar vor dem Polizeibeamten bei der Kapelle.
Er untersuchte die Tür.
»Sie ist mit einem Stemmeisen oder etwas Ähnlichem aufgebrochen worden«, stellte er fest.
Um das zu erkennen, hätte man die Polizei nicht zu bemühen brauchen. Hierauf machte er sich Notizen und zeichnete die Merkmale ab.
»Sie können das Schloß nun instand setzen lassen«, erklärte er. »Irgendwelche Spuren von dem Dieb? Fußabdrücke oder so etwas? Hat er etwas verloren? Einen Zigarettenstummel? Ein Streichholz?«
»Nein«, erwiderte ich. »In der Kapelle war alles sauber and ordentlich, als ich gestern herkam. Jedenfalls ist mir nichts aufgefallen.«
»Ist seitdem reingemacht worden?«
»Ja, die Putzfrau kommt immer morgens, fegt und wäscht den Boden auf.«
»Hm«, machte er.