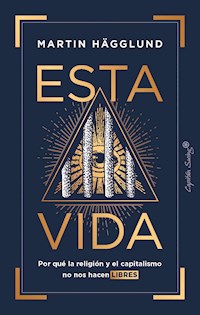24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Was wir brauchen, um ein sinnvolles Leben zu führen, ist die beinahe heroische Anerkennung und Bejahung dieses einen Lebens: Darin besteht die inspirierende Einsicht des philosophischen Shootingstars Martin Hägglund. In seinem gefeierten Bestseller zeigt er, dass wir keinen religiösen Glauben an die Ewigkeit, sondern einen säkularen Glauben kultivieren sollten, der sich unserem endlichen Zusammenleben widmet. Nur ein solcher Glaube kann die Quelle einer wahren Freiheit sein – und muss folglich das Zentrum einer überzeugenden Ethik und Politik für das 21. Jahrhundert bilden. Unsere Freiheit ist untrennbar mit materiellen und ökonomischen Bedingungen verbunden: Es kommt darauf an, wie wir in diesem Leben miteinander umgehen und was wir mit unserer begrenzten Zeit anfangen. In seinem tiefgründigen, originellen und durchweg zugänglichen Buch beschäftigt sich Hägglund daher nicht nur mit großen Philosophen von Aristoteles bis Hegel und Marx, sondern auch mit Schriftstellern von Dante bis Proust und Knausgård, mit politischen Ökonomen von Mill bis Keynes und Hayek sowie mit religiösen Denkern von Augustinus bis Kierkegaard und Martin Luther King Jr. Ihm geht es dabei sowohl um eine Kritik religiöser Ideale als auch um eine neuartige Vision einer postkapitalistischen Form des Zusammenlebens, in der wir unsere Lebenszeit wirklich besitzen und unsere geistige Freiheit leben können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
MARTIN HÄGGLUND
DIESES EINE LEBEN
Glaube jenseits der Religion, Freiheit jenseits des Kapitalismus
Aus dem Englischen von Stephanie Singh
C.H.BECK
Zum Buch
Was wir brauchen, um ein sinnvolles Leben zu führen, ist die beinahe heroische Anerkennung und Bejahung dieses einen Lebens: Darin besteht die inspirierende Einsicht des philosophischen Shootingstars Martin Hägglund. In seinem gefeierten Bestseller zeigt er, dass wir durchaus einen engagierten Glauben benötigen — aber nicht einen religiösen Glauben an Gott oder an etwas, das größer als unser Leben ist. Allein ein säkularer Glaube an den unbedingten Wert unseres endlichen Lebens, das wir gemeinsam mit anderen auf dieser prekär gewordenen Erde verbringen, kann die Quelle einer wahren Freiheit sein — und muss folglich das Zentrum einer überzeugenden Ethik und Politik für das 21. Jahrhundert bilden.
Weil die Religion und der Kapitalismus aber den Wert unseres zeitlich befristeten Lebens systematisch untergraben, benötigen wir eine genauso sorgfältige wie konstruktive Kritik unseres spirituellen und materiellen Denkens. In seinem tiefgründigen, originellen und durchweg zugänglichen Buch beschäftigt sich Hägglund daher nicht nur mit großen Philosophen wie Aristoteles und Marx, sondern auch mit Schriftstellern wie Dante und Knausgaard, mit Ökonomen wie Keynes und Hayek sowie religiösen Denkern wie Augustinus und Martin Luther King Jr. Ihm geht es dabei nicht bloß um die Kritik religiöser Ideale, sondern auch um eine neuartige Vision einer postkapitalistischen Form des Zusammenlebens, in der wir unsere Lebenszeit wirklich besitzen und unsere spirituelle Freiheit leben können.
Vita
Martin Hägglund ist Professor für vergleichende Literaturwissenschaft und Humanities an der Yale University, Mitglied der Society of Fellows der Harvard University und Autor mehrerer hochgelobter Bücher. In seiner schwedischen Heimat veröffentlichte er im Alter von 25 Jahren sein erstes Buch, «Chronophobia». Sein erstes englischsprachiges Buch, «Radical Atheism», war Gegenstand einer Konferenz an der Cornell University und eines Kolloquiums an der Oxford University. Sein philosophischer Bestseller «This Life» wurde mit dem René Wellek Preis ausgezeichnet und u.a. vom Guardian als Buch des Jahres prämiert.
INHALT
EINLEITUNG
I
II
III
Teil I: SÄKULARER GLAUBE
1: GLAUBE
I
II
III
IV
V
2: LIEBE
I
II
III
IV
V
VI
3: VERANTWORTUNG
I
II
III
IV
V
Teil II: GEISTIGE FREIHEIT
4: NATÜRLICHE UND GEISTIGE FREIHEIT
I
II
III
IV
V
5: DER WERT UNSERER ENDLICHEN ZEIT
I
II
III
IV
6: DEMOKRATISCHER SOZIALISMUS
I
II
III
IV
V
VI
Schluss: UNSER EINZIGES LEBEN
I
II
III
IV
DANKSAGUNG
ANHANG
BIBLIOGRAFIE
ANMERKUNGEN
Einleitung
1 Glaube
2 Liebe
3 Verantwortung
4 Natürliche und geistige Freiheit
5 Der Wert unserer endlichen Zeit
6 Demokratischer Sozialismus
Schluss Unser einziges Leben
Für meinen Freund Niklas Brismar Pålsson Mit ihm verbrachte Zeit ist immer freie Zeit
Wäre ich im Himmel, Nelly, würde ich dort sehr unglücklich sein. […] Mir träumte einmal, ich wäre dort. […] Ich wollte doch nur sagen, dass der Himmel mir nicht mein Zuhause zu sein schien. Und ich weinte mir schier das Herz aus dem Leib, weil ich wieder auf die Erde zurückwollte; und die Engel waren so wütend, dass sie mich hinauswarfen, mitten auf die Heide, an der höchsten Stelle von Wuthering Heights; dort erwachte ich und schluchzte vor Freude.
Emily Brontë, Sturmhöhe
EINLEITUNG
I
Meine Familie stammt aus Nordschweden. Das Haus, in dem meine Mutter geboren wurde und in dem ich jeden Sommer meines Lebens verbracht habe, liegt an der Ostsee. Die dramatische Landschaft mit ihren riesigen Wäldern, zerklüfteten Bergen und hoch über dem Meer aufragenden Klippen entstand während der letzten Eiszeit vor 12.000 Jahren, als sich das Eis hier hineingrub. Die Landmasse wächst noch immer. Das Abschmelzen der Gletscher legt immer mehr Land frei. Wo sich früher, als meine Mutter ein Kind war, noch sandiger Meeresboden befand, liegt heute ein Teil unseres Gartens. Die Felsen unter meinen Füßen erinnern an die Erdgeschichte, innerhalb derer wir nur ein Wimpernschlag sind. Wenn ich das Haus meiner Großmutter betrete, fällt mein Blick auf den Familienstammbaum an der Wand – zerbrechliche Linien mit Bauern und Landarbeitern, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen. Wenn ich die Berge erklimme, die aus dem Meer aufragen, erkenne ich das Ausmaß der Gletscherzeit, die noch heute unsere Landschaft formt.
Die Rückkehr ins Haus meiner Großeltern erinnert mich daran, wie sehr mein Leben von der Geschichte bestimmt wird: von der Naturgeschichte, der Evolution, und der sozialen Geschichte all jener, die vor mir kamen. Wer ich sein und was ich tun kann, wird nicht nur von mir selbst bestimmt. Mein Leben hängt von den vorangegangenen Generationen ab und von den Menschen, die sich um mich gekümmert haben. Wir alle wiederum werden bestimmt von einer Erdgeschichte, die auch ganz anders hätte verlaufen können, sodass wir vielleicht nie entstanden wären.
Mein Leben ist zudem historisch in dem Sinne, dass es auf eine keineswegs selbstverständliche Zukunft hin orientiert ist. Die Welten, denen ich angehöre, die Projekte, an denen ich mich beteilige und die ein Teil von mir sind, können sich gut entwickeln und dynamisch verändern, aber sie können auch in sich zusammenfallen, verkümmern und sterben. Die Welten, die sich durch meine Familie und Freunde eröffnen, und die Projekte, die meine Arbeit und politischen Verpflichtungen beeinflussen, bergen das Versprechen auf mein Leben und zugleich das Risiko, dass mein Leben zerstört wird oder aufhört, sinnvoll zu sein. In einem Wort: Sowohl mein Leben als auch die Projekte, für die ich mich einsetze, sind endlich.
Endlich sein heißt hauptsächlich zweierlei: von anderen abhängig sein und in einem Verhältnis zum Tod zu leben. Ich bin endlich, weil ich mich nicht allein am Leben erhalten kann und sterben werde. Auch die Projekte, denen ich mich widme, sind endlich, weil sie nur durch die Bemühungen derer am Leben erhalten werden, die sich für sie engagieren, und nur existieren, solange ihr Bemühen andauert.
Der Gedanke an meinen Tod und den Tod all dessen, was ich liebe, ist äußerst schmerzhaft. Ich will nicht sterben, sondern mich und alles, was ich liebe, am Leben erhalten. Gleichzeitig möchte ich nicht, dass mein Leben unendlich ist. Ewiges Leben ist nicht nur unerreichbar – es ist auch nicht erstrebenswert, weil es ebenjene Fürsorglichkeit und Leidenschaft vernichten würde, die mein Leben antreiben. Diese Problematik findet sich selbst innerhalb religiöser Traditionen, die den Glauben an das ewige Leben beinhalten. Ein Artikel in der Zeitschrift U. S. Catholic fragt: «Ist es im Himmel langweilig?» Der Artikel beantwortet die Frage mit Nein, da die Seelen im Himmel «nicht zu ewiger Ruhe, sondern zu ewiger Aktivität – ewiger sozialer Fürsorge» aufgerufen seien.[1] Diese Antwort unterstreicht jedoch das Problem, denn es gibt nichts, worum man sich im Himmel kümmern müsste. Sich kümmern setzt voraus, dass etwas misslingen oder verloren gehen kann – andernfalls würden wir uns keine Sorgen machen. Um ewige Aktivität muss sich – genau wie um ewige Ruhe – niemand kümmern, weil sie weder angehalten werden kann noch gesteuert werden muss. Die Schwierigkeit ist nicht, dass ewige Aktivität «langweilig» sein könnte, sondern dass sie nicht als meine eigene Aktivität erkennbar wäre. Jede meiner Aktivitäten, auch eine langweilige, setzt voraus, dass ich sie fortführe. Bei ewiger Aktivität gibt es keine gelangweilte oder in anderer Form beteiligte Person, weil ewige Aktivität keiner Aufrechterhaltung bedarf.
Die Ewigkeit würde meinem Leben also nicht nur keine Bedeutung verleihen, sie würde es sogar bedeutungslos machen, weil meine Handlungen keinen Zweck hätten. Was ich tue und liebe, ist für mich nur wichtig, weil ich mich selbst als sterblich begreife. Mein Selbstverständnis als Sterblicher muss mir nicht explizit gedanklich präsent sein, sondern es ist all meinen praktischen Verpflichtungen und Prioritäten inhärent. Die Frage, was ich mit meinem Leben anfangen soll, steht in meinem gesamten Tun zur Debatte. Sie setzt voraus, dass ich meine Lebenszeit als endlich begreife. Denn um die Frage, wie ich mein Leben führen soll, als Frage zu erfassen, muss ich glauben, dass ich sterben werde. Glaubte ich, mein Leben dauere ewig, stünde es nie auf dem Spiel und ich hätte nie das Bedürfnis, meine Zeit sinnvoll zu nutzen. Ich könnte nicht einmal verstehen, was es heißt, etwas lieber früher als später im Leben zu tun, weil ich keine Vorstellung von der endlichen Lebenszeit hätte, die jedem Vorhaben und jeder Aktivität eine gewisse Dringlichkeit verleiht.
Das Bewusstsein meines eigenen, unersetzlichen Lebens ist somit untrennbar von dem Wissen um sein Ende. Meine alljährliche Rückkehr in dieselbe Landschaft wird auch deshalb so bedeutsam, weil ich diese Region vielleicht nie wiedersehen werde. Darüber hinaus ist mir die Erhaltung dieser Landschaft wichtig, weil ich weiß, dass selbst die Fortdauer unserer natürlichen Umwelt nicht garantiert ist. Genauso ist meine Hingabe an geliebte Menschen untrennbar mit dem Wissen verbunden, dass deren Leben nicht selbstverständlich ist. Zeit mit Freunden und Familie ist wertvoll, weil wir sie bestmöglich nutzen müssen. Unsere gemeinsame Zeit wird von dem Gespür bestimmt, dass sie nicht unbegrenzt ist und wir uns umeinander kümmern müssen, weil unsere Leben zerbrechlich sind.
Unser Sinn für die Endlichkeit – für die Zerbrechlichkeit von allem, was uns wichtig ist – bildet den Kern dessen, was ich als säkularen Glauben bezeichne. Säkularer Glaube bedeutet, sich einem Leben hinzugeben, das enden wird, und Vorhaben zu verfolgen, die von der Gefahr des Scheiterns bedroht sind. Mit konkreten Beispielen (unserem Umgang mit Bestattungen) und in allgemeiner Hinsicht (was macht das Leben lebenswert) werde ich hier zeigen, wie säkularer Glaube sich ausdrückt: in unserer Trauer um geliebte Menschen, in den Bindungen, die wir eingehen, und in unserer Sorge um eine nachhaltige Welt. Ich bezeichne diesen Glauben als säkular, weil er einer zeitlich begrenzten Form des Lebens verpflichtet ist. Entsprechend der Bedeutung des lateinischen Wortes saecularis meint säkularer Glaube, sich Personen oder Projekten zu widmen, die weltlich und zeitlich sind. Es ist eine Form des Glaubens, die wir alle praktizieren, indem wir uns um jemanden oder etwas kümmern, das dem Verlust oder Verschwinden ausgesetzt ist. Wir alle sind fürsorglich – gegenüber uns, anderen und der Welt, in der wir leben –, und Fürsorge birgt stets das Risiko des Verlusts.
Im Gegenteil dazu ist allen Formen des Glaubens, die ich als religiös bezeichne, gemeinsam, dass sie unser endliches Leben als eine niedrigere Stufe der Existenz begreifen und damit entwerten. In allen Weltreligionen (Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Islam und Christentum) ist die höchste Stufe der Existenz oder die erstrebenswerteste Lebensform nicht endlich, sondern ewig. Religiös sein oder das Leben aus religiöser Perspektive betrachten heißt, unsere Endlichkeit als Mangel, Illusion oder untergeordnete Seinsweise zu betrachten. Dieser religiöse Blick auf das Leben ist jedoch nicht auf institutionalisierte Religionen oder Gläubige beschränkt. Auch viele Menschen, die nicht im religiösen Sinne gläubig sind, halten unsere Endlichkeit für eine Beschränkung und wünschen sich ein unendlich langes Leben.
Aus religiöser Perspektive erscheint unsere Endlichkeit als beklagenswerter Zustand, der idealerweise überwunden werden sollte. Diese Prämisse stört mich. Ich möchte zeigen, dass jedes lebenswerte Leben endlich sein muss und des säkularen Glaubens bedarf.
Säkularer Glaube ist Personen und Vorhaben verpflichtet, die wir verlieren können: Es geht darum, dass sie auch in Zukunft weiterleben. Der säkulare Glaube findet sich also nicht nur mit dem Tod ab, sondern versucht auch, ihn hinauszuzögern und die Lebensbedingungen zu verbessern. Wir werden sehen, dass Weiterleben nicht mit ewigem Leben verwechselt werden sollte. Im Engagement für das Weiterleben drückt sich kein Streben nach ewigem Leben aus, sondern nach einem längeren und besseren Leben; kein Versuch der Überwindung des Todes, sondern der Verlängerung und qualitativen Verbesserung des Lebens.
Dem Bekenntnis zum Weiterleben wohnt der Sinn für unsere Endlichkeit inne. Wie lange das Weiterleben auch dauern und wie sehr sich die Lebensqualität auch verbessern mag – das Leben bleibt endlich. Selbst wenn wir für ein Ideal kämpfen, das weit über unser eigenes Leben hinausreicht – etwa eine politische Zukunftsvision oder ein nachhaltiges Erbe für die kommenden Generationen –, bleiben wir doch einer Form des Lebens verpflichtet, das enden kann oder sogar nie entstehen könnte. Dieser Sinn für die Endlichkeit ist wesentlich für die Bedeutung, die wir dem Weiterleben von jemandem oder etwas verleihen. Wenn wir ein Leben hervorbringen, verlängern oder verbessern wollen, sind wir von dem Wissen getrieben, dass es verloren sein könnte, wenn wir nicht handeln. Ohne dieses Verlustrisiko wären unser Einsatz und unsere Verpflichtung nicht nötig.
Säkularer Glaube bedeutet, dass das Objekt unseres Glaubens von der Praxis des Glaubens abhängig ist. Ich spreche von säkularem Glauben, weil das Objekt unserer Zuwendung nicht unabhängig von denen existiert, die an seine Bedeutung glauben und es durch ihre Treue am Leben erhalten. Der Gegenstand säkularen Glaubens – etwa das Leben, das wir führen, die Institutionen, die wir schaffen, oder die Gemeinschaft, die wir erzeugen wollen – ist untrennbar von dem, was wir tun und wie wir es tun. Indem wir säkularen Glauben praktizieren, binden wir uns an ein normatives Ideal (einen Begriff davon, wer wir als Individuen und als Gemeinschaft sein sollten). Dieses Ideal hängt jedoch davon ab, wie sehr wir an unsere Verpflichtung glauben, und es kann hinterfragt, verändert oder gekippt werden. Im Gegensatz dazu wird der Gegenstand eines religiösen Glaubens – sei es Gott oder ein anderes unendliches Wesen – letztlich als von der Praxis des Glaubens getrennt begriffen, weil er selbst nicht von irgendeiner Form des endlichen Lebens abhängt.
In unserer gegenwärtigen historischen Situation ist das grundlegendste Beispiel für eine endliche Existenz die Aussicht auf die Zerstörung der Erde selbst. Würde sie zerstört, wären alle Lebensformen, die uns wichtig sind, ausgelöscht. Niemand würde weiterleben, und kein Aspekt unseres Lebens würde erinnert.
Doch vom Standpunkt des religiösen Glaubens aus ist ein solches Ende des Lebens nur ein scheinbares Ende. Auch wenn alles Weiterleben endet, geht nichts Essentielles verloren, weil das Essentielle nicht endlich, sondern ewig ist. William James stellt im Fazit seines klassischen Texts Die Vielfalt religiöser Erfahrung fest, die Nachrangigkeit des Endlichen gegenüber dem Ewigen sei eine Gemeinsamkeit sowohl orthodoxer Religionen als auch aller Formen des religiösen Mystizismus. Die Welt möge, wie uns die Wissenschaft versichere, tatsächlich eines Tages verbrennen oder einfrieren, so James, aber allen religiös Gläubigen garantiere die Existenz Gottes eine ideale Ordnung, die auf ewig erhalten bleibe.[2] Deshalb ist das Ende der Welt aus religiöser Perspektive letztlich keine Tragödie – im Gegenteil: Viele religiöse Doktrinen und Visionen begrüßen das Ende der Welt als Moment der Erlösung. Dieser Moment wird entweder als kollektives Ende der Menschheit imaginiert, in dem über Verdammnis und Erlösung entschieden wird (wie etwa im Judentum, im Christentum und im Islam). Oder es erscheint als Ende eines Individuums, das in einen zeitlosen Seinszustand übergeht (wie im Hinduismus und Buddhismus). In beiden Fällen werden unsere Leben als sterbliche Wesen nicht als Endpunkte betrachtet, sondern als Möglichkeiten, das Ende der Menschheitsgeschichte zu erreichen.
Aus dem gleichen Grund können aus dieser Perspektive auch der Klimawandel und die mögliche Zerstörung der Erde nicht als existentielle Bedrohung künftiger Generationen gesehen werden. Um die existentielle Bedrohung der eigenen Generation und kommender Generationen zu begreifen, muss man nicht nur an die Endlichkeit des Lebens glauben, sondern auch daran, dass alles Wertvolle – alles, worauf es ankommt – von diesem endlichen Leben abhängt. Genau das aber negiert der religiöse Glaube. Wer religiös ist, glaubt, dass alles endliche Leben beendet werden und das wahrhaft Wertvolle dennoch fortbestehen kann.
Der Dalai Lama fasste dies perfekt zusammen, als er gefragt wurde, wie sich ein Buddhist um unsere derzeitige ökologische Krise Sorgen machen könne – sei für ihn die endliche Welt doch eine Illusion und er selbst von allem Vergänglichen losgelöst. «Ein Buddhist würde sagen, das ist egal», antwortete der Dalai Lama.[3] Das mag überraschen, weil die buddhistische Ethik bekanntermaßen für ein friedvolles Verhältnis zur Natur und allen Lebewesen eintritt. Doch sie interessiert sich nicht für Natur und Lebewesen als Zwecke für sich selbst, sondern strebt nach der Loslösung vom Karma mit dem Ziel, vom Leben selbst erlöst zu werden und anderen dabei zu helfen, das Gleiche zu erreichen. Das Ziel des Buddhismus besteht nicht darin, dass jemand – oder die Erde selbst – weiterlebt, sondern es liegt im Zustand des Nirwana, in dem nichts mehr Bedeutung besitzt.
Die buddhistische Perspektive ist keine Ausnahme, macht aber explizit, was jede religiöse Orientierung auf die Ewigkeit hin impliziert. Im Streben nach ewigem Leben zählt endliches Leben nicht um seiner selbst willen, sondern dient nur als Vehikel zur Erlösung.
Natürlich kann man selbst als religiöser Mensch unser Leben auf der Erde als zutiefst bedeutsam empfinden. Mein Punkt ist jedoch: Wer sich um unsere Lebensform als Selbstzweck sorgt, agiert auf der Basis säkularen Glaubens, selbst wenn er behauptet, religiös zu sein. Religiöser Glaube kann bedeuten, dass man sich an moralische Normen hält. Er beinhaltet aber nicht die Anerkennung, dass der Endzweck unseres Tuns – der bestimmt, warum es wichtig ist, wie wir miteinander und unserer Erde umgehen – unser fragiles gemeinsames Leben darstellt. Aus religiöser Perspektive liegt der Endzweck im Dienst an Gott oder in der Erlösung, nicht in der Sorge um unser gemeinsames Leben und die künftigen Generationen, für die wir Verantwortung tragen. Sobald wir erkennen, dass unsere endlichen Leben – und die Generationen, die unser endliches Erbe fortführen – Zwecke in sich selbst sind, drücken wir aus, dass unser Glauben nicht religiös, sondern säkular ist.
Unsere ökologische Krise kann deshalb nur auf dem Standpunkt des säkularen Glaubens ernst genommen werden. Allein ein säkularer Glaube kann dem Wohl endlichen Lebens, dem nachhaltigen Leben auf der Erde, als Selbstzweck verpflichtet sein. Wenn die Erde selbst innerhalb der ökologischen Krise Gegenstand der Fürsorge wird, dann deshalb, weil wir sie für eine endliche Ressource halten – für ein Ökosystem, das beschädigt und zerstört werden kann. Ob wir uns um die Erde kümmern, weil sie selbst uns am Herzen liegt oder weil wir uns um die auf ihr lebenden Arten sorgen: Unser Wissen um ihre fragile Existenz ist ein intrinsischer Teil unserer Fürsorge. Das soll nicht heißen, dass wir uns nur um die Erde sorgen, weil wir sie verlieren könnten. Vielmehr liegt das an den positiven Eigenschaften, die wir ihr zuschreiben. Doch ein intrinsischer Teil unserer Sorge um die positiven Eigenschaften der Erde ist unser Glaube, dass sie verloren gehen könnten – entweder für uns oder als Zwecke in sich selbst.
Gleiches gilt für die Art, auf die wir uns um unser eigenes Leben, das Leben unserer Lieben oder das Leben jener kümmern, für die wir Verantwortung tragen. Sich um jemanden oder etwas kümmern impliziert, dass wir an dessen Wert glauben und es gleichzeitig für endlich halten. Um auf diese Weise Sorge zu tragen, müssen wir die Zukunft nicht nur für eine Chance, sondern auch für ein Risiko halten. Nur im Lichte des Risikos, des möglichen Scheiterns oder Verlusts, können wir uns dazu verpflichten, das, was wir wertschätzen, am Leben zu erhalten. Säkularer Glaube allein genügt nicht für ein verantwortungsvolles Leben und führt nicht automatisch zur Verbesserung der Welt. Um ethisches, politisches und verwandtschaftliches Engagement zu motivieren, ist er jedoch nötig.
Entsprechend werde ich zu zeigen versuchen, dass säkularer Glaube den Kern des Verantwortungsgefühls bildet. Ein einfaches Beispiel ist die Goldene Regel. Andere so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte, ist ein Grundprinzip sowohl der säkularen als auch der religiösen Morallehre. Die Goldene Regel setzt allerdings keinerlei religiösen Glauben voraus. Im Gegenteil: Echtes Verantwortungsgefühl für andere muss auf säkularem Glauben basieren. Folgt man der Goldenen Regel, weil man sie für einen Gottesbefehl hält, wird man eher durch den Gehorsam gegenüber Gott motiviert als durch die Sorge um andere Menschen. Folgt man ihr, weil man sich eine göttliche Belohnung erhofft (etwa die Erlösung vom Karma), handelt man nicht im Sinne des Wohlergehens anderer, sondern aus Sorge um die eigene Erlösung. Basiert die Sorge um andere auf religiösem Glauben, geht sie verloren, sobald der Glaube schwindet. Auf diese Weise wird deutlich, dass die Sorge nie den anderen als Zwecken in sich selbst galt.
Wie das gesamte Buch richtet sich auch dieses Argument gleichermaßen an ein religiöses und ein nicht-religiöses Publikum. Leser und Leserinnen, die sich als religiös definieren, lade ich ein, sich zu fragen, ob sie sich um andere kümmern, weil sie sich von Gott dazu aufgerufen fühlen oder sich eine göttliche Belohnung erhoffen. Religiöse wie säkulare Leser möchte ich ermutigen, ihre Sorge um endliches Leben als Bedingung ihrer Verantwortung zu begreifen. Die Goldene Regel ist nicht von einem religiösen Ewigkeitsverständnis abhängig. Sie bedarf, im Gegenteil, eines säkularen Verständnisses von Endlichkeit.
Andere so zu behandeln, wie man selbst gern behandelt würde, verlangt die Anerkennung unserer gemeinsamen Endlichkeit, weil nur endliche Wesen gegenseitige Fürsorge brauchen. Ein unendliches Wesen benötigt nichts und schert sich nicht darum, wie es behandelt wird. Deshalb fordert die Goldene Regel, dass wir einander als endlich anerkennen und als Selbstzwecke die Treue halten. Weil ich endlich bin, habe ich Bedürfnisse und möchte auf eine bestimmte Weise behandelt werden. Und weil ich andere als endlich anerkenne, kann ich verstehen, dass sie Bedürfnisse haben und auf eine bestimmte Weise behandelt werden wollen. Wenn wir unsere gemeinsame Verletzlichkeit und Endlichkeit nicht akzeptieren, ist die Aufforderung zur Gegenseitigkeit unverständlich und motiviert uns nicht, uns umeinander als Selbstzwecke zu kümmern.
Ich möchte deshalb das emanzipatorische Potential aufzeigen, das in der Anerkennung unseres säkularen Glaubens und unserer wesentlichen Endlichkeit liegt. Das emanzipatorische Potential säkularen Glaubens ist eine Möglichkeit und in unserer derzeitigen Phase der Säkularisierung bei Weitem nicht erreicht. Es sollte auch nicht mit einer emanzipierten Form säkularen Lebens verwechselt werden. Selbst wenn das säkulare Leben gelingt, bleibt es immer fragil, da es nur insofern aufrechterhalten wird, wie wir uns dafür einsetzen. Die Anerkennung der Endlichkeit garantiert nicht, dass wir uns in der richtigen Weise umeinander kümmern. Sie ist eine notwendige Bedingung, mit der die Forderung nach gegenseitiger Fürsorge erst verständlich wird. Sie ist aber keineswegs ausreichend für tatsächliche gegenseitige Fürsorge. Gerade weil wir aufeinander angewiesen sind und unser Leben zerbrechlich ist, sind wir aufgerufen, Institutionen zu entwickeln, die sich sozialer Gerechtigkeit und materiellem Wohlstand verpflichten. Unsere Fähigkeit, andere gerecht zu behandeln, hängt davon ab, wie wir selbst behandelt und umsorgt werden – von unseren ersten Erfahrungen elterlicher Liebe bis zu den gesellschaftlichen Strukturen, innerhalb derer wir leben. Nur die säkulare Perspektive erlaubt uns die Konzentration auf diese normativen Praktiken – Erziehung, Bildung, Arbeit, Regierung etc. – als essentielle Formen unseres Handelns, als Praktiken, für die wir verantwortlich sind und die nicht etwa von der Natur oder einer übernatürlichen Macht stammen, sondern von uns aufrechterhalten, hinterfragt oder überprüft werden müssen.
Aus dem gleichen Grund ist der säkulare Glaube die Voraussetzung der Freiheit. Frei sein, so meine ich, heißt nicht, souverän oder von allen Zwängen befreit zu sein. Vielmehr sind wir frei, weil wir uns fragen können, was wir mit unserer Zeit anfangen sollten. All unsere Formen der Freiheit – beispielsweise die Freiheit, zu handeln, sich zu äußern oder zu lieben – werden nur als Freiheiten begreifbar, weil wir die Freiheit haben, uns der Frage zu stellen, was wir aus unserer Zeit machen sollten. Wäre uns vorgegeben, was wir zu tun und zu sagen oder wen wir zu lieben haben – wäre also vorgegeben, was wir mit unserer Zeit anfangen sollten –, wären wir nicht frei.
Die Fähigkeit, diese Frage zu stellen, ist die Grundvoraussetzung dessen, was ich als geistige Freiheit bezeichne. Um ein freies und geistiges (im Gegensatz zu einem bloß von natürlichen Instinkten bestimmten) Leben zu führen, muss ich für mein Handeln verantwortlich sein. Das heißt nicht, dass ich von natürlichen und gesellschaftlichen Zwängen befreit bin. Ich habe mich nicht entschieden, mit meinen individuellen Einschränkungen und Fähigkeiten geboren zu werden. Zudem hatte ich keine Kontrolle darüber, wer sich um mich kümmerte und was diese Leute für mich und mit mir machten. Meine Familie und der historische Kontext, in den ich hineingeboren wurde, formten mich, ehe ich darauf Einfluss nehmen konnte. Zudem beeinflussen gesellschaftliche Normen weiterhin, wie ich mich sehen und was ich aus meinem Leben machen kann. Ohne soziale Normen – die ich nicht selbst entwickelt habe und die meine Lebenswelt formen – kann ich nicht begreifen, wer ich sein oder was ich tun soll. Dennoch bin ich dafür verantwortlich, diese Normen aufrechtzuerhalten, zu hinterfragen oder zu verändern. Ich werde nicht nur kausal von Natur oder Normen bestimmt, sondern handele im Licht von Normen, die ich hinterfragen und verändern kann.[4] Ebendas bedeutet, ein geistiges Leben zu führen. Selbst um den Preis meines biologischen Überlebens, meines materiellen Wohlergehens oder meines gesellschaftlichen Ansehens kann ich mein Leben einem Prinzip widmen, an dem ich mich messe, oder einem Anliegen, an das ich glaube.
Meine Freiheit verlangt also, dass ich mich fragen kann, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Selbst wenn ich in dem, was ich tue, sage und liebe, völlig aufgehe, muss die Möglichkeit dieser Frage in mir lebendig sein. Es ist notwendig, dass meine Aktivitäten das Risiko der Langeweile bergen – andernfalls wären sie nur zwanghaftes Handeln. In meiner Orientierung auf das, was ich liebe, muss ich das Risiko eingehen, es zu verlieren oder aufzugeben – andernfalls stünde nichts auf dem Spiel und ich müsste zu dem, was ich liebe, nicht aktiv eine Beziehung aufrechterhalten. Ganz grundlegend muss ich im Verhältnis zu meinem unaufhaltsamen Tod leben – andernfalls glaubte ich, meine Zeit sei unbegrenzt und es gäbe keine Notwendigkeit, mein Leben einer bestimmten Sache zu verschreiben.
Die Bedingung unserer Freiheit ist also, dass wir uns selbst als endlich begreifen. Nur im Licht des Wissens um unseren Tod, um unsere nicht klar definierte, aber endliche Lebenszeit, können wir uns fragen, was wir mit unserem Leben anfangen sollen, und sind dazu in der Lage, uns in unserem Handeln Risiken auszusetzen. Wie wir sehen werden, sind deshalb alle religiösen Vorstellungen von Ewigkeit letztlich Vorstellungen von Unfreiheit. Im Vollzug der Ewigkeit müssten wir uns nicht fragen, was wir mit unserem Leben anfangen sollen. Wir wären umfangen von ewigem Glück und somit jeglicher Handlungsfähigkeit enthoben. Wir hätten kein freies Verhältnis zu dem, was wir tun und lieben, sondern wären gezwungen, es zu genießen.
II
Dieses eine Leben richtet sich sowohl an eine religiöse als auch eine säkulare Leserschaft. Das religiöse (und zur Religiosität neigende) Publikum lade ich dazu ein, sich zu fragen, ob es wirklich an die Ewigkeit glaubt und dieser Glauben mit dem Engagement, das ihr Leben animiert, vereinbar ist. Außerdem lade ich sowohl die religiöse als auch die säkulare Leserschaft ein, die Endlichkeit unseres Lebens nicht als Mangel, Einschränkung oder minderwertigen Zustand zu begreifen. Statt die fehlende Ewigkeit zu beklagen, sollten wir die Bindung an ein endliches Leben als Grundbedingung begreifen, dank derer etwas auf dem Spiel steht und wir ein freies Leben führen können.
Meine Kritik des religiösen Glaubens hebt nicht primär auf wissenschaftliche Erkenntnis ab. Genauso wenig bezieht sich meine Kritik religiöser Werte vorrangig auf wissenschaftliche Fakten. Vielmehr möchte ich eine neue Perspektive auf das vorschlagen, was wir glauben und wertschätzen. Indem wir uns um jemanden oder etwas kümmern, praktizieren wir bereits eine implizite Form des säkularen Glaubens, weil wir uns an etwas Zerbrechliches gebunden haben. Mein Ziel besteht darin, unseren säkularen Glauben explizit zu machen, und zwar im Rahmen unseres Verständnisses von dem, was wir tun. So möchte ich emanzipatorische Möglichkeiten eröffnen, mit denen wir unsere Praxis gegenseitiger Fürsorge, aber auch unser gemeinschaftliches Leben verändern können.
Mein Argument hinterfragt eines der größten Vorurteile über die Religion. Vielen Umfragen zufolge glauben über 50 Prozent der Amerikaner, dass ein religiöser Glaube nötig sei, um ein moralisches, verantwortungsvolles Leben zu führen. Diese Annahme gehört in eine allgemeine Renaissance der politischen Theologie, die sowohl unter prominenten Philosophen wie auch in der breiten Öffentlichkeit zu beobachten ist. Der Ideenhistoriker Peter E. Gordon hat das Wiederaufleben der politischen Theologie bei Denkern wie Charles Taylor, Jürgen Habermas und José Casanova untersucht und die umfassendste Definition geliefert. Gordon zufolge wird die politische Theologie von zwei Thesen bestimmt. Die erste These postuliert ein normatives Defizit: Dem säkularen Leben mangele es an moralischer Substanz; es biete keinen tragfähigen Grund für unser politisches Zusammenleben. Die zweite These geht von religiöser Fülle aus: Um das normative Defizit zu kompensieren, müsse sich das säkulare Leben zur Religion als einzigartiger und privilegierter Quelle moralisch-politischer Belehrung hinwenden, ohne die unser gesellschaftlicher Zusammenhalt nicht möglich sei. Gordon zeigt, dass diese beiden Thesen der politischen Theologie sich mit bemerkenswerter Hartnäckigkeit nicht nur in der Ideengeschichte, sondern auch in der zeitgenössischen Philosophie und Soziologie wiederfinden.[5]
Eine derartige politische Theologie trägt zu dem allgegenwärtigen negativen Narrativ über die Möglichkeiten des säkularen Lebens bei. Es heißt, in unserem säkularen Zeitalter sei der Glaube an ewiges Leben oder unsterbliche Lebewesen zurückgegangen. Und doch sind viele der Überzeugung, der fehlende religiöse Glaube sei ein großer Verlust und die Hoffnung auf Ewigkeit Ausdruck unserer tiefsten Sehnsucht – wenngleich sie sich nicht erfüllen wird. Aus dieser Perspektive kranke das säkulare Leben sowohl an einem normativen als auch an einem existentiellen Defizit. Aufgrund der Säkularisierung hätten wir gleichermaßen die moralische Grundlage für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und die sinnstiftende Hoffnung auf Erlösung verloren.
Die einflussreichste Version dieser negativen Einschätzung unseres säkularen Lebens formulierte der Soziologe Max Weber im frühen 20. Jahrhundert. Webers berühmte Behauptung, das säkulare Leben leide an der «Entzauberung» der Welt, dient noch heute als Alibi politischer Theologie und soll vermitteln, eine Gesellschaft ohne religiösen Glauben sei hoffnungslos mangelhaft. Weber zufolge hat die Entzauberung drei Hauptfolgen.[6] Zunächst bedeute sie, dass wir uns nicht mehr auf «geheimnisvoll[e] unberechenbar[e] Mächte» oder andere übernatürliche Erklärungen der Ereignisse in unserer Welt berufen können. Die Vernunft wird vielmehr instrumentell in der Annahme, «daß man vielmehr alle Dinge – im Prinzip – durch Berechnen beherrschen könne». Zweitens bedeutet Entzauberung für Weber, dass «gerade die letzten und sublimsten Werte zurückgetreten sind aus der Öffentlichkeit», sodass wir jede Form «echte[r] Gemeinschaft» vermissen müssen. Und schließlich beklagt Weber, die Entzauberung führe dazu, dass der Tod keine «sinnvolle Erscheinung» mehr sei.
Laut Weber hatten jene Menschen, die in einer verzauberten Welt lebten – sein Beispiel ist «Abraham oder irgendein Bauer der alten Zeit» –, eine «sinnvolle» Beziehung zum Tod, starben «lebensgesättigt» und betrachteten sich als Teil eines «organischen Kreislauf[s]». An der Schwelle zum Tod konnten Abraham oder der Bauer der Vergangenheit «genug» vom Leben haben, weil es ihnen «gebracht hatte, was es bieten konnte», und «weil für [sie] keine Rätsel, die [sie] zu lösen wünschte[n], übrig blieben». Der entzauberte Mensch hingegen, der «Kulturmensch», kann sein Leben nie als vollendet betrachten, da er dem Fortschrittsgedanken verpflichtet ist (der fortwährenden «Anreicherung der Zivilisation mit Gedanken, Wissen, Problemen») und an ihm teilhaben will. Ein solcher Mensch wird stets unzufrieden sein, so Weber, denn sein Leben ist nie vollendet: Er «erhascht von dem, was das Leben des Geistes stets neu gebiert, ja nur den winzigsten Teil, und immer nur etwas Vorläufiges, nichts Endgültiges, und deshalb ist der Tod für ihn eine sinnlose Begebenheit.» Der Tod wird nicht mehr als bedeutungsvoller Abschluss eines Lebens und als Eintritt in die Ewigkeit verstanden, sondern als sinnlose Unterbrechung des Lebens. So kommt Weber zu dem Schluss, die Verpflichtung auf den Fortschritt wirke sich auf unser Leben sinnentleerend statt sinnstiftend aus: «Und weil der Tod sinnlos ist, ist es auch das Kulturleben als solches, welches ja eben durch seine sinnlose ‹Fortschrittlichkeit› den Tod zur Sinnlosigkeit stempelt.»
Seit Weber Anfang des 20. Jahrhunderts diese Gesellschaftsdiagnose lieferte, haben viele Denker nach einem Heilmittel gegen die Entzauberung und Bedeutungslosigkeit gesucht, die dem säkularen Leben angeblich inhärent sind. Im Gegensatz dazu lautet mein Argument, dass die Diagnose selbst zutiefst irreführend ist und in jeder Hinsicht hinterfragt werden sollte.
Webers Grundproblem besteht darin, dass er die Verpflichtung zur Freiheit nicht als genuine, historische Errungenschaft der säkularen Moderne begreift. Für Weber bleibt nach Abzug religiöser Normen und Werte nur eine verarmte instrumentelle Vernunft übrig, die keine «letzten Werte» oder «echte Gemeinschaft» mehr ermöglicht. Doch die Vorstellung einer isoliert agierenden instrumentellen Vernunft wird nicht verständlich. Wir können nicht instrumentell denken, ohne einen Lebenssinn vor Augen zu haben. Denn instrumentell kann nur sein, was im Lichte eines Werts betrachtet wird, den wir für einen Selbstzweck halten. Hätten wir keine bestimmenden Ziele und wäre alles auf instrumentelle Mittel reduziert, wäre es nicht möglich, den Sinn irgendeiner Handlung zu begreifen. Im Gegensatz zu religiösem Glauben erkennt der säkulare Glaube an, dass die für uns lebensbestimmenden Ziele von unseren eingegangenen Verpflichtungen abhängen. Die Autorität unserer Normen kann nicht durch göttliche Offenbarung oder natürliche Eigenschaften hergestellt, sondern muss von unseren Praktiken eingesetzt, aufrechterhalten und legitimiert werden. Dass wir uns nicht an mysteriöse Kräfte oder eine übernatürliche Autorität wenden, heißt – anders, als Weber behauptet – nicht, dass wir glauben, alles könne durch «Berechnung» beherrscht werden. Im Gegenteil. Auf säkulare Weise zu glauben schließt eine Akzeptanz unserer grundlegenden Abhängigkeit von und eine Verpflichtung gegenüber anderen Menschen ein, die wir nicht beherrschen oder kontrollieren können, weil wir alle freie, endliche Wesen sind.
Im gleichen Sinne können die Normen, im Lichte derer wir unser Leben führen, hinterfragt, angefochten und revidiert werden. Die Erkenntnis, dass wir für die Form unseres gemeinsamen Lebens verantwortlich sind, hindert uns keineswegs an «echter Gemeinschaft», sondern bildet den Kern unserer modernen, säkularen Verpflichtung zur Demokratie. Wie andere politische Theologen glaubt Weber jedoch nicht an Demokratie als tatsächliche Macht des Volks, sondern meint, sie bedürfe eines charismatischen Führers (so Weber fünfzehn Jahre vor Hitlers Machtergreifung). Ohne einen Führer in der Rolle der religiösen Autorität habe die Demokratie keine «Seele». Weber glaubt nicht an eine Eigenschaft des säkularen Lebens, die Menschen in echter Gemeinschaft aneinanderbinden könne.[7]
So mag Weber seine Diagnose zwar als «wertneutral» bezeichnen, doch seine negative Beurteilung der Möglichkeiten säkularen Lebens verrät die zugrunde liegenden religiösen Annahmen. Damit meine ich nicht, dass Weber an Gott oder die Ewigkeit glaubt, sondern dass er unsere Endlichkeit als negative Einschränkung betrachtet und annimmt, das säkulare Leben kranke an Bedeutungslosigkeit. Weber ist stolz darauf, die «Leere» des Lebens ohne Religion mutig zu konfrontieren, und sieht sich im Gegensatz zu jenen, die «dem Schicksal der Zeit nicht in sein ernstes Antlitz blicken» und zurückstreben in «die weit und erbarmend geöffneten Arme der alten Kirchen».[8] Doch seine Vorstellung des säkularen Lebens als leer oder sinnlos ist selbst eine religiöse Betrachtungsweise.
Weber stützt seine Behauptung, die Verpflichtung zum Fortschritt mache unser Leben sinnlos statt sinnvoll, auf den tiefreligiösen Schriftsteller Leo Tolstoi. Sein gesamtes Argument zeugt von einer bemerkenswerten Unfähigkeit, die Dynamik einer freien, endlichen Lebensführung zu begreifen. Weber scheint zu glauben, ein erfülltes Leben müsse zu endgültiger Befriedigung oder Vollendung führen, sodass man «genug» vom Leben hat und den Tod als «sinnvoll» begrüßen kann. Es handelt sich hierbei um eine zutiefst fehlgeleitete Perspektive darauf, was es bedeutet, als Person sein Leben zu führen. Eine Person zu sein ist kein Ziel, das erreicht werden kann, sondern ein Zweck, der aufrechterhalten werden muss.
Betrachte ich beispielsweise die Soziologie als meine Berufung (wie Weber es tat), so verstehe ich die Bedeutung meines Lebens im Lichte meines Engagements als Soziologe. Soziologe zu sein ist kein Projekt, das abgeschlossen werden kann, sondern ein Sinn, um dessentwillen ich mein Leben führe und mich auf meinem Feld betätige. Ist mein Leben als Soziologe befriedigend, heißt das nicht, dass ich genug davon habe, Soziologe zu sein. Selbst wenn ich nicht mehr als Soziologe arbeite und mich auf andere Tätigkeiten konzentriere, bin ich dem Dasein als Soziologe noch immer insofern verpflichtet, als ich mich mit meiner getanen Arbeit identifiziere (selbst, wenn ich meine Standpunkte revidiere oder die Arbeit anderer für besser halte). Hätte ich wirklich «genug» von der Soziologie, hieße das, jedes Interesse an meiner bisherigen Arbeit und Identität als Soziologe aufzugeben. Und selbst wenn ich dies erreichen würde, wäre mein Leben nicht vollendet. Solange ich es führe, muss ich einem oder mehreren Zwecken verpflichtet sein – etwa als Rentner, Großvater, Bürger oder Freund –, die mein Selbstbild bestimmen. Meine Lebensführung ist kein Prozess, an dessen Ende die Erfüllung steht, sondern eine Aktivität, die ich aufrechterhalten muss, weil mir manche Dinge etwas bedeuten. Selbst wenn ein Lebenssinn wegbricht, ist dieses Wegbrechen für mich von Bedeutung, weil ich nach Sinn strebe. Die Aktivität der Lebensführung – mein Streben nach Sinn – kann nicht einmal prinzipiell vollendet werden. Wäre mein Leben vollendet, wäre es nicht meines, weil es dann vorbei wäre. Indem ich mein Leben führe, strebe ich nicht nach einer unmöglichen Vollendung meiner selbst, sondern nach der möglichen und fragilen Kohärenz dessen, was ich sein will: Ich möchte die Bindungen und Verpflichtungen zusammenführen, die mein Selbstverständnis ausmachen. Ein erfülltes Leben bedeutet nicht, den Status der Vollendung zu erreichen, sondern sich für etwas zu engagieren und mich für Dinge einzusetzen, die mir wichtig sind.
Aus dem gleichen Grund gilt: Wenn ich an einen Punkt gelange, an dem ich genug vom Leben habe und den Tod willkommen heiße, bedeutet das nicht, dass mein Leben erfüllt ist und seinen letztgültigen Sinn offenbart. Im Gegenteil: Wenn ich «genug» von meinem Leben habe, heißt dies, dass es mir nicht mehr gelingt, ein sinnerfülltes Leben zu führen. Der Tod kann keine sinnvolle Vollendung meines Lebens sein, da mein Leben nicht vollendet «sein» kann. Mein Tod ist nichts, das ich als eine Form der Vollendung erleben kann, da er meine Existenz ausschließt. Solange ich mein Leben führe, bleibt das Buch des Lebens geöffnet, und es ist weder möglich noch erstrebenswert, «genug» von mir selbst zu haben.
Anders als Weber meint, gibt es keine Korrelation zwischen einer sinnvollen Lebensführung und dem Tod als deren angeblicher Vollendung. Solange unser Leben uns etwas bedeutet, streben wir nach dessen Fortführung – nicht nach dessen Vollendung.
Die Verpflichtung auf die Möglichkeit des Fortschritts – im Rahmen derer wir uns um Dinge bemühen, die über unsere eigene Lebenszeit hinausgehen und innerhalb dieser nicht «vollendet» werden können – macht unser Leben nicht bedeutungslos. Vielmehr gründet ein Teil der Bedeutung unseres Handelns darin, dass es für kommende Generationen entscheidend sein und deren Leben verbessern kann.[9]
Nehmen wir die Möglichkeit demokratischen Fortschritts ernst, sollten wir deshalb Webers konservativer Sehnsucht nach einer vormodernen, verzauberten Welt etwas entgegensetzen. Bruce Robbins argumentiert in seiner kenntnisreichen Weber-Analyse, «die Annahme, es habe ‹echte Gemeinschaft› gegeben, vergisst all jene, die von dieser Gemeinschaft ausgeschlossen waren – etwa die Sklaven und Frauen im alten Griechenland, um ein zufälliges Beispiel unter vielen zu nennen. Die Beurteilung der Echtheit einer Gemeinschaft war stets von der individuellen Erfahrung abhängig. Fragte man landlose Arbeiter im Mittelalter, wäre diese Gemeinschaft wohl nicht so eindeutig echt erschienen.»[10] Dass heutige Arbeiter mit ihrem Leben unzufriedener sind als die Landarbeiter der Vergangenheit, die Weber sich vorstellte, ist «eher eine Folge gestiegener Erwartungen als der Entzauberung – eine Folge demokratischen Fortschritts, der vor dem Hintergrund jahrhundertelanger Resignation der Armen hinsichtlich ihres unausweichlichen gesellschaftlichen Schicksals gesehen werden muss. Nein, damals gab es kein Elend. Und warum nicht? Weil die Menschen wussten, was ihnen zustand.»[11] Wir sind also zu einer ganz anderen Diagnose unserer schwierigen Situation in der Lage als Weber und seine Anhänger. Die Probleme des gegenwärtigen Zustands unserer Säkularisierung gründen nicht im Fortschrittsgedanken. Wie Robbins betont, ergeben sie sich vielmehr aus dem «Scheitern des Fortschritts» – genauer: aus unserem «Unvermögen, ein Niveau an sozialer Gerechtigkeit zu erreichen, das die vormoderne Welt nicht einmal anstrebte.»[12]
Der Schlüssel zu diesem Verständnis des Versprechens eines säkularen Lebens findet sich im Werk von Karl Marx. Marx’ Denken wird oft mit den totalitären kommunistischen Regimen des 20. Jahrhunderts gleichgesetzt, doch ich möchte zeigen, dass er der wichtigste Erbe der säkularen Bindung an Freiheit und Demokratie ist. Im Gegensatz zu Weber und anderen politischen Theologen sehnte sich Marx nicht nach einer vormodernen Welt. Vielmehr machte er deutlich, dass sowohl der Kapitalismus als auch der Liberalismus historische Möglichkeitsbedingungen der von ihm angestrebten Emanzipation sind. Genau hier setzte Marx’ Kritik des Kapitalismus und Liberalismus als Lebensformen an. Er wollte zeigen, dass beide sich selbst überwinden müssen, und zwar mittels der ihnen inhärenten säkularen Verpflichtung auf Freiheit und Demokratie.
Zu Marx’ Lebzeiten – und später inspiriert von seinen Schriften – verbreitete sich zunehmend die säkulare Anerkennung, dass wir sind, was wir tun, und dass wir anders handeln können. Wir müssen uns nicht den Gesetzen von Religion oder Kapital unterwerfen, sondern können unsere historische Situation durch kollektives Handeln verändern und Institutionen schaffen, deren Zweck die freie Entwicklung sozialer Individuen darstellt.
Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert – zur gleichen Zeit, als Weber den Verlust «echter Gemeinschaft» beklagte – gründeten Arbeiter demokratisch-sozialistische Organisationen, die einen Sinn für die eigene praktische Identität und für Solidarität hervorbrachten – sowie ethische und politische Ziele stifteten. Die Arbeiterbewegung organisierte Jugendgruppen, Chöre, Buchclubs, Sportvereine und andere gemeinschaftliche Aktivitäten. Sie verbreitete die Demokratie durch eigene Tageszeitungen und Zeitschriften, in denen offen über die Herausforderungen und Ziele der Bewegung debattiert wurde. Arbeiter jeder Provenienz bekamen die Möglichkeit zur Fortbildung; Frauen trafen sich, um die eigene Emanzipation voranzutreiben. Das gemeinsame Anliegen bestand in dem Bestreben, eine bessere Gesellschaft zu erschaffen. Ein deutscher Bergmann, 33 Jahre alt und Vater von acht Kindern, sprach für viele Arbeiter dieser Zeit, als er 1912 formulierte: «Die moderne Arbeiterbewegung bereichert mich und all meine Freunde durch das zunehmende Licht der Erkenntnis. Wir verstehen, dass wir nicht länger der Amboss sind, sondern der Hammer, der die Zukunft unserer Kinder formt, und dieses Gefühl ist mehr wert als Gold.»[13] Dieses Gefühl geistiger Freiheit – dass wir Subjekte unserer Geschichte und nicht nur der Geschichte unterworfen sind – bildet den Kern des marxschen Emanzipationsbegriffs.
Die wachsende internationale Solidarität der Arbeiterbewegungen wurde 1914 durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen. Beim Ausbruch der Russischen Revolution 1917 lagen die materiellen und gesellschaftlichen Bedingungen für die Erschaffung einer neuen Gesellschaft weitgehend in Trümmern. Die große politische Denkerin, Feministin und Aktivistin Rosa Luxemburg bezeichnete Russland damals als «isolierten, vom Weltkrieg erschöpften, vom internationalen Proletariat verratenen» Staat.[14] Unter diesen Umständen war es nahezu unmöglich, den mustergültigen demokratischen Sozialismus zu erreichen. Luxemburg zufolge könne man von den Revolutionären keine «Wunder» erwarten, sondern müsse ihre Leistungen «in den Grenzen der historischen Möglichkeiten» betrachten.[15] Doch bereits in den ersten Phasen der Russischen Revolution warnte Luxemburg zu Recht vor der Gefahr, aus der Not eine Tugend zu machen und die Verpflichtung zur Demokratie aus den Augen zu verlieren. Es wäre tödlich, würden die Revolutionäre «ihre von diesen fatalen Bedingungen aufgezwungene Taktik nunmehr theoretisch in allen Stücken fixieren und dem internationalen Proletariat als das Muster der sozialistischen Taktik zur Nachahmung empfehlen». Luxemburg empfand es als töricht, wenn das Proletariat «in seine Speicher als neue Erkenntnisse all die von Not und Zwang in Rußland eingegebenen Schiefheiten eintragen woll[te], die letzten Endes nur Ausstrahlungen des Bankrotts des internationalen Sozialismus in diesem Weltkriege waren».[16]
Mit Stalin und Mao war dieser Bankrott endgültig. Niemand, der sich heute mit Marx’ Ideen beschäftigt, sollte diese totalitären Regime rechtfertigen, die Marx’ Gedankengut weder in praktischer noch in theoretischer Hinsicht begriffen hatten. Um Marx’ Erkenntnisse in eine neue Richtung zu entwickeln, müssen wir uns stattdessen mit der fundamentalen Frage der Freiheit beschäftigen, die er untersucht.
Dies ist umso wichtiger, weil der Freiheitsbegriff in den vergangenen Jahrzehnten in die Agenda der politischen Rechten Eingang fand, wo er den «freien Markt» legitimieren soll und weitgehend auf formale, individuelle Freiheit reduziert wird. Als Reaktion darauf haben sich viele Denker der politischen Linken vom Freiheitsbegriff distanziert oder ihn sogar offen abgelehnt. Das ist ein fataler Fehler. Jede emanzipatorische Politik – genau wie jede Kritik des Kapitalismus – bedarf eines Freiheitsbegriffs. Nur vor dem Hintergrund einer Verpflichtung zur Freiheit können wir Unterdrückung, Ausbeutung oder Entfremdung als ebendies begreifbar machen. Und nur vor diesem Hintergrund können wir vermitteln, was wir erreichen wollen und warum es wichtig ist.
Marx’ Kritik am Kapitalismus wird deshalb nicht ohne seinen Freiheitsbegriff verständlich. Dazu wiederum müssen wir begreifen, weshalb Ökonomie und materielle Umstände untrennbar mit allen geistigen Aspekten der Freiheit verknüpft sind. Die wirtschaftliche Organisation unserer Gesellschaft ist kein bloßes instrumentelles Mittel zum Erreichen individueller Ziele. Unsere gemeinsame Wirtschaft drückt vielmehr aus, wie wir das Verhältnis von Mitteln und Zielen verstehen. Ökonomische Angelegenheiten sind nicht abstrakt, sondern betreffen die meisten allgemeinen und konkreten Aspekte unseres Lebens. Wie ich im Detail zeigen werde, beschreibt die Organisation unserer Wirtschaft einen intrinsischen Teil unseres Zusammenlebens und unserer gemeinsamen Werte.
Marx’ ökonomische Analysen entwickeln sich von seinem Früh- bis zu seinem Spätwerk im Ausgang von einem philosophischen Verständnis von Leben und Freiheit: einem Begriff dessen, was es heißt, lebendig und frei zu sein. Alle Lebewesen sind endlich – sowohl, weil sie nicht selbstgenügsam, als auch, weil sie sterblich sind. Ein Lebewesen kann nicht einfach existieren, sondern muss etwas tun, um am Leben zu bleiben. Das Bedürfnis eines Lebewesens, sich am Leben zu erhalten – die für die Lebenserhaltung nötige Arbeit –, ist die Minimaldefinition dessen, was Marx das «Reich der Notwendigkeit» nennt. Weil wir alle Lebewesen sind, müssen wir arbeiten, um uns am Leben zu erhalten. Es ist jedoch für unser biologisches Überleben nicht nötig, dass wir die gesamte uns zur Verfügung stehende Zeit mit Arbeit verbringen. So stellt sich die Frage, was wir mit der verbleibenden Zeit anfangen. Aus diesem Grund leben wir laut Marx auch im «Reich der Freiheit». Wir sind in der Lage, unsere Lebensaktivität als freie Aktivität zu gestalten, weil wir uns fragen können, was wir tun sollten und ob dies das Richtige sei.
Durch technische Innovationen (von einfachen Werkzeugen bis zu komplizierten Maschinen) können wir zudem die Zeit verringern, die wir damit verbringen müssen, unser Überleben sicherzustellen: Wir ersetzen große Teile unserer lebendigen Arbeit mit nicht-lebendigen Kapazitäten zur Herstellung gesellschaftlicher Güter. Damit können wir das Reich der Notwendigkeit verkleinern (die Zeit, die wir unserem Überleben widmen) und das Reich der Freiheit vergrößern (die Zeit, die wir mit Tätigkeiten verbringen, die wir um willen dieser Tätigkeiten selbst ausüben – darunter auch die Beschäftigung mit der Frage, was uns wichtig ist und welche Tätigkeiten wir als Zwecke in sich selbst begreifen sollten).
Der Vollzug unserer geistigen Freiheit hängt sowohl von materiellen Produktionsbedingungen als auch gesellschaftlicher Anerkennung ab. Sofern wir einer Arbeit nachgehen, die uns nicht erfüllt, sondern nur unser Überleben sichert, ist unsere Arbeitszeit unfrei, weil wir sie nicht als Ausdruck unserer selbst begreifen können. Wir können uns nicht frei mit der Frage beschäftigen, was unser Leben lebenswert macht – was wir mit unserer Zeit anfangen sollten –, sondern müssen für unser Überleben arbeiten. Für ein freies Leben genügt es nicht, das Recht auf Freiheit zu haben. Es bedarf des Zugangs zu materiellen Ressourcen und zu Formen der Bildung, damit wir unsere Freiheit leben und die Frage, wie wir unsere Zeit verbringen wollen, selbst entscheiden können. Unser wahres, unabänderliches Eigentum besteht nicht in Besitz oder Gütern, sondern in unserer Lebenszeit.
Die Akzentuierung meines – und deines – eigenen Lebens steht jedoch nicht im Gegensatz zur Gesellschaft. Marx betont: «[M]ein eignes Dasein ist gesellschaftliche Tätigkeit; darum das, was ich aus mir mache, ich aus mir für die Gesellschaft mache und mit dem Bewußtsein meiner als eines gesellschaftlichen Wesens.»[17] Als «Eigentümer» des eigenen Lebens bin ich also nicht unabhängig, sondern vielmehr in der Lage, meine eigene individuelle Abhängigkeit anzuerkennen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Liebe. Wer liebt – als Freund, Elternteil oder Lebenspartner –, empfindet die Abhängigkeit vom anderen nicht als Einschränkung, die Freiheit verhindert. Sie gehört vielmehr zum eigenen Leben. Handlungen für die geliebte Person sind keine entfremdeten Zwecke, sondern Ausdruck einer Verpflichtung, in der man sich selbst erkennt, weil die Fürsorge um die Interessen und das Wohlergehen des anderen zum eigenen Selbstverständnis gehört. Genauso verhält es sich mit der Arbeit: Erledigt man sie im Namen einer Sache, an die man um ihrer selbst willen glaubt – wie ich, wenn ich unterrichte oder dieses Buch schreibe –, dann sind selbst die schwierigen oder anspruchsvollen Aspekte dieser Arbeit keine äußeren Einschränkungen einer a priori bestehenden Freiheit. Im Gegenteil: Die Wünsche meiner Studierenden und die Schwierigkeiten beim Schreiben sind ein intrinsischer Teil der Lebensform, der ich mich verpflichtet habe. Selbst wenn mir die Arbeit schwerfällt, habe ich den Anspruch an mich selbst, die Herausforderungen zu meistern.
Wer sich im Zweck seiner Arbeit nicht erkennt, ist seiner Arbeitszeit selbst bei hoher Bezahlung und gesellschaftlicher Anerkennung entfremdet. Im Vergleich mit den Arbeitsbedingungen der meisten Menschen, die weltweit unsere Güter produzieren, mag dieses Problem klein erscheinen. Und natürlich besteht ein Unterschied zwischen jenen, die in Fabriken unsere Computer zusammenbauen oder in ausbeuterischen Betrieben unsere Kleidung nähen, und jenen, die einfach diese Computer einschalten und diese Kleidung anziehen – während sie die bei der Herstellung dieser Güter herrschenden Arbeitsbedingungen vergessen. Doch aus Marx’ Perspektive hängen alle diese Themen zusammen, weil sie mit der Organisation unseres gemeinsamen Wirtschaftslebens und dessen schädlichen Auswirkungen auf unsere Freiheit zu tun haben. Um frei zu leben und uns mit unserem Tun zu identifizieren, müssen wir uns sowohl im Zweck unserer Arbeit als auch in den gesellschaftlichen Bedingungen dieser Arbeit, die uns am Leben erhält, wiedererkennen; und wir müssen unsere eigene Verpflichtung zur Freiheit in den Institutionen wiedererkennen, von denen wir abhängig sind und an denen wir uns beteiligen. Diese Identifikation verlangt, dass alle von uns die Freiheit haben, sich an möglichen Veränderungen der Zwecke unseres Tuns zu beteiligen – an demokratischen Transformationen der gesellschaftlichen Institutionen der Arbeit – und die eigene angebliche Berufung infrage zu stellen, aufzugeben und sich anderen Tätigkeiten zu widmen.
Kurz gesagt: Unsere Freiheit verlangt, dass wir selbst entscheiden können, was wir mit unserer Zeit anfangen sollten. Für Marx bemisst sich politischer Fortschritt nach dem Grad, bis zu dem er diese Freiheit gewährt. Alle Marx-Lektüren, die eine finale Lösung als Ziel der Politik darstellen – in Form eines totalitären Staats oder eines utopischen Lebens, das die Endlichkeit überwindet –, verraten deshalb die wichtigsten Lehren seines Werks. Das Ziel besteht nicht in der Überwindung der Endlichkeit, sondern in der qualitativen Veränderung unserer Fähigkeit, ein freies Leben zu führen. Selbst im Idealzustand werden wir uns mit den Risiken der Endlichkeit auseinandersetzen müssen – mit der Gefahr, das, was wir lieben, zu verlieren, und das, was wir gerne tun, nicht mehr ausführen zu können. Denn diese Risiken sind der Freiheit selbst inhärent.
Zudem geht es keineswegs darum, das Reich der Notwendigkeit hinter uns zu lassen. Wie wir unser Leben im Reich der Freiheit führen, ist untrennbar mit unserer Lebensführung im Reich der Notwendigkeit verbunden. Als Lebewesen werden wir immer in irgendeiner Form arbeiten müssen, um uns am Leben zu erhalten. Arbeit per se ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil: Alle Formen freier Tätigkeit – wie etwa meine Beispiele des Unterrichtens und Schreibens – sind Formen von Arbeit. Ein emanzipiertes Leben ist nicht frei von Arbeit. Es ist ein Leben, in dem wir auf Basis unserer eigenen Überzeugungen arbeiten. Selbst unsere gesellschaftlich notwendige Arbeit kann Ausdruck unserer Freiheit sein, wenn sie im Namen des Gemeinwohls geteilt wird. Das Ziel besteht dann darin, das Reich der Notwendigkeit zu verkleinern und das der Freiheit zu vergrößern, indem die Beziehung zwischen beiden als demokratische Frage gefasst wird. Aus dem gleichen Grund kann das Verhältnis von Notwendigkeit und Freiheit nicht ein für alle Mal geregelt, sondern muss stets neu verhandelt werden. Marx bietet keine endgültigen politischen Lösungen. Vielmehr erklärt er ein lebenswichtiges Problem. Wir müssen sowohl individuell als auch kollektiv aushandeln, wie wir die endliche Zeit kultivieren wollen, die Bedingung unserer Freiheit ist.
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum die Entstehung des Kapitalismus für Marx eine Form des Fortschritts ist. Kapitalistische Lohnarbeit ist historisch betrachtet die erste gesellschaftliche Anerkennung der Tatsache, dass jedem Einzelnen seine Lebenszeit «gehört» und diese inhärent «wertvoll» ist. Anders als Sklaven, denen der Besitz ihrer zur Verfügung stehenden Zeit systematisch abgesprochen wird, sind wir «frei», unsere Arbeit an jemanden zu verkaufen, der bereit ist, dafür zu bezahlen. Arbeit wird zudem explizit als Mittel zum Zweck einer freien Lebensführung begriffen.
Dem Versprechen auf Freiheit qua Lohnarbeit widerspricht jedoch zwangsläufig die Art und Weise, wie wir den Wert unseres Lebens im Kapitalismus schätzen. Marx’ Kritik der kapitalistischen Wertbemessung ist das wichtigste Argument in seinem gesamten Werk – und zugleich jenes, das am häufigsten missverstanden wird. Im Gegensatz zu der weit verbreiteten Auffassung, die von vielen Anhängern im linken und vielen Kritikern im rechten Spektrum vertreten wird, unterschreibt Marx keine allgemeine «Arbeitstheorie» des Werts, der zufolge die Arbeit der notwendige Ursprung allen Wohlstands sei. Marx argumentiert vielmehr, dass die Produktion von Wohlstand im Kapitalismus zu einer historisch spezifischen Bemessung des Werts führt (der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit), die im Widerspruch zum Wert der freien Zeit steht und im Namen unserer Emanzipation überwunden werden muss.
Ich werde Marx’ Kritik am kapitalistischen Wertbegriff darlegen und zeigen, dass sie zu einer Neubewertung des Werts auffordert. Diese Neubewertung erfordert nicht nur eine theoretische, sondern auch eine praktische Veränderung unserer Lebensführung. Von der gesellschaftlichen Organisation unserer Arbeit über die technische Herstellung von Gütern bis hin zu unseren Bildungssystemen müssen wir eine Neubewertung durchführen, die unsere endliche Lebenszeit als Bedingung dafür begreift, dass etwas von Bedeutung ist oder Wert hat. Marx selbst äußert sich bekannterweise kaum dazu, wie unsere Lebensführung nach dem Kapitalismus aussehen könnte. Auf Basis dessen, was Marx Kommunismus nennt, werde ich eine neue Vision des demokratischen Sozialismus vorstellen, der sich darauf verpflichtet, die materiellen und geistigen Bedingungen zu schaffen, in denen wir alle frei leben können, und zwar in wechselseitiger Anerkennung unserer gegenseitigen Abhängigkeit. Durch eine interne Kritik des Kapitalismus und Liberalismus werde ich die Grundprinzipien des demokratischen Sozialismus herausarbeiten und ihre konkreten Implikationen spezifizieren. Mein Verständnis des demokratischen Sozialismus beschreibt weder eine Blaupause noch ein abstraktes Utopia. Vielmehr erwachsen die Prinzipien des demokratischen Sozialismus aus meiner Sicht aus unserem gemeinschaftlichen Engagement für Freiheit und Gleichheit.
Das politische Projekt eines demokratischen Sozialismus bedarf eines säkularen Glaubens. Der Glaube an die Möglichkeit, die Freiheit zu verwirklichen, bedeutet nicht, dass diese Freiheit als garantiert oder gesichert gilt. Der Glaube an die Möglichkeit der Freiheit beschreibt vielmehr den Glauben an etwas, das selbst in seiner vollständigen Verwirklichung stets prekär und umstritten bleibt.
Der Kampf um die Freiheit ist ein Akt säkularen Glaubens, weil er einer wesenhaft endlichen Form individuellen und kollektiven Lebens verpflichtet ist. Diese Verpflichtung auf ein freies, endliches Leben wohnt allen Formen des Widerstands gegen Ausbeutung und Entfremdung inne. Die einzige Fähigkeit, die ausgebeutet oder entfremdet – und befreit – werden kann, ist unsere Fähigkeit, die Frage nach dem Umgang mit unserer Zeit zu entscheiden. Denn diese Fähigkeit wird von allen Gestalten der Freiheit vorausgesetzt. Natürlich ist sie das Ergebnis einer Entwicklung und bedarf der kulturellen Formung. Doch ohne den Glauben an diese Fähigkeit ist die Vorstellung von Freiheit nicht verständlich. Um auf Ausbeutung und Entfremdung im Leben einer Person zu reagieren, muss man an die zerbrechliche Möglichkeit und den intrinsischen Wert ihrer Fähigkeit glauben, selbst über ihre Zeit zu bestimmen. Dieser säkulare Glaube treibt auch jeden an, der sich gegen die eigene Unterdrückung auflehnt. Um sich selbst als ausgebeutet oder entfremdet zu begreifen, muss man glauben, dass die eigene Lebenszeit endlich und wertvoll ist – und dass einem mit dieser Zeit zugleich das eigene Leben genommen wird.
Die Entwicklung des säkularen Glaubens ist deshalb im Rahmen einer fortschrittlichen Politik unabdingbar. Emanzipation setzt voraus, dass wir die materiellen und gesellschaftlichen Bedingungen der Freiheit als Selbstzweck verbessern wollen. Marx betont deshalb, dass Religionskritik stets von einer Kritik der jeweiligen gesellschaftlichen Lebensformen begleitet werden muss. Wer versklavt oder arm ist, braucht vielleicht einen Glauben an Gott, um weitermachen zu können. Das ist aber kein Grund, diesen Glauben zu propagieren, sondern vielmehr ein Grund, Sklaverei und Armut abzuschaffen.
Der Bedarf für eine derart kritisch-emanzipatorische Perspektive ist so hoch wie eh und je. Wir leben in einer Zeit, in der soziale Ungleichheit, Klimawandel und globale Ungerechtigkeit verflochten sind mit dem Wiederaufleben religiöser Formen von Autorität, die gerade die höchste Dringlichkeit dieser Herausforderungen abstreiten. Eine weitverbreitete Reaktion auf diese Gemengelage besteht im Rückzug vom säkularen Glauben an die Möglichkeit des Fortschritts zugunsten einer Vorstellung religiöser «Erfüllung», die unser moralisch-geistiges Leben aufrechterhalten soll. Dieses Buch richtet sich gegen solche Formen der politischen Theologie. Im Gegenteil: Mein Angebot besteht in einer säkularen Vision, der zufolge alles davon abhängt, was wir mit unserer gemeinsamen Zeit anfangen. Der Niedergang des religiösen Glaubens an die Ewigkeit ist nicht bedauernswert. Vielmehr bietet er die Möglichkeit, unseren säkularen Glauben an dieses eine Leben als Selbstzweck herauszustellen und zu stärken.
III
Das Buch besteht aus zwei Teilen, die sich den beiden im Untertitel genannten Begriffen widmen: dem (säkularen) Glauben und der (geistigen) Freiheit.
Der erste Teil beschäftigt sich mit den Unterschieden zwischen säkularem und religiösem Glauben. Als religiös bezeichne ich jede Form des Glaubens an ein ewiges Wesen oder eine Ewigkeit jenseits des Seins, entweder in Gestalt einer der Zeit enthobenen Ruhe (beispielsweise des Nirwana), eines transzendenten Gottes oder einer immanenten, göttlichen Natur. Ich möchte nicht den Gegenbeweis zum religiösen Glaubenssystem antreten, indem ich etwa beweise, dass es keine Ewigkeit gibt. Vielmehr hinterfrage ich die Vorstellung, die Ewigkeit sei erstrebenswert. Die Annahme, Ewigkeit sei wünschenswert, ist weitaus stärker verbreitet als die angebliche Gewissheit hinsichtlich ihrer Existenz. Theologische Gottesbeweise gelten vielen zeitgenössischen religiös Gläubigen als überholt, doch der Gedanke, die Ewigkeit sei etwas Anbetungswürdiges, ist für die Verteidigung religiösen Glaubens zwingend nötig. Es gibt keinen Grund, an die Ewigkeit zu glauben, wenn man nicht zugleich überzeugt ist, sie biete Trost, eine Alternative oder einen Ausweg angesichts des Verlusts all dessen, was wir lieben.
Im Gegensatz dazu möchte ich zeigen, dass ein ewiges Leben unser Bedürfnis, weiterzuleben, nicht erfüllen würde. Im Kern des säkularen Glaubens liegt das Engagement für das Weiterleben – nicht für das ewige Leben. Mein Verständnis säkularen Glaubens benötigt den Kontrast zum religiösen Glauben nicht, weil der säkulare Glaube jeder Form der Fürsorge inhärent ist. In unserer heutigen historischen Situation ist das Glaubensverständnis aber noch fest mit religiösen Denkweisen verknüpft. Um unser überkommenes Glaubensverständnis zu verändern, müssen wir uns direkt mit diesen Denkweisen auseinandersetzen. Deshalb erwachsen meine Argumente im ersten Teil des Buchs aus dem expliziten Dialog mit religiösen Denkern. Die Beschäftigung mit ihrer Arbeit bietet Gelegenheit, ein säkulares Glaubensverständnis zu entwickeln und es gegen die schwerwiegendsten Einwände zu verteidigen. Meinen Begriff des säkularen Glaubens entwickele ich deshalb anhand von Lektüren der Bibel, der buddhistischen Philosophie und religiöser Schriftsteller von den griechischen und römischen Stoikern über Augustinus, Martin Luther, Dante Alighieri, Meister Eckhart, Baruch Spinoza, Søren Kierkegaard, Paul Tillich und C. S. Lewis bis zu Charles Taylor. Gerade weil sie den säkularen Glauben überwinden wollen, haben diese Denker einen geschärften Blick für die Gefahren dieses Glaubens und beschreiben ausführlich dessen Dynamik.
Im 1. Kapitel zeige ich auf, inwiefern der säkulare Glaube die Voraussetzung dafür ist, Fürsorge allererst zu verstehen. Die Phänomenologie säkularen Glaubens veranschauliche ich anhand des schwierigsten und schrecklichsten Ereignisses: des Todes eines geliebten Menschen. Ich will zeigen, dass der säkulare Glaube den Kern dessen bildet, worauf es ankommt – selbst für jene, die behaupten, religiös gläubig zu sein –, wie etwa Martin Luther, der über den Tod seiner Tochter Magdalena trauert, oder C. S. Lewis, der den Verlust seiner Frau Joy Davidman beweint. Über verschiedene historische Epochen hinweg zeugen ihre Schilderungen der Trauer davon, dass ihr Glaube an Gott und die Ewigkeit unvereinbar ist mit dem säkularen Glauben, der ihre Bindung an die geliebte Person antreibt. Nur ein säkularer Glaube kann der Erfahrung von Liebe und Trauer gleichermaßen gerecht werden. Das fällt besonders auf, wenn wir unsere tiefsten Bindungen anerkennen und explizit machen, was unserer Leidenschaft und Trauer implizit ist.
Das 2. Kapitel arbeitet den Begriff des säkularen Glaubens weiter aus, indem es die Vorstellung von Zeit und Ewigkeit in den Bekenntnissen des Augustinus analysiert. Die Bekenntnisse sind nicht nur eines der einflussreichsten Narrative über religiöse Bekehrung, sondern gelten auch als erste Autobiographie der westlichen Tradition und als tiefgründige philosophische Abhandlung – vor allem hinsichtlich der darin enthaltenen Diskussion der Zeit. Augustinus zeigt, inwiefern der säkulare Glaube jeden Aspekt unseres Lebens beeinflusst. Ob wir glücklich sind oder trauern, Freude oder Schmerz empfinden – wir leben weiter nach einer Vergangenheit, die nicht mehr ist, und vor einer Zukunft, die vielleicht nie sein wird. Die Bedeutung aller von Augustinus beschriebenen Handlungen – Sprechen, Singen, Lieben, Hoffen und Erinnern – hängt von der zeitlichen Erfahrung des Weiterlebens ab. Umgekehrt bedeutet die ewige Präsenz, die Augustinus zum Ziel allen religiösen Strebens erklärt, das Ende dieser Handlungen. In der Ewigkeit kann es keine sinnvollen Tätigkeiten geben, weil in einer zeitlosen Gegenwart nichts weiterleben und in einer ewigen Existenz nichts von Bedeutung sein kann.
Augustinus’ Bekenntnisse liefern also Gründe, den Glauben an das zeitlich begrenzte Leben aufrechtzuerhalten und den Glauben an die Ewigkeit zu überwinden. Diese Perspektive bedürfte aber eines säkularen, nicht religiösen Texts. Als solchen lese ich Karl Ove Knausgårds Romanzyklus Min Kamp [im Deutschen erschienen unter den Titeln Sterben, Lieben, Spielen, Leben, Träumen und Kämpfen], der als zeitgenössische Antwort auf Augustinus aufgefasst werden kann. Wie Augustinus beschäftigt sich auch Knausgård mit der Fürsorge, die uns an andere bindet, und mit der Erfahrung der Zeit, die jeden Augenblick bestimmt. Während Augustinus auf die Ewigkeit hin orientiert ist, fokussiert Knausgård unser endliches Leben als Kern von allem, was zählt. Das bestimmende Prinzip seines Schreibens ist unsere Bindung an das endliche Leben. Dieses Prinzip ist umso tiefgründiger, weil es der Ambivalenz jeder Bindung Rechnung trägt. Wenn wir dem säkularen Leben verpflichtet sind, erwarten uns Glück und Zerstörung, Hoffnung und Verzweiflung, Erfolg und Scheitern. Knausgård zeigt, was es bedeutet, den Glauben an ein auf das Sterben zulaufendes Leben zu erhalten. Dieser säkulare Glaube erst eröffnet die Möglichkeit für jede Art von Leidenschaft und bedeutungsvollem Engagement.
Das 3. Kapitel untersucht eine Frage, die sich nach den ersten beiden Kapiteln stellt: Warum steht ein säkularer – ein dieser Welt und dem endlichen Leben verpflichteter – Glaube notwendigerweise