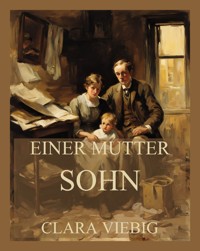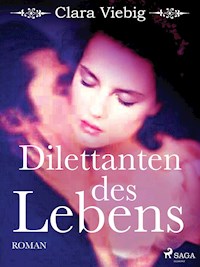
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Mir graut vor der Liebe, Fritz. Ich mag nicht mehr. Die Freude ist so kurz – und dann all die Tränen!" Lena hat bittere Erfahrungen gemacht und will nicht mehr heiraten. Doch ihr Bruder Fritz sorgt sich um sie – allein, ohne Mann, könne Lena den vor ihr liegenden Lebensweg nicht meistern. Aber kann sie es denn mit Mann? Als sie Bredenhofer heiratet, scheint sich das Schicksal zu wiederholen ... Viebig vertauscht im Laufe ihres Romans das ländliche Milieu des "kleines Nests im Bergischen", wie es ähnlich auch ihre ersten, früheren Romane und Erzählungen prägt, mit der glitzernden, beängstigenden verführerischen Großstadtwelt Berlins. Ein beeindruckender Roman über Stadt und Land, starke und schwache Frauen und verständnislose Männer.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clara Viebig
Dilettanten des Lebens
Roman
Saga
I.
„Ich bin nicht überflüssig hier, du kannst mich brauchen,“ sagte Lena langsam, „das beruhigt mich!“ Sie hob das bräunliche Gesicht und sah den Bruder sinnend an. „Was du für Falten auf der Stirn hast, Fritz!“ Sie fuhr leicht mit der Hand über seine Stirn. „Mein Bruder, sind es Sorgenfalten? Meinetwegen? Bist du nicht glücklich?“
„Glücklich?“ Er lächelte, aber es war ein etwas bitteres Lächeln. „Natürlich. Ich habe ja alles, was das Herz begehrt. Ich mache mir nur oft Sorge um dich. Noch haben wir unsere gute Mutter; aber wie lange?! Ich kann dich mir nicht allein in der Welt vorstellen, du bist nicht die Person dazu. Es wäre mir direkt unangenehm, dich in Pensionen und dergleichen zu wissen — hm.“ Er räusperte sich. „Sage doch nicht, Lena, dass du nicht mehr an heiraten denken willst; das ist Unsinn! Einmal gemachte bittere Erfahrungen mahnen nur zur Vorsicht, aber sie brauchen nicht für immer abzuschrecken!“
Sie schüttelte den Kopf: „Mir graut vor der Liebe, Fritz. Ich mag nicht mehr. Die Freude ist so kurz — und dann all die Tränen!“ Ihr Gesicht wurde bleich. „Hab’ ich den — den —“ sie stockte und zögerte den Namen auszusprechen, „den — ach, du weisst schon! — nicht geliebt? Schien er mich nicht zu lieben? Und doch war’s nichts, wieder nichts! Er hat sich mit der Reichen verlobt, jetzt heiraten sie bald.“ Sie legte den Kopf auf den Tisch und weinte. „Jetzt promeniert er mit ihr über die Linden, oder sie schlendern durch den Tiergarten. Es ist nicht darum, aber“ — sie schluchzte heftig auf —, „es ist die Enttäuschung; ich kann keine mehr ertragen. Pass auf, noch eine, und ich sterbe daran. Ich will dann auch sterben!“
„Lena, Lena, du bist kindisch heftig!“ Sein schon ergrauender Kopf schmiegte sich an ihren dunklen Scheitel. „Kleine Schwester, soll ich dich mal wieder trösten, wie ich dich so oft als Kind getröstet habe? Weisst du noch, wie du heultest, wenn du nachsitzen musstest oder einen Tadel bekommen hattest oder ein schlechtes Zeugnis?“
Sie schluchzte noch immer.
„Nur singen konntest du gut, da bekamst du immer Nummer eins. Weisst du noch, wie ich dich auf den Schoss nahm, wenn du untröstlich warst? Hier auf diesem linken Knie hast du oft gesessen, immer auf dem linken, deinen zerzausten Kopf stecktest du unter meinen Rock —“
„Ja,“ sie hob rasch das Gesicht vom Tisch, „ich konnte fühlen, wie dein Herz schlug — ja, und dann musstest du den Rock ganz über meinen Kopf ziehen; ich dachte, dann könnte mir gar nichts Schlimmes passieren!“
„Und dann steckte ich dir einen Groschen in die Hand und sagte: Lauf, hol’ dir Bonbons!“
„Ach,“ sie lachte auf, „die sogenannten Klümpchens! Von der alten Frau in dem kleinen Lädchen. Puh, war die schmutzig! Aber sie schmeckten; so gut hat mir nie mehr was geschmeckt. Die roten ass ich besonders gern.“
„Ja, und ich Unglücklicher“ — er lachte gutmütig — „bekam dann auch eins in den Mund gesteckt, eins, das du schon vorher tüchtig beleckt hattest; du trenntest dich so ungern davon. Ja, ja, so war’s, Lena!“
Sie lachten beide, und dann blickte das Mädchen um sich, wie aus einem Traum erwachend.
Sie sassen im Garten hinter dem Haus; über ihnen eine Esche. Die zum Schirm gezogenen schlanken Zweige hingen fast nieder auf das runde Tischchen. Die untergehende, schon blässliche Herbstsonne lugte schräg durchs Blätterwerk und zog helle Streifen über die Tischplatte. Sie gab auch dem braunen Lockengekräusel über der Mädchenstirn einen goldenen Schimmer.
„Lena!“ sagte der Bruder plötzlich und griff nach ihrer Hand. Er sagte nicht: ‚Wie hübsch du bist!‘, aber er dachte es.
Sie sah ihn zärtlich an, und dann schweiften ihre Augen über den Garten, über die Mauer nach den Bergen, die sich dort, gebadet in Glanz, erhoben. Rosige Abendwolken standen hinter ihnen. Man hatte eine schöne Aussicht von der kleinen Erhöhung an der Gartenmauer. Die blaue Mosel sah man nicht, die lag zu tief, aber jenseits die Berge mit ihren roten Felswänden, ihrem dunklen Grün und den angeklexten weissen Häuschen.
„Komm hin!“ sagte Lena.
Sie standen beide auf; Hand in Hand gingen sie über den berasten Weg, die paar Stufen hinan. Nun lehnten sie an der bröckligen Mauer und starrten schweigend in den farbenglühenden Himmel. Sie liessen sich nicht los, sie standen noch immer Hand in Hand. Ein Lüftchen kam und wehte dem Manne die seidenen Mädchenhaare ums Gesicht. Er zog die Schwester noch enger an sich. Jetzt sah man’s erst, wie sie sich glichen; dieselben Augen, dieselben Nasen, auch den gleichen vollippigen Mund mit tiefen, eigensinnigen Winkeln. Selbst die Gestalten waren von einer Grösse, der Mann kaum einen Fingerbreit höher als das schlanke Mädchen.
„Wie schön die Berge sind und der Himmel — ah, das tut gut!“ Der Luftzug war stärker geworden. Mit einem Seufzer lehnte Lena den Kopf an die Schulter des Bruders. „Wenn ich hier so mit dir siehe, begreife ich nicht, dass ich wieder fort muss, wieder fort will — nein, ich hielt’s doch nicht aus in der kleinen Stadt, immer mit denselben Menschen und immer das gleiche Gerede! Freilich, wenn der Sommer kommt und man in der grossen Stadt so eingesperrt ist, dann mag ich da auch nicht sein. Dann begreife ich nicht, wie man in Berlin leben kann,“ setzte sie kleinlaut hinzu. „Fritz, warum ich nur immer so unruhig in mir bin? Da ist immer ein Sehnen und wieder ein Sehnen, ein Auf und Nieder — hätt’ ich doch endlich Ruh’! Verstehst du mich?“
Er sah besorgt auf sie, dann zog es wie Ärger über sein Gesicht. „Du bist aus den sentimentalen Backfischjahren mit ihren eingebildeten Empfindungen längst heraus, Lena. Nimm dich ein bisschen zusammen, dann vergehen die Duseleien. Ich habe dich wahrhaftig lieb, aber schon als du noch Kind warst, mochte ich das an dir nicht leiden; du schwankst umher, du irrst von einem zum anderen. Man spricht von ‚Künstlernaturen‘ — ich wünsche dir gewiss, dass du eine Künstlerin wirst, aber die betreffende Natur wünschte ich dir nicht dazu.“
„Ich mir auch nicht,“ sagte sie leise.
„Meiner Ansicht nach kann ein wahrer Künstler auch gar nicht solche Natur gebrauchen. Da gibt’s kein Schwanken, kein Auf und Nieder von Stimmungen; unentwegt auf ein Ziel los, nur so kann er etwas erreichen.“
„Mei—nst du?“ Sie zog das ‚Meinst du‘ ganz lang und schüttelte den Kopf. „Du verstehst mich nicht.“ Ihre Stimme klang traurig. „Du weisst nicht, wie das hier drinnen zugeht —“ sie klopfte sich mit der geballten Hand auf die Brust —, „man möchte, und man kann nicht. Man fühlt, dass man auffliegen könnte, und doch kriegt man immer wieder einen Schlag auf den Kopf. Man tappt überall herum und sucht Hilfe.“
„Und verliebt sich darum so leicht,“ warf er halb neckend, halb vorwurfsvoll ein. „Lena, Lena, wie froh würden die Mutter und ich sein, dich in einem ruhigen Geleise zu sehen. Mir wär’s ja am liebsten, dich einmal später für immer bei mir im Haus zu haben, aber —“
„Nein, nein, nein!“ Ein Schauder ging ihr über den Leib, und dann, als fürchtete sie, ihn beleidigt zu haben, schnellte sie von seiner Schulter auf und warf ihm beide Arme um den Hals. „Mein lieber Bruder!“
„Ich weiss,“ murmelte er, „du und Amalie, ihr seid zu verschiedene Naturen, ihr versteht euch nicht.“
„Sei nicht böse! Mein Bruder!“ Sie hielt ihm den Mund entgegen.
„Meine Schwester!“ Er küsste sie auf die Lippen, und dann flüsterte er, kaum seinen Mund von dem ihren hebend: „Weisst du noch, Lena, ich sagte immer zu dir ‚mein Biederweibchen‘? Du warst noch so klein, du konntest nur mühselig Schritt halten, aber du liefst tapfer neben mir her!“
„Ja, ich liess deine Hand nicht los, ich war so stolz, wenn du statt mit deinen grossen Herren und Damen mit mir gingst. Weisst du noch, unsere Spaziergänge an meinen schulfreien Nachmittagen? Wir suchten Blumen und Beeren, du machtest mir einen Kranz und küsstest mich. Du sagtest: mein Biederweibchen. Da war ich so selig, dass ich ordentlich fühlte, wie mir das Herz gegen die Rippen schlug.“ Lena war rot geworden, die Tränen schossen ihr in die Augen. „Sag’s noch einmal: ‚mein Biederweibchen‘! Bitte!“
Er lächelte, aber es klang gerührt: „Mein Biederweibchen!“
Die Geschwister standen wie ein Liebespaar. Ihre Gestalten waren jetzt ganz von Sonnengold umflossen; die warmen Lichter glitten an dem hellen Kleid des Mädchens auf und nieder. Beide nah zueinander geneigten Gesichter hatten denselben rötlichen Schimmer; plötzlich vertiefte sich dieser, sie fuhren auseinander.
Vom Haus her klang eine Frauenstimme: „Fritz, Fritz!“
„Amalie ruft,“ sagte der Mann und liess den Arm sinken, der die Taille der Schwester umschlungen hatte. „Ja, wir kommen schon, Amalie!“
„Dachte ich’s doch! Ihr seid hier? Ich will das zärtliche tête-à-tête nicht stören!“
Die grosse Frau, die mit langen Schritten über den berasten Gartenweg daherkam, hob kaum die Zähne voneinander, jedes Wort schien ihr zu viel. Ihre Stimme war merkwürdig klanglos. Sie beachtete die Schwägerin gar nicht und wandte sich nur an ihren Mann. „Es ist eben eine Einladung von Weiherhofs gekommen für morgen; grosse Partie auf den Kockelsberg. Ich habe zwar nachmittags erst Visitation der Kleinkinderschule, dann muss ich einen Augenblick zu den Diakonissen; aber dann komme ich sofort nach Haus, ziehe mich um, du gehst dann einfach mit mir nach. Wir werden uns eventuell einen Wagen nehmen; gar kein Gegenstand.“
„Und Lena? Soll sie mit den anderen gehen oder auf uns warten?“ fragte der Mann.
„Lena —?“ Die grosse Frau öffnete die kalten klarblauen Augen weiter. „Lena ist gar nicht mit eingeladen!“
„So — dann verzichte ich.“
„Was — du willst deswegen nicht annehmen?“ Das blasse Gesicht der Frau wurde dunkelrot, man sah, wie ihr das Blut zu Kopf schoss. „Einfach lächerlich! Lena wollte ja keine Besuche machen,“ setzte sie mürrisch hinzu.
„Ich? Du hast mich gar nicht dazu aufgefordert!“ Des Mädchens Augen funkelten. „Übrigens“ — ihr Blick streifte rasch das verfinsterte Gesicht des Bruders —, „ich mache mir nichts aus Einladungen, ich bleibe lieber zu Haus.“
„Das dachte ich mir auch,“ sagte die Schwägerin rasch. „Lena macht sich nichts aus unseren kleinstädtischen Vergnügungen, und dann“ — sie hob die schmale Lippe spöttisch —, „in unseren Kreisen findet sie wenig Nahrung für ihre extravaganten Ideen. Bei ihrer sogenannten Künstlergesellschaft in Berlin mag sie besser am Platz sein; ich muss gestehen, ich käme um in solcher Luft. Komm, Fritz,“ sie nahm seinen Arm, „das Abendessen ist fertig. Die Kinder warten noch auf dich mit dem Beten!“ Sie zwang ihn, seinen Schritt ihrem eigenen, weit ausholenden anzupassen.
Ihr seidenes Kleid raschelte. Frau Amalie Langen trug meist seidene Kleider, auch im Hause. Prall spannte sich der schmiegsame Stoff über ihre volle Büste, ihr stattlicher Körper bot eine vorteilhafte Auslage; ihr Vater, der reiche Seidenfabrikant im Wuppertal, wusste das, er schickte der Tochter immer die neuesten Muster.
Langsam schlenderte Lena hinter dem Ehepaar drein. Da war das Beet mit den Georginen, ringsum von abgezirkeltem Buchsbaum eingefasst. Sie waren der einzige Blumenschmuck im Garten. Frau Langen war nicht für Überflüssiges, nur diese steifen, farbenstrotzenden Dinger liebte sie; jetzt blühten sie in voller Pracht.
Nachdenklich blieb Lena am Beet stehen und hob eine der dickköpfigen Blüten an ihre Nase — kein Duft, kein Honiggeruch, wie ihn selbst die wilde Feldblume entwickelt; kalt berührten die glatten Blätter ihr Gesicht. Warum sie dabei nur immer an ihre Schwägerin denken musste? Ein Seufzer hob ihre Brust: „Mein armer Bruder!“
„Lena, wo bleibst du?“ Mit eiligen Schritten kam Langen zurück, die Stufen der Veranda herunter; er fasste nach der Hand der Schwester. „Bist du böse, Lena? Beleidigt?“ Er seufzte. „Du musst das nicht so auffassen, Amalie hat eben eine, eine“ — er stockte und suchte nach dem Ausdruck — „eine etwas andere Art. Aber sie ist ein vortrefflicher Charakter. Man muss sie nur zu nehmen wissen.“
„Und verstehst du das?“ Lena hob die Augen; sie leuchteten klug aus dem bräunlichen Gesicht.
Langen biss sich auf die Lippen. „Sie liebt mich,“ sagte er ausweichend.
„Wer sollte dich nicht lieb haben?“ Sie lächelte ihn zärtlich an. „Du guter Mensch!“ Sie rieb die weiche Wange an seiner Schulter, immer auf und nieder, wie ein junges Fohlen sich an der Mutter reibt.
„Komm, wir wollen Amalie nicht warten lassen, sie liebt das nicht.“
Die Geschwister gingen miteinander ins Haus. In der Veranda war der Tisch gedeckt; im verdunkelten Zimmer dahinter hoben sich schwere geschnitzte Möbel undeutlich von den Wänden, alles solide, wie für die Ewigkeit gemacht. Jedes Stück kostete eine Summe, das sah man auf den ersten Blick. Auf dem Boden kein Teppich, der brachte nur Staub; ungehindert glitt man über spiegelblankes Parkett. Frau Amalie Langen war berühmt wegen ihres Parketts und ihrer Einrichtung; sie hielt auch etwas darauf.
Es war eigentlich gar keine Einrichtung für einen Beamten mit bescheidenem Gehalt; Landgerichtsrat Langen hätte sich aus eignen Mitteln das auch nicht leisten können. Beamtensohn ohne Vermögen — da gibt’s nur ein Achselzucken.
Die Welt fand, er hatte sehr klug getan, dass er als Amtsrichter in dem kleinen Nest im Bergischen zu den Gesellschaften und Juristenbällen nach Elberfeld hinüberfuhr. Die schöne Amalie Barminghaus hatte sich unrettbar in ihn verliebt, soweit das bei ihr überhaupt möglich war. Jedenfalls vertieften sich ihre hellen, kühlen Augen, wenn er in den Saal trat; ihre Blicke spähten umher, verfolgten ihn von Dame zu Dame, bis er endlich vor ihr stand. Ihre grosse, weisse Hand umspannte dann den kostbaren Fächer fester, ihr makelloser, blendender Hals hob und senkte sich unter lebhafteren Atemzügen.
Papa Barminghaus war nicht für Bälle, seine Tochter bis dato auch nicht. Jetzt fand Fräulein Amalie auf einmal Geschmack daran.
‚Wenn sie nur das Haar nicht so glatt aus dem Gesicht gestrichen hätte! Wie ein Dienstmädchen,‘ dachte Amtsrichter Langen, und beim Kotillon sagte er ihr, wie reizend er ungezwungene lockige Frisuren fände. „Sie sollten meine kleine Schwester sehen, Fräulein Barminghaus, sie ist noch ein Schulmädel, fünfzehn Jahr jünger als ich: es gibt nichts Entzückenderes als diesen braunen Struwelkopf!“
Sie verzog die Lippen, ohne zu antworten; aber als er am nächsten Sonntag zum Diner die Villa ihres Vaters betrat, kam sie ihm entgegen, das blonde Haar in Locken gebauscht und tief in die zu hohe Stirn frisiert. Da sah er erst, dass sie schön war.
Es war furchtbar viel Verwandtschaft da; die Frauen seidenrauschend, die Männer mit dicken Uhrketten, brillantberingt und schwerste Zigarren rauchend. Das Gespräch drehte sich um Seide und Samt und Eisenindustrie. Bekannte Firmennamen schwirrten, man spielte Fangball mit Riesensummen; der Mammon sass oben am Tisch und nickte langsam mit dem Kopf.
Der junge Amtsrichter war etwas verblüfft, die Grossartigkeit der geschäftlichen Transaktionen imponierte ihm; Tausende waren gar nichts und andere Weltgegenden nur so ‚nebenan‘. Noch mehr aber langweilte er sich. Innerlich gähnte er, er blickte seine Nachbarin, die Tochter des Hauses, von der Seite an; hatte sie’s auch nicht gemerkt? Gottlob, ihre Nasenflügel zitterten, sie verbarg auch heimlich ein Gähnen.
Nach dem Kaffee promenierte man durch den Garten. Es war nahendes Frühjahr, die Wupper ging hochgeschwellt, ihr Wasser tintenschwarz gefärbt von den Abflüssen der Fabrik. An anderen Villengärten mochten die Wellen grün, rot, blau vorüberfliessen ... hier die eine tote Trauerfarbe; Papa Barminghaus fabrizierte vorzugsweise schwarze Seide.
Die scheue Märzsonne vergoldete das mattblonde Haar der jungen Dame; ausserordentlich vorteilhaft hob sich ihr regelmässiges Gesicht mit dem reinen Teint von dem dunklen Pelzwerk ab. Der grosse Sealkragen verdeckte das gestreifte schwarzweisse Seidenkleid mit dem Besatz von echten Points; die ganze massive Gestalt bekam etwas Weiches, Schmiegsames. Selbst ihre Stimme klang weicher denn sonst, als sie nun sagte:
„Die Fastenzeit ist vor der Tür, wir besuchen jetzt selbstverständlich keine Gesellschaften mehr, Herr Amtsrichter — es tut mir leid!“
Er hätte fragen sollen: ‚Warum tut’s Ihnen leid?‘ Aber er traute sich nicht, er wusste, sie würde sagen: ‚Weil wir uns dann nicht mehr treffen‘ — oder war sie zu wohlerzogen, um so etwas zu verraten?
Als sie Seite an Seite über die sauber geharkten, kiesbestreuten Wege schritten, an deren Rändern unterm Buchsbaum sich noch schmale Schneestreifchen versteckten, fröstelte es ihn; und doch leckte die Sonne alles blank und rein. Die Strahlen waren scharf, aber sie wärmten noch nicht.
Nach einer Pause, in der nichts zu hören war, als das Rauschen des schweren Seidenstoffs, sagte er: „Ich werde mir erlauben, mich zuweilen persönlich nach Ihrem Befinden zu erkundigen, Fräulein Barminghaus!“
Sie wurde über und über rot; es war ein Vergnügen, unter ihrer klaren Haut das Pulsen des Blutes zu beobachten. An der Tür des Gartensaales küsste er ihr die Hand, dies Rotwerden schmeichelte ihm. Sie war doch ein schönes, stolzes Mädchen — und dazu dieser Reichtum!
Nicht, dass Amtsrichter Langen auf Geld Jagd gemacht hätte, das lag ihm fern; aber es war schön, sich zu sagen: ‚Du kannst dann gleich für deine Mutter sorgen, die, schon so lange Witwe, doppelt auf ihren einzigen Sohn angewiesen ist.‘ Und Lena —?! Vor ihn, auf die Schwelle des Gartensaals, trat plötzlich das kindliche, bräunliche Mädchen, schüttelte die zerzausten Locken und sah ihn aus runden, glänzenden Kinderaugen bittend an. Sie war so musikalisch, sie wollte gern Musik studieren; er war ihr Vater und Bruder zugleich — musste er nicht etwas für sie tun?
Und hier an der Wupper lag er förmlich in der Luft, dieser Wunsch nach gutem Auskommen und gesicherter Position; es roch nach Geld.
Er gab sich einen Ruck: „Fräulein Barminghaus, ich hoffe, es ist Ihnen nicht unangenehm, wenn ich komme?“
Sie lächelte nur, blickte rasch auf und schlug ebenso rasch die Lider nieder.
Dann waren sie in den Saal getreten zu der seidenrauschenden, brillantberingten Verwandtschaft; die Atmosphäre satten Wohlbehagens und absoluter Wohlanständigkeit nahm sie auf.
Im Sommer hatten sie sich verlobt. — — — —
„Fritz, fall’ nicht,“ sagte Lena und fasste nach der Hand des Bruders; er war im Halbdunkel gegen eine prachtvolle metallbeschlagene Truhe gerannt. „O, hast du dir weh getan? Du warst wohl in Gedanken?“
„Fritz, kommst du endlich?“ tönte Frau Amalies Stimme ziemlich scharf aus dem Nebenzimmer.
Die Geschwister traten ein; es war das Schlafzimmer der Kinder, mit einer ungeheueren Sauberkeit und Akkuratesse eingerichtet. Die Spielsachen regelrecht auf dem Tischchen in der Ecke aufgeschichtet; kein Höschen, kein Röckchen, kein Strümpfchen umhergestreut, alles glattgestrichen und zusammengelegt. Blütenweiss die beiden Betten, und in den Kissen die zwei Kinder in ihren langen weissen Nachtkitteln kniend, die Hände wie anbetende Engel gefaltet.
Zwischen den Betten kniete Amalie; sie wandte nur einen Augenblick den Kopf, als die Geschwister leise hereinkamen. Sie betete vor, viel zu hohe, unverständliche Worte. Aber die Kinder falteten die Hände wie die Mutter, sie bewegten die Lippen wie die Mutter; der Junge war ganz bei der Sache, das kleine Mädchen jedoch drehte blitzschnell den Kopf, als die Tür knarrte: „Papa, Papa!“
„Lora, bete,“ klang die strenge Stimme der Mutter.
Sie beteten weiter, nun waren sie am Schluss.
„So — nun seid ihr gute Kinder! Gute Nacht!“
Ein leichter Kuss auf die beiden reinen Stirnen, dann wandte sich Frau Langen zu ihrem Mann: „Du hättest wohl auch eher —“
Der helle Kinderjubel schnitt ihr das Wort ab: „Papa, Papa!“ Der Junge machte Miene, aus dem Bett zu springen, Lora richtete sich kerzengerade in den Kissen auf. Jetzt glitt ein seliges Lächeln über ihr süsses Gesicht, sie hatte Lena erblickt, die im Halbdunkel an der Tür lehnte. „Tante Lena,“ jauchzte sie und streckte die Arme aus.
„Ruhe,“ gebot die Mutter; ihre grosse Gestalt schob sich wie eine Wand vor die Betten. „Fritz, ich wünsche nicht, dass die Kinder abends nach ihrem Gebet noch abgelenkt werden. Du hättest eher kommen sollen. Gut’ Nacht. Seid still!“
Ohne Wort verliess Langen hinter seiner Frau die Stube. Zögernd sah sich Lena an der Tür noch einmal um; Walter hatte den Kopf ins Kissen gedrückt, aber Lora sass aufrecht.
Der Laden vorm Fenster war angelehnt, durch den Spalt fiel ein matter Schimmer scheidenden Tageslichts mitten auf das schöne Kindergesicht. Die Augen waren gross, mit einem merkwürdig sehnsüchtigen Ausdruck emporgerichtet.
Es durchschauerte Lena eigentümlich; sie lief rasch auf das Bett zu und schlang, niederkniend, die Arme um den zarten Körper. Ihr Kopf ruhte an der warmen kleinen Brust, sie flüsterte: „Hast du Tante Lena lieb, Lora? Und den Papa auch? Sehr lieb, ja?“
Das Kind nickte mehrmals hintereinander, dann lehnte es sich zurück in die Kissen und sagte schläfrig: „Tante Lena, singen!
Zwei Englein, die mich wecken,
zwei Englein —“
Lena schüttelte verneinend den Kopf: „Nicht das Lied, Lora!“ Ihr wurde bange vor den grossen, sehnsüchtigen Kinderaugen. „Ich will dir etwas singen vom ‚Marienkäfer‘ oder vom ‚Sandmann‘, von dem ‚schwarzen und dem weissen Schaf‘.“
„Nein!“ Lora stiess mit den Beinen die Decke tiefer herunter. „Zwei Englein! Zwei Englein!“
Lena sang:
„Zwei Englein, die mich wecken,
zwei Englein, die mich decken,
zwei Englein, die mich weisen,
zum himmlischen Paradeise!“
Weich klangen die halblauten Töne durch das stille Zimmer.
Da — auf der Veranda heftiges Stuhlrücken, man hörte es bis hierher. Lena sprang hastig auf — jetzt drang auch die Stimme der Schwägerin durch; sie klang erregt! Nun gedämpfte Worte des Mannes — und nun die Frauenstimme noch einmal, noch erregter!
Lena huschte zur Schlafzimmertür hinaus, nebenan im Dunkeln stiess sie auf den Bruder.
„Komm,“ flüsterte er, „Amalie wartet nicht gern!“
Sie traten in die Veranda. Am gedeckten Tisch, obenan, sass Frau Langen, den Rücken nach dem Garten gekehrt. Die Gasampel brannte schon, ihr grelles Licht kämpfte mit der weichen Dämmerung draussen. Das Silber blinkte auf dem steif gestärkten Tischtuch, die Schüsseln dampften.
„Barben mit frischer Butter und Petersilienkartoffeln. Iss, Fritz!“ Amalie reichte ihrem Mann die Schüsseln. Lena, die ihr gegenübersass, schien sie nicht zu bemerken; als sei da leere Luft, so blickte Frau Langen über sie weg.
„Hier, Lena, nimm du auch,“ sagte Langen und hielt der Schwester die Schüssel.
Schweigend langte Lena zu; sie hätte lieber nichts gegessen, die Art und Weise der Schwägerin schnürte ihr die Kehle zu.
Draussen hatte sich der Nachtwind aufgemacht und wisperte in den Bäumen; eine der Glasscheiben war geöffnet, ein wunderbar erquickender Duft nach Grün und nächtlicher Frische kam herein. Ein Falter, vom Lampenlicht gelockt, taumelte über den Tisch und verfing sich in Amalies blondem Haar.
„Ä, das garstige Tier!“ Sie riss ihn herab und trat ihn auf dem Boden tot. „Pfui, was gibt das für einen ekligen Fleck — Fritz, mach das Fenster zu, es zieht unerträglich!“
In dem geschlossenen Glaskasten entwickelte sich eine drückende Luft, das Gas summte und strahlte erhitzend nieder. Das Dienstmädchen kam und brachte eine dampfende Mehlspeise.
„So iss doch, Fritz! Ich denke, dein Lieblingsgericht — was, du willst nicht? So.“ Frau Amalie kniff die Lippen zusammen und sass mit hochrotem Gesicht da.
„Ich danke,“ sagte Langen ruhig, „ich habe keinen Appetit mehr; aber willst du nicht Lena davon anbieten?“
„Da!“ Die Frau schob, ohne hinzusehen, die Schüssel über den Tisch. Lena rührte sich nicht, sie streckte die Hand nicht aus.
Jetzt eine Pause. Draussen geht der Nachtwind lauter, die Zweige des Nussbaumes, dicht am Haus, werden niedergebeugt und wischen über das Verandadach. Ein Vogel stösst an die geschlossenen Scheiben und jetzt —
Amalie sprang plötzlich auf, so heftig, dass der Stuhl hinter ihr zu Boden polterte; mit einem Krachen brach ein Stück der geschnitzten Lehne ab.
„Ich verbitte mir solches Benehmen in meinem Haus! Wenn ich jemandem etwas anbiete, hat er zu nehmen; wenn ich etwas nicht wünsche, hat er sich danach zu richten. Hört ihr’s? Ich will das, ich will das!“ Sie stampfte mit dem Fuss.
Langen war totenbleich geworden. Er fasste den Arm seiner Frau: „Amalie, ich bitte dich, was hast du?“
„Geh nur, du!“ Sie schüttelte zornig seine Hand ab. „Meinetwegen ..., meinetwegen kannst du mit ihr schön tun, wie du willst! Schade, dass sie deine Schwester ist, dass du sie nicht heiraten kannst! Ich kann ja gehen, ich bin doch überflüssig! Deine Liebe wird mir gestohlen, die Liebe meiner Kinder — mein Gott, mein Gott!“ In konvulsivisches Schluchzen ausbrechend, die Hände hoch erhoben, stürzte sie davon; man hörte sie polternd im anstossenden dunklen Raum, dann klappte die Tür zum Schlafzimmer der Kinder. Es war still.
Lena bebte am ganzen Leib; sie wagte nicht aufzusehen. Ihr Herz pochte rasend, sie fühlte seine Schläge bis hinauf in den Hals; sie wollte sprechen und konnte nicht. Ihre zitternden Atemzüge wehten über den Tisch, andere zitternde Atemzüge antworteten. Draussen rauschte es — sonst nichts.
Und jetzt, Geklapper! Lena schaute auf. Da sass er, hatte Teller und Besteck weit von sich geschoben, die Arme auf den Tisch gestemmt und das Gesicht in den Händen vergraben. Die Tränen kamen ihr, das Entsetzen wich, und grosses Mitleid trat an die Stelle. Sie wagte nichts zu sagen, aber sie stand leise auf, kauerte neben dem Bruder nieder und schmiegte den Kopf an seine Schulter.
Minuten vergingen, eine Viertelstunde, sie rührten sich nicht: nur enger umschlangen ihn ihre Arme, sie fühlte sein Herz schlagen — da, ein greller Ton der elektrischen Klingel! Lang, anhaltend wie ein vibrierender Hilferuf gellte er durchs Haus. Sie fuhren auf und horchten — das kam aus dem Zimmer der Kinder! Jetzt hastiges Laufen, ein unterdrückter Schrei.
„Lass mich — Amalie!“ Langen sprang auf und stürzte fort.
Lena blieb allein zurück, verwirrt sah sie um sich. Da waren der umgestürzte Stuhl, das verschobene Tischtuch, die halbgeleerten Schüsseln; da der Teller und die Gabel darauf, wie Amalie sie hatte aus der Hand fallen lassen! Und über dem allen das grelle Gaslicht, grausam klar die Disharmonie bescheinend.
Horch, draussen der Wind in den Bäumen! Es wisperte, es klopfte an die Scheiben. Und so allein! Lena fühlte, wie es ihr über den Rücken lief in der beklommenen Stille. Kam denn niemand? Nein, kein Mensch; sie war vergessen! Wo blieben sie, was ging vor?
Zögernd, Schritt vor Schritt setzend, tappte sie nebenan durch die Stube; nun stand sie vor der Schlafzimmertür, die Hand auf der Klinke. Sollte sie eintreten? Unschlüssig stand sie. Da — drinnen Schluchzen, krampfhaftes, wildes Schluchzen, nun Stöhnen! Um Gottes willen, was war das?!
Lena trat ein. Auf dem Boden lag Amalie; ihr Kopf mit den festgeschlossenen Augen ruhte im Schoss des Dienstmädchens, das neugierig und erschrocken zugleich dreinsah. Sie schien Krämpfe zu haben, sie zuckte an allen Gliedern; bald wurde sie hoch emporgeschleudert, bald wieder das grässliche, unerträgliche Stöhnen.
Ihr Mann kniete neben ihr, rieb ihre Hände und beugte sein sorgenvolles, bleiches Gesicht tief auf das ihre: „Amalie, liebe Frau, um Gottes willen, beruhige dich! Amalie, Amalie!“
Sie öffnete die Augen nicht, sie gab kein Zeichen des Erkennens.
In den Betten knieten die Kinder, jäh aus dem Schlaf geschreckt; mit weit aufgerissenen Augen starrten sie drein, Loras Gesichtchen trug den Ausdruck angstvollsten Entsetzens. „Mama, Mama!“
„Amalie, Amalie!“
Die geschlossenen Lider der Frau pressten sich noch fester zusammen; kein Hören, kein Sehen.
„Mama, Mama!“ Die Kinder weinten laut, Lora war ganz ausser sich.
Lena umfasste das Kind und drückte dessen zitternden Körper fest an sich: „Lora, mein Liebling, mein Goldkind, ich bin ja bei dir, ich“ — Sie kam nicht weiter.
„Fort! Sie soll fort!“ Die am Boden Liegende war plötzlich aufgesprungen. Jetzt stand sie schon am Bett — jetzt schob sie Lena zur Seite. „Mein Kind, mein Kind, — niemand soll es mir stehlen!“ Frau Langen fiel über das Bett und weinte herzbrechend.
Die Magd hatte in natürlichem Schicklichkeitsgefühl das Zimmer verlassen.
Langen versuchte seine Frau aufzurichten; sie klammerte sich an den Kissen fest und überströmte das Kind mit ihren Tränen.
„Amalie,“ sagte er, „Amalie!“ Und nun in weichem Ton: „Geliebte Amalie!“ Mit zitternder Hand strich er ihr übers Haar.
„Fritz!“ Sie liess die Kissen fahren und warf sich ihm an den Hals. „Ich liebe dich, ich liebe dich,“ schluchzte sie, „ich will nicht teilen — fort, fort!“ Es war, als sollte der Paroxysmus zurückkehren.
Lena drückte sich zum Zimmer hinaus, sie konnte es nicht mehr mit ansehen; ein ohnmächtiger Zorn war in ihr, der ihr dunkel vor den Augen machte und ihr Blut wallen liess. Sie hörte noch draussen das geschluchzte ‚Ich liebe dich‘ und das gütige Zureden des Bruders. Sie fühlte es, sie musste fort; hier war ihres Bleibens nicht länger. Wie gepeitscht jagte sie die Treppe hinan auf ihr Stübchen; erst als sie die Tür hinter sich verschlossen, fühlte sie sich sicher.
Ihr graute vor Amalies Augen, diesen klarblauen Augen, die immer kalt und gleichgültig blickten und doch so aufflammen konnten. In besinnungsloser Hast riss sie ihre Kleider aus dem Schrank und stopfte sie in den Koffer; nur fort, fort! Ein grosser Jammer war in ihr, sie biss die Zähne aufeinander, um nicht laut zu weinen; er hatte sie nicht schützend in die Arme gezogen, er hatte Amalie nicht das Wort verboten! Er fürchtete sich vor seiner Frau!
„Oh!“ Lena kauerte sich in die Ecke des kleinen Sofas zusammen, zog die Füsse herauf und drückte den schmerzenden Kopf gegen die Lehne. Sie konnte nichts mehr denken, nichts überlegen, nur das eine: ‚Fort, fort!‘ Morgen in aller Frühe ging der Expresszug über Köln nach Berlin; um elf Uhr abends konnte sie dort sein, zu Hause, bei der Mutter. Und doch überfiel sie ein Grauen vor dem heissen, staubigen Berlin.
Fort, fort! Draussen rauschte der Nachtwind; wie spät mochte es sein? Es war ganz dunkel um sie, nur durch die lichter sich abhebende Öffnung des Fensters sah sie die Moselberge in finsteren Umrissen. Im Haus war es still, die Mägde nebenan in ihrer Kammer waren längst zu Bett gegangen; sie hatten nicht gelacht wie sonst allabendlich, sie waren auch bedrückt. Welche Blamage vor den Dienstboten! Lena fühlte, wie ihr das Blut immer heisser aufwallte und zu Kopf stieg; in ihren Ohren summte es — halt! Das hörte sie doch, ein Rascheln draussen vor der Tür.
Eine Hand drückte auf die Klinke, nun ein Pochen. „Lena!“
Sie horchte, aber sie rührte sich nicht. Es war des Bruders Stimme.
„Liebe Lena! Lena, hörst du mich nicht?“
„Was willst du?“
„Lena, es tut mir so leid, es ist mir so unangenehm, ich bitte dich —“
„Weiss Amalie, dass du hier bist?“ unterbrach sie ihn rasch.
„N—ein!“ Das ‚Nein‘ klang zögernd.
„So geh!“ Der Trotz stieg ihr zu Kopf. „Wenn du nicht den Mut hast, offen zu mir zu halten, vor allen, dann —“
„Lena, Lena, sei doch verständig! Wir haben Kinder — sie liebt mich — ich lebe mit ihr — ich — du weisst nicht, was die Ehe ist!“
„Dann — dann danke ich! Ich reise morgen ab.“ Tonlos klang’s und doch deutlich vernehmbar. Lena hielt sich die Ohren zu, sie mochte nicht hören, was der draussen sagen würde. Heisse Tränen liefen ihr über die Wangen.
Alles still. Ob er noch vor der Tür stand? Sie nahm die Hände von den Ohren — ja, er flüsterte: „Lena, was wird die Mutter sagen? Amalie wird sich besinnen. Lena, Lena, tu mir’s zulieb, reise nicht so Knall und Fall ab! Bleibe — mir zulieb!“
Wie schmerzlich das ‚mir zulieb‘ klang!
„Nein!“ Lena presste wieder die Hände an die Ohren und den Kopf zwischen Sofakissen und Lehne. Sie konnte es nicht verhindern, dass sie draussen immer noch das Flüstern und Pochen hörte — oder war’s ihr nur so?
Sie horchte. Nichts, gar nichts mehr! Er war gegangen.
II.
Der Morgen kam herauf. In dem kleinen Zimmer mit dem zerwühlten Bett und dem geöffneten Koffer war fahle Frühbeleuchtung.
Lena trat hin und her, schon in Hut und Mantel; jetzt sah sie sich um. In dem nüchternen Licht erschien ihr alles anders als gestern. Im Dunkel der Nacht war sie sich wie eine Märtyrerin vorgekommen; Hirngespinste, Träume hatten sie umwoben — und jetzt —?! Was würde die Mutter sagen? Zu Tode erschrecken musste sie über ihre plötzliche Heimkehr. Und Fritz?! ‚Bleibe mir zulieb‘, hatte er gesagt. Er würde böse sein. Sinnend blieb Lena stehen. — Aber Amalie?
„Nein, ich reise ab!“ Der eigensinnige Zug um Lenas Mundwinkel trat deutlicher hervor, mit einem Ruck warf sie den Kofferdeckel zu und setzte sich darauf; das Schloss schnappte ein.
Nebenan in der Mägdekammer rührte sich’s, jetzt klappte die Tür. Lena öffnete rasch die ihre: „Marie, hören Sie! Wenn der Herr fragt, sagen Sie, ich wäre abgereist. Ich muss abreisen; sofort!“ Sie vermied den Blick der Magd. „Ich will niemanden stören. Vom Bahnhof schicke ich einen Dienstmann, geben Sie ihm meinen Koffer. Adieu!“ Schon war sie die Treppe hinunter, und Marie sah ihr kopfschüttelnd nach. Allzu verwundert war die Marie nicht.
Draussen war’s noch menschenleer; in der Allee, zwischen den Villen und Gärten, begegnete der Eilenden niemand. Überall waren die grünen Jalousien geschlossen; hinter den Eisengittern die Blumen taubesprengt. Und drüben, jenseits der Mosel, die Berge in wunderbarem Duft; um die Spitze der Mariensäule das erste Gleissen der hervorbrechenden Sonne.
Lena sah nicht hin, sie rannte wie auf der Flucht; jetzt mässigte sie ihren Schritt — die ersten Menschen! Durchs alte römische Stadttor, in die innere Stadt hinein, zogen die Marktleute, Wagen knarrten, Hunde bellten; Lena empfand das Quietschen der Räder schneidend bis ins Mark. Sie fröstelte; sie war übernächtig, die Augen brannten, der Kopf schmerzte.
Jetzt war sie am Bahnhof. Wenige Kofferträger lungerten umher; einen derselben schickte sie ab, und dann setzte sie sich in den Wartesaal. Es war so lange Zeit, über eine Stunde noch. Sie bestellte sich Kaffee und mochte ihn doch nicht trinken, ein übles Gefühl sass ihr in der Kehle; es war ihr alles zuwider. Sie fühlte sich grenzenlos elend; verstört schweifte ihr Blick an den Wänden auf und nieder. Da die Bilder einiger Potentaten, in Reih und Glied aufgehängt; in der Mitte die Büste des Kaisers, sie war neugegipst, der Eichenkranz sass schief. Und da das Büfett mit der unvermeidlichen dicken Mamsell, dem verschlafenen Kellner und den vertrockneten Brötchen unter Glasglocken.
Ab und zu klappte die Tür; übermodern gekleidete Handlungsreisende mit Musterkoffern stürmten herein und riefen gähnend nach einer Tasse Kaffee. Endlos dehnten sich die Minuten. Lena stützte den schmerzenden Kopf in die Hand. Nie im Leben glaubte sie unglücklicher gewesen zu sein, nie unglücklicher sein zu können; der öde Bahnhof, die herbe Morgenfrühe, hier ihr einsamer Winkel, die nüchterne Leere in ihrem eignen Innern, alles stimmte zueinander. Kein Mensch kümmerte sich um sie.
Und er liess sie ungehindert aus seinem Hause gehen. Wie eine, die etwas verbrochen, hatte sie fliehen müssen!
Sie stöhnte und biss sich dann auf die Lippen; sie hätte in heisse Tränen ausbrechen mögen, aber nein, nicht weinen! Der Stolz verbot es ihr. Sie versuchte nun doch den Kaffee, langsam, Löffelchen um Löffelchen, und dazwischen blickte sie nach der Tür; ob der Kofferträger bald kam? Auf der Uhr dort über dem Büfett rückten die Zeiger allmählich vor.
Da — sie liess den Löffel aus der Hand fallen, dass er auf die Untertasse klirrte. Die Tür hatte sich geöffnet; vor dem Dienstmann her drängte sich eine wohlbekannte Gestalt, den Überzieher nicht zugeknöpft, den Schlips ungebunden, lose herunterhängend.
Lena sah’s in einem Augenblick und musste lächeln in aller Betrübnis — ihr ordentlicher Bruder, dem konnte das passieren? Ja, er liebte sie doch!
„Lena, Lena!“ Landgerichtsrat Langen trat atemlos an den Tisch. „Was tust du mir an? Marie sagte mir eben, du seist fort, und gerade kommt auch der Dienstmann und will deinen Koffer holen. Ich bitte dich, Lena, mach’ keinen Eklat! Bleib, Lena!“ Er suchte ihren Blick.
Eine heimliche Freude durchzuckte sie, aber sie bezwang sich. „Haben Sie den Koffer?“ fragte sie den Träger.
„Jawohl, Madam!“
„Kommen Sie mit an den Schalter, ich habe noch kein Billett.“ Und sich flüchtig zum Bruder wendend: „Ich bin gleich wieder hier.“
„Lena, Lena!“
Sie zögerte. Sein Ton durchschauerte sie; blass und rot flog es über ihr Gesicht, unschlüssig senkte sie den Kopf.
„Lena, wenn ich dich nun bitte?! Amalie hat mir versprochen, liebenswürdig zu sein, sie lässt dich grüssen und bittet dich, zurückzukommen, sie — zucke nicht so mit dem Mund! — sie ist wirklich verständiger als du!“
„So?“ Lena zuckte zusammen, es traf sie wie ein Schlag ins Gesicht. „Ich — ich — kommen Sie,“ sagte sie hart zu dem Dienstmann.
„Lena, du bist eigensinnig, trotzig!“
Sie hörte ihn nicht mehr, sie war schon hinaus. Oh, dieses Mädchen! Unwirsch, mit raschen Schritten, ging Langen vor dem Tisch hin und her. Er kannte diese Falte zwischen ihren Brauen, diesen Zug um den aufgeworfenen Mund. Eine tiefe Bekümmernis stieg in seiner Seele auf; wie würde sie im Leben noch anlaufen! Die Mutter war viel zu schwach, er selbst konnte nicht immer bei ihr sein — und wenn auch, folgte sie denn? Sie war liebevoll und schmiegsam, aber nur bis zu einer gewissen Grenze; da stand ihr eigner Wille, machte sich breit und liess nichts anderes passieren. Nach wieviel Kämpfen hatte sie’s durchgesetzt, Musik zu studieren. Sängerin werden! Sie hatten’s ihr alle gesagt, ihr Körper sei nicht stark, ihre Stimme schwach — vergebens! Die Mutter musste nach Berlin ziehen, pekuniäre Opfer wurden gebracht, seit Jahren wurde nun studiert; sie musste eben mit dem Kopf durch die Wand.
Ärgerlich riss Langen an seinem Schnurrbart. Da trat sie wieder in den Saal, schlank und schmächtig im langen Reisemantel, den Schleier zurückgeschlagen von dem blassen, aufgeregten Gesicht; ihre grossen Augen blickten trüb. Nein, er konnte ihr nicht böse sein! Eine grosse Zärtlichkeit wallte in ihm auf.
„Lena,“ sagte er weich, „meine Schwester!“
Sie war auf einen anderen Ton gefasst gewesen; überrascht sah sie ihn an. Es war, als wollte sie sich an ihn schmiegen; sie ergriff seine Hand. „Es ist nett von dir, dass du noch gekommen bist; ich danke dir!“
„Böses Mädchen!“ Er versuchte zu lächeln, aber es war ihm nicht danach. „Was wird die Mutter sagen? Und was du für einen harten Kopf hast!“
„Krause Haare, krauser Sinn!“ Sie lachte wirklich, hell auf.
Es berührte ihn fast unangenehm; wie konnte sie nur jetzt lachen? „Lena, gestern sagtest du noch, du wüsstest, ich brauchte dich — heut gehst du von mir, und es tut dir gar nicht leid?“
„O doch, o doch!“ Ihr Lachen war verschwunden, sie presste seine Finger in ihren beiden Händen, und dann, rasch sich umblickend, ob auch niemand herschaue, drückte sie ihren Mund auf seine Hand. „Grüss’ Lora und auch Walter. Du musst mir nicht böse sein. Ich kann, ich kann nicht anders! Sie hat mich beleidigt, ich kann nicht vergessen!“
„Aber vergeben!“ Er sah sie ernsthaft an. „Du wirst es lernen müssen im Leben.“
„Vergeben?“ murmelte sie, „nein, ich“ — sie stockte, der Portier riss die Tür auf.
„Einsteigen in der Richtung nach Gerolstein, Euskirchen, Köln!“
„Du musst umsteigen in Köln,“ sagte Langen hastig, „du hast anderthalb Stunden Aufenthalt dort. Schreib mir eine Karte vom Bahnhof, wie es dir geht.“
„Ja, ja!“ Ihre Stimme klang gepresst, eine unnennbare Angst vor der langen einsamen Reise überfiel sie; und heute, gerade heute, hatte sie so das Bedürfnis, sich anzulehnen! Im Hinausgehen presste sie des Bruders Arm. „Fritz, lieber Fritz!“ Sie weinte.
„Meine Schwester!“ Er half ihr in das Kupee, kein anderer Reisender stieg ein, und dann schwang er sich noch einmal zu ihr hinauf. „Leb wohl, Lena!“
Sie schluchzte laut und presste ihren Kopf an seine Schulter.
„Lena, was machst du uns für Kummer, dir und mir! Ich bin traurig.“
Es wallte in ihr auf, trotzig wollte sie erwidern: ‚Ich? Nicht ich, deine Frau macht dir Kummer,‘ aber sie sah sein Gesicht. „Du hast ja Lora,“ sagte sie aus einer merkwürdigen Ideenverbindung heraus.
Er nickte. „Sie ist mein einziges — mein grösstes Glück,“ verbesserte er sich rasch.
„Fertig!“ Der Schaffner warf die Türen zu.
„Leb’ wohl, Lena, komm gut nach Haus!“
Noch ein hastiger Kuss. Langen sprang auf den Perron zurück. Lenas blasses verweintes Gesicht nickte zum Fenster heraus.
*
Station auf Station. Die Eifelberge guckten rechts und links ins Fenster. Lena sah nicht hinaus. Den wüsten Kopf an das Seitenpolster gedrückt, sass sie mit geschlossenen Augen. Sie fuhr wie aus einem Traum auf, wenn der Zug an einer Station hielt; dann duselte sie weiter. Der Wagen wurde hin und her geworfen, immer das gleiche Rrrrrr —, das eintönige Rattern der Räder. So sass ihr ein Rad im Kopf, das drehte sich unaufhörlich um die gleiche knarrende Achse.
Gekränkt! Eine andere vorgezogen! So war’s beim Bruder gegangen, er hatte sie lieb und hielt doch zu der anderen; so war’s bei dem gegangen, um dessentwillen sie aus Berlin geflohen war! Wie hatte er ihr die Cour gemacht im vergangenen Winter! Sie hatten sich oft bei einer befreundeten Familie getroffen, zu oft; er hatte ihren Gesang bewundert, ihr glühend die Hand geküsst, dann kam das Frühjahr — aus! Er hatte auch eine andere vorgezogen.
Hatte sie ihn geliebt? Lena presste die Augen fester zu, eine Röte stieg ihr jäh ins Gesicht; wenn sie das nur wüsste! Sie hatte schon oft zu lieben geglaubt; immer war aus den Trümmern einer alten Liebe das Morgenrot einer neuen gestiegen. ‚Das muss so sein,‘ sagte der berühmte Gesangsprofessor, ‚immer verliebt! Wo soll denn eine sonst den Ausdruck herkriegen?‘
Aber nun glaubte Lena nicht mehr an eine neue Liebe. Die rechte würde doch nicht kommen, nie, nie! Alles ging unter in dem Gefühl der erlittenen Kränkung, in dem neuen grossen Unglücklichsein. Sie wollte nun nichts mehr von den Menschen, nein, nur die Kunst, die Kunst! Sich an die mit allen Fasern klammern, immer ihr nach, ohne nach rechts und links zu blicken! Eine stürmische Sehnsucht fasste plötzlich Lenas Herz; ein unwiderstehlicher Drang trieb ihr Tränen in die Augen, ihre Wangen glühten.
„Gerolstein!“
Sie fuhr auf; sie war erschrocken. Draussen Laufen auf dem Perron, Schlagen von Türen, Rufen — jetzt wurde ihr Kupee aufgerissen.
„Steigen Sie ein, Herr, hier ist Platz,“ sagte die rauhe Stimme des Schaffners.
Wie unangenehm! Lena zog sich ganz in ihre Ecke zurück, sie hatte jetzt nicht Lust auf Gesellschaft; sie schämte sich der Tränen, die noch verräterisch in ihren Augen glänzten, und ihrer heissen Wangen.
„Sie gestatten,“ sagte der Fremde, fasste an den Hut, brachte sein Gepäck unter — Lena sah Malutensilien, Farbkasten, Staffelei, Leinwandschirm, Feldstuhl — und warf sich dann auf den Sitz, die Beine von sich streckend.
Der Zug rasselte weiter.
Eine halbe Stunde war vergangen; nach und nach wurde die Landschaft draussen flacher, die pittoresken Formen der Eifelberge verschwanden, die schwermütig nackten Kuppen mit ihrer kahlen Einsamkeit machten sanften Abdachungen, Äckern und Dörfern Platz. Schon tauchten Fabrikschornsteine auf.
Lena fröstelte, die ganze Poesie war dahin; und dabei musste sie gähnen, eine schreckliche Leere in ihrem Magen quälte sie. Sie hatte Hunger. Sie schämte sich vor sich selber; wie konnte man so unglücklich sein und doch Hunger haben? Bis Köln würde sie’s noch aushalten müssen. Unruhig glitt ihr Blick umher.
Ihr Gegenüber zog jetzt ein weisses Papierpaketchen aus der Handtasche; ein paar appetitliche Butterbrote waren darin, und zwischen Blättern auch Früchte. Das Wasser lief ihr im Mund zusammen, sie neigte sich vor und machte grosse Augen.
Als ob er’s geahnt hätte, so sah er jetzt auf; ihre Blicke begegneten sich, sie wurde über und über rot, wie ein ertapptes Kind. Ein leichtes Lächeln hob seine Oberlippe, man sah die schönen weissen Zähne; auf der flachen Hand hielt er ihr das Papier hin. „Darf ich Ihnen etwas Obst anbieten? Auf den primitiven Bahnhöfen, die wir passieren, gibt’s nichts Geniessbares. Verzeihen Sie, ich wollte nicht unbescheiden sein!“
Lena hatte sich auf die Lippen gebissen und war in ihre Ecke zurückgefahren — was dem einfiel?! Es wurmte sie, aber gleich darauf kam ihr alles so komisch vor, sie musste lachen. „Sehe ich so hungrig aus?“ Und dann streckte sie die Hand aus und nahm eine Frucht und dann, zögernd, ein Butterbrot. „Ich bin auch hungrig! Es ist gewiss komisch, dass ich —“ sie brach verlegen ab.
„O gar nicht!“ Er hatte eine famose Art, ihr über die Befangenheit wegzuhelfen. „Reisegefährten sind ja für eine Weile Lebensgefährten — warum also nicht?“ Er langte wieder in die Tasche und entkorkte eine Flasche. „Da, bitte trinken Sie!“ Er hielt ihr einen Becher mit Wein hin.
Ohne Zögern tat sie einen tiefen Zug, und noch einen. Der Wein war stark, die Schatten unter ihren Augen verschwanden, ihre Lippen wurden feucht und rot. „Ich fühle mich jetzt ganz anders,“ murmelte sie, „so viel frischer, ich danke sehr!“ Ihre Augen glänzten.
Er fand sie hübsch, viel hübscher, als er anfänglich gedacht hatte. Diese schmale Stirn mit den Lockenringeln, der eigentlich zu grosse Mund mit der charakteristischen kurzen Oberlippe waren pikant. Ein Mund, der viel Amüsantes plaudern konnte, den es lockend war, zu küssen.
„Mein Fräulein?“ Es klang wie eine Frage.
Sie nickte.
„Also, mein Fräulein, erlauben Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle: Bredenhofer, Richard Bredenhofer, Dilettant in allen Künsten — und sonst nichts!“
„Oh!“ Sie schielte nach den Malergerätschaften, die oben im Netz schaukelten.
„Nein, nein,“ er lachte halb spöttisch, halb leichtsinnig, „wirklich nur ein Dilettant, auch hierin. Aber man gibt die Hoffnung im Leben nicht auf. Einmal muss es doch kommen, das, nach dem man Durst hat, das“ — er schloss die Hand und öffnete sie wieder — „das — ich weiss nicht, wie ich’s nennen soll!“
„Ach,“ sie wurde zutraulich, „geht’s Ihnen so wie mir? Ich hatte nicht bloss Hunger auf Ihr Butterbrot. Sind Sie auch nie satt? Ich meine geistig. Einen Tag ist man so voll und könnte die Welt stürmen, und den anderen ist man dann wieder so erbärmlich und klein und hat gar keine Courage zu was. Es ist greulich!“ Sie legte die Hände ineinander und sah wehmütig drein. „Ob grosse Leute, wie Schiller und Goethe und Beethoven und Mozart, auch so gefühlt haben?“
„Diese führenden Geister? Sie greifen gleich sehr hoch!“
„Hoch oder gar nicht!“ Sie warf den Kopf hintenüber.
„Das sage ich auch!“ Seine Augen blitzten. „Wer will es uns wehren, nach den Sternen zu greifen? Hallo!“ Er sprang auf, die Früchte rollten ihm unbeachtet vom Schoss auf den staubigen Kupeeboden. „Sie sind Künstlerin, gnädiges Fräulein?“
„Ich möchte gern.“ Ein banger Ausdruck trat in ihr Gesicht. „Wenn’s mir nur gelingt!“
„Es wird, es wird!“ Er sah sie an.