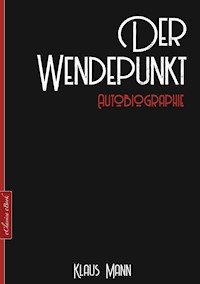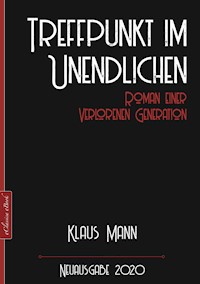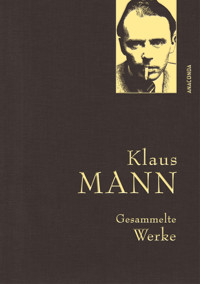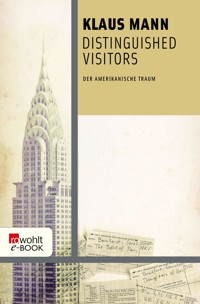
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist ein Buch über Amerika und Europa. Klaus Mann porträtiert berühmte Reisende, die im Laufe der Jahrhunderte ihre europäische Heimat verließen und die Neue Welt erkundeten. Entstanden ist ein Werk über Ferne und Nähe, über Abschied und Ankommen, über Liebe und Verzweiflung. Berichtet wird von Triumphen wie von Desastern - und oft liegt beides nahe beieinander. Das Buch enthält Kapitel unter anderem über Eleonora Duse, Peter Tschaikowski, Chateaubriand, Leo Trotzki und - Franz Kafka, der Amerika lediglich im Geiste (als Karl Roßmann) bereist hat. "Distinguished Visitors" entstand 1939/40, als der Autor selbst - von den Nazis aus Europa vertrieben - in den USA Zuflucht gesucht hatte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Klaus Mann
Distinguished Visitors
Der amerikanische Traum
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Heribert Hoven
Übersetzung Monika Gripenberg
Über dieses Buch
Dies ist ein Buch über Amerika und Europa. Klaus Mann porträtiert berühmte Reisende, die im Laufe der Jahrhunderte ihre europäische Heimat verließen und die Neue Welt erkundeten. Entstanden ist ein Werk über Ferne und Nähe, über Abschied und Ankommen, über Liebe und Verzweiflung. Berichtet wird von Triumphen wie von Desastern – und oft liegt beides nahe beieinander. Das Buch enthält Kapitel unter anderem über Eleonora Duse, Peter Tschaikowski, Chateaubriand, Leo Trotzki und – Franz Kafka, der Amerika lediglich im Geiste (als Karl Roßmann) bereist hat. »Distinguished Visitors» entstand 1939/40, als der Autor selbst – von den Nazis aus Europa vertrieben – in den USA Zuflucht gesucht hatte.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2019
Die Originalausgabe erschien 1992 in der edition spangenberg, München.
Copyright © 1996 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Umschlagabbildung Münchner Stadtbibliothek / Monacensia, KM D 53
ISBN 978-3-644-00354-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Zu dieser Ausgabe
Klaus Mann stellte im August 1940 die große Revue der reisenden Berühmtheiten, Distinguished Visitors, nach neunmonatigen intensiven Recherchen fertig. Das rund 450 Seiten umfassende englischsprachige Typoskript, von dem das Münchner Klaus-Mann-Archiv einen Durchschlag besitzt, boten der Autor und sein Agent Franz Horch zusammen mit einer ausführlichen Synopsis den amerikanischen Verlagen an.
Nach dem Erfolg von Escape to Life will sich Klaus Mann in den Jahren 1939/1940 auch als englischsprachiger Autor etablieren. Allerdings leidet er, wie er seinem Tagebuch wiederholt mitteilt, zeitweise unter der fremden, ihm nicht völlig geläufigen Sprache. Immerhin sind jetzt auch seine handschriftlichen Notate und Vorstudien in Englisch verfaßt.
Für sein neues Buch greift Klaus Mann zu einer auf den ersten Blick unverfänglichen Maske, einer List, die er dem amerikanischen Journalismus abgeschaut hat: Um sich die Aufmerksamkeit seines neuen Publikums zu sichern, wählt er illustre Köpfe aus der Geschichte und verpackt in deren persönliche Erfahrungen mit der Neuen Welt seine Forderung an Amerika, die neutrale Haltung gegenüber Nazi-Deutschland aufzugeben und auch für die Zukunft Europas Verantwortung zu übernehmen.
Das Angebot, durch die Brille fremder Besucher das eigene Land zu sehen, wird von den amerikanischen Verlagen jedoch nicht angenommen. Scheute man sich vor dem Blick in den Spiegel? Oder war Klaus Manns gegen den amerikanischen Isolationismus gewandter Appell vielleicht doch zu direkt?
Nachdem Klaus Mann inzwischen in Deutschland als Autor und in seinem politischen Engagement wahrgenommen wird und anerkannt ist, möchten Verlag und Herausgeber auch dieses bisher unveröffentlichte Typoskript unter dem Originaltitel, ergänzt um den erläuternden Untertitel, jetzt dem deutschen Lesepublikum in Buchform vorstellen.
Dieses Vorhaben beinhaltet die ungewöhnliche Aufgabe, Klaus Manns englischen Text in seine Muttersprache zu übertragen, nachdem ein halbes Jahrhundert seit der Entstehung dieses zeitbedingten Werkes vergangen ist.
Die Übersetzung konnte sich auf ein nahezu fehlerfreies, in flüssigem und differenziertem Englisch geschriebenes Typoskript stützen. Welche Anteile daran die von Klaus Mann beauftragten Redakteurinnen Ann Persor und Eleanor Clark hatten, läßt sich aufgrund der weitreichenden Korrekturen von fremder Hand, vor allem im letzten Kapitel, nur erahnen. Immerhin hat sich Klaus Mann im Verlauf der Arbeit an Distinguished Visitors von Ann Persor getrennt, weil sie zu stark in den Text eingegriffen hatte.
Die deutsche Übersetzung zielt nicht darauf ab, den bekannten ›Originalton‹ Klaus Manns zu imitieren. Nur einzelne, für Klaus Mann typische Ausdrucksweisen, die noch im Amerikanischen zu identifizieren waren, versucht sie widerzuspiegeln. Bei den vielen eingestreuten Zitaten weicht Klaus Mann häufig vom Original bzw. von bekannten deutschen Übersetzungen. ab, – oft wurden sie von ihm wohl bewußt abgeändert, um so manches aus fremdem Munde pointierter sagen zu können. An diesen Stellen wurde die Version Klaus Manns zugrunde gelegt und ›neu‹ ins Deutsche übersetzt.
Es gibt in diesem Buch auch zwei Passagen, die bereits als deutscher Urtext von Klaus Mann bzw. als eine spätere Rückübersetzung seiner Schwester Erika vorlagen: Der Abschnitt über Tschaikowski basiert auf Klaus Manns Roman Symphonie pathétique; der Text über Masaryk dagegen wurde von Erika Mann für den Essay-Band Heute und Morgen (1969) ins Deutsche übersetzt. In beiden Fällen hält sich diese Ausgabe an die bereits vorliegenden deutschen Versionen.
Das ursprünglich geplante zehnte Kapitel, Prophets, das sich mit ›bemerkenswerten Amerika-Besuchern‹ wie Rudolf Steiner, Annie Besant und dem Theosophen Emanuel Swedenborg befassen sollte, wurde vermutlich nicht zu Ende geführt. Klaus Mann leitete es mit einer Übertragung von Goethes Gedicht Amerika, du hast es besser ein. Die Abschrift des deutschen Originals von Klaus Manns Hand und das Typoskript der Übertragung werden als Faksimile in diesem Buch auf Seite 366 wiedergegeben. Außerdem werden nahezu alle »erlauchten Besucher« im Anhang in kurzen biographischen Abrissen und, analog zu Escape to Life, mit Porträtabbildungen vorgestellt.
Eberhard Spangenberg Heribert Hoven
Für Liesl und Bruno Frank
Amerika, du hast es besser
Als unser Kontinent, das alte,
Hast keine verfallene Schlösser
Und keine Basalte.
Dich stört nicht im Innern
Zu lebendiger Zeit
Unnützes Erinnern
Und vergeblicher Streit.
Benutzt die Gegenwart mit Glück!
Und wenn nun eure Kinder dichten,
Bewahre sie ein gut Geschick
Vor Ritter-, Räuber- und Gespenstergeschichten.
Johann Wolfgang Goethe
Vorwort
Gewaltige Anstrengungen werden unternommen, um einen neuen Seeweg nach Indien zu finden – und dabei entdeckt man eine Unzahl Ebenen und Berge, Wälder und Wüsten, Seen und Flüsse: einen jungfräulichen Kontinent. Der Kontinent erhält einen Namen, und dann nimmt er, langsam, nach und nach, auf geheimnisvolle Weise Form an und entwickelt sich.
Was ist Amerika?
Die Amerikaner sind heute selbst mit einer mühevollen Forschungs- und Entdeckungsarbeit beschäftigt. Während sie sich wie skeptische und dennoch mitfühlende Fremde selbst analysieren, sind sie zu selbstbewußten und objektiven Betrachtern geworden. Sie bilden sich eine neue Meinung über ihre Geschichte und taxieren ihre Reichtümer. In ihren widersprüchlichen Herzen suchen sie nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner des amerikanischen Wesens, auf daß ihre Zukunft als Nation in einer Welt, der man immer weniger trauen kann, nicht gänzlich unvorhersagbar sein möge. In den Schaufenstern türmen sich Bücher über Amerika und über die Demokratie: historische, regionale, proletarische Romane; Lebensbeschreibungen amerikanischer Helden und Banditen, Reiseführer für sämtliche Bundesstaaten, Sammlungen amerikanischer Volkslieder, ernsthafte soziologische Studien, Bücher über die Depression, den New Deal, die Zukunft der Demokratie, über die Sprache der Amerikaner, die amerikanischen Flüsse, Wörterbücher des amerikanischen Slangs, nahezu gänzlich unpersönliche Poesie, die sich enthusiastisch mit sozialen Problemen, mit amerikanischen Angelegenheiten befaßt … Amerikanische Künstler haben sich von Europa abgewandt und malen jetzt im amerikanischen Stil. Radiokommentatoren präsentieren den idealen Durchschnittsamerikaner und preisen ihn Millionen geduldigen Zuhörern an, die in aller Demut ihre große Unterschiedlichkeit erkennen.
Amerikanische Intellektuelle, die lange als freiwillige Exilanten in Florenz, Paris oder Wien gelebt haben, kehren heim und begutachten die ihnen halb fremde, halb vertraute Szenerie. Einige fühlen sich abgestoßen von der »gigantischen, gefühllosen Maschinerie, die wir aus Amerika gemacht haben«, wo jeder einzelne »gewaschen, frisch gestärkt, desinfiziert, sterilisiert, kastriert und normiert in den Alltagstrott eingespannt ist«. Trotzdem, im Gegensatz zu den Ländern Europas haben die Weite und Vielfältigkeit ihres Kontinents, sein Mangel an Homogenität, für die Amerikaner etwas Beunruhigendes. Sie möchten wissen, was Amerika eigentlich ist – und jede Antwort scheint problematisch.
Was ist typisch amerikanisch?
Oder umgekehrt formuliert, was ist unamerikanisch? Man kann eine Definition versuchen, indem man das scheinbar Überflüssige wegläßt. Die Schwierigkeit dabei ist, möglicherweise auf so negative Art kreativ zu werden, daß, hat man Amerika erst auf eine subjektiv angenehme Größe reduziert, vielleicht sehr wenig übrig bleibt.
Die Amerikaner sind im Moment so intensiv mit sich beschäftigt, daß ich mir denke, ein andersgeartetes Buch über Amerika ist vielleicht willkommen. Ein Buch, das von Besuchern handelt, die sich zu den verschiedensten Zeitpunkten hier aufgehalten haben. Sie haben sich distanziert und neugierig und manchmal liebevoll umgesehen und sind mit etwas von Amerika, vielleicht auch nur mit dem Spiegelbild ihrer Impressionen, in ihr eigenes Leben in der eigenen Heimat zurückgekehrt.
Es war nicht leicht, diese Besucher auszuwählen. So viele wunderbare und phantastische und amüsante und bemerkenswerte Menschen sind hierher gekommen, daß man Jahr für Jahr, bändeweise, zahllose Geschichten über sie schreiben könnte. Es ist faszinierend, eine vertraute Landschaft durch die Augen anderer Menschen zu sehen, Menschen aus der Vergangenheit und Gegenwart, die man nicht kennt, die man sich daher nur vorstellen kann. Durch die Augen dieser Besucher gesehen, nimmt die Landschaft ganz andere Formen an.
Was haben sie gesucht, diese Prinzen und Schauspieler, Soldaten und Musiker, Philosophen, Hochstapler, Poeten und Clowns? Jeder einzelne kam und ging mit seiner eigenen Vorstellung, seinem Verlangen, seinen Hoffnungen, Ängsten und Verrücktheiten. Einige kamen um des Abenteuers willen, einige um eine neue künstlerische oder religiöse Botschaft zu verkünden, andere waren einfach bestrebt, soviele Dollars wie möglich zu verdienen. Es gibt unter ihnen Lebensfrohe und Überempfindliche, Arrogante und Bescheidene. Manche werden von Amerika angeregt, andere verwirrt oder inspiriert oder gar zerstört. Sie durchqueren den Kontinent auf Pferderücken, in Salonwagen, mit der Postkutsche, mit dem Flugzeug oder zu Fuß auf den Highways. Was sie sehen, irritiert und amüsiert sie oder regt sie an.
»Also das ist Amerika … diese wilde Landschaft, diese Yankees … Sie empfinden Hochachtung für das Wort Independency, für George Washington, Gegner der Sklaverei jedoch werden in Boston geteert und gefedert … Also das ist Amerika … Die Grenzen werden immer mehr nach Westen geschoben … In Kalifornien wurde vor 87 Jahren Gold gefunden … Edgar Allan Poe, Mark Twain, Emily Dickinson, Walt Whitman, Emerson, Thoreau, Ella Wheeler Wilcox, Frank Norris … Also das ist Amerika … Wolkenkratzer, Charlie Chaplin, Negerlynchen, Sacco und Vanzetti, Jazz, die Fordfabriken, Main Street, Hollywood, die Frauenvereine, Babbit, Father Divine, und der C.I.O. … Also das ist die amerikanische Tragödie, die amerikanische Komödie, das amerikanische Rätsel, das amerikanische Wunder …«
Die Reflexion des amerikanischen Lebens durch die Augen dieser distinguished visitors, dieser bemerkenswerten Besucher, mag oft einseitig und manchmal sogar verzerrt sein. Und doch ist das Bild immer erkennbar. Zumindest spiegelt es bestimmte Aspekte einer komplexeren Realität wider.
Die Art, mit der Amerika diese Besucher empfängt, ist sowohl für die Gastgeber als auch für die Gäste charakteristisch.
Wenn ich ihre Wege verfolge, wenn mir ihre Verzweiflungen und Freuden, ihre Triumphe und Fehler klar werden, empfinde ich Rührung und Belustigung. Ich werde mich bemühen, für jene Besucher aus fernen Orten und fernen Zeiten Dolmetscher und Erzähler zu sein. Ich bin immer noch Europäer genug, um ihre Wesenszüge und Schicksale zu verstehen; und gleichzeitig hoffe ich, genug über Amerika zu wissen, um zu verstehen oder zu erraten, warum diese Männer und Frauen in diesem Lande verehrt oder verhöhnt, geliebt oder verachtet wurden. Beinahe hätte ich gesagt, ich würde gerne Mittler zwischen diesen Fremden und our own people spielen, aber das wäre eine Übertreibung. Denn ein Mittler ist ein Vermittler, der Unterschiede ausgleicht – das Wort ist mir unwillkürlich in den Sinn gekommen, zweifellos aufgrund der angespannten Lage in unserer Zeit. Sehr wenige dieser Besucher hätten Verwendung für die Dienste eines Mittlers gehabt. Und andererseits – Amerika ist noch nicht meine Heimat. Ich habe hier noch nicht lange genug gelebt, um es ohne Überraschung und Staunen zu akzeptieren.
Einige Personen in diesem Buch sind zudem heimatlos. Und gerade die sind mir vielleicht am allerliebsten …
Es gibt andere, die sich nirgendwo heimatlos fühlen. Sie sind überall dort zuhause, wo sie menschliche Kultur vorfinden. Nach der Überwindung des krankhaften Nationalismus unserer Zeit werden möglicherweise solche Menschen, Menschen ohne Haß und Vorurteile, sogenannte Weltbürger, die zukünftigen Epochen beherrschen.
Die Personen, die ich vorstellen werde, kommen aus einem weitaus weniger gefährlich bedrohten Europa, als das von 1940. Selbst das Europa der napoleonischen Kriege scheint eine Insel der Beschaulichkeit und Sicherheit verglichen mit dem modernen Europa der totalitären Kriege und der Gefahr der totalen Zerstörung. In der Tat, wir haben allen Grund, mit einer Dankbarkeit auf Amerika zu blicken, die diese berühmten oder abenteuerlustigen Besucher nicht gekannt haben können. Das Versprechen, in diesem Land leben zu dürfen, konnte für sie nicht das bedeutet haben, was es uns bedeutet.
Aber durch ihre Augen und ihre Erfahrungen können wir vielleicht, so ganz nebenbei, ein neues Amerika entdecken. Indem wir uns ihre fernen und vertrauten Gesichter ins Gedächtnis zurückrufen, erfahren wir vielleicht etwas über unser eigenes Leben, unsere eigenen Ängste, Hoffnungen und Möglichkeiten.
Kapitel IEine Kriegskorrespondentin
Madame von Riedesel
DIE »GROSSEN MÄNNER«, WELCHE die Geschichte machen, sind nicht immer die zuverlässigsten Chronisten. Viele von ihnen neigen zur Unwahrheit. Aber von den einfachen, anonymen Zeugen großer Ereignisse erfahren wir möglicherweise die Wahrheit.
Ein General, beispielsweise, könnte in seinen Memoiren um seines Ruhmes und seiner Ehre willen Fakten verändern oder sogar verfälschen. Seine Frau hingegen, eine hingebungsvolle und doch nüchterne und tüchtige Person, sieht und erinnert sich an die einfachen Dinge, die wirklichen Dinge, die Wahrheit.
General John Bourgoynes amerikanischer Feldzug wurde von verschiedenen Koryphäen beschrieben, analysiert und beurteilt: von Historikern, Militärexperten, Dichtern, englischen Tories und amerikanischen Patrioten. Aber Gentleman Johnny Bourgoyne hatte, ganz unbeabsichtigt, eine wache Beobachterin in seiner unmittelbaren Umgebung, deren präzise Augenzeugenberichte heutzutage mehr oder weniger vergessen sind.
Baronin von Riedesel, die Frau eines deutschen Generals bei der englischen Armee, ist eine unermüdliche Korrespondentin und führt aufs gewissenhafteste Tagebuch. In fast täglichen Eintragungen berichtet sie vom Beginn des Feldzuges bis zum Ende der langen Jahre der Gefangenschaft. Eine amerikanische Ausgabe ihres Buches Briefe und Erinnerungen über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und die Gefangennahme der deutschen Truppen bei Saratoga wurde 1828 in New York veröffentlicht.
AM 14. MAI 1776 VERLÄSST DIE Baronin Friederike Charlotte Luise von Riedesel mit ihren drei kleinen Töchtern, Gustava, vier Jahre, Friederike, zwei Jahre, und Caroline, erst zehn Wochen alt, die kleine deutsche Stadt Wolfenbüttel. Der »gute alte Rockel« hilft zuerst der Baronin in die Kutsche, und sie drückt das Baby fest an ihre Brust, als sie ihm zuschaut, wie er die kleinen Mädchen auf ihre Plätze setzt. Für gewöhnlich plappern die Kinder unausgesetzt mit ihren sanften, geschäftigen Stimmchen, aber jetzt sitzen sie da und starren, fast atemlos, ihre Mutter an. Besorgnis überkommt Madame von Riedesel. Zur Umkehr ist es noch nicht zu spät. War ihr Entschluß richtig, die Kinder die weite Strecke nach Amerika mitzunehmen? Rockel würde sein Leben für sie geben – er dient ihrer Familie seit Jahren –, und die Dienstmädchen, die in einer Kutsche weiter hinten folgen, hat sie mit größter Sorgfalt ausgewählt. Nur Gott weiß, welchen Gefahren sie begegnen werden. Plötzlich erinnert sie sich an den überzeugten Ton in der Stimme einer Freundin, die sie gewarnt hat, sie und ihre Kinder könnten von Wilden aufgegessen werden und »daß die Menschen in Amerika von Pferdefleisch und Katzen lebten«. Ihre Mutter, die Witwe eines Staatsministers, hat auch versucht, sie umzustimmen, und hat schließlich die Abreise mit ihrer ganzen Autorität untersagt. Aber die Baronin ist standhaft geblieben. »Es tut mir sehr leid, aber zum ersten Mal muß ich willentlich ungehorsam sein. Es ist mir unmöglich, hierzubleiben, wenn der beste und liebste Gatte seine Zustimmung erteilt hat, daß ich ihm folge.«
Halb lächelnd erinnert sie sich an den unterdrückten Jubel in seinem Brief, als er schreibt, der Herzog von Braunschweig habe ihn vom Oberst zum Generalmajor befördert, der für die gesamten deutschen Truppen in Amerika verantwortlich ist. Natürlich ist Englands Auseinandersetzung mit seinen Kolonien nicht die Angelegenheit deutscher Fürstenhäuser, aber Englands König und Königin sind beide deutscher Abstammung, und so tat der Herzog recht, ihnen zu helfen. Mit Stolz denkt sie daran, daß der Herzog der erste unter den sechs deutschen Regenten war, der Ihrer englischen Majestät vertraglich zusicherte, mit Infanterie und unberittenen Dragonern zu Hilfe zu kommen. Sie weiß, daß manche Leute sagen, der Herzog habe seine Männer wie Vieh verkauft. Aber das ist nicht wahr. Die Kolonisten haben sich von einigen schlechten Menschen in die Irre führen lassen, und es ist nur rechtens, die Engländer zu unterstützen. Und es ist auch richtig, daß England bezahlt – denn der Herzog von Braunschweig ist arm. Er hätte seine geliebte Oper und sein entzückendes französisches corps de ballet aufgeben müssen, ohne diese substantielle Hilfe aus dem Ausland. Die Behauptung kann doch nicht stimmen, daß man Leute in den Militärdienst gezwungen habe. Die Baronin jedenfalls hat persönlich keinen solchen Fall erlebt. Solches Gerede ist nicht nur skandalös: es ist aufrührerisch!
Ihr geliebter Friedrich! Die Trennung ist für ihn sehr schmerzlich und kaum erträglich. Er hat ihr täglich geschrieben, während er, vor der Abreise nach England, seine Soldaten drillte: Auf der Reise von England nach Kanada und von Montreal nach Quebec berichtet er jedes kleinste Detail vom Leben an Bord des Schiffes. Es ist, als ob all seine Erlebnisse nicht wirklich wären, solange er sie nicht mit seiner Frau teilen kann. Vielleicht finden die Leute sie ein wenig lächerlich, sie, eine dreißigjährige Frau, vierzehn Jahre verheiratet, Mutter dreier Kinder, verhält sich wie ein junges, liebeskrankes Mädchen, und das ihrem eigenen Ehemann gegenüber. Ihr Friedrich ist schwerfällig geworden, er ist nicht mehr der schneidige junge Offizier von damals.
»Liebe mich … liebe mich immer«, schreibt er. »Erhalte Dir Deine kostbare Gesundheit um meinetwillen.« Sie fühlt seine Sehnsucht nach ihr in den Briefen, eine Sehnsucht, die nicht allein der Gewohnheit und Einsamkeit entspringt, sondern wie ein quälender Hunger ist. Dennoch kommt der Vorschlag, ihm zu folgen, von ihr. Er ist erleichtert, glücklich und angstvoll. »Ich gestehe, ich zittere bei dem Gedanken daran«, schreibt er. Es sei gefährlich, die Kinder könnten seekrank werden, sie sei eine zarte Dame. »Die Schiffsmannschaft besteht im allgemeinen aus schmutzigen und rohen Menschen, deren Hauptnahrungsmittel halbrohes und kaum eßbares Pökelfleisch ist. Das Wasser wird nach kurzer Zeit so faulig und ekelerregend, daß man es unmöglich trinken kann.«
Auf der Überfahrt nach Dover will einer der Matrosen Caroline halten. Es ist drollig, ihn, einen rauhen, schwarzbärtigen Seemann, zu beobachten, wie er behutsam wie ein Heiliger mit dem Kind umgeht. Gustava und Friederike lachen fröhlich und spielen Fangen auf Deck. Jetzt braucht sie sich nicht mehr gegen die Schrecken zu wappnen, die sie vor den Kindern verborgen hat. Ein Gastwirt hat ihr erzählt, die Straßen seien voller Räuber und man habe innerhalb von vierzehn Tagen einhundertunddreißig Menschen gehängt. Sie beschließt, nicht nach Einbruch der Dunkelheit durch die Wälder zu fahren, aber einmal, in der Dämmerung, als die Pferde ins Schrittempo verfallen, streift sie ein in der Luft baumelnder Gegenstand durch das offene Kutschenfenster. Madame von Riedesel stößt ihn weg. Ohne hinzusehen, weiß sie, daß sie den Tod berührt hat. Es ist der Körper eines Gehängten, und sie hat seine Wollsocken gefühlt. Sie darf niemals mehr daran denken.
Von Dover fahren sie nach London und dann nach Bristol. Dort trifft die Baronin Mrs. Foy, die amerikanische Frau eines englischen Kapitäns. Der General hat es arrangiert, daß seine Frau gemeinsam mit Mrs. Foy den Atlantik überqueren soll, denn es schickt sich nicht für eine Dame, ohne Begleitung zu reisen. Aber Mrs. Foy ist eine leichtlebige und verantwortungslose, kokette und alberne Person, die sich nicht entschließen kann oder will. Drei oder vier Monate vergehen, und die Baronin ist immer noch in Bristol, auf der anderen Seite des Atlantiks.
Sowohl die Baronin als auch Rockel können nur einige Worte Englisch, und sie weint viel während der einsamen Stunden in ihrem Zimmer. Sie ist eine gute Hausfrau, die den Wert des Geldes wohl kennt, und sie weiß, daß sie von Gastwirten, Kutschern und Bediensteten schamlos ausgebeutet wird. Sie kann es nicht ertragen aufzufallen, und man hält sie auch noch für eine Französin, was sie empört. Einmal, als sie in einem mit knisterndem grünen Taft verzierten neuen Kalikokleid und einem kecken kleinen Fächer die Straße hinuntergeht, grölt ihr eine Gruppe betrunkener und lärmender Seeleute hinterher. »Französische Hure«, rufen sie … »Französische Hure« … Sie ist sich so schön vorgekommen in diesem Kleid. Sie hat es so gemocht. Jetzt ist es abscheulich geworden, und sie muß es der Köchin schenken …
Falls Mrs. Foy nicht abreisen will, wird sie die Kinder und die Mädchen nehmen … und Rockel würde sich um sie alle kümmern. Aber in Portsmouth bekommt sie nur zu hören, daß die Jahreszeit bereits zu weit fortgeschritten sei, daß sie den St. Lawrence Strom wahrscheinlich zugefroren vorfinden würde und den Hafen von Quebec geschlossen. Sie muß mehrere Monate warten. Sie weint in der Nacht, wenn sie an seine Briefe denkt. »Wo bist Du jetzt?« schreibt er. »Vielleicht auf See, vielleicht in großer Gefahr. Oh! Ich hoffe, Gott beendet bald meine Ängste und gewährt mir das Glück, Dich in meinen Armen zu halten …«
Aber sie macht auch eine sehr befriedigende Erfahrung. Die Königin hat den Wunsch geäußert, sie zu sehen, und am ersten Januar 1777 präsentiert sie sich bei Hof. Man hat ihr erzählt, der König küsse nur Engländerinnen und Gräfinnen, und dann beugt er sich recht unvermittelt zu ihr hinunter und berührt mit seinen Lippen ihre Wange. Sie kann ein tiefes Erröten nicht verhindern. Weil die Königin weiß, daß sie auch eine Mutter ist, führt sie sie ins Kinderzimmer, um ihr die zehn glücklichen Königskinder zu zeigen. Als Madame Riedesel bekennt, all ihre Gedanken beschäftigten sich mit Kanada, ist Ihre Majestät beeindruckt.
»Haben Sie keine Furcht vor der See? Ich liebe sie gar nicht.«
Die kleine Deutsche kann ein Zittern in der Stimme nicht unterdrücken. »Ich auch nicht, Madam. Aber da es keine andere Möglichkeit gibt, meinen Mann wiederzusehen, werde ich also guten Mutes reisen.«
Es ist wieder Frühling, April, und fast ein Jahr her, daß sie Wolfenbüttel verlassen hat. Schließlich ermöglicht ihr ein alter Freund ihres Vaters die Passage auf einem seiner Handelschiffe. Den Kindern geht es gut, Mrs. Foy wird überredet mitzukommen, und endlich, endlich, als der Wind die Segel bläht und die Möwen am regnerischen Himmel immer seltener werden, kann sie wieder an die Worte ihres Mannes glauben, die er kurz nach seiner Abreise, niedergeschrieben hat: »Gott liebt uns zu sehr, um uns lange zu trennen.«
Zwei Monate später, als das Handelschiff stolz den St. Lawrence Strom aufwärts segelt, bringt Madame von Riedesel die Kinder an Deck, um mit ihnen den ersten Blick auf Quebec zu genießen. Verschleiert und lieblich liegt die Stadt im nebligen, gelben Sonnenlicht, und als sie zitternd dasteht, mit Leib und Seele der Neuen Welt zugewandt, das Baby im Arm, Gustava und Friederike an ihren Röcken hängend, geben alle Schiffe im Hafen einen Salutschuß ab.
Sie sucht die Menge der rufenden, winkenden Leute am Kai ab, schaut gespannt von Gesicht zu Gesicht. Ihr Herz macht eine Satz … da! … sie kann nicht länger warten. Die letzte Woche ist beinahe unerträglich gewesen. Aber da nähert sich ein Kanu, kommt rasch längsseits, und ein Seemann klettert gewandt wie ein Eichhörnchen die wacklige Strickleiter herauf an Deck. Sie erkennt die Handschrift, noch ehe sie, ganz benommen, die Hand nach dem Brief ausstreckt. Ihr Mann mußte mit General Bourgoyne nach St. John aufbrechen, und sie würde noch ein paar Tage warten müssen.
Sie kann nicht, nicht jetzt, da sie den Ozean überquert hat. Er ist vor mehr als einem Jahr, im Februar, aufgebrochen und kennt das Baby noch gar nicht. Sie plant, ihm am nächsten Tag nachzureisen. Die Kinder würden schon genügend ausgeruht sein.
Die Kaleschen, die man hier an Stelle von Kutschen benutzt, sehen zu leicht aus, um sicher zu sein, und ihre Mädchen weigern sich, darin zu reisen, wenn nicht Rockel in ihrem Wagen mitfahre. Die Kinder sind begeistert. Friederike lacht, als die Baronin sie aus Sicherheitsgründen sorgfältig in einer Ecke festzurrt: die fest schlafende Caroline hält sie auf dem Schoß. Bald würden sie ihren Vater sehen …
Sie trifft ihren Mann zwei Tage später in Chambly, und weinend sinken sie einander in die Arme.
Wie müde er aussieht. Hatte er sie wirklich so sehr vermißt, wie sie ihn – in all den schlaflosen Nächten? Hatte er wirklich lange Zeit nicht gewußt, wo sie war oder ob seine Briefe sie erreichten? Wie albern von ihm, sich Sorgen zu machen. Es ist überhaupt nicht schlimm, den Atlantik zu überqueren, nicht so wie er gedacht hatte. Oh, den Kindern hat es auf See gut gefallen. Sie sind großartige Seeleute, besonders Caroline.
Nur Gustava, die älteste, erkennt den Vater. Sie umarmt ihn, als wolle sie ihn niemals wieder loslassen. Aber Friederike fürchtet sich vor der seltsamen Uniform und dem müden Gesicht. Sie klammert sich an ihre Mutter und schluchzt: »Nein, nein! Das ist ein häßlicher Papa! Mein Papa ist schön!«
Zwei ziellose, ungestüme, schöne Tage – erst später, in einer schweren Zeit, sollen sie als solche richtig geschätzt werden! Aber er muß wieder weg. Bourgoyne erwartet ihn in Montreal. Sie will ihn begleiten: »Warum nicht? Sag mir Friedrich! Warum nicht?« Aber er besteht daruf, sie solle nach Trois Rivières gehen und dort auf ihn warten. »Es ist deine Pflicht, meine Liebe! Vergiß nicht, daß du die Frau eines Soldaten bist.«
Welche Macht und Faszination dieses magische Wort auf ihn ausübt, Pflicht! Sein Gesicht wird starr, seine Stimme feierlich und gleichzeitig barsch und aggressiv, wenn er das Wort Pflicht erwähnt. Seine ergebene Frau fühlt eine plötzliche Beklemmung, als sie diese schreckliche und mysteriöse Verwandlung der geliebten und vertrauten Gesichtszüge sieht. »Männer sind von abstrakten Ideen besessen. Abstrakte Ideen sind schädlich und verwirrend. Sie komplizieren das Leben nur. Das Leben sollte einfach sein. Mein Leben ist recht einfach. Die Geburt eines Kindes, eine Krankheit, schönes Wetter, schlechtes Wetter, Essen und Schlafen: das ist Leben. Und Liebe. Ich liebe ihn. Das ist mein Leben und meine Pflicht und sonst gar nichts. Ich bin seine Frau, und ich habe ein Recht, bei ihm zu sein. That's all, voilà tout, das ist alles. Ich will bei ihm sein.«
Sie denkt an die schönen Zeilen, die sie einmal in einem alten Buch gefunden hat.
»Wohin dich auch das Schicksal treiben wird, über die stürmischen Wogen des Ozeans oder durch mannigfaltige und furchtbare Gefahren zu Lande, ich werde immer an deiner Seite sein. Es gibt keine noch so schreckliche Gefahr und keine noch so grausame Todesart, die nicht leichter zu ertragen wären, als so fern von dir zu leben.«
Die Baronin hat diese Worte in ihr Tagebuch notiert.
MITTE JULI LEGEN DIE BARONIN und die drei kleinen Mädchen eine Rast in Ticonderoga ein. Sie befinden sich auf dem Weg nach Fort Edward, um dort den geliebten General zu treffen. Die Soldaten, die Ticonderoga besetzt halten, können es gar nicht erwarten, ihr die Neuigkeiten mitzuteilen. Hat Madame Riedesel schon gehört? Es steht außer Frage, daß Bourgoyne in vierzehn Tagen in Albany sein wird. Der Krieg mit diesen Bauern ist ein Kinderspiel. Wie können sie auch erwarten, gegen Europas Spitzenregimenter durchzuhalten? Bourgoynes Männer haben Fort Ticonderoga eingenommen, ohne einen einzigen Schuß abzufeuern. Gentleman Johnny weiß, wo es lang geht, und er könnte keine fähigeren Generäle haben, als Phillips, Fraser und ihren Mann. Kaum zu glauben! Diese Geschwindigkeit! Am 1. Juli verläßt Bourgoyne Montreal mit achttausend Mann, führt sie nach Lake Chaplain und hat sie am 5. in einem Lager bei Crown Point untergebracht. Er umstellt nur das Fort, und am 6. machen sich General St. Clair und seine Männer wie gehetzte Kaninchen aus dem Staub. Aber, Madame von Riedesel, wissen Sie, das war das Seltsame daran. Gott allein weiß, wie sie da herausgekommen sind und auch noch den Großteil ihrer Vorräte mitnehmen konnten oder wohin sie geflüchtet sind, praktisch eingeschlossen von einer Armee. Bourgoyne hat Riedesel und Fraser mit ihrer Verfolgung beauftragt, aber sie bekommen die Amerikaner in diesem wilden Land nicht einmal zu Gesicht. Die Feiglinge kämpfen wie Indianer und schießen aus dem Hinterhalt, und die Briten haben ein paar Mann verloren, nicht viele, einige Hundert, größtenteils Braunschweiger.
Bitte, verzeihen Sie, Baronin. Ich will Sie nicht erschrecken. Ihrem Gatten geht es gut. Er ist wieder bei der Armee, und sie marschieren von Skeensborough nach Fort Edward.
In der Tat, sie kann nun, da die Briten den Lake George beherrschen, schnell zu ihm gelangen. Sie verschicken nämlich jetzt das schwere Gepäck und die Artillerie über den See nach Fort George und weiter über Land nach Fort Edward, und so ist es der Baronin möglich, noch am gleichen Abend mit einem der Boote überzusetzen. In Fort George kann sie dann leicht ein Gefährt mieten, welches sie nach Fort Edward bringt. Sie wird wahrscheinlich noch vor ihrem Mann dort eintreffen.
Ja, das sind gute Neuigkeiten, und Friedrich ist in Sicherheit. Sie kann wieder atmen. Ständig liegen Angst und Furcht in ihrem Herzen auf der Lauer und warten nur darauf, sie zu vernichten. Diese zu verbergen und zu besiegen kostet all ihren Mut und ihre Stärke. Warum kann Friedrich nicht verstehen, daß es für sie leichter ist, bei ihm zu sein, egal was geschehen mag, solange sie es nur weiß. In Trois Rivières hat sie, von mildtätigen Ursulinen aufs beste versorgt, mit jeder nur erdenklichen Todesart gerechnet. Haben die Kinder es in ihrem Gesicht gelesen?
Eine kühle Brise weht, als sie den Lake George hinuntersegeln, und plötzlich spürt sie ein köstliches Glücksgefuhl.
Die Landschaft um Fort Edward ist wunderschön, seltsam lethargisch und friedlich. Die Truppen lungern im Lager herum, manchmal exerzieren sie – aber die meiste Zeit gehen sie fischen oder streifen durch die Wälder und warten auf Bourgoynes Befehl, nach Albany vorzustoßen. Die Baronin wüßte gerne, worauf er eigentlich wartet. Von der amerikanischen Armee keine Spur, und Kundschafter bringen eine Botschaft nach der anderen, die besagen, daß der Feind den Hudson überquert und sich bis zum Mohawk zurückgezogen hat. Dieser Marsch durch ein von seinen Bewohnern verlassenes Land ist überhaupt nicht wie ein Krieg.
Nahezu vierzehn Tage lang hört man keinen Schuß, und doch ist ihr lieber Friedrich besorgt. Er kann nicht verstehen, wieso Bourgoyne den Männern befohlen hat, alles außer dem Allernötigsten abzulegen, und den Rest der Vorräte zurück nach Fort George geschickt hat. Natürlich, die Armee kann mit solch leichter Ausrüstung schneller vorrücken, aber dann müßten sie sich damit beeilen. Die Rationen sind bereits sehr mager. Was hält Bourgoyne zurück? General von Riedesel ist nahezu außer sich. Ohne Probleme haben sie Fort Ticonderoga und Fort George eingenommen – aber sie sind weitermarschiert – und haben so gut wie keine Truppen zum Schutz der eroberten Forts zurückgelassen, bloß eine Handvoll Männer. Die Amerikaner könnten sie nach Belieben zurückerobern. Und das würde bedeuten, daß sie von Kanada abgeschnitten wären.
Als sie später darüber nachdenkt, kann sich die Baronin nicht mehr erinnern, wann sie die ersten Gerüchte über die riesigen Vorräte in Bennington, an der nördlichen Grenze Neu-Englands gehört hat. Jeder scheint davon zu wissen. Sie seien so gut wie gar nicht bewacht. Es gäbe genügend Pferde für all die unberittenen Dragoner, Zugpferde für die schweren Vorratswagen, eine große Rinderherde und Scheunen voller Weizen und Gemüse. Die Soldaten haben Hunger. Man muß sie nur ansehen, um zu wissen, daß sie von immer kleineren Rationen leben müssen. Man hört nur noch ein Thema: Bennington. Eine Schlacht scheidet aus. Die Vorräte laden ja förmlich zur Eroberung ein.
Sechshundert Braunschweiger Dragoner brechen auf, der General ist nicht dabei. Ein Hauptmann würde ausreichen. Und dennoch steht Madame von Riedesel an diesem klaren Augustmorgen früh auf, um ihrem Aufbruch zuzusehen. Es sind alle über sechs Fuß große Männer, die Elite der herzoglichen Truppen. Sie folgt ihnen durch das hohe Gras und sieht sie in den düsteren, dichten Wald verschwinden. Sie winkt und ruft ihnen zum Abschied zu. Mühsam stapfen sie in ihren schweren Reitstiefeln mit den riesigen Sporen, die sich im Unterholz verheddern, voran, mit ihren lächerlichen Zöpfen und Federhüten, ihren klappernden, nutzlosen Säbeln, die sich in den Ästen und Büschen verfangen. Viele von ihnen sind Freunde aus ihrer Kindheit.
Tage vergehen ohne eine Nachricht. Die Männer tun ihre Pflichten, aber die Angst hängt wie ein schwerer Mantel über dem Lager.
Es ist erschütternd, daß Berichte über das tatsächlich Geschehene, als sie im Lager eintreffen, beinahe Erleichterung auslösen. Bourgoyne ist völlig falsch informiert gewesen. Mehr als zweitausendfünfhundert Mann bewachten die Vorräte in Bennington, und die Braunschweiger Abteilung war in weniger als zwei Stunden ausgelöscht.
Die Baronin notiert das Datum in ihr Tagebuch, 16. August 1777.
Wieviel Geld bedeutet das für den Herzog, bei 35 Dollar pro Kopf, für ihre Freunde, die niemals die Elbe, die Weser oder das liebliche Rheintal wiedersehen werden? Was, wenn ihr Friedrich mit ihnen gegangen wäre? Zufällig ist er es nicht. – Es ist kein Zufall, sondern Vorsehung. Gott selbst hat ihren Mann verschont. Er nimmt ihn ihr nicht weg, weil er weiß, wie sehr sie ihn liebt. Obwohl nicht herzlos, hat sie für die toten Männer keine Tränen übrig. Sie ist realistisch. Liebe ist selbstsüchtig. Die Männer anderer Frauen interessieren sie nicht. Nur eines ist wichtig: Friedrich ist in Sicherheit. Sie betrachtet ihn wie einen Besitz.
Die Riedesels leben, von englischen und deutschen Truppen umgeben, in einem roten Haus, mitten im Wald, wo sie bei gutem Wetter im Freien essen und mit den Kindern lachen und spielen. Bourgoyne ist gezwungen, nahezu einen Monat auf Nachschub vom Lake George zu warten, bevor er weitermarschieren kann. Madame von Riedesel berichtet in ihrer eleganten, für das 18. Jahrhundert typischen Schrift heiter von dem Glück dieser Tage und schließt allen Schrecken der Zukunft davon aus. »Als Folge der unglücklichen Geschehnisse in Bennington hatte ich das Glück, ihn – General von Riedesel – am 18. August wiederzusehen. Von da an verbrachten wir drei Wochen in erquicklicher Ruhe.« Die kleine Baronin kostet zum ersten Mal Bärenfleisch und ist begeistert.
Die Armee marschiert am 11. September weiter, und sie will unbedingt mit. Der General läßt für sie eine große Kalesche bauen, und seine Frau, die Kinder, zwei Dienstmädchen und Rockel schaukeln gemächlich, mit der Verzögerung einer Marschstunde, den königlichen Truppen hinterher. Die Soldaten sind guter Stimmung und singen, während sie »durch endlose Wälder und großartige, von ihren Bewohnern, die sich der Armee des amerikanischen Generals Gates angeschlossen haben, verlassenen Ländereien marschieren.« Am 13. setzt die Armee zum Westufer des Hudsons über und gelangt dann nur langsam vorwärts, höchstens ein paar Meilen am Tag, da Straßen freigemacht und Brücken instand gesetzt werden müssen.
Am 19. September bricht bei Freemans Farm, einige Meilen südlich von Saratoga, die verschollen geglaubte amerikanische Armee ganz unvermittelt aus dem Dickicht hervor. Diese riesige Horde Männer unter den Generälen Gates und Benedict Arnold, deren Uniform aus Bibermützen, grobem Wollstoff, Wildleder und Mokassins besteht, verhalten sich still wie die Indianer und schießen aus den Baumwipfeln – sie sind nahezu unsichtbar in den Herbstwäldern.
Hinter den Linien werden den ganzen Tag über die Verwundeten und Sterbenden in das Haus gebracht, in dem sich die Baronin und die Kinder aufhalten. Man hört die Schlacht in jedem Raum, das klare Geräusch der kleinen Geschütze, die Explosion der Kanonen. Die Kinder drängen sich wortlos zusammen und pressen sich gegen eine Wand, als böte sie Deckung – sie empfinden den Schrecken mehr, als daß sie ihn begreifen. Die Baronin läuft zwischen den Verwundeten umher und spricht mit ihnen in ihrem gebrochenen Englisch und flüssiger in ihrer tröstlichen, vertrauten Muttersprache Deutsch …
Ihr Friedrich treibt die Feinde zurück – jedenfalls verschwinden sie wieder in das hinter ihnen liegende Land. Wohin sind sie verschwunden? Wieviele sind dort? Albany scheint so weit entfernt wie Samarkand oder Bagdad.
Im Morgengrauen bewegt sich die königliche Armee vorwärts, schmutzig, zersprengt und erschöpft – dieses Mal nach Norden. Die Verwundeten stöhnen auf den Transportkarren, die für die Vorräte gedacht waren. Es ist ein langsamer, müder Rückzug, nicht sehr lang, nur ein paar Meilen den Hudson aufwärts. Die Männer reden untereinander leise, ohne Groll, eher mit einer melancholischen, gleichgültigen Hoffnungslosigkeit. Die Amerikaner haben Ticonderoga angegriffen und halten es praktisch im Belagerungszustand. Es ist nicht einmal möglich, bis Fort George zu gelangen, und die Flotte auf dem See zwischen den beiden Forts, die den britischen Nachschub sichern sollte, ist ebenfalls in der Hand der Rebellen. Ein schneller Rückzug nach Kanada steht nicht zur Debatte – sie sind gleichsam ausgesetzt. Wie lange können sie durchhalten? Was können sie tun?
Der Wind weht heftig, und es beginnt zu regnen, große Tropfen, die mit leichtem, deutlich knallendem Geräusch auf die von den Bäumen sich lösenden Blätter fallen, ein Blätterregen, der roten und gelben, durch einen Schuß aufgeschreckten Vogelschwärmen gleicht. Es riecht stark nach Balsam und frischer Erde. Das Geräusch des Regens vermischt sich mit den lauten Wogen des Hudsons, mit dem Ächzen der hölzernen Räder und mit dem schmatzenden Geräusch schwerer Stiefel, die in die aufgeweichte Erde einsinken. Die Verwundeten auf den Karren haben aufgehört zu stöhnen. Sie liegen ganz ruhig, mit geschlossenen Augen – manchmal schluchzt einer leise vor sich hin.
Die Nacht bricht herein. Die Männer verkriechen sich, wie bei einer geheimen Verschwörung, in ihren Zelten, die einer zerbrechlichen Nomadenstadt gleichen. Hinter den Linien zieht die Baronin wieder in ein verlassenes Haus, dessen Räume noch an die Familie erinnern, die darin in Frieden und Freude gelebt hat.
General Riedesel befindet sich bei der Hauptabteilung der Armee, die »mit kleinen Scharmützeln ohne erwähnenswerte Konsequenzen« beschäftigt ist. Die Baronin kann ihren Mann jeden Morgen besuchen, mit ihm Mittag essen, und von Zeit zu Zeit kann er zum Abendessen nach Hause kommen. Es ist kein richtiges Zusammenleben – sie gehört einfach zu ihm. Keiner weiß, wie lange dies alles dauern wird. Sie will sich ein eigenes Haus bauen lassen, eine Blockhütte aus wohlduftendem Fichtenholz. Der Bau wird nur ein paar Tage dauern. Dann kann Friedrich bei ihr sein, wo sie richtig für ihn sorgen kann.
Hilfe ist unterwegs, wenn die Truppen nur durchhalten. Wenn die Männer doch ihre elende Resignation überwinden, wenn sie soviel Kampfgeist aufbringen könnten, die sie umgebenden amerikanischen Linien zu durchbrechen, dann würden sie auf das britische Bataillon unter General Clinton stoßen, welches den Hudson aufwärts bis Kingston gesegelt ist und Nachschubposten der Rebellen zerstört hat. Gemeinsam könnten sie wieder südlich in Richtung Albany marschieren.
Am 7. Oktober beschließt Bourgoyne, mit fünfzehnhundert Mann einen Aufklärungsmarsch zu Freemans Farm zu machen, um zu erkunden, ob man es wagen kann, die Amerikaner anzugreifen. Die Männer bewegen sich mit einer Art bitterem Mut der Verzweiflung durch die aufgegebenen Felder. Sie marschieren, aber nicht wie eine Armee, sondern eher wie eine Schar Krieger. Sie marschieren bewußt zusammen und keiner hat irgendwelche Abschiedsworte ausgesprochen, denn das bedeutete, nicht an ein Gelingen zu glauben. Dies zuzugeben wäre das Ende, und so rufen sich die Männer dann und wann joviale, muntere Bemerkungen zu. Keiner erwähnt England oder Deutschland – oder das, was vor diesem Marsch passiert ist.
Madame von Riedesel und die Kinder sehen sich das Blockhaus an, das schon beinahme bezugsfertig ist. Die Kinder stochern hier und da an dem Mörtel zwischen den Balken herum, der den Wind abhalten soll. Es ist ein himmlischer Ort, und die kleinen Mädchen quietschen vor Vergnügen.
Aber jetzt müssen sie artig sein und bei Lena, dem Kindermädchen, bleiben. Sie müssen jetzt kleine Damen sein und nicht herumstrolchen – denn Mutter hat heute nachmittag viel zu tun. Papa bringt die drei anderen Generäle, Bourgoyne, Phillips und Fraser, zum Abendessen mit.
Es würde, trotz knapper Rationen, ein schönes Essen werden. Rockel hat genügend Forellen gefangen, und sie hat der Verpflegungsstelle zwei Hühner abschmeicheln können. Jetzt braten sie in dem holländischen Ofen neben dem Kamin in der Küche. Bourgoyne ist ein Feinschmecker. Sie möchte, daß das Essen besonders gelingt.
Sie mag Bourgoyne nicht. Er ist ein zügelloser Trunkenbold, allzu schnell bei der Hand mit flammenden, immer etwas ironisch klingenden Komplimenten. Seine Schamlosigkeit ist kompromittierend. Er nimmt seine Geliebte öffentlich überall mit hin. Man sagt, er habe zu Hause eine Frau, die er aufrichtig liebe. Wie kann das sein? Aber Männer verhalten sich seltsam in solchen Dingen – jedenfalls ist es gut gewesen, daß sie nach Amerika gekommen ist – obwohl sie sich Friedrich nicht mit einer anderen Frau vorstellen kann.
Der Tisch sieht bezaubernd aus. Im Haus gibt es schönes Porzellan und echtes Silber. Sie hat das Zimmer mit den buntesten Herbstblättern, die sie finden konnte, geschmückt. Wo bleiben die Männer? Friedrich ist sonst immer pünktlich. Der Braten wird verderben. Vom Fenster aus kann sie beträchtliche Truppenbewegungen, sogar in den hintersten Linien, wahrnehmen. Über den fernen Wäldern hängt ein dichter Nebel aus schwarzem Rauch, und plötzlich erschüttert das dumpfe Grollen der Kanonen das Haus. Die Kinder sind mit Lena in der Küche. Essen hin oder her, sie möchte sie bei sich haben.
»Lena, bringe die Kinder zu mir, sofort, hörst du?«
Sind es englische oder amerikanische Kanonen? Die schweren Geschütze sind von der Flottille nicht mehr geliefert worden, und diese ist jetzt auch noch in der Hand der Amerikaner. Lieber Gott, lasse es diesmal gut ausgehen!
Am Rande der Lichtung befindet sich ein Beet Astern, die verwelkt auf ihren geschwärzten Stengeln die Köpfe hängen lassen. Genau an dieser Stelle treten aus dem Dickicht zwei Männer mit einem Schubkarren, auf dem ein Mann liegt. Es kann doch nicht sein … Sie wirft einen Schal um und rennt los.
Es ist General Fraser, der junge Earl von Balcarres. Seine Kleider sind schmutzig und blutig. Seine blauen Augen müssen sich bereits anstrengen, die anwachsende Dunkelheit zu durchbrechen. Er hat einen Beckenschuß erlitten. Noch stärker als die atemlose Erleichterung der Baronin ist ihre lähmende Scham. Sie versucht, die Lippen anzufeuchten, aber ihre Kehle ist trocken. General Fraser schaut sie an, als kenne er ihre Gefühle, und er lächelt ihr, unter all seinen Schmerzen, bestätigend, fast humorvoll zu. Er versucht, den ernst dreinschauenden Kindern zuzunicken, als man ihn in ihr Zimmer trägt. Er ist ein liebenswürdiger junger Mann und so ein guter Soldat, sagt ihr Mann.
Für General Fraser kommt jede Hilfe zu spät. Das weiß sie sofort. Er stöhnt erbarmungswürdig nach Wasser, aber sie können es ihm nicht geben – das wäre zu schmerzhaft. Die Geschütze dröhnen den ganzen Nachmittag. Sie verstummen auch nicht bei Sonnenuntergang. Am Abend kommt ihr Mann mit Bourgoyne. Bourgoyne setzt sich neben den jungen Earl, hält seine Hand, streicht ihm das feuchte Haar aus der Stirn und weint ganz offen vor den Kindern, was sie selbst niemals tun würde. Nach dem Ausgang der Schlacht braucht man nicht zu fragen. Sie muß nur in Friedrichs verwirrtes und eingefallenes Gesicht sehen, um zu wissen, daß es Unheil bedeutet.
Gustava, Friederike und Caroline schlafen jetzt. Sie würden vergessen. Aber die kleine Baronin sitzt noch Stunden da und betrachtet ihre Kinder. Sie wagt nicht, sich an ihren Mann zu wenden, der bitter gedemütigt dasitzt. Sie ist »ständig in Angst, die Kinder könnten aufwachen und weinen und so den armen Sterbenden stören, der sich immer wieder für die Umstände entschuldigt, die er macht.«
Der Morgen bricht an und dann der Mittag, und den ganzen Tag geht das Schießen sporadisch weiter – sogar in der Abenddämmerung, als sich der gesamte Generalstab auf einer Hügelkuppe zu General Frasers Begräbnis versammelt. Die Dunkelheit wird von plötzlichen Blitzen erleuchtet. Kanonenkugeln fliegen um und über die Männer. Ein dünner Nieselregen fällt, als man den Leichnam zur letzten Ruhe bettet und General Bourgoyne mit zögernder, tiefbewegter Stimme einige Worte spricht. Die Soldaten packen ihre Marschvorräte ein. Es regnet noch immer, als sie in jeder Himmelsrichtung Feuer entzünden und ihre Zelte zurücklassen, ein hoffnungsloser und kindischer Versuch, ihren Rückzug zu verbergen.
Die ganze Nacht hindurch schleppt sich die Armee mühsam durch die Wälder. Die Baronin, ihre Kinder und Dienstboten befinden sich wieder in der Kalesche. Caroline und Gustava schlafen tief und fest, aber Friederike beginnt, ängstlich zu weinen. Sie fürchtet sich vor den geheimnisvollen Wäldern und dem verzweifelten Schweigen der Männer. Ihre Mutter preßt ihr ein Taschentuch auf den Mund.
Um sechs Uhr morgens ordnet Bourgoyne eine Pause an. Die Soldaten schlafen auf der Erde; sie sind zu müde, sich um den Regen zu kümmern. Baron von Riedesel schläft an der Schulter seiner Frau drei Stunden lang. Dann marschiert die Armee, den Feind immer in Sichtweite, umgeben von versprengten Indianern, weiter in Richtung Heimat. Gegen Abend, bei Saratoga, schlagen die Männer ein Lager auf.
Ihre einzige, verzweifelte Hoffnung zu entkommen liegt in einem schnellen Rückzug nach Fort Edward, und die Baronin richtet an General Phillips indigniert die Frage, wieso sie nicht weitermarschieren, solange noch Zeit dazu ist.
»Gute Frau«, sagt er, »Sie versetzen mich in Erstaunen! Sie sind durch und durch naß und haben dennoch den Mut, weitergehen zu wollen, bei dem Wetter! Wären Sie doch unser kommandierender General! Er hält an, weil er müde ist und weil er hier die Nacht verbringen und uns ein Abendessen geben will!«
Am nächsten Tag um zwei Uhr haben die Amerikaner sie eingeholt und eröffnen das Feuer. Die Baronin setzt sich mit den Kindern in die Kalesche und flüchtet zu einem verlassenen Haus am Hudson. Als sie die Einfahrt erreichen, sieht sie fünf oder sechs Männer mit auf sie gerichteten Gewehren auf der anderen Flußseite. Unwillkürlich wirft sie die Kinder auf den Boden der Kalesche und sich selbst schützend darüber. In diesem Moment feuern die Männer und zerschmettern den Arm ihrer Eskorte, eines unglückseligen, englischen Soldaten.
Die Kinder schreien, als sie sie zur Haustüre zerrt. Sie flüchten sich in den Keller. Das Haus liegt Tag und Nacht unter dem Beschuß der Kanonen, deren Kugeln mit ohrenbetäubenden Schlägen gegen die Wände donneren. Madame Riedesel legt sich in eine Ecke in der Nähe der Tür. Die Kinder liegen auf der Erde, die Köpfe in ihrem Schoß, und weinen. Es hat jetzt keinen Sinn, mit ihnen zu sprechen …
Sie fürchtet sich nicht mehr. Es ist erstaunlich, wie einfach ihr Leben geworden ist: reduziert auf etwas, das es zu schützen galt. Um wieviel komplizierter ist ihr Leben mit sechzehn gewesen, umschwärmt von all den jungen Offizieren. Ihr Leben war erfüllt von halbgelungenen Intrigen, plötzlichen Eingebungen, die sie später bereute, und von einer unverständlichen, schmerzlichen Sehnsucht. Doch an dem Tag, als sie Friedrich traf, passierte etwas in ihrem Herzen. Sie heirateten am 21. Dezember 1762, drei Tage vor Weihnachten. Ist das schon so lange her?
Kein Mädchen hatte je eine prächtigere Hochzeit. Sie erinnert sich an die tanzenden Bauern, die fahnengeschmückten Häuser, die Parade der Adjutanten und Offiziere, wie sie in ihren Ausgehuniformen die Straßen auf und ab gallopierten. Mit Geschenken beladen, kamen die Bauern und Stadtleute aus ganz Braunschweig zum Anwesen ihres Vaters. Wichtige Persönlichkeiten, Herzog Ferdinand, Prinz Friedrich, hatten sich, als Geschenk für sie, in Lebensgröße porträtieren lassen. Die Bilder hängen jetzt in der langen Eingangshalle in Wolfenbüttel – wird sie sie jemals wiedersehen? Und kurz vor ihrer Hochzeit waren die hübschesten Mädchen Braunschweigs ausgewählt worden, um für ein Gemälde zu posieren, das die vier Jahreszeiten darstellen sollte. Sie trug ein Kleid in zartestem Grün, im Arm lauter Maiglöckchen und Veilchen, ihr Kopf von zarten, weißen Blüten umkränzt, deren Blätter mit ihren blonden, hüftlangen Haaren, verschlungen waren. Sie verkörperte den Frühling.
Langsam gewöhnen sich ihre Augen an die Dunkelheit, und sie kann die Gesichter um sie herum unterscheiden: ihre Mädchen; eine große Zahl verwundeter Soldaten, zwei fremde Frauen. Keiner sagt ein Wort. Was denken sie, diese stummen, geisterhaften Leute?
Das Haus bebt, als nochmals eine Kanonenkugel einschlägt. Gustava und Caroline schlafen jetzt, ihre Tränen trocknen langsam auf ihren Wangen. Nur Friederike weint noch herzerweichend. Immer Friederike, sie ist ein geplagtes Kind. Sie soll damit aufhören. Aber sie tut es nicht.
Einer der verwundeten Offiziere bietet seine Hilfe an. Er setzt sich neben der Baronin auf den Boden. »Magst du Kätzchen, ganz kleine Kätzchen?«
Das Kind antwortet nicht.
Er miaut. Man glaubt das graue, wollige Fell, die kleinen, spitzen Ohren und die großen Augen mit den dunklen Pupillen zu sehen. Dann schnurrt er, ein tiefes, zufriedenes Schnurren.
»Hier ist ein kleines Lämmchen, das seine Mutter verloren hat.« Er blökt traurig. Das Schluchzen des Kindes läßt etwas nach. Sie wendet ihm ihr unglückliches kleines Gesicht zu. Die Kanonen donnern wieder. Friederike zittert heftig, aber sie weint nicht mehr.
Er ist ein Zauberer. Er ist ein Hund, ein Wolf oder ein Löwe. Er ist eine Henne, die gerade ein Ei legt, oder ein Hahn, der triumphierend kräht. »Darf ich die Kleine nehmen? Sie müssen sehr müde sein, Madam.«
Vertrauensvoll begibt sich das kleine Mädchen in seine Arme, spricht mit ihm und lacht leise. Bald schläft sie ein, und das abgespannte Gesicht des jungen Offiziers ist genauso friedlich wie das des Kindes.
Am Morgen liegt das Haus unter Beschuß von der anderen Seite, aber die Baronin ist es schon etwas gewohnt. Es dringt ausreichend trübes Licht in den Keller, so daß sie die drei großen, modrigen Räume inspizieren kann. Madame Riedesel nimmt alles in die Hand. »Ich riet allen, eine Zeitlang den Keller zu verlassen, währenddessen ich ihn säubern wollte, damit wir nicht alle krank würden. Sie befolgten meine Aufforderung, und ich ging sogleich ans Werk, was mehr als notwendig war: denn Frauen und Kinder, die sich nicht ins Freie trauten, hatten den ganzen Keller beschmutzt.« Die Räume werden ausgefegt und ausgeräuchert, indem man Essig auf glühende Kohlen spritzt. Die Schwerverwundeten werden in einem Raum, Frauen und Kinder in einem anderen und alle übrigen in einem dritten untergebracht.
Sechs Tage lang halten sie sich in dem Keller auf, sie leben, inzwischen an die Dunkelheit gewöhnt, wie in einer versunkenen Welt. Wasser ist knapp und kann nur unter größter Lebensgefahr hereingebracht werden, dennoch stehlen sich die Männer hin und wieder hinaus, weil sie das Stöhnen der Verwundeten nicht mehr ertragen können. Es gibt kaum etwas zu essen, und nur die Kinder spüren den Hunger nicht. Einmal zerbersten elf Kanonenkugeln, eine nach der anderen, im Haus. Einem Soldaten, dem gerade ein Bein amputiert werden soll, wird das andere Bein während der Operation weggeschossen. Er stirbt sofort! Es ist keine Zeit für Verzweiflung. Der Baronin wird bewußt, wie unbeirrt das Leben weitergeht, auch unter diesen düstersten Umständen.
Am 13. Oktober erklärt sich Bourgoyne bereit, mit dem Feind zu verhandeln. Am 17. Oktober 1777 kapitulieren die Briten. Unter dem Kommando ihrer eigenen Offiziere marschieren die Truppen durch das amerikanische Lager und legen ihre Waffen nieder.
MADAME VON RIEDESEL FÜRCHTET, die siegreichen Amerikaner könnten sie grob und verächtlich behandeln. So wagt sie kaum, die Augen zu erheben, als ihr Mann nach ihr schickt und sie am Nachmittag der Kapitulation durch das Lager der Rebellen reitet. Die Kinder sehen benommen aus, als sie sie das erste Mal aus dem Keller ans Tageslicht führt – ihre Augen sind wie die neugeborener Babys, die unterschiedliche Helligkeit wahrnehmen, aber keine Gegenstände, und sie ist überrascht, daß sogar sie selbst das fahle Licht dieses grauen Tages als zu grell und überwältigend empfindet. Sie hat das benommene Gefühl völliger Leere, und als ein älterer Mann auf sie zukommt, die Kinder aus dem Wagen hebt, ihnen einen Kuß gibt und dann ihr beim Aussteigen hilft, beginnt sie zu zittern.
»Sie brauchen keine Angst zu haben«, sagt der Mann halb entschuldigend. »Ich bin General Schuyler.«
Das also ist der Kommandeur der amerikanischen Nordtruppen! Er ist ein Gentleman. Aber was hat sie denn erwartet? Als könne er ihre Gedanken lesen, schießt ihr das Rot in die Wangen. Dann jedoch erholt sie sich und versichert ihm, sie könne keine Angst vor einem Mann haben, der so zärtlich mit Kindern umgehe.
In General Gates Zelt findet sie ihren Mann, Bourgoyne und Phillips, die so liebenswürdig mit Gates und Benedict Arnold plaudern, als seien sie alte Freunde. Sie werden zusammen zu Abend essen.
General Schuyler glaubt, sie fühle sich vielleicht als einzige Frau unter so vielen Männern unwohl, und bringt sie zu seinem eigenen Zelt, wo er ein Festmahl für sie vorbereitet hat. Er hat eine besondere Art mit Kindern umzugehen, einen drolligen, feinen Witz, und sofort scharen sie sich kichernd um ihn. Sie ertappt sich, daß sie ihm, dem Feind, vertraut, und als er sie und ihre Familie in sein Haus nach Albany einlädt, General Bourgoyne würde auch da sein, nimmt sie sofort an.
Endlich in Albany, aber als Kriegsgefangene! General Schuyler, seine Frau und seine Töchter sind so zuvorkommend, daß man den zwischen England und Amerika herrschenden Krieg nicht wahrnimmt. Es ist erstaunlich, daß sie so freundlich zu General Bourgoyne sind, »obwohl er ihre prächtigen Häuser niederbrennen ließ – ohne Notwendigkeit, wie man behauptet. Aber sie benahmen sich uns gegenüber wie ein Volk, das sein Unglück angesichts der Verluste anderer vergessen kann.«
Sie bleiben drei Tage, und die Baronin wäre gerne noch länger geblieben. Aber sie müssen nach Boston. Unter der Bedingung, daß sie nicht mehr am Revolutionskrieg gegen die Amerikaner teilnehmen würden, hat General Gates versprochen, alle Truppen nach England zurückzusenden, sobald man ihm Schiffe schicke.
Es ist schwierig, ihren Mann aus seiner Niedergeschlagenheit zu reißen. Hätte sie ihn davon abhalten können, ständig an die Niederlage zu denken, wäre die Reise von Albany recht angenehm gewesen.
Wie seltsam doch die Amerikaner sind! Einige der begleitenden Generäle sind Schuster und schämen sich ganz und gar nicht, ihr Handwerk auszuüben. An Rasttagen machen sie Stiefel für die Offiziere und reparieren sogar die Schuhe der gemeinen Soldaten. Einmal hört sie, wie ein englischer Hautpmann, dessen Stiefel zerfetzt waren, einem amerikanischen General, der ein gutes Paar Stiefel besaß, eine Guinee dafür bietet. Der General steigt sofort von seinem Pferd, nimmt das Geld, zieht seine Stiefel aus und die kaputten des Offziers an! Natürlich, amerikanisches Geld ist damals so gut wie nichts wert. Aber das hier ist ein neues Land!
Die Truppen dürfen nicht nach Boston hineinmarschieren. Etwas ist geschehen. Der Kongreß konnte sich nicht darauf einigen, die Gefangenen freizulassen. Sie müssen warten. Die Soldaten werden in elende Baracken einquartiert, ohne Böden, es gibt nicht einmal ein wenig Stroh, um darauf zu schlafen, kein Feuerholz, aber undichte Dächer, durch die es hereinregnet. Sogar den Riedesels wird nur ein winziger Raum auf einem Bauernhof zugewiesen. Die Mädchen müssen auf dem Boden schlafen und die Männer im Flur. Es ist schmutzig, und die Bauernfamilie haßt sie.
Und doch ist der General erzürnt, als sie nach Cambridge beordert werden. Nach Boston sollten doch die Schiffe kommen, die sie zurück nach England bringen würden. Jetzt ist alles unsicher geworden. Bourgoyne ist so töricht gewesen, sich auf das Wort General Gates zu verlassen. Der General läuft in dem winzigen Zimmer auf und ab, und seine Frau leidet mit ihm.
Cambridge ist eine reizende Stadt. Sie sind in einem schönen Haus untergebracht, das früher Royalisten gehört hat. Während des langen Winters verläuft ihr Leben heiter und bequem. Sie freundet sich mit vielen amerikanischen Familien an, und diese hätten nicht freundlicher sein können. Der Frühling kommt, ihr Garten ist voller Blumen, Flieder, Phlox und Hyazinthen.
Im Juni gibt sie anläßlich des vierzigsten Geburtstages ihres Mannes ein Abendessen und einen Ball. Sie lädt dazu sämtliche Generäle und Offiziere ein. Haus und Garten sind von Fackeln erleuchtet, deren Licht weich auf die weißen, rosafarbenen und roten Kletterrosen fällt. Während des Essens erhebt sich ihr Mann, bringt einen Trinkspruch auf den König und den Herzog von Braunschweig aus, und alle singen God Save the King. Plötzlich ist das Haus von aufgebrachten Amerikanern umringt. In Neu-England nämlich sind brennende Fackeln ein Zeichen für drohende Gefahr, jeder gesunde Mann läßt dann sofort seine Arbeit stehen, ergreift sein Gewehr und eilt in Richtung des Signals. Die Baronin hat ihr Haus so hell erleuchtet, daß die Amerikaner gedacht haben, es sei Alarm und die Gefangenen planten eine Meuterei. Als sie erfahren, daß es sich um eine Festlichkeit handelt, entschuldigen sie sich und kehren sofort wieder um.
Madame Riedesel ist ein gesellschaftlicher Erfolg. Ihr Haus »ist immer voller englischer Gentlemen«, wie sie stolz in ihrem Tagebuch vermerkt. Die Leute mögen sie, sie ist beliebt und wird respektiert. Einer ihrer Besucher in dieser Zeit nennt sie »die liebenswerte, kultivierte und vornehme Baronin«. Er schwärmt auch von ihren »entzückenden blauen Augen, die sich mit Tränen füllen, wenn sie von ihren Leiden erzählt«. Sie hätte »ausreichend embonpoint und ein hübsches Gesicht«, fügt er hinzu.
Ihr Mann dagegen wird immer trübsinniger. Er verbringt die meiste Zeit damit, an einem militärischen Memoire zu arbeiten, in dem er den Feldzug von 1777 beschreibt und analysiert. Es soll seine endgültige Rechtfertigung und Entschuldigung darstellen.
Er beginnt seinen Bericht mit folgender bezeichnenden Aussage: »Vom Anfange der Campagne im Jahre 1777 ist der General Riedesel weder in den Kriegsrat der englischen Generalität, die Bewegungen dieses Feldzugs betreffend, zugelassen, noch sind demselben die Instruktionen mitgeteilt worden, die der General Bourgoyne vom englischen Ministerium erhalten hatte.« Seinen eigenen Angaben zufolge, konnte er nur »Bourgoynes Anordnungen unter allen Umständen mit größter Genauigkeit ausfuhren.« Also ist Bourgoyne allein verantwortlich für das, was geschehen ist. Er und niemand sonst ist schuld. »Ich bin unschuldig«, versichert der deutsche General.
Riedesel weiß offenbar nicht oder will es nicht wahrhaben, daß Bourgoyne seinerseits das Opfer einer Verwechslung des englischen Kriegsministers geworden ist. Als sich der General im November 1776 auf Urlaub in London aufhält, nimmt er die Gelegenheit wahr, König Georg III. und dem Kriegsminister, Lord George Germaine, einen Plan für den Amerikafeldzug von 1777 vorzulegen. Er schlägt vor, eine Armee solle von Montreal aus nach Süden, eine zweite von Oswega aus nach Osten und eine dritte von New York aus nach Norden marschieren – alle drei sollten sich bei Albany treffen, Neu-England von den anderen Staaten abschneiden und dabei ausreichend Truppen zum Schutze Kanadas zurücklassen. Der Plan wird für gut befunden. Bourgoyne erhält das Kommando über die nördliche Armee und den Befehl, nach Albany zu marschieren und sich dort mit General Howe zu treffen. Nur, Howe weiß nichts davon.
Im Dezember des gleichen Jahres schreibt General Howe, der mit ungefähr zwanzigtausend Mann in New York steht, an Lord Germaine und schlägt einen anderen Plan vor, in dem er zusätzliche dreißigtausend Mann anfordert, um gegen Neu-England und New Jersey vorzugehen und den Süden zu halten. Germaine antwortet, der König denke wohlwollend über seinen Plan nach, schlage aber auch einen Ablenkungsangriff der Truppen auf die Küsten Massachusetts' und New Hampshires vor. Dies ist der letzte Brief, den Howe von Germaine erhält, ehe er im folgenden Sommer nach Philadelphia aufbricht.
Riedesel unterbreitet bis zum bitteren Ende der Tragödie immer wieder hilfreiche und vernünftige Vorschläge, die von dem arroganten und verantwortungslosen General Bourgoyne verächtlich abgetan werden. Wären die Dinge nach den Vorstellungen des deutschen Offiziers verlaufen, gehörte Amerika womöglich heute noch zum britischen Empire.
Im November 1778 werden die Gefangenen nach Virginia beordert. Die Baronin empfindet Trauer und Bedauern bei dem Gedanken, ihre zahlreichen neuen Freunde und das liebgewonnene Haus verlassen zu müssen. Es fällt ihr schwer, wieder über Land zu reisen. Die Kinder finden das allerdings aufregend. Sie freuen sich lautstark über die elegante englische Kalesche und den gedeckten Wagen für die Vorräte, die ihr Vater für sie gekauft hat, und tun so, als wären sie alle Zigeuner. Es ist jetzt November, und es würde eine lange Reise werden.
Sie erreichen Virginia Mitte Februar 1779. Sie kamen durch Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania und Maryland und legten in zwölf Wochen sechshundertachtundsiebzig englische Meilen zurück. Es ist eine harte Reise. Die Straßen sind die meiste Zeit eisbedeckt, es regnet, schneit, und es weht ein schneidendkalter Wind. Oft übernachten sie in den Wäldern, wo die armen, zu Fuß marschierenden Soldaten, in tiefen Felsritzen oder im Dickicht schutzsuchend, auf der blanken Erde lagern müssen. Die Riedesels schlafen in ihrem Wagen, aber es ist unmöglich, die Kinder ausreichend warm zu halten. Wenn sie in der Nacht weinend aufwachen, singt ihnen die Baronin deutsche oder kleine französische Volkslieder vor.
Nach der Reise gibt es für Madame von Riedesel keinen Zweifel mehr über das Verhältnis der Amerikaner zu ihrem Mutterland. Während ihrer Reise denkt sie oft an Bourgoynes naive Hoffnung, Tausende Königstreuer würden sich unter des Königs Banner stellen. Die Amerikaner haben den Krieg noch nicht gewonnen – aber sie sind keine Siedler mehr. Sie sind eine Nation.
Oft will man den Riedesels keine Vorräte verkaufen. Auf ihre Bitte, ihnen irgendetwas zu verkaufen – ein bißchen Gemüse – ein paar Eier – schreit sie eine Dame grob an: »Ihr sollt keinen Krümel erhalten. Ihr seid in unser Land gekommen, um uns zu töten und unseren Besitz zu verwüsten. Jetzt seid ihr unsere Gefangenen.« Aber als die kleine Caroline, nunmehr zweieinhalb Jahre alt, sagt, daß sie Hunger habe, gibt ihnen die Frau ganz beschämt alles, was sie wollen. In Virginia, lediglich eine Tagesreise von ihrem Ziel entfernt, besitzen sie nur noch Tee. Die Baronin bettelt bei den Bauern um Essen für die Kinder. Den »Royalisten-Hunden« würden sie nichts verkaufen …
Im Haus eines Oberst Howe hört sie, wie seine hübsche, vierzehnjährige Tochter beim Anblick glühender Kohlen ausruft: »Oh! Wäre doch der König von England hier, mit welcher Genugtuung würde ich ihn in Stücke schneiden, sein Herz herausreißen, es auseinandernehmen, auf diese Kohlen legen und verzehren.«
Die Baronin schaut sie mit Entsetzen an. »Ich schäme mich fast, einem Geschlecht zuzugehören, das imstande ist, sich solche Vergnügungen auszudenken.«