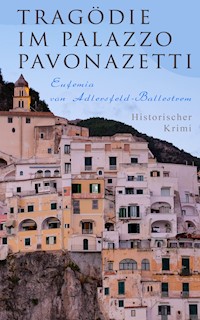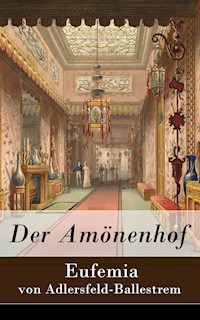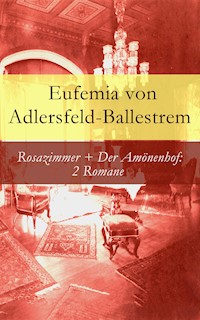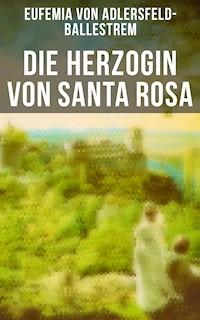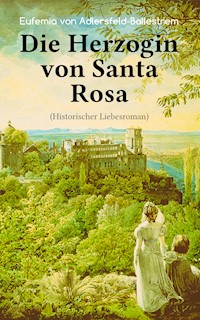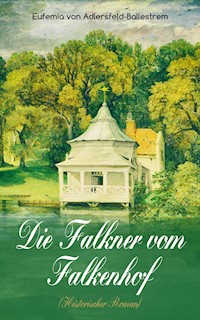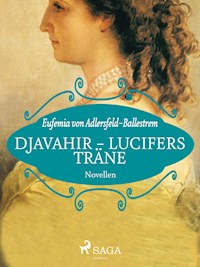
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Die beiden Novellen sind Vorläufer der Spionage-Romane a la Forsyth. "Djavahir" erzählt von Graf Max von Westermann, Leutnant und Attaché in Rom. Seine Schwester, die jung verwitwete, bildhübsche Freifrau von Triberg, bringt eine neue, nicht minder schöne Hausgenossin mit, die blonde Russin Fürstin von Woszgorod. Während sich Maxens Chef langsam, aber stetig in dessen Schwester verliebt, gerät Max selber in den Bannkreis der geheimnisvollen Fürstin. Als eines Tages eine Depesche verloren geht, die Max seiner Königin überbringen soll, "brennt der Baum". Max wird vom Botschafter weggeschickt und ein Privatdetektiv ermittelt "gegen die Meisterspionin von Woszgorod". Doch am Ende stellt sich heraus, dass die Meisterspionin eine abgelegte Frau des verstorbenen Fürsten war – und der Brief versehentlich unter die Tischdecke geriet."Lucifers Träne" ist eine kurze Novelle mit tragischem Ausgang. Am 18. März 1853 verschwindet die Philanthropin Fürstin Sonja Sergienskow; vermutlich ist sie tot. Mit ihr verschwunden ist ein geheimnisvoller Schmuck – eine unermesslich wertvolle Perle –, Lucifers Träne benannt. Dieser Schmuck taucht viele Jahre später in der Hand der völlig verarmten Malerin Astrid Tellgrem auf. Was hat die Schwedin mit Russland zu tun?Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem (1854–1941) war eine deutsche Schriftstellerin, die um 1900 zu den beliebtesten deutschen Unterhaltungsschriftstellerinnen zählte. Sie war eine der wenigen deutschen Autorinnen des 19. Jahrhunderts, die ihre Werke nicht unter einem Pseudonym verfasste. Ihr erstes Werk "Die Nichten des Kardinals" veröffentlichte sie bereits mit 17 Jahren 1871 unter ihrem Geburtsnamen Eufemia Gräfin Ballestrem. Es folgten Gedichte, Novellen, Humoresken und über 40 Romane. Etwa ab 1910 legte sich die Autorin ganz auf das Schreiben von Romanen und Belletristik fest und veröffentlichte in der Regel einen Roman pro Jahr. Ihre wichtigsten Romane sind zweifelsohne die sogenannten "Windmüller"-Romane um den Gentleman-Detektiv Dr. Xaver Windmüller, die meist in aristokratischen Kreisen spielen. Mit den Romanen "Falkner vom Falkenhof", "Trix" und "Die weißen Rosen von Ravensberg" lieferte sie für die damalige Zeit außerordentliche Bestseller, von denen bis zu 120 Auflagen erschienen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem
Djavahir - Lucifers Träne
Zwei Novellen
Saga
Djavahir - Lucifers Träne
German
© 1919 Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711517666
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Djavahir.
„Much Ado about Nothing.“
And, Max, nicht wahr, du vergisst nicht die Mutter Mollwitz — bitte, bitte! Sie hängt mich verkehrt auf, wenn sie hört, dass ich hier bin! Sei ein guter Junge und denke ja daran! Und noch eins, Max, wie gefällt sie dir?
„Die Mutter Mollwitz? Na, hör’ mal —“
„Ach, Unsinn — ich meine —“ und eine Handbewegung nach rückwärts ersetzte die fehlenden Worte.
„Mhm!“ war die ganze, aber vielsagende Antwort. „Na, also, adieu und auf Wiedersehen, Therese!“
„Auf Wiedersehen, Max!“
Die Szene dieses Gespräches war das weite, geräumige, freskengeschmückte Treppenhaus eines römischen Renaissancepalastes; die redenden Personen waren Max Graf Westermann, Leutnant bei den 30. Ulanen und kommandiert zur XYZschen Gesandtschaft, und seine Schwester, die junge verwitwete Freifrau v. Triberg, die nun die halboffne Tür mit freundlichem Kopfnicken hinter sich schloss, indes ihr Bruder langsam die breite Marmortreppe zum zweiten Stockwerk emporstieg, wo seine Zimmer lagen. Dort angelangt, zog er den Überzieher an, nahm Hut und Handschuhe und warf noch einen Blick in den Spiegel, einen langen Blick, aber es schien, als ob er sich selbst gar nicht damit sah. Eine Schönheit war er ja nicht, was man hier in Rom so unter Schönheit verstand; aber er war trotzdem ein ganz hübscher Mensch, gross, wohlgewachsen, mit offenen, männlichen Zügen, denen der „schneidige“ Schnurrbart etwas Martialisches gab, welchem Ausdruck aber die gutmütigen, freundlichen und dabei fröhlichen Augen in etwas widersprachen. Er rückte sich die Krawatte zurecht und sah in dem Spiegel dabei gar nicht einmal auf dies zartgetönte Meisterwerk der letzten Mode mit dem kleinen goldnen Hufeisen als Nadel darin, er sah vielmehr statt sich selbst eine gertenhaft biegsame Gestalt mit krausem Haar von der Farbe eines reifen Ährenfeldes und darunter ein zartes, liebreizendes Gesicht mit Grübchen in den Wangen, auf denen ein Hauch von dem Farbenton der wilden Rose ruhte.
„Max, mein Sohn, was fällt dir ein?“ damit riss der Attaché sich mit Gewalt los von dem holden Bilde im Spiegel, das nur er sah. „Ist dir der Schirokko in den Kopf gestiegen? So schnell? Oder ist an dir erfüllt, was Scheffel vom ‚Trompeter‘ sagt: ‚Den Mann hat’s?‘ Nach der ersten Viertelstunde? O! o! Machen wir also, dass wir zur Mutter Mollwitz kommen.“
Und er ging, aber immer noch nicht wie gewohnt, mit schnellen Schritten, die Aufmerksamkeit auf alles gerichtet, was ihn umgab und ihm begegnete, denn er pflegte offnen Auges um sich zu schauen, sondern langsam, nachdenklich, mit in sich gerichtetem Blick, kurz, wie ein Mensch, den eben ein Gedanke ganz erfüllt.
Nun war die „Mutter Mollwitz“ im gewöhnlichen Leben und für die Gesellschaft eigentlich Ihre Exzellenz die verwitwete Frau Staatsminister Melanie v. Mollwitz, die ihrem Bruder, dem Botschafter und Chef des Leutnants Graf Westermann, wie man so sagt, die Wirtschaft führte, das heisst, seinem Hause, dem immer noch die Hausfrau fehlte, als Repräsentantin vorstand und die Honneurs der Gesandtschaft machte. Die Wirtschaft führte sie dabei auch noch gründlich, nicht nur dem Namen nach, und es war, so weit der Name Mollwitz reichte, sattsam bekannt, dass die gute Dame an der deutschen Hausfrauenkrankheit, der „Scheuralgie“, litt, vor der selbst die höchste Lebensstellung nicht schützt. Mit dem blossen Staubabwischen kostbarer Nippes und persönlichem, gelegentlichem Überwachen häuslicher Arbeiten begnügen sich die also „Behafteten“ dann ebensowenig, wie Ihre Exzellenz es tat. Schon in den seligen Tagen, da der häusliche Dulder v. Mollwitz am Ruder eines Staatsschiffs sass, hatte man Ihre Exzellenz oft dabei ertappt, wenn sie die Treppe fegte, die Wäsche im Vorgarten des Staatsministeriums aufhängte oder im Vestibül die Unaussprechlichen Seiner Exzellenz mit der Klopfpeitsche bearbeitete, dass es eine Lust war zu sehen, und nun, als Repräsentantin Seiner Exzellenz des Botschafters v. Grünholz, setzte sie diese ihr so lieben Beschäftigungen mit gleicher Energie und Lebendigkeit fort zum Gaudium des gesamten diplomatischen Korps und zum masslosen Erstaunen der Gesellschaft des schwarzen wie des weissen Roms. Da sie es aber sonst mit ihren repräsentativen Pflichten ernst nahm, schon weil sie persönlich die Geselligkeit liebte, so drückte man über ihre häuslichen Eigentümlichkeiten und Liebhabereien gern ein Auge zu und besuchte die Salons der Gesandtschaft mit grossem Eifer; nicht, weil die Verpflegung dort besonders gut und reichlich gewesen wäre — das konnte kein Mensch behaupten — sondern weil man sich vor dem Mundwerk Ihrer Exzellenz fürchtete. „Die Mutter Mollwitz“ wurde sie, hinter ihrem Rücken natürlich nur, von aller Welt genannt, gleichgültig, ob man es Mutter, mère, madre oder matuschka aussprach; wer die Bezeichnung aufgebracht, wusste man eigentlich nicht mehr genau, aber wir dürfen schon verraten, dass es Max Westermann war, der die energische Dame nie anders nannte schon von seiner frühen Jugend an. Denn seitdem stand Ihre Exzellenz in nahen Beziehungen zu seiner Familie, zu deren jüngeren Gliedern sie mit der Zeit in jenes gewisse „tantliche“ Verhältnis getreten war, das seinen Ausdruck darin fand, dass sie sich berechtigt glaubte und verpflichtet fühlte, den „Jöhren“ den Kopf zu waschen, sie zu erziehen und herunterzuputzen, wo immer sich die Gelegenheit bot. Das gehört nun mal so zu den „Tanten aus Courtoisie“ oder „Polkatanten“, wie Max Westermann diese Spezies nannte. Dass er inzwischen ins Leben getreten und seine Schwester gar schon Witwe war, änderte nichts an der süssen Gewohnheit — darin wie in vielem andern war Mutter Mollwitz streng konservativ.
Zu ihr also lenkte Max Westermann an jenem Nachmittag seine Schritte, denn dass er nachher oder vorher noch pflichtgemäss das Bureau der Botschaft besuchte, um etwaige ihm zugedachte Arbeiten zu erledigen, war nur ein Vorwand, Beiwerk sozusagen! Mutter Mollwitz hielt die Attachés eigentlich für ihren Stab, dessen vornehmste Pflicht war, sich ihr zur Verfügung zu stellen, und jedenfalls wusste sie „diese Leute“ reichlich zu beschäftigen.
Fünf Uhr hatte es eben erst auf dem Kapitol geschlagen, und die „Gesellschaft“ pflegte um diese Zeit von ihren Spaziergängen oder Ausfahrten zurückzukehren. Mutter Mollwitz thronte also noch allein hinter ihrem Teetisch und benutzte die kostbare Zeit, um eine wollene Socke zu stricken; sie strickte immer Socken von Wolle, Vigogne oder Baumwolle, je nach der Jahreszeit, und kein Mensch begriff, dass der Gesandte solch grobes, graues Zeug tragen konnte, denn für ihn schaffte sie mit diesem schönen Eifer, wie sie männiglich mitzuteilen nicht verfehlte. „Er ist ein kolossaler Strümpfezerreisser,“ versicherte sie, „da sind selbstgestrickte viel billiger, weil man die so schön anstricken kann.“ Woraus erhellt, dass auch bei solchen Leuten mit solchen Gehältern die Strumpfpreise eine Rolle spielen. Wenigstens behauptete Mutter Mollwitz das mit grossem Nachdruck, trotzdem sie es nur bei einigen sehr leicht einzuschüchternden und devoten Hausfrauen ihrer Kreise, nie aber bei einer Römerin erreichte, dass sie in ihrer Gegenwart so taten, als folgten sie ihrem leuchtenden Beispiel.
„Na, Max, da sind Sie ja!“ rief sie dem eintretenden Attaché entgegen. „Warum sind Sie denn so lange nicht zu meiner Teestunde hier gewesen? Was? Zu tun hatten Sie? Ach, papperlapapp! Die Cour haben Sie geschnitten, mit die hübschen jungen Mädels gekaschbert oder mit den ‚schönen‘ Römerinnen karmauzelt! Reden Sie mir nichts vor — ich kenne die jungen Leute! Na, nun setzen Sie sich her und warten Sie hübsch auf Ihre Tasse Tee. Ich brühe ihn erst, wenn andre kommen, sonst wird er bitter. Gott, wenn ich Sie mir so mit Ihrem ‚Es ist erreicht‘-Schnurrbart ansehe und bedenke, dass ich Sie schon in Ihren ersten Hosen bewundert habe und die Therese noch im Sabberlätzchen — apropos, wann kommt denn die Therese nun eigentlich —?“
Max Westermann holte tief Atem — der Augenblick zur Schlacht war gekommen ohne seine diplomatische Einleitung, auf die er sich schon so wohl vorbereitet hatte. Aber bei Mutter Mollwitz ging alle Diplomatie in die Brüche, da war nichts zu wollen.
„Sie ist schon da, Exzellenz,“ sagte er mit wohlgeheuchelter Vergnügtheit.
„Waaaaas?“
„Seit gestern abend, Exzellenz,“ fuhr er im gleichen Ton fort mit einem liebevollen Blick auf die grauwollene Socke, die nun müssig in Mutter Mollwitzens Schoss ruhte. „Sie ist furchtbar müde von der Reise und hat mich beauftragt, Exzellenz ihren Handkuss zu überbringen. Natürlich wird Therese selbst sofort erscheinen und ihren Besuch machen, sobald sie etwas ausgeruht ist und ihren Koffer ausgepackt hat —“
„Natürlich,“ unterbrach ihn Frau v. Mollwitz mit geschwungener Stricknadel. „Aber warum hat sie mir denn nicht vorher geschrieben? Und Sie, Max, hätten doch auch den Mund aufmachen können, mir was zu sagen, damit ich euch hätte raten können, wo ihr sie unterbringen könnt, statt euer Geld einem teuern Hotel in den Schlund zu werfen. Wo ist sie denn abgestiegen?“
Max Westermann holte nochmals tief Atem: die Schlacht stand auf dem Entscheidungspunkt.
„Sie ist gleich in ihre Wohnung gegangen, Exzellenz,“ erwiderte er, Rüffel Nr. 1 in Gedanken als genossen quittierend. „Ich habe es nämlich übernommen, ihr ein Privatquartier zu besorgen, was ja doch angenehmer und billiger ist, da sie den ganzen Winter hier bleiben will.“
„Selbstverständlich!“ rief Mutter Mollwitz dazwischen. „Sie wird doch nicht so töricht sein, ins Hotel zu gehen auf so lange Zeit oder sich in einer Pension mit Krethi und Plethi zusammen zu setzen! So, und Sie haben ihr eine Wohnung gemietet, Max? Sie? Konnten Sie da nicht zu mir kommen und um Rat fragen? Ich wäre doch gern mit Ihnen von Pontius zu Pilatus gerannt, schon um den Leuten von ihren unverschämten Preisen gründlich abzuhandeln!“
Da dieser Umstand den armen Attaché gerade zu seiner strafbaren Eigenmächtigkeit veranlasst hatte, weil er sich bei dem ihm wohlbekannten „Abhandeln“ der Mutter Mollwitz nicht ein dutzendmal wie ein Pudel schämen wollte, so schluckte er auch Rüffel Nr. 2 hinunter.
„Die Zeit drängte, Exzellenz,“ entgegnete er sanft, „und überdies bot sich mir eine sehr gute Gelegenheit, die ich schleunigst ergriff, da noch eine Masse andre Aspiranten auf dieselbe Wohnung da waren.“
„Da werden Sie wohl was Nettes ausbaldowert haben,“ fiel Frau v. Mollwitz dieser etwas ausgeschmückten Darstellung in die Parade. „Haben Sie sich auch alles ordentlich angesehen? Rauchen die Öfen und die scheusslichen Kamine nicht? Gibt’s keine Wanzen und Flöhe in den Betten, hinter den Tapeten und unter den Dielen? Sie werden doch nicht etwa Zimmer mit Estrich genommen haben? Na, und so weiter. Jesses! Mietet so ’n junger, unerfahrener Mensch ohne meinen Rat eine Wohnung und bringt seine leibliche Schwester hinein! Was hat Ihnen denn das arme Wurm getan? Ich werde Ihnen eine Adresse geben, wo Sie das Insektenpulver im Pfunde billig kriegen, Sie leichtsinniges Huhn Sie! Wo ist denn die Wohnung?“
„Sehr gut gelegen, Exzellenz,“ erwiderte der also Gerüffelte liebenswürdig, denn der Strom ergoss sich nicht unerwartet über sein Haupt. Das Schlimmste ram ja auch noch. „Es ist der erste Stock im Palazzo Toffano, in dessen zweitem Stock ich selbst wohne.“
„Max, sind Sie verrückt geworden?“ kreischte Mutter Mollwitz auf, die Hände zusammenschlagend.
„Wieso, Exzellenz?“ fragte er unschuldig. „Der Palazzo liegt ausgezeichnet, hat einen grossen Garten, die Räume sind herrlich, gross, luftig und sehr gut eingerichtet. Die Öfen rauchen auch nicht —“
„Das fehlte gerade noch — in so ’nem Hause,“ fuhr ihm Ihre Exzellenz in die Rede. „Übergeschnappt sind Sie, sage ich! Der Palazzo Toffano! Mensch, das kostet ja ein Heidengeld! Ein Hei—den—geld, sage ich! Sie denken wohl, die Therese hat einen — Rothschild totgeschlagen?“
„Die Therese ist in einer sehr guten Lage —“
„Aber doch nicht, um das Geld zum Fenster ’rausschmeissen zu können! Und was will sie denn mit solch grosser Wohnung machen? Hä? Das sind ja mindestens zehn Zimmer — pah, Säle sind’s!“
„Vierzehn Piecen, alles in allem,“ berichtigte Max Westermann mit verbindlichstem Lächeln.
„Vierzehn Piecen!“ wiederholte Mutter Mollwitz mit einem Blick zum Himmel. „Sie ist wohl in Ohnmacht gefallen, wie sie die gesehen hat, was? Max, ich werde dafür sorgen, dass Sie unter ärztliche Aufsicht kommen, denn das ist doch ein starkes Stück. Vierzehn Piecen!“
„Ja, aber sie benutzt sie nicht alle.“
„Benutzt sie nicht alle! Natürlich nicht, sie müsste sie denn brauchen wollen, um sich darin im Radschlagen zu üben!“
„Denn die reichliche Hälfte der Wohnung hat eine Dame genommen, mit der Therese schon den ganzen Sommer gereist ist und mit der sie sich verabredet hatte, den Winter in Rom zuzubringen,“ schloss Max Westermann mit scheinbarer Seelenruhe seinen diplomatischen Auftrag, innerlich aber alle die eingeheimsten Injurien auf das Kerbholz seiner „Polkatante“ schreibend. Denn auch der Wurm krümmt sich, wenn er getreten wird.
„So, so, also Therese zahlt den kleineren Teil des Sündengeldes. Na, das lässt sich schon eher hören,“ meinte Ihre Exzellenz etwas besänftigt, trotzdem das Geld weder ganz noch geteilt aus ihrer Tasche gefordert worden war. „Immerhin ist die Wohnung auch so noch unsinnig gross. Wer ist denn diese Dame?“
„Die Fürstin Woszgorod, Exzellenz.“
„Kenn’ ich nicht. Russin?“
„Ich weiss es wirklich nicht. Der Name klingt eher polnisch.“
„Na, dass sie sich nur nicht holländisch dünne macht und die Therese mit der ganzen Wohnung sitzen lässt — unbezahlt natürlich. Ist schon vorgekommen, lieber Max! Wo hat sie denn die Person aufgegabelt?“
„Therese ist nicht so rasch zur Hand, sich jemand ‚aufzugabeln‘,“ erwiderte der arme Attaché, sich nun sichtbarer krümmend. „Soviel ich weiss, hat sie die Fürstin im Frühjahr in Baden-Baden kennen gelernt, wo Therese in den besten Kreisen verkehrte —“
„Da trifft man oft den grössten Schund,“ fiel Exzellenz mehr wahr als höflich ein.
„Und beide Damen scheinen dort eine gegenseitige Zuneigung zueinander gefasst zu haben,“ vollendete Max mit so viel erhobener Stimme, als ihm die gute Lebensart und der Respekt vor der älteren Dame, der Repräsentantin seines Chefs, erlaubten. Die Mutter Mollwitz ging ihm doch manchmal furchtbar auf die Nerven!
„So! Na, die Therese muss ja wissen, was sie tut, ein Baby ist sie nicht mehr,“ meinte Exzellenz trocken. „Haben Sie diese Fürstin Woschi-Groschi schon gesehen? Altes Register, was?“
„Witwe. Jung und sehr schön,“ entgegnete Max resigniert.
„Pöhhhh! Nachtigall, ich hör’ dir trapsen!“ zitierte Exzellenz mit einem langen und vielsagenend Blick auf das unglückliche Opfer brüderlicher Gefälligkeit. „So, so. Ich werde mir diese neue Freundin Theresens mal ansehen. Sie braucht sie mir nicht gleich herzubringen. Nicht eher, als bis ich’s ihr sage. Verstanden? Ja, Vorsicht ist die Mutter der Weisheit und der Porzellantöpfe! Man muss so wie so schon eine Masse Leute empfangen, die nicht gesiebt worden sind, und ich will diesen Winter besser aufpassen, wer in die Botschaft kommt. Wie war der Name? Woszgorod? Gehört muss ich den schon haben. Aber wo? Na, ich werde schon dahinter kommen — man hat dazu seine Verbindungen —“
Hier wurde der arme Attaché erlöst durch das Erscheinen eines ganzen Trupps Damen und Herren der diplomatischen Kreise, was Mutter Mollwitz Gelegenheit gab, ihren Teepott aufzubrühen.
Man kam gern in geschlossener Phalanx zu ihrem jour fixe, denn es lag Sicherheit, wenigstens eine relative Sicherheit in diesem Manöver; allein getraute man sich nur ungern in die Höhle des Löwen wegen der dann reichlicher und zwangloser fliessenden „Wahrheiten“, wie Mutter Mollwitz ihre Grobheiten zu nennen beliebte. Um gerecht zu sein: in diesem frommen, das heisst niederträchtigen Selbstbetrug sind meist die Leute befangen, die sich verpflichtet fühlen, andern die sogenannte Wahrheit zu sagen.
Max Westermann empfahl sich, sobald er das mit einigermassen guter Manier tun konnte; aber er stieg die Treppen des Botschaftshotels immer noch, figürlich gesprochen, mit gesträubten Federn hinunter.
„Greuliches altes Weib,“ kommentierte er dabei inwendig Ihre Exzellenz. „Die sieht mich sobald nicht wieder. Was diese alten Hexen immer gleich zusammen kombinieren, das ist einfach nicht zu glauben; wo unsereins ahnungslos ist wie ein Kind in der Wiege, da schnüffeln diese sozialen Waschweiber gleich Dinge aus, dass einem übel werden könnte. Ob Therese — Unsinn, Therese ist eine harmlose Seele und denkt nicht daran, sich einen Kuppelpelz zu verdienen! Dass einem doch auch gleich solch eine — — die ganze Harmlosigkeit vergällen muss — es ist einfach grässlich! Grässlich, sage ich! Puh!“
„Lieber Westermann, Sie sind ja kolossal in Gedanken,“ schreckte ihn eine Stimme dicht neben sich aus seinen empörten Meditationen, und förmlich zurückprallend sah er seinen Chef vor sich stehen, der eben aus seinem Bureau des Erdgeschosses getreten war. „Wer hat Ihnen denn droben so die Gedanken absorbiert, dass Sie weder hören noch sehen? Ich wollte eben auch mal einen Blick in den Salon werfen, sonst kriege ich eine Gardinenpredigt von meiner Schwester — hören Sie, lieber Westermann, Sie haben für einen Diplomaten ein viel zu ausdrucksvolles Gesicht, denn ich kann darauf deutlich die Gardinenpredigt lesen, die Sie oben erwischt haben. Sonderbare Passion von meiner Schwester, die Leute ohne Ansehen der Person herunterputzen zu müssen. Leider gibt’s immer noch viele, die das übelnehmen, aber ich dachte, Sie wären nun nachgerade daran gewöhnt —“
Max Westermann musste unwillkürlich lachen.
„Exzellenz haben ganz recht — aber Frau von Mollwitz verfügt über so viel überraschende Varianten, dass man immer wieder daran zu verdauen hat,“ konnte er sich nicht enthalten zu sagen, denn es bestand in diplomatischen Kreisen der Verdacht, dass Herr von Grünholz Material sammelte, um der strengen Herrschaft seiner Schwester damit ein Ende zu bereiten, das er von dem Tage an ersehnt hatte, da sie ihm zum erstenmal den Schreibtisch aufgeräumt und höchstselbst die Fenster geputzt hatte zum Erstaunen der Passanten. Gutmütige Seelen hatten ihm auch schon angedeutet, dass das wirksamste Mittel zur Vertreibung von Mutter Mollwitz wäre, eine Frau zu nehmen — man behauptete sogar, diese Idee habe Wurzel gefasst im tiefsten Schreine des Herzens Seiner Exzellenz, aber wenn man fünfundfünfzig Jahre alt geworden ist, ohne ein Weib genommen zu haben, so ist die Sache nicht so einfach, wie töchterreiche Mütter denken. Auf alle Fälle war Exzellenz noch eine sehr stattliche Erscheinung, die im Verein mit seiner Stellung ihm das Anrecht gab, sogar in jüngern Sphären zu wählen. Man konnte also gar nicht wissen, was noch passierte, um Mutter Mollwitz aus diesem Paradies zu vertreiben, wo das Grossreinemachen das ganze Jahr nicht aufhörte und so vielen Menschen die „Wahrheit“ gesagt werden musste. Exzellenz schmunzelte sichtlich zu den Worten seines Attachés, schon weil geteilter Schmerz bekanntlich halber Schmerz ist.
„Ja ja, darin ist sie grossartig,“ meinte er behaglich. „Übrigens,“ setzte er geschäftsmässig hinzu, wollte ich Sie rufen lassen, lieber Westermann, man sagte mir aber, dass Sie oben wären, und da war ich eben auf dem gleichen Wege. Kommen Sie mit mir in mein Zimmer, dort kann ich Ihnen gleich sagen, was ich von Ihnen will.“
Der Attaché folgte seinem Chef nicht ohne eine leise Neugier in dessen Arbeitszimmer, denn dienstlich hatte er mit ihm noch wenig zu tun gehabt, einmal, weil er noch nicht lange hier war und dann war seine Stellung bei der Botschaft doch eine mehr dekorative, als tätig in den Gang der Geschäfte eingreifende.
„Ich habe einen diplomatischen Auftrag für Sie,“ begann Herr von Grünholz und fügte lächelnd hinzu: „Na, machen Sie kein so wunderbar erstaunt-erwartungsvolles Gesicht — man kann Ihnen wahrhaftig jeden Gedanken davon ablesen — was Sie zu tun haben, wird Ihrem Verstande nichts zumuten. Sie haben weiter nichts zu tun, als morgen Ihre Paradeuniform anzuziehen und der Königin ein eigenhändiges Schreiben unsrer allergnädigsten Königin zu überreichen, zu dessen Bestellung man diesen förmlichen Weg aus mir unbekannten Gründen für dieses Mal gewählt, beziehungsweise befohlen hat. Wahrscheinlich steht in diesem Briefe nichts drin, was man so ‚nichts‘ nennt, aber trotzdem scheint man von — äh — andrer Seite hochpolitische Mitteilungen darin zu vermuten, denn man hat nicht weniger als drei Versuche gemacht, den Kurier, der den Brief gebracht, unterwegs zu kidnappen, das heisst, ihm das Schreiben zu entführen. Jedenfalls hat man ihn für den Überbringer andrer politischer Schriftstücke gehalten, für die auch ein andrer Weg gewählt wurde, aber solche Irrtümer können den geschicktesten politischen Agenten passieren. Agenten, lieber Westermann! Ich hörte Sie neulich das Wort ‚Spion‘ gebrauchen für dieses notwendige Übel — wir haben keine Spione, nur Agenten. Also, um zur Sache zu kommen: Sie sollen den Brief morgen übergeben — ich habe dazu schon die nötigen Schritte getan. Ich selbst habe eine Sitzung, die ich nicht verlegen kann, na, und für solche Sachen sind doch die Attachés da — voilà! Haben Sie ein Portefeuille bei sich, damit sie den Brief gleich mitnehmen können? Ja? Na, das ist gut. Hier ist er — Siegel unverletzt. Um zwölf ist die Audienz, wenn nicht Gegenbefehl kommt. So, das wäre erledigt. Verlieren Sie mal bloss den Brief nicht, das könnte eine nette — Melange geben. Und um von was anderm zu reden: ich höre, Ihre Frau Schwester ist angekommen — bitte, empfehlen Sie mich ihr bestens — sehr hübsche und liebenswürdige Dame, Ihre Frau Schwester. Hat so ein nettes, betuliches Wesen — sah sie zum letztenmal, als ihr Mann noch lebte, sind nun auch schon — lassen Sie mal sehen — ja, fünf Jahre sind’s. Die Zeit vergeht, und man wird leider alt dabei. Mit wem hat Ihre Frau Schwester doch die Beletage im Palazzo Toffano zusammen gemietet?“
Max Westermann wunderte sich, dass sein Chef das trotz aller Geheimhaltung schon wusste, aber er war eben noch ein diplomatischer Neuling und dachte nicht gleich an die „Agenten“.
„Weiss ich schon seit acht Tagen, dass und an wen das Logis vermietet ist,“ schmunzelte Herr v. Grünholz, seinem Attaché die Gedanken vom Gesicht lesend. „Meine Schwester — keine Ahnung! Sie ahnt auch zum Glück — wollte sagen natürlich, nicht, dass ich solche Sachen vor ihr erfahre. War ganz schlau von Ihnen, lieber Westermann, die Geschichte geheim zu halten, werden Sie aber noch lange unter die Nase gerieben kriegen. Also, mit wem ist Frau von Triberg gekommen? Aus dem Namen hat man nämlich einen schauerlichen Kuddelmuddel gemacht. Woszgorod? Fürstin Woszgorod? Hm! Etwa Witwe von dem alten Woszgorod, der vor zirka zehn Jahren Gouverneur von Dingsda war? War viel älter als ich — ganz slawischer Grandseigneur — hat eine Unmasse Geschichten geliefert — auch mal eine cause célèbre, wenn ich nicht sehr irre — war etwas mit einer seiner Frauen — mehrmals verheiratet gewesen. Ganz jung ist die Freundin Ihrer Schwester? Bin neugierig, ob sie zur Familie des Generals Ladislaus Woszgorod gehört, den ich meine. Na, also auf Wiedersehen, lieber Westermann, und vergessen Sie nicht meine Empfehlungen an Frau von Triberg!“
Max Westermann nahm eine Droschke und fuhr zurück nach dem Palazzo Toffano, dessen Besitzer, um seinen bedrängten finanziellen Verhältnissen in etwas aufzuhelfen, sein fürstliches Stammhaus vermietet hatte und selbst billig im Ausland lebte. Das Erdgeschoss des in herrlichem, aber etwas verwildertem Park liegenden historischen Gebäudes barg in den Haupträumen die grossartige Bibliothek, auf die der Vatikan schon längst ein Auge geworfen und für die er eine hohe Summe geboten hatte; vermietet wurden die Beletage mit ihren königlich prächtigen Zimmern und im zweiten Stock die drei Zimmer, welche Max Westermann innehatte, während die andern Gemächer die kleine, aber aus lauter Meisterwerken bestehende berühmte Gemäldegalerie enthielten, die dem Publikum gegen einen Permesso, den die Konsulate ausgaben, geöffnet war und immer einen Strom von Fremden anlockte, die sich dem Odium nicht aussetzen wollten, in Rom gewesen zu sein, ohne die Galeria Toffano gesehen zu haben. Aber auch kopierenden Künstlern und solchen, die es zu sein glaubten, war die Galerie zugänglich, denn die Toffano hielten ihr altes Prestige als Kunstmäcene durch alle Wechselfälle der Generationen aufrecht, ohne etwas dafür zu fordern. Ein „mancia“, zu deutsch Trinkgeld genannt, an den Kastellan war alles, was der Besucher zu entrichten hatte, und der alte Marzio stand sich gut dabei, schon weil im „Bädeker“ die ungefähre Höhe des Obulus normiert war.
In seinen Zimmern angelangt, schloss der Attaché zunächst das ihm anvertraute Schreiben in seinen Schreibtisch ein und stieg dann hinab in die Beletage, um seine Schwester aufzusuchen. Er trat ohne weiteres in das verhältnismässig kleine Zimmer, das sie sich als Boudoir ausgesucht, und fand sie bei noch nicht angezündeten Lampen am Kaminfeuer „Schummerstunde“ halten, wie sie es liebte. Wenig älter als ihr Bruder, war Frau v. Triberg wirklich eine sehr hübsche Frau. Aber sie war mehr als das, denn sie war bei der einfachsten Natürlichkeit ihres Wesens eine wahrhaft liebenswürdige Natur ohne Launen und von grösster Gleichmässigkeit ihres heitern Temperaments. Nach dem jähen Ende ihrer kurzen Ehe — ihr Gatte war auf einer Jagd verunglückt — hatte sie sich bald dem Leben wieder zugewendet.
„Guten Abend, Max,“ rief sie ihrem Bruder entgegen. „Schon zurück vom Drachenfels? Und ganz heil?“
„Na, ich danke,“ gab er heiter zurück. „Wenn nach der Sitzung ein Hund noch ein Stück Brot von mir nimmt, dann ist er eben nicht wählerisch. Freu’ dich, Therese, du kriegst auch noch deine Standpauke von der Mutter Mollwitz, besonders wegen deines unverantwortlichen finanziellen Leichtsinns. Aber sie lässt dich schön grüssen, und mein Chef hat mir wiederholt die besten Empfehlungen an dich aufgetragen.“
„Danke schön!“ erwiderte Frau v. Triberg sichtlich erfreut. „Exzellenz Grünholz war immer sehr nett zu mir — wie doch Geschwister so grundverschieden sein können, nicht?“
„Die beiden gleichen sich wie der Dorftümpel dem Bergsee,“ gab Max zu. „Du, der Chef hat mir heut’ eine diplomatische Mission anvertraut,“ setzte er mit der fast knabenhaften Freude hinzu, die charakteristisch bei ihm war und ihm die Frische bewahrt hatte, die nicht zum mindesten zu der Beliebtheit beitrug, deren er sich in allen Kreisen erfreute, weil sie so vorteilhaft abstach von der wirklichen und affektierten Blasiertheit seiner Alters- und Standesgenossen.
„Ach was!“ sagte Frau v. Triberg interessiert.
„Tatsache!“ nickte er. „Ich soll einen Brief unsrer Königin Ihrer Majestät hier überreichen. Morgen. Das ist alles, aber immerhin doch etwas. Den Brief habe ich schon anvertraut erhalten —“
„Hoffentlich enthält er keine wichtigen Staatsgeheimnisse,“ sagte eine melodische Stimme hinter ihm, und sich jäh umwendend, sah er nun erst in einer dunkeln Ecke des Zimmers in einem tiefen Lehnstuhl eine schlanke Gestalt mit lichtestem Blondhaar sitzen: die Fürstin Woszgorod!
„Durchlaucht — Sie hier?“ rief er perplex. „Ich hatte ja keine Ahnung.“
„O, ich bin auch hier gar nicht zu sehen, und Sie stürmten herein in dem festen Glauben, Ihre Schwester allein zu finden,“ erwiderte dieses reizendste aller weiblichen Wesen mit dem zarten, blumenhaften Gesicht und den ernsten Kinderaugen freundlich lächelnd. „Aber es war Zeit, dass ich mich meldete, ehe Sie Staatsgeheimnisse verrieten.“
„Leider habe ich nur verraten, welch kindischer Kerl ich bin,“ entgegnete Max Westermann, die ihm gereichte Hand mit den blitzenden Diamantringen küssend.
„Sie haben verraten, dass Sie ein ebenso natürlicher Mensch sind wie Ihre Schwester,“ erwiderte die Fürstin. „Sie haben keine Ahnung, welcher Segen die Gesellschaft Theresens für mich geworden ist,“ setzte sie mit einem sonnigen Lächeln hinzu. „Dass ich diese Perle auf meinen Lebenswegen finden musste, war für mich ein grosses Glück. Nein, Therese, Sie dürfen nicht protestieren oder mich für eine banale Schmeichlerin halten!“
„Gott bewahre — ich will ja nur das Kompliment zurückgeben,“ meinte Frau v. Triberg.
„Ich möchte wissen, mit welchem Grunde,“ rief die Fürstin lebhaft. „Ich bin ursprünglich auch natürlich veranlagt und heiter und warmherzig, aber alles das hat mir das Leben genommen, und ich bin so schrecklich alt geworden —“
„Dabei ist der ganze Wurm zweiundzwanzig Jahre alt,“ fiel Frau v. Triberg mit herzlichem Lachen ein.
„Ach, die Jahre machen’s nicht,“ sagte die Fürstin traurig. „Aber,“ fügte sie schnell hinzu, „Therese, Sie haben verstanden, mir einen Schein meiner Jugend zurückzugeben. Sie sind eine so sympathische Natur, die alles Schlafende in der Menschenseele weckt, ohne nach ‚wie‘ und ‚warum‘ zu fragen.“
„Vertrauen muss von selbst kommen,“ murmelte Therese.
„Nicht wahr?“ rief die Fürstin lebhaft. „Ich habe so lange zu keinem Menschen mehr Vertrauen haben können, aber ich hatte es zu Ihnen, als ich die ersten Worte mit Ihnen sprach. Das ist Instinkt, glaube ich. Ihre Schwester, Graf Westermann, fasst auch, was man so ‚Vertrauen‘ nennt, richtig auf. Die meisten Leute verstehen darunter, dass man ihnen umgehend seine ganze Lebensgeschichte mit allen Details bis ins dritte und vierte Glied rückwärts erzählt — aber macht es das? Manche Menschen können nicht über Vergangenes sprechen; dazu gehört eine besondere Stunde, die gerufen nicht kommt. Therese weiss nichts von mir, gar nichts, und hat mich doch in ihre Nähe gezogen — auf mein ehrliches Gesicht hin.“
Frau v. Triberg nickte der lieblichen Sprecherin freundlich zu. „Das ist auch Sache des Instinkts, Djavahir,“ sagte sie.
„Djavahir? Sie heissen Djavahir, Fürstin?“ fragte Westermann. „Welch seltsamer, schöner Name! Er klingt — wie soll ich’s nur ausdrücken — er klingt wie ein Notturno von Chopin.“
„Er ist persisch,“ erklärte sie, „und bedeutet ‚Diamant‘. Meine Eltern waren in Teheran, als ich geboren wurde, und gaben mir zur Erinnerung an diesen Aufenthalt den dort ziemlich gebräuchlichen Namen. Aber nun denken Sie, Graf, welche Freude ich gleich am ersten Tage in Rom hatte: ich darf in der Galerie des Palazzo Toffano kopieren! Und den herrlichen Guido Reni vor allen — wie lange habe ich davon geträumt!“
„Durchlaucht sind Künstlerin?“
„Wirklich, das ist sie!“ rief Frau v. Triberg enthusiastisch. „Nicht Dilettantin, die nur Leinwand und Papier verdirbt pour passer le temps, nein, Künstlerin mit Wollen und Können!“
„Es ist das einzige, was ich kann, ordentlich kann, was mir Freude macht und was ich tun muss, malgré moi,“ erwiderte die Fürstin ohne die törichte falsche Bescheidenheit, daran der Amateur kenntlich ist. Sinnend fuhr sie fort: „Ich weiss nicht, was aus mir geworden wäre ohne diese Gabe und die unbesiegbare Sehnsucht, sie auszuüben, ohne die ernsten Studien, an deren Ende ich ja noch lange nicht angelangt bin. Aber das Kopieren