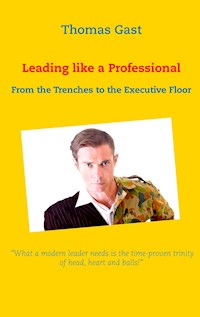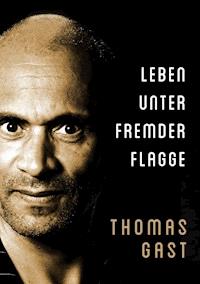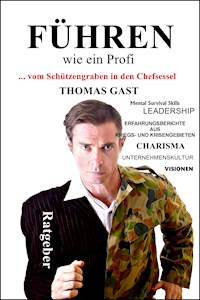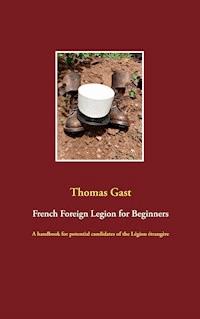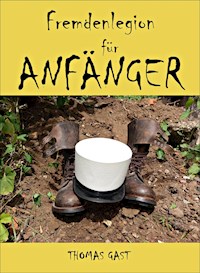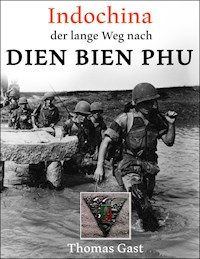Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Zwei Grenzläufer finden durch Zufall einen Durchlass zu einem längst vergessenen Ort – eine Höhle, durchzogen von einer enormen Goldader. Nur eine blutjunge Indianerin beobachtet die beiden Männer, von denen nur einer die Höhle wieder lebend verlässt, entschlossen den Fund auf ewig geheim zu halten. Doch von diesem Gold weiß bald schon der gesamte Westen Amerikas, und Glücksritter aus allen vier Erdteilen suchen nach der "Lost Dutchman Mine". Umsonst! Nur "Bärenfrau", die vom eigenen Volk verstoßene Indianerin, kennt fortan das Versteck. Im Sog dieser Goldgräberstimmung möchte eine Gruppe Schausteller die Chance nutzen, reich und bekannt zu werden. Ein Frontiersmann führt sie hinauf in die Berge, wo sie anstatt Ruhm einen grausamen Tod finden. Nur der Seiltänzer Andrew überlebt und Bärenfrau nimmt sich seiner an, doch sie ist wie ihr Land: wild und grausam.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas GAST
Dog Soldiers
Das Vermächtnis der Bärenfrau
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Widmung
Vorwort
Prolog
Frankreich 1859
Paris, November 1859, einen Monat später
Adieu, altes Europa
Lebœuf
Auf der Chippewa
Fort Benton
Weites Land
Bärenfrau
Die Höhle
Der Bär
Cheyenne
Nino
Gold
Indian Summer
Spürhundkrieger
Anovaoo’o
Fort Bridger
Northern Cheyenne
Der Raid wird vorbereitet
An der Quelle des Big Horn
Lane
Unter Wölfen
Hunted Bull
Indian Raid
Riley
Sweet Medicine
Kimi
Mocking Bird
Die Verfolgung
Wotla
Heammawihio
Wardens Tod
Kirgi
Palo Verde
Die Abrechnung
Der-Zuerst-Kam
Epilog
Nachwort
Impressum neobooks
Widmung
„Die Sehnsüchte des Menschen
… sind Pfeile aus Licht.“
Weisheit der Cheyenne
Dieses Buch widme ich voll Dankbarkeit meinem Freund Michael, dem „Poesiepiraten.“ Wir hatten eine schöne Zeit, damals, und der Zauber lebt weiter!
Vorwort
Paris, 1901
Mein Name ist Andrew Morlock-Fontaine. Ich bin zu dem Zeitpunkt, da ich diese Zeilen schreibe, etwa fünfundsechzig Jahre alt. Mein Haar ist grau, ich sehe nicht weiter, als ich einen Stein werfen kann, und laufen gelingt mir nur mühsam am Stock. Vor kurzem fiel mir zu allem Übel beim Urinieren auf, dass mein Strahl nur noch ein erbärmliches Rinnsal war. Wenn ich in den Spiegel sehe, starrt mich ein Monstrum an, doch es gab eine Zeit, in der alles anders war, und von dieser Zeit möchte ich erzählen. Ich möchte Ihnen meine Geschichte erzählen!
Eine Geschichte, die sich in einem fernen, fremden, dunklen Land abspielte, unter fremden und dunkelhäutigen Menschen. Für mich hatte dieses Leben damals tausend Gesichter. Mal war es hart, grausam, absurd und Zeuge von menschlicher Dummheit, dann wieder erschien es mir faszinierend, voller atemberaubender Schönheit, voll mit Wundern, zerbrechlicher Neugier und nie gestilltem Wissensdurst. Mir geht es aber beileibe nicht nur darum, einen Streckenabschnitt im Leben des jungen Mannes zu erzählen, der ich einmal war, und noch weniger geht es mir darum, zu versuchen, eine historische Epoche, wie den Aufbruch in den Westen eines schier unendlichen Kontinents, wieder aufleben zu lassen, nein! Ich will vielmehr ganz unabhängig davon hervorheben, wie dunkel, wie kalt und grausam die tiefen Abgründe der Seele eines Mannes sein konnten, dem das Leben ganz unverhofft all das schenkte, wonach er sich unbewusst immer schon gesehnt hatte, der dann aber ohnmächtig mit ansehen musste, wie das Tier “Mensch” ihm all dies wieder nahm. Auch wenn meine Erlebnisse von dramatischen Ereignissen überschattet waren und sich für mich die Welt irgendwann mittendrin aufgehört hat zu drehen, auch wenn Zeit und Ort an einem ganz gewissen Punkt meines Lebens ihren Sinn verloren, so kommt nun doch, im Alter, die Erinnerung mit aller Macht zurück.
Alles begann mit einem Traum …!
Prolog
Wiser und Walz
Wiser stieß zufällig auf die Höhle, ein knorriger, vom Ostwind geduckter Baum wies ihm den Weg. Wie er später zu Walz sagte, hatte er die Nacht zuvor von diesem Baum geträumt. Der Baum war uralt. Auf seinen dicken Stämmen war sterbende Rinde zu sehen, die wie alte ledrige Haut an ihm herunterhing. Wiser kannte diese Art Bäume, und er wusste, dass sie hauptsächlich in wärmeren Gefilden zu finden waren, unten in Arizona oder in den Geröllwüsten Mexikos. Aber hier?
Walz, ein stämmiger Deutscher, dachte wohl ähnlich. Neugierig trat er näher. »Das ist ein Palo Verde!«, sagte er überrascht.
»Und ich will verdammt sein, wenn ich daraus schlau werde«, erwiderte Wiser. »Übrigens, wusstest du, dass die Apachen in den Dragon Mountains Mehl aus der Rinde des Palo Verde machen?«
Walz zog nur die Schultern hoch. »Nein, das wusste ich nicht.«
»Doch, doch. Sie mischen es mit dem Mehl von Eichen und machen Suppe und Brot draus. Schmeckt gar nicht so übel, das Zeug.«
Walz’ Gesichtsausdruck verhärtete sich. Er konnte Indianer nicht riechen und weiterhin konnte er es sich auch schwer vorstellen, dass Indianer so etwas Wertvolles wie Mehl oder gar Brot herstellten.
»Ich hatte da ein Mädchen«, rechtfertigte Wiser sich ohne Grund. »Sie war Chiricahua.«
Ein Geräusch am Fuße des Baumes ließ ihn aufhorchen. Dort sprang ein fettes Karnickel flink auf den Palo Verde zu. Als es ihn sah, immobilisierte es sich eine schier endlose Sekunde lang und hoppelte schließlich auf die Felswand zu, an welche sich der Baum angelehnt hatte. Dann war es plötzlich spurlos verschwunden.
Wiser war sofort Feuer und Flamme. »Sag, Walz, wann hatten wir zuletzt ein saftiges Karnickel? Vor einem Jahr, vor zehn Jahren?«
Walz dicht auf den Fersen, kroch er mit gezogenem Revolver in das Geäst, wo sich urplötzlich eine Höhle vor ihren Augen auftat. Als sie dann eine Stunde später den unterirdischen Raum fanden, in dem das Gold lag, war das Karnickel längst vergessen. Wiser tanzte vor Glück. Er fiel auf die Knie und streckte die Arme weit von sich. »Das … das ist Wahnsinn. Sieh doch, Walz, wir sind gemachte Männer!«
Er schloss seine Augen, träumte von einer besseren Zukunft, was ein Fehler war, ein Irrtum, den er mit dem Leben bezahlen sollte, denn als er die Augen wieder öffnete, starrte er direkt in die Mündung von Walz’ Revolver.
»Du warst immer schon ein Dummkopf, Wiser, das wollte ich dir seit Jahren schon sagen.«
Ohne seinem langjährigen Begleiter auch nur den Hauch einer Chance zu geben, drückte er ab. Wisers Tod bedauerte er keine einzige Sekunde. Ein irres Flackern in den Augen, widmete er sich den wie Arterien verzweigten Goldadern, die so dick waren wie sein Daumen und so rein und pur, wie er es selten gesehen hatte.
Zwei Dinge jedoch übersah Walz in seinem Rausch. Kaum nämlich war das Echo der Detonation verklungen, bewegte sich eine riesige Gestalt auf den Ausgang der Höhle zu und verließ diese lautlos wie ein Schatten, einen Geruch hinterlassend, der an eine scheußliche Pest erinnerte. Und dann übersah Walz, oder er hörte und spürte es nicht, wie die Höhle sich kaum merklich bewegte, aufächzte, so als ob das Gewicht der hunderttausenden von Tonnen des Berges auf ihr sie bald unter sich begraben würde. Ein Riss in der Felswand hinter ihm hätte auch das stärkste Gemüt in Panik versetzt, doch Walz bekam von alldem nichts mit und war zufrieden, war glücklich, denn er hatte den größten Goldfund gemacht, von dem ein Mensch nur träumen konnte. Bald wusste der gesamte Westen Amerikas davon, und Glücksritter aus allen vier Erdteilen suchten nach der Lost Dutchman Mine: Umsonst! Nur eine einzige Person, eine vom eigenen Volk verstoßene Indianerin, kannte das Versteck. Die Indianer nannten sie “Bärenfrau“.
Frankreich 1859
Wir lebten damals in Le Havre. Meine Mutter, Julie Fontaine, eine rassige Kreolin aus Hispaniola, starb, als ich sieben war, an Syphilis. Mutters Erbe an mich waren der schlanke Körper, eine fast feminine Sensibilität und Zartheit und die katzenhaften Bewegungen, Dinge also, aus denen ich Jahre später ausreichend Kapital zu schlagen gedachte. Mein Vater, Michael Morlock, war ein Flibustier, ein echter Seeräuber, der zeit seines Lebens zunächst seine Frau und danach sein Kind sträflich vernachlässigt hatte, nur um die Gewässer der Karibik bei Jamaika, Maracaibo und Panama unsicher zu machen. Ich hatte diesen Mann nur dreimal in meinem Leben gesehen und jedes Mal kam er mir vor wie der Satan in Person: Ein Prahlhans und ein Angeber, ständig betrunken und auf der Suche nach Streit mit den Behörden oder nach sonstigem Verdruss! Ich denke, es ist schlimm, so etwas von seinem eigenen Vater zu denken oder gar zu sagen, doch die Tatsachen konnte ich nicht wegleugnen. Eines Tages, nachdem Vater mit seinem Schiff aufgebrochen und wir monatelang ohne Nachricht von ihm waren, erreichte uns die vage Botschaft, dass man ihn im Karibischen Meer an Bord einer Schaluppe wegen Meuterei am Galgen aufgehängt hatte. Doch dies geschah zu einer Zeit, in der ich mich längst von ihm und vom Rest meiner Familie losgesagt hatte, und sein Tod war für mich von daher keine Tragödie. Jemand, den ich vage kannte, war gestorben, mehr war es nicht. Auch heute noch, wenn ich zurückdenke, ist mir der Tod dieses Mannes ziemlich gleichgültig. Meine Mutter, so hatte man mir erzählt, hatte ihn abgöttisch geliebt, während er sie in den letzten Monaten, die sie miteinander verbrachten, behandelte wie ein Stück Dreck, und das obwohl er um ihre Gefühle und um ihren Zustand gewusst haben musste. Sie war schwanger! Er hingegen hatte sich anderen Frauen gewidmet, weil ihr runder, weißer Bauch ihn angeblich abgestoßen hatte. Nach Mamas Tod nahm eine Tante mich unter ihre Fittiche und adieu, Le-Havre, denn Tante Martine wohnte in Paris. Ich wuchs in Paris in einer Epoche auf, die von zwei total unterschiedlichen Gesellschaftsschichten geprägt war. Hier die Reichen, die sich ihre Rechte und ihre Freiheit kaufen konnten und dies auch zur Genüge taten, und dort die armen Leute, für welche die Existenz nichts weiter als ein ständiger tagtäglicher Kampf ums nackte und pure Überleben war. Meine neue nette Familie zählte eindeutig zur zweiten Kategorie, und deswegen war mir Hunger kein Fremdwort. Aus der Notwendigkeit heraus, angestachelt von Tante Martine und ihrem Taugenichts von einem ständig betrunkenen Mann, lernte ich schon früh, Brieftaschen, silberne Uhren, Anstecknadeln und sogar Ringe zu mopsen. Ich war sogar richtig gut darin. Die Sachlage war einfach. Je mehr ich heimbrachte, desto öfter ließen sie mich in Frieden und umso mehr konnte ich mir den Wanst vollschlagen. Kam ich dagegen mit leeren Händen, so musste ich hungern, und ich dachte damals wirklich, die Welt bestünde nur aus langen Hungerstrecken und endlosen Überlebenskämpfen. Bis zu jenem Tag, auf den mein neunzehnter Geburtstag fiel.
Robbles, ein renommierter Zirkusdirektor, wurde auf mich aufmerksam und nahm mich fortan unter seine Fuchtel. Er hatte ziemlich rasch erkannt, dass das Diebshandwerk bei weitem nicht meine brillanteste Gabe war. Ich hatte das Talent, ein großartiger Artist und Seiltänzer zu werden! Robbles’ Etablissement nannte sich das Théâtre du Merveilleux und es zog die Massen an wie frischer Kot grün schillernde Mistfliegen. Ein treffenderer Vergleich fällt mir nicht ein. Die Menschen kamen herbeigeströmt, weil Robbles ihnen das bot, was sie zu jener Zeit brauchten, ob arm oder reich: Träume und etwas Licht im Schatten des grauen Alltags. Die ganze Truppe war ein Kunterbunt aus Akrobaten, Tänzern, Clowns, Jongleuren und Tierbändigern, aber außerhalb der Zirkuskuppel gab es auch Schießwägen und Schaukeln und natürlich Stände mit allerlei kulinarischen Verköstigungen. Zuckerwatte, kandierte Äpfel, gebrannte Mandeln, gegrillte Makrelen, Orgelmusik und ich erspare mir den ganzen Rest. Die Zeit mit Robbles und seiner Traumfabrik war jedoch nur begrenzt, denn der gute Mann verschwand eines Tages mit den Einnahmen eines ganzen Jahres, und es gab niemanden, der sich zutraute das Ruder in die Hand zu nehmen. Überdies drohte uns allen das Zuchthaus, weil unser Freund auch vergessen hatte, die anfallenden Steuern zu zahlen, und so zerstreute sich die Truppe innerhalb recht kurzer Zeit in alle Winde, wobei jeder mitnahm, an was er Hand legen konnte. Einzig eine kleine Gruppe mit mir an ihrer Spitze blieb nach der Trennung zusammen. Wir wollten wegen Robbles’ krummer Geschäfte unsere Talente und vor allem unsere Freundschaft nicht einfach in den Wind schießen, und so formierten wir uns unter dem Namen Cirque Du Rêve in einem anderen Stadtteil neu. Irgendwann gesellten sich dann langsam andere Künstler zu uns, und aus einem anfänglichen Viermannspektakel formte sich ein Ensemble, das von der Anzahl seiner Mitglieder und von seiner Vielfältigkeit her diesen Namen auch verdiente: Zirkus der Träume!
Der Erfolg jedoch blieb aus. Es schien gar, als hätte Robbles uns mit einem Fluch belegt, kurz bevor er verschwand. Eines Tages fiel mir dann dieses Buch mit dem Titel The Far West in die Hände. Ich las es an einem Tag und ohne dass ich mich daran erinnern konnte, es auch nur ein einziges Mal länger als eine Minute weggelegt zu haben, und während des Lesens hatte ich urplötzlich eine Idee, die mich nicht mehr losließ.
Und so hatte alles begonnen ... mit einer verwegenen Idee!
Paris, November 1859, einen Monat später
Seit Stunden regnete es ohne Unterlass. Der Wind fauchte wie ein Ungetüm, fuhr in und durch alle Ritzen und legte offen dar, wie unzulänglich wir nach dem letzten Herbststurm die Kuppel und die schrägen, einsam im Wind vor sich hin flatternden Seitenwände des Zeltes ausgebessert hatten. Wir, damit meinte ich Phillip de la Tour und seine Frau Margaret, beide wie ich Hochseilartisten. Dann waren da natürlich Julius Wegener, unser Clown, Mary und Jo Ann, zwei Schwestern aus Schweden, die ohne Ausnahme alle Männer verrückt machten, wenn sie ihre Röcke durch die Luft wirbelten und man ihre nackten Schenkel bewundern konnte. Kenneth, unser Messerwerfer, und Paul Bailey, ein Ire, der von Bordeaux aus zu uns gestoßen war, gehörten ebenfalls dazu, und dann natürlich Carmen, meine über alles geliebte Carmen.
»Die Niagarafälle? Das ist Selbstmord!«
Phillip saß auf einem vom Regen feuchten Strohballen und rauchte.
Wir anderen tranken heißen Kaffee mit einer Spur Cognac darin. Es war kalt. Der Atem wurde zu Eiskristall, sobald er die Lungen verließ, unsere Finger waren klamm und blau, unsere Nasenspitzen rot und mit feinen Adern durchzogen. In den Augen der anderen bemerkte ich ein seltsames Glänzen, das ich nicht nur mit dem Alkohol in Verbindung bringen wollte.
Hatte es vielleicht mit meinen verwegenen Plänen zu tun?
»Irgendwann wird es jemand wagen, und dieser Jemand wird reich und berühmt werden!«, hielt ich dagegen.
Phillip sah mich aus müden Augen an. Er kannte meine Ambitionen und wusste, dass meine Worte hauptsächlich an Carmen gerichtet waren, die einige Schritte weiter entfernt den Kopf gehoben hatte und unser Gespräch höchst aufmerksam verfolgte.
Sie sah mich an, wurde rot und sah schnell wieder weg.
Plötzlich war Phillip hellwach. Ihm war wohl der Ernst in meiner Stimme erst jetzt aufgefallen.
»Ich kenne da aber jemanden, der angeblich schon mal dort war«, sagte er aufgeregt.
»Am Grand Canyon?«, fragte ich sprachlos und mein Herz schlug Stakkato.
Er blinzelte leicht irritiert.
Ein kurzer Seitenblick verriet mir, dass, der Kälte zum Trotz, fast alle dem Thema nun ihre vollste Aufmerksamkeit gewidmet hatten, und das war schon mehr, als ich zu hoffen gewagt hatte.
»Nein, nein, nicht am Grand Canyon«, sagte Phillip. »Wir sprachen doch von den Niagarafällen!«
Auch er erhob sich. Sein mahnender Blick wirkte ernüchternd auf mich, berührte jedoch einen Stachel, der sehr tief saß.
»Dieser Jemand«, fragte ich aufgewühlt. »Könnte er uns hinführen?«
»Zu den Niagarafällen? Die Reise würde Monate dauern! Außerdem«, so fuhr er etwas ernüchtert fort, »ist der Mann, von dem ich spreche, weit über neunzig, bettlägerig und halb blind. Leider, und das ist wohl das Schlimmste an der Sache, spielt ihm seit kurzem auch sein Gedächtnis ab und zu einen Streich. Wenn ich es mir jetzt so richtig überlege, denke ich, ich hätte ganz einfach meinen Mund halten sollen. Also lasst uns die Sache einfach vergessen und …«
»Und was?«, unterbrach ich ihn entrüstet. Nichts hielt mich mehr auf dem Strohballen, der meinem Hintern eh nur Frostbeulen bescherte. »Sollen wir warten, bis Paris aufwacht und händeringend nach unseren drittklassigen Aufführungen schreit? Sollen wir hier im Dilettantismus versinken, während in der Neuen Welt eine dicke Scheibe vom großen Kuchen auf uns wartet?«
Ich hatte meine Stimme erhoben und sah, wie sich die anderen neugierig näherten. Carmen stand hinter mir, und so konnte ich den entzückten Ausdruck in ihrem Gesicht nur erahnen. Es gab nun kein Zurück mehr. Euphorisch erklärte ich mich.
»Gut! Es müssen nicht gleich die Niagarafälle sein. Aber lasst uns zumindest Spektakel machen, großes Spektakel!«
Ich machte eine weit ausholende Geste, drehte mich langsam um die eigene Achse und blinzelte Carmen zu.
»Hier kennt uns niemand, warum wohl eurer Meinung nach?«
Keiner machte sich die Mühe mir zu antworten. Wie eine Herde Schafe, die es gewohnt war, dass man die Antworten auf Fragen gleich mitlieferte, glotzten sie mich nur abwartend an.
»Herrgott!«, entfuhr es meinen Lippen. Ich war mir dabei der Theatralik des Augenblicks nur allzu sehr bewusst. »Weil es hier Künstlertrupps, wie wir es sind, zu Hunderten gibt. Das Podium ist platt, übersättigt, gelangweilt. Dort aber …«
Ich deutete mit dem Zeigefinger auf die gegenüberliegende nackte Wand, was Sinn machte, denn dort war Westen. »Dort drüben bauen sie neue Städte. Große Städte, und die Männer und Frauen dieser Städte heischen im Stillen nach Abwechslung. In den vorgeschobenen Forts langweilen sich Soldaten zu Tode. Soldaten, Büffeljäger und Trapper verbringen ihre Tage mit Saufen und …«
Kurzatmig hielt ich inne und sah kurz zu Carmen hinüber, bevor ich hitzig fortfuhr.
»Nun ja … Mit Saufen und mit dem nackten Fleisch irgendwelcher Squaws. Nur allzu gern würden sie die Hälfte ihrer Ersparnisse für eine etwas zivilisiertere Zerstreuung ausgeben. Oder stellt euch nur die Goldgräber vor, die unsere Vorstellungen sicherlich mit Goldstaub oder Nuggets bezahlen könnten, oder die Eisenbahnarbeiter, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen würden, nur um Marys und Jo Anns Cancan-Künste zu bewundern, und ...«
»Ärsche!«, fiel Paul mir laut ins Wort. »Marys und Jo Anns Arsch wollen sie bewundern, weil’s zur Abwechslung mal weiße Ärsche sind und keine braunen der Squaws.« Er lachte.
Carmen wurde wieder rot, doch Paul legte noch einen drauf.
»Es heißt ja, dass Indianersquaws nicht so katholisch sind wie unsere prüden Bräute hier in Europa. Ich könnte mir sogar vorstellen ...«
Mein scharfer Blick ließ ihn augenblicklich verstummen. Innerlich triumphierte ich, denn als ich wieder das Wort übernahm, klebten alle Blicke förmlich an meinen Lippen. Meine Idee hatte alle in ihren Bann gezogen. In allen Augen sah ich mehr als nur ein interessiertes Funkeln. Ich sah endlich Hoffnung!
Kenneth, die stumpfen Wurfmesser in der Hand, schob sich in den Vordergrund.
»Und woher weißt du das alles?«
»Ja«, fragte nun auch Phillip. »Woher weißt du das?«
»Woher, woher!«, äffte ich sie nach. »Könnt ihr denn nicht lesen? Die Zeitungen sind voll davon, New York, New Orleans, Baltimore. Jeden Monat laufen Schiffe aus. Sie fahren in die Neue Welt, kommen zurück mit Menschen an Bord, die drüben waren. Und die davon erzählen ...!«
»Ja. Menschen, die zurückkamen und erzählen, dass sie’s nicht geschafft haben!«, warf Phillip erzürnt ein. Er kam mir vor wie jemand, der sogar mitten im Hochsommer beim kleinsten Problem kalte Füße bekam. Sein Mangel an Abenteuerlust, an Mut und an Vertrauen missfiel mir immer mehr. War das der Phillip, den ich vor Tagen noch auf dem Hochseil bei einer waghalsigen Nummer und ohne Netz und doppelten Boden gesehen hatte?
Mir platzte endgültig der Kragen.
»Falls ich jedes Mal, wenn ich Angst habe etwas nicht zu schaffen, gleich die Flinte ins Korn werfe, dann sollte ich den Beruf wechseln. Angst lähmt, Angst ist der schlimmste Feind von Zuversicht, Angst hat noch nie dazu beigetragen, irgendwo eine bessere Welt zu schaffen!«
Ich schrie es fast, worauf alle entsetzt zurückwichen. Ich musste wohl ausgesehen haben wie der Teufel in Person, doch ich sprach aus Überzeugung.
Die Verwirrung dauerte nur einige Sekunden.
»Und was ist mit den Niagarafällen?«, erkundigte sich Kenneth.
»Das ist ein Gerücht, Ken«, erwiderte ich aus dem Bauch heraus, denn ich wusste die Antwort nicht. »Wer sollte schon so etwas Unsinniges gewagt haben wie die Niagarafälle zu überqueren? Niemand!«
Ich hielt den Atem an.
»Bis jetzt zumindest. Aber ich werde es tun. Wenn wir erst einmal berühmt sind, dann …«
»Blondin!«, sagte plötzlich eine laute Stimme hinter mir.
Ich drehte mich um und sah verwundert, aber auch etwas verärgert in Carmens haselnussbraune Augen.
»Blondin?«
Sie nickte, strich sich dabei eine rebellische Strähne aus dem Gesicht. Eine Geste, die ich nur allzu gut kannte. In diesem Augenblick wäre ich für sie sogar die Niagarafälle runtergesprungen, nackt mit einer Feder im Arsch, wenn sie es verlangt hätte!
»Charles«, sagte sie. »Charles Blondin. Er hat die Niagarafälle vor sechs Monaten überquert und das mehrere Male, soviel ich weiß!«
»Und woher weißt du das?«, fragte Phillip neugierig.
Carmen wurde rot. »Er … Er hat es mir gesagt!«
Nun war es heraus. Er hatte es ihr gesagt. Er, den ich gar nicht kannte, hatte sich nicht damit begnügt, mir meine Idee zu stehlen. Nein! Er hatte sogar die Dreistigkeit besessen in feindliches Gebiet vorzudringen, und das war Carmen allemal. Carmen, so dachte ich naiverweise, war mein Territorium, vermessen und abgesteckt in meinen kühnsten Gedanken. Doch was für ein Narr ich war! Hatte ich wirklich ernsthaft geglaubt, sie könnte mir allein gehören?
Dies alles ging mir im Bruchteil einer Sekunde durch den Sinn.
Mein Herz krampfte sich vor Enttäuschung zusammen. Alles Blut wich aus meinem Kopf, was dazu beitrug, dass ich keinen einzigen vernünftigen Gedanken mehr fassen konnte. Es schien, als konnten alle in diesem Augenblick meine Gedanken lesen, meine Angst und meine Enttäuschung riechen.
»Charles ist mein Cousin!«
»Und er hat die Niagarafälle überquert?«, hörte ich Kenneth wie von weitem fragen.
Carmen nickte. »Als Erster!«
Wieder stach ein Dolch in meine Eingeweide, aber meine Gedanken waren nun plötzlich klar, mein Angstschweiß getrocknet. Wie ein wütender Stier suchte ich nach der nächsten Herausforderung. In meiner Verzweiflung wandte ich mich an Phillip.
»Weiß dein Freund auch, wie wir zum Grand Canyon kommen?« Und mit einem mahnenden Blick auf Carmen: »Oder war dein geliebter Cousin dort etwa auch schon?«
Noch am selben Tag besuchten wir den unbekannten Alten, von dem Phillip gesprochen hatte. Er wohnte in einer Seitenstraße des Boulevard du Montparnasse und tatsächlich, der Mann schien sich auszukennen. Er erzählte uns von Landstrichen beiderseits zweier großer Flüsse, die er Mississippi und Missouri nannte. Während er erzählte, waren seine von einer mysteriösen Krankheit fast erblindeten Augen auf das halb geöffnete Fenster gerichtet. Sie erschienen mal trübe und matt, funkelten eine Weile später jedoch schon wieder wie glühende Kohlen. Wir selbst waren entzückt. Er sprach von satten grünen Wiesen, von Antilopenherden, welche die Ufer der Flüsse so zahlreich säumten, dass man ihre Zahl nur schätzen konnte, von endlosen Büffelherden, von friedlichen schwarzen Bären und von Wölfen, die in ganzen Rudeln auftauchten. Und er erzählte lebhaft von den Goldfunden und von den Menschen, die nach diesem Gold schürften. Obwohl er die Worte Milch und Honig nicht erwähnte, kam es uns genauso vor ... ein Land, in dem Milch und Honig floss! Was dieser Alte uns erzählte, sprengte bei weitem den Rahmen unserer Vorstellungskraft. Selbst den größten Gefahren, die von den Einheimischen, er nannte sie Indianer, ausgingen, gewann er nur eine gewisse träumerische, romantische Seite ab, und wir sahen das ebenso. Weshalb auch sollten die Indianer uns etwas anhaben wollen, würden wir doch nichts anderes verlangen, als dass sie uns in Ruhe ließen?
Als wir dem Boulevard du Montparnasse den Rücken zukehrten, hatten wir den Grand Canyon längst aus unserem Gedächtnis gestrichen. Unser tatsächliches Ziel war nun dieses geheimnisvolle Land nordwestlich einer Ortschaft Namens Fort Benton am oberen Missouri. Ein Land, und davon waren wir überzeugt, das Zukunft hatte. Wir handelten rasch. Zunächst warfen wir all unsere Ersparnisse in einen Topf. Das Ergebnis? Umgerechnet etwas mehr als siebentausend Dollar! Das war zu der Zeit eine beträchtliche Summe. Dazu kam eine Handvoll Edelsteine. Ich glaube sogar, es handelte sich dabei um Diamanten. Meine Mutter, Gott sei ihrer armen Seele gnädig, hatte sie mir am Tag, bevor sie starb, anvertraut. Ein silberner Armreif, den sie jahrzehntelang getragen hatte, vervollständigte meinen Reichtum. Die Einzige, die davon wusste, war Carmen; und so sollte es auch bleiben. Die wenigen Habseligkeiten, die wir besaßen, reduzierten wir auf ein striktes Minimum, drei große Kisten alles in allem. An einem grauen Morgen, als Paris noch schlief, stiegen wir in eine Kutsche. Unser Ziel war Toulon, wo wir hofften, sobald als möglich ein Schiff zu finden, das uns in die Neue Welt bringen sollte.
Adieu, altes Europa
Glich die Fahrt über das Meer einer Herausforderung, einem Abenteuer, wie niemand von uns es je zuvor aufregender erlebt hatte, die Reise von der wilden Küste in New Orleans bis hinauf nach St. Louis war es nicht. Im Gegenteil. Sie war Ernüchterung, Schikane, eine Tortur! Die wilden Herbststürme schüttelten die Barke derart durch und es regnete so stark, dass wir uns nicht nach draußen ans Oberdeck wagen konnten, und wir alle litten an der Seekrankheit, Carmen, die Arme, am meisten. In St. Louis verbrachten wir unsere erste längere Etappe und dort bestätigten sich die Aussagen des Mannes in Paris prompt. Ich war eines Abends alleine losgezogen und hatte es mir in einer überfüllten Pinte gemütlich gemacht. An diesem schrecklichen Ort stank es penetrant nach Tabak, Bier und Schweiß. An der Bar lehnten bewaffnete, ungepflegte bärtige Männer, während in der mir gegenüber liegenden Ecke ein Mann mit Zylinder vergeblich versuchte, einem alten Piano ein paar Töne zu entlocken. Draußen in den schlammgefüllten Straßen fiel irgendwo ein Schuss. Laute Stimmen drangen zu uns herein. Ein zweiter Schuss beendete das Tohuwabohu. Mir gegenüber am Tisch saß ein alter und recht redseliger Mann.
»Ja, ja! Nördlich von Fort Benton irgendwo an den Quellen des Missouri liegt ein Paradies. Wenn Sie reich und berühmt werden wollen, dann gehen Sie dorthin ... nach Fort Benton!«
Solche oder ähnliche Sprüche hörten wir in St. Louis an jeder Straßenecke, doch der Mann, aus dessen Mund diese Worte nun kamen, machte einen ernsten und aufrichtigen Eindruck auf mich. Ich rückte näher an ihn heran, um mir bloß kein Wort von dem, was er zu sagen hatte, entgehen zu lassen. Die Neugier hatte mich gepackt. Bevor er weitersprach, drehte sich der Alte um und sah vorsichtig über seine Schulter hinweg. Fast ängstlich fügte er leise hinzu:
»Da oben in Montana gibt es Gold, das hat mir ein alter Blackfeet Indianer vor kurzem erzählt. Derselben Meinung sind auch der eine oder andere Trapper, die meinen Weg dieser Tage kreuzten.«
Gold! Es stimmte also. In mir brodelte es.
»Und?«, fragte ich wie beiläufig. »Was hat dein Indianer-Freund noch erzählt? Gold, musst du wissen, interessiert mich nicht so doll.«
Ich musste nicht mal lügen, doch der Alte sah mich an, als hätte ich den Verstand verloren.
»Nun, er sagte auch, dass es viele Stromschnellen gibt am oberen Missouri, und einen großen Wasserfall, vielleicht größer als der Niagara!«
Mein Herz tobte in der Brust. Größer als der Niagara, das hieß bekannter und berühmter als dieser Blondin, das hieß ...! Ich spann diesen Gedanken nicht zu Ende, lächelte stattdessen dem Alten ermunternd zu, doch aus irgendeinem Grund wollte er nicht mehr preisgeben.
»So, und nun sag ich besser gar nichts mehr«, bemerkte er hustend. Er zog an seinem fettigen, vom Nikotin gelben Zigarettenstummel und schwieg beharrlich. Erst jetzt bemerkte ich, dass ihm beide Beine fehlten. Nach einer Weile zahlte und verabschiedete er sich von mir. Auf seinen Wink hin erschien ein großer und kräftiger Junge, beugte sich zu ihm hinab und nahm ihn in seine Arme. Kurz darauf waren beide aus meinem Blickfeld verschwunden.
Je schneller die Tage vergingen, und je intensiver wir die rüde Welt um uns herum beobachteten, desto klarer wurde uns eine Sache: Keiner von uns war auf das, was uns erwarten würde, vorbereitet. Niemand hatte auch nur ein einziges Mal den Winter im Freien verbracht oder gar gelernt, wie man ein einfaches Feuer macht, in einer eisigen Nacht Wache steht oder ein Gewehr abfeuert und es danach ölt, Dinge, die, wenn man hier überleben wollte, unverzichtbar, wenn nicht sogar lebensnotwendig waren. Wir waren uns also alle einig, dass wir jemanden brauchten, der uns führte. Doch hier in St. Louis war es noch zu früh, nach diesem Jemand Ausschau zu halten. Von St. Louis aus fuhren wir also mit dem nächsten Dampfschiff erst nördlich den Mississippi und dann Richtung Westen den Missouri stromaufwärts. Das Wetter war günstig und unsere Stimmung beschwingt. Dieser Enthusiasmus hielt auch dann noch an, als wir die Lichter von Kansas City am Horizont erblickten. Vom Westen her zog ein Gewitter auf. Riesige Wolken hingen wie Trauben dunkelgrau über der Stadt. In Kansas City angekommen regnete es in Strömen. Die Straßen waren ein Gräuel aus knöcheltiefem Matsch, der Ort selbst trist, kurz, es war der erbärmlichste Flecken Erde, den wir jemals gesehen hatten! Wir quartierten uns in einem Zeltlager ein, welches weder Intimität gewährte noch unser Bedürfnis nach etwas Ruhe und Erholung auch nur annähernd stillte. Unter den Paletten, auf denen unsere Feldbetten standen, floss stinkendes Wasser durch die glitschigen Lattenroste aus Holz, es war laut und Ratten huschten sogar tagsüber ungeniert an einem vorbei. Jedes dritte Gebäude war entweder ein Saloon oder ein Store, in dem man Waffen, Munition, Lebensmittel, Biberfelle oder sonst was erstehen konnte. Da jedermann gezwungen war hier zu kaufen, waren die Preise entsprechend gesalzen, und die Händler und Saloon-Besitzer rieben sich kräftig die speckigen Hände. An jeder Häuserecke boten sich Frauen schamlos an. Frauen schien es überhaupt nur zwei Sorten zu geben: leichte Mädchen, zierlich und graziös, aber allesamt raffinierte Biester, oder derbe Siedlerinnen, Abenteuerinnen mit sehr männlichen Zügen. Man sah viele Auswanderer, vornehmlich Deutsche, Franzosen wie wir und Spanier. Es gab Trapper, Pelzhändler, Soldaten, Spieler, Scouts, Indianer und Neger, Banditen aller Art, und alle, die Siedler und die Indianer mal ausgenommen, waren nur aus einem Grund hierhergekommen. Sie suchten Fortuna, den schnellen Profit! Auf eine Frau kamen im Schnitt fünfzig Männer und am liebsten hätte ich Carmen, die seit Tagen seltsam still war, irgendwo versteckt. Um sie bei Laune zu halten, schenkte ich ihr den silbernen Armreif meiner Mutter und ich muss sagen, er stand ihr ausgesprochen gut. Im Gegenzug küsste sie mich flüchtig. Von den viertausend Dollar, die uns blieben, nachdem wir unsere Passage bis hierher bezahlt hatten, sollte der Großteil genügen bis nach Fort Benton zu kommen, um dort einige Ochsenkarren, zwei oder drei Pferde und genügend Trockenfutter für die Tiere zu erstehen. Die Liste der Dinge, die wir für den langen Trip benötigen würden, war ellenlang: stählerne Äxte, einige kleine Holzfässer, Seile, Schnur und Riemen, Medikamente, ein kleiner Vorrat Whiskey, Zündhölzer, Zelte, Töpfe und Kannen, ausreichend Proviant, Tabak, genügend Munition und, und, und. Damit wollten wir nach Norden zu den neuen Siedlungen aufbrechen, von denen jeder sprach, doch nach wie vor fehlte uns jemand, der uns den Weg weisen würde.
Lebœuf
»Der mit der Fellmütze ...!«
Einen kalten Zigarrenstummel im Mund, deutete der zahnlose und recht schmuddelige Barkeeper auf einen Mann, der allein am Tresen stand.
»Er könnte Ihnen weiterhelfen!«
Ich ging zu dem Mann hinüber.
Sein Name war Marc Lebœuf, wenigstens nannte er sich so.
»Wildes Land«, sagte er fast gelangweilt, als ich ihm gegenüber zum ersten Mal erwähnte, in welche Gegend wir uns begeben wollten. »Man sagt, dass es Gold gibt oben in Montana, doch niemand weiß das so genau. Wenn dem so ist, heißt das, dass über Nacht eine oder mehrere Städte wie Pilze aus dem Boden schießen werden. Das ist immer so.«
Hierbei stöhnte er und tat, als ob ihn das alles nicht im Mindesten berührte, es ihm sogar lästig war darüber zu sprechen. Er gab sich lässig und das beeindruckte mich zutiefst.
Und wieder das Wort Gold! Es stimmte also, der Alte von St. Louis hatte recht gehabt, damit zumindest.
Lebœuf fuhr im selben gleichgültigen Ton fort.
»Aber da ist noch etwas, ich denke, das sollten Sie wissen. Wenn Sie da hoch in die Mountains wollen, kriegen Sie es mit den Assiniboin, den Cree und den Blackfeet, gleichzeitig zu tun. Das schaffen Sie nie, es sei denn …«
Ich sah plötzliches Interesse in seinen Augen flackern, konnte mich aber auch täuschen. Er leerte sein Glas Whiskey in einem Zug und wischte sich das glattrasierte Kinn mit dem Handrücken sauber. »Es sei denn, Sie investieren etwas Geld in eine Schutztruppe. Ich würde mich anbieten. Meine Männer und ich wären froh, uns auf diese Art etwas ehrliches Geld zu verdienen. Ständig in den Bars rumlungern ist nicht so das Gelbe vom Ei.«
Dieser Lebœuf war groß. Ich schätzte ihn auf eins neunzig. Bei einem ungefähren Gewicht von etwa zweihundertvierzig Pfund war er eine eindrucksvolle Erscheinung. Er trug ein Cape aus Biberfell Marke Astor, sein Kopf darunter war kahl und in einem Holster sah ich einen mattierten Colt, dessen hölzerne Griffstücke vom häufigen Gebrauch speckig glänzten. Ich rückte näher und nickte dem Barkeeper zu.
»Noch mal dasselbe für diesen Gentleman!«
Der Barkeeper grinste.
Während dieser Lebœuf vor Selbstsicherheit und Energie nur so strotzte, war ich vor Angst und Unsicherheit wie gelähmt.
»Eine Schutztruppe, sagten Sie?«
Meine Stimme musste erbärmlich in seinen Ohren klingen.
Er nickte. »Sagte ich! Lohnt sich aber nur, wenn sich mehrere von eurer Sorte zusammentun. Wird sonst zu teuer.«
Er griff nach dem Glas, das der Barkeeper auf den Tresen gestellt hatte, und grunzte dankbar. »Soviel ich weiß, sind Sie nicht die Einzigen, die es in die Richtung treibt. Unten am Fluss stellen sie gerade einen Konvoi zusammen. Doch wie schon gesagt ist niemand dabei, der Land und Leute kennt, schade aber auch, denn noch bevor der Monat zu Ende ist, werden die meisten von denen eines gewaltsamen Todes sterben, und es wird niemand da sein, der sie begräbt und ihnen zu Gedenken post mortem einen schönen Spruch vom Stapel lässt. Wirklich jammerschade!«
Er trank, stellte das Glas auf die Theke zurück und wandte sich zum Gehen.
Als er die Schwingtüre des schmuddeligen Saloons fast erreicht hatte, holte meine Stimme ihn ein.
»Ich denke, dass so ein Treck es auch ohne eine Schutztruppe schaffen könnte, wenn nur ein paar beherzte Männer darunter sind. Mit ein paar Wilden nehmen wir es allemal auf!«
Lebœuf blieb wie angewurzelt stehen, schnappte nach Luft und zuckte dann nur mir der Schulter.
»Wenn Sie meinen, dann viel Spaß«, stieß er hervor und verschwand aus meinem Blickfeld.
»Sie sollten auf ihn hören, Mister«, meinte der Barkeeper, der unser Gespräch verfolgt hatte. »Lebœuf kennt sich in den Bergen aus wie kein Zweiter. Noch einen?« Er schickte sich an, mein Glas nachzufüllen, was ich dankend ablehnte.
Noch am selben Abend sprach ich mit den anderen darüber.
»Wie mir scheint«, sagte Kenneth ernst, »gibt es Männer wie diesen Lebœuf wie Sand am Meer. Ich hab mich umgesehen, während du weg warst. Es sind mächtig viele Trapper in der Stadt. Gibt ’ne Menge Waldläufer, die ihre Westentasche nicht besser kennen als die Gegend, wo wir hinwollen.«
»Du hast vielleicht recht«, sagte Margaret. »Aber zumindest ist dieser Mann Franzose, ein Ehrenmann, falls er wirklich so ist, wie Andrew ihn beschrieben hat!«
Paul, unser Ire, spuckte in den nassen Sand neben ihr.
»Ein Franzose und Ehrenmann, das wär ja noch schöner! Andrews Beschreibung nach war’s wohl eher ein Preisboxer, der nach einem unvorsichtigen Opfer Ausschau hält. Passt du eine Sekunde lang nicht auf, paff, gibt’s auf die Nase! Solchen Typen sind wir doch hilflos ausgeliefert, sobald wir der Zivilisation den Rücken kehren. Habt ihr auch daran gedacht?«
Irgendwann in den frühen Morgenstunden einigten wir uns. Wir wollten die Menschen sehen, denen es ähnlich ging wie uns, denn falls Lebœuf recht hatte, dürften wir nicht die Einzigen sein, die sich gerade mit solchen Diskussionen das Leben schwer machten. Am Fluss erwartete uns eine Überraschung. Die Menschen, die sich hier gruppiert hatten, es handelte sich um drei Deutsche untereinander verwandter Familien, trugen alles, was sie besaßen, entweder am Leib oder hatten es in einige Kisten verstaut, die sie unter schweren Regenplanen vor allzu neugierigen Blicken zu verbergen suchten. Das kleine Lager war gepflegt. Alles in allem zählten wir ungefähr fünfundzwanzig Männer, Frauen und Kinder. Neugierig starrten sie uns entgegen: große Kinderaugen, skeptisches Frauenblinzeln, Augenspiele, prüfende, ja feindselige Blicke von Männern und großen Buben. Ein Mann, seine mächtigen Arme auf der breiten Brust verschränkt, versperrte uns schließlich den Weg. Er schien entschlossen, uns zur Rede zu stellen, was er auch tat.
»Was wollt ihr hier?«
Es klang alles andere als einladend, und so kam meine Antwort ebenso trocken.
»Nur mit euch reden, Monsieur!«
Der Mann nickte kaum merklich, seine Miene blieb jedoch verschlossen.
»Wir hörten, dass euer Ziel der obere Missouri ist, Fort Benton, die Ecke?«
Daraufhin sah er mich nur an, und ich war mir nach einer Weile gar nicht mehr so sicher, ob er mich überhaupt verstanden hatte.
»Nun«, ich deutete hinter mich, »dahin wollen wir nämlich auch. Vielleicht wäre es keine gar so schlechte Idee, wenn wir uns zusammentäten, schon allein wegen der Indianer.«
Noch während ich sprach, bemerkte ich, wie der Mann vor mir immerzu auf meine Waffe starrte, ein nagelneues französisches Infanterie-Gewehr von eindrucksvoller Länge. Wir hatten uns bei der Ankunft in St. Louis mit einem halben Dutzend dieser Gewehre eingedeckt, ein Muss, wollte man in diesem Land überleben, so viel wusste sogar ich. Was ich noch wusste: dass jedes dieser Gewehre jemandem auch über große Distanz hinweg den Arsch wegpusten konnte. Die Mündung zeigte genau auf die Körpermitte des Mannes, was wohl seinen bösen Gesichtsausdruck erklärte, und das wurde mir erst jetzt so richtig bewusst. Rasch senkte ich den Lauf. Ich sah mich im Lager um, erblickte aber nirgends auch nur eine einzige Waffe. Diese Leute hatten Angst, und es war diese Angst, die sie dazu trieb, uns gegenüber eine ablehnende Haltung einzunehmen.
Behutsam klopfte ich mit der Handfläche zweimal gegen den Schaft meines Gewehrs. »Glauben Sie, Sie könnten mit so einer Waffe umgehen?«
Die Augen meines Gegenübers blitzten kurz auf, was mir natürlich nicht entging. Er schien zu überlegen, war aber absolut nicht gewillt, mich an seinen Überlegungen teilhaben zu lassen. Als ich die Schlacht längst verloren glaubte, geschah das Wunder.
Unser Clown Julius drängte sich an mir vorbei. Sein Clownskostüm glitzerte rot, grün und hellblau. Von seinem Hals baumelte eine Kette mit bunten, kleinen, lachenden Hundefratzen. Süß, lustig! Selbst ich musste lachen, als ich hinsah. Die mit Ölfarbe getünchten Bälle, die er im atemberaubenden Tempo jonglierte, wurden von großen Kinderaugen aufmerksam verfolgt. Die Kinder hatte ich zuerst gar nicht bemerkt, doch es waren so ziemlich ein Dutzend, von vier bis vierzehn Jahren, Jungen und Mädchen.
Ahhhh, Ohhhh!
Ich nutzte die Gelegenheit, trat einen Schritt vor und streckte dem verdutzten Mann die Waffe hin. »Es ist ein Geschenk, nein wirklich … wir können sie entbehren. Ich kann Ihnen auch erklären, wie sie funktioniert, wie man sie abfeuert und erneut lädt!«