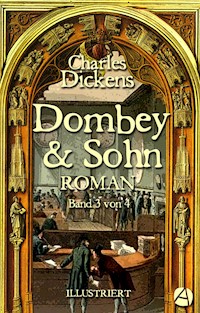
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Tragödie des Paul Dombey
- Sprache: Deutsch
Paul Dombey ist ein wohlhabender, stolzer und kalter Mann, der nur einen Wunsch hat: einen Sohn, der seinen Namen trägt und das Geschäft weiterführt, das er aufgebaut hat. Als Paul Dombey sein Sohn geboren wird, den er ebenfalls Paul nennt, glaubt er endlich den Nachfolger für sein Unternehmen zu haben, auf den er solange gehofft hatte – ist sein erstes Kind Florence doch als Tochter für seine geschäftlichen Belange nicht weiter zu gebrauchen. Doch Paul entwickelt sich nicht so kräftig, gesund und vielversprechend, wie Dombey es erwartet… „Dombey und Sohn“ ist die fesselnde Darstellung eines Mannes, der in seinem eigenen Stolz gefangen ist, und zeigt die verheerenden Auswirkungen emotionaler Verarmung auf eine dysfunktionale Familie. Paul Dombey führt seinen Haushalt so, wie er sein Geschäft führt: kalt, berechnend und kommerziell. In dem Maße, wie Dombeys Gefühllosigkeit sich auf andere ausweitet, einschließlich seiner trotzigen zweiten Frau Edith, legt er den Grundstein für seinen eigenen Untergang. “Dombey und Sohn” ist voller unvergesslicher Charaktere und Szenen, die mit einer fast surrealen Intensität geschrieben sind. Der Roman ist, wie die meisten von Dickens’ Werken, von eindringlicher Sprache und stiller Melancholie geprägt. Die Geschichte veranschaulicht die alte Botschaft, dass nichts außer Liebe und Güte zählt, dass wir und alles, was wir haben, vergänglich ist und dass Stolz und Egoismus die verderblichsten Waren sind, die man auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten kaufen kann. Es gibt (typisch für Dickens) viele groteske Figuren in dem Roman – einige gute (der liebevolle und gutmütige Kapitän Cuttle, die freche und defensive Susan Nipper), einige schlechte (die mürrische Mrs. Pipchin, der kriecherische Major) und einige böse (das Sinnbild vollendeter Heuchelei – Mr. Carker). Der Charakter des frühreifen und dem Untergang geweihten Paul Dombey ist jedoch eine literarische Schöpfung eigener Klasse. Das Kapitel mit dem Titel “Was die Wellen immer sagten” beschreibt mit halluzinatorischer Intensität die Welt in den Augen eines sterbenden Kindes und war eine der berühmtesten Szenen der viktorianischen Zeit; sie bleibt eine der stärksten in der gesamten Literatur. „Dombey und Sohn“ hat alles, was der reife Dickens zu bieten hat. Lebendige Charaktere, eine fesselnde Geschichte und Sätze von beeindruckender Tiefe und Scharfsinn. Dies ist der dritte von insgesamt vier Bänden. Illustrierte Ausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
CHARLES DICKENS
DOMBEY UND SOHN
ROMAN
IN VIER BÄNDEN
BAND DREI
ILLUSTRIERT
DOMBEY UND SOHN wurde zuerst im englischen Original als Fortsetzungsroman veröffentlicht von Bradbury & Evans, London 1846-48.
Diese Ausgabe in vier Bänden wurde aufbereitet und herausgegeben von
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
1. Auflage 2022
V 1.0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
Band Drei
ISBN 978-3-96130-524-7
Buchgestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Erhalte zwei eBook-Klassiker gratis als Willkommensgeschenk!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen sehr kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
***
Charles Dickens
DOMBEY UND SOHN
BAND EINS | BAND ZWEI | BAND DREI | BAND VIER
Klicke auf die Cover oder die Textlinks!
GESAMTAUSGABE
***
BUCHTIPPS
Entdecke unsere historischen Romanreihen.
Der erste Band jeder Reihe ist kostenlos!
DIE GEHEIMNISSE VON PARIS. BAND 1
MIT FEUER UND SCHWERT. BAND 1
QUO VADIS? BAND 1
BLEAK HOUSE. BAND 1
Klicke auf die Cover oder die Textlinks oben!
Am Ende des Buches findest du weitere Buchtipps und kostenlose eBooks.
Und falls unsere Bücher mal nicht bei dem Online-Händler deiner Wahl verfügbar sein sollten: Auf unserer Website sind natürlich alle eBooks aus unserem Verlag (auch die kostenlosen) in den gängigen Formaten EPUB (Tolino etc.) und MOBI (Kindle) erhältlich!
* *
*
Inhaltsverzeichnis
DOMBEY UND SOHN. Band Drei
Impressum
BAND DREI
Erstes Kapitel.
Die Trauung.
Zweites Kapitel.
Der hölzerne Midshipman geht in die Brüche.
Drittes Kapitel.
Gegensätze.
Viertes Kapitel.
Wieder eine Mutter und eine Tochter.
Fünftes Kapitel.
Das glückliche Paar.
Sechstes Kapitel.
Der offizielle Einzugsschmaus.
Siebentes Kapitel.
Mehr als eine Warnung.
Achtes Kapitel.
Miß Tox nimmt eine alte Bekanntschaft wieder auf.
Neuntes Kapitel.
Weitere Abenteuer des Schiffskapitäns Edward Cuttle.
Zehntes Kapitel.
Häusliche Verhältnisse.
Elftes Kapitel.
Neue Stimmen auf den Wellen.
Zwölftes Kapitel.
Vertraulich und zufällig.
Dreizehntes Kapitel.
Nachtwachen.
Vierzehntes Kapitel.
Eine Trennung.
Fünfzehntes Kapitel.
Die zuverlässige Mittelsperson.
Sechzehntes Kapitel.
Prüfend und nachdenklich.
Siebzehntes Kapitel.
Der Donnerschlag.
Eine kleine Bitte
Charles Dickens im apebook Verlag
Buchtipps für dich
Kostenlose eBooks
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
Links
Zu guter Letzt
BAND DREI
Erstes Kapitel.
Die Trauung.
Das Grauen des Tages mit seinem leidenschaftslosen Antlitz stiehlt sich schaudernd nach der Kirche, unter welcher der Staub des kleinen Paul neben dem seiner Mutter liegt, und blickt durch die Fenster hinein.
Es ist kalt und dunkel. Die Nacht duckt sich noch nieder auf dem Pflaster und brütet schwer und düster in den Nischen und Winkeln des Gebäudes. Die über die Häuser erhabene Turmuhr, auftauchend unter den andern zahllosen Wellen in der Flut der Zeit, die regelmäßig nach dem ewigen Gestade rollt und sich daran bricht, ist nur in graulichem Lichte sichtbar gleich einem steinernen Leuchtturm, der den Wogengang anzeigt; aber innerhalb der Türen kann die Dämmerung nur nach der Nacht hereinschauen und sehen, daß sie da ist.
Matt um die Kirche her sich breitend und hineinblickend, stöhnt und weint das Zwielicht um seine kurze Herrschaft. Seine Tränen träufeln an den Fensterscheiben nieder, und die Bäume beugen ihre Häupter gegen die Kirchenmauer, indem sie zugleich teilnehmend ihre vielen Hände ringen. Die erbleichende Nacht schwindet allmählich aus der Kirche, zögert aber noch in den Gewölben unten und setzt sich auf die Särge. Und nun kommt der helle Tag, die Uhr vergoldend, den Kirchturm rötend, die Tränen der Dämmerung trocknend und ihre Klagen erstickend. Das scheue Zwielicht folgt der Nacht, jagt sie aus ihren letzten Zufluchtsorten, schleicht selbst in die Gewölbe und verbirgt sich mit erschrecktem Gesichte unter den Toten, bis die Nacht neu belebt zurückkehrt, um es davon auszutreiben.
Und jetzt verbergen die Mäuse, die sich mit den Gebetbüchern mehr zu schaffen machen als ihre regelmäßigen Eigentümer, und mit ihren kleinen Zähnen die Kirchenröcke mehr abnützen, als es von menschlichen Knien geschieht – ihre hellen Augen in den Löchern und drücken sich dicht aneinander in ihrem Schrecken über das dröhnende Knarren der Kirchentür. Denn der Kirchendiener, dieser gewaltige Mann, ist am heutigen Morgen mit dem Küster früh auf den Beinen, und Mrs. Miff, die schweratmige kleine Kirchstuhlöffnerin – eine außerordentlich ausgetrocknete, dürftig gekleidete alte Dame, an welcher der Finger nirgends auch nur einen Zoll Fülle fassen kann – hat sich gleichfalls eingefunden und an dem Portal, als an dem ihr zustehenden Platz, schon eine halbe Stunde auf den Kirchendiener gewartet.
Mrs. Miff hat ein Essiggesicht, ein zerbeultes Hütchen und eine nach Sixpencen und Schillingen dürstende Seele. Das Hereinwinken verirrter Leute nach den Kirchstühlen hat ihr eine geheimnisvolle Miene verliehen, und auch in ihrem Auge drückt sich eine Zurückhaltung aus, als wisse sie noch immer einen weicheren Sitz, obschon sie mißtrauisch sei wegen der Belohnung. Es gibt keinen Mr. Miff und hat auch seit zwanzig Jahren keinen gegeben; darum vermeidet auch Mrs. Miff es gerne, auf ihn anzuspielen. Wie es scheint, hegte er gar schlimme Ansichten betreffs Freisitze, und obschon Mrs. Miff hofft, seine Seele werde aufwärts gegangen sein, wagt sie es doch nicht, dies mit Bestimmtheit zu behaupten.
Mrs. Miff ist diesen Morgen vor der Kirchtür mit Ausstäuben des Altartuchs, des Teppichs und der Polster emsig beschäftigt. Auch weiß sie viel über die bevorstehende Hochzeit zu erzählen. Sie weiß, daß die neuen Möbel und die Veränderung im Hause ein Vermögen kosten, und hat aus der besten Quelle in Erfahrung gebracht, daß die Braut kein Sixpencestück besitzt, um sich damit bekreuzigen zu können. Ferner erinnert sich Mrs. Miff, als sei es gestern gewesen, des Leichenbegängnisses der ersten Frau, dann der Taufe und endlich der andern Beerdigung. Auch meint sie, sie wolle doch sogleich jenes Täfelchen dort mit Seifenwasser bearbeiten, ehe der Brautzug anlange. Mr. Sownds, der Kirchendiener, der die ganze Zeit über auf der Kirchentreppe in der Sonne sitzt und selten etwas anderes tut, wenn er nicht etwa bei kaltem Wetter das Feuer vorzieht, schenkt beifällig Mrs. Miffs Reden Gehör und fragt sie, ob ihr nicht zu Ohren gekommen wäre, daß die Dame ungemein schön sei. Mrs. Miff hat hievon Kunde, und Sownds, der Kirchendiener, der trotz seiner Rechtgläubigkeit und Korpulenz noch immer ein Bewunderer von weiblicher Schönheit ist, bemerkt mit Salbung, ja, er habe in Erfahrung gebracht, sie sei ein Kernstück – ein Ausdruck, der Mrs. Miff ein wenig zu kräftig scheint und auch von jeder andern Lippe als von der des Kirchendieners Mr. Sownds so erscheinen dürfte.
Mittlerweile geht es in Mr. Dombeys Hause wirr und bunt durcheinander, namentlich unter den Dienstmägden, denn keine derselben hat von vier Uhr an auch nur einen Augenblick geschlafen, und alle sind schon vor sechs in vollem Putz. Mr. Towlinson wird von der Hausmagd mehr als je berücksichtigt, und beim Frühstück sagt die Köchin, daß eine Hochzeit noch viele nach sich ziehe – eine Behauptung, der die Hausmagd keinen Glauben schenken kann, da sie dieselbe für ganz und gar unrichtig hält. Mr. Towlinson behält seine Ansicht über diese Frage für sich und ist überhaupt etwas verstimmt über die Einstellung eines Ausländers mit einem Backenbart (Mr. Towlinson ist selbst bartlos), der das glückliche Paar nach Paris begleiten soll und sich eben mit Bepackung des neuen Wagens zu schaffen macht. In Beziehung auf diese Person weiß Mr. Towlinson sogleich, daß bei Ausländern nie etwas Gutes herausgekommen sei, und da ihn die weibliche Dienerschaft des Vorurteils zeiht, so erklärt er, man solle nur den Bonaparte ansehen, der an ihrer Spitze gestanden habe; ob dieser nicht das beste Beispiel gebe. Das ist ein Hinweis, gegen den die Damen des Haushalts keine Einsprache zu erheben vermögen.
Der Pastetenbäcker hat in dem leichenhaften Zimmer zu Brook-Street alle Hände voll zu tun, und die sehr langen jungen Männer sehen emsig zu. Einer derselben riecht bereits stark nach Wein, und seine Augen verraten die Neigung, starr in seinem Kopf stehenzubleiben und die Gegenstände anzuglotzen, ohne sie selbst zu sehen. Der sehr lange junge Mann ist sich selbst dieses Gebrechens bewußt und teilt seinen Kameraden mit, die Erbauung sei daran schuld; seine Sprache war jedoch etwas umnebelt, und er wollte wahrscheinlich Erregung sagen.
Die Glockenmänner haben eine Witterung von der Hochzeit; ebenso auch die mit den Markknochen und die Blechmusikbande. Die ersten üben sich in einem hinteren Hofe unfern von Battle Bridge ein; die zweiten setzen sich durch ihren Hauptmann mit Mr. Towlinson in Verbindung, dem sie die Honorarforderungen mitteilen. Die dritte lauert und duckt sich in der Person eines schlauen Posaunisten um die Ecke und harrt auf irgendeinen gefälligen Menschen, der ihm gegen Bestechung den Platz und die Stunde des Frühstücks andeuten soll.
Die Erwartungen und Aufregungen greifen noch mehr um sich und verbreiten sich weiter. Mr. Perch bringt von Balls Pond seine Frau mit, damit sie den Tag unter Mr. Dombeys Dienstleuten zubringe und diese verstohlenerweise begleite, um die Trauung mitanzusehen. Mr. Toots kleidet sich in seiner Wohnung, als sei er selbst wenigstens der Bräutigam, und entschließt sich, das prachtvolle Schauspiel von einer geheimen Ecke der Emporkirche aus mitanzusehen, wohin ihn der Preishahn begleiten soll. Denn Mr. Toots hegt den verzweifelten Plan, letzterem Florence zu zeigen und unverhohlen zu ihm zu sagen: »Ich will Euch nicht länger täuschen, Preishahn. Der Freund, von dem ich hin und wieder mit Euch sprach, bin ich selbst, und Miß Dombey ist der Gegenstand meiner Leidenschaft. Was haltet Ihr bei solchem Stand der Dinge von der Sache, und was ratet Ihr mir nunmehr?«
Der Preishahn, dem eine solche Überraschung bevorsteht, netzt inzwischen in Mr. Toots Küche seinen Schnabel mit einem Becher starken Biers und pickt ein paar Pfunde Beefsteaks zusammen. Auf dem Prinzessinnenplatz ist Miß Tox geschäftig; denn ungeachtet ihrer tiefen Betrübnis hat auch sie sich vorgenommen, Mrs. Miff einen Schilling in die Hand zu drücken und die Feierlichkeit, die für sie eine so grausame Entzauberung ist, von einer einsamen Ecke aus anzusehen. Selbst in dem Quartier des hölzernen Midshipman geht es lebhaft zu; denn Kapitän Cuttle sitzt mit seinen Bundstiefeln und einem ungeheuren Hemdkragen bei seinem Frühstück und hört Rob dem Schleifer zu, der ihm zum voraus das Trauungsritual vorlesen muß, damit sein Gebieter die hehre Szene, an der er teilnehmen will, gehörig verstehe. Dabei erteilt der Kapitän von Zeit zu Zeit an seinen Kaplan die ernste Weisung, »haltzumachen« oder »diesen Artikel noch einmal zu wiederholen«, verweist ihn auf die ihm zustehende Pflicht und verlangt, daß er die »Amen« ihm, dem Kapitän, überlasse – eine Obliegenheit, die er mit klangvoller Selbstbefriedigung erfüllt, so oft Rob, der Schleifer, eine Pause macht.
Außerdem haben allein in Mr. Dombeys Straße zwanzig Kindermädchen ebenso vielen Familien von kleinen Frauenzimmern, deren instinktartiges Interesse für Hochzeiten schon von der Wiege herstammt, versprochen, daß sie die Trauung mitansehen dürften. Mr. Sownds, der Kirchendiener, hat in der Tat guten Grund, die Würde seines Amtes zu fühlen, wie er so dasitzt, um seine stattliche Gestalt auf der Kirchentreppe zu sonnen, und der Trauungsstunde entgegensieht. Ferner darf Mrs. Miff auf ein unglückliches zwerghaftes Kind mit einem riesigen Wickelbübchen, das zum Portal hineinschaut, losstürzen und es entrüstet fortjagen.
Vetter Feenix ist ausdrücklich in der Absicht, der Hochzeit beizuwohnen, von seiner Reise zurückgekehrt. Er hat schon vor vierzig Jahren als ein Lebemann gegolten, ist aber noch so jugendlich in Gestalt und Benehmen, dabei so gut erhalten, daß Fremde nicht genug erstaunen können, wenn sie in Seiner Herrlichkeit Gesicht verborgene Falten und in seinen Augen Krähenfüße entdecken, oder zum erstenmal die Bemerkung machen, daß sein Gang etwas unsicher sei. Wenn aber Vetter Feenix um halb acht Uhr oder so aufsteht, ist er etwas ganz anderes, als der aufgestandene Feenix, und er hat in der Tat ein sehr trübes Aussehen, solange er noch in Longs Hotel zu Bond-Street rasiert wird.
Mr. Dombey verläßt sein Ankleidezimmer unter einem allgemeinen Zurückweichen des Frauenpersonals von der Treppe, das sich mit einem gewaltigen Rauschen der Kleider nach allen Richtungen zerstreut. Nur Mrs. Perch, die sich wie gewöhnlich in einer interessanten Lage befindet, ist nicht so fix, sondern muß ihm entgegentreten und ist in ihrer Verwirrung bereit, vor lauter Knixen in die Erde zu sinken – möge der Himmel alle übeln Folgen von dem Hause Perch abwehren! Mr. Dombey begibt sich nach dem Besuchszimmer hinauf, um zu warten, bis seine Zeit gekommen ist. Wie prächtig ist nicht sein neuer blauer Frack, die rehfarbene Beinbekleidung und die lila Weste Auch verbreitet sich ein Geflüster durch das Haus, daß Mr. Dombeys Haar gekräuselt sei.
Ein Doppelschlag meldet die Ankunft des Majors, der sich gleichfalls prachtvoll herausgeputzt hat und einen ganzen Geraniumstock in seinem Knopfloch trägt. Auch sein Haar ist schön gekräuselt, und der Eingeborene weiß davon zu erzählen.
»Dombey«, sagt der Major, indem er seine beiden Hände ausstreckt, »wie geht es Euch?«
»Major«, versetzt Mr. Dombey, »wie befindet Ihr Euch?«
»Beim Herkules, Sir«, sagt der Major, »Joey B. ist diesen Morgen in einer Stimmung«, – und er klopft sich dabei hart auf die Brust – »diesen Morgen in einer Stimmung, Sir, daß er, soll ihn der Teufel holen, Dombey, halb Lust hat, zu einer Doppelheirat die Hand zu bieten, Sir, und die Mutter zu nehmen.«
Mr. Dombey lächelt, aber nur leicht; denn er fühlt, daß die Mutter zu seiner Verwandtschaft gehören wird und daß er unter solchen Umständen keinen Scherz verstehe.
»Dombey«, sagt der Major, der das bemerkt, »ich wünsche Euch Glück. Ich gratuliere Euch, Dombey. Beim Himmel, Sir«, fügte er bei, »Ihr seid heute mehr zu beneiden als irgendein Mann in England.«
Auch hier ist Mr. Dombeys Beifall nur bedingt; denn es handelt sich bei ihm darum, einer Dame eine große Auszeichnung zuteil werden zu lassen, weshalb ohne Zweifel sie am meisten zu beneiden ist.
»Was Edith Granger betrifft, Sir«, fährt der Major fort, »so gibt es in ganz Europa kein Mädchen, das nicht seine Ohren und seine Ohrenringe dazu hergeben möchte, – erlaubt Bagstock beizufügen, Sir: und sie auch hergeben würde – um an Edith Grangers Stelle zu sein.«
»Ihr seid sehr gütig«, sagt Mr. Dombey.
»Dombey«, erwidert der Major, »Ihr wißt es selbst. Wozu auch eine falsche Bescheidenheit! Ihr wißt es. Wißt Ihr es oder wißt Ihr es nicht?« sagte der Major fast in Leidenschaft.
»O, in der Tat, Major–«
»Gott verdamm mich, Sir«, entgegnet der Major, »wißt Ihr diese Tatsache oder wißt Ihr sie nicht? Dombey, ist der alte Joe Euer Freund? Stehen wir auf jenem Fuß rückhaltloser Vertraulichkeit, Dombey, der einen Mann, wie den derben alten Joseph B., rechtfertigt, Sir, sich offen auszusprechen? Oder muß ich das für eine Weisung annehmen, Dombey, den Abstand zu berücksichtigen und zeremoniös zu werden?«
»Mein lieber Major Bagstock«, sagt Mr. Dombey geschmeichelt, »Ihr werdet ja ganz warm.«
»Bei Gott, Sir«, versetzt der Major, »ich bin warm. Joseph B. stellt es nicht in Abrede, Dombey. Er ist warm. Es handelt sich ja um eine Gelegenheit, Sir, die alle ehrenhaften Sympathien, welche etwa noch in dem Gerippe des alten, höllischen, zerbeulten, aufgebrauchten, invaliden J.B. zurückgeblieben sind, in Tätigkeit ruft. Ich muß Euch etwas sagen, Dombey, – zu einer solchen Zeit muß der Mann mit dem herausplatzen, was er fühlt, oder einen Maulkorb anlegen, und Joseph Bagstock erklärt es Euch ins Gesicht, wie er es auch hinter Eurem Rücken in seinem Klub tut, daß er sich nie einen Maulkorb anlegen lassen will, wenn Paul Dombey in Frage kommt. Gott verdamm mich, Sir«, schließt der Major mit großer Festigkeit, »was habt Ihr darauf zu erwidern?«
»Major«, sagt Mr. Dombey, »ich versichere Euch, daß ich mich Euch in der Tat zu Dank verpflichtet fühle. Es fiel mir nicht ein, Eurer allzu parteiischen Freundschaft Einhalt zu tun.«
»Nicht allzu parteiisch, Sir!« ruft der cholerische Major. »Dombey, ich stelle das in Abrede!«
»So will ich sagen, Eurer Freundschaft zu mir«, fährt Mr. Dombey fort. »Auch kann ich bei einem Anlaß wie der gegenwärtige nicht vergessen, Major, wie sehr ich Euch verpflichtet bin.«
»Dombey«, sagt der Major mit einer entsprechenden Gebärde, »dies ist die Hand des Joseph Bagstock – des einfachen alten Joey B., Sir, wenn Ihr lieber so wollt. Dies ist die Hand, von der Seine Königliche Hoheit der verstorbene Herzog von York gegen Seine Königliche Hoheit den verstorbenen Herzog von Kent zu bemerken mir die Ehre erwies, daß es die Hand Joeys sei, eines rauhen, zähen, alten Vagabunden. Dombey, möge der gegenwärtige Augenblick der am wenigsten unglückliche in unserm Leben sein. Gottes Segen über Euch!«
Jetzt tritt Mr. Carker ein, der gleichfalls prächtig gekleidet ist und in der Tat wie ein Hochzeitsgast lächelt. Er ist so reich an Glückwünschen, daß er kaum Mr. Dombeys Hand loslassen kann. Dabei schüttelt er dem Major die Hand so herzlich, daß auch seine Stimme im Einklang mit den Armen beweglich wird, während sie sich durch die Zähne hindurch ihre Bahn bricht.
»Sogar der Tag deutet auf Glück«, sagt Mr. Carker. »Das heiterste, lieblichste Wetter! Hoffentlich komme ich doch nicht zu spät?«
»Ihr seid durchaus pünktlich, Sir«, bemerkt der Major.
»Das freut mich in der Tat«, sagt Mr. Carker. »Ich fürchtete, ich möchte mich um einige Sekunden über die bestimmte Zeit verspätet haben; denn ich wurde durch einen Zug von Frachtwagen aufgehalten. Ich nahm mir die Freiheit, nach Brook-Street zu reiten« – dies zu Mr. Dombey – »und ein paar kleine Seltenheiten von Blumen für Mrs. Dombey dort zurückzulassen. Ein Mann in meiner Stellung, der durch eine solche Einladung ausgezeichnet wird, rechnet es sich zur hohen Ehre an, in Anerkennung seiner Lehenspflichtigkeit eine Huldigung darzubringen. Da ich natürlich nicht zweifle, Mrs. Dombey sei schon mit allem Kostbaren und Prächtigen überschüttet worden« – er begleitet diese Worte mit einem seltsamen Blick auf seinen Chef – »so hoffe ich, daß deshalb auch meine arme Gabe Gnade finden wird.«
»Ich bin überzeugt«, erwidert Mr. Dombey herablassend, »daß die künftige Mrs. Dombey Eure Aufmerksamkeit zu schätzen wissen wird.«
»Und wenn sie noch heute morgen Mrs. Dombey sein soll, Sir«, sagt der Major, seine Kaffeetasse niedersetzend und auf seine Uhr sehend, »so ist es hohe Zeit, daß wir uns auf den Weg machen.«
Mr. Dombey, Major Bagstock und Mr. Carker fahren in einer Equipage nach der Kirche. Mr. Sownds, der Kirchendiener, hat sich längst von der Treppe erhoben und wartet mit dem Eckenhut in der Hand. Mrs. Miff knixt und bietet Stühle in der Sakristei an. Mr. Dombey zieht es vor, in der Kirche zu bleiben. Als er nach der Orgel hinaufblickt, verbirgt sich Miß Tox auf der Emporkirche hinter dem fetten Bein eines Cherubs, der Backen hat wie ein junger Wind. Kapitän Cuttle dagegen steht auf und schwenkt seinen Haken zum Zeichen des Willkomms und der Ermutigung. Mr. Toots teilt dem Preishahn hinter der vorgehaltenen Hand mit, daß der mittlere Gentleman, der in den rehfarbenen Hosen, der Vater des Gegenstands seiner Liebe sei. Der Preishahn flüstert darauf Mr. Toots in heiseren Lauten zu, er sei ein so steifer Kunde, wie er nur je einen gesehen habe, aber es liege in der Macht der Wissenschaft, ihn gelenkig zu machen, und man bedürfe hierzu nur eines einzigen Schlages in die Magengegend.
Mr. Sownds und Mrs. Miff besehen sich Mr. Dombey aus einiger Entfernung, als sich auf einmal das Getöse rasselnder Räder vernehmen läßt und Mr. Sownds hinausgeht. Mr. Dombey wendet eben seinen Blick von dem anmaßenden Tollhäusler auf der Emporkirche ab, der ihn mit so viel Leutseligkeit begrüßt, und begegnet dabei dem der Mrs. Miff, die ihm einen Knix macht und die Bemerkung beifügt, sie glaube, daß seine »gute Dame« komme. Dann gibt es ein Gedränge und ein Flüstern in der Nähe der Tür, worauf die gute Dame mit stolzen Schritten eintritt.
Auf ihrem Gesicht zeigt sich keine Spur von den Leiden der letzten Nacht. Man bemerkt in ihrem Wesen nichts von dem knienden Weibe, das in schönem Selbstvergessen das verwirrte Haupt niedergelegt hat auf das Kissen des schlafenden Mädchens. Jenes Mädchen, so sanft und lieblich, geht an ihrer Seite – ein auffallender Gegensatz zu ihrer eigenen trotzigen Gestalt, wie sie dasteht, ruhig, aufrecht, und unergründlich in ihren Gefühlen, prächtig und majestätisch in der höchsten Blüte ihrer Reize, aber doch die Bewunderung, zu der sie Anlaß gibt, abweisend und unter die Füße tretend.
Eine Pause tritt ein, während der Mr. Sownds, der Kirchendiener, in die Sakristei schlüpft, um den Geistlichen und den Küster zu holen. Mrs. Skewton redet Mr. Dombey an – bestimmter und nachdrücklicher, als es ihre Gewohnheit ist. Dabei tritt sie dicht an Ediths Seite.
»Mein teurer Dombey«, sagte die gute Mama, »ich fürchte, ich muß am Ende doch auf die liebe Florence verzichten und sie nach Haus gehen lassen, wie sie es selbst vorgeschlagen hat. Nach dem Verlust, der mich heute betrifft, mein lieber Dombey, fühle ich meinen Geist so gedrückt, daß mir vielleicht auch ihre Gesellschaft zuviel wird.«
»Wäre es nicht besser, wenn sie bei Euch bliebe?« versetzt der Bräutigam.
»Ich glaube nicht, mein teurer Dombey. Nein, ich glaube nicht. Es wird besser sein, wenn ich allein bin. Außerdem ist nach Eurer Rückkehr meine liebe Edith ihre natürliche und beständige Schützerin; deshalb will ich ihr in keiner Weise vorgreifen. Sie könnte eifersüchtig werden – meinst du nicht, meine liebe Edith?«
Die zärtliche Mama drückt bei diesen Worten den Arm ihrer Tochter, vielleicht um sich ihre Aufmerksamkeit zu erbitten.
»Im Ernst, mein teurer Dombey«, sagt sie weiter, »ich will unser liebes Kind nach Haus lassen und es nicht mit meiner Schwermut behelligen. Wir haben uns hierüber ganz verständigt. Sie sieht es vollkommen ein, mein teurer Dombey. Edith, meine Liebe – sie sieht es vollkommen ein.«
Abermals drückt die gute Mutter den Arm ihrer Tochter. Mr. Dombey macht keine weitere Gegenvorstellung; denn der Geistliche erscheint mit dem Küster, und Mrs. Miff weist unter dem Beistande des Kirchendieners, Mr. Sownds, der Gesellschaft die geeigneten Plätze vor dem Altargeländer an.
»Wer vergibt diese Frau, daß sie mit diesem Manne vermählt werde?«
Vetter Feenix tut das. Er ist deshalb ausdrücklich von Baden-Baden hergekommen. »Zum Henker«, sagte Vetter Feenix; ein herrlicher Mann, dieser Vetter Feenix – »wenn wir einen reichen City-Burschen in die Familie kriegen, so müssen wir ihm einige Aufmerksamkeit zeigen. Wir müssen etwas für ihn tun.«
»Ich vergebe diese Frau, damit sie mit diesem Manne vermählt werde«, sagt demgemäß Vetter Feenix.
Vetter Feenix, der geradeaus gehen will, aber vermöge seiner eigensinnigen Beine ein wenig seitab gerät, vergibt anfangs die unrechte Frau, damit sie mit diesem Manne vermählt werde, nämlich eine Brautjungfer von Stand, entfernt mit der Familie verwandt und etwa zehn Jahre jünger als Mrs. Skewton. Aber Mrs. Miff, die das zerbeulte Hütchen dazwischen steckt, zieht ihn gewandt zurück und läßt ihn voll auf die »gute Dame« loslaufen, die nun Vetter Feenix vergibt, damit sie mit diesem Manne vermählt werde.
»Und wollen Sie im Angesicht des Himmels –?«
Ja, sie wollen. Mr. Dombey erklärt, er wolle. Und was sagt Edith? Auch sie will.
So verpflichten sie sich von Stunde an zu gegenseitiger Treue – sich zu lieben und zu tragen in Glück und Unglück, in Reichtum und Armut, in kranken und gesunden Tagen. Sie sind vermählt.
Mit fester, freier Hand zeichnet die Braut ihren Namen in das Kirchenregister ein, das in der Sakristei aufgeschlagen ist.
»Es kommen nicht viele Damen her«, sagt Mrs. Miff mit einem Knix – denn wenn man sie zu solchen Zeiten ansieht, so geht es stets mit ihrem zerbeulten Hütchen auf und nieder – »die ihre Namen schreiben wie diese gute Dame!«
Mr. Sownds, der Kirchendiener, meint, es sei eine wahrhafte Kern-Unterschrift, die der Schreiberin Ehre mache – dies jedoch nur zwischen ihm und seinem Gewissen.
Auch Florence unterzeichnet, findet aber keinen Beifall; denn ihre Hand zittert. Alle Zeugen unterschreiben – Vetter Feenix zuletzt, obschon er seinen edlen Namen an den unrechten Platz setzt und sich selbst unter diejenigen einreiht, die an jenem Morgen geboren wurden.
Der Major küßt nun die Braut in höchst galanter Weise und dehnt diesen Zweig militärischer Taktik auf alle Damen aus, obschon der Mrs. Skewton nur sehr schwer beizukommen ist und sie in dem heiligen Gebäude ein schrilles Quieken erschallen läßt. Vetter Feenix und sogar Mr. Dombey folgen diesem Beispiel. Endlich naht sich auch Mr. Carker mit seinen glänzenden weißen Zähnen der Braut, wie es scheint eher in der Absicht, sie zu beißen, als um die Süßigkeiten zu kosten, die ihre Lippen umschweben.
Auf ihren stolzen Wangen und in dem Blitzen ihrer Augen zeigt sich eine Glut, die vielleicht den Zweck hat, ihn zurückzuhalten. Das nutzt aber nichts; denn er küßt sie, wie die übrigen es getan haben, und wünscht ihr alles Glück.
»Wenn bei einem Bund, wie der gegenwärtige, Wünsche nicht etwa überflüssig sind«, fügt er mit gedämpfter Stimme bei.
»Ich danke Euch, Sir«, antwortet sie mit aufgeworfener Lippe und klopfendem Busen.
Aber fühlt Edith noch wie an dem Abend, als sie erfuhr, Mr. Dombey werde zurückkehren, um ihr seine Hand anzubieten, daß Carker sie durchaus kennt, daß er in ihrer Seele gelesen hat und daß sie hierdurch mehr herabgewürdigt wird als durch irgend etwas anderes? Ist dies der Grund, warum ihr Stolz unter seinem Lächeln zusammenschmilzt gleich dem Schnee in der ihn zerdrückenden Hand? Läßt sie deshalb ihren gebieterischen Blick sinken, um den Boden zu suchen, wenn er dem seinigen begegnet?
»Ich bin stolz darauf«, sagt Mr. Carker mit einer unterwürfigen Beugung seines Halses, welche die Offenbarung, die in seinen Augen und Zähnen zu lesen ist, Lügen straft, »ich bin stolz darauf, zu sehen, daß meine geringe Gabe von Mrs. Dombeys Hand gnädig aufgenommen wurde und bei diesem frohen Anlaß einen so begünstigten Platz einnehmen durfte.« Obschon sie als Erwiderung den Kopf verneigt, liegt doch etwas in der augenblicklichen Bewegung ihrer Hand, das andeutet, als wolle sie die Blumen, die sie hält, zerdrücken und mit Verachtung auf den Boden werfen. Sie legt indessen diese Hand in den Arm ihres neuen Gatten, der in der Nähe sich mit dem Major bespricht, und ist wieder stolz, stumm und regungslos.
Die Wagen stehen vor der Kirchentür. Mr. Dombey führt seine Braut durch die zwanzig Familien kleiner Damen, die sich auf der Treppe aufgestellt haben, und von denen jede sich den Schnitt und die Farbe der Kleidung im einzelnen genau merkt, daß sie diese an ihrer Puppe nachzubilden vermag, die gleichfalls den ewigen Bund der Treue eingehen muß. Kleopatra und Feenix steigen in den nämlichen Wagen. Der Major hilft Florence und der Brautjungfer, die aus Irrtum beinahe selbst vergeben worden wäre, in den zweiten, um dann selbst mit Mr. Carker nachzufolgen. Die Pferde stampfen und legen aus. Kutscher und Lakaien prunken in flatternden Schleifen, Blumen und neuen Livreen. Rasselnd geht es durch die Straßen, und tausend Köpfe drehen sich zum Nachsehen, während tausend nüchterne Moralisten sich für den Umstand, daß sie nicht auch an jenem Morgen vermählt wurden, durch die Betrachtung rächen, wie wenig die Leute daran denken, daß ein solches Glück nicht ewig währen kann.
Sobald alles ruhig ist, schlüpft Miß Tox hinter dem Cherubim hervor und kommt langsam von der Galerie herunter. Ihre Augen sind rot, und ihr feuchtes Taschentuch deutet auf Tränen. Sie fühlt sich tief verwundet, ist aber nicht bitter und hofft, das Paar möge glücklich sein. Sie gesteht sich ein, wie schwach ihre eigenen verblichenen Reize der Schönheit der Braut gegenüber sind. Aber auch das stattliche Bild des Mr. Dombey in der lila Weste und den rehfarbenen Beinkleidern vergegenwärtigt sie sich in ihrem Geiste, und sie weint aufs neue hinter ihrem Schleier auf dem ganzen Wege nach dem Prinzessinnenplatz. Kapitän Cuttle, der in alle Responsorien und Amen mit andächtigem Brummen eingestimmt hat, fühlt sich durch seine religiösen Übungen sehr gehoben und geht in friedevoller Geistesstimmung, den Glanzhut in der Hand, nach dem Kirchenschiff hinunter, wo er das Täfelchen zum Andenken des kleinen Paul liest. Der galante Mr. Toots verläßt, von dem getreuen Preishahn begleitet, das Gebäude in einer wahren Liebesfolter. Der Preishahn ist bis jetzt noch nicht imstande gewesen, einen Plan auszudenken, um Florence zu gewinnen; aber die erste Idee haftet in ihm fest, und er meint, wenn man durch einen tüchtigen Schlag vor den Magen Mr. Dombey gelenkiger mache, so wäre das ein Vorgehen in geeigneter Richtung. Mr Dombeys Mägde kommen aus ihren Verstecken hervor und schicken sich an, im Sturmschritt nach Brook-Street zu eilen, werden aber durch Symptome von Übelkeit seitens Mrs. Perch aufgehalten, die um ein Glas Wasser bittet und ihre Begleiterinnen in großen Schrecken versetzt. Mrs. Perch befindet sich indessen bald wieder besser und wird mit fortgedrängt, während Mrs. Miff mit Mr. Sownds, dem Kirchendiener, auf der Treppe niedersitzt, um von ihrem heutigen Erwerb zu sprechen, und der Küster die Glocke zu einem Leichenbegängnis anzieht.
Die Wagen langen vor der Wohnung der Braut an, die Glockenmänner beginnen ihr Spiel, die Blechmusikbande fällt ein, und Mr. Polichinell, dieses Urbild ehelichen Glückes, küßt sein Weib. Die Leute laufen, schieben und drücken sich in gaffendem Gedränge, während Mr. Dombey, die Braut an der Hand führend, mit feierlichen Schritten auf die Feenixhallen zuschreitet. Jetzt steigen die übrigen Hochzeitsgäste aus und begeben sich hinter dem Brautpaar in das Gebäude. Warum denkt wohl Mr. Carker, während er durch den Volkshaufen nach der Hallentür sich Bahn bricht, an das alte Weib, das ihm an jenem Morgen unter den Bäumen nachgerufen hat? Oder warum erinnert sich Florence beim Eintreten in das Haus mit Zittern der Zeit, in der sie als Kind irreging, und warum vergegenwärtigt sich ihr das Gesicht der guten Mrs. Brown?
An diesem glücklichsten der Tage gibt es noch mehr Glückwünsche und Grüße, obschon im ganzen nicht viel. Sie verlassen jetzt das Besuchszimmer und verteilen sich an dem Tisch in dem dunkelbraunen Speisesaal, den kein Konditor aufheitern kann, mag er auch die beiden erschöpften Neger mit so vielen Blumen und Liebesschleifen verzieren, wie er will.
Gleichwohl hat der Pastetenbäcker seine Pflicht erfüllt wie ein Mann, und ein reiches Frühstück steht bereit. Unter andern haben sich auch Mr. und Mrs. Chick der Gesellschaft angeschlossen. Mrs. Chick drückt ihr Erstaunen aus, daß Edith schon von Natur eine so vollkommene Dombey ist, und benimmt sich mit redseliger Vertraulichkeit gegen Mrs. Skewton, die eine schwere Last von ihrem Herzen gewälzt sieht und bei dem Champagner nicht zu kurz kommen will. Der sehr lange junge Mann, der am Morgen mit seiner Erbauung so viel zu schaffen hatte, befindet sich wohler. Aber ein unbestimmtes Gefühl von Reue hat sich seiner bemächtigt, und er haßt den andern sehr langen jungen Mann, dem er mit Gewalt seine Schüsseln entreißt, wie er denn überhaupt eine grimmige Lust daran zu hoben scheint, der Gesellschaft sich in keiner Weise verbindlich zu zeigen. Die Gesellschaft selbst ist kalt und ruhig, ohne es sich einfallen zu lassen, die auf sie niederschauenden schwarzen Wappenbilder durch irgendein Übermaß von Heiterkeit zu beleidigen. Vetter Feenix und der Major sind die lebhaftesten. Aber Mr. Carker hat ein Lächeln für den ganzen Tisch – ein besonders eigentümliches Lächeln für die Braut, obschon diese nur sehr, sehr selten darauf achtet.
Nachdem die Gesellschaft das Frühstück eingenommen und die Dienerschaft den Speisesaal verlassen hat, erhebt sich Vetter Feenix. Wie wunderbar jung er aussieht in den weißen Manschetten, die seine sonst etwas knöchernen Hände fast ganz bedecken, und in der Glut des Champagners auf seinen Wangen!
»Auf Ehre«, sagt Vetter Feenix, »obschon dies etwas Ungewöhnliches in dem Privathause eines Gentleman ist, muß ich doch um die Erlaubnis bitten, euch zu einem Bescheid auf das aufzufordern, was man gemeinhin einen Toast nennt.«
Der Major gibt mit sehr heiserer Stimme seinen Beifall zu erkennen. Mr. Carker, der in der Richtung des Vetter Feenix seinen Kopf über den Tisch vorbeugt, lächelt und nickt zu öfteren Malen.
»Ist es – in der Tat, ist es nicht –« beginnt Vetter Feenix abermals, ohne weiter fortfahren zu können.
»Hört, hört!« ruft der Major im Tone der Überzeugung.
Mr. Carker drückt sanft seine Hände zusammen, beugt sich wieder über den Tisch vor und lächelt und nickt noch öfter als zuvor, wie wenn er durch die letzte Bemerkung besonders angeregt worden sei und den wohltuenden Eindruck kundzugeben wünsche, den er davon gehabt.
»Es ist in der Tat ein Anlaß«, sagt Vetter Feenix, »bei dem man ohne Ungebühr von dem gewöhnlichen Brauch abgehen kann, und obschon ich in meinem Leben nie ein Redner war, und ich während meines Sitzes im Unterhaus die Ehre hatte, die Adresse zu unterstützen, die dann in der Überzeugung des Fehlschlagens auf zwei Wochen vertagt wurde –«
Der Major und Mr. Carker sind über dieses Bruchstück von Privatgeschichte so entzückt, daß Vetter Feenix lacht und ausdrücklich gegen sie fortfährt:
»In Wahrheit, es ging mir verteufelt schlecht dabei – gleichwohl könnt Ihr Euch denken, daß ich wohl fühle, welche Pflicht mir obliegt. Und wenn ein Engländer eine Pflicht zu erfüllen hat, muß er, wie ich meine, diese erfüllen, so gut er kann. Wohlan, unserer Familie wird heute die Freude, sich in der Person meiner liebenswürdigen und begabten Verwandten, die ich in der Tat hier gegenwärtig sehe –«
Allgemeiner Beifall.
»Gegenwärtig sehe«, wiederholte Vetter Feenix, der fühlt, daß es sich hier um einen Glanzpunkt handelt, der wohl eine Wiederholung vertragen kann – »mit einem Mann zu verbinden, auf dem nie der Finger der Verachtung – in der Tat, mit meinem ehrenwerten Freund Dombey, wenn er mir erlauben will, ihn so zu nennen.«
Vetter Feenix verbeugt sich gegen Mr. Dombey, der mit großer Feierlichkeit das gleiche tut. Jedermann fühlt sich mehr oder weniger freudig angeregt von dieser außerordentlichen, vielleicht beispiellosen Ansprache an das Herz.
»Ich habe nicht so viele Gelegenheit gehabt, als ich wohl wünschen möchte«, fuhr Vetter Feenix fort, »die Bekanntschaft meines Freundes Dombey zu pflegen und die Eigenschaften kennenzulernen, die seinem Kopf und in der Tat auch seinem Herzen so große Ehre machen; denn unglücklicherweise mußte es sich treffen, daß ich, wie wir zu meiner Zeit im Unterhause zu sagen pflegten – denn damals spielte man noch nicht auf die Lords an, und in den parlamentarischen Verhandlungen wurde die Ordnung weit besser gewahrt, als heutzutage – an – in Wahrheit –« fügt Vetter Feenix bei, der seinen Spaß sehr zu lieben scheint und zuletzt unter einem Anlauf mit ihm herausrückt – »›an einem anderen Platze‹ war.«
Der Major gerät in Zuckungen, aus denen er nur mit Mühe sich wieder aufrafft.
»Aber ich kenne meinen Freund Dombey hinreichend«, sagt Vetter Feenix in ernsterem Ton, als sei er plötzlich ein ganz anderer, weiserer Mann geworden, »um zu wissen, daß er in Wahrheit ist, was man bedeutungsvoll einen Kaufmann – einen britischen Kaufmann – und einen – einen Mann nennt. Und obschon ich seit einigen Jahren mich im Ausland aufhalte – es würde mir das größte Vergnügen bereiten, wenn ich meinen Freund Dombey oder jeden der anwesenden Gäste in Baden-Baden begrüßen und ihn bei dieser Gelegenheit mit dem Großherzog bekannt machen könnte – so darf ich mir doch schmeicheln, daß ich meine liebliche und begabte Verwandte zureichend kenne, um überzeugt zu sein, sie besitze jedes Erfordernis, das einen Mann zu beglücken imstande ist, und ihre Verbindung mit meinem Freund Dombey sei aus gegenseitiger Neigung hervorgegangen.«
Mr. Carker lächelt und nickt sehr viel.
»Deshalb gratuliere ich der Familie, deren Mitglied ich bin«, fährt Vetter Feenix fort, »zu der Erwerbung meines Freundes Dombey. Ich gratuliere meinem Freund Dombey zu seiner Verbindung mit meiner liebenswürdigen und begabten Verwandten, die jedes Erfordernis besitzt, um einen Mann glücklich zu machen; und ich nehme mir die Freiheit, alle Anwesenden aufzufordern, daß sie sich den Glückwünschen anschließen, die ich bei dem gegenwärtigen Anlaß meinem Freund Dombey und meiner liebenswürdigen, begabten Verwandten darbringe.«
Die Rede des Vetter Feenix wird mit großem Beifall aufgenommen, und Mr. Dombey dankt darauf in seinem und Mrs. Dombeys Namen. J.B. bringt unmittelbar nachher einen Trinkspruch auf Mrs. Skewton aus. Dann wird das Frühstück wieder langweilig, die beleidigten Wappenbilder erhalten ihre Sühne, und Edith erhebt sich, um sich in ihr Reisekostüm zu werfen.
Mittlerweile haben sämtliche Dienstboten unten ihr Mahl eingenommen. Der Champagner ist unter ihnen etwas zu Gemeines geworden, als daß er sich nur der Rede verlohnte, und gebackene Hühner, hohe Pasteten und Hummernsalat stehen nur noch im Lichte von Hausmannskost. Der sehr lange junge Mann hat sich wieder aufgefrischt und beginnt abermals auf Erbauung anzuspielen, während das Auge seines Kameraden mit dem seinen zu wetteifern anfängt, da es gleichfalls die Gegenstände anstiert, ohne sie zu erkennen. Auf den Gesichtern der Damen zeigt sich ein allgemeines Rot, namentlich auf dem der Mrs. Perch, die vor Lust ganz strahlend wird und sich so weit über die Sorge des Lebens erhoben fühlt, daß sie wohl Schwierigkeit haben dürfte, auf Befragen irgendeinem verirrten Wanderer den Weg nach Balls Pond, wo sie ihre Sorgen zurückgelassen, anzudeuten. – Mr. Towlinson hat einen Toast auf das glückliche Paar ausgebracht und der silberhaarige Kellermeister mit viel Zierlichkeit und Empfindung darauf geantwortet, denn die Hälfte der Anwesenden beginnt zu glauben, er sei wirklich ein alter Familiendiener, dem die Verpflichtung obliegt, durch solche Wechsel sich sehr ergriffen zu fühlen. Sämtliche Teilnehmer an dem Frühstück, namentlich die Damen, zeigen eine ausgelassene Fröhlichkeit. Mr. Dombeys Köchin, die in der Gesellschaft das große Wort zu führen pflegt, hält es für unmöglich, nach einem solchen Morgen gleich wieder ins alte Geleise einzufahren; warum also nicht lieber gemeinschaftlich das Theater besuchen?
Alles – selbst Mrs. Perch mit inbegriffen – zollt diesem Vorschlag Beifall, namentlich der Eingeborene, der wie ein Tiger getrunken hat und die Damen (Mrs. Perch insbesondere) durch das Rollen seiner Augen in Schrecken setzt. Einer der sehr langen jungen Männer hat sogar den Antrag gestellt, daß man nach dem Schauspiel einen Ball halten sollte – ein Gedanke, der niemand (nicht einmal Mrs. Perch) im Lichte der Unmöglichkeit erscheint. Zwischen der Hausmagd und Mr. Towlinson ist es zu einem Wortwechsel gekommen; denn sie behauptet die Wahrheit des alten Sprichworts, daß die Ehen im Himmel beschlossen werden, während er meint, der Handel gehe anderswo vor, und sie spreche nur so, weil sie selbst unter die Haube kommen möchte. Dagegen verwahrt sie sich mit der Erklärung, Gott möge jedenfalls verhüten, daß sie nicht etwa mit ihm den Bund schließen müsse. Um diese Hohnreden zu beschwichtigen, erhebt sich der silberhaarige Kellermeister, um die Gesundheit Mr. Towlinsons auszubringen, den man nur zu kennen brauche, um ihn zu achten; und wer ihn achte, müsse wünschen, daß er im Leben ein gutes Auskommen habe mit dem Gegenstand seiner Wahl, gleichviel – dabei haften seine Augen auf der Hausmagd – woher er auch denselben holen möge.
Mr. Towlinson bedankt sich darauf in einer sehr gefühlvollen Rede und geht sodann auf die Ausländer über, die, wie er meint, bisweilen bei schwachen, flatterhaften Köpfen in Gunst kämen. Er hoffe aber nur, er möge nie etwas von solchen Ausländern hören, die einen Reisewagen ausgemaust hätten. Dabei wird Mr. Towlinsons Auge so streng und ausdrucksvoll, daß die Hausmagd in Krämpfe verfällt, sich aber bald wieder erholt und mit allen übrigen die Treppe hinaufeilt, weil sich die Kunde verbreitet, daß die Braut abreise.
Der Wagen steht an der Tür, und die Braut kommt nach der Halle herunter, wo Mr. Dombey sie erwartet. Florence steht auf der Treppe, um gleichfalls aufzubrechen, während Miß Nipper in einem Putze, der die Mitte hält zwischen der Küche und dem Besuchzimmer, alle Vorbereitung getroffen hat, sie zu begleiten. Wie Edith erscheint, eilt Florence auf sie zu, um von ihr Abschied zu nehmen.
Friert es Edith, daß sie so zittert? Liegt in Florences Berührung etwas Unnatürliches oder Ansteckendes, daß die schöne Frau zurückweicht und zusammenzuckt, als könne sie das nicht ertragen? Hat sie es so eilig, daß sie nur die Hand schwenkt, vorüberrauscht und hinweg ist?
Von mütterlichen Gefühlen überwältigt, sinkt Mrs. Skewton, sobald das Rasseln des Reisewagens verhallt ist, in einer Kleopatra-Pose auf ihren Sofa und vergießt mehrere Tränen. Der Major kommt mit der übrigen Gesellschaft von der Tafel und versucht sie zu trösten; da sie aber um keinen Preis Trost annehmen will, so verabschiedet er sich. Vetter Feenix und Mr. Carker tun das gleiche. Alle Gäste entfernen sich. Kleopatra, die allein zurückbleibt, fühlt infolge der allzu großen Aufregung einen Schwindelanfall und schläft ein.
Auch im Erdgeschoß herrscht Schwindel. Der sehr lange junge Mann, bei dem die Erbauung so bald wieder zurückgekehrt ist, scheint mit dem Kopf an dem Speisekammertisch angeleimt zu sein und kann ihn nicht loskriegen. Mit Mrs. Perchs Heiterkeit ist ein großer Wechsel vorgegangen, und sie zeigt eine sehr wehmütige Stimmung in bezug auf Mr. Perch, indem sie der Köchin ihre Besorgnisse mitteilt, er hänge nicht mehr mit derselben Liebe an der Heimat, wie in der Zeit, als ihre Familie nur aus neun Gliedern bestand. Mr. Towlinson spürt ein Sausen in seinen Ohren, und es ist ihm, als ob ihm ein Mühlrad im Kopf herumgeht. Die Hausmagd hofft, daß es keine Sünde sein möchte, wenn man jemandem den Tod wünsche.
Was die Zeit angeht, so zeigt sich in den unteren Regionen gleichfalls eine allgemeine Verblendung. Jeder meint, es müsse mindestens schon zehn Uhr abends sein, während es doch nicht einmal drei geschlagen hat. Eine schattenhafte Vorstellung von irgendeiner Bosheit spukt in allen Köpfen, und jeder hält den andern dabei für beteiligt, weshalb es am besten sei, ihm auszuweichen. Niemand hat die Kühnheit, auf den beabsichtigten Theaterbesuch anzuspielen; und wer den Gedanken an den Ball wieder aufgewärmt hätte, wäre von allen übrigen als ein boshafter Tollhäusler angesehen worden.
Zwei Stunden später liegt Mrs. Skewton noch immer in ihrem Schlummer; und in der Küche ist das Schlafen noch nicht vorüber. Die Wappenbilder im Speisesaal schauen wieder auf Krumen, unreine Teller, verschütteten Wein, halbaufgetautes Eis, alte verfärbte Fußspuren, Überreste von Hummern, Schenkelknochen von Geflügel und schwermütige Gelees, die in lauwarme Gummibrühen zerfließen. Die Hochzeit ist inzwischen fast ebenso allen ihren Prunks entkleidet wie das Frühstück. Mr. Dombeys Dienstboten moralisieren so viel darüber und benehmen sich zu Hause bei ihrem Tee so reuig, daß gegen acht Uhr hin allenthalben der tiefste Ernst waltet. Mr. Perch, der um diese Zeit in weißer Weste und mit einem lustigen Liedchen frisch und heiter aus der City kommt, um sich einen fröhlichen Abend zu machen, ist im höchsten Grade erstaunt über die kalte Aufnahme, die ihm zuteil wird, und da sich Mrs. Perch gar übel befindet, so fällt ihm die angenehme Pflicht zu, diese Dame im ersten besten Omnibus nach Hause zu begleiten.
Die Nacht bricht an. Florence, die in dem schönen Haus Zimmer nach Zimmer durchwandelt hat, sucht ihr eigenes Gemach auf, wo sie sich infolge von Ediths Sorgfalt von aller Bequemlichkeit umgeben sieht. Nachdem sie ihr schönes Gewand abgelegt hat, zieht sie das einfache Trauerkleid, das sie seit Pauls Tod getragen, wieder an und setzt sich nieder, um zu lesen, während Diogenes auf dem Boden neben ihr nickt und blinzelt. Aber Florence kann heute nacht nicht lesen. Das Haus kommt ihr fremd und neu vor: auch ist das Echo so laut. In ihrem Herzen lauert ein Schatten; sie fühlt es beschwert, ohne daß sie sich den Grund anzugeben vermag. Sie schließt ihr Buch. Diogenes, der das für ein Signal hält, legt seine Pfote auf ihren Schoß und reibt seine Ohren gegen ihre liebkosenden Hände. Aber Florence kann ihn für eine Weile nicht deutlich sehen; denn es liegt zwischen ihren Augen und ihm ein Nebel, in dem ihr toter Bruder und ihre gestorbene Mutter wie Engel auftauchen. Ach Walter – der arme, unstete, schiffbrüchige Knabe – ach, wo ist er!
Soviel ist gewiß, daß es der Major nicht weiß, und daß er sich auch nicht darum kümmert. Nachdem er den ganzen Nachmittag Erstickungsanfällen ausgesetzt gewesen ist und viel geschlummert hat, nimmt er ein spätes Diner in seinem Klub ein und sitzt jetzt bei seinem Glase Wein, um einen jungen Mann von frischer Gesichtsfarbe am nächsten Tisch – wie gerne ließe es sich dieser nicht ein Schönes kosten, wenn es ihm möglich wäre, aufzustehen und sich zu entfernen – mit Anekdoten von Bagstock, Sir, bei Dombeys Hochzeitsfeier und von des alten Joe verteufelt ritterlichem Freund, dem Lord Feenix, zum Wahnsinn zu bringen. Vetter Feenix, der jetzt schon in Longs Hotel und in den Federn sein sollte, befindet sich statt dessen an einem Spieltisch, nach dem ihn seine eigensinnigen Beine, vielleicht gegen seinen Willen, getragen haben.
Die Nacht erfüllt gleich einem Riesen die Kirche vom Pflaster bis zum Dach und übt während der schweigenden Stunde ihre Herrschaft. Das gleiche Zwielicht kommt wieder, um durch die Fenster hereinzuschauen, weicht dem Tag, sieht nach, ob die Nacht sich in den Gewölben verbirgt, folgt ihr, verscheucht sie und nimmt selbst ihren Versteck ein unter den Toten. Die schüchternen Mäuse drängen sich wieder zusammen, wenn die große Tür erknarrt und Mr. Sownds und Mrs. Miff, gleich dem Trauring den ununterbrochenen Kreislauf ihres täglichen Lebens beginnend, hereintreten. Der Eckenhut und das zerbeulte Hütchen stehen wieder während der Stunde der Vermählung im Hintergrund, und abermals nimmt dieser Mann dieses Weib und dieses Weib diesen Mann unter der feierlichen Versicherung:
›Von Stund' an fest auszuharren in gegenseitiger Treue – sich zu lieben und zu tragen in Glück und Unglück, in Reichtum und Armut, in kranken und gesunden Tagen, bis der Tod sie scheidet.‹
Dieselben Worte, die Mr. Carker auf seinem Ritte stadteinwärts vor sich hin wiederholt, mit einem Mund, der sich mit Macht in die Breite zieht, während er die saubersten Stellen der Straße auswählt.
Zweites Kapitel.
Der hölzerne Midshipman geht in die Brüche.
Der ehrliche Kapitän Cuttle versäumte, obgleich er schon Wochen in seinem befestigten Zufluchtsorte zugebracht hatte, keineswegs die klugen Vorsichtsmaßregeln gegen Überraschung, und ließ sich durch das Ausbleiben des Feindes nicht beirren. Er war der Ansicht, daß seine gegenwärtige Sicherheit viel zu tief und wunderbar sei, um für die Dauer bestehen zu können. Er wußte, daß der Wetterhahn selten nagelfest blieb, wenn der Wind aus einer ungünstigen Richtung blies, und war zu gut mit dem entschlossenen furchtlosen Charakter der Mrs. Mac Stinger bekannt, um daran zu zweifeln, daß diese heroische Dame nicht alle ihre Kräfte aufbieten werde, um ihn aufzufinden und wieder zu kapern. Zitternd unter dem Gewicht dieser Gründe, führte Kapitän Cuttle ein sehr stilles, zurückgezogenes Leben und ging selten anders als nach Einbruch der Dunkelheit aus. Selbst dann wagte er sich nur in die dunkelsten Straßen. Namentlich hütete er sich, an Sonntagen seine Wohnung zu verlassen, und bei jeder Gelegenheit, sowohl innerhalb wie außerhalb der Mauern seines Zufluchtsorte, mied er Weiberhüte, als würden sie von brüllenden Löwen getragen.
Der Kapitän ließ sich nie den Gedanken kommen, daß es, wofern Mrs. Mac Stinger ihn auf einem seiner Ausgänge ertappte, möglich sein könnte, ihr Widerstand zu bieten. Er fühlte, daß dieses nicht anging, und vergegenwärtigte sich sogar schon, wie er ganz zahm in eine Mietkutsche gepackt und nach seiner alten Wohnung abgeführt wurde. War er einmal dort eingemauert, so mußte er sich als verlorenen Mann betrachten. Sein Hut wurde in Beschlag gelegt, Mrs. Mac Stinger bewachte ihn Tag und Nacht, Vorwürfe fielen auf sein Haupt nieder vor der jungen Familie, und er selbst erschien als der schuldbeladene Gegenstand des Argwohns und Mißtrauens – in den Augen der Kinder als ein Werwolf, in denen der Mutter als ein entdeckter Verräter.
Der Kapitän wurde stets ganz kleinmütig, und der Schweiß brach ihm aus allen Poren, wenn er sich dieses düstere Bild seiner Einbildungskraft vergegenwärtigte. Das war in der Regel der Fall, ehe er nachts um der frischen Luft und der Bewegung willen sich aus dem Hause schlich. Im Gefühl der Gefahr, die ihn bedrohte, verabschiedete er sich bei solchen Anlässen von Rob mit der Feierlichkeit eines Mannes, der vielleicht nie wieder zurückkehrt. Er ermahnte ihn für den Fall seines plötzlichen zeitweiligen Verschwindens, auf den Pfaden der Tugend fortzuwandeln und die Messing-Instrumente blank zu erhalten.
Um übrigens keine Gelegenheit zu versäumen, sich für den schlimmsten Fall ein Mittel zu sichern, mit der äußern Welt in Verkehr zu treten, kam Kapitän Cuttle bald auf den glücklichen Gedanken, Rob, den Schleifer, über ein geheimes Signal zu belehren, wodurch dieser Anhänger ihm in der Stunde der Not seine Nähe und Treue bekunden konnte. Nach reiflicher Erwägung entschied er sich dafür, ihn die Melodie des Matrosenliedes: »Auf, Matrosen, die Anker gelichtet!« pfeifen zu lehren, und nachdem es Rob, der Schleifer, darin zu einer Vollkommenheit gebracht hatte, wie sie besser von einer Landratte nicht zu erwarten war, legte ihm sein Gebieter noch folgende geheimnisvolle Weisungen ans Herz:
»Jetzt halt bei, mein Junge! Wenn ich gefaßt werde –«
»Gefaßt, Kapitän?« unterbrach ihn Rob, seine runden Augen weit aufsperrend.
»Ah!« entgegnete Kapitän Cuttle geheimnisvoll, »wenn ich je fortgehe, in der Absicht, beim Nachtessen wieder da zu sein, und nicht wieder in Rufweite komme, so suchst du vierundzwanzig Stunden nach meinem Verschwinden Brig-Place auf und pfeifst dort in der Nähe meines alten Ankergrundes diese Melodie. Merke wohl, nicht als ob du etwas damit im Schild führst, sondern unter dem Anschein, als seiest du von ungefähr dahin getriftet. Gebe ich in der gleichen Weise Antwort, mein Junge, so stoppst du ab und kommst nach vierundzwanzig Stunden wieder; pfeife ich aber eine andere Melodie, so steuerst du aus und ein und wartest, bis ich dir weitere Signale zugehen lasse. Begreifst du diese Weisungen?«
»Wie soll ich denn aus- und einsteuern, Kapitän?« fragte Rob. »Auf dem Fahrwege?«
»Du bist mir ein pfiffiger Bursche«, rief der Kapitän, ihn finster ins Auge fassend, »der nicht einmal sein eigenes ABC versteht! Du gehst abwechselnd ein bißchen weg und kommst wieder zurück – begreifst du das?«
»Ja, Kapitän«, versetzte Rob.
»Gut also, mein Junge«, sagte der Kapitän in milderem Ton. »So wirst du es halten.«
Damit hierin ja kein Fehler vorgehe, ließ sich Kapitän Cuttle abends, nachdem der Laden geschlossen war, bisweilen herab, den Schleifer eine Probe des Patrouillenganges vornehmen zu lassen. Zu diesem Ende begab er sich in das Hinterstübchen, das die Wohnung einer vermeintlichen Mac Stinger vorstellen mußte, und faßte von dem Spionierloch aus, das er in die Mauer gebohrt hatte, das Benehmen seines Verbündeten sorgfältig ins Auge. Bei derartigen Gelegenheiten machte Rob, der Schleifer, seine Sache mit solcher Pünktlichkeit und Umsicht, daß ihm der Kapitän zu verschiedenen Zeiten als Zeichen seiner Zufriedenheit sieben Sechspencestücke schenkte. Anbei faßte allmählich in seinem Geiste die Ergebung eines Mannes Wurzel, der für den schlimmsten Fall seine Maßregeln getroffen und nichts versäumt hat, um sich gegen ein unvermeidliches Schicksal bestens zu verwahren.
Trotzdem hütete sich der Kapitän sorgfältig, das Schicksal herauszufordern, und er benahm sich um kein Haar waghalsiger, als zuvor. Zwar hielt er es für einen Anstands- und Ehrenpunkt, als Freund der Familie im allgemeinen Mr. Dombeys Trauung, von der ihm durch Mr. Perch Kunde zugegangen war, beizuwohnen und dem Bräutigam von der Emporkirche aus ein erfreutes, Beifall zollendes Gesicht zu zeigen. Aber er machte die Fahrt nach der Kirche in einer Mietkutsche, deren beide Blenden er niedergelassen hatte. Vielleicht würde er in seiner Furcht vor Mrs. Mac Stinger auch vor diesem Wagnis Anstand genommen haben. Aber da die erwähnte Dame unter die Gemeinde des ehrwürdigen Melchisedek gehörte, so war es sehr unwahrscheinlich, daß man ihrer in einem Gotteshause der bischöflichen Kirche begegnen könnte.
Der Kapitän war glücklich wieder nach Hause gekommen und fühlte seine neue Lebensweise fort, ohne daß von dem Feind eine unmittelbare Behelligung ausging, ausgenommen die tägliche Erscheinung von Weiberhüten auf der Straße. Aber jetzt begannen auch andere Gegenstände den Geist des Kapitäns zu bedrängen. Von Walters Schiff hatte man noch immer nichts gehört, und auch von dem alten Sol Gills lief keine Kunde ein.
Florence war nicht einmal von dem Verschwinden des alten Mannes unterrichtet, und dem Kapitän gebrach es an Mut, ihr die betreffende Mitteilung zu machen. In der Tat begannen seine Hoffnungen für den wackeren, hübschen, treuherzigen Jungen, den er nach seiner rauhen Art von Kindheit auf geliebt hatte, von Tag zu Tag mehr hinzuschwinden, weshalb schon der Gedanke an eine Rücksprache mit Florence ihm schmerzlich wurde. Freilich, wäre er der Überbringer guter Neuigkeiten gewesen, so würde er sich zu ihr Bahn gebrochen haben, trotz des neu herausgeputzten Hauses und der prächtigen Möbel, obschon ihm diese in Verbindung mit der Dame, die er in der Kirche gesehen, einen geheimen Schrecken einflößten. So aber umdüsterte ein schwarzer Horizont ihre gemeinschaftlichen Hoffnungen. Es kam dem Kapitän fast vor, als sei er für sie ein neuer Gegenstand des Unglücks und des Leides, so daß er sich vor einem Besuch bei Florence kaum weniger fürchtete, als vor dem Erscheinen der Mrs. Mac Stinger selbst.
Es war ein frostiger trüber Herbstabend, und Kapitän Cuttle hatte Feuer in dem kleinen Hinterstübchen anzünden lassen, das jetzt mehr als je wie die Kajüte eines Schiffes aussah. Der Regen fiel in Strömen nieder, und es stürmte sehr. Der Kapitän ging in dem windigen Dachstübchen, wo sein alter Freund zu schlafen pflegte, umher und stellte Witterungsbeobachtungen an. Aber das Herz erstarb ihm fast in seinem Innern, als er wahrnahm, wie wild und trostlos es draußen aussah. Zwar fiel es ihm nicht ein, das damalige Wetter mit dem Schicksal des armen Walter in Verbindung zu bringen, oder daran zu zweifeln, daß es längst mit ihm vorbei sein müsse, wenn die Vorsehung beschlossen habe, ihn durch Schiffbruch umkommen zu lassen. Jedoch unter dem äußeren Einflusse, wie verschieden er auch sein mochte von dem Hauptgegenstand seiner Gedanken, entsank dem Kapitän der Mut; und seine Hoffnungen erblichen, was auch weiseren Männern schon oft so ergangen ist und noch oft ergehen wird.
Das Gesicht gegen den scharfen Wind und den schräg einfallenden Regen kehrend, blickte Kapitän Cuttle nach der schweren Wolke hinauf, die schnell über das Labyrinth von Hausgiebeln hinflog, ohne auch nur eine Spur von Ermutigung darin zu finden. Die Aussicht in unmittelbarer Nähe war nicht besser. Zu seinen Füßen girrten in allerlei Teekisten und anderen rauhen Truhen die Tauben Robs, des Schleifers, gleich ebenso vielen aufspringenden unheimlichen Winden. Eine gichtbrüchige Windfahne, einen Midshipman mit dem Teleskop vor Augen darstellend, der vordem von der Straße aus sichtbar gewesen war, jetzt aber unter der Masse von Ziegeln verschwunden zu sein schien, ächzte und jammerte auf ihrem rostigen Stift, wie die pfeifenden Stöße, die den Midshipman umherdrehten und grausames Spiel mit ihm trieben. Auf der groben blauen Weste des Kapitäns standen die kalten Regentropfen gleich Stahlperlen, und er vermochte sich kaum zu halten vor dem steifen Nordwest, der gegen ihn andrängte, als habe er Lust, ihn über die Böschung aufs Pflaster hinunterzuwerfen. »Wenn an einem solchen Abend sich noch ein bißchen Hoffnung regt«, dachte der Kapitän, während er seinen Hut festhielt, »so ist sie sicherlich im Hause und nicht draußen«; er schüttelte daher verzagt den Kopf und ging hinunter, um nach ihr zu sehen.
Er stieg langsam nach dem kleinen Hinterstübchen hinab, setzte sich in seinen gewöhnlichen Stuhl und suchte sie in den Flammen des Feuers; aber da war sie nicht, obschon das Feuer hell aufloderte. Dann nahm er Tabak, Dose und Pfeife heraus, um zu rauchen. Er suchte sie in der roten Glut des Pfeifenkopfs und in den Dampfwolken, die von seinen Lippen aufwirbelten. Aber auch hier wollte sich nicht einmal ein Atom von dem Rost des Hoffnungsankers zeigen. Er versuchte es mit einem Glas Grog; indessen die traurige Wahrheit lag auf dem Boden dieses Brunnens, und er konnte nicht damit fertig werden. Dann machte er einige Gänge durch den Laden und spähte nach der Hoffnung unter den Instrumenten. Doch sie arbeiteten hartnäckig, trotz aller Einreden, die er vorzubringen vermochte, für das fehlende Schiff nur Gissungen aus, die mit dem Grunde des einsamen Meeres endigten.
Der Wind brauste fort, und der Regen klatschte noch immer gegen die geschlossenen Läden. Der Kapitän legte vor dem hölzernen Midshipman auf dem Ladentisch bei und machte sich, während er mit seinem Ärmel die Uniform des kleinen Offiziers trocknete, Gedanken, wie alt dieser wohl sein möge – wie wenige Wechsel (kaum irgendeiner) seine Schiffskameradschaft betroffen habe – wie die Veränderungen sozusagen fast auf einen Tag zusammenfielen – und wie erschütternder Art sie gewesen. Die kleine Gesellschaft des Hinterstübchens war aufgelöst und weit und breit hin zerstreut. Es gab keine Zuhörerschaft mehr für die liebliche Peg, selbst wenn jemand da gewesen wäre, um das Lied zu singen. Der Kapitän fühlte nämlich die moralische Überzeugung, außer ihm sei niemand einer derartigen Aufgabe gewachsen, und unter obwaltenden Umständen befand er sich nicht in der Stimmung, es auch nur zu versuchen. Es gab kein heiteres Wal'r-Gesicht im Hause – hier führte der Kapitän für einen Augenblick seinen Ärmel von der Uniform des Midshipmans nach der eigenen Wange – die bekannte Perücke und die Knöpfe des alten Sol Gills gehörten der Vergangenheit an. Richard Whittington war auf den Kopf geschlagen, und jeder Plan, jeder Entwurf, der Bezug auf den Midshipman hatte, lag ohne Mast und Steuer triftig auf der endlosen Wasserfläche.
Während der Kapitän mit trostlosem Gesicht sich in solchen Gedanken erging und teils in der liebevollen Zärtlichkeit alter Bekanntschaft, teils in der Zerstreutheit seines Geistes an dem Midshipman polierte, jagte ein Klopfen an die Ladentür Rob, dem Schleifer, einen mächtigen Schrecken ein. Dieser saß nämlich auf dem Ladentisch, verwandte keines seiner großen Augen von dem Gesicht des Kapitäns und überlegte schon hundertmal in seinem Innern, ob wohl sein Gebieter einen Mord verübt, daß er ein so böses Gewissen habe und alle Augenblicke Reißaus nehme.
»Was ist das?« fragte Kapitän Cuttle leise.
»Es klopft jemand, Kapitän«, antwortete Rob, der Schleifer.
Mit scheuer, schuldbewußter Miene schlich der Kapitän auf den Zehen in das kleine Hinterstübchen und schloß sich ein. Rob, der die Tür öffnete, hatte im Sinne, auf der Schwelle den Besuch wie ein Kriminalkommissar zu behandeln, falls sich dieser in weiblicher Verkleidung zeigte. Aber der Besuch gehörte seinem Äußern nach dem männlichen Geschlecht an, und da Cuttles Weisungen sich nur auf Weiber bezogen, so riß er die Tür auf und ließ den Gast eintreten, der seinerseits nicht zögerte und überfroh war, aus dem Regen zu kommen.
»Jedenfalls wieder Arbeit für Burgeß und Co.«, sagte der Besuch, der mit kläglicher Miene abwärts auf seine durchnäßten und mit Kot bespritzten Schuhe sah. »O, wie geht es Euch, Mr. Gills?«
Diese Begrüßung galt dem Kapitän, der tat, als komme er ganz zufällig aus dem Hinterstübchen heraus, obschon dieses Anstellen so erkünstelt war, daß man es auf den ersten Blick durchschauen konnte.
»Danke«, fuhr der Gentleman in demselben Atem fort, »ich bin in der Tat ganz wohl. Mein Name ist Toots – Mister Toots.«
Der Kapitän erinnerte sich, den jungen Herrn bei der Hochzeit gesehen zu haben, und machte eine Verbeugung. Mr. Toots antwortete mit einem Kichern, und da er sich, wie gewöhnlich, in großer Verlegenheit befand, so atmete er tief auf und schüttelte dem Kapitän geraume Zeit die Hand, um sodann in Ermangelung eines anderen Auskunftsmittels in der herzlichsten Weise mit Rob, dem Schleifer, dasselbe Manöver vorzunehmen.
»Wenn Ihr nichts dagegen habt, so möchte ich gern ein Wörtchen mit Euch sprechen, Mr. Gills«, sagte endlich Toots mit überraschender Geistesgegenwart. »Ihr wißt, ich meine wegen Miß D.D.M.«
Mit entsprechender geheimnisvoller Würde schwenkte der Kapitän seinen Haken nach dem Hinterstübchen, wohin ihm Mr. Toots folgte.
»O, ich muß Euch um Verzeihung bitten«, fuhr Mr. Toots fort und blickte, sobald er auf dem für ihn neben den Kamin gerückten Stuhl Platz genommen, zu Kapitän Cuttles Gesicht auf. »Ihr werdet wohl den Preishahn nicht kennen, Mr. Gills – oder?«
»Den Preishahn?« versetzte der Kapitän.
»Ja, den Preishahn«, sagte Mr. Toots.
Der Kapitän schüttelte den Kopf, und Mr. Toots setzte nun auseinander, daß er auf die berühmte öffentliche Person anspiele, die sich und sein Vaterland in dem Kampf gegen den Nobby aus Shropshire mit Lorbeeren bedeckt habe. Aber diese Mitteilung schien den Kapitän nicht sonderlich aufzuklären.
»Weil er draußen ist, meine ich«, sagte Mr. Toots. »Doch es ist von keinem Belang, obschon er vielleicht tüchtig durchnäßt wird.«
»Ich kann ihm augenblicklich das Signal zugehen lassen«, versetzte der Kapitän.





























