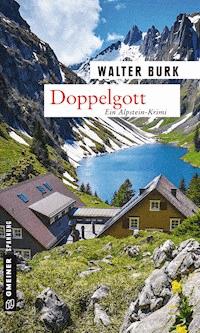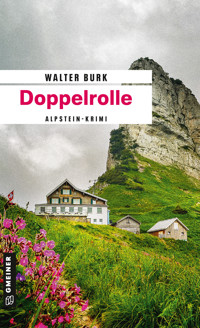
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Leutnant Bruno Fässler
- Sprache: Deutsch
Wanderer und Krimiautor Roger Marty erlebt im Berggasthaus ›Staubern‹ hautnah ein vermeintliches Verbrechen. Blutspuren, welche die Wirtin am Morgen entdeckt, weisen auf eine Gewalttat hin - doch von wem stammt das Blut? Auch nachdem der leitende Ermittler Bruno Fässler eine Leiche findet, bleibt weiter rätselhaft, was in der Idylle des Alpsteins wirklich passiert. Roger Marty ermittelt auf eigene Faust ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Burk
Doppelrolle
Zweiter Teil der Alpsteinkrimi-Trilogie
Zum Buch
Mord im Idyll? Wanderer und Krimiautor Roger Marty muss im Berggasthaus ›Staubern‹ im Alpstein ein vermeintliches Verbrechen miterleben. Blutspuren, welche die Wirtin Janine Dietsche am Morgen entdeckt, weisen auf eine Gewalttat hin – doch stammt das Blut wirklich von der vermissten slowakischen Saisonangestellten Valeska Hovorka? Und wo ist Alena Selnická, die ihre Freundin an diesem Wochenende im Alpstein besucht? Auch nachdem der leitende Ermittler der Innerrhoder Kriminalpolizei, Bruno Fässler, eine Leiche findet, bleibt verborgen, was in der Idylle des Alpsteins wirklich abläuft. Erst Roger Marty, der auf eigene Faust Ermittlungen anstellt, kommt einem Verbrechen auf die Spur, das überhaupt nicht in die Beschaulichkeit der Region passt und in welches nicht nur weitere Personen, sondern auch international tätige Organisationen involviert sind. Doch welche Rolle spielen Patrik Fricker, Valeskas Freund, und Monika Inauen, Servicemitarbeiterin in den ›Staubern‹ und Verehrerin von Roger Marty, – und auch er selbst – in diesem Fall?
Walter Burk wurde in Horgen am Zürichsee geboren und lebt seit 1979 in der Ostschweiz. Nach über 30 Jahren beruflicher Tätigkeit in der Bildung hat er sich 2010 als Berater für Organisationsentwicklung selbständig gemacht und arbeitet seither auch als Dozent an verschiedenen Fachhochschulen. Als ehemaliger Journalist, Blogschreiber und Redaktor blieb er bis heute seiner Leidenschaft, dem Schreiben, treu. Seine Verbundenheit zum Alpsteingebirge, sein Interesse an der Diskussion existentieller Fragen des Lebens und Zusammenlebens, an der Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Themen, seine Freude an der Vermischung von Realität und Fiktion sowie am Spiel mit der Sprache bilden die Basis für seinen zweiten Kriminalroman ›Doppelrolle‹.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Autor Walter Burk
ISBN 978-3-8392-4608-5
TEIL 1
Sonntagmorgen, Mitte August, Berggasthaus ›Staubern‹ (Prolog)
Als Roger Marty den Schrei hört, weiß er sofort, was passiert ist.
Er beschleunigt seine Schritte und spürt, dass sein Körper trotz der frühen Morgenstunden bereit ist, die Leistungsbereitschaft zu erhöhen. Der Alkohol des Vorabends, den er während der langen, inspirierenden und schönen Unterhaltung mit Monika konsumiert hat, scheint sich auf seinem Morgenspaziergang verflüchtigt zu haben. Wobei sich Roger durchaus bewusst ist, dass er sich bei dieser Interpretation mehr auf Illusion und Wunschdenken als auf Wissenschaft abstützt. Denn dafür war der Spaziergang zu kurz, der ihn von der Staubernkanzel, wo das Berggasthaus ›Staubern‹ steht, über den Staubernfirst bis zur Gabelung, wo der Weg hinunter ins Rheintal nach Frümsen abzweigt, führte. Und wo – für die meisten Wanderer unbekannt – auf der Nordwestseite noch die Ruine des ersten Berggasthauses ›Staubern‹ steht.
Mehr als Grundmauern, welche durch ein rostiges Blechdach geschützt werden, sind vom Wanderweg auf dem First aus nicht zu erkennen, der Weg zur Ruine ist nur für Eingeweihte zu finden. Wer diesen aber einmal gefunden hat, wird durch eine herrliche Aussicht von dieser kleinen Hochebene aus auf den Säntis, den Sämtisersee mit dem ›Plattenbödeli‹ und auf den Hohen Kasten belohnt. Nur eine kleine, gelbe Tafel neueren Datums mit der Aufschrift ›STAUBEREN 1619 m Staubere‹ deutet noch auf die Geschichte hin, die in diesem Haufen aus Steinen, Balken und Schutt verborgen liegt.
Roger liebt solche Orte, hortet sie als sein ganz persönliches Geheimnis. Orte, die nicht allgemein bekannt sind und zu denen er sich zurückziehen kann, ohne andere Wanderer zu treffen, wo er nur mit sich alleine die Faszination und Ruhe des Alpsteins genießen kann. Noch ist dies möglich, doch der geplante Wiederaufbau des alten Berggasthauses, das dann einen Spaziergang durch die Vergangenheit und Geschichte ermöglichen soll, wird auch diese Oase zum Verschwinden bringen. Bereits wurde von den Besitzern der heutigen ›Staubern‹ ein Gönnerverein gegründet, der dieses Projekt finanzieren soll, und auch erste Pläne eines Architekten für eine mögliche Rekonstruktion liegen vor.
Die letzten Meter zum Berggasthaus legt Roger im Laufschritt zurück, betritt dieses kurz vor halb sieben Uhr durch die Eingangstür auf der Rheintalerseite, durchquert zügigen Schrittes die Gaststube, in welcher Monika, die Servicemitarbeiterin, wie versteinert steht und ihn mit starrem Blick fixiert, und steuert direkt auf die Küche zu. Eher instinktiv als bewusst lässt er Monika einfach stehen und biegt zielstrebig beim Eingang zur Küche direkt links ab zur Treppe, die zum Keller führt.
Die Tür ist offen, im Keller brennt Licht. Roger steigt die Holztreppe hinunter – nichts zu sehen, nichts zu hören. Er biegt links ab, durchquert den ersten Raum, der mit PET-Flaschen und Lebensmittelvorräten gefüllt ist. Auch im nachfolgenden, links liegenden Raum, der schlecht beleuchtet ist und der ebenfalls als Lager für Getränke dient, ist nichts zu erkennen – außer, dass die Verbindungstür zum ›Stübli‹ offen steht. Dieser Raum steht den Gästen für Sitzungen und Seminare zur Verfügung oder einfach auch, um nach der Polizeistunde und dem offiziellen Schluss der Bewirtung im Berggasthaus noch weiterfeiern zu können.
Aus dem Raum strömt der bissige Geruch abgestandenen Rauches – ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Gäste gestern Abend die Gelegenheit genutzt haben, dass das ›Stübli‹ vom generellen Rauchverbot im Berggasthaus ausgenommen ist. Roger Marty beugt sich vor und versucht sich einen Überblick zu verschaffen. Im Raum stehen zwei Tische, auf denen noch zahlreiche leere Flaschen und benutzte Gläser stehen, neben den Stühlen bietet eine Eckbank weitere Sitzmöglichkeiten, auf der rechten Seite stehen auf einem kleinen Buffet frische Gläser, Tassen und all das, was die Gäste hier unten noch benötigen könnten, dahinter führt eine weitere Tür ins Freie. Der Raum wird von dem durch die Fenster einfallenden Morgenlicht und von zwei gelblich leuchtenden gläsernen Lampen beleuchtet, welche an Reh- und Hirschgeweihen befestigt sind. An den Wänden hängen eingerahmte Fotos.
Was Roger in diesem Bild stört, ist aber weniger Wirtin Janine Dietsche, die wie versteinert in der Mitte des Raumes steht, als vielmehr ein eingetrockneter, rotbräunlicher Blutstreifen, der sich von der Ablagefläche der Eckbank über diese erstreckt und in einer Blutlache auf dem Boden endet.
Am Vortag, Berggasthaus ›Staubern‹
Monika freut sich sehr, als sie erkennt, dass Roger Marty ins Berggasthaus ›Staubern‹ kommt. Wann hat sie ›Rotscher‹, wie er sich nennt, das letzte Mal gesehen? Das muss schon lange her sein. Dem letzten längeren philosophischen Austausch im ›Plattenbödeli‹ vor Jahresfrist folgten einige wenige Kontakte, bevor sie sich aus den Augen verloren.
Denn Monika Inauen hatte nach vier Jahren als Serviceangestellte im Berggasthaus ›Plattenbödeli‹ Lust auf Veränderung verspürt. Nicht primär beruflich, sondern in erster Linie örtlich. Seit 28 Jahren, seit ihrer Geburt, hatte sie ihr Leben in Appenzell Innerrhoden verbracht, blieb ein Leben lang ›an die Scholle gefesselt‹, hatte es nicht geschafft, sich von ihrem Heimatkanton zu lösen.
Der Begriff ›an die Scholle gefesselt‹ hatte Monika schon immer fasziniert, weil sie sich selber so fühlte und sich bisher nicht hatte überwinden können, sich von diesen Fesseln zu lösen. Obschon der Ausdruck ursprünglich einen Fortschritt und etwas Befreiendes beschrieb, beinhaltet er auch etwas Traditionelles, etwas Bindendes. In alten germanischen Gesetzen definierte er, dass der Knecht nicht ein Sklave ist, mit dem der Eigentümer machen kann, was er will, sondern dass der Leibeigene nicht ohne Boden verkauft werden kann und somit dem Grundbesitzer zu folgen hat. Doch erst als die bäuerliche Produktion den Menschen sesshaft machte, fesselte sie ihn wirklich an die Scholle und forderte ihm seine gesamte Arbeitsleistung ab.
Gegen Ende des Vorjahres war für Monika der Zeitpunkt gekommen, sich von ihren Wurzeln und Freunden zu lösen und wegzugehen. Umso mehr, als sich ihre Hoffnungen, dass sich aus der Begegnung mit Peter ›Pit‹ Keller, dem Kriminalpolizisten, den sie Ende der Saison als Gast im ›Plattenbödeli‹ kennenlernt hatte, etwas ergeben würde, nicht erfüllt hatten. Er hatte ihr versprochen, sich wieder bei ihr zu melden. Doch daraus wurde nichts. Und Monika traute sich auch nicht, sich bei ihm zu melden. Das Wissen darüber, dass der Kontakt zu einem Menschen, den man gerne näher kennenlernen würde, möglichst schnell aufgebaut werden muss, da sonst Befürchtungen und Ängste schnell Oberhand gewinnen, nützte ihr dabei wenig. Sie war – und so schätzte sie auch Pit ein – dafür einfach zu zurückhaltend und zu scheu.
»Drei Dinge kann man nicht zurückholen: den Pfeil, der vom Bogen schnellte, das in Hast und Eile gesprochene Wort, die verpasste Gelegenheit«, erinnerte sich Monika an eine Aussage von Hadrat Ali, dem Vetter und Schwiegersohn des Propheten Mohammad. Wie recht er doch hatte!
So hatte sie sich entschieden, ab Jahresbeginn einige Monate im Ausland zu verbringen, bereiste wie so viele ihrer Kolleginnen und Kollegen Australien, ließ sich faszinieren von der Wärme, die trotz anfänglicher Regenzeit herrschte, von der Lockerheit der Australier und von den Möglichkeiten, neue Menschen kennenzulernen. Monika hatte diese Zeit ausgekostet, hatte sich gehen lassen und es genossen, tun und lassen zu können, was und wie es ihr beliebte.
Doch je näher die bereits im Voraus gebuchte Rückreise kam, desto mehr spürte sie auch, dass ihr ›Down Under‹ die Verbindlichkeit und die Sicherheit der Schweiz fehlte, dass sie sich nach ausgeprägten Jahreszeiten, ja auch nach Kälte und Schnee, zurücksehnte. Und nach dem Alpstein – nach seinen drei Edelsteinen, dem Seealp-, dem Fälen- und dem Sämtisersee – nach den sechs Luftseilbahnen und den 27 Berggasthäusern, nach ausgiebigen Spaziergängen und Bergwanderungen in den Appenzeller Alpen.
So kehrte Monika Ende Juni nach knapp einem halben Jahr auf der südlichen Halbkugel wieder zurück ins beschauliche Appenzellerland, wo sie im Berggasthaus ›Staubern‹ mit ihrer großen Erfahrung als Verstärkung im Team sehr willkommen war. Denn Janine wollte für den erwarteten Ansturm während der Ferienzeit gewappnet sein.
Auf 1.751 Meter über Meer statt auf 1.284 Meter ging es damit für sie weiter in ihrem Beruf, den sie so über alles liebte: die Nähe zur Natur und speziell zu den Bergen, zu ihrem Alpstein, der Kontakt zu den Gästen, die Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen und mit ihnen zu kommunizieren, die Arbeit im Team und die Freude darüber, ihren Gästen ihrerseits eine Freude bereiten zu können und Gastgeberin zu sein.
Der Wiedereinstieg fiel ihr leicht – umso mehr, als sie natürlich einen Großteil ihrer Gäste bereits kannte. Denn wer im ›Plattenbödeli‹ verkehrt, ist mit größter Wahrscheinlichkeit auch in den ›Staubern‹ anzutreffen. Wobei im Gegensatz zum ›Plattenbödeli‹, wo vor allem Wanderer und Gäste aus Appenzell und Umgebung auf einen Drink oder zum Essen vorbeikommen, hier dank der Seilbahnverbindung von Frümsen her mehr Gäste aus dem Rheintal auf die Staubern kommen.
Und auch das Pächterehepaar und ihre Kolleginnen waren ihr nicht unbekannt, denn es ist üblich, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benachbarter Berggasthäuser regelmäßig gegenseitig besuchen. So war Monika schon zu ihren ›Plattenbödeli‹-Zeiten oft an einem ihrer freien Tage vom Sämtisersee über die Rainhütte den steilen, aber gut ausgebauten Bergweg zum Staubernfirst aufgestiegen. Aber auch die etwas längeren Varianten Richtung Hoher Kasten und übers Wänneli hinauf auf den Kamm zwischen Kastensattel und Staubernfirst, oder über die Bollenwees und die Saxer Lücke hinauf auf die Staubern hatte sie schon mehrmals gewählt.
Im ›Staubern‹-Team wurde Monika sofort gut aufgenommen, ihre neue Chefin Janine Dietsche und ihr Mann Martin zeigten Monika deutlich, wie froh sie über ihre Verstärkung waren. Das Team umfasst mit dem Besitzerehepaar in Spitzenzeiten zwölf Personen: Jakob, der die betriebseigene Bahn von Frümsen auf die Staubern bedient, die Portugiesinnen Juliana und Edna, welche für die Zimmer und die Wäsche zuständig sind, Daniel, der zusammen mit Martin in der Küche arbeitet sowie Roswitha und – in einem Teilzeitjob – Anna am Buffet. Und dann natürlich die Kolleginnen im Service: Petra, wie Monika waschechte Appenzellerin, Alexandra, die Stadtzürcherin mit ausgeprägter Liebe zur Bergwelt und die Saisonangestellte Valeska Hovorka aus dem ostslowakischen Košice.
Das Team funktioniert gut, so gut wie im Jahr zuvor im ›Plattenbödeli‹, Janine ist ebenso mütterlich besorgt um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie damals Fränzi. Mit dem Unterschied, dass ihr im Gegensatz zur alleinstehenden Fränzi mit Martin ein Mann zur Seite steht. Ein Mann, der sehr engagiert ist, immer auch selber zupackt, wenn es notwendig ist, und der permanent an der Weiterentwicklung des Berggasthauses, seiner Infrastruktur und seines Angebotes arbeitet. Und der mit Leidenschaft sein Ziel, den Betrieb der ›Staubern‹ so ökologisch und nachhaltig wie möglich zu gestalten, verfolgt.
Und dann diese Überraschung, die eigentlich keine war, da sie früher oder später erwartet werden konnte, erwartet werden musste: Roger kommt als Gast in die ›Staubern‹! Monika freut sich sehr, Roger wiederzusehen, die Gespräche mit ihm sind ihr in bester Erinnerung geblieben. Es war die Faszination der Unterhaltungen, in welchen so vieles gesagt, ohne dass es ausgesprochen wurde, in denen so viel Raum für persönliche Interpretation blieb. Und in denen sie so viel von dem, was sie beschäftigte, mitteilen konnte, ohne es anzusprechen. Irgendwie fühlte sie sich von Roger angezogen, genoss es, mit ihm zusammen zu sein und war gleichzeitig nach jedem Treffen zutiefst verunsichert. Verunsichert über das, was sie gesagt hatte, verunsichert über das, was sie von ihm gehört hatte – und verunsichert über ihre Gefühle zu ihm.
Lange hatte sie nach dem letzten ausführlichen Gespräch mit Roger im ›Plattenbödeli‹ darüber nachgedacht, ob und wie sie den Kontakt zu ihm aufrechterhalten könnte. Gerne hätte sie eine längerfristige und engere Beziehung zu ihm aufgebaut, trotz des Altersunterschiedes. Denn obwohl sie auch jüngere Männer attraktiv und interessant findet, fühlt sie sich schon seit längerer Zeit zu reiferen Männern hingezogen – zu Männern, die oft beträchtlich älter sind als sie. Männer, die vom Alter her auch ihre Väter hätten sein können. Wenn sie mit ihren besten Freundinnen darüber spricht, stößt sie meist auf Unverständnis und den Erklärungsversuch, dass dies wohl mit ihrer starken Bindung zu ihrem Vater zusammenhängen würde. Deshalb würde sie einen Partner suchen, der ihrem Vater ähnlich ist, einen Vaterersatz. Doch für Monika sind es eine gefühlte Seelenverwandtschaft, ihre Ähnlichkeiten in der Art des Denkens, die Tiefe der Gespräche, die Möglichkeit, von seiner Lebenserfahrung zu profitieren und ihre gemeinsame Liebe zur Philosophie, die sie zu Roger hinziehen.
Doch ihre Australienpläne erübrigten weitere Gedanken. Da sie sich keinen zusätzlichen Abschiedsschmerz auferlegen wollte, suchte sie nicht mehr den Kontakt zu Roger, meldete sich auch nicht bei ihm, als sie ›Down Under‹ war und genoss einmal wieder die Spontaneität und Unverbindlichkeit im Kreise ihrer Alterskolleginnen und -kollegen, den Genuss des Moments.
Umso mehr freut sie sich jetzt über das Wiedersehen, welches gleich beim ersten Treffen nach langer Zeit wieder so vertraulich ist, als wären sie immer zusammen gewesen. Schnell tauchen sie wieder ein in philosophische Themen, sprechen über Monikas Veränderungswünsche, tauschen sich über ihre gemeinsam erlebten Erfahrungen und das, was sie zwischenzeitlich alleine oder mit anderen Menschen erlebt haben, aus. Obschon sie als Bauerntochter während ihrer Schulzeit nicht groß auf die Unterstützung ihrer Eltern, welche in der heutigen Zeit wohl als ›bildungsfern‹ bezeichnet würden, zählen konnte, hatte sie im jungen Erwachsenenalter eine spezielle Intelligenz entwickelt. Nicht diese kognitive, verstandesmäßige, an welcher die Kinder in den Schulen gemessen werden, sondern eher eine Lebensintelligenz oder eine gewisse Bauernschläue. Die Intelligenz, sich mit den wirklichen Herausforderungen und Anliegen des Lebens zu befassen, sich mit grundlegenden Themen des Lebens auseinanderzusetzen. So verschlang sie philosophische Bücher und Literatur über Lebensfragen, während sich ihre gleichaltrigen Kolleginnen auf Liebes-, Frauen- und Familienromane oder Sitcoms stürzten.
Monika ist dankbar für die Unterstützung durch Rogers Zuversicht, dass alles gut werde, wenn man geduldig bleibe. Geduld war noch nie ihre Stärke, dessen ist sie sich bewusst. Warten wird für sie oft zur Qual, sie will handeln, will Kontrolle über das haben, was läuft, will auch Einfluss darauf nehmen, wie es läuft oder sich entwickelt. »Im Warten lassen wir das, worauf wir warten, offen«, hatte Monika in einem Aufsatz von Wilhelm Höck über Geduld gelesen und wurde sich einmal mehr bewusst, dass sie sich nur ungern damit abfindet, dass auch etwas Unerwartetes eintreffen kann. Deshalb muss sie das Warten in ein Erwarten umwandeln, um damit umgehen zu können.
Wie damals mit Beat.
Beat war Monikas erster Schulschatz gewesen, zaghaft hatten sie gemeinsam ihre ersten Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht gemacht, sich geküsst, gestreichelt, gespürt, dass da etwas Neues, bisher Unbekanntes geschah, hatten versucht, die Grenzen auszuloten, was bereits möglich war. Doch wie die meisten Freundschaften in diesem Alter hielt auch diese nicht lange, bald fragte Beat ein anderes Mädchen, ob sie »mit ihm gehen will«, seine Freundin sein wolle. Das war Monikas erste Erfahrung, dass schlankere, hübschere Mädchen mehr Chancen bei Männern haben – eine Erfahrung, die sie ihr ganzes Leben lang begleiteten sollte.
Monika verfolgte Beats Beziehungen aus der Ferne und erlebte, wie er mit einer Frau zusammenzog und über längere Zeit mit dieser zusammenblieb. Monika gab Beat schon beinahe verloren, als er plötzlich wieder allein war, seine Freundin hatte ihn überraschend verlassen. Monika witterte ihre Chance, sah diese aber schnell wieder schwinden, als Beat für längere Zeit in eine Trennungsdepression abtauchte und sich zurückzog, kaum mehr unter Menschen anzutreffen war. Erst als seine Freunde alles daran setzten, ihn aus diesem Tief herauszuholen, kam auch Monika wieder in Kontakt mit ihm. Nicht wirklich intensiv und nahe, aber immerhin tauchte Beat ab und zu wieder im ›Plattenbödeli‹ auf.
Auch so an einem Nachmittag, als er, wie sich schnell herausstellte, wegen Monikas neuer, jungen und hübschen Kollegin zusammen mit seinen Freunden den halbstündigen Aufstieg durchs Brüeltobel auf sich genommen hatte. Und damit hatte sich auch Monikas Versuch, Beat zurückzugewinnen, bereits wieder erledigt. Beat hatte fortan nur noch Augen für die andere, nahm Monika noch weniger wahr als zuvor.
Monika hatte ihre neue Kollegin in ihren Freundeskreis eingeführt, war viel mit ihr unterwegs, hatte mit ihr eine Menge Spaß. Doch als diese mit Beat zusammenkam, verlor sie nicht nur ihren Wunschpartner Beat, sondern auch eine Freundin. Und wurde sich einmal mehr bewusst, dass sie als stämmige und kräftig gebaute Bauerntochter bei Männern keine Chance hatte gegen so grazile und hübsche Frauen, wie ihre Kollegin eine war.
Obwohl sie alles unternommen hatte, um das Warten auf Beat in eine konkrete Erwartung umzuformen, war alles missglückt. Monika war enttäuscht, wurde sich aber sehr schnell bewusst, dass sie weiterhin den Lauf der Dinge mitbestimmen musste, um zu dem zu kommen, was sie sich immer schon so sehnlichst gewünscht hatte.
Und diesem Grundsatz will sie auch in Bezug auf Roger treu bleiben.
Sonntagmorgen, Mitte August, Berggasthaus ›Staubern‹
Im ersten Moment ist auch Roger sprach- und fassungslos. Doch schnell findet er zurück in seinen vermutlich angeborenen Forscherinstinkt, der ihm schon so oft in seinem Leben – und vor allem in jüngster Vergangenheit – geholfen hat, Neues und für ihn Bedeutendes und Wichtiges zu entdecken.
»Gibt es Spuren zu der Lei…, ich meine zu dem Verletzten? Von wem könnte das Blut stammen, was ist hier wohl geschehen?« Die Fragen sprudeln aus Roger heraus, ohne jedoch von jemandem beantwortet zu werden. Janine steht nach wie vor wie angewurzelt im Raum und fixiert mit starrem Blick die Blutspur. Roger eilt zu ihr, packt sie von hinten an den Schultern, schüttelt sie sanft und versucht, sie wieder in die Realität zurückzuholen: »Janine, verstehst du mich, Janine, sag was, komm, wir müssen jetzt was tun, ich brauche deine Hilfe!«
»Blut …, Blut, überall, was ist hier geschehen?«, stammelt die Wirtin. Und wird sich gleichzeitig langsam bewusst, dass hier etwas geschehen sein muss, was ihr Leben und das Leben hier oben auf den Staubern nachhaltig verändern wird. »Ja, von wem stammen diese Blutspuren, wo ist diese Person? Was …, wer …, wo …? Was sollen wir jetzt machen?«, fragt Janine, und wendet sich langsam Roger zu.
»Die Polizei rufen, nichts berühren, alles absichern, schauen, dass keine Gäste hier runterkommen … und den Betrieb sicherstellen«, tönt es aus der Tür, durch die eben Monika ins ›Stübli‹ eingetreten ist. Roger schaut sie ungläubig an, ist erstaunt, wie schnell sie sich aus ihrer Starre, die er kurz zuvor im Vorbeigehen bemerkt hat, lösen und in diese Sachlichkeit wechseln konnte.
»Monika, alles in Ordnung, geht es dir gut?«
»Nein, nicht wirklich … Aber es nützt jetzt nichts, dass wir uns darüber unterhalten, wie es uns geht, wir müssen handeln«, antwortet Monika forsch. Ihre Augen haben von dem starren Blick in einen gewechselt, der Entschlossenheit und Zielstrebigkeit zeigt.
Janine schweigt einige Sekunden, scheint zu überlegen, wendet sich dann ruckartig zu Monika und fragt bestimmt: »Wo sind die anderen, wo sind die anderen Mädchen, Petra, Alexandra, Valeska? Monika, geh hinauf und schau nach, wo sie sind!«
»Janine, Petra kommt erst um halb acht Uhr mit der Bahn hoch, Alexandra am Nachmittag, Valeska ist noch im Zimmer, sie soll um sieben beginnen, das war so vereinbart«, versucht Monika ihre Chefin zu beruhigen.
»Langsam Janine, nur nichts überstürzen, lass uns zuerst mal kurz überlegen, was wir tun sollen. Bevor wir mit unüberlegten Handlungen etwas auslösen, was wir nicht wollen … Und dass wir hier oben nicht eine Panik auslösen, die das, was geschehen ist, unkontrollierbar macht«, interveniert Roger.
»Monika hat es bereits angedeutet, wir müssen hier unten die Situation ›einfrieren‹, nichts darf verändert werden, keine möglichen Spuren dürfen verwischt werden. Und niemand sonst außer uns darf diesen Raum betreten. Dann gilt es, oben den normalen Betrieb so gut wie möglich aufrechtzuerhalten, schon bald werden die ersten Gäste ihr Frühstück verlangen, dieses muss dann bereit sein. Das heißt, Monika geht hinauf und weist ihre Kollegin auf die besondere Situation hin, zu der sie aber im Moment nicht mehr sagen kann, garantiert den Frühstücksservice, und wir, Janine und ich, bleiben hier, rufen die Polizei und weisen diese hier ein«, schlägt Roger vor.
»Doch welche Polizei sollen wir rufen? Unser Berggasthaus steht auf Appenzell Innerrhoder Boden, die Bergstation der Seilbahn auf St. Galler Kantonsgebiet. Wer ist denn nun zuständig?«, fragt Janine Dietsche.
Roger wechselt einen kurzen Blick mit Monika, worauf beide wie aus einem Mund antworten: »Appenzell Innerrhoden, Leutnant Bruno Fässler, Leiter der Kriminalpolizei.« »Was nicht nur damit zu tun hat, dass der vermeintliche Tatort, das ›Stübli‹, auf Appenzeller Kantonsgebiet liegt, die Grenze verläuft ja genaugenommen schon kurz nach dem Eingang quer durch die Gaststube«, ergänzt Roger, »es geht vielmehr um die Erfahrung, die Fässler mitbringt. Und da seine Schwester ja das ›Plattenbödeli‹ führt, weiss er auch, was so ein Vorfall für ein Berggasthaus bedeuten kann.«
»Wobei wir ja noch nicht wissen, was hier wirklich geschehen ist«, wirft Monika ein.
»Monika, es ist jetzt bald Viertel vor sieben, geh hinauf und sieh zu, dass das Frühstücksbuffet bereit ist und reibungslos abläuft. Du Janine, rufst Bruno Fässler an, am besten über seine Schwester – es ist ja Sonntag, und Fässler wird wohl nur zuhause erreichbar sein … Er soll so schnell wie möglich mit seinen Leuten hier raufkommen, wohl am besten über Frümsen mit der Seilbahn, alles andere dauert zu lange. Brülisau – Plattenbödeli – Rainhütte oder Brülisau – Hoher Kasten – Staubernfirst beinhalten lange Fußwege, das geht nicht mit dem Material, welches sie mitnehmen müssen. Ich gehe schnell in mein Zimmer und hole meine Kamera, damit ich den jetzigen Zustand festhalten kann. Nicht, dass dann jemand auf die Idee kommt, wir hätten etwas verändert.«
Roger ist in seinem Element, dirigiert, koordiniert, scheint der Einzige zu sein, der trotz der speziellen Situation den Überblick behält. »Und, Janine, instruier dein Personal, dass niemand den Keller betritt – und den Seiteneingang zum ›Stübli‹ schließen wir ab, damit nicht noch jemand zufällig hier reinkommt.«
Die drei schwärmen aus, wissen, was sie zu tun haben, folgen ohne Widerrede Rogers Anweisungen. Janine geht nach oben in die Küche, wo bereits auch Daniel vor dem Herd steht und die warmen und heißen Speisen des Frühstücksbuffets vorbereitet: Rührei, gebratenen Speck, Siedwürste, Rösti. Da sein Chef, Martin, gestern bis spät in den Abend noch in der Küche stand, hat er die Frühschicht übernommen. »Dani, unten im ›Stübli‹ ist etwas passiert, wir wissen noch nicht genau was, ich muss die Polizei rufen, schau du, dass niemand in den Keller geht und dass die Gäste ihr Frühstück bekommen, als wäre nichts geschehen.« Noch bevor Daniel etwas sagen, geschweige denn eine Frage stellen kann, fügt sie an: »Ich muss jetzt sofort Martin wecken, ich brauche seine Hilfe.«
Roger ist unterdessen mit der Kamera, die er aus seinem Zimmer geholt hat, wieder im ›Stübli‹ und fotografiert alle Details, die aus seiner Sicht wichtig sein könnten. Er fotografiert zuerst den ganzen Raum aus verschiedenen Perspektiven, geht dann auf Details ein. Auf die Tische, auf denen noch gebrauchte Gläser und leere Flaschen des Vorabends stehen, schießt auch Bilder des mit Zigaretten- und Zigarrenstummeln gefüllten Aschenbechers, dann die Sitz- und Ablageflächen, die Wände mit den Bildern, die Lampen, die Fenster und Türen. Zu guter Letzt hält er die Blutspur in mehreren Bildern fest, jeden Abschnitt im Detail, in Nahaufnahmen. So engagiert er sich diesen detaillierten Bestandsaufnahmen des vermutlichen Tatortes widmet, so sicher ist er sich, dass diese Aufnahmen vor allem ihm, und weniger – falls überhaupt – der Polizei dienen werden.
Monika arbeitet unterdessen wieder in der Gaststube, wo sie das Frühstücksbuffet weiter herrichtet. Immer wieder schaut sie nervös auf ihre Uhr, bis sie es zwei Minuten vor 7 Uhr nicht mehr aushält. Sie stürmt in die Küche und fordert Daniel auf, sofort mit ihr zu kommen: »Daniel, komm, wir schauen nach, wo Valeska bleibt. Ich brauche deine Unterstützung, du musst mich begleiten!« Monika und Daniel steigen in den zweiten Stock hinauf, wo sich neben dem Fünfer- und Zehnerzimmer auch die Personalzimmer befinden, versuchen leise zu sein, um die Gäste nicht zu wecken. Monika klopft vorsichtig an die Tür von Valeskas Zimmer. Keine Antwort, nichts regt sich. Monika klopft noch einmal, wartet, drückt dann vorsichtig die Klinke runter und öffnet die Tür einen kleinen Spalt: »Valeska, hallo, Valeska, bist du wach?« Als sich noch immer nichts und niemand regt, öffnet sie die Tür etwas weiter und tritt ins Zimmer ein.
Daniel folgt ihr mit kleinem Abstand, wirft einen Blick über Monikas Schulter in den Raum. Das Zimmer ist leer und das unberührte Bett weist darauf hin, dass niemand diese Nacht hier verbracht hat. Plötzlich beginnt Monika vor ihm zu wanken. Daniel sieht noch, wie sie sich zu ihm dreht und den Mund aufreißt. Doch der Schrei bleibt lautlos, die ausgestoßene Luft erreicht die Stimmbänder nicht mehr. Denn obwohl Monika versucht, sich mit einem kleinen Schritt zur Seite aufzufangen, kann sie sich nicht mehr kontrollieren. Wie ein umstürzender Baum fällt Monika vor ihm in einer leichten Rotation der Länge nach hin, ohne irgendwelche Abwehr- oder Schutzreaktionen, ihr Kopf schlägt hart seitlich auf der Bettkante auf, die Haut platzt und Blut fließt aus der gesamten Länge des Risses der Wunde. Alles geht so schnell und passiert so überraschend, dass Daniel ohne Chance bleibt, helfend einzugreifen.
Als Monika nur wenige Sekunden später wieder zu sich kommt, blickt sie in Daniels Gesicht, der sich über sie gebeugt hat. Reflexartig greift sie mit der rechten Hand an ihren Kopf, spürt etwas Warmes und Feuchtes und sieht, als sie ihre Finger zurückzieht, dass diese voll Blut sind. »Was ist passiert, was ist geschehen? Ich wollte doch … Wo ist Valeska?«
»Ruhig Monika, bleib liegen, ich hole Hilfe. Hier, nimm mein Taschentuch, es ist sauber, und presse dieses gegen die Wunde, ich bin gleich wieder zurück«, versucht Daniel, Monika zu beruhigen. Da bereits ein Gast den Kopf zur Tür reinsteckt und fragt, ob er helfen könne, bittet er diesen, kurz bei Monika zu bleiben und eilt hinunter in die Gaststube.
Und noch bevor Daniel diese erreicht, steigt in ihm eine Vermutung hoch, die Monikas Ohnmacht erklären könnte: Das, was unten im ›Stübli‹ passiert ist, hängt mit der Beantwortung der Frage zusammen, wo Valeska ist.
Drei Monate zuvor, Košice, Ostslowakei
Valeska macht sich auf in die Stadt. Noch einmal will sie sich mit ihrer besten Freundin und Studienkollegin Alena treffen, bevor es dann für längere Zeit in die Schweiz geht. Sie verlässt ihre kleine Einzimmerwohnung in einem dieser großen und auch für Valeskas Empfinden hässlichen Wohnblöcke mit acht Stockwerken und zwölf Wohnungen pro Etage nahe des Stadtzentrums. Wie in vielen Ballungszentren des ehemaligen Ostblocks prägen diese Plattenbausiedlungen um die Altstadt herum auch in Košice das Stadtbild.
Nachdem sich in den Sechzigerjahren Industriebetriebe in Košice angesiedelt hatten, explodierte die Einwohnerzahl förmlich. Aus dem beschaulichen Städtchen mit 60.000 Einwohnern wurde in zehn Jahren eine Stadt mit über 140.000 Einwohnern, zehn Jahre später waren es über 200.000. Heute ist Košice mit 240.000 Einwohnern nach Bratislava die zweitgrößte Stadt der Slowakei, die jedoch mit gut 20 Kilometern zur ungarischen oder 100 Kilometern zur ukrainischen Grenze wesentlich näher bei ihren Nachbarländern liegt als bei ihrer 450 Kilometer entfernten Hauptstadt.
Hässlich erscheint der Wohnblock Valeska auch deshalb, weil alle Bewohner ihre Balkone individuell zu gestalten versuchen – so sieht das Haus von der Toryská her gesehen, der Straße, die von Westen ins Stadtzentrum führt, wie ein buntes Flickwerk aus.
Da es nur knapp zwei Kilometer bis zum Treffpunkt sind, entschließt sich Valeska, den Weg zu Fuß zu gehen. Nur kurz muss sie der stark befahrenen Toryská folgen, denn schon bald kann sie links abbiegen und gelangt über eine nur schwach besiedelte Grünzone auf die Floriánska, welche in die Šrobárova, später in die Alžbetina und schließlich in die Hlavná mündet, welche zum Dóm svätej Alžbety, dem Dom der heiligen Elisabeth, führt.
Valeska hat diesen Treffpunkt bewusst gewählt – erstens, weil jede Slowakin und jeder Slowake den größten Dom des Landes und das Wahrzeichen von Košice kennt; zweitens, weil sie diesen noch einmal aus nächster Nähe sehen will. Und als gläubige Christin lässt sie es sich auch nicht nehmen, die Zeit bis zum Eintreffen von Alena für ein kurzes Gebet im mächtigen Hauptschiff des fünfschiffigen Doms zu nutzen. Sie kniet sich in einer Bank nieder, den Blick auf den Elisabeth-Altar gerichtet, den Hauptaltar der heiligen Elisabeth mit seinen 48 gotischen Tafelgemälden und der Statue von Maria mit Jesuskind in der Mitte, und betet. Valeska bittet um Kraft für ihre neue Aufgabe, die sie erwartet, aber auch für Schutz in einem fremden Land fernab der Heimat.
Valeska ist unsicher, obschon ihr Vorname eigentlich ›die Starke‹ bedeutet. Ein wichtiger Schritt in ihrem Leben steht ihr bevor – beziehungsweise hat sie diesen bereits vollzogen: Ab- oder zumindest Unterbruch des Studiums. Vier Jahre, acht Semester Zahnmedizin hat sie an der ›Pavol Josef Safárik‹-Universität absolviert, doch jetzt ist ihr sprichwörtlich die Luft ausgegangen. Einerseits in finanzieller Hinsicht, denn trotz regelmäßiger Arbeitseinsätze während der Semesterferien reicht das Geld einfach nicht für die Studiengebühren und die Lebenshaltungskosten. Und von ihren Eltern, die aus einfachen Verhältnissen stammen und selber nur mit Mühe über die Runden kommen, kann und will sie keine Unterstützung erhalten. Andererseits aber auch, weil sie, je länger sie studiert, umso unsicherer geworden ist, ob sie mit Zahnmedizin wirklich die richtige Wahl getroffen hat.
Denn eigentlich hatte sie nach den vier Jahren im Gymnasium noch keine Vorstellung davon, was sie einmal ein Leben lang oder mindestens eine längere Zeit arbeiten wollte. Ihre Eltern drängten sie dazu, zu studieren. Sie wollten ihrer Tochter, die kurz nach der ›Samtenen Revolution‹ im Jahre 1989 – dem gewaltfreien Wechsel zur Demokratie – zur Welt gekommen war, eine bessere Zukunft und ein Leben im Wohlstand ermöglichen. Was sie aber nicht erkannten, war, dass diese Generation der ›Samtkinder‹ an ihren eigenen Erwartungen und dem Druck des ökonomischen Regimes, welches dem politisch diktatorischen folgte, zerbrach.
Trotzdem wählte Valeska wie sechzig Prozent der Schulabgänger den Weg an die Universität, obwohl sie wusste, dass neunzig Prozent der Abgänger ohne Job dastehen. Und die neu vom Staat eingeführten und subventionierten Absolventenpraktika für Jungakademiker in Unternehmen bieten mit einem Monatslohn von 190 Euro auch keine wirkliche Perspektive.
Deshalb fokussierte sich Valeska bei ihrer Studienwahl auf eine Richtung, welche wenigstens im nahen Ausland anerkannt ist und für die Zukunft eine gute Perspektive bietet. Obwohl der amerikanische Stahlkonzern U. S. Steel mit 16.000 Angestellten der größte Arbeitgeber der Stadt ist und bei diesem immer wieder interessante Kaderstellen zu besetzen sind, konnte sie sich nicht für eine technische Richtung begeistern. Und da im benachbarten Ungarn in der Zahnmedizin wegen des wachsenden Medizintourismus immer neue Fachkräfte gesucht werden, entschied sich Valeska für diese Richtung. Doch schon bald merkte sie, dass die Qual vor der Wahl nur durch die Qual nach der Wahl abgelöst wurde: »Bin ich hier am richtigen Ort?«
So versuchte sie schon vor einem Jahr, eine Stelle im Ausland zu finden – einfach mal weg aus Košice, weg aus der Slowakei, in den Westen Europas, von dem man hört, dass dort viel mehr Geld zu verdienen sei. Dass sie dafür wie auch hier arbeiten muss, ist ihr klar, zum Arbeiten ist sie sich wie viele ihrer Landsfrauen nicht zu schade. Doch hier sind die Perspektiven schlecht. Denn obwohl die Arbeitslosenquote des Landes mit gut 14 Prozent noch unter der des Gesamtdurchschnitts des europäischen Raums liegt, steigt diese, je weiter man in den Osten der Slowakei und damit in die Region um Košice kommt, auf über 22 Prozent. Die Arbeitslosenquote für die 15- bis 24-Jährigen liegt gar bei beinahe 38 Prozent, und eine wesentliche Verbesserung ist nicht in Sicht.
Einige ihrer Kolleginnen aus der Schulzeit arbeiten schon länger in landwirtschaftlichen Betrieben in der Schweiz, vor allem im Ostzipfel dieses kleinen Landes, das in Europa wirtschaftlich und politisch noch immer eine Sonderstellung einnimmt. Ihre Kolleginnen pflanzen Salate und Gemüse an, pflücken Äpfel, Erdbeeren und andere Früchte – meist nur in den Sommermonaten, dann kehren sie wieder zurück. Sie leben in einfachen Verhältnissen, in großen Gruppen in kleinen Wohnungen, zusammen mit Frauen und Männern aus Polen und Tschechien, die wie sie aus der Slowakei in diesen Betrieben als Arbeitskräfte gerne aufgenommen werden. Sie sind genüg- und arbeitsam, arbeiten oft über achtzig Stunden die Woche. Und nicht selten sind Studierte oder Studierende dabei, die solche Arbeiten verrichten, um zu Geld zu kommen. Denn mit dem im Ausland hart verdienten Lohn – rund 1.600 Euro netto gegenüber einem durchschnittlichen Monatseinkommen von rund 400 Euro in der Ostslowakei – lässt sich dann zu Hause eine Zeit lang gut leben.
Doch Valeska will nicht in die Landwirtschaft. Nicht wegen der großen körperlichen Belastung, aber sie will auch bei der Arbeit unter Menschen sein, sich mit diesen unterhalten, mit ihnen reden. »Du machst deinem Namen wirklich Ehre«, muss sie sich oft von ihren Freundinnen sagen lassen. Denn ihr Familienname ›Hovorka‹ bezeichnet eine sehr gesprächige Person.
Über eine Agentur, welche osteuropäische Arbeitskräfte nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz vermittelt, suchte sie eine Stelle in einem Restaurant oder Hotel. Doch im April waren die meisten Stellen bereits weg, und als dann doch noch eine auftauchte, für die sie sich melden konnte, hieß es, dass diese soeben vergeben worden sei. Eine Stelle in einem Berggasthaus in der Schweiz, im Appenzellerland, ganz in der Nähe von Appenzell – das wäre das gewesen, was sie sich vorgestellt hatte. Im Internet hatte sie sich in einem Filmportrait das Gasthaus angeschaut, wunderschön gelegen, auf einer Waldlichtung und auf einer Hochebene, nahe an einem kleinen See und mitten in einem beeindruckenden Gebirge. ›Plattenbödeli‹, diesen Namen hatte sie sich trotz der für sie ungewohnten Konsonanten gemerkt und gehofft, dass sich ihr vielleicht ein Jahr später diese Gelegenheit nochmals bieten würde.
Noch im letzten Jahr war sie im ersten Bewerbungsgespräch bei dieser Agentur gescheitert, hatte aber ihre Unterlagen dort hinterlegt und mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass sie sehr, ja, sehr an einer Stelle in diesem Berggasthaus interessiert sei. Oder, wenn dort keine Stelle frei sei, in einem anderen der scheinbar zahlreichen Berggasthäuser dieser Region.
Und nun hat es geklappt: In den ›Staubern‹, etwas höher gelegen als das ›Plattenbödeli‹, aber in Sichtweite zu diesem, wird sie nächste Woche ihre Saisonstelle im Service beginnen. Valeska freut sich auf diese neue Herausforderung, wenn auch eine gewisse Unsicherheit bleibt, die sie nun mit ihrem Gebet im Dom zu verdrängen versucht.
Draußen wartet bereits Alena. »Was hast du denn im Dom gemacht, Valeska?«, fragt sie, noch bevor sie ihre Freundin begrüßt. »Gebetet«, lautet Valeskas knappe und klare Antwort, die Alena hindert, weiter nachzufragen.
Die beiden Freundinnen schlendern die ›Hlavná ulica‹ auf und ab, die Fußgängerzone, in der es neben zahlreichen kleinen Läden auch mehrere Cafés und kleine Restaurants gibt. Die ›Hlavná ulica‹ ist die Hauptstraße und der eigentliche Kern von Košice, die sich in der Mitte linsenförmig zu einem Platz öffnet, südlich am ›Námestie osloboditeľov‹, dem ›Befreierplatz‹, und nördlich am ›Námestie Maratónu mieru‹, dem ›Friedensmarathon‹, in einer Kreuzung endet. Dazwischen liegen alle wichtigen Denkmäler von Košice, die Michaeliskapelle, der Urbanturm, das historische Theater und auch der hochgotische Elisabeth-Dom.
Im ›Carpano‹, unmittelbar neben dem Dom, gönnen sich die beiden nach dem kurzen Spaziergang einen Kaffee. Sie sitzen draußen, obwohl es erst Anfang Mai, am späteren Nachmittag und noch relativ kühl ist. »Wie geht es dir, so kurz vor der Abreise«, will Alena nun endlich von ihrer Freundin wissen, nachdem sie sich während des gemeinsamen Spazierganges nur über Belangloses unterhalten haben.
»Freude, Spannung, Unsicherheit, vielleicht gar etwas Angst – alles kommt im Moment zusammen. Ich weiß nicht genau, was mich erwartet, ob ich die Erwartungen meiner neuen Arbeitgeber erfüllen und die für mich ungewohnte Arbeit bewältigen kann, wie ich den Abschied von Košice und meinen Freunden verkrafte, ob ich es aushalte, so lange von zu Hause weg zu sein. Ich war ja noch nie länger an einem anderen Ort«, sprudelt es aus Valeska heraus.
»Auch wenn ich dich natürlich sehr vermissen werde – ich denke, du hast riesiges Glück, dass sich dir mit 22 Jahren bereits eine solche Chance bietet und du diese packst«, versucht Alena sie zu beruhigen. »Hier geht es ja nicht wirklich vorwärts, ich weiß auch noch nicht, ob ich während der Semesterferien einen Job finde werde. Denn im Moment spüre ich noch nicht viel davon, dass Košice wie Marseille Kulturhauptstadt Europas ist. Das Einzige, das offensichtlich auf diesen Status hinweist, sind die farbigen Prismen, welche das Logo der Kulturhauptstadt repräsentieren und die überall in der Stadt aufgestellt sind. Und auch wenn einiges erneuert und verbessert wurde, scheinen bis heute noch nicht wirklich mehr Touristen hierherzukommen.«