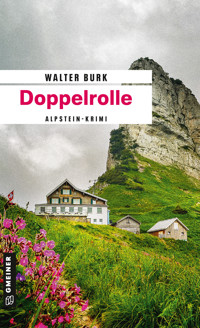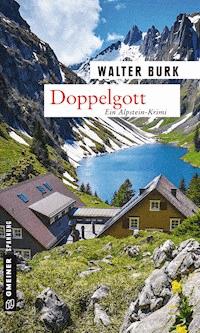Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Begeben Sie sich auf den legendären Whiskytrek. In Fässern aus aller Welt schlummern in den Kellern der 27 Berggasthäuser rund um die berühmten Gipfel Hoher Kasten, Ebenalp, Kronberg und Säntis seit Jahren unnachahmliche Whiskys. Erkunden Sie in 27 Kriminalgeschichten die einmaligen und speziellen Whiskyeditionen des höchstgelegenen Whiskytreks Europas. Nicht nur Protagonisten der Alpsteinkrimi-Trilogie tauchen in einzelnen Kurzkrimis wieder auf - auch alte Sagen des Appenzellerlandes und Mythen rund um das »flüssige Gold« werden in diesen wieder lebendig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Walter Burk
Whiskytrek
Krimis aus dem Alpstein
Impressum
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Doppelgott (2016), Doppelrolle (2015), Doppelbindung (2014)
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Brauerei Locher AG
ISBN 978-3-8392-5298-7
Wasser des Lebens (Prolog)
Dingwall, Schottland, im Herbst 1435
Der Nebel hängt tief über den schottischen Highlands.
Hier, im Nordwesten des Landes, gehört dieser im Herbst ebenso zum gewohnten Bild wie regelmässiger Regen. Doch in Dingwall bleibt die Luft auch ohne Regen immer feucht, saugt sich selbst während der raren trockenen Sonnenstunden mit dem Wasser des Cromarty Firth, dem Meeresarm der Nordsee, voll.
Im gut 20 Kilometer nordwestlich von Inverness gelegenen Dorf – dort, wo sich der River Peffery mit dem Schwemmland des River Conon vereinigt – steht die von König Alexander II. im Jahre 1226 erbaute königliche Burg. Die Festung, die während der schottischen Unabhängigkeitskriege durch König Edward I. von England besetzt worden war, jedoch später wieder durch schottische Kräfte für König Robert I. von Schottland, besser bekannt als »Robert the Bruce«, zurückerobert wurde. Und auch der Earl of Ross, der Anführer des Clan Ross, führte von hier aus seine Männer 1314 gegen die Engländer in die Schlacht von Bannockburn.
Diese Geschichten kennt Aodh McBarrel, dessen kleiner Hof in unmittelbarer Nähe der Burg liegt, nur aus den Erzählungen, die ihm sein Vater erzählt und ihm auf diesem Weg auch den Stolz seines Clans weitergegeben hat. Denn die McBarrels hatten schon immer an der Seite befreundeter Clans für die Freiheit und Unabhängigkeit der Highlands und gegen verfeindete Familiengemeinschaften gekämpft. Was sein Vater mit seinem Leben bezahlte hatte, als er 1411 in der Schlacht von Harlaw die Ansprüche der Lords of the Isles gegen den Duke of Albany unterstützte.
Aodh war damals erst 16 Jahre alt und musste damit bereits früh die Verantwortung für den Hof übernehmen – nur eine kurze Zeit zusammen mit seiner Mutter, die wenige Jahre später ebenfalls verstarb.
Seit der Krönung James I. im Jahre 1424 hat sich die Situation in den Highlands beruhigt. Als Verfechter eines starken Königtums war es ihm gelungen, die rivalisierenden Hochlandclans und die einflussreichen Lords of the Isles in Schach zu halten. Und vor sieben Jahren konnte er die »Auld Alliance«, das Bündnis mit Frankreich, erneuern, obwohl die Schotten 1424 in der Schlacht von Verneuil an der Seite der Franzosen von den Engländern besiegt worden waren und 4.000 Mann verloren hatten.
Dass James I. dies geschafft hat, ist für Aodh McBarrel eine Überraschung. Denn als Prinz wurde der erst 13-jährige James 1406 gefangen genommen und so in einem englischen Gefängnis zum König der Schotten. Erst 18 Jahre später konnte er nach Edinburgh zurückkehren – mit einer englischen Braut – und wurde endlich offiziell gekrönt.
Doch Schottland war bitterarm und die Schatzkammer leer – darüber täuschten auch James’ Versuche, das Land zu einen, um den Schotten Voraussetzungen für ein Mindestmaß an Autonomie zu schaffen, nicht hinweg.
Doch Aodh McBarrel ist stolz, Schotte zu sein. Und als Bauer zu arbeiten.
Die Gerste, die im Sommer als Grundnahrungsmittel und Viehfutter angebaut wird, ist längst geerntet und eingefahren. In den letzten Jahren waren die Ernten ausreichend, sodass Aodh nicht den ganzen Ertrag brauchte, um über den Winter zu kommen. Deshalb hatte er, wie viele andere Bauern, begonnen, aus den überschüssigen Vorräten einen Wärme spendenden Schnaps zu brennen. Was ursprünglich nur als Medizin gedacht war, entwickelte sich bald zu einem beliebten Getränk in den Clans, dem »aqua vitae«, dem »Wasser des Lebens« oder »uisge beatha«, wie es Aodh im Gälischen nennt.
Dafür muss er aber zuerst die Gerste mälzen. Nach der Reinigung des Getreides wird es in Wasser eingelegt, damit es zu keimen beginnt. Auf dem flachen Tennenboden ausgebreitet, werden im wieder zum Leben erweckten Korn Enzyme gebildet, welche die im Korn enthaltene Stärke zu Malzzucker umwandeln. Während dieses Prozesses des Ankeimens wird das sogenannte »Grünmalz« immer wieder gewendet und kommt nach einigen Tagen in einen mit Torf beheizten Raum, in dem der Keimprozess gestoppt und das Malz getrocknet wird.
Über die gemahlene Gerste gießt Aodh McBarrel dann heißes Wasser und gibt Hefe dazu, damit in dieser zuckerreichen Flüssigkeit, der Maische, über die Vergärung Alkohol entstehen kann. Anschließend wird sie in einer Brennblase erhitzt, in welcher die Flüssigkeit am Deckel kondensiert und in einer Rille aufgefangen wird. Mit dieser einfachen, aber aufwendigen Methode brennt Aodh jeden Herbst ein Fass seines »Wassers des Lebens«, welches er dann aus einem Quaich, der flachen hölzernen Trinkschale mit zwei Griffen, genießt.
Trotz der momentan guten Lebenssituation mit Ernteüberfluss und den damit verbundenen Annehmlichkeiten ist für Aodh McBarrel klar, dass er früher oder später Schottland verlassen und sein Glück auf dem europäischen Festland suchen muss. Einerseits, weil er bei einer schlechten Ernte wie viele seiner Landsleute schnell wieder arm sein würde. Andererseits aber auch, weil die Pest, der »Schwarze Tod«, welche Mitte des 14. Jahrhunderts rund einen Drittel der schottischen Bevölkerung hingerafft hatte, in regelmäßigen Abständen immer wieder auftaucht.
So verlässt er im darauffolgenden Sommer seinen Hof und schifft sich nach Irland ein. Von dort soll seine Reise weiter gehen nach Frankreich und dann Richtung Süden. Doch weiter als Dublin schaffen es er und sein Fass mit Lebenswasser, welches er mitnimmt, nicht. Dort lernt er eine Frau kennen, die er ehelicht und mit der er drei Kinder – zwei Söhne und eine Tochter – zeugt. Und die ihn dazu bringt, in Irland zu bleiben.
Seine Erfahrung in der Herstellung von »uisge beatha« hilft Aodh McBarrel, seine Existenz und die seiner Familie zu sichern – bald wird sein gebranntes Wasser so beliebt, dass er von dessen Verkauf leben kann.
Doch Aodh erlebt nicht mehr, dass »aqua vitae« im Jahre 1494 erstmalig in schottischen Steuerunterlagen, den »Exchequer Rolls«, urkundlich erwähnt wird. Und erst Generationen später werden auch seine Nachkommen nicht mehr von »uisge beatha« sprechen, sondern von »Whisky«, nachdem dieser Begriff 1736 zum ersten Mal in Dokumenten auftaucht.
Als zwischen 1845 und 1852 eine neuartige Kartoffelfäule das Hauptnahrungsmittel der Bevölkerung Irlands vernichtete, starben in der »Grossen Hungersnot« eine Million Menschen; zwei Millionen Iren gelang die Auswanderung.
Und zu diesen Auswanderern gehörten auch die Nachkommen von Aodh McBarrel.
Über Umwege und nach mehreren Zwischenhalten landeten sie schließlich in der Nähe der Region, in welcher bereits der irische Wandermönch Gallus im 6. Jahrhundert seine Bleibe gefunden und das Kloster St. Gallen gegründet hatte.
Und mit den McBarrels kamen nicht nur die ersten Schotten, sondern auch der Whisky nach Appenzell und in den Alpstein.
Angels’ Share
Brauquöll Appenzell, im Spätsommer 2015
Patrik Böttcher klopft das Fass erneut ab.
Der Hall verrät ihm den Hohlraum, der über die jahrelange Lagerung entstanden ist, obwohl das Fass einst bis zum Rand gefüllt worden war.
»Angels’ Share«, lacht sein Mitarbeiter Klaus, der eben den Lagerraum betreten und Patrik beobachtet hat.
»Du hast gut lachen«, wendet sich Patrik diesem zu, »aber hör mal genau hin, da stimmt doch etwas nicht.«
Er klopft das Fass noch einmal ab, wechselt dann zu dem danebenliegenden, wiederholt das Prozedere. »Hörst du den Unterschied?«
»Der Klang ist bei diesem Fass heller«, antwortet Klaus emotionslos.
»Das heißt, dass …«, fordert ihn Patrik heraus.
»Der Hohlraum kleiner ist?«
»Richtig, Klaus«, bestätigt der Braumeister und klopft weitere Fässer ab. »Hörst du, dumpf, dumpf, dumpf, alle haben in etwa den selben Klang, den gleich großen Hohlraum. Aber Achtung, hör gut hin!« Er steuert zielstrebig auf ein weiteres der 27 Whiskyfässer, welches etwas weiter hinten im Raum gelagert wird, zu und klopft auch dieses ab.
»Heller Klang«, ruft Klaus erstaunt aus, »wieder ein Fass mit größerem Hohlraum. Liegt das am verwendeten Holz?«
»Nein, so große Unterschiede können durch die unterschiedlichen Holzarten nicht entstehen. Der Whiskyanteil, der verdunstet, hängt wohl ein wenig von der Art und dem Alter des verwendeten Fasses ab, vor allem aber von der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Und diese beiden Faktoren werden ja hier in unserem Lagerraum konstant gehalten, damit der Angels’ Share nicht mehr als zweieinhalb Prozent pro Jahr beträgt.«
»Und damit eher mehr Wasser als Alkohol verdunstet, wird die Luftfeuchtigkeit hoch gehalten«, fügt Klaus an, stolz darüber, dass er seinem Chef sein Fachwissen beweisen kann.
»Das heißt, dass aus einzelnen Fässern Whisky auf eine unnatürliche Weise verschwindet«, bringt nun Patrik das auf den Punkt, was er bereits bei der Prüfung des ersten Fasses vermutet hat.
»Diebstahl?« Klaus schaut seinen Chef fragend an.
»Diebstahl, ja Diebstahl, anders kann ich mir das nicht erklären«, bestätigt ihn dieser.
»Doch wer …?«
»Bevor wir uns damit befassen, sollten wir nochmals gemeinsam prüfen, welche Fässer davon betroffen sind«, unterbricht ihn Patrik.
In der Grösse unterscheiden sich die 27 verschiedenen Fässer nicht, nur in der Art und der Farbe des Holzes. Und der einheitliche, kreisförmige Beschlag auf der Frontseite mit dem Bären aus dem Logo des Appenzeller Biers, eingerahmt von Edelweiß, und dem Schriftzug »Säntis Malt – Appenzeller Whiskytrek – Swiss Alpine Whisky« lässt alle Fässer gleich aussehen.
»Betroffen sind die Fässer vom ›Aescher‹, von der ›Alpenrose‹, vom ›Hohen Kasten‹, der ›Krone Brülisau‹, dem ›Lehmen‹, dem ›Mesmer‹, dem ›Rotsteinpass‹, dem ›Säntisgipfel‹, der ›Tierwis‹ und von unserem ›Brauquöll‹«, kommt Klaus zum Schluss, nachdem die beiden alle Fässer noch einmal überprüft haben.
»Zehn der 27 Berggasthäuser des Whiskytreks«, sinniert Patrik, »doch was verbindet diese miteinander, was haben sie gemeinsam? Oder anders gefragt: warum diese zehn und nicht die anderen 17?«
»Doch ein Angels’ Share, einfach ein außergewöhnlich großer«, spekuliert Klaus.
»Über den Destillerien und ihren Lagerhäusern liegt ein spezieller Dunst, verursacht von der teilweisen Verdunstung der hochprozentigen Destillate durch das Holz hindurch. Das ist unbestritten. Doch dass dadurch viele Engel von solchen Orten angezogen werden und sich ihren Engelsteil, eben diesen ›Angels’ Share‹ holen, gehört definitiv ins Reich der Mythen«, reagiert Patrik genervt.
»Vielleicht wollte jemand unserem Geheimnis auf die Spur kommen? So wie viele Menschen gerne wüssten, welches Geheimnis hinter dem Appenzeller Käse steckt …«
»Wir haben kein Geheimnis«, interveniert Patrik. »Es ist doch bekannt, dass wir auf solides Handwerk setzen, das Quellwasser aus dem Alpstein und Braugerste aus Berggebieten verwenden, wo sie später reift und dadurch besonders kräftig ist.«
»Was sollen wir jetzt machen?« Klaus wirkt hilf- und ideenlos.
»Wir müssen unbedingt die Polizei einschalten, wir können nicht einfach so tun, als sei nichts geschehen. Spätestens bei der Auslieferung an die betroffenen Berggasthäuser wird klar werden, dass mit ihren Fässern etwas nicht stimmt«, wendet Patrik ein.
Während Klaus sich aufmacht, um aus dem Büro der Brauerei die Polizei aufzubieten, bleibt Patrik im Lagerraum, lässt sich noch einmal durch den Kopf gehen, was passiert ist und welche Auswirkungen dieser Vorfall haben könnte.
Der vermeintliche Diebstahl würde das ganze Konzept des Whiskytreks in Gefahr bringen. Denn alle Berggasthäuser sollten die gleiche Menge Whisky erhalten, welcher sich durch den Ausbau in unterschiedlichen Fässern in individuellen Editionen entfaltet. Aber so schnell lässt sich der verschwundene Inhalt, der über Jahre gereift ist, nicht wieder ersetzen.
Patrik sieht sein Lebenswerk gefährdet, aber auch seine Stellung in der Appenzeller Gemeinschaft, die er sich erarbeitet hat.
Eigentlich weiß niemand so recht, wie und wann seine Familie mit Namen Böttcher nach Appenzell Innerrhoden gekommen ist. Aber es interessiert auch kaum jemanden. Der Name klingt einfach deutsch – sehr deutsch – und damit ist allen klar, dass sie Fremde, »frönte Fötzel«, wie es die Appenzeller ausdrücken, sein müssen.
Aber der Vorname Patrik ist dort geläufig. Deshalb war Patrik Böttcher auch selbst lange nicht daran interessiert, mehr über seine Herkunft herauszufinden. Doch als seine Arbeitgeberin, die Brauerei Locher in Appenzell, sich erstmals mit dem Brennen von Whisky befasste, tauchte Patrik in die schottische Geschichte ein und stieß dabei auf Familiennamen, die in ihrer Bedeutung dem seinen sehr nahe kamen.
Bereits der erste Single Malt Whisky seiner Brauerei, der »Säntis Malt«, wurde traditionsgemäß in Holzfässern ausgebaut – Fässer, welche früher schon Fassbinder, Büttner, Küfer oder eben Böttcher hergestellt hatten. Schnell war Patrik klar, dass sein Familienname von dieser Berufsbezeichnung stammt.
Es war denn für ihn auch keine große Überraschung, in schottischen Geschichtsbüchern und Archiven auf Namen zu stoßen, deren Wurzeln sich auf den gleichen Ursprung zurückführen ließen: Cooper, Hooper – oder auch McBarrel.
Als er dann seine eigene Familiengeschichte ins Visier nahm, führte ihn seine Spurensuche nach Norddeutschland, wo seine Herkunft ihren Ursprung in einer Namensänderung fand. Ende des letzten Jahrhunderts hatte dort die schottischstämmige Familie McBarrel eine Änderung ihres Familiennamens auf Böttcher beantragt. Was auch, da die Familie schon über Generationen in Deutschland ansäßig war, bewilligt wurde.
Patrik forschte weiter, wollte wissen, wo seine Wurzeln waren. Und stieß dabei auch auf eine Verbindung zu seinem neuen Berufsfeld, das Braumeisteramt der Whiskyherstellung. Ein Aodh McBarrel hatte bereits in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts Whisky gebrannt, in Dingwall, nordwestlich von Inverness.
Dass der Vorname seines letzten nachweisbaren Vorfahren, Aodh, die gleiche Bedeutung hat wie der seine, war für Patrik dann nur noch eine kleine zusätzliche Überraschung: Aodh stammt von »aed«, was »Feuer« bedeutet, ab; Patrik steht im Altirischen für »brennendes Feuer«.
Patrik wird von der eintreffenden Polizei aus seinen Gedanken geholt. Vorerst ist es nur eine Zweierpatrouille, die im Lagerraum auftaucht und genau wissen will, was geschehen ist.
»Wann haben Sie die Fässer das letzte Mal kontrolliert«, fragt der Beamte Patrik.
»Ich kontrolliere die Fässer ja nicht jeden Tag«, erklärt dieser, »denn der Whisky braucht vor allem Ruhe, um sich entwickeln zu können. Ende des letzten Monats, das heißt vor rund vier Wochen, war aber alles noch in Ordnung. Das weiß ich mit Sicherheit, weil ich von allen Fässern Proben genommen habe, um den aktuellen Stand der Reifung zu prüfen.«
»27 Proben an einem Tag – na dann Prost«, lacht der Beamte, »Sie haben ja einen schönen Beruf.«
»Den habe ich wirklich«, bestätigt Patrik, »auch wenn ich die 27 Proben natürlich nicht trinke. Ich mache nur ein ›Nosing‹, das heißt ich errieche den Whisky und versuche, seine Geschmäcker zu bestimmen. Dann beurteile ich seine Wirkung im Mund, auf der Zunge und im Abgang, bevor ich die Probe wieder ausspucke.«
»Nun, dann muss sich in den letzten vier Wochen jemand an den zehn Fässern bedient haben«, folgert der Beamte. »Haben Sie schon einen Zusammenhang zwischen den zehn betroffenen Fässern herausgefunden? Dürfte ja wohl kaum Zufall sein, welche vom vermeintlichen Dieb ausgewählt wurden.«
»Darauf sind Klaus und ich auch gekommen«, bestätigt Patrik etwas genervt, »doch haben wir noch keinen logischen Zusammenhang entdeckt. Klaus hat sich mit dieser Frage beschäftigt, jedoch in so kurzer Zeit nicht die Spur einer Verbindung gefunden. Das wäre ja dann auch Ihre Aufgabe, beziehungsweise die Ihrer Kollegen.«
Der Beamte versteht sofort, bricht die Befragung ab und bietet seine Kollegen der Kriminalpolizei auf.
Als Kriminalpolizist Max Dörig mit seinem Assistenten Emil Dobler in der Brauerei auftaucht, hat der Beamte bereits alle Mitarbeitenden zusammengetrommelt, deren Personalien aufgenommen und sie darüber informiert, dass sie sich für eine kurze Befragung zur Verfügung halten sollen.
Nachdem Max vom Beamten über die bisherigen Erkenntnisse ins Bild gesetzt worden ist, wendet er sich dem Braumeister zu: »Herr Böttcher, bevor wir die Fässer auf Spuren untersuchen, müssen Sie uns erklären, wie Sie Whisky zur Probe entnehmen. Wir müssen ja wissen, wo wir was suchen müssen.«
»Nun, das ist ganz einfach, Herr Dörig, Zapfen raus, das machen wir mit einem speziellen Instrument, einer Art Zapfenzieher ohne Schraubgewinde, damit der Zapfen nicht verletzt wird. Dann Ansaugeinrichtung rein, Whisky ansaugen und ins Glas ablassen.«
»Und wo finden wir diese Ansaugeinrichtung und den Zapfenzieher? An diesen sind ja am ehesten Spuren, Fingerabdrücke, zu finden. Auf dem Korken wird dies etwas schwieriger, wenn nicht gar unmöglich.«
»Hier«, zeigt Patrik an die Wand hinter den Fässern, wo die beiden Geräte stehen. Neben dem bläulich schimmernden Zapfenzieher steht das meterlange Ansaugrohr, welches ins Fass gesteckt wird, damit der Whisky darin hochsteigt. Durch ein einfaches Abklemmen der Luftzufuhr bleibt die Flüssigkeit im Rohr und kann so ins Glas abgelassen werden, wobei dieses normalerweise zuerst außen und innen mit dem Whisky ausgespült wird, um fremde Gerüche zu eliminieren.
Die Forensiker machen sich an die Arbeit, um die auf beiden Geräten vorhandenen Fingerabdrücke zu sichern und mit denen der Mitarbeiter der Brauerei zu vergleichen, um die Unschuldsvermutung zu bestätigen. Klar bestimmen können sie jedoch nur die von Patrik – weitere zufällige oder auch absichtliche Zugriffe auf die beiden Geräte können wegen der mehrfachen Überlagerungen nicht extrahiert werden.
»Herr Böttcher, haben Sie schon daran gedacht, dass die Fässer nicht von einer außenstehenden Person, sondern von jemandem aus ihrem Unternehmen angezapft wurden?«
»Einer von uns, ein Brauereimitarbeiter?«, fragt Patrik ungläubig. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand aus unserer Belegschaft zu einer solchen Tat fähig wäre. Alle stehen hinter dem Produkt des Whiskytreks, sind stolz darauf, daran beteiligt zu sein! Wir kommen ja alle – zumindest die in der Produktion Beschäftigten – aus der Bierbrauerei, haben uns jedoch gerne auf die Innovation der Whiskyproduktion eingelassen und uns darauf spezialisiert. In unterschiedlichen Ausprägungen natürlich, den Anforderungen und Fähigkeiten entsprechend.«
»Könnte es sein, dass sich jemand zu wenig wahrgenommen und berücksichtigt fühlt, glaubt, mehr beitragen zu können, als von ihm oder ihr verlangt wird?«, fragt der Ermittler nach.
»Das ist natürlich immer möglich, mir jedoch bisher nicht aufgefallen«, stimmt Patrik zu.
Max Dörig geht einen Schritt auf Patrik zu, so dass er neben ihn zu stehen kommt und ihm zuflüstern kann: »Dann schlage ich vor, dass wir für alle hier die Ermittlungen offiziell und ohne Erfolgsmeldung abschließen, aber den Lagerraum über die kommenden Nächte überwachen. Vielleicht geht uns ja der Täter doch noch in die Falle.«
Patrik nickt und informiert alle Mitarbeitenden über den Abschluss der Ermittlungen: »Schreiben wir diese Verluste ab und gehen wir wieder zur Tagesordnung über! Lasst uns vorwärts schauen und weiter an einem erfolgreichen Whiskytrek arbeiten!«
Es vergehen drei Nächte, während denen die Beamten, welche – ohne dass dies außer Patrik und seinem Chef weitere Mitarbeitende wissen – im Lagerraum auf der Lauer liegen, am Morgen nichts rapportieren können. Dann, in der vierten Nacht, rührt sich etwas.
Wie der Schatten, der plötzlich über den Fässern erkennbar ist, in den Lagerraum gekommen ist, können die Beamten ihrem Chef im Nachhinein nicht erklären. Doch das, was sie ihm übereinstimmend wiedergeben, ist, was sie gehört haben.
Dieses tiefe Einatmen, begleitet von einem Gemurmel, aus welchem immer wieder das Wort »Karamell« herauszuhören ist. Dann dieses schlürfende Geräusch, mit welchem der Unbekannte den Whisky einsaugt und das begleitende Selbstgespräch, aus dem wiederum das gleiche Wort zu erkennen ist. Jedoch dieses Mal in einer eher fragenden Stimmlage.
»Karamell?«
»Zugriff«, flüstert der eine Beamte seinem Kollegen zu, bevor sie auf den Schatten zustürmen. Der Eindringling versucht nicht sich zu wehren, blickt die beiden Beamten ungläubig an, hebt das Glas, in welches er Whisky aus einem der Fässer gefüllt hat, und streckt dieses den beiden hin: »Kein Karamellgeschmack im Gaumen, nur in der Nase.«
Die beiden Beamten schauen sich fragend an.
Doch noch bevor sie reagieren können, beginnt Klaus zu erklären: »Zehn unserer Whiskys haben einen Karamellgeruch, der über die Nase klar erkennbar ist. Oh, wie ich diesen Geruch liebe! Aber nicht bei allen dieser zehn Ausprägungen ist das Karamellige auch im Gaumen erkennbar. Ich kann mir bis heute nicht erklären warum …«
»Und das wolltest du herausfinden, du wolltest Antworten auf deine Fragen«, folgert Patrik im Verhör, das am folgenden Tag auf dem Kommandoposten im unteren Ziel stattfindet.
»Es tut mir leid, Patrik«, antwortet Klaus kleinlaut, »es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich weiß schon viel über Whisky – wenn auch nicht so viel wie du – und will besser werden, vielleicht auch einmal Braumeister werden wir du.«
»Aber warum hast du dich selber bedient, statt mich zu fragen?« Patrik verwirft die Hände.
»Kennst du denn die Antwort?«, fragt Klaus erstaunt.
Patrik schweigt, schweigt sehr lange.
»Gewisse Geheimnisse sollen im Mythos Whisky bleiben, müssen – oder dürfen – nicht aufgelöst werden.«
Das erste Fass
Berggasthaus Meglisalp, im Frühling 2012
Johan und Emil sind hinten, Johan auf der Bergseite. Es ist eine sehr schmale Stelle, Johan muss sich gegen den Berg drücken, damit Emil noch genug Platz auf dem Weg hat.
Doch dann rutscht dieser plötzlich mit dem rechten Fuß weg.
Johan versucht noch, wieder Tritt zu fassen, drückt dabei das Fass gegen den Berg. Dadurch rutscht es von seiner Schulter und kippt talwärts. Er und die beiden anderen Träger vor ihm haben keine Chance, das Fass zu halten. Die beiden vorne schaffen es noch, von der Tragevorrichtung wegzukommen, doch das Fass reißt Emil mit in die Tiefe.
Alles geht sehr schnell.
Mit gesenkten Köpfen betreten die drei Männer wenig später die Terrasse des Berggasthauses »Meglisalp«. Johan steuert direkt auf seine Schwägerin zu, nimmt sie wortlos in die Arme und drückt sie an seine Brust. »Es tut mir leid …, so leid …«, stammelt er, »Emil ist … wir hatten keine Chance … konnten nichts machen …«
Rita stößt Johan mit einem lauten Aufschrei von sich weg: »Was hast du getan?«
Johan steht mit gesenktem Kopf vor seiner Schwägerin, bringt zuerst kein Wort über die Lippen. Erst nach einer längeren Pause stammelt er: »Es ging … es ging alles so schnell.«
»Nein«, schreit Rita laut heraus, »nein, nein, warum, warum nur?« Sie wirft sich Johan an den Hals, sucht Halt und Trost bei ihrem Schwager. Dieser jedoch scheint unfähig, Rita zu helfen, steht mit herunterhängenden Armen wie eine Salzsäule auf der Terrasse.
Rita löst sich langsam von Johan und schleicht mit hängendem Kopf ins Berggasthaus, lässt die drei Träger und die sichtlich betroffenen Gäste zurück.
Unter diesen beginnen schon bald Diskussionen über den tragischen Unfall und auch darüber, wie es wohl mit dem Berggasthaus weitergehen werde.
Und ohne es wirklich auszusprechen, werden auch gegen Johan Verdachtsmomente geäußert wie: »Jetzt kommt er doch noch zu seinem Berggasthaus.«
Denn es ist ein offenes Geheimnis, dass auch Johan damals gerne das Berggasthaus von seinen Eltern übernommen hätte. Doch weil die beiden Brüder so unterschiedlich waren, führte dies zu einer klaren Entscheidung der Eltern zugunsten von Emil und gegen Johan.
Johan, der Ältere, ist introvertiert, verschlossen, unfreundlich, mürrisch, ein Einzelgänger, oft ohne ersichtlichen Grund schlecht gelaunt, und verbreitet dadurch in seinem Umfeld immer wieder eine Atmosphäre der Freudlosigkeit und Unlust.
Emil hingegen war lebensfroh, gutmütig, fröhlich und bei allen Menschen beliebt. Und diese Beliebtheit führte auch dazu, dass er zum Präsidenten der Flurgenossenschaft der neuen Transportseilbahn Seealp-Meglisalp, welche die alte und erste aus dem Jahre 1952 abgelöst hatte, gewählt wurde. Die Bahn, welche die Alpgenossenschaft 1999 erstellt hatte und die den Transport von Waren auf die Meglisalp und ins gleichnamige Berggasthaus wesentlich vereinfachte. Im 19. Jahrhundert wurden Waren noch von Trägern ab Wasserauen über den Schrennenweg transportiert. So wurde auch das ganze Material für den Bau des Berggasthauses in den Jahren 1897/1898 auf die Meglisalp getragen. Die schwerste Last oder »Strussbodi«, wie diese genannt wurde, welche ein Mann alleine tragen konnte, betrug damals beachtliche 128 Kilogramm.
Emil war froh, dass er sich für die Zufuhr von Waren für sein Berggasthaus nun auf die Transportbahn verlassen konnte. Das Berggasthaus hatte er 1989 von seinen Eltern übernommen und ihnen dieses auch abgekauft. Er – und auch seine Eltern – wussten, dass dies auch Johans Wunsch gewesen wäre. Doch konnte er sie überzeugen, dass es für den Betrieb des Gasthauses nicht von Vorteil wäre, es ihm zu übergeben. Denn welcher Gast will schon bei einem Wirt, der Freudlosigkeit und Unlust ausstrahlt, einkehren!
So bleibt Johan nur die Bewirtschaftung der Alp, die er gerne übernommen hatte, wie er immer wieder betonte. Doch niemand weiß, was die Entscheidung seiner Eltern wirklich für ihn bedeutet hatte und wie er damit umgehen kann. Denn griesgrämig war er schon vor dieser Aufteilung gewesen.
Es erweckte aber schon den Anschein einer Trotzreaktion, als Johan seinem Bruder und seinen Eltern eröffnete, dass er die Alp nicht von unten her, sondern von der 100 Meter höher gelegenen Alp Meglisalp-Oberchellen oder Alp Sitzig Stein aus bewirtschaften wolle. Und wohnen werde er im Haus, in welchem gemäß der Sage der Senn Josua von einem großen Stein begraben wurde, welcher ein unheimlicher Fremder auf ihn rollen ließ.
Der Legende nach war Josua mit diesem Fremden ein Versprechen eingegangen, dass er ihm seine Alp überlassen würde, wenn er es schaffen sollte, seinen allseits beliebten und erfolgreichen Bruder Meggelin von der unteren fruchtbareren Alp zu vertreiben. Doch dieser blieb hartnäckig, obwohl ein Fluch des Fremden den Wasserzufluss zu seiner Alp versiegen ließ. Trotz der Hilfe der Zwerge blieb der See verschwunden, und das Quellwasser von der oberen Alp versickerte nach wie vor, ohne eine Spur zu hinterlassen. Dennoch wurden die Brunnen wie aus einer unsichtbaren Quelle jeden Morgen wieder aufgefüllt, sodass die Alp genug Wasser für Meggelin und sein Vieh erhielt.
Aus Sicht von Josua war damit der Versuch gescheitert, Meggelin zu vertreiben, und er sah keinen Anlass dazu, seine Alp dem Fremden zu übergeben. Doch diese Entscheidung bezahlte er mit seinem Leben.
Johan war sich sehr wohl der Symbolik seiner Entscheidung bewusst und genoss – ohne es nach außen zu zeigen – die Verunsicherung, welche er in seiner Familie auslöste. Dies war für ihn wie eine kleine Rache dafür, nicht für das Berggasthaus berücksichtigt worden zu sein. Obwohl er sich auch der Anerkennung seiner Arbeit als Alpsenn durchaus bewusst ist. Denn die Alpwirtschaft hat im Kanton Appenzell Innerrhoden einen großen Stellenwert – über 45 Quadratkilometer im Kanton und damit mehr als ein Viertel der Kantonsfläche sind Alpen.
Doch Johan war und blieb seinem Bruder immer behilflich, wenn dieser seine Unterstützung brauchte. Sei es bei der Instandhaltung der Wanderwege, für die er als Berggastwirt verantwortlich war, oder für kleinere Reparaturarbeiten, bei welchen er jeweils sein größeres handwerkliches Geschick ausspielen konnte.
Oder wie jetzt, wenn es darum ging, das erste Fass mit dem eigenen Single Malt Whisky auf die Meglisalp zu bringen. Denn Emil war der Erste der Bergwirte im Alpstein, der die Idee hatte, in seinem Gasthaus seinen Haus-Whisky aus dem eigenen Fass anzubieten.
In der Brauerei Locher in Appenzell hatte er schnell einen Partner gefunden, der für dieses Experiment bereit war. So reifte über die letzten Jahre in einem Bier- und später in einem Portweinfass dieser Whisky heran, der nun darauf wartete, auf die Meglisalp gebracht zu werden.
Doch Emil wollte dieses Fass nicht einfach mit dem Helikopter einfliegen oder mit der Transportbahn hinaufbringen lassen. Er wollte die Tradition der »Säntisträger« noch einmal aufleben lassen, welche früher das Material aus dem Tal auf den Gipfel des Säntis getragen hatten – oft auch von Wasserauen auf dem Schrennenweg auf die Meglisalp und weiter über den Rotsteinpass auf den Gipfel.
Im Jahre 1846 wurde auf dem Säntis die erste Unterkunft gebaut, für die vermehrt Lebensmittel und Getränke gebraucht wurden, um die Wünsche der Gäste befriedigen zu können. Zuerst besorgte der Wirt diese Arbeit selber und musste bis nach Wasserauen, um die angelieferte Ware zu holen, während sich seine Frau der Bewirtung der Gäste widmete. Milch, Käse und Butter wurden während der Alpzeit auch von den Sennen in der Meglisalp hinaufgebracht, das wusste Emil noch aus den Erzählungen seines Großvaters.
Mit dem Ausbau der Wanderwege wuchs auch der Bergtourismus und verunmöglichte dem Säntiswirt, all seine Waren selber zu holen. So zog er auch familienfremde Helfer hinzu – eben diese Träger, die mit der Zeit den Namen »Säntisträger« erhielten und diese Arbeit zu ihrem Beruf machten. Und nicht wenige dieser Träger fanden bei ihrer Berufsausübung den Tod.
Der Transport des Whiskyfasses sollte zelebriert werden – Emil versprach sich davon eine gute Medienpräsenz. So beauftragte er seinen Bruder Johan, eine entsprechende Tragevorrichtung zu bauen, mit welcher das über 200 Kilogramm schwere Fass den Berg hinauf getragen werden konnte.
Auf zwei mit mehreren Stricken verbundenen Baumstämmen von guten 15 Zentimetern Durchmesser sollte das Fass zu liegen kommen. Hinten und vorne wurden die Stämme mit Tüchern umwickelt, damit der Druck auf die Schultern der Träger auszuhalten war. Damit das Fass in den steilen Passagen nicht rutschen konnte, wurde es vorne und hinten durch einen Querbalken gesichert und zusätzlich mit weiteren Seilen an dieser Konstruktion festgebunden.
Zwei starke Männer waren schnell gefunden, die bereit waren, Johan und Emil bei diesem spektakulären Transport zu unterstützen. Vom Gasthaus »Alpenrose« in Wasserauen, wo die Vier das Fass mit einem lauten »Ho Hopp« auf die Schultern hievten, galt es, zuerst den steilen Weg durch das Hüttentobel hinauf in die über 300 Meter höher gelegene Klein- und Großhütten zu bewältigen. Von dort führt der teilweise exponierte Schrennenweg hoch über dem Seealpsee, vorbei an der Schirmhütte, hinauf über die Stockegg zum Chrüzböhl und auf die Meglisalp.
Doch dort sollten das Fass und auch Emil nie ankommen.
Emils Leiche wird noch am gleichen Tag weit unterhalb des Schrennenwegs von der Rettungskolonne geborgen, er musste sofort tot gewesen sein. Das Whiskyfass zersplitterte durch die harten Aufschläge, und auch von dem Tragegerüst wurden nur noch einzelne Stücke gefunden. Damit konnte in den polizeilichen Ermittlungen auch nicht mehr rekonstruiert werden, ob eventuell ein Fehler in der Konstruktion den Absturz begünstigt hatte.
So bleibt der Polizei nichts anderes übrig, als den Unfallhergang genau zu rekonstruieren, die Sichtweise der Beteiligten zusammenzutragen, Übereinstimmungen festzuhalten und allfällige Widersprüche zu klären.
Bruno Fässler, seines Zeichens Chef der Appenzell Innerrhoder Kriminalpolizei, und sein engster Mitarbeiter, Max Dörig, versuchen, Johan aus der Reserve zu locken, denn auch ihnen ist das gespannte Verhältnis zwischen den beiden Brüdern bekannt.
Für die beiden Ermittler wäre ein denkbares Motiv für eine mögliche Tat, dass Johan ebenfalls das Berggasthaus hatte übernehmen wollen, was ihm aber von seinen Eltern verwehrt wurde. Aus Erfahrung wissen sie, dass Neid, das Gefühl, das besitzen zu wollen, was andere haben, ein klassisches Mordmotiv ist. Ein Motiv, das bereits im Alten Testament beschrieben wird: der Brudermord von Kain, dem ältesten Sohn von Adam und Eva, an Abel, weil er neidisch ist auf die Zuneigung Gottes zu seinem Bruder.
Doch etwas aus Johan herauszulocken, ist kein einfaches Unterfangen bei diesem verschlossenen und schweigsamen Menschen.
Immer und immer wieder fordern sie ihn auf: »Erzähl uns nochmals genau, was passiert ist.«
Und Johan beschreibt den Unfallhergang jedes Mal fast wortwörtlich gleich, in kurzen und abgehackten Sätzen.
»Seine Erklärungen scheinen mir plausibel«, muss Max anerkennen, »dass er durch Emils Versuch, das Fass hochzustemmen, gegen den Berg gedrückt wurde und ihm der Stamm von der Schulter rutschte.«
»Eine Absicht in seiner Handlung zu erkennen und nachzuweisen, ist ein Ding der Unmöglichkeit«, muss auch Bruno eingestehen, »umso mehr, als die beiden anderen Träger nicht beurteilen können, was hinter ihrem Rücken abgelaufen ist.
Nach den Einvernahmen nimmt Rita ihren Schwager energisch beim Arm und zieht ihn wortlos in die Wirtswohnung des Berggasthauses hinein. »Was hast du ihnen gesagt«, zischt sie ihn an, »ich hoffe, du bist bei deiner Version geblieben, die du vor den Gästen auch mir erzählt hast!«
»Nur keine Angst, Rita, natürlich habe ich nur das wiederholt, was auch alle bei unserer Ankunft Anwesenden gehört haben! Weder die Polizei noch sonst wer wird jemals herausfinden, was wirklich geschehen ist.«
»Und vor allem: warum es geschehen ist«, atmet Rita hörbar auf.
»Was aber bedingt, dass wir unsere Rollen noch eine Weile weiterspielen«, fügt Johan an. »Du die der trauernden Witwe und ich die des Bruders, der die ›Meglisalp‹ nun übernehmen muss.«
»Und ich beschränke mich darauf, dir unter die Arme zu greifen, damit das, was Emil bisher aufgebaut hat, weitergeführt werden kann. Was sonst zwischen uns läuft, darf niemand erfahren!«
Denn das konnten Rita und Johan bisher als Geheimnis bewahren.
Es ist nun bereits über ein Jahr her, seit sie sich zum ersten Mal näher gekommen sind. Oder besser: als Rita sich an ihren Schwager heranmachte.
Schon immer war er ihr, trotz seines verschlossenen und mürrischen Verhaltens, sympathisch gewesen. »Mit Emil wird es mir oft zu viel«, hatte sie Johan eingestanden, »er will immer und überall im Mittelpunkt stehen, zieht die ganze Aufmerksamkeit und alle Sympathien auf sich.«
»Und du wirst damit in seinem Schatten nicht wahrgenommen«, vergewisserte sich Johan, ob er mit seiner Vermutung richtig liege. »Da hast du es neben mir einfacher, ich suche die Aufmerksamkeit anderer nicht.«
»Neben dir könnte ich die Rolle der Gastgeberin besser übernehmen – die Rolle, die ich so gerne ausübe«, bestätigte Rita.
Es war einfach, ihr Verhältnis geheim zu halten, Emil war zu stark mit sich, seinen Aufgaben und seinen Gästen beschäftigt. »Ich bin froh, dass du dich um meinen Bruder kümmerst«, hatte er ihr einmal gesagt, »und ihn ab und zu auf seiner Alp aufsuchst.« Einen Verdacht hegte er nicht, was dort wirklich ablief. Dafür war sein Selbstbewusstsein zu stark, als dass er sich dies hätte vorstellen können.
Johan genoss die Zuneigung seiner Schwägerin, war froh, dass sich eine Frau für ihn interessierte. Nie hätte er von sich aus die Initiative ergreifen können, auf das andere Geschlecht zuzugehen. Dafür war er zu scheu, zu unsicher.
Und je mehr er genoss, von Rita begehrt zu werden, umso weniger merkte er, dass dies mit einer klaren Zielsetzung geschah und er immer stärker in ein Abhängigkeitsverhältnis zu ihr rutschte.
Als dann der Transport des Whiskyfasses aktuell wurde, zeigte Rita erstmals ihr wahres Gesicht: »Das ist unsere Chance!«
»Was meinst du mit Chance«, fragte Johan irritiert zurück.
»Die Chance, ein neues und unser eigenes Leben aufzubauen.«
Und nach einer kurzen Pause fügte sie an: »Ohne Emil.«
»Du willst ihn … Er soll …?« Johan konnte nicht glauben, was er aus Ritas Antwort herauszuhören scheint.
Rita erklärte ihm ihren Plan und drängte ihn dazu, diesen umzusetzen. Denn sie war sich ihrer Macht über Johan bewusst, wusste, dass er nicht mehr von ihr lassen konnte und damit auch bereit war, das Leben seines ihm schon längst entfremdeten Bruders zu opfern.
Und so kam es, dass nicht nur das erste Whiskyfass erst im zweiten Anlauf auf der Meglisalp ankam, sondern das gleichnamige Berggasthaus auch einen neuen Besitzer und eine neue Gastgeberin erhielt.
Das Beweisstück
Berggasthaus Bollenwees, im Sommer 2016
Und nun noch das: Gestern lagen die Schweine, denen er am Abend Schotte, die gelblich-grüne Flüssigkeit, die aus der Käseproduktion übrig bleibt, verfüttert hatte, Stunden später apathisch am Boden. Einige von ihnen schienen Atemnot zu haben, andere hatten Anfälle, die sie in einen regungslosen Zustand brachten, als würden sie jeden Moment sterben.
Meinrad vermutete aufgrund der Symptome eine Salzvergiftung, konnte sich aber nicht erklären, woher das Salz hätte stammen können. Was er aber wusste, war, wie er die Tiere behandeln konnte: Dank regelmässiger Wasserzufuhr und Nahrungsentzug gelang es ihm, alle Tiere zu retten.
Trotz aller Hektik während dieser Rettungsaktion blieb jedoch Meinrad nicht verborgen, dass hier jemand seine Finger im Spiel gehabt haben musste. Neben dem Trog, in welchem er die Schotte verfüttert hatte, lag ein kleines Fläschchen. Und Meinrad wusste sofort, woher dieses stammt: Das eingravierte Logo mit dem Bären des Appenzeller Biers, eingerahmt von Edelweiß, ermöglichte ihm eine erste Zuordnung, die Gravur darunter – »Bollenwees« – die zweite und genaue.
Das Fläschchen war eines aus der Whiskytrek-Serie, abgefüllt im Berggasthaus »Bollenwees«, voll und verschlossen – der Besitzer oder die Besitzerin musste dieses erst kürzlich in der »Bolle« erwandert haben.
Was war hier geschehen? Meinrad war zutiefst verunsichert. Umso mehr, als dies bereits der dritte Vorfall innert kürzester Zeit war.
Doch auch das, was geschehen ist, kann nichts daran ändern, dass Meinrad es liebt, Senn zu sein.
Vor allem hier, am Ufer des Fälensees auf der Fälenalp. Dass ab und zu der See über seine Ufer tritt und die Alp und seine Hütten überschwemmt, gehört für Meinrad zum natürlichen Jahreszyklus.