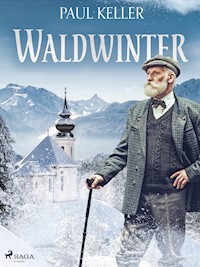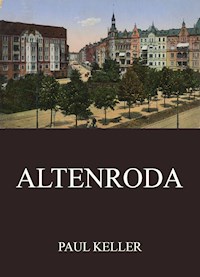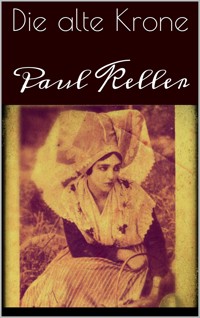Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Paul Keller, in Schlesien aufgewachsen, war Dorfjunge durch und durch. Seine zwölf Anekdoten und Geschichten erzählen von einem bäuerlich geprägten Landstrich, dessen Bewohner trotz bitterer Armut ihr barockes Lebensgefühl und die Verbundenheit zur Heimat nie verlieren. Kellers Großvater ist ein Mensch voller Humor und Bescheidenheit. Fünf Enkelkinder muss er in seinem Haus großziehen, weil die Kinder versterben. Trotzdem geht ihm der Sinn fürs Komische nicht aus. Glaubhaft versichert er, dass nur der Schnupftabak seine Scharfsichtigkeit erhält (und bleibt tatsächlich bis zum 72. Lebensjahr ohne Brille). Als ihm und dem großen Haushalt einmal nur noch fünf Pfennige geblieben sind, beschließt er, sein armseliges Barvermögen mit einem Korn zu verkneipen. Doch im Wirtshaus findet eine wundersame Geldvermehrung statt und er kehrt mit fast zehn Mark nach Hause. Die Erzählungen Kellers aus seiner Kindheit sind voller Herzenswärme, Geheimnisse und wunderbarer Begegnungen, wie zum Beispiel in "Das Niklasschiff", wo der jugendliche Erzähler die Seele des Müller-Karl im kleinen Segelboot im Bach findet und so den Todkranken wieder zum Leben erwecken kann. Oder wie die erste Berufung zum Dichter eine Tracht Prügel verhindert. Oder die geradezu hinreißende Geschichte über eine Schlittenfahrt mit dem lieben Gott!Das alte Schlesien wie es leibt und lebt – ein Heimatbuch der besonderen Art
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Keller
Dorfjunge
Saga
Dorfjunge
German
© 1920 Paul Keller
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711517444
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Einleitung
Am Abend und am Morgen ist der Himmel rot. Am Abend und am Morgen ist die Luft kühler als am Tag, singen die Vögel heller, ist der Wald frischer, ist die Welt freundlicher. So auch in den Morgenstunden und in der Abendzeit des einen flüchtigen Tages, der das Menschenleben heisst. Abend und Morgen sind einander näher verwandt als dem Tage. Ihr Gemeinsames ist, dass der Mensch an seinem Morgen in ein Leben hineinwächst, das ihm noch fremd ist, und am Abend langsam einem anderen Leben sich naht, das er nicht kennt. Kinder bleiben wir immer, weil wir immer neu werden müssen.
In den Jahren meiner Wanderung bin ich oft nach meinem alten Kinderlande zurückgekehrt, manchmal nur von den Hügeln der Erinnerung aus in sehnsüchtiger Schau, öfter aber auch, indem ich nach Hause fuhr, die alte Strasse entlang wanderte und in alle Seitengässchen ging, bei Vater und Mutter einkehrte und bei alten Freunden. Sonntags hörte ich in der Kirche die alten Lieder, und wenn ich über den Friedhof wanderte, stand auf jeder Grabtafel ein Name, den ich kannte. Niemals versäumte ich, über die Felder zu gehen, ich wusste ja von der kleinsten Parzelle, wem sie gehörte und wie es um ihre Ertragsfähigkeit stand. Der Dorfjunge ist in mir so lebendig geblieben, dass ich noch jetzt immer um das Wetter bange, ob es auch im Frühjahr nicht zuviel Trockenheit, im Sommer nicht zu viel Regen, im Winter genügend Schnee bringe. Ich bin meiner Kinderheimat treu verbunden geblieben, habe nichts von ihrer Art, Sprache, Gewohnheit, ihren Mühen und Freuden aus den Augen verloren. Ich war Dorfjunge so durch und durch, dass ich wohl Dorfjungengeschichten schreiben konnte. Sie sind im Laufe vieler Jahre entstanden, in meinen Büchern verstreut und erscheinen hier zum ersten Male gesammelt. Ein paar Stücke, die noch nicht in meinen Büchern stehen, sind dazu gekommen.
Möge es dem „Dorfjungen“ gut gehen! Ich denke, man wird zugeben, dass er ein gesunder Bursche ist, manchmal ein bisschen frech und voll spitzbübischer Schelmerei; aber das gehört dazu. Die Jungen sollen erkennen, wie sie sind, die Alten, wie sie waren. Ein leichter Morgenwind fährt durch alle Jugend; wem er aber in der Schwüle der Not oder durch lieblose Art der Erzieher erstarb, der ist bitter zu beklagen.
Ich war einmal ein armer, aber herzfröhlicher Dorfjunge, dafür danke ich Gott und allen denen, die mir meine Kindheit so liebevoll und verständig betreuten.
Breslau, im Juli 1925.
Paul Keller.
Von meinem Grossvater
Arbeit und Leid.
Zehn „Morgen“ Ackerland sind 2½ Hektar. So gross war das Besitztum meines Grossvaters. An Viehstand besass er zwei Kühe, ein Schwein, das jährlich zweimal „erneuert“ werden musste, einen Hund und eine Katze, also fünf Tiere. Kinder waren acht. Mit fünfen von ihnen musste der Grossvater, als schon alle verheiratet gewesen waren, zu Grabe gehen. Die verwaisten Enkel musste er in sein Haus aufnehmen, sie nähren und kleiden. Dann kam noch ein schwerer Prozess, der sich wohl an die zwei Jahre hinzog und viel Geld kostete. Leicht hat es Johann Keller nicht gehabt. Aber er war der fröhlichste Mann des ganzen Dorfes, wohl, weil er trotz seines Bauernkittels ein Philosoph war, den kein Ungemach zerbrach.
Bei allem Fleiss, bei aller Fröhlichkeit des Grossvaters aber wäre es doch wohl auf seiner schmalen Hube mit den vielen Essern recht traurig hergegangen; wir hätten hungern müssen. Aber niemand von uns hat gehungert oder auch nur gedarbt.
Die Saugpumpe! Die „saugte“ Geld heran. Überall im weiten Umkreise, wo die Wasserversorgung nicht funktionierte, wurde nach Johann Keller gerufen. Manchmal wurde er mit einem Gefährt abgeholt. Das war in ganz dringlichen Fällen, wenn die Wassernot schon bis an den Hals reichte. Ich prägte damals das geistreiche Wort: „Bei Wassersnot“ ersauft man, bei „Wassernot“ verdurstet man. Das alles macht so ein kleines „Ringel-s“. Und in der Schule prahlte ich: „Meinen Grossvater holten sie heut wieder mal „per Achse“. Abgeholt haben sie ihn oft „per Achse“, aber nach Hause haben sie ihn immer zu Fuss gehen lassen. Mich wunderte das; aber später habe ich im Leben das gelernt: wenn dich jemand dringend braucht, so wird er ausserordentlich höflich sein; aber wenn sein Wunsch erfüllt ist, dann wird sich die Hochachtung vermindern.
Meine Grossmutter, Christiane Keller, war von Gemütsart das gerade Gegenteil ihres Mannes. Herb von Natur, durch tägliche schwere Arbeit und durch vieles Herzeleid unfroh gemacht, war sie nervös und fast schwermütig geworden. Ich erinnere mich nur, sie einmal lachen gesehen zu haben und erinnere mich nicht, dass sie dem Grossvater ein liebes Wort gegeben hätte. Aber sie liebte ihn trotzdem. Wenn er auf „Brunnenarbeit“ war, litt sie immer schreckliche Angst. „Da kriecht er nun auf solchen wackligen Leitern in diese ‚Löcher!‘ Wie leicht kann er verunglücken!“
Sie atmete auf, wenn er abends todmüde nach Hause kam. Dann bereitete sie so freundlich, wie sie es vermochte, das Mahl, und Grossvater sagte befriedigt;: „23 Böhm habe ich heute verdient;“ Dreiundzwanzig „Böhm“ in hochdeutsche Valuta übersetzt, sind 2 Mark 30 Pfennige.
Das Rotkehlchen.
In jeder richtigen Bauernstube gibt es Schaben. Die wohnen an dem grossen Ofen. Mit Insektenpulver liessen wir uns nicht ein. Da hätte der Hund oder die Katze dran lecken können, oder die kleine Bertha konnte denken, das sei Kuchenstreusel. Wir fingen im Herbst mittels eines Vogelkastens ein Rotkehlchen. Der Grossvater sagte: „Das ist vernünftig; denn erstens macht es Spass, zweitens braucht es im Winter nicht zu frieren und zu hungern, und drittens frisst es die Schwaben.“ Hierzu muss bemerkt werden, dass in Schlesien die Schaben „Schwaben“ heissen. Wahrscheinlich heissen in Schwaben die Schaben „Schlesinger“. Es wäre nicht mehr als recht und billig.
Wenn wir nun das Rotkehlchen im Kasten hatten, trugen wir es sorgsam nach Hause. Unterwegs redeten wir dem verängstigten Tierchen gut zu. „Fürcht’ dich nicht! Sollst es gut haben, fast so gut wie unser Hund!“ — „Und“, sagte ich, „die Katze mache ich morgen tot.“ Da zwinkerte der Grossvater das Rotkehlchen an und sagte: „Schwindel! Lass dir nichts vorreden!“
Dann liessen wir das Rotkehlchen in der grossen Bauernstube, die sechs Fenster hatte, fliegen. Es wurde bald so zahm, dass es auf den Tisch kam und sich sein Teil wegholte. Alle passten auf die Katze auf. Der Hund war ein so dummguter Kerl, dass ihm das Rotkehlchen auf den Kopf flog und ihn ins Ohr piekte. Höchstens dass er mal leise brummte: „Lass das! Es zwickt mich!“ Aber das Rotkehlchen liess es nicht. Da liess sich der Hund zwicken. Das Rotkehlchen flog wie ein kleines, rotbrüstiges Wunder den ganzen langen Winter durch unsere Stube. Manchmal sahen wir drei, das Rotkehlchen und ich und der Hund traurig durch die Eisblumen zum Fenster hinaus und wünschten, dass es Sommer würde. Aber gleich darauf waren wir alle wieder lustig.
Das ging so bis zum St. Georgstag, dem 23. April. An diesem Tage ist für die schlesischen Bauern der Winter aus. Ich erhielt dann stets vom Grossvater die Erlaubnis, nach Belieben barfuss zu gehen, und an diesem Tage wurde das Rotkehlchen entlassen. Ich trennte mich mit grossem Schmerz von dem lieben Tierchen. Dem Hunde war’s egal. Traurig sagte ich zum Grossvater: „Die Schwaben sind zwar weg, aber sie haben doch in die Risse hinter dem Ofen Eier gelegt. Da werden wieder Kleine! Vielleicht eine Million!“
„Zwei Millionen,“ sagte der Grossvater; „aber wenn ich dich jetzt den ganzen Sommer über einsperrte und du solltest von zwei Millionen eben ausgekrochener Schwaben leben, da würdest du abmagern.“
„Es war diesmal ein so tüchtiges Rotkehlchen,“ sagte ich noch. Aber auch das nutzte nichts.
Da liessen wir’s dann fliegen, und ich rannte hinterher und fand es nicht mehr und setzte mich ins junge Frühlingsgras und weinte ein wenig um den entschwundenen Freund. Der aber war im Freien, im Grünen.
Zwei Zusammenstösse.
Zweimal aber hat mich mein Grossvater auch geschlagen. Es war in jedem Falle zwar nur um eine Ohrfeige zu tun, aber jede dieser Ohrfeigen war von geradezu elementarer Gewalt. In beiden Fällen handelte es sich um verbotenes Lachen.
Wenn man einem Menschen verbietet, zu lachen, so lacht er. Sag bloss einem mit richtigem Ernst: „Dass du jetzt ja nicht lachst,“ dann wird er lachen, auch ohne, dass etwas zu belachen da ist. Ich war einmal bei einem Begräbnis, das an sich traurig genug war. Der Prediger wurde von einer aufdringlichen Wespe bedrängt, die es auf seine Nase abgesehen hatte. Der Geistliche schlug mit der Hand, fuchelte mit seinem Taschentuche und machte dadurch das Tier immer erboster. So ging Angriff und Abwehr eine Weile, bis plötzlich einer der Begräbnisteilnehmer ausplatzte. Und nun lachte die ganze Gesellschaft, die um das Grab stand.
Ist es etwas Lächerliches, wenn sich ein Mensch gegen ein zudringliches Insekt wehrt? Es wurde nur gelacht, weil das Lachen durch die Sachlage verboten war. Diese allgemeinen Bemerkungen sollen dazu dienen, meine Vergehen gegen meinen Grossvater in einem milderen Lichte erscheinen zu lassen.
Der erste Fall ereignete sich folgendermassen: Der Grossvater hatte auf unserer Aue einen Baum ausgerodet. Aber da steckte in der Erde noch eine Wurzel, diese wollte er heraushaben. Ich sah zu. Er zog also aus Leibeskräften an der Wurzel, so dass sein Gesicht blaurot wurde und die Adern an Schläfen und Hals dick anschwollen. Ich dachte gerade mit einem unangenehm angenehmen Gruseln: Jetzt wird ihn wahrscheinlich der Schlag rühren, da geschah etwas ganz anderes. Die Wurzel riss in der Erde ab, und der Grossvater schlug nach hinten einen geradezu erstaunlichen Kobolz. Ich schrie vor Vergnügen und klatschte Beifall. Da sprang der Grossvater blitzschnell auf; ich geriet plötzlich aus der vertikalen Stellung in die horizontale, schlichter ausgedrückt, ich flog auf den Rücken, und da lag ich denn in einem gewissen Dämmerzustande neben der entwurzelten Wurzel. — — —
Im zweiten Falle war meine Cousine Bertha schuld. Bertha besass trotz ihrer elf Jahre noch keinen richtigen Lebensernst, auch hatte sie keine kritischen Fähigkeiten, wie sie literarischen Kindern von heute eigen sind. Bertha war ein kindisches Ding, das sich einfach seines Lebens freute, und sie lachte viel, am öftesten aber über mich.
Einmal beim Mittagessen fragte ich sie leise, ob sie wohl wisse, warum die Haare, die der Hase an seiner Schnauze habe, „Spürhaare“ hiessen. Die Worte „Hase“ und „Schnauze“ hatten sie schon mächtig zum Lachen gereizt, bei „Spürhaare“ platzte sie aus. Da schlug der Grossvater der an meiner anderen Seite sass, mit zwei harten Bauernfingern auf die Tischkante und wiederholte das schon oft gegebene Verbot: „Beim Essen wird nicht gelacht!“ Das Essen hielt der Grossvater für eine ernste und wichtige Sache, weil da die Quelle der Arbeitskraft ist. Ich merkte, wie es in meiner Cousine wegen der Spürhaare rumorte, und da verführte mich ein böser Kobold, ihr die Lösung zuzutuscheln: „Wenn man ihn daran zieht, da spürt er’s!“ Ich weiss bloss noch, dass Bertha die Suppe über den Tisch prustete, und dann lag ich in einem entfernten Stubenwinkel. Unser Hund kam, betrachtete nachdenklichen Angesichts diesen Fall, beschnupperte meine Herzgrube und mein Gesicht, stellte fest, dass ich noch am Leben sei und meldete schwanzwedelnd diesen Befund bei Tische. Für diese ärztliche Bemühung erhielt er als Honorar einen Knochen.
Das waren die beiden Fälle, wo es in des Wortes wahrster Bedeutung zwischen dem Grossvater und mir zu Zusammenstössen kam. Sie waren für mich unerwartet, heftig und schmerzhaft, haben aber unser gutes Einvernehmen nur ganz vorübergehend gestört. Nach dem ersten Falle war ich auf den Grossvater drei Tage lang „böse“, beim zweiten nur zwei.
Das Augenmittel.
Als Johann Keller etwas über 50 Jahre alt war, glaubte er, jetzt müsse er wohl eine Brille haben. Zu uns kamen öfters Handelsfrauen, die führten drei Artikel: Erstens Jerusalemer Balsam. Ich glaube der Jerusalemer Balsam wurde damals in Neisse gemacht. Er half für „böse“ Finger und so. Den Balsam kauften wir auf Vorrat. Zweitens Patent-Seife. Davon gingen die Sommersprossen und alle Hautpusteln weg. Die Seife kauften wir nicht, dieweil wir nichts derartiges Aussätziges hatten. Drittens Brillen. Es hiess, sie seien aus Rathenow, der grössten Brillenstadt der Welt. Das Gestell war aus Draht, die Linsen waren aus Glas. Jedweder konnte alles ausprobieren und aussuchen, was für ihn „passte“. Meine Grossmutter, die äusserst sparsam war, kaufte sich eine solche Brille. Johann aber sagte zur Handelsfrau: „Glauben Sie, ich wolle mir meine hübschen Augen verderben?“ Die Händlerin lachte leise über die „hübschen Augen“, die Grossmutter lachte laut. Das war das einzige Mal, da ich sie lachen hörte. Aber Johann fuhr fort: „Ich geh zum Doktor nach Schweidnitz und lasse meine Augen nachsehen.“ Die Grossmutter hielt das für sündhaften Hochmut.
Der Doktor in Schweidnitz war ein ziemlich grober Mann. Er sah sich den Bauern an und sagte: „Brille? Quatsch! Kaufen Sie sich lieber eine Schnupftabakdose. Da brauchen Sie keine Brille!“ So wurde anno l868 ordiniert.
Der Grossvater kaufte sich eine Dose und schnupfte zum grossen Ärger seiner Christiane ganz mächtig. Und er blieb tatsächlich scharfsichtig bis zu seinem 72. Lebensjahre. Dann erst musste eine Brille heran. Der Grossvater pries den Schweidnitzer Doktor als den grössten Augenarzt aller Zeiten bis an sein Ende.
Der Nasenheiber.
Mein Grossvater hatte eine ziemlich grosse Nase. Aber da war im Dorfe ein Mann, der hatte ein Riechorgan, mit dem unter den lebenden Wesen nur die Nilpferde und die Elefanten hätten konkurrieren können. Das war der „Nasenheiber“. Er hiess so zur Unterscheidung von den vielen anderen „Heiber“, des „Fluch-Heiber“, des „Sauf-Heiber“, des „Hunde-Heiber“, des „Eingefallenen Schweinstall-Heiber“ und der anderen Heiber. Der Nasenheiber hatte eine Nase, die, so man sie in weiterem Umkreise erschaut hätte, ein Anstoss für das ganze gebildete Europa gewesen wäre.
Ausgerechnet dieses zinnengekrönte Monstrum musste es sich einfallen lassen, meinen Grossvater im Wirtshaus wegen seiner grossen, aber immerhin doch noch normalen Nase anzuulken.
Johann Keller lächelte milde.
„Heiber,“ sagte er, „es ist wahr, ich habe eine grosse Nase. Was meine Frau ist, die Christiane, mit der ich nun schon acht Kinder habe und also leidlich bekannt bin, die guckt mich manchmal verstohlen an und dann sagt sie sich wahrscheinlich im Innern: „Ich hätt’ mir damals auch einen hübscheren Kerl aussuchen können.“ — Aber Heiber, wenn ich mal sterbe, passe ich doch in den Sarg. Aber du! Wenn du vor mir stirbst, da lasse ich dir auf den Sargdeckel ein Häusel bauen, dass du deine Gurke reinstecken kannst. Das Häusel lasse ich zu Ehren des Inhalts rot anstreichen und an die Spitze mache ich ’ne wasserhelle Laterne, die wie ein Tropfen aussieht. Heiber, ich sag dir, wenn du am jüngsten Tage aus diesem Sarge rauskriechst, da lachen die Guten wie die Bösen.“
Die Gerste und der Wind.
Diese kleine Geschichte habe ich selber erst jetzt erfahren. Ein alter Bauer, der den Grossvater noch gut gekannt hat, hat sie mir in diesem Frühjahr erzählt. Er sagte: „Damals hat jeder im ganzen Umkreise, der den Johann Keller und seine Christiane kannte, über die Geschichte gelacht.“ Ich war damals schon aus der Heimat fort. Also es war Erntezeit. Die Felder waren fast leer. Nur Johann Keller hatte seine Gerste noch draussen. Der war immer etwas „hinter der Angst“. Die Grossmutter hatte schon tagelang geschimpft, er solle doch endlich mal die Gerste einfahren, aber er hatte immer gesagt: „Es ist noch lange Zeit.“ Da macht er sich endlich auf und ladet ein Riesenfuder auf. Gerade will er dem Dorfe zu, da kommt ein heftiger Wirbelsturm und wirft das Fuder um. Gleichzeitig setzt ein schrecklicher Wolkenbruch mit heftigem Hagelwetter ein. Johann Kellers Gerste wird in den Sumpf gedroschen.
Abends hockt die Grossmutter auf der Ofenbank und weint. Johann sitzt am Tische und lässt die Christiane etwa zwei Stunden lang weinen. Dann steht er auf und sagt: „Christiane, ich garantier’ dir: wenn ich den Wind in einem Sacke gehabt hätte, da hätt’ ich ihn nicht eher rausgelassen, bis der Johann Keller seine Gerste in der Scheune hatte!“
Die wunderbare Geldvermehrung.
Eines Tages stand die Not wieder einmal vor der Türe Johann Kellers. Die Ernte war noch weit, die Kühe standen vor dem Kalben, gaben also keine Milch, das letzte Schwein war beinahe aufgezehrt, das andere noch nicht fett. Die Grossmutter sass in schwerer Sorge auf der Ofenbank, die Hände in die Schürze gewickelt, der Grossvater spielte auf dem Tische mit einem Fünfpfennigstücke.
„Das is nu mein ganzes Geld!“ sagte er, ernster als sonst. Die Grossmutter weinte. Da stand Johann lebensmutig auf und sagte: „Ach was, mit einem solchen Kapital lässt sich doch nichts Gescheutes anfangen; ich gehe jetzt ins Wirtshaus und verkneip’ mein ganzes Barvermögen.“ „Dass du dich nicht unterstehst,“ jammerte die Grossmutter; „das wäre eine schöne Verschwendung!“
„Verschwendung oder nicht,“ sagte Johann; „ich kauf mir jetzt für all mein Geld einen kleinen Korn.“
Er steckte den Fünfpfennig in die Westentasche und ging. Die Grossmutter flennte hinter ihm her.
„’s letzte Geld trägt er fort!“
Zwei Stunden später kam Johann in ungeheuer vergnügter Stimmung nach Hause.
„Siehst du, Christiane, was das für einen Segen stiften kann, wenn man mal ins Wirtshaus geht! Ich sitze bei meinem kleinen Korn, da kommt der Sattler-Bauer aus Zirlau. Der sagt: „Schön, dass ich Sie mal treffe, Meister Keller; ich bin Ihnen doch immer noch 10 Mark schuldig.“ — Ich sagte, ich könne mich darauf nicht besinnen. „Ja, ja,“ sagte Sattler, „es stimmt. Ich schreib ja alles auf. Von der Rechnung für den neuen Brunnen damals blieben noch 10 Mark Rest.“
„Und da sind sie,“ sagte der Grossvater und schüttelte lachend seinen silbernen Reichtum auf den Tisch. Die Grossmutter machte ein aufheiterndes Gesicht, zählte das Geld, zählte es noch einmal und sagte dann: „Es sind bloss neun Mark fünfzig.“
„Nu, Christiane,“ lachte Johann, „denkst du etwa, wenn ich so ein Heidengeschäft mache, da werde ich bei einem kleinen Korne sitzen bleiben?“
Zwei Tage später kam neue Brunnenarbeit; eine Kuh kriegte ihr Kalb; das wurde verkauft; es gab wieder Milch; die Not war von der Tür verscheucht.
Ausklang.
Mein Grossvater ist über achtzig Jahre alt geworden; er war im Leben nie einen Tag krank. Aber eines Morgens merkte er plötzlich, dass der Tod nahe. Die Grossmutter war schon lange vorher gestorben. Der Grossvater liess den Pfarrer holen, bereitete sich auf das Sterben vor und sagte: „Der Paul soll noch einmal kommen, aber Ihr müsst ihm telegraphieren, denn es wird rasch gehen.“ Ich traf den geliebten Alten noch am Leben; zwei Tage später war es zu Ende.
Die Graue Schwester, die ihn pflegte, fragte: „Meister Keller, haben Sie noch einen Wunsch?“ Er schmunzelte und erwiderte: „Ach ja, ich möchte noch gern eine Zigarre rauchen.“ Die Schwester, die doch sah, wie es stand, wunderte sich über das seltsame Begehren, aber da der Arzt befohlen hatte, dem Sterbenden jeden Wunsch zu erfüllen, ging sie tatsächlich nach der Nebenstube und sah sich nach einer Zigarre um. Sie fand auch bald eine. Als sie zurückkam, war Johann Keller tot. Er war ohne den mindesten Todeskampf gestorben. —
Als ich dem Grossvater einen Denkstein errichtete, grübelte ich lange, was für einen Spruch ich darauf schreiben sollte. Da dachte ich wieder daran, wieviel Kinder und Kindeskinder in dem Hause dieses armen und doch so fröhlichen Mannes hatten hausen und grosswachsen müssen und so liess ich auf den Stein das milde und tröstliche Heilandswort schreiben: „In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen.“ Es ist das Wort, mit dem ich zehn Jahre später meinen Roman „Der Sohn der Hagar“ beschloss, dort allerdings in anderem Sinne.