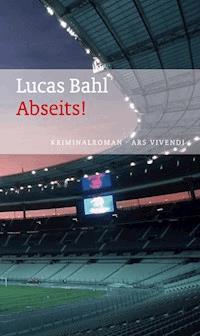Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Roter Drache
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Das Universum, eine hundertstel Sekunde nebenan. Die totale Überwachung ist erst der Anfang! Jetzt erobern die Meister der bösen Träume deine Gedanken, deine Wünsche, deine Träume, dein Ich … Nein, sympathisch sind sie nicht, die beiden „Helden“ dieser Geschichte. Weder der abgetakelte, menschenverachtende, alte Gangster mit dem albernen Tarnnamen Dr Crıme, noch das Objekt seiner Überwachung, der großmäulige, sexistische Doktorand Leon Walter. Beide haben die fatale Angewohnheit, sich immer wieder selbst zu überschätzen. Leon ist im Institut für Traumforschung als Proband Teil eines verstörenden Programms namens „Helter Skelter“. Dass die Forschungen insgeheim von einem internationalen Finanztycoon finanziert werden, erregt das Misstrauen von Leons Doktorvater. Als sich Dr Crıme und Leon persönlich begegnen, sind sie sich nur in einem einig: in der Verachtung, die sie für den anderen empfinden. Doch für Animositäten ist keine Zeit. Unerklärliche Amok-Exzesse mit vielen Toten und Verletzten öffnen Leon die Augen: Hinter „Helter Skelter“ steckt mehr als nur das harmlose Forschungsprojekt einer Provinz-Uni. Handelt es sich wirklich um die gefährlichste Waffe, die jemals in der Geschichte der Menschheit entwickelt wurde? Als Leon und Dr Crıme endlich erkennen, dass das Schicksal, sie zu Spielfiguren einer globalen Verschwörung gemacht hat, ist es schon fast zu spät …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
… und wenn er in das Delirium geriet, das dem Schlafe vorherzugehen pflegt, so hatte er wieder das kleine holde Wesen in seinen Armen und fühlte heiße glühende Küsse auf seinen Lippen.
E. T. A. Hoffmann, Meister Floh, 1822
„Cnypher! Cnyper!“
Rooter, Hax’n’Sex Trax, 1999
Lucas Bahl
Dr Crıme und die Meister
der bösen Träume
Edition Roter Drache
DER AUTOR
Lucas Bahl (d.i. Achim Schnurrer), geb. 1951 in Bergisch-Gladbach; seit 1979 Schriftsteller, Journalist u. Ausstellungsmacher.
1984–1998 Initiator und Mitorganisator des Internationalen Comic-Salons Erlangen. 1985–2000 Chefredakteur, später auch Herausgeber und Verleger von U-COMIX und SCHWERMETALL, Alpha Comic Verlag / Edition Kunst der Comics. Autor von zahlreichen Krimis, Science Fiction, Historische Romane und Phantastik; unter andren "Abseits!" (Thriller), "Spielzeugstadt" (Krimi), "Das Amulett der Keltenfürstin" (Historischer Roman).
Mehr Infos zum Autor auf www.luc-bahl.de
1. Auflage September 2017
Copyright © 2017 by Edition Roter Drache.
Edtion Roter Drache, Holger Kliemannel, Haufeld 1, 07407 Remda-Teichel
[email protected]; www.roterdrache.org
Umschlaggestaltung: Milan Retzlaff, www.man-at-media.de
Buchgestaltung: Sarah Bräunlich
Lektorat: Isa Theobald
Gesamtherstellung: MCP, Polen
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2018
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form (auch auszugsweise) ohne die schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden.
ISBN 978-3-964260-16-1
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Prolog
Folge 1: Was bisher geschah
Folge 2: Was bisher geschah
Folge 3: Was bisher geschah
Folge 4: Was bisher geschah
Folge 5: Was bisher geschah
Folge 6: Was bisher geschah
Folge 7: Was bisher geschah
Folge 8: Was bisher geschah
Folge 9: Was bisher geschah
Folge 10: Was bisher geschah
Folge 11: Was bisher geschah
Folge 12: Was bisher geschah
Folge 13: Was bisher geschah
Folge 14: Was bisher geschah
Folge 15: Was bisher geschah
Folge 16: Was bisher geschah
Folge 17: Was bisher geschah
Folge 18: Was bisher geschah
Folge 19: Was bisher geschah
Folge 20: Was bisher geschah
Folge 21: Was bisher geschah
Folge 22: Was bisher geschah
Folge 23: Was bisher geschah
PROLOG
Die unbekannten Beobachterinnen (DUB):
In diesem Text ist alles geklaut.
Worte, Ideen, sogar die Satzzeichen.
Wer glaubt, Ansprüche geltend machen zu können, erhält die Möglichkeit, sein Eigentum gegen Zahlung eines angemessenen Lösegelds zurückzubekommen.
„Die rotglühenden Strahlen der aufgehenden Sonne berühren die Datenhalde.“
„Das ist kompletter Mist, meine Liebe.“
„Ich wollte doch nur etwas zu eurer ästhetischen Schulung beitragen.“
„Wenn du mich fragst, dann bevorzuge ich für meine Geschmacksbildung lieber noch ein Stück dieser vorzüglichen Eierlikör-Torte. Herr Ober! Kommen Sie mal her.“
FOLGE 1
WAS BISHER GESCHAH
Licht fällt auf die Datenhalde.
Ich bin Dr Crıme.
Grinsen Sie ruhig wegen des albernen Namens. Ihnen wird das Lachen schon noch im Hals stecken bleiben.
Damit ist normalerweise meine Begrüßungsformel beendet. Heute jedoch bin ich gezwungen, hinzuzufügen, dass selbst einem abgrundtief abgebrühten Charakter wie dem meinen angesichts der Geschichte, die ich Ihnen zu erzählen habe, das Lachen in der Kehle zu einem Katarakt klirrender Eiszapfen gefroren ist.
Falls Sie sich das absurde Bild meines Halsinneren tatsächlich vorstellen wollen, dann kommt dem ein Kameraschwenk durch eine arktische Gletscherhöhle ziemlich nahe. Auf das, was an verrottenden Fleischfetzen und erstarrten Blutlachen zwischen den Stalagmiten und Stalaktiten zu sehen ist, gehe ich nicht näher ein. Das zweite Buch von Rabelais verrät mehr.
Damit gestehe ich zweierlei: Erstens, ich liebe solche vertrackten literarischen Irrwege. Zweitens, dummerweise teile ich diese Leidenschaft – auch wenn es da nur eine kleine Schnittmenge gibt – mit dem verachtenswerten Leon Walter.
Was also Rabelais anbelangt, verweise ich auf das 32. Kapitel, das in Pantagruels Mund spielt.
Und da wir gerade beim Spielen sind, sei der Hinweis erlaubt, dass ich selbst in den zu schildernden Ereignissen nur eine beschämend-bescheidene Nebenrolle gebe. Der so genannte Held, dem die Hauptrolle gänzlich unverdient in den Schoß fiel, ist besagter Leon Walter. Mir gelang es, seine vollständigen Aufzeichnungen auf eine Weise an mich zu bringen, die ich vorerst nicht näher erläutern will. Und ob ich mich im weiteren Verlauf meiner Schilderung dazu entschließen werde, auf diesen Punkt ausführlicher zu sprechen zu kommen, behalte ich mir vor. In dieser Erzählung werden die Details zu meiner Arbeit nicht das einzige unmöglich zu entschlüsselnde Geheimnis bleiben. Falls Sie Lektüren gewohnt sind, die eine vollständige Aufklärung aller in ihr behandelten Fragen und Sachverhalte bietet, muss ich Sie enttäuschen. Seien Sie stark! Das Leben funktioniert ohnehin meistens ganz anders. Eine beantwortete Frage, vorausgesetzt es war eine gute Frage und eine kluge Antwort, zieht in der Regel mindestens ein halbes Dutzend neuer Fragen nach sich.
Allerdings kann ich meine kleine bescheidene Rolle in diesem Spiel nicht völlig vernachlässigen. Immerhin wirkten einige meiner Anstöße, ohne dass ich das gewollt hätte, in einer Weise auf das Geschehen, die man als richtungsentscheidend, um nicht zu sagen richtungsändernd bezeichnen könnte. Sie wissen schon: der kleine Stein und die große Lawine.
Wie mein Alias bereits andeutet, treibe ich mich in den dunklen Ecken unserer Gesellschaft herum; dort, wo die Fassade der bürgerlichen Existenz und des legalen Geschäftslebens so dünn und fadenscheinig ist, dass es einem Spezialisten wie mir problemlos gelingt, unerkannt von einer Seite auf die andere zu diffundieren, wie man diesen Prozess der Osmose so schön nennt. Schlichtere Gemüter sehen in mir einfach einen netten, älteren Herrn, der seinen Ruhestand genießt, gerne reist und – vielleicht bemerkenswert für einen Knacker meines Jahrgangs – Ahnung von Computer- und Internettechnologien hat. Zu meinem letzten Auftrag namens Leon Walter kam ich – wie ich vermutete – aus genau diesen Gründen. Im Grunde sollte es einfach nur eine etwas erweiterte Form der Überwachung sein. Ein Job, den jeder Privatdetektiv mit der entsprechenden Ausrüstung auch hätte erledigen können. Aber man wollte mich, weil ich in bestimmten Kreisen dafür bekannt bin, Aufträge auch dann erfolgreich abzuschließen, wenn die Grenzen der Legalität längst überschritten sind. Außerdem war es eines dieser berühmten Angebote, die man nicht ablehnen kann.
Bei Leon Walters Aufzeichnungen handelt es sich nicht um sein ohnehin halb oder ganz öffentliches Gesülze, das er via Twitter, Facebook oder WhatsApp abgesondert hat. Dieses unerträgliche Gelalle werde ich nur im Notfall heranziehen, wenn seine privaten Notizen Lücken aufweisen, über die dieser Mensch erstaunlicherweise neben seinen öffentlichen Posts auch verfügt. Glauben Sie mir, allein diese vertraulichen Aufzeichnungen sind Zumutung genug.
So viel vorab: Leon ist ein reichlich unbedarfter junger Mann mit – man muss es so unverblümt sagen – ständig dicken Eiern, dessen Hauptbestreben Tag für Tag in erster Linie dem Triebabbau der stets geschwollenen Testikel gewidmet ist. Dabei scheint es ihm herzlich egal zu sein, wer ihm Befriedigung verspricht. Hauptsache, er kommt zum Schuss, wie man ebenso unschön wie chauvinistisch eine derartige Fixierung auf das Sexuelle in den längst vergangenen Jahren meiner eigenen Jugend bezeichnet hat. In seinem Fall sind die abgegriffenen Phrasen er hüpft von Loch zu Loch oder er rammelt wie ein Karnickel alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist trotz ihrer unerträglichen Banalität die zutreffendsten Beschreibungen seines Charakters. Und nur die Tatsache, dass ihm dabei bisher lediglich Vertreter der eigenen Spezies vors Rohr kamen (Rohr! Sie sehen, die mangelnde geistige Reife dieses Menschen ist ansteckend), heißt nicht, dass er sich nicht irgendwann einmal in seiner Not auch an Schafen oder Hühnern vergreifen wird.
„How auch ever“, wie Leon in seiner profund-pubertär-infantilen Art sagen würde. Der junge Mann liebt schlichte Scherze über alles: So vertauscht er gerne mal Vor- und Nachnamen und nennt sich Walter Leon, was er – wie nicht eigens betont werden muss – ungemein witzig findet.
Ich jedenfalls, als ich unter anderem sein Smartphone gekapert hatte und dann notgedrungen den Müll an SMS, Bildchen und Videos durchforsten musste, nannte ihn seinerzeit Leon, den Unprofessionellen. Nicht zuletzt deshalb, weil ich im Datenwust auch einige Spuren nachlässig gelöschter kleinkrimineller Neigungen gefunden habe, die für den Nachwuchs meiner Zunft, will man Leons Beispiel verallgemeinern, keine besonders rosige Zukunft erahnen lässt.
Leon:
Der Job ist ideal.
Träumen! Und zwar im Dienst der Wissenschaft.
Ich werde Versuchskaninchen und verdiene mein Geld im Schlaf. Ich denke, sehr viel bessere Jobs gibt’s nicht. Selbst die Arbeitszeiten sind äußerst flexibel. Wenn ich tagsüber mal ein Nickerchen halten will, um fit für die anstehende Nacht zu sein, bin ich im Institut ebenso willkommen wie nach einem anstrengenden Ausflug auf die Piste früh um halb fünf.
Ich hatte tierisches Glück, …
Dr Crıme:
Da würde ich eher von Unglück oder, wenn schon, dann von teuflischem Glück reden, wobei das Wort Glück zur überdeutlichen Akzentuierung auch noch mit Gänsefüßchen umrahmt werden müsste.)
Leon:
… dass ich genommen wurde. Laut Mensa-Aushang suchte die Prof lediglich drei neue Schläfer für ihre Versuchsreihe.
Ich klingele also das Institut an und diese weibliche Stimme am anderen Ende – man soll sich niemals NUR auf den Klang einer Stimme verlassen, ich weiß das und falle trotzdem immer wieder darauf rein – also die betörend verführerisch klingende Stimme fragt, ob ich sofort kommen könne.
„Sofort?“ In dir?, fügte ich in Gedanken hinzu.
„Sofort.“
„Kein Problem. Ich räum‘ nur noch das Tablett weg.“
Schließlich will ich bei meinen Kommis, insbesondere den weiblichen, die auf so was Wert legen, nicht den Eindruck eines unverbesserlichen Messies hinterlassen.
Wie bereits angedeutet, war das Gesicht zur Stimme eine Enttäuschung, aber dafür stimmten die Bedingungen des Jobs. Ich hatte ja keine Ahnung, dass man als Dauer-Doktorand, noch dazu eingeschrieben an der geisteswissenschaftlichen Hungerkünstler-Fakultät der SFU, derart fürstlich entlohnt werden kann.
Zur Terminabstimmung hätten sie mich eigentlich gar nicht gebraucht, denn nach Eingabe meiner Matrikel-Nummer hatte die umwerfende Stimme zum ernüchternden Äußeren sofort sämtliche Seminare und Vorlesungen auf dem Schirm – einschließlich all jener Veranstaltungen, die ich im Verlauf meiner akademischen Karriere geschwänzt hatte. Problemlos konnte sie meine künftigen Arbeitszeiten im Institut drum herum legen. Drumrum liegen, dumm herumliegen. Das ist für einen halb gebackenen Literaturwissenschaftler wie mich erstaunlich unelegant formuliert, aber (tä tä!) es passt, wie die berühmte Faust ins blaue Äugelein oder mein kleiner Walter in die Muschi einer willigen Schnalle. Denn man muss ja von berufsbedingten Schlafphasen sprechen.
Das mit der Flexibilisierung der Arbeitszeit kam erst etwas später.
„Sie werden Traumprotokolle führen müssen“, sagte die Stimme, „aber das wird Ihnen Professor Meltendonck noch genauer erläutern. Jedenfalls gehören die Protokolle mit zur Arbeitsbeschreibung. Sehen Sie, das steht hier in Ihrem Arbeitsvertrag.“
Sie zeigte auf eine Passage Kleingedrucktes, die ich ähnlich zur Kenntnis nahm, wie das Anklicken der AGBs bei Online-Versendern.
„Muss ich mit meinem Blut unterschreiben?“, fragte ich.
Der dünnlippige blasse Mund zur umwerfenden Stimme lächelte gequält. Ich überlegte: Sollte ich je in die Verlegenheit kommen, eine Retrocompany zu gründen, die Telefonsex für Audiophile anbietet, würde ich sie abwerben.
Die Assistentin oder Sekretärin oder was auch immer ihre genaue Funktion war, wollte mir ihren Kuli reichen. Doch ich zückte schwungvoll den erst gestern geklauten schwarz-silbernen Diabolo-Griffel von Cartier und setzte meinen Leo unter den Vertrag.
Der Diebstahl des sündteuren Schreibgeräts mit dem zu solcher Unverfrorenheit passenden Namen versetzte mich immer noch in Hochstimmung. Jetzt brauchte ich das Ding so schnell nicht für zwei, drei lächerliche Hunnis weit unter Wert verticken. Neu kostet das Teil im Fachhandel immerhin stilvolle 666 Euronen …
Dr Crıme:
Statt der Traumprotokolle hat Leon Walter pünktlich zum Einstieg im Institut mit klassischen Tagebuchaufzeichnungen begonnen. Allerdings nur in den seltensten Fällen handschriftlich mit dem geklauten Edelschreibgerät namens Diabolo notiert, sondern in ein stinknormales Word-Dokument in sein Notebook getippt.
Nb.: Die Tatsache, dass Leon zu den Nutzern von Windows, kurz den Windioten zählt, sagt eigentlich schon alles …
Leon:
Ich will ja nicht mäkeln. „Glück ist selten vollkommen. Und wenn es uns vollkommen erscheint, dann hat sich meist ein dichter Schleier vor unsere Augen gelegt. Die Vernebelungstaktik endogener Drogen.
Dopamin-, Serotonin- oder Endorphin-Räusche führen zu wahrhaft paradoxen Erscheinungen. Sie fokussieren unsere Wahrnehmung passenderweise auf das, was wir sehen wollen und als gut und schön empfinden und blenden alle (unter normalen Bedingungen offensichtlichen) Mängel großzügig aus.“
Na? Wie war das?
Ich denke, mit meinem schlauen Gelaber könnte ich auch im gut verkäuflichen Glücksbuchratgeber-Segment eine erfolgreiche Karriere starten. Aber natürlich nur unter Pseudonym, selbstredend einem weiblichen. Ein Face-Double sollte nicht schwer zu finden sein. Wie wär’s mit Waltraud Leoni? Oder gibt’s die etwa schon?
Wo war ich stehen geblieben?
Ach ja, die Unvollkommenheit. Als ich tags darauf neben der stimmlich überwältigenden, aber visuell eher bescheidenen Sekretärin auch die hochberühmte Frau Professor Dr. Lucia Meltendonck höchst persönlich kennenlernte, drehte sich die ganze Angelegenheit um 180 Grad. Frau Professors Stimme war – um es freundlich auszudrücken – in ihrer kaum beherrschbar-durchdringenden Art nur eingeschränkt erträglich, während sie stattdessen für ihre reifen Jahre (ich schätze sie auf Mitte, Ende vierzig) schlicht umwerfend aussah. Die Stimme der einen im Körper der anderen und das eingangs beschworene Glück wäre perfekt!
Andererseits … und derart ehrliche Äußerungen, wie ich sie jetzt in die Tastatur hämmere, darf ich in meinen privaten Aufzeichnungen, die nicht zu meinem Arbeitsauftrag gehören, problemlos machen – es erfährt ohnehin niemand was davon, da ich nicht vorhabe, das hier zu posten (lol) … Also andererseits sagt mir meine Erfahrung, dass eine Frau mit ihrem Mund und ihren Lippen und ihrer Zunge außer Quasseln auch noch ganz andere Sachen machen kann … Oink, oink!
Dr Crıme:
Hatte ich Ihnen gegenüber schon erwähnt, dass unser Held ein unerträglicher Klugscheißer im Gewand eines Sprüche-Plattklopfers ist? Spätestens jetzt haben Sie es schwarz auf weiß. Und nicht nur das. Seine oberflächliche Einstellung gegenüber Frauen ist, angesichts der Tatsache, dass es sich bei Leon Walter um einen Endzwanziger handelt, skandalös vorgestrig. Ich gebe ja gerne zu, dass ich selbst keineswegs vor gewissen Chauvinismen gefeit bin. Political correctness geht mir am Arsch vorbei.
Aber ich behandle alle gleich – und zwar gleich schlecht.
Wenn es unumgänglich ist, stanze ich einer Frau ebenso ein Loch in den Schädel wie einem Mann. Bei solchen Fragen zählen nur die Umstände und nicht das Geschlecht.
Und um durch Leons Aufzeichnungen keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen: Ich habe Frau Professor Meltendonck, nachdem meine Zusammenarbeit mit dem Meister begann, ebenfalls kennengelernt und kann Ihnen versichern, ihre Stimme ist keineswegs so schrill und schrecklich, wie dieser Trottel meint. – Gut, sie kann laut werden, auch über längere Zeit, ohne einen Anflug von Heiserkeit, aber das ist im Rahmen ihres Lehrauftrags wohl eher von Vorteil. Ansonsten stimmt Leons Beschreibung, sie ist keinesfalls unattraktiv, im Gegenteil. Was jedoch das Gelaber wegen ihres angeblich „reifen Alters“ anbelangt – sie ist gerade fünfzig geworden –, so muss man das als jugendlichen Stuss abhaken. Das Bürschchen sieht sich selbst altersmäßig noch eher in der erweiterten Kindergartengruppe denn als Mitglied der Welt der sogenannten Erwachsenen.
Sein Job im Institut für angewandte Traumforschung an der renommierten SFU unserer hübschen mittelfränkischen Stadt sollte sich letztlich als bedeutend, um nicht zu sagen als Glücksfall herausstellen, wenn auch nicht unbedingt für ihn.
Damit Sie sich ein Bild von ihm machen können, das über die bereits gründlich entlarvenden Statements hinausgeht, die er ohne Not von sich preisgegeben hat, werde ich der Einfachheit halber einen Vergleich bemühen: Er ist groß – ich schätze mal einiges über einsneunzig – und er sieht aus wie die jugendliche Version des Schauspielers Rowan Atkinson, sattsam bekannt als Mr. Bean. Wenngleich ihm jedoch die schauspielerischen Fähigkeiten dieses Mimen völlig abgehen. Entgleisen Leon die Gesichtszüge, ist das selten komisch, sondern im Gegenteil fast immer tragisch. Selbstbeherrschung ist für Menschen wie ihn ein Fremdwort und so verrät er einem halbwegs erfahrenen Gegenüber, ohne ein Wort sagen zu müssen, alles, was der von ihm wissen will.
Ähnlich wie Atkinson scheint er eine Leidenschaft für unvernünftig schnelle und schicke Autos zu haben, ohne sich diese freilich leisten zu können. So gut wurde sein Job dann doch nicht bezahlt.
Leon:
Morgen Nachmittag geht’s los. Dann wird die Kohle im Schlaf verdient.
Um das zu feiern, geht es heute Nacht noch mal auf die Piste. Meine bisher so unnahbare Mondgöttin Eva – also Eva aus der Mondstraße in Fürth – hat mir erlaubt, sie in die Margarinefabrik zu begleiten. Dafür habe ich mich extra in meine schwarze True Religion Designer-Jeans im Rocco-Leather-Look gezwängt, die ich Anfang des Jahres in dieser Erlanger Nobel-Boutique geklaut habe.
Wir tanzen nun schon seit Stunden inmitten tausender Partywütiger zu Techno und House aus den 90ern. Wahrscheinlich gibt es einen Grund dafür. Vielleicht feiern Scooter Goldene Hochzeit. Mir läuft der Schweiß in Strömen herab und meine Socken sind derart feuchtigkeitsdurchtränkt, dass jeder Step ein quietschend-matschiges Geräusch verursacht. Zum Glück sind die Beats derart knallend, dass selbst ich das nur vermuten, aber nicht wirklich hören kann.
Auch Eva glänzt, aber bei ihr sieht das einfach nur derart geil aus, dass mich allein der Gedanke, diesen Schweißfilm abzulecken, zu Höchstleistungen anspornt. Mädels mögen gute Tänzer, denn sie hoffen ja, dass man sich beim Laken-Zweikampf genauso geschickt bewegt. Die vielen bunten Smarties, die wir eingeworfen haben, tun das ihre, um uns quietschlebendig zu halten.
Vorhin – das muss schon eine Weilchen her sein – als mal eine halbe Minute lang nur die Bass-Drum aus den Boxen knallte, schrie sie in mein Ohr: „Wenn du mein Prinz bist und wacker durchhältst, gibt es später noch Dessert!“ Dabei zog sie das ohnehin tief ausgeschnittene, klatschnasse Shirt ein Stück nach vorne und ließ mich die runde weiße Pracht ihrer Äpfelchen bewundern. Genau in diesem Moment setzte wieder die volle Dröhnung ein und seitdem bekomme ich den bescheuerten Refrain nicht mehr aus dem Kopf: „Bass-Drum, Bass-Drum, los, gib uns den Takt an! Bass-Drum, Bass-Drum, los, gib uns den Takt an!“
Später werde ich wohl in einem unbeobachteten Moment auch noch eine von den blauen „Davon kriegst du garantiert einen Hammerharten, Mann, das versprech‘ ich dir“-Drops einschmeißen. Nicht, dass ich die Dinger wirklich nötig hätte, aber nach all dem Speed und Ecstasy werd‘ ich kein Risiko eingehen. Schließlich erwartet meine Mondgöttin ein Rundum-Glücklich-Paket und ich habe einen Ruf zu verlieren.
Mittlerweile grölt dieser nervige Kerl zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit in meinem Ohr: „Bass-Drum, Bass-Drum, los, gib uns den Takt an!“
Es klingt, als sitze der Schwachmat direkt vor dem Trommelfell, schreit seinen Text und schlägt mit seinem Knüppel – naja, worauf wohl …
Dann zieht mich die Mondgöttin quer durch das Gewimmelmeer zuckender, sich verrenkender, von Stroboskopblitzen zerhackter Körper, bis wir schließlich hinter der DJ-Bühne vor dieser wuchtigen Stahltür stehen. Ich erkenne sie sofort wieder. Heute Abend, als wir von der U-Bahn-Station in ihrer Nähe aufbrachen, sind wir unten am eklig gefliesten Bahnsteig schon mal an einer vorbeigekommen, die genauso aussah. Eine riesige Neun prangte dort auf dem Stahl.
Number nine, number nine.
Verdammt, woher kenne ich das?
Richtig, auf dieser kleinen Plastikkarte, die wir am Eingang der Margarinefabrik in die Hand gedrückt bekamen, prangte auch eine große Neun und sonst nix. Ich spür‘ das Ding in meiner Hosentasche. Es ist doppelt so dick wie ’ne normale Kreditkarte und genauso lang, nur schmäler. Und ansonsten auf beiden Seiten schwarz wie die Nacht.
„Für eure Freigetränke“, hatte der Kerl beim Einlass gesagt.
Hier also schon wieder die Neun und wie in der U-Bahn auf einem Stahltor. Muss das Motto der Nacht sein. Ich zieh‘ die Karte aus der Hosentasche, aber meine stroboskopgeschädigten Glotzer können die Neun auf der Plaste nicht erkennen. Da ist nur tiefste Schwärze zwischen meinen Fingern. Ich steck das Ding wieder ein, denn in diesem Augenblick öffnet Eva die Tür und wir schlüpfen hindurch …
Was erwartet Eva und Leon hinter Tür Nr. 9?
Wird die nächste Folge diese Frage beantworten?
FOLGE 2
WAS BISHER GESCHAH
Eva und Leon stehen in der Nürnberger Margarinefabrik hinter
dem DJ-Pult vor einer Stahltür, auf die eine Neun gemalt ist.
Kurzerhand öffnet Eva die Tür und sie schlüpfen hindurch …
Die Musik macht augenblicklich anderen Geräuschen Platz. Tierlaute, Wasserrauschen, Blätterrascheln. Wir stehen mitten im ecuadorianischen Regenwald. Eine Affenhorde tobt über unsere Köpfe hinweg und stößt schrille Schreie aus. Bunte Papageien hocken auf Ästen und legen ihre Köpfe schräg, um die Eindringlinge anzuglotzen. Uns. Und nach wie vor plärrt die Stimme in meinem Kopf: „Bass-Drum, Bass-Drum, los, gib uns den Takt an!“
„Hier lang!“, dirigiert Eva und ich versinke knietief im Matsch am Ufer eines etwa zwei Meter breiten Baches, der flach genug zu sein scheint, dass man ihn durchwaten kann, wenn man sich nur nicht so blöd anstellt wie ich.
„Vorsicht!“ Sie reißt mich am anderen Ufer zur Seite. Ich verrenke meinen Hals und starre direkt in Kaas sich spiralförmig drehende Pupillen.
Soll ich mir Sorgen machen, weil wir in Mittelamerika einer Cartoonschlange begegnen? Soll ich mir Sorgen machen, weil wir auf einmal Tausende von Kilometern von unserem Ausgangspunkt entfernt sind? NEIN! Zugegeben: So was passiert auch mir nicht alle Tage, aber wenn, dann bin ich jemand der zupackt und keine Fragen stellt.
Währenddessen singt der mittlerweile zu einem gewaltigen Männerchor angewachsene Gesangsverein in meinem Ohr: „Bass-Drum, Bass-Drum, los, gib uns den Takt an!“
„Dort ist es“, sagt Eva und kriecht unter einer massiven, mit seltsamen Zeichen verzierten Steinplatte in eine dreieckige Öffnung, die in der Höhe knapp einen Meter misst. Links ist der obere Teil einer Säule zu sehen, von der diese Steinplatte abgestützt wird. Irgendwann einmal muss es weiter rechts ein Gegenstück dazu gegeben haben, das einst den Torsturz in der Waagerechten hielt. Doch diese Säule ist verschwunden, irgendwann umgestürzt, ihre Trümmer wurden überwuchert und vom Dschungel verschlungen. Der von ihr bis zu ihrer Zerstörung getragene steinerne Torsturz hat sich deshalb schräg in den schlammigen Dschungelboden gebohrt. Die noch sichtbaren Reste dieses Eingangs sind dermaßen wuchtig, dass er, wie ich mir vorstelle, seinerzeit groß genug gewesen sein muss, um einem Saurier hindurch zu lassen, falls es damals noch Dinos gab.
Ich folge Eva durch die dreieckige Öffnung und gelange ins Innere einer Tempelanlage.
Als ich zurückblicke, sehe ich, wie es draußen schlagartig dunkel wird. „Erstaunlich, wie schnell in den Tropen die Nacht hereinbricht“, sagt sie und greift nach meiner Hand. „Komm!“
Woher sie auf einmal die Fackel hat, weiß ich nicht mehr. Es gibt aber ohnehin nur einen Weg. Vorwärts. Die Wände des Gangs, der rasch so groß wird, dass wir nicht mehr zu kriechen brauchen, sind über und über mit Bildern und Bilderschriften verziert.
„Mayas“, kommentiert Eva knapp und unterbricht damit für eine wohltuende Sekunde: „Bass-Drum, Bass-Drum, los, gib uns den Takt an!“
Wir kommen in einen kreisrunden Raum, dessen Decke mit der ausgestreckten Hand nicht mehr zu erreichen ist. In der Mitte der Decke haben die Erbauer der Anlage eine ebenfalls runde Öffnung mit einem Durchmesser von etwa zwei Metern gelassen, durch die die Sterne des nächtlichen Himmels blinken. Unterhalb des Deckenfensters zur Nacht steht ein schlichter Steinkubus von vielleicht einem Meter Kantenlänge.
„Ein Altar“, sage ich, um Eva zuvorzukommen. Sie nickt und hebt den Deckel von der Schale, die in der Mitte auf dem Kubus steht. Im Sternenlicht sehen wir kleine blaue Perlen schimmern, mit denen die Schale bis fast zum Rand gefüllt ist. Ich erkenne, dass sich der Altar nicht exakt im Zentrum unterhalb der kreisförmigen Öffnung in der Kuppel befindet. Diesen Platz nimmt eine flache, kaum einen Fußbreit aus dem Boden ragende, an allen Ecken und Kanten abgerundete Lagerstätte ein, quadratisch und in der Fläche doppelt so groß wie der Altar.
„Irgendwie sieht das Ding aus wie ein Futon“, sage ich, während ich darauf Platz nehme. Die flache Erhebung lädt – obwohl aus Stein – zum Lümmeln ein.
Eva hockt sich mir gegenüber. Sie öffnet mit den Fingern zart meine Lippen und legt eine der Perlen auf meine Zungenspitze. Dann streckt sie mir ihre Zunge entgegen, auf der ebenfalls so ein rundes Ding ruht. Wie mechanisch und ohne dass ich von diesem eigentlich höchst prickelnden Vorgang das Geringste mitbekommen hätte, haben wir uns in einem Affentempo ausgezogen und sind jetzt splitterfasernackt. Ich spüre, dass meine Göttin nicht viel Zeit mit Vorspielen vertrödeln will. Nachträglich finde ich es ungemein schade, dass ich mich partout nicht mehr daran erinnern kann, wie ich Eva die Kleider vom Leib gerissen habe, aber manche Schlüsselmomente versacken im Nebel des Vergessens.
Jetzt dringe ich jedenfalls genau in dem Moment in sie ein, in dem sie mir ihre Zunge samt Perle in den Mund stößt. Wir schlucken beide die kleinen runden Kapseln und unsere Körper bewegen sich im Rhythmus unserer Lust.
Keinen Wimpernschlag später heben wir ab. Wir lassen die Atmosphäre unseres blauen Planeten hinter uns. Wir rasen in einem aberwitzigen Tempo an Mond, Mars und Asteroidengürtel vorbei.
„Bei Jupiter“, stöhne ich, „die Ringe des Saturn!“ und schon taumeln Neptun und der einsam-traurig-degradierte Pluto von uns fort. Die Sonne ist jetzt so winzig, dass ich Mühe habe, sie zu erkennen. Sirius kommt und geht. Wir sehen brennende Schiffe an der Schulter des Orion. Und schließlich wächst uns nach dem Pferdekopfnebel der spektakulärste Ort der ganzen Galaxis entgegen, wird immer größer, immer farbenprächtiger, immer atemberaubender.
Ich kann unmöglich erklären, wie zwei durch die Milchstraße rasende, im Liebestaumel ineinander verschlungene, nackte Körper atmen und zudem nicht augenblicklich zu schockgefrosteten Materieklumpen erstarren können. Muss aber auch gestehen, dass mir dieser Gedanke erst nachträglich in den Sinn kommt. Während unserer überlichtschnellen Schussfahrt durchs Universum sind wir voll und ganz und ausschließlich mit zwei Dingen beschäftigt: bumsen und staunen.
„Lor Els Auge“, flüstert Eva in mein Ohr. „Der jährliche Austragungsort der galaktischen Meisterschaft der besten Space-Surfer von hier bis Andromeda.“
Wir nähern uns der zentralen Raumstation, um die herum, an der vorbei und von der ausgehend die einzelnen Disziplinen ausgetragen werden.
Jetzt ficken wir nicht mehr.
Stattdessen ist der aus der Schwärze geborene Raum vor dieser grandiosen Kulisse mit aggressiven Hiphop-Beats erfüllt und der Männerchor von Wanne-Eickel rapt:
„Bass-Drum, Bass-Drum, los, gib uns den Takt an! Bass-Drum, Bass-Drum, los, gib uns den Takt an!“
Die Station wird langsam größer und dreht sich aus unserer Perspektive zur Seite weg, sodass wir ungehindert auf das größte Naturwunder der Milchstraße glotzen können. Die farbigen Gasnebel erstrahlen in gelben, roten und leuchtend-blauen Farbtönen und sehen wie ein riesiges, Lichtjahre durchmessendes, weit aufgerissenes Auge aus, das gottgleich alles im Kosmos überblickt und unter Beobachtung hält. Selbst die kleinste Kleinigkeit, etwa das Verwehen mikroskopisch kleinsten Blütenstaubs auf einer Wiese am Ufer der Regnitz entgeht diesem allumfassenden Blick nicht.
„Die NSA ist sicher neidisch auf Lor Els Auge“, sage ich und verfalle angesichts der überwältigen Pracht dieses Gebildes in ein andächtig gedämpftes Flüstern. Mir wird, kaum habe ich diese Banalität von mir gegeben, trotz meines gedämpften Tonfalls übel, da ich fürchte, mit meinen Worten den Zauber jäh zu zerstören, der zwischen Eva und mir entstanden ist und der von der gewaltigen Pracht, die das Universum vor uns entfaltet, auf so unbeschreibliche Weise gespiegelt wird.
Gibt es Größeres als Sex in der freien Natur? Ja!
Sex im All und zwar dort, wo der Kosmos am schönsten ist!
„Das schwarze Loch in seinem Zentrum soll das stärkste in der ganzen Galaxis sein“, erwidert Eva in normaler, unbeeindruckt klingender Lautstärke. Ich bin enttäuscht und erleichtert zugleich. Mein mir selbst so unpassend erschienener Kommentar löst zwar keine Abwehr bei ihr aus. Andererseits hat sich auch in ihr eine eher nüchterne Stimmung breit gemacht. „Es erzeugt die besten Gravitationswellen, die man sich als Space-Surfer wünschen kann“, fügt sie hinzu, bevor sie meine Aufmerksamkeit auf ein im wahrsten Sinne des Wortes buntes Treiben an der Station lenkt.
Dort tobt eine Horde mit Spraydosen bewaffneter Äffchen, die allesamt in niedlichen, kleinen, quietschbunten Raumanzügen stecken. Die Köpfchen blicken flink durch die durchsichtigen, kugelförmigen Raumhelme hin und her. Sie hinterlassen auf der tristen grauen Außenwand der Raumstation eine immer größer werdende Spur bunter Tags und riesiger Bilder. Und während wir näher schweben, um die Kunstwerke noch genauer betrachten zu können, singt der Affenchor:
„Bass-Drum, Bass-Drum, los, gib uns den Takt an! Bass-Drum, Bass-Drum, los, gib uns den Takt an!“
„Das muss aufhören!“, denke ich und beschließe, mich wieder auf jene Gemeinsamkeit zwischen Eva und mir zu konzentrieren, die uns hierher gebracht hat. Ich greife nach ihren Brüsten und spüre die apfelgroßen Kugeln in meinen Handflächen, fühle ihre harten Nippel, dringe wieder in sie ein und ein und ein und … gemeinsam kommen wir in einem gewaltigen kosmischen Urknall, zuckend und erschauernd, aller Sinne beraubt.
Beinahe aller Sinne beraubt. Denn aus den Augenwinkeln sehe ich noch das Ur-Grafitti an der Außenwand der Station:
Kilroy was here!
Ich lache und erwachte.
In meinem Bett.
Schlafblind tastete ich neben mir über Kissen und Decke. Niemand da.
Bitte sehr, wer sollte da auch sein?
Bettdecke, Laken, mein Schlafanzug – alles pappte und schien klebrige Fäden zu ziehen. Und während ich schlaftrunken grunzte, „Bass-Drum, Bass-Drum, los, gib uns den Takt an!“ wurde mir bewusst, dass dies der farbigste all meiner feuchten Träume gewesen war. Und der ergiebigste. Ich musste mindestens einen halben Liter meines Safts von mir geschleudert haben.
Aber was ist mit Eva?
Falsche Frage.
Wer zum Teufel ist Eva?
Es sollte wohl besser heißen: Wer um Himmels willen ist Eva?
Ob es darauf in der nächsten Folge eine Antwort gibt?
FOLGE 3
WAS BISHER GESCHAH
Leon fragt sich, wer um alles in der Welt
diese Mondgöttin namens Eva ist …
Ihr Gesicht kam mir vage bekannt vor. Natürlich kenne ich die Mondstraße in Fürth, aber ich kenne niemanden, der dort wohnt, erst recht keine Eva.
Dann fiel mir etwas ein. Eine Ähnlichkeit.
Ihr Gesicht, so dämmerte mir, war eine Version von Frau Professor Dr. Lucia Meltendonck. Hatte ich ihre Titten in meiner Hand gespürt? War es ihr Hintern gewesen, den ich umklammert hatte?
Für ein Traumprotokoll mögen diese Aufzeichnungen ja nicht schlecht sein. Aber falls Frau Professor heute Nachmittag von mir verlangt, meinen letzten Traum aufzuschreiben, werde ich mir wohl was anderes ausdenken müssen. Sonst bin ich den Job schneller los, als ich ihn bekommen habe …
Dr Crıme:
Dieser schamlose Schlagmichtot liebt also auch maßlose Übertreibungen. Dass sich junge testosterongesteuerte männliche Primaten notorisch selbst überschätzen – geschenkt, davon lebt die prosperierende Autotuning-Branche neben vielen anderen, die männliche Eitelkeit streichelnden Geschäftsbereichen. Kann sich noch jemand an die Fuchsschwänze erinnern, die an Auto-Antennen baumelten?
Aber haben Sie schon mal von einem drogeninduzierten Weltraum-Sextrip gehört?
Vielleicht bin ich doch allmählich zu alt für solche Jobs. Jedenfalls hat mir die unappetitliche Schilderung gründlich die ohnehin gewohnt miese Laune verdorben, sodass ich schon befürchten muss, meine von mir sorgsam gepflegte schlechte Stimmung würde sich zusätzlich in einer Weise verfinstern, die dazu angetan wäre, mir tatsächlich den Tag zu verderben.
So jemandem wie Leon will man ja nicht mal in Gedanken die Hand schütteln.
Bevor ich auf meine erste Begegnung mit dem Meister zu sprechen komme, ist es an der Zeit, etwas klarzustellen.
Natürlich ist Dr Crıme – wohlgemerkt ohne Punkte – nicht der Name, der in meiner Geburtsurkunde stand. Punkte mitten im Namen sind wie Einschusslöcher – sollte man also vermeiden! Man gibt sich solche Namen nicht selbst, sondern bekommt sie verliehen. Es handelt sich mithin um eine Auszeichnung, die in meinem Fall auch damit zu tun hat, dass ich vor Jahrzehnten in einer meiner parallelen Existenzen erfolgreich eine Dissertation verteidigt habe. Nicht etwa in naheliegenden Fächern wie Jura oder Kriminologie, sondern – wie eingangs schon angedeutet – in Literaturwissenschaften. Ich bin nicht so dumm und werde hier den Titel verraten, sondern nur das grobe Thema anreißen: Mimesis und Heteroglossie.
Wissenschaftliche Arbeiten zu diesen literaturwissenschaftlichen Themenkomplexen gibt es einige Hunderttausend. Und selbst wenn ich verrate, dass ich mich in meiner Arbeit auf Erich Auerbach, Michail Michailowitsch Bachtin und William Empson bezog, wird ihre Zahl kaum kleiner. Ich erwähne das nicht, weil ich mir auf den akademischen Titel etwas einbilde, sondern weil dieser Umstand unserer Geschichte insofern eine besondere Wendung verleiht, als auch das Objekt meiner Observation ein angehender Literaturwissenschaftler ist. Allerdings keiner, mit dem ich mich unter normalen Umständen fachlich ausgetauscht hätte.
Meine erste persönliche Begegnung mit dem Meister hatte wenige Wochen zuvor stattgefunden.
Nicht, dass wir uns nicht längst kannten. Das bleibt kaum aus in einem Geschäft, das schon lange, bevor alle Welt vom globalen Dorf zu faseln begann, rund um den Erdball aufs Engste vernetzt war. Wir hatten zwangsläufig bereits in den frühen 1970er-Jahren voneinander Kenntnis genommen. Bei erfolgreich im weiten Feld internationaler, krimineller Machenschaften agierenden Akteuren lässt es sich kaum verhindern, dass in der Branche über sie gesprochen wird. Auch wenn dieser Klatsch und diese Gerüchte selten die Kreise derjenigen verlassen, die genau wissen, wem sie was erzählen dürfen und vor allem wem nicht. Nur selten erreichen diese in Umlauf befindlichen Geschichten die Gegenseite – also Polizei und Justiz. Und noch viel seltener bieten sie handfeste Anhaltspunkte, mit denen jemand wirklich festgenagelt werden könnte. Doch auch hier gibt es Ausnahmen und zwar dann, wenn sich eine Seite übervorteilt fühlt.
Unvergessen ist in diesem Zusammenhang der angebliche Coup der britischen Justiz gegen Tommy Adams, der seinerzeit in der Presse als bedeutender Schlag gegen das organisierte Verbrechen bejubelt wurde und der den bösen Buben für ein paar Jahre hinter Gitter brachte. Dabei wollten die übrigen Adams-Brüder ihrem unbotmäßigen Tommy nur einen Denkzettel verpassen, damit er sich künftig an die innerfamiliären Abmachungen hält. (Das stand selbstredend nicht in der Zeitung.)
Derartige Vorkommnisse sind dem Meister und mir nie widerfahren. Abgesehen von der unleugbar schlichten Tatsache, dass dies für den potenziellen Flötenspieler das letzte Konzert gewesen wäre.
Zum Glück ist die Welt des Verbrechens groß genug. Der Meister und ich sind uns nie ins Gehege gekommen. Das ist gut so. Denn bei zwei ausgewiesen durchsetzungsstarken Charakteren kann sich eine derartige Konfrontation rasch zu einem höchst unproduktiven Kräftemessen auswachsen und Situationen provozieren, die letztlich und unweigerlich zur Schwächung beider Seiten führen, wenn nicht ohnehin eine der involvierten Parteien ein unschönes Ende findet. Wobei noch anzumerken ist, dass selbst in diesem Fall der Überlebende keineswegs der Sieger ist.
Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede.
Schließlich war auch ich einmal jung, leistungsstark und mit aller Macht darauf erpicht, meinen Ruf auszubauen, zu festigen und an meiner eigenen Legende zu stricken. Ich denke da an jene unschöne Begebenheit mit Roberto 1974 auf Lanzarote.
Der Auftrag damals war ebenso simpel wie lukrativ.
Die gelangweilte Gattin – nennen wir sie Mrs. X – eines erfolgreichen Industriellen der britischen Energiebranche – ein gewisser Mr. X – wünschte sich nichts sehnlicher als das baldige Ableben ihres Mannes.
Sie besaß eigenes Vermögen und war bereit, ein stattliches Sümmchen zu investieren, um ihr Anliegen zu realisieren.
Im Verlauf ihrer Ehe waren viele Gründe zusammengekommen, von denen jeder einzelne ihrer Ansicht nach ausgereicht hätte, dem ungeliebten Gatten ein vorzeitiges Ende zu bereiten. Da gab es beispielsweise seine zahlreichen Affären mit kostspieligen Geliebten, die das gemeinsame Vermögen in einer Weise belasteten, die Mrs. X schlicht unerträglich fand.
„Über irgendwelche billigen Nutten aus Soho hätte ich hinweg gesehen“, sagte sie mir, als wir uns zu einem ersten Gespräch trafen, „aber diese Luxus- kann ich nicht tolerieren.“ Ich muss wohl, als ich ihr Schimpfwort hörte, eine Augenbraue hochgezogen haben, denn sie fuhr fort: „Entschuldigen Sie meine verbale Entgleisung, aber diese gierigen Schlampen habe keine bessere Bezeichnung verdient, jedenfalls nicht, wenn er sie mit meinem Geld stopft!“
Doch auch sie hatte sich längst anderweitig umgesehen. Sie hatte sich auf Lanzarote mit einem jungen, feurigen Conejero eingelassen, Sohn einer alteingesessenen Familie von Vulkanweinbauern, die weniger wegen des Weinhandels als vielmehr dank küstennahen Landbesitzes im Verlauf der touristischen Entwicklung der Insel zu einem gewissen Wohlstand gekommen war.
Außerdem hätte sich Mrs. X gerne dauerhaft auf Lanzarote niedergelassen und damit getan, was so viele ihrer Freundinnen bereits vor ihr getan hatten. Doch Mr. X weigerte sich, seine Frau allein in ihrem gemeinsamen Ferienhaus in Puerto del Carmen zurückzulassen, während er der Geschäfte wegen den größten Teil des Jahres auf anderen Inseln verbringen musste, die ohne Frage auch über landschaftliche Reize verfügen, wenngleich sie klimatisch weniger bevorzugt sind. Gemeint sind natürlich die britischen Inseln.
Wie bei solchen Geschäften üblich, gab es die Hälfte des vereinbarten Honorars im Voraus, die zweite Hälfte sollte nach erfolgreicher Erledigung des Auftrags ausgezahlt werden.
Während Mrs. X zur vereinbarten Zeit in Teguise, der früheren Hauptstadt Lanzarotes, die im Inselinnern liegt, zusammen mit ihrer besten Freundin eine kleine Töpferei besuchen sollte, um dort ihrer Leidenschaft, dem Erwerb bunt bemalter Teller und Krüge zu frönen und sich somit ein wasserdichtes Alibi zu verschaffen, erschoss ich Mr. X und als leider unvermeidlichen Kollateralschaden – heute sagt man Beifang dazu – zwei seiner Freunde in einem kleinen Fischrestaurant am Jachthafen von Puerto del Carmen.
Zur Tarnung trug ich eine Langhaarperücke, eine rot umrandete Sonnenbrille mit handtellergroßen Gläsern, einen breitkrempigen Strohhut sowie einen kessen Minirock. Selbstverständlich hatte ich nicht nur mein Gesicht, sondern auch meine Beine sorgfältig rasiert. Der Push-up-BH unter der Bluse war mit Abstand das unbequemste Kleidungsstück, das ich je getragen hatte. Kajal brauchte ich wegen der dunklen Sonnengläser nicht, aber ein farblich sorgfältig auf Hutband und Brillengestell abgestimmter Lippenstift verwandelte meinen Mund zum zentralen Punkt in einem pure Sinnlichkeit ausstrahlenden Gesicht. Ich gab mir jedenfalls alle Mühe, wie eine echte Frau und nicht wie eine abgewrackte Transe zu wirken. Das kann sich, wer mich heute kennt, kaum jemand vorstellen. Doch damals war mein Körper noch wesentlich anpassungsfähiger.
Außerdem waren die siebziger Jahre eine Zeit, in der in aller Öffentlichkeit mordende Frauen zum Alltag gehörten.
Wann immer es mir möglich war, habe ich meinen Opfern zur Erbauung ein paar schöne Zeilen mit auf ihren letzten Weg gegeben. Mr. X flüsterte ich, nachdem ich ihm und seinen Begleitern ins Herz geschossen hatte, zwei Verse des unglücklichen Theodor Däubler ins Ohr, darauf bedacht, dass nur er meine Stimme hören konnte:
„Und diese wird die Schranken brechen,
Sie reißt die Klammern jäh entzwei,
Wenn Flammen den Granit durchstechen,
Durchdonnert ihn ein Lebensschrei!
Ein Glutstrom stürzt nach der Verwundung
Der Rippen aus dem finsteren Ball,
Denn unterwühlt ward seine Rundung
Durch seinen inneren Flammenschwall!“
Wie viel Mr. X von meinem Vortrag noch mitbekommen hat, weiß ich nicht. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass während eines Mordes oftmals die Zeit für einige Augenblicke stehenbleibt. Dieses zeitlupenartige Sich-wie-durch-Sirup-Bewegen ereignete sich auch damals und gab mir so die Gelegenheit, mein Sprüchlein aufzusagen und unbehelligt wieder aus dem Lokal zu verschwinden.
Nachdem ich mich wenig später wieder in einen gepflegten jungen Mann mit kurzen Haaren und Schnauzbart zurückverwandelt hatte, hörte ich im Autoradio meines Mietwagens die Meldung, das fast auf die Minute zur gleichen Zeit in Teguise eine Mrs. X, die sich mit einem jungen Einheimischen in einer billigen Pension eingemietet hatte, nackt und stranguliert auf dem Bett liegend aufgefunden worden war. Den Conejero fand man bleich, ausgeblutet und ebenso tot wie seine Geliebte im ansonsten leeren Kleiderschrank. Es hieß, dass es noch unklar sei, ob er letztlich am Blutverlust gestorben oder an seinen bis tief in die Luftröhre gestopften Geschlechtsteilen erstickt war.
Mrs. X hatte sich also nicht an unsere Absprache gehalten. Warum sie derart leichtsinnig gewesen war, darüber konnte sie mir jetzt nichts mehr erzählen und ich nur spekulieren.
Soweit, so unschön.
Dennoch möchte ich aus heutiger Sicht dazu anmerken: Sie und auch ihr Liebhaber könnten noch am Leben sein, hätte sie sich – wie verabredet – mit ihrer Freundin getroffen. Der Killer, den offensichtlich ihr Mann umgekehrt auf seine untreue Gattin angesetzt hatte, hätte Mrs. X möglicherweise nicht in einem Töpferladen umgebracht. Schließlich erledigt nicht jeder Auftragsmörder seine Arbeit gerne vor mehr oder weniger großem Publikum. Ich vermute zudem, dass er die Frau zusammen mit ihrem Stecher umbringen sollte, wozu er in der Pension ja auch die passende Gelegenheit gefunden hatte. Deshalb ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Mörder, sobald er vom plötzlichen Versiegen seiner Geldquelle, sprich dem gewaltsamen Ableben seines Auftraggebers, erfahren hätte, auf die Durchführung der Tat verzichtet hätte. Warum noch arbeiten und trotz präziser Planung die immer vorhandenen unkalkulierbaren Risiken eingehen, wenn der Auftraggeber die vereinbarte zweite Hälfte des Honorars nicht mehr zahlen und die bereits geleistete Anzahlung nicht mehr zurückverlangen kann?
Ich merke, dass ich inkonsequent bin und jetzt doch angefangen habe zu spekulieren. Dank des Leichtsinns von Mrs. X kam alles anders.
Abgesehen davon, dass ich diese Art Arbeit schon seit vielen Jahren nur noch in seltenen Ausnahmefällen eigenhändig erledige, würde ich – geschähe mir so etwas heute – zähneknirschend die zweite Hälfte des Honorars abschreiben. Nicht nur das. Ich würde versuchen, mit dem Kollegen Kontakt aufzunehmen. Er hat schließlich den gleichen Verlust erlitten wie ich. Ich würde mich verhalten, wie es selbständige Handwerker auf einer Baustelle tun, die eines Morgens erfahren, dass ihr Auftraggeber Pleite gegangen ist:
fluchen und zusammen einen trinken gehen.
Doch damals war ich jünger, dümmer, gieriger und noch längst nicht in der Komfortzone meiner reiferen Jahre angelangt. Das heißt, ich war nicht nur angepisst.
Ich war stinksauer.
Eine unbestimmte Zeit verbrachte ich in meinem Mietwagen bei heruntergekurbeltem Seitenfenster mit Atemübungen, um nicht um mich ballernd die halbe Inselbevölkerung zu liquidieren, was ja zutiefst unproduktiv gewesen wäre und nur noch weiteren Ärger provoziert hätte.
Als ich wieder einigermaßen klar denken konnte, versuchte ich herauszufinden, wer jetzt mit der zweiten Hälfte des eigentlich mir zustehenden Honorars herumlief.
Ich war schon damals recht technikaffin. Deshalb hatte ich das Autoradio des Mietwagens mit ein paar Handgriffen um zusätzliche Frequenzen erweitert. Ein Eingriff, der sich genau so leicht wieder rückgängig machen ließ. Zudem ist mein Spanisch ganz passabel. Es war also kein Problem, den lebhaften Funkverkehr der Guardia Civil abzuhören. Hier erfuhr ich, dass der eiligst von Gran Canaria eingeflogene Comandante seinen ihm zugeordneten Subteniente nach kurzer Lageschilderung mit einem einzigen Wort seine Theorie des Tathergangs erläuterte: „Anarchisten!“
„Terroristen?“, so der Subteniente. In der in Frageform gekleideten Antwort des Unteroffiziers war in komprimierter Form die komplette Kulturgeschichte militärischer, respektive quasimilitärischer Verhältnisse zwischen Befehlshabern und den ihnen untergeordneten Rängen enthalten.
Befehl ist Befehl.
Was der Chef sagt, ist heiliger als alle heiligen Schriften zusammen, selbst dann, wenn er nicht in der Lage ist, Zucker und Salz am Geschmack zu unterscheiden.
Trotzdem konnte der Comandante das rektal verabreichte Zäpfchen des Subteniente natürlich nicht unkommentiert lassen, sondern erwiderte: „Anarchisten, Terroristen. Ist das nicht dasselbe?“
„Jawoll – Comandante.“
Für den Bruchteil einer Sekunde war ich irritiert.
Der Unteroffizier sagte „jawoll“ – auf Deutsch – nicht „si!“ oder „comprende“. Den Hauch eines Augenblicks lang dachte ich, sie wüssten, dass ich ihren Funkverkehr abhörte, aber dann wurde mir klar, dass der Subteniente ein noch nicht außer Dienst gestellter Veteran des Bürgerkriegs sein musste, in dem sich Generalissimo Franco von den Deutschen bekanntermaßen nicht nur hatte beraten lassen.
Die an ein Eifersuchtsdrama gemahnenden Hinweise seien eine perverse, aber leicht zu durchschauende Tarnung der „republikanischen Schweine“, erläuterte der Vorgesetzte gönnerhaft. Das würde letztlich auch die Spurenlage beweisen.
Ich überlegte kurz, ein Bekennerschreiben einer antiimperialistischen Befreiungsfront für die Autonomie der Kanarischen Inseln zu verfassen, wusste aber nicht, ob es die nicht möglicherweise sogar gab. Da meine Niedertracht nicht so weit ging, zu den ohnehin entstandenen Kollateralschäden ohne Not im Nachgang noch weitere hinzuzufügen, verwarf ich diesen Gedanken wieder. Wer gegen die Diktatur Francos opponierte, hatte es auch ohne böse Scherze schon schwer genug.
Dann folgte im Funkverkehr der beiden Guardia Civil-Offiziere der entscheidende Hinweis: Der Killer von Teguise hatte seine beiden Opfer mit dem reichlich geflossenen Blut des jungen Weinbauern signiert.
Mit einem großen roten R.
Eine elektrisierende Botschaft.
R wie Roberto.
Ein R war das für ihn typische Zeichen, was natürlich nur Insider wussten. Für die Ermittler würde es wahlweise rebelión, revolución, resistencia oder rata (Ratte) bedeuten.
Zwar musste Roberto inzwischen ebenfalls von der unglücklichen Parallelität der Ereignisse erfahren haben, doch er wusste mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht, nach wem er umgekehrt suchen musste.
Ich dagegen schon.
Roberto war trotz seiner jungen Jahre bereits eine Legende. Jeder Regisseur hätte ihm sofort Probeaufnahmen angeboten, um zu sehen, ob er neben seinem strahlenden, alle für sich einnehmenden Aussehen auch noch ein Minimum an schauspielerischen Fähigkeiten vorzuweisen hätte. Und vielen wäre selbst das egal gewesen. Eine Rolle hätte er selbst dann bekommen, wenn seine Stimme wie die von Donald Duck geklungen hätte. („Dann wird der Bursche halt synchronisiert.“)
Es ist für einen Killer immer schlecht, wenn jeder sein Gesicht nach einem flüchtigen Blick wieder erkennt und vor allem Frauen – ohnehin oft die aufmerksameren Beobachter – sich dieses Antlitz ganz unwillkürlich tief eingeprägt hätten. Aber Roberto war Profi genug und hatte sicherlich alles Notwendige unternommen, um ungesehen in die Pension hinein- und wieder herauszukommen. Er würde sogar dafür gesorgt haben, dass ihn noch nicht einmal ein zufälliger Zeuge in Teguise oder auch nur im Inselinneren gesehen hatte. Als exzellenter, zuverlässiger und vor allem kaltblütiger Auftragsmörder war er ohnehin nur in jenen Kreisen bekannt, in denen die von ihm angebotene Dienstleistung nachgefragt wurde. Wie alle in der Branche wusste auch er, sollte er erst einmal in der Kartei irgendeiner x-beliebigen Polizeibehörde auftauchen und sei es lediglich als zweitklassiger Ladendieb, er wäre seinen Job los – zumindest die lukrativen Aufträge.
Aber er war wie die meisten von der Natur mit einem umwerfenden Aussehen bevorteilten Menschen extrem eitel. Es musste sehr schwer für ihn sein, wenn man das Plus einer blendenden Erscheinung so gut wie nie ausspielen darf. Wie schon betont, für Killer gilt: Unauffälligkeit ist Trumpf. Je langweiliger und nichtssagender einer wirkt, desto leichter tut er sich mit dieser Arbeit. Filme, die uns brillante Auftragsmörder vom Schlage eines Alain Delon zeigen, gehen deshalb so gut wie immer meilenweit an der Wirklichkeit vorbei.
Um diesen Widerspruch irgendwie auszugleichen, hatte es sich Roberto, der sich mit Delon die Merkmale dunkler Haare und blau-grauer Augen teilte, angewöhnt, seine Taten wie Kunstwerke anzusehen und sie, wie es die meisten Künstler tun, zu signieren.
Vermutlich hatte er Lanzarote längst verlassen.
Für mich wäre das nur im äußersten Notfall infrage gekommen. Es ist nicht nur eine Sache der Ehre, sondern der simplen Vernunft geschuldet, tunlichst lange und möglichst unauffällig in der Nähe zu bleiben. Natürlich nicht dort, wo es von Ermittlern wimmelt, sondern dort, wo man sich, etwa als Urlauber, schon zuvor aufgehalten hat. Nirgendwo sonst erfährt ein Profi mehr über den Stand der Ermittlungen als unter vielen tausend Touristen, deren Erholungsalltag auf einmal durch ein höchst aufregendes Ereignis zusätzliche Farbe bekommen hat. Touristen wie auch Einheimische, jeder dieser Menschen ist ein potenzieller Spion. Selbstverständlich muss man die Spreu vom Weizen trennen, aber es ist nun mal so, nach einer solchen Tat wird darüber geklatscht, was die mitunter magere Faktenlage auch hergeben mag. Da hat eine von der Freundin eines anderen, die jemanden bei der Polizei kennt, was gehört und so können sich mitunter in einem wüsten Meer von falschen Einschätzungen, Theorien und Gerüchten kleine Info-Perlen verbergen, die sich als extrem nützlich erweisen können.
Dennoch lag die Chance, Roberto noch auf Lanzarote anzutreffen, höchstens bei fünfzig Prozent. Andererseits hatte ich während der restlichen Zeit meines gebuchten Aufenthalts nichts anderes zu tun, als nach ihm zu suchen. Ich ging einfach mal von der Annahme aus, Roberto würde ähnlich überlegt handeln wie ich und zuerst dafür sorgen, das so plötzlich halbierte Honorar in Sicherheit zu bringen, an einen Ort, wo es zugleich sicher und zu gegebener Zeit leicht wiederzufinden war, also keine Gefahr bestand, dass jemand anderes zufällig darüber stolpern würde. Viel Bargeld im Handgepäck ist ein Risiko, das niemand in solchen Situationen gerne eingeht.
Plätze, um derartige Schätze zu verstecken, gibt es auf Lanzarote zur Genüge. Der beste aber war damals jene weitläufige Felslandschaft am Fuß der Montañas del Fuego. Heute gehört diese Gegend zum Timanfaya-Nationalpark, eines der beeindruckendsten Vulkangebiete der Welt.
Durch die mit zahllosen, zum Teil haushohen schwarzen Lava-brocken übersäte, viele Quadratkilometer große Ebene führen nur eine Handvoll kaum begeh- und noch viel weniger befahrbare Pfade, die sich schnell im Labyrinth der gewaltigen Felsen verlieren. Knirschendes, spitzes und messerscharfes Gestein unter den Sohlen macht jeden Schritt zum Abenteuer.
Eine Welt schwarz in schwarz.
Ganz nach meinem Geschmack.
Neben der Frage, ob das wirklich eine gute Gegend ist, um Geld zu verstecken, bleibt sehr viel Wichtigeres offen: Ist Roberto noch auf der Insel? Wird die nächste Folge wenigstens darauf eine Antwort bereithalten?
FOLGE 4
WAS BISHER GESCHAH
Dr Crıme sucht ein Versteck für sein Geld,
während Leons Auftauchen auf dieser Welt und in
dieser Geschichte noch in ferner Zukunft liegt …
Eine Welt schwarz in schwarz.
Ganz nach meinem Geschmack.
Reizvoll und heikel zugleich waren die Kamine und Schlote, die unvermittelt vor einem im Boden auftauchten, so als wären sie gerade eben noch nicht da gewesen. Sie klafften natürlich schon seit langem dort, waren aber wegen der ringsum vorherrschenden Schwärze manchmal erst zu sehen, wenn man direkt vor ihnen stand. Ich spreche hier nicht von dunklen Neumondnächten, in denen ein Ausflug in dieses Gebiet nur für Selbstmörder reizvoll gewesen wäre, sondern von jenem hellen, sonnendurchfluteten Tag, als ich vor der Erledigung meines Auftrags dieses Gelände zum ersten Mal erkundet hatte. Schließlich war ich auf Lanzarote vor allem Tourist. Ein ehrgeiziger Tourist, der die Stätte seiner Erholung besser kennenlernen wollte als mancher Einheimische.
Jedenfalls waren diese heimtückischen Löcher senkrecht in unergründliche Tiefen reichende Schächte von ein bis zwei Metern Durchmesser, durch die einst kochendes Magma an die Oberfläche gepumpt worden war. Und die den Eindruck erweckten, genau dies in jedem Moment wieder tun zu können.
Heute kommt man als Urlauber nicht mehr so leicht in dieses lebensfeindliche und nicht ganz ungefährliche Areal. Damals aber kümmerte es niemanden, wenn sich turistas necios, idiotische Urlauber, in der vulkanischen Trümmerwüste verirrten. Es trauten sich ohnehin nur die wenigsten dort hinein. Zu abweisend und unzugänglich ist dieses Gebiet, das schon von außen vor allem eines verspricht: Das monotone Grauen einer schwarzen Wüste, die dem Lebensmüden nach wenigen Schritten lediglich dann verrät, aus welcher Richtung er gekommen ist und wohin er zurück muss, wenn er sich den Stand der Sonne gemerkt hat.
Doch nicht einmal die schien an diesem Tag, als ich hierhin zurückkam, um ein Depot zu eröffnen.
Ein-, zweimal im Jahr erfährt Lanzarote ein Wetterphänomen, durch das das übliche, regenarme, mild-sonnige, von beständigen Brisen durchwehte Atlantikklima von einem Vorgeschmack auf die Hölle abgelöst wird. Normalerweise wird es selbst im Hochsommer kaum wärmer als 27 Grad, während im Winter die Temperaturen um 17 Grad Celsius betragen. Heute jedoch hatte der Calima für eine Hitzewelle von 40 Grad und mehr gesorgt und zudem einen rot-braunen Vorhang über die Welt gezogen. Ich konnte kaum hundert Meter weit sehen. Die Sahara-Staub-Aerosole schluckten nicht nur die Sicht, sondern auch die Geräusche. Kurz – es herrschten die idealen Bedingungen, um im vulkanischen Labyrinth jenes Geld zu verstecken, das als Teilzahlung für meinen Mord an Mr. X geflossen war.
Direkt neben der Straße, wo ich meinen Wagen am Rand zwischen zwei wuchtigen tonnenschweren Felsbrocken geparkt hatte, die mir als Wegmarken dienten, begann ein kurzer Stichweg, der etwa hundert Meter mitten in das Gelände hineinführte und dann abrupt inmitten der Ödnis vor einer gewaltigen, drei bis vier Meter hohen vulkanischen Trümmerwand endete. Schon vorher waren schmale, kaum als Wege zu bezeichnende Pfade rechts und links abgegangen. Ich wählte einen von ihnen und merkte mir genau, wo ich den Hauptweg verlassen hatte. Auch an klaren hellen Tagen wäre ich nun vor fremden Blicken geschützt. Ich schob die Tasche mit dem Geld in einen Felsspalt und wuchtete einen scharfkantigen, knapp einen halben Meter hohen Felsbrocken davor, an dem ich mir die Handflächen aufschnitt. Die Arbeitshandschuhe, die ich mir extra für solche Aufgaben besorgt hatte, lagen im Wagen. Ich entschuldigte meine Vergesslichkeit mit Hitze und Staub. Damit zufällige Blicke eines hier Vorbeikommenden, so unwahrscheinlich das auch war, nichts anderes als tiefschwarzes Geröll wahrnehmen würden, deckte ich das Versteck auch von oben sorgfältig ab. Ich starrte darauf und prägte mir die unmittelbare Umgebung gründlich ein.