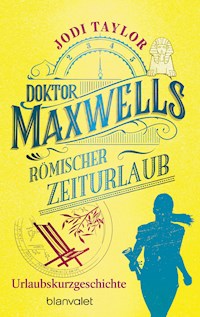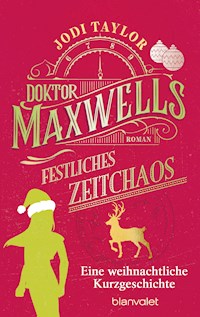6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die englische Bestseller-Autorin Jodi Taylor legt mit "Draußen wartet die Liebe" einen warmherzigen Frauen-Roman vor, voller poetischer Bilder und britischem Witz. Ihre Heldin Jenny entwickelt sich in dieser charmanten Liebes-Geschichte vom schüchternen Entlein zum selbstbewussten Schwan, von einem Mädchen ohne Freunde zur glücklich verliebten Frau – eine moderne Aschenputtel-Geschichte, anrührend, liebevoll und originell. Wenn man 28 Jahre alt ist und schrecklich schüchtern, furchtbar stottert und von Onkel und Tante quasi vor der Welt versteckt wird, dann braucht es eine gehörige Portion Mut, um das Leben endlich in die eigenen Hände zu nehmen. Doch unterstützt von Thomas, dem wohl zauberhaftesten imaginären Freund der Welt, und von Russel, dem chaotischen Maler mit seinem heruntergekommenen britischen Landhaus und dem Herz voller Liebeskummer, greift Jenny schließlich mit beiden Händen nach dem, was ihr neues Leben werden wird – entschlossen, es nie wieder herzugeben. Ein Liebes-Roman so "very british", gefühlvoll und witzig wie ein Hugh-Grant-Film!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Jodi Taylor
Draußen wartet die Liebe
Roman
Aus dem Englischen von Alexandra Baisch
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Eine moderne Aschenputtel-Geschichte, anrührend, liebevoll und originell.
Wenn man 28 Jahre alt ist und schrecklich schüchtern, furchtbar stottert und von Onkel und Tante quasi vor der Welt versteckt wird, dann braucht es eine gehörige Portion Mut, um das Leben endlich in die eigenen Hände zu nehmen. Doch unterstützt von Thomas, dem wohl zauberhaftesten imaginären Freund der Welt, und von Russel, dem chaotischen Maler mit seinem heruntergekommenen britischen Landhaus und dem Herz voller Liebeskummer, greift Jenny schließlich mit beiden Händen nach dem, was ihr neues Leben werden wird – entschlossen, es nie wieder herzugeben.
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Epilog
1. Kapitel
Letztendlich hatte ich mich dann doch nicht umgebracht. Nicht, dass ich es nicht versucht hätte. Tatsächlich traf ich alle Vorkehrungen mit der Gründlichkeit eines dreizehnjährigen Mädchens, dessen Lehrer besagte »Gründlichkeit« immer lobten, weil ihnen sonst nichts zu ihm einfiel. Sorgfältig hatte ich alle Mittel und Wege erwogen und meine Entscheidung gefällt.
Ich hatte mich gegen das Aufschneiden der Pulsadern entschieden, vermutlich aufgrund der Schweinerei. Irgendjemand würde sie hinterher beseitigen müssen. Man hatte mir aber beigebracht, ordentlich zu sein. Nicht viel Aufhebens zu machen. Ich weiß schon, die Badewanne wäre dafür gut geeignet, aber ich wollte ganz bestimmt nicht unbekleidet gefunden werden, und so fiel meine Wahl auf Paracetamol. Ich hortete es, achtete sorgfältig darauf, immer mal wieder ein Päckchen zwischen anderen harmloseren Einkäufen zu verstecken; ich wusste nicht genau, wann, nur dass es irgendwann bald zum Einsatz kommen würde.
Und so war es auch. Das Wochenende verlief nach dem üblichen Schema. Wie immer war da die Freitagabend-Euphorie. Die Schulwoche war zu Ende. Ich hatte zwei ganze Tage vor mir, an denen ich nicht einmal einen Gedanken daran verschwenden musste. Der Montag war noch eine halbe Ewigkeit entfernt. Ich war glücklich; selbst wenn das in meinem Fall nur bedeutete, nicht trübsinnig zu sein. Ich wachte am Samstagmorgen auf – keine Schule. Jippie! Am Samstagnachmittag dachte ich jedoch bereits, »morgen um diese Zeit bin ich schon wieder fast zurück in der Schule«, und etwas Dunkles überschattete meine Gedanken.
Am Sonntag war mein erster Gedanke, »morgen bin ich wieder in der Schule«, und somit verbrachte ich den restlichen Tag in ängstlicher Erwartung vor der kommenden Woche. Bis zum Sonntagabend war ich nur noch ein kleines Häufchen Elend in der Ecke meines Zimmers. Und der Tag danach war dann – natürlich – der Montag.
Aber jetzt nicht mehr. Das war mein letzter Montag gewesen. Der letzte Dienstag, Mittwoch und der ganze Rest. Das war mein letzter Sonntagabend. Es würde keinen weiteren Montag geben.
Zuerst nahm ich ein entspannendes Bad. Überraschenderweise war ich ziemlich ruhig. Ich hatte gedacht, ich würde vielleicht nervös sein, doch das Wissen, mich der Welt niemals wieder stellen zu müssen, verlieh mir die nötige Entschlossenheit. Es tat gut loszulassen. Sorgfältig bürstete ich mir die Haare, zog meine Lieblingsjeans und mein Lieblingsoberteil an und lehnte mich dann in die Kissen zurück. Ich hatte alles zusammengetragen, was ich brauchte – schließlich bin ich ja gründlich: Wasserkaraffe, Glas und drei Schachteln Paracetamol. Keine Nachricht. Mir lag nicht daran, andere leiden zu lassen. Ich überlegte, wie lange es wohl dauerte, bis sie mich fanden. Wenn ich morgen nicht in der Schule auftauchte, würden sie dann einfach davon ausgehen, dass ich einen weiteren Arzttermin wahrnahm, über den ich sie wieder einmal nicht informiert hatte? Nie sagten sie etwas, weil sie nicht diejenigen sein wollten, die auf dem Mädchen mit den Problemen herumhackten. Natürlich nur für den Fall, dass sie sich überhaupt daran erinnerten, wer ich war. Wie sollte ich ihnen vorhalten, dass sie das nicht konnten? Manchmal konnte ich mich ja selbst kaum an mich erinnern.
Keine Ahnung, ab wann meine Familie mich vermissen würde. Vielleicht wenn ich anfing zu stinken.
Ich hatte mir auch keine Mühe mit einem Testament gemacht. Zum einen, weil ich erst dreizehn Jahre alt war, hauptsächlich aber, weil meine Eltern tot waren und ich bei meinem Onkel und meiner Tante lebte. Ich hatte das Geld meiner Eltern geerbt, und jetzt würde es an sie gehen. Mein Onkel ist Anwalt. Ich weiß solche Sachen. Nicht, dass sie es nötig hätten. Sie waren selbst nicht gerade arm.
Da war ich also, bereit loszulegen. Als Mittel, nicht mehr in die Schule zu müssen, war es vielleicht etwas übertrieben – ein Vorschlaghammer, um eine Walnuss zu knacken –, aber ich hielt es einfach nicht länger aus. Mein bisheriger Lebensweg war zwar nicht sehr lang, dafür aber sehr schmerzhaft gewesen, außerdem war keine Besserung in Sicht, also wollte ich jetzt gehen, ehe es noch schlimmer wurde. Es war unwahrscheinlich, dass die Welt mich vermissen würde. Oder gar wahrnehmen.
Jahre später nannte mich jemand einmal das nichtssagende Mädchen. Zugegeben, es war ein emotionaler Moment, in dem Neid, Hass und Untreue nur so durch den Raum flogen und alles verletzten, was ihnen in die Quere kam. Doch vor all diesen Jahren, als ich erst dreizehn war und darum kämpfte, meinen Platz in dieser Welt zu finden, war ich genau das.
Das nichtssagende Mädchen.
Inzwischen weiß ich, dass es andere Menschen wie mich gibt. Menschen, die aus Versehen oder mit Absicht durch die Spalten im Leben fallen. Und keiner bemerkt es. Man ruft, aber niemand hört einen. Man geht unter, aber niemand sieht es. Man wird nicht übersehen, denn das würde ja bedeuten, dass man überhaupt erst einmal wahrgenommen werden müsste. Ich spreche von Leuten wie mir – von Geistern im eigenen Dasein. Die sich Schmerzen zufügen, nur um herauszufinden, ob sie noch am Leben sind.
Ich wischte eine Träne weg, nahm eine Blisterpackung, drückte die ersten beiden Tabletten heraus und schluckte sie mit etwas Wasser. Ich wollte schon zwei weitere einwerfen, als eine Stimme wie aus dem Nichts sagte: »Ich finde, zwei reichen, meinst du nicht auch?«
Vor lauter Schreck wäre ich fast vom Bett gefallen. Ich weiß nicht, was ich dachte. Ein auf unerklärliche Weise aufgetauchter Onkel Richard? Ein Einbrecher? Gott?
Ich krabbelte vom Bett, verteilte dabei überall Blisterpackungen und fragte: »Wer ist da? Wer spricht da?«
Das war der zweite heftige Schock für mich an diesem Abend, denn mir wurde klar, dass ich ganz normal sprach.
Das gibt es bei mir sonst nicht. Ich stottere nämlich. Eine ziemlich doofe Sache. Als Kind hatte ich leicht gestottert, wenn ich wütend oder verängstigt war. Nach dem Tod meiner Eltern wurde es immer schlimmer, bis ich das Gefühl hatte, ich müsste die Wörter aus meinem tiefsten Inneren regelrecht ausgraben, und jedes einzelne gesprochene Wort höhlte mich irgendwie aus. Außerdem war es schrecklich mühsam. Und es dauerte so lange. Zuerst zeigten sich die Leute ganz unterschiedlich verständnisvoll. Sie warteten geduldig, bis ich mich durch einen Satz gekämpft hatte, wodurch ich mich schlecht fühlte. Oder sie beendeten die Sätze für mich, wodurch ich mich noch schlechter fühlte. Also sagte ich immer weniger, und inzwischen spreche ich fast gar nicht mehr. Ganz bestimmt platzte ich jedoch nicht ohne viel Stammeln und Stottern und der beinahe übermenschlichen Anstrengung, die meine Klassenkameraden immer zum Lachen brachte, mit einem »Wer ist da? Wer spricht da?« heraus.
Merkwürdigerweise empfand ich keine große Angst. Schließlich war ich gerade dabei, mir das Leben zu nehmen. Was sollte da noch schlimmer werden? Ich glaube, ich war eher verärgert als verängstigt. Ich hatte es bis hierher geschafft – das war die wichtigste und vermutlich auch die letzte Handlung in meinem Leben –, und jetzt sagte mir jemand, zwei Paracetamol seien ausreichend, als plagten mich nur leichte Kopfschmerzen und nicht etwa ein so unerträgliches Leben, dass ich nicht länger darin gefangen sein wollte.
In diesem Moment höchster Dramatik, als ich in die im Schatten liegenden Ecken meines Zimmers starrte, nahm ich den Geruch von warmen Ingwerkeksen wahr. Ja, okay, ich war damals erst dreizehn. Und Kekse spielten eine große Rolle in meinem Leben. Außerdem war der Geruch vertraut und beruhigend.
Ich beugte mich zur Nachttischlampe und stellte sie heller. Der kleine Lichtfleck um mein Bett wurde größer, und die Dunkelheit zog sich etwas zurück. In gebührendem Abstand, auf der anderen Seite beim Schrank, stand ein riesiges goldenes Pferd.
Ein echtes Pferd. Kein Bild oder eine Projektion. Ein sehr echtes, sehr massives, sehr großes Pferd. Ohne es laut auszusprechen, fragte ich mich: »Bist du eine Halluzination?«
»Ich finde, Traumbild ist ein sehr viel schöneres Wort, findest du nicht, Jenny?«
»Bist du ein Traumbild?«
»Nein.«
»Stelle ich mir dich nur vor?«
»Nein.«
»Bin ich tot?«
»Nein.«
»Was bist du?«
Überrascht schaute es an sich herunter. »Ich bin ein Pferd!«
Einen Moment lang starrten wir einander an.
»Warum bist du hier?«
»Ich will dein Freund sein.«
Das klang zu schön, um wahr zu sein, und ich weigerte mich, es zu glauben. So etwas wie Freunde hatte ich nun einmal nicht.
»Wie bist du reingekommen? Können Pferde Treppen steigen?«
»Ich kann überall da hingehen, wo du hingehst. Weil ich dein Freund bin.«
Ich lehnte mich wieder zurück und starrte das Wesen an. Es hatte recht. Es war ein Pferd, das schönste, das ich je gesehen hatte. Und ganz bestimmt auch das größte. Es war golden und erstrahlte sanft im Licht der Lampe. Seine Mähne war lang und cremefarben, genau wie sein Schweif, den es sachte hin und her schwingen ließ. Sein Schopf zwischen den Ohren verdeckte leicht den weißen Stern auf seiner Stirn und zwei große dunkle Augen.
Seine Ohren zuckten, und es verlagerte leicht das Gewicht. Ich stellte mir mit einem Mal einen riesigen Haufen Pferdeäpfel auf Tante Julias teuer glänzendem Holzboden vor.
Es schnaubte, schien zu lachen, und das war witzig, aber ich versuchte noch immer, mit einem riesigen goldenen Pferd in meinem Zimmer und einem bislang nicht ganz durchgeführten Selbstmordversuch klarzukommen. Deshalb war ich auch ein klein wenig betrübt über diese Unterbrechung. Selbstmord ist eine ernste Sache.
»Warum jetzt?«
»Ich glaube, wir beide kennen die Antwort darauf.«
»Bist du etwa hier, um mich aufzuhalten?«
»Das muss ich nicht«, sagte es ruhig. Es senkte den Kopf und betrachtete die Bücher in meinem Regal.
»Warum musst du mich nicht aufhalten? Das kannst du außerdem gar nicht, ist das klar? Ich werde das durchziehen.«
Es drehte sich wieder weg vom Bücherregal. »Nein, wirst du nicht.«
»Du kannst mich nicht davon abhalten«, wiederholte ich und versuchte, nicht zu bockig zu klingen.
»Jenny, lass uns nicht gleich mit einem Streit anfangen. Du kannst mir sagen, was immer du willst. Tatsächlich hoffe ich sogar, dass du genau das machst. Ich bitte dich nur darum, ehrlich mit mir zu sein. Wenn du mich belügst, belügst du dich selbst.«
Ich war wütend. »Ich will, dass du verschwindest.«
»Nein, willst du nicht.«
»Doch. Geh weg. Du machst mir Angst.«
»Nein, mache ich nicht.«
»Ich rufe meinen Onkel.«
»Und was willst du ihm sagen?«
Das ließ mich verstummen. Ich hatte schon mehr als genug »Arzttermine« gehabt. Da fehlte es mir gerade noch, nach unten zu poltern und zu verkünden, dass sich ein riesiges, sprechendes Pferd in meinem Zimmer aufhielt.
»Jenny«, sagte es leise. »Nimm die ganzen Packungen und wirf sie weg.«
»Nein«, erwiderte ich und presste sie an mich.
»Du wirst es nicht tun.«
»Doch. Wohl.«
»Nein, wirst du nicht.«
»Das weißt du nicht. Woher willst du das wissen?«
»Weil du deine Hausaufgaben gemacht hast.«
»Was?«
»Du hast deine Hausaufgaben für Montag gemacht. Sie liegen da drüben. Ein Aufsatz über Julius Cäsar, zwei Seiten Übersetzung für Deutsch und dann noch etwas, das aussieht wie … ja … eine Seite mit Gleichungen. Die zweite ist übrigens falsch, aber alle anderen sind richtig. Gut gemacht.«
Ich hielt unvermittelt inne, kämpfte mit dem, was das bedeutete. Es hatte recht. Ich hatte meine Hausaufgaben gemacht. Obwohl ich vorgehabt hatte, mich am Sonntagabend umzubringen, hatte ich meine Hausaufgaben für Montag gemacht. Und als ich mich jetzt in meinem Zimmer umsah, sah ich auch, dass meine Sachen für Montag hergerichtet waren. Meine Uniform hing im Schrank. Meine Schuhe waren geputzt und einsatzbereit. Nun ja, ich habe doch gesagt, dass ich gründlich bin. Ich versuchte, darüber nachzudenken, was das bedeutete, und brach schließlich in Tränen aus.
Ich hörte, wie das Pferd durch das Zimmer auf mich zukam. Sein Atem strich warm und beruhigend durch meine Haare. Da war wieder dieser Geruch nach Ingwerkeksen. Es stand zwischen mir und der Tür. Mein Schutzschild gegen die Welt.
»Ist schon gut«, sagte es liebevoll. »Es ist wirklich alles gut, Jenny. Du musst einfach abwarten und Tee trinken.«
Ich fuhr mir mit dem Ärmel über die Nase. »Warum bist du hier? Warum ich?«
Niemals vergaß ich seine Antwort.
»Weil du etwas Besonderes bist, Jenny.«
So habe ich Thomas getroffen. Als ich nach seinem Namen fragte, sagte das Pferd: »Thomas.« Bestimmt war es einfach nur Zufall, dass mir dieser Name schon die ganze Zeit durch den Kopf gegangen war.
Fünf Jahre später verließ ich die Schule mit guten Noten; jedenfalls besseren als meine beiden Cousins. In einer perfekten Welt hätte Francesca natürlich Schönheit und Christopher Intelligenz besitzen müssen. Tja, das war dem Universum wohl etwas missglückt. Francesca war tatsächlich wunderschön. Christopher dagegen besaß leider die Intelligenz eines Regenwurms und nicht ganz so viel Persönlichkeit. Er war ein Reinfall auf der ganzen Linie. Obwohl seine Eltern und seine Schwester groß waren, hatte er es geschafft, deutlich unter der Durchschnittsgröße zu bleiben. In einer gutaussehenden Familie sah er nicht nur gewöhnlich aus, sondern war geradezu farblos. Zehn Minuten nachdem er verschwunden war, würde man sich nur mit Mühe an ihn erinnern können. Er machte das damit wett, dass er unausstehlich war. Sein einziges Talent waren völlig überzogene Vorstellungen hinsichtlich seiner Fähigkeiten. Er glaubte ernsthaft, er wäre etwas Besonderes, und jedes Mal, wenn seine verschiedenen Geschäfte spektakulär scheiterten, wie sie das unweigerlich immer taten, war er der felsenfesten Überzeugung, die Schuld daran läge bei allen anderen. Er war so dumm, dass er es geschafft hatte, die einzige Buchhandlung in Rushford zu übernehmen und langsam zugrunde zu richten. Weiß Gott, wie viel Geld Onkel Richard da reinsteckte, damit er nicht pleiteging. Aber so war es nun mal. Christopher bekam, was Christopher wollte. Obendrein war er nämlich ein feiger, gehässiger Tyrann, der mit Begeisterung Schwächere quälte. Ich wusste, wovon ich sprach. Ich erinnere mich daran, wie Russell Checkland ihn, als ich ein Kind war, mehrfach von mir wegreißen musste.
Und keiner erwähnte gute Noten und Francesca in einem Satz. Sie brauchte auch keine.
Und so führten die beiden ein behagliches Leben. Bei mir tat sich die nächsten zehn Jahre erst einmal nichts. Nach dem, was Tante Julia mir an jenem Tag eröffnet hatte, achtete ich darauf, nicht aufzufallen und ein nettes, ereignisloses Leben zu führen.
Dieses schicksalhafte Gespräch war die Folge meines Versuchs, mir etwas mehr Freiraum zu erobern. Ich hatte mir ein Herz gefasst und meiner Tante nervös ein paar Broschüren und Prospekte von Universitäten gezeigt. Aufmerksam ging sie alle durch, nutzte die Zeit, um zu überlegen, was sie sagen sollte. Ich dachte, sie sei verletzt, weil ich das Zuhause verlassen wollte, aber es war schlimmer als das.
»Jenny, Liebes.« Sie hielt inne.
Ich nahm einen tiefen, beruhigenden Atemzug, ordnete meine Worte, als wären sie widerspenstige Schafe. »I-i-ich … mag die hier. Schau dir den G-G-Geschichtslehrplan an.«
Natürlich brachte ich das nicht ganz so problemlos heraus wie hier, aber wenn ich tatsächlich jedes Stottern abtippen würde, würde es ewig dauern, und es zu lesen ist noch lästiger, als es sich anzuhören. Sie müssen sich das jetzt einfach vorstellen.
»Jenny«, setzte sie erneut an.
»D-d-du schaust sie ja g-g-gar nicht an.«
»Jenny. Ich hatte so sehr gehofft, wir würden diese Unterhaltung nicht führen müssen. Du musst mir jetzt sehr genau zuhören. Natürlich sind dein Onkel und ich sehr erfreut über deinen guten Schulabschluss. Es ist schön zu sehen, wie gut du zurechtkommst.«
Tief in mir ballte sich etwas zusammen. Ich konnte fast sehen, wie meine Worte unbeschwert aus dem Fenster flogen und mich weit hinter sich zurückließen – ich würde niemals abheben.
»Liebes, die Sache ist die … ach herrje, das ist so schwierig. Jenny, du lebst inzwischen schon sehr lange mit uns, und wir hatten gehofft, du würdest für immer bei uns wohnen bleiben.«
Thomas stand hinter mir und blies mir sanft in die Haare. Ich konnte ihn nicht sehen, wusste aber, dass er da war. Er war immer für mich da. »Bleib ganz ruhig. Atme langsam. Warte erst mal ab, was sie zu sagen hat.«
»Weißt du, vor ein paar Jahren, du erinnerst dich doch, da hatten wir die ganzen Arzttermine mit dir, und die Sache ist die, also, sie wollten, dass du … in einer speziellen Anstalt lebst, wo du davon profitieren könntest, mit anderen wie dir zusammen zu sein.«
»Wie mir?«, platzte ich heraus.
»Ja. Wir lieben dich, Jenny, das weißt du. Dein Onkel und ich, deine Cousins Christopher und Francesca, wir sind deine Familie. Wir wissen, wie schwierig es für dich ist, eine … Beziehung zu anderen aufzubauen. Wir sagen den Leuten, du wärst ruhig und schüchtern, aber das ist nicht alles. Und das weißt du auch. Wir, dein Onkel und ich, waren natürlich schrecklich entsetzt. Niemals würden wir dich an einem solchen Ort unterbringen. Also hat dein Onkel mit ihnen gesprochen, und sie waren schließlich einverstanden und erachteten es als ausreichend, wenn wir eine ruhige und sichere Umgebung für dich schaffen würden, damit du weiter bei uns leben könntest. Und das hat so wunderbar funktioniert. Du hast zurückgezogen bei uns gelebt, ein normales Leben geführt und bist auf eine normale Schule gegangen. Aber das ist die Abmachung, Jenny. Du musst bei uns wohnen bleiben … es tut mir leid, Liebes, aber du musst einsehen, dass es so zu deinem Besten ist. Du bleibst hier, ohne Stress, ohne Druck. Solange du hier bei uns bist, kannst du ein nettes Leben haben. Die Alternative dazu würde dir überhaupt nicht gefallen. Jetzt verstehst du, weshalb wir dich nicht aufs College schicken können. Es tut mir schrecklich leid.«
Hinter mir sagte Thomas in einem Tonfall, den ich noch nie bei ihm gehört hatte: »Es ist sehr wichtig, dass du jetzt ruhig bleibst. Schnapp dir die Broschüren, nimm dir Zeit, sie zu ordnen. Stapel die größeren unten und leg die kleineren obenauf. Mach das bitte jetzt.«
Und das tat ich. Schließlich war ich es gewohnt, das zu tun, was man mir auftrug. Ich betrachtete meine Hände, die die College-Unterlagen sorgfältig sortierten, und konzentrierte mich auf meine Atmung.
Tante Julia fuhr hastig fort: »Ich bin froh, dass du es so gut aufnimmst, Jenny. Das zeigt einfach, wie gut du zurechtkommst, wenn du zu Hause ein sicheres Umfeld hast.«
Ich sagte noch immer nichts, legte die Broschüren vorsichtig auf dem Couchtisch ab.
»Sobald dein Onkel heute Abend heimkommt, werde ich mit ihm sprechen. Ich hoffe, das war kein zu großer Schock für dich.«
Ich lehnte mich zurück. Die aufgestauten und einander blockierenden Worte und Emotionen flauten langsam wieder ab. Ich sah zu Tante Julia, lächelte sie unsicher an und nickte.
»Ich wusste, dass du das verstehen würdest. Außerdem glaube ich nicht, dass das Studentenleben etwas für dich wäre, meine Liebe. Da geht es manchmal recht turbulent zu. Das würde dir nur Angst machen. Du weißt doch, wie schüchtern du bist.«
Wieder nickte ich.
»Jetzt gehst du schnell auf dein Zimmer, und ich bitte Mrs. Finch, dir eine schöne Tasse Tee hochzubringen.«
Thomas und ich schleppten uns zurück in mein Zimmer. Ich hatte Angst und zitterte. Ich setzte mich aufs Bett und wiegte mich vor und zurück. Etwas stimmte nicht mit mir. Ich war nicht normal. Sie hätten mich fast in eine Anstalt gegeben. Das könnten sie noch immer.
Aus dieser speziellen Unterhaltung ergaben sich drei Dinge. Onkel Richard kam am Abend zu mir hoch und schlug vor, ich könne doch ein Fernstudium machen. Er sagte das so freundlich, dass ich in Tränen ausbrach. Er meinte, es sei eine Schande, einen so guten Schulabschluss zu vergeuden; dass ein Studium zu mir passen würde; dass ich ein schlaues, kleines Mädchen sei. Er wollte ein paar Kursinformationen für mich zusammenstellen, die ich dann durchgehen könnte.
Ich hörte auf zu weinen, schluckte und nickte.
»Und, Jenny, wenn du ein Fernstudium machst, dann brauchst du einen richtig guten Computer. Erlaubst du, dass deine Tante und ich dir ein … ein … ›Schulabschlussgeschenk‹ machen? Hättest du gern einen neuen Laptop?«
Wieder nickte ich.
Er lächelte. »Und natürlich brauchst du auch ein Zimmer, um zu studieren. Komm mal mit.«
Wir traten auf den Treppenabsatz, öffneten die Tür und gingen nach oben auf den großen Dachboden mit seinen drei Gauben. Der Boden war mit Brettern ausgelegt, und da er zu Tante Julias Bereich gehörte und ihren Regeln unterlag, herrschte hier oben kein Chaos, und es war fast nicht staubig. Nur ein paar zusammengefaltete Kartons lagen in einer Ecke.
Thomas war uns nach oben gefolgt. »O ja!«, sagte er begeistert und durchquerte den Raum, um aus dem Fenster zu sehen. »Daraus könnten wir wirklich etwas machen. Das Bett hier, Bücherregale überall an den Wänden, Schreibtisch oder Tisch unter dem Fenster, da drüben ein Fernseher, Teppiche, Kunstwerke und das alles. Und da drüben in der Ecke dein eigenes Badezimmer.«
»Was?«, sagte ich lautlos. »Das alles werden sie niemals machen.«
»Sie fühlen sich schuldig. Lass es darauf ankommen, solange du kannst. Ich gehe davon aus, dass du hier oben ganz schön viel Zeit verbringen wirst.«
Also versuchte ich es. Mit Thomas, der mir von hinten soufflierte, tat ich so, als wäre ich Francesca, und bat um alles, was mir in den Sinn kam. Weder Onkel Richard noch Tante Julia hatten Einwände oder versuchten, mir etwas auszuschlagen. Ich bekam alles, was ich wollte. Einen wunderschönen Raum, warm und voller Licht. Viel Platz für meine Bücher, einen großen Tisch, an dem ich arbeiten konnte. Ich wählte meine Lieblingsfarben – keiner widersprach. Ich dachte, Tante Julia, die an den Gott der Farbkoordination glaubte, würde Einspruch erheben, aber ich bekam alles so, wie ich wollte. Sechs Monate später hatte ich meinen kleinen Palast.
Allerdings sollte Thomas recht behalten. Wir verbrachten sehr viel Zeit in meinem Zimmer. Inzwischen waren fünfzehn Jahre vergangen, ich ertrug diesen Anblick nicht mehr, und als Russell Checkland mich fragte, ob ich ihn heiraten wolle, sagte ich ja.
Die Schuld dafür können Sie Thomas in die Hufe schieben. Ich zumindest tue das.
Ich war allein zu Hause, als es an der Tür klingelte. Tante Julia und Francesca waren shoppen. Selbst Mrs. Finch war ausgegangen.
»Na los, mach die Tür auf«, sagte Thomas, bewegte sich aber keinen Zentimeter vom Fernseher weg.
»Warum ich?«
»Ich bin ein Pferd. Ich öffne keine Haustüren.«
Ich seufzte theatralisch. »Sag mir, was passiert.«
Ängstlich ging ich die Treppe nach unten und stellte erleichtert fest, dass es nur Daniel Palmer, Francescas Verlobter, war.
»Schönen Abend«, sagte er beim Eintreten. »Du machst es richtig, bei diesem ganzen Regen drinnen zu bleiben, Jenny.« Das war nett von ihm, tatsächlich war ich nämlich gar nicht zum Shoppen eingeladen worden. Oder auch nur darüber informiert. »Ist Francesca schon zurück? Ich sollte sie vor zehn Minuten abholen. Ist sie da?«
Ich schüttelte den Kopf und bedeutete ihm, ins Wohnzimmer zu gehen. Freundlich plaudernd ging er voraus, schüttelte den Regen aus seinem ergrauenden Haar und wischte sich mit dem Ärmel über sein nasses Gesicht. In der dicken Jacke wirkte er massiger, als er war, dabei war er keineswegs dick. Tatsächlich war er nicht sehr viel älter als Franny, auch wenn sein stark zerfurchtes Gesicht und seine ruhige Art ihm diesen Anschein gaben. Und ich nehme an, regelmäßig mit Francesca zu verkehren reichte aus, um jemanden vorzeitig altern zu lassen. Ich mochte Daniel Palmer. Er redete zur Abwechslung mit mir und formulierte seine Fragen für gewöhnlich so, dass ich sie mit Ja oder Nein beantworten konnte.
Jetzt ist es wohl an der Zeit, über diese ewig interessante Dreiecksbeziehung zu sprechen: Daniel Palmer, Russell Checkland und Francesca Kingdom.
Ich kannte Russell seit der Kindheit. Er, Francesca und ich waren etwa gleich alt. Christopher war drei Jahre älter und hatte seine eigene Gruppe ihm ebenbürtiger unangenehmer Freunde, also bekamen wir ihn nicht viel zu sehen. Tatsächlich bekam ich auch von Russell und Francesca nicht viel zu sehen, aber manchmal erlaubten sie mir, zehn Minuten mit ihnen herumzuziehen, ehe sie mich stehenließen.
Francesca war ein hübsches Kind, das zu einer atemberaubend schönen Frau heranwuchs. Sie hat dichtes, dunkles rotes Haar, das sich üppig um ihren Kopf lockt, grüne Augen und makellose, milchweiße Haut. Sie ist groß, hält sich spielend schlank und bewegt sich anmutig. Sie hat die Intelligenz einer Teekanne, aber das ist allen so ziemlich egal, allen voran Francesca. Sie hat alles, was sie braucht, um zurechtzukommen.
Und wie sie zurechtkommt. Es dürfte nicht überraschen, dass man ihr das Zeug zum Topmodel bescheinigte, woraufhin sie beschloss, genau das zu werden. Sie und Tante Julia gingen nach London, beauftragten einen überaus teuren Fotografen und verschickten die Aufnahmen an Modelagenturen. Ebenso wenig überrascht es, dass sie von der besten ausgewählt wurde und damit dann ihr Glück machte.
In London traf sie auch erneut auf Russell, der seinerseits sein Glück in der Stadt versuchen wollte. Er hatte ein Kunststudium absolviert, und seine Gemälde erregten bei den wichtigen Leuten beachtliche Aufmerksamkeit. Augenscheinlich war es Liebe auf den ersten Blick, und schon kurz darauf zog das aufsteigende junge Model mit der vielversprechenden Zukunft bei dem aufsteigenden jungen Künstler mit der ebenso vielversprechenden Zukunft ein.
Sie waren Londons strahlendstes Promipaar. Ständig war einer von ihnen oder sogar beide in der Zeitung. Es war eine Märchenliebe – auch er war groß, auch er hatte dunkles rotes Haar, aber seines hing ihm über die Augen, ein romantischer, poetischer Look. Wenn es je zwei Menschen gab, für die alles wie am Schnürchen lief, dann diese beiden. Ihr Leben war voll des Ruhms und Reichtums, voller Chancen und Aufregungen, die meinem Leben fehlten. Ich verfolgte ihr Tun und Lassen in Zeitungen und Zeitschriften, träumte jedoch nicht einmal davon, dass ich eines Tages Teil dieser Geschichte sein könnte.
Wie auch immer, es lief so richtig gut für die beiden, und dann bekam Francesca eine Rolle in einer neuen Fernsehserie angeboten. Kurz zuvor hatte eine Zeitschrift einen Artikel über sie und ihre Macken gebracht – sie trug niemals eine andere Farbe als Schwarz, Weiß oder Grün (was völlig affektiert war; sie sah in egal welcher Farbe phantastisch aus) – und ihre renaissanceartige Schönheit gepriesen. Das hatte der Regisseur Daniel Palmer gesehen, der eine Schauspielerin für eine kleine Rolle in seiner neuen Fernsehserie über die Borgias suchte. Dass Francesca keinerlei Schauspielerfahrung hatte, schien keinen zu stören, und tatsächlich musste sie auch nur finster, geheimnisvoll oder begehrlich aussehen (häufig genau in dieser Reihenfolge, manchmal aber auch alles gleichzeitig) und hin und wieder ein paar Sätze sagen. Die Serie war ein großer Erfolg. Genau wie Francesca.
Russell, der inzwischen nach einem neuen Hauptstück für seine nächste Ausstellung suchte, kam auf die Idee, Franny in einem ihrer Renaissancekleider zu malen. Anscheinend war es das Beste, was er bis dahin gemalt hatte. Ein ganz vernarrter Daniel Palmer erbeutete das Gemälde. Und Francesca gleich mit dazu.
Francesca, die entschieden hatte, ihre Zukunft liege fortan mehr im Schauspielern als im Modeln, sah in Daniel vermutlich jemanden, der ihr einfach Zutritt zu dieser Welt verschaffen konnte, also ließ sie es zu, erbeutet zu werden. Die beiden verschwanden am Horizont in einer Wolke des Glücks und – was sie betraf – des Ehrgeizes, und Russell Checkland wachte eines Morgens allein auf.
Russell litt sehr. Keiner weiß etwas Genaueres über diese Zeit. Zwölf Monate später schleppte ihn jedenfalls sein Vater, der das mit äußerstem Unmut wahrgenommen hatte, zurück nach Frogmorton, dem baufälligen Familienanwesen, bezahlte seine unzähligen Schulden, nüchterte ihn aus und schickte ihn zum Militär. Russell wehrte sich nicht.
Ein paar Jahre lang hörte man nichts von ihm, und Francescas Schauspielkarriere war auch nicht der glänzende Erfolg, auf den sie gehofft hatte. Sie verbrachte viel Zeit zu Hause. Tante Julia sagte, sie ruhe sich aus.
Und dann war Russell Checkland auf einmal wieder da, entlassen aus der Armee. Er hatte jemanden zusammengeschlagen, einen Unteroffizier, glaube ich. Ich dachte immer, genau darum ginge es in der Armee, aber anscheinend durfte man so etwas nicht tun, zumindest nicht als Gefreiter.
Er war also wieder zurück, unehrenhaft entlassen, und sein Vater starb drei Monate später. Es geht das Gerücht, die beiden Ereignisse stünden miteinander in Verbindung. Daniel Palmer musste ein paar Monate ins Ausland, und Russell und Francesca wurden gesehen, wie sie einander eines Abends voller Verlangen in einem abgeschiedenen Pub in der Nähe von Whittington beäugten.
Rushford fing wieder an, begeistert über seine beiden Lieblingsklatschkandidaten zu tratschen, und jetzt, nach Daniels Rückkehr, warteten alle darauf, was als Nächstes passieren würde.
Vermutlich raufte sich Tante Julia auf sehr elegante und geschmackvolle Weise, und ganz bestimmt ohne die Stimme auch nur das kleinste bisschen zu erheben, diesbezüglich die Haare. Was in Daniel Palmers Kopf vorging, darüber stellten alle nur Vermutungen an.
Wie aufregend, nicht wahr?
Da saß nun also der vermeintlich hintergangene Verlobte auf Tante Julias Sofa und wartete auf Francesca, die wirklich mit ihrer Mutter beim Shoppen war. Ich fragte mich, was ich jetzt tun sollte, als Thomas hereingeschlendert kam.
»Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende«, sagte er, und es dauerte einen Moment, bis mir klarwurde, dass er über den Film sprach und nicht über das reale Drama, das gerade quer durch Rushford seinen Lauf nahm. »Willst du ihm nicht eine Tasse Tee anbieten?«
Zu meiner großen Erleichterung lehnte Daniel ab.
Ich bekam einen sanften Stupser in den Rücken. »Streng dich ein bisschen an.«
Sich konzentrieren, atmen und dann etwas sagen. »A-a-arbeitest du g-g-gerade an etwas I-I-Interessantem?«
Er wartete, bis ich den Satz ganz herausgebracht hatte.
»Ja, ich denke über die Tudors nach. Da gibt es richtig viel Material. Denkst du, etwas über Elisabeth würde gut ankommen?«
Ich nickte.
»Sie ist natürlich schon tausend Mal umgesetzt worden. Ich müsste einen neuen Ansatz finden, und ich hatte nicht gerade viel Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Das liegt noch immer auf meinem Ideenstapel. Was denkst du?«
Ich nickte.
»Nein«, sagte Thomas. »Finde etwas, auf das du dich konzentrieren kannst, atme zweimal tief ein und aus, und dann sag wieder was. Du schaffst das.«
Ich fixierte das Kissen mit dem Rosenmuster, zeichnete es mit Blicken nach und formulierte meine Gedanken. »K-k-konzentrier dich auf die B-B-Beziehung z-z-zwischen E-E-Elisabeth und Maria. Fang jede S-S-Serie als Sch-Sch-Schachspiel an. E-E-Elisabeth die rote Königin, Maria die weiße. Jede K-K-Königin stellt die beteiligten Personen vor. U-u-umreißt das Geschehen. D-d-die erste F-F-Figur zieht los. Blende zur n-n-normalen Handlung über. Und zum Sch-Sch-Schluss kommst du wieder zum Schachbrett zurück und zeigst den a-a-aktuellen Stand der Dinge zusammen mit allen t-t-toten oder verlorenen Figuren, die auf dem B-B-Brett herumliegen.«
Erschöpft hörte ich auf.
»Super gemacht«, sagte Thomas. »Die Sätze waren ein bisschen abgehackt, aber abgesehen davon nicht schlecht.«
Daniel Palmer lächelte mich an. »Das ist ein interessantes Konzept. Dir geht ziemlich viel durch den Kopf, oder? Ich werde darüber nachdenken.«
»Was ist ein interessantes Konzept?«, fragte Francesca, die schwer beladen mit Einkaufstüten durch die Tür kam. Er sprang auf, um sie zu begrüßen, und ich vergaß das alles schnell wieder.
»Ach, wie nett für dich«, sagte sie spöttisch, »Jenny hat mit dir geplaudert.«
Habe ich etwa vergessen zu erwähnen, dass sie auch eine ziemlich blöde Kuh ist?
»Ja, sie hat mich sogar ziemlich gut unterhalten.« Was für ein netter Mann er doch war. »Tatsächlich hätte ich den eigentlichen Grund meines Kommens heute fast vergessen.«
Er zog zwei Umschläge aus seiner Tasche. »Einladungen zu unserer After-Weihnachtsparty.«
»Oh, wie nett«, sagte Tante Julia, die jetzt hereinplatzte. »Ich bin immer so gern auf Ihren Partys, Daniel.«
»Eine für Sie und Richard und eine für Jenny.«
Ich nahm den Umschlag entgegen, als bestünde er aus reinstem Gold.
Tante Julia bemerkte mich erst jetzt.
»Entschuldige Liebes, ich habe dich nicht gesehen.«
Ich saß ja auch nur in Lebensgröße auf dem Sofa. Einmal habe ich eine Sendung gesehen, in der ein junges Mädchen von seinem ganzen Umfeld ignoriert wurde, bis es schließlich verblasste. Ich schaute an mir herunter, um zu überprüfen, ob ich noch immer sichtbar war, dann öffnete ich den Umschlag und las die Einladung.
»Aber Daniel, du weißt doch, dass Jenny nicht auf Partys geht. Die überfordern sie mitunter einfach ein bisschen zu sehr.«
»Es ist ja schön, dass du unsere Partys als so lebhaft einstufst, Julia, aber es handelt sich lediglich um ein paar Drinks und kleine Häppchen bei uns zu Hause. Keine wilde Tanzorgie, kein Zocken um Geld und ganz bestimmt nichts, was die Pferde scheu machen würde.«
Ich öffnete den Mund und wollte schon höflich ablehnen.
»Du solltest hingehen«, sagte Thomas ruhig, aber etwas an seinem Tonfall war anders.
Francesca blickte von ihren Einkäufen auf. »Sie geht nicht auf Partys.«
»Du solltest hingehen.«
Jetzt mischte sich auch Tante Julia wieder ein. »Vielen Dank, Daniel, aber ich fürchte, dass Jenny …«
»Du solltest hingehen.«
Einen kurzen Moment lang hielt sich alles perfekt die Waage, doch ich musste mich für eine der beiden Waagschalen entscheiden.
»Ja«, verkündete ich, und alle starrten mich an. »Ja, ich w-w-würde gern kommen. Danke.«
»Wunderbar«, erwiderte Daniel. »Wir freuen uns, euch drei dort zu sehen. Dienstag in einer Woche. Francesca, bist du so weit?«
Sie sammelte ihre Taschen ein.
Er wandte sich an Julia. »Grüße an Richard. Jenny, ich würde mich gern länger mit dir über Elisabeth unterhalten. Können wir uns auf der Party einen Moment Zeit nehmen?«
Ich nickte und kam mir auf einmal wie ein richtiger Mensch vor.
»Was sollte das denn?«, grummelte Francesca im Gehen.
Meine Tante wandte sich mir zu. »Er ist ein sehr netter Mann. Das weißt du, Liebes. Es wäre klug, nicht zu viel in das hineinzuinterpretieren, was vermutlich einfach nur dem Anstand geschuldet ist.«
Gehorsam nickte ich und versuchte, mir meine Freude darüber nicht nehmen zu lassen. Ich wollte an diesem Moment festhalten. Ich würde auf eine Party gehen, und jemand wollte dort mit mir reden. Wie mit einem richtigen Menschen.
So kam es dann aber nicht. Ich muss jedoch einräumen, dass Daniel keine Schuld trifft. Es war nicht die beste Party, die er je gegeben hatte, aber ich genoss jede Minute.
Die nächsten zehn Tage zerbrach ich mir den Kopf über die Party. »Wie soll ich mich verhalten? Werden die Leute mit mir reden wollen? Was soll ich sagen?«
»Du gehst das völlig falsch an«, meinte Thomas nicht gerade tröstlich. »Du solltest dir darüber Gedanken machen, was du anziehst, wie du die Haare frisierst und welche Schuhe du trägst.«
»Schuhe?«
»Denken Frauen nicht die ganze Zeit daran? An Schuhe?«
»Ich weiß, was ich anziehen werde«, antwortete ich. »Ich habe Schuhe. Genau wie du – du bist ein Pferd. Darüber mache ich mir keine Gedanken. Woher soll ich wissen, wie ich mich richtig verhalte? Hätte ich nur nicht zugesagt. Ich werde mich schrecklich blamieren. Keiner wird den Abend damit zubringen wollen, mir beim Herauspressen von Sätzen zuzuhören. Das wird eine Katastrophe.«
»Nein, wird es nicht. Nur keine Panik. Wir gehen das jetzt mal durch. So, du kommst an, bestens gekleidet und frisiert.«
Ich schnaubte.
»Das solltest du besser nicht machen. Zunächst einmal ist das nicht sehr damenhaft, und dann hast du gerade ein richtig schlimmes Wort auf Pferdisch gesagt.«
»Ach ja? Was habe ich denn gesagt?«
»Das ist egal. Von einem jungen Füllen wie dir will ich keine solchen Flüche mehr hören.«
Ich kicherte und fühlte mich mit einem Mal wieder viel besser.
»Okay, du steigst also aus. Ganz langsam. Denk daran, alles langsam zu machen. Das verschafft dir Zeit, um nachzudenken, und lässt dich elegant aussehen. Lass deine Tante und deinen Onkel als Erste hineingehen. Halte dich hinter ihnen. Bleib stehen und sieh dich um, damit du nicht blindlings nach drinnen stolperst. Jemand wird dir den Mantel abnehmen. Du musst nichts sagen, lächle einfach. Jemand wird dir einen Drink anbieten.« Er schaute mich an. »Nichts Alkoholisches.«
Ich nickte. Auf keinen Fall etwas Alkoholisches.
»Der Gastgeber und die Gastgeberin werden dich begrüßen. Lächle einfach und bedanke dich für die Einladung. Dann machst du Platz für die nächsten Gäste und siehst dich um. Verzieh dich ja nicht in die erstbeste Ecke und bleib den ganzen Abend da stehen.«
»Aber du wirst doch da sein, versprochen? Du gehst mit mir dahin?«
»Natürlich komme ich, ich habe einfach nur keine Lust, den ganzen Abend über in einer Ecke rumzustehen. Du siehst dich also im Raum um. Lächle und nicke den Leuten zu, wenn eure Blicke sich treffen. Du musst nichts sagen. Ich weiß, dass du das nicht glaubst, aber die meisten Leute sind netter, als du denkst.«
Wieder nickte ich.
»Nachdem du dir einen Überblick verschafft hast, gehst du langsam durch das Haus. Daniel hat eine wunderbare Kunstsammlung, und die meisten Zimmer stehen vermutlich offen, da können wir dann herumschlendern und uns alles anschauen. Ich will mir vor allem Checklands Porträt von Francesca ansehen, du etwa nicht?«
»Doch«, sagte ich. »Die Bibliothek ist vermutlich auch offen. Dann können wir uns die Bücher ansehen.«
»Na also. Das sollte uns eine Weile von irgendwelchem Unfug abhalten. Dann holen wir uns was zu essen, nehmen ein weiteres nicht alkoholisches Getränk zu uns und gehen nach Hause. Um Mitternacht verwandelt sich deine Tante nämlich in einen Kürbis.«
Ich lachte und hatte mit einem Mal ein besseres Gefühl bei dieser Sache. Das war ein guter Plan. Leider kamen wir nie dazu, ihn in die Tat umzusetzen.
Nervös kam ich in meinem schlichten schwarzen Kleid die Treppe herunter. Um den Hals trug ich den wunderschönen dunkelrot-blau-grünen Glasanhänger meiner Mutter an einem dunkelroten Band. Die Haare fielen mir offen über die Schultern, ich hatte nur eine glitzernde Spange hineingesteckt.
Meine Tante betrachtete mich. »Richard, ich bin mir bei dieser Sache wirklich nicht sicher.«
Na ja, zumindest war sie nicht vor Entsetzen über mein Outfit zurückgewichen, aber sie hätte doch etwas dazu sagen können.
»Ich finde, du siehst wunderschön aus«, sagte Thomas leise hinter mir.
»Meine Liebe, Jenny wird diesen Abend außer Haus genießen. Es ist ja nicht so, als würde das zur Gewohnheit werden.«
»Nein, aber sie wird müde werden und …«
Hey, ich stehe genau vor dir, dachte ich.
»Blende sie einfach aus«, sagte Thomas. »Ich mache das zumindestso. Von dem, was sie die letzten zehn Jahre von sich gegeben hat, habe ich kein Wort gehört. Lass dich von ihr nicht aufbringen. Bleib ruhig.«
Leichter gesagt als getan. Mein Herz pochte wie wild, und meine Hände waren feucht, dabei hatte ich noch nicht einmal das Haus verlassen.
Irgendwie konnte Onkel Richard ihre Zweifel zerstreuen, und wir setzten uns ins Auto. Ich saß hinten und starrte aus dem Fenster. Vielleicht konnte ich ja auch einfach im Auto sitzen bleiben, bis es an der Zeit war, nach Hause zu gehen.
»Leg es bloß nicht darauf an, dass ich dich aus dem Auto ziehe«, sagte Thomas, der kurz auftauchte und gleich wieder verschwand. Das Cheshire-Pferd.
Die Palmers lebten in einem entzückenden alten Haus auf der anderen Seite von Rushford. Es war aus rotem Backstein und hatte diese wunderschönen gedrehten Schornsteine.
Ich ging Thomas’ Anweisungen noch einmal durch. Onkel Richard half erst Tante Julia, dann mir aus dem Auto. Er drückte leicht meine Hand, was ich schön fand. Vielleicht könnte ich den Abend ja doch genießen.
Alles verlief, wie Thomas es vorhergesagt hatte. Ich lächelte dem zu, der mir den Mantel abnahm, und stand hinter meiner Tante und meinem Onkel, solange sie mit Francesca und Daniel redeten. Dann gingen sie weiter, und ich war an der Reihe. Daniel war die Freundlichkeit in Person. »Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Schau, Francesca, Jenny ist hier.«
Doch Francesca war schon zur Seite getreten und redete mit interessanteren Leuten. Mir wurde schwer ums Herz, aber er überspielte diesen Moment ganz gut. »Mach dir keine Gedanken, sie wird später zu dir kommen. Der Großteil des Hauses steht heute Abend offen, also geh einfach herum und schau dir meine kleine Sammlung an. Und ich weiß, dass du auf die Bibliothek gespannt bist. Da hängt auch Francescas Porträt.«
Sie rief ihn zu sich.
»Schau dich um und sieh es dir an, wenn du willst, Jenny. Und ich möchte mich später immer noch mit dir unterhalten. Viel Spaß.« Er verschwand.
Jemand trat mit einem Tablett voller Gläser näher. »Früchtepunsch, Madam. Rot ist alkoholisch, grün nicht.«
Ich nahm ein grünes Glas. So, da war ich also. Ich hatte einen Drink in der Hand und musste bislang noch kein Wort sagen. Ausgezeichnet!
Ich erinnerte mich an Thomas’ Anweisungen und ging langsam den Gang hinunter. Gedimmtes Licht spiegelte sich in den Holztäfelungen, und wunderschöne, ungewöhnliche Gegenstände waren an den Wänden ausgestellt, die ich mir gern aus nächster Nähe ansehen wollte. Daniel und seine Partys waren beliebt, und das Haus war voll. Die Gäste hatten sich auf die angrenzenden Räume verteilt. Überall hörte ich fröhliches Geschnatter. Leise Musik lief.
Ich sah mich um und entdeckte ein, zwei Leute, die gelegentlich auch bei uns zu Hause waren. Eine Frau winkte mir kurz zu, was nett war. Ich lächelte ihr zu. Dann fand ich einen ruhigen Platz – keine Ecke – und nippte an meinem Drink, wobei ich, wie ich hoffte, geheimnisvoll und nachdenklich aussah. Und da war auch schon Thomas.
»Magst du deinen Drink nicht?«
»Doch, der ist gut. Weshalb?«
»Du hast das Gesicht so merkwürdig verzogen.«
»Ich mache hier einen auf mysteriöse Geheimagentin.«
»Nein«, sagte er. »Ganz ehrlich, tust du nicht.«
»Du bist ein Pferd«, erwiderte ich. »Du hast nicht mal einen Gesichtsausdruck.«
»Tja, also da hast du nicht recht, du Schlauberger. Schau mal her.« Er flehmte, zog die Nase kraus und entblößte seine riesigen Pferdezähne.
»Mach das bitte nie vor kleinen Kindern oder schwangeren Frauen.«
Wieder schnaubte er. Ich mochte es, wenn er lachte. »Schon besser«, sagte er. »Du siehst jetzt etwas entspannter aus. Sollen wir uns hier ein bisschen umschauen?«
Wir gingen zur Treppe. »Zuerst oben, dann unten. Und die Bibliothek zum Schluss – das große Finale«, schlug ich vor.
»Guter Plan«, antwortete er. Wir standen gerade auf den ersten Stufen nach oben, als wir Scheinwerfer im Fenster aufblitzen sahen.
»Ein Nachzügler«, sagte Thomas, während wir darauf warteten zu sehen, wer da so spät noch kam. Die Treppe war direkt gegenüber der Haustür, also hatten wir die beste Sicht im ganzen Haus.
Die Tür ging auf, und ein einzelner Mann kam herein. Die Unterhaltungen verstummten sofort, so dass ich seine Schritte auf dem gefliesten Boden hören konnte.
Er blieb stehen, ohne sich der Bestürzung bewusst zu sein, die er verursachte. Selbstsicher schaute er sich um und suchte nach dem Gastgeber. Oder besser gesagt, nach der Gastgeberin. Seine Krawatte saß schief, seine Haare waren zerzaust. Er steckte die Hände in die Hosentaschen, relaxt und rüpelhaft. Ich konnte kaum glauben, was ich da sah, und machte einen Schritt zum Geländer, um besser sehen zu können. Diese Bewegung musste ihm aufgefallen sein, denn er schaute nach oben. Er starrte mich viel zu lange an, und ich konnte den Blick nicht von ihm abwenden.
Da stand Russell Checkland, und er war ziemlich betrunken.
»O wow!«, sagte Thomas. »Jetzt wird’s interessant.«
2. Kapitel
Einen Moment lang schienen alle wie erstarrt, selbst Francesca. Sie stand in der Tür, leicht hinter ihm, so dass er sie noch nicht gesehen hatte. Der Moment zog sich endlos hin, bis Daniel Palmer mit dem höflichsten Lächeln der Welt nach vorn trat.
»Russell, wie schön, dass du gekommen bist. Wir waren uns nicht sicher, ob du es schaffen würdest.«
Ich nahm an, damit brachte Daniel zum Ausdruck: »Du warst zwar nicht eingeladen und bist hier ganz bestimmt nicht willkommen, aber lass uns jetzt keine Szene machen.«
»Ich wurde eingeladen«, sagte Russell sehr bedächtig und schwankte dabei leicht. »Die Einladung ist hier irgendwo, ich kann es beweisen.« Er schaute sich um, als erwartete er, dass sie sich irgendwo in der Luft neben ihm materialisieren würde. Jemand kicherte nervös.
»Er hat schon ein paar intus«, sagte Thomas. »Was glaubst du, warum ist er hier?«
Weil er nicht wegbleiben kann, dachte ich. Wie bei einer Motte und einer Flamme. Und sie ermutigte ihn dazu.
Francesca trat zu ihm, wunderschön schwarz-weiß gekleidet. »Ach, da bist du ja endlich, Russell. Aber immer noch besser zu spät als gar nicht.« Sie fasste ihn am Arm. »Daniel, Schatz, ich dachte, es wäre nett für Russell, mal wieder ein paar Leute zu treffen, jetzt, wo er versucht, in Rushford Fuß zu fassen, und das hier könnte ein guter Start sein.«
Daniels Schweigen dauerte nur eine Millisekunde. »Was für eine schöne Idee, Francesca. Warum führst du ihn nicht herum und stellst ihn vor?« Damit wandte er sich ab und führte seine Unterhaltung fort, scheinbar desinteressiert an dem Neuankömmling. Somit standen Francesca und Russell leicht isoliert in der Mitte des Raums. Das war deutlich gewesen.
»Nicht schlecht«, sagte Thomas. »Sie ist wirklich strohdumm! Ich frage mich, ob ihr bewusst ist, was sie alles kaputt macht. Doch ich bezweifle es. Wenn sie ein bisschen Grips hat, dann stellt sie ihn Mr. Spritz von Eiswasser, Mrs. Starker-schwarzer-Kaffee und Miss Taxi-nach-Hause vor. Aber wir wollen doch nichts davon verpassen, oder? Sollen wir wieder nach unten gehen? Wir können uns immer noch später oben umsehen.«
Ich stimmte zu, und wir mischten uns wieder unter die wild tratschende Menge im Erdgeschoss. Von Tante Julia oder Onkel Richard war nichts zu sehen, sie waren wohl beide beim ersten Anzeichen von gesellschaftlichem Unbehagen von den Holzvertäfelungen aufgesaugt worden.
Wir wanderten von einem Zimmer ins nächste, von Gemälde zu Gemälde, bewunderten und kritisierten, bis wir zum Schluss in der Bibliothek landeten. Das Licht war eingeschaltet, das Zimmer aber leer. Schmal und lang erstreckte es sich im hinteren Teil des Hauses. Jeder Zentimeter Wand war mit Regalen bestückt. Schwere, dunkelrote Vorhänge hingen an den Fenstern. Das Mobiliar bestand aus dunklem Holz und weichem Leder. Es war ein sehr männliches Zimmer. Das einzige Zeichen von Francesca war das berühmte Porträt über dem Kamin, das – typisch für sie – allerdings den ganzen Raum beherrschte.
Das Bild war großartig. Die Feinheiten der Kleidung waren hervorragend wiedergegeben, die Falten in den Seidenärmeln ganz besonders auffällig gestaltet. Der geklöppelte Kragen war wunderschön filigran, von geschmeidiger, sicherer Hand gemalt. Das Gesicht war ganz Francesca. Sie sah geradewegs aus dem Gemälde heraus, ein rätselhaftes Lächeln auf den Lippen, als schmiedete sie irgendwelche bösartigen Pläne; oder, was eher passte, wenn man Francesca kannte, ganz damit beschäftigt zu überlegen, was sie wohl zum Mittagessen zu sich nehmen sollte. Eine unsichtbare Lichtquelle ließ ihre Haare schimmern, hob die rotgoldenen Locken von den dunklen Schatten ab. Es war wirklich ein Kunstwerk.
»Tja«, sagte Thomas leise. »Ich vergebe ihm alles. Das ist beeindruckend. Was hält sie da in der Hand?«
Ich stellte mich auf die Zehenspitzen. »Eine kleine Glasphiole.«
»Glaubst du, sie will gleich jemanden vergiften oder hat es gerade getan?«
»Das werden wir nie herausfinden.«
»Warum hat er aufgehört zu malen?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Seine Muse hat ihn verlassen.«
»Glaubst du, sie bereut das jetzt?«
»Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß sie das ja nicht einmal selbst.«
»Tja, er bereut es in jedem Fall. Armer Russell.«
Überrascht schaute ich ihn an.
»Ihm ist übel mitgespielt worden. Ich frage mich, ob ihr klar ist, dass sie sein Leben vermutlich ruiniert hat.«
Ich zitterte. Mit einem Mal war das keine amüsante Seifenoper, die man aus sicherer Distanz heraus betrachtete und über die man so seine Vermutungen anstellte. Das war das Leben von drei Menschen. Und ja, wenn Russell Checkland sich nicht am Riemen riss, dann war sein Leben vermutlich ruiniert. Und ich ahnte, dass Daniel und Francesca auch nicht so glücklich zusammen waren. Mit einem Mal kam mir mein ruhiges Dachbodenleben gar nicht so übel vor.
»Stell dir vor«, sagte Thomas leise, »stell es dir nur mal vor. Du hast dein ganzes Leben vor dir, strahlend und voller Versprechungen mit einer Frau, die du bewunderst, die deine Inspiration ist, dein Ein und Alles. Und eines Tages wachst du auf, und sie ist zur Tür hinausgewirbelt, um mit jemandem zusammen zu sein, der ihr das neue Spielzeug geben kann, das sie haben will. Wie muss er sich da gefühlt haben? Du weißt, dass er seine Wohnung kurz und klein geschlagen hat, oder? Hat die Gemälde zerrissen und alles in den Müll geworfen. Dabei war er so talentiert, Jenny. In seinen Bildern lag so viel Freude. Und jetzt ist das alles weg. Ich frage mich, ob er das jemals wieder zurückerlangen wird. Und ob er das überhaupt will.«
Er klang so traurig. Ich drehte mich zu ihm um, streckte die Hand aus und streichelte über seine Stirn, etwas, das ich selten tat. Er war ja schließlich kein Haustier.
»Du magst ihn ziemlich gern, was?«
»Ja, das tue ich. Sein Vater war ein unsympathischer Mann. Seine Mutter, die ein Puffer zwischen den beiden hätte sein können, starb, als er noch so klein war, dass er sie durchaus gebraucht hätte. Die Liebe seines Lebens hat ihn verlassen. Selbst sein Talent hat ihm den Rücken gekehrt. Also ja, trotz all seiner Bemühungen, alles und jeden vor den Kopf zu stoßen, mag ich ihn.«
Ich erinnerte mich an den langen Blickkontakt auf der Treppe. »Ich auch.«
Eine ganze Weile betrachteten wir das Gemälde. Ich leerte mein Glas und schaute mich nach einem Platz um, wo ich es abstellen könnte. Aus dem Nichts tauchte eine Hand auf, und eine Stimme fragte: »Soll ich das nehmen?«
In Gesellschaft bin ich wirklich ziemlich hoffnungslos. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ihm das Glas geben? Entsetzt zurückweichen? Ihn anlächeln? Mich durch ein langes Hallo kämpfen? Und wo bitte schön war Thomas, wenn ich ihn brauchte? Na wunderbar, auf der anderen Seite des Zimmers, um einen Blick auf die Erstausgaben zu werfen.
Ich drehte mich um und sah Russell Checkland zum ersten Mal richtig an. Seine Haare waren feucht, vielleicht von einer kurzen Begegnung mit kaltem Wasser. Er hatte sich nicht großartig verändert, seit ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, doch neue Falten umspielten seine Augen und seinen Mund. Sein Gesicht wirkte schmaler, und wenn Thomas recht hatte und irgendwann Freude darauf zu sehen war, dann war jetzt nichts mehr davon übrig.
Unser Schweigen zog sich viel zu sehr in die Länge.
»Alles in Ordnung«, meinte er schließlich. »Sie sagten mir, ich könne bleiben, wenn ich mich ordentlich benehme, und bei wem könnte ich das besser als bei dir? Obwohl ich jetzt tatsächlich einräumen muss, dass es ganz offensichtlich nicht die schmeichelhafteste Bemerkung ist, die ich machen konnte. Du kannst mich gern ohrfeigen.«
Na prima! Ich war eine sichere Option. Genau das, was jede Frau gern hört. Einen kurzen Moment wünschte ich, ich wäre dunkel und gefährlich, und erlaubte meinem Blick nicht, zum Porträt abzuschweifen.
Ich wusste, wie ich ihn loswerden konnte. Ich atmete tief durch, konzentrierte mich auf den schief sitzenden Knoten seiner Krawatte, und dann fing der Kampf an.
Es hatte den völlig gegenteiligen Effekt. Er wartete nicht höflich oder versuchte zu helfen oder seufzte und verzog sich. Er sagte: »Du lieber Himmel, Jenny, das ist ja viel schlimmer geworden, seit ich dich das letzte Mal sah. Warte mal eben.« Dann verschwand er, ließ mich mit meinem Glas in der Hand und den krampfhaften Bemühungen zu sprechen zurück. Ich hatte gar nicht mehr an seine nervöse Energie gedacht und dass er kaum eine Sekunde stillstehen konnte.
Wenige Augenblicke später war er wieder zurück, eine Tasse mit Untertasse und ein Glas mit rotem Punsch in den Händen. »Hier, bitte schön. Trink das.«
Ich wollte nach Tasse und Untertasse greifen, aber er sagte: »Nein, das ist für mich. Das hier ist für dich.« Und damit drückte er mir das Glas in die Hand. Ich nahm einen argwöhnischen Schluck. Es schmeckte ganz okay. Ein bisschen spritzig, aber sonst ziemlich harmlos.
Während ich daran nippte, fing er wieder an zu reden. Ich hatte ebenfalls vergessen, dass er einem regelrecht das Ohr abkauen konnte. »Und, was hast du so gemacht, während ich weg war? Als ich dich das letzte Mal sah, hattest du ein Zeugnis mit Examensnoten an dich gepresst und gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd. Bist du aufs College gegangen? An die Uni? Was machst du jetzt? Wohnst du immer noch in Rushford?«
Verzweifelt starrte ich ihn an. Er grinste mich von oben herab an, dieser idiotische Pony fiel in seine Stirn, und plötzlich war ich wild entschlossen, es zu tun. Ich würde es tun.
Nichts passierte.
Ich versuchte es erneut.
Nichts passierte.
Erwartungsvoll stand er da, dann sah ich, wie der Groschen bei ihm fiel. Er streckte den Arm aus und fuhr mir sanft mit zwei Fingern über den Unterarm. »Es tut mir leid. Ich bin ja so dämlich. Und betrunken. Und wütend. Und nichts davon ist deine Schuld. Soll ich dich in Ruhe lassen?«
Thomas war offensichtlich verschwunden, von ihm war keine Hilfe zu erwarten. Ich schüttelte den Kopf und zeigte auf ein altes Ledersofa beim Kamin.
»Gute Idee«, sagte Russell. »Meine Beine fühlen sich gerade so an, als gehörten sie jemand anderem. Und ich würde mir wünschen, bei meiner Zunge wäre das auch der Fall. Ich wollte dir keine Angst machen. Du siehst heute Abend so hübsch aus, dass ich es einfach vergessen habe.«
Hatte ich erwähnt, dass er auch ein redegewandter Charmeur war?
Vorsichtig nahm er Platz. Ich setzte mich neben ihn, fühlte mich etwas selbstsicherer und glühte leicht.
»Okay, fangen wir noch mal von vorne an. Schön, dich zu sehen. Geht’s dir gut?«
Ich nickte und schaute ihn mit hochgezogener Braue an.
»Ja, mir geht’s auch gut. Also, jetzt im Moment nicht so, und morgen werde ich mich und vermutlich auch den Rest der Welt hassen, aber darüber mache ich mir heute keine Gedanken. Was treibst du jetzt so? Hast du einen Job?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Was machst du dann? Aber ja doch, du musst wahrscheinlich gar nicht arbeiten, oder? Du hast das Geld von deinen Eltern. Wo wohnst du? Moment, wohnst du etwa immer noch bei den Kingdoms?«
Ich nickte.
»Lass mal eben überlegen. Ich bin jetzt neunundzwanzig, und du musst so um die achtundzwanzig sein, und du wohnst immer noch bei diesen merkwürdigen alten Käuzen? Warum? Was ist passiert? Ach, jetzt reicht’s aber wirklich, Jenny. Kipp deinen Drink runter und sprich mit mir.«
Was sollte ich sagen? Ich konnte ihm nicht erzählen, dass ich die Wahl zwischen Tante Julia oder irgendeiner Anstalt hatte. Er legte einen Finger unter mein Glas. »Trink es aus. Das hilft vielleicht. Wenn nicht, kannst du mir einen Aufsatz schreiben. Fünfhundert Worte zu: ›Warum ich mich dazu entschlossen habe, bei den langweiligsten Leuten im Universum zu bleiben, wo ich doch eine richtige Partymaus sein könnte.‹«
Ich würgte einen Schluck nach dem anderen hinunter.
»So ist es gut. Jetzt wirst du im Handumdrehen losplappern. Wenn ich ein paar Drinks hatte, dann höre ich gar nicht mehr auf zu reden.«
So funktionierte es zwar nicht, aber ich dachte daran, dass ich nüchtern und unbeholfen oder betrunken und unbeholfen sein konnte, und nüchtern und unbeholfen war ich schon mein ganzes Leben. Ich nahm noch ein paar Schlucke und lehnte mich zurück.
»Schon viel besser. Jetzt erzähl mal. Kein Stress. Je weniger ich im Weg bin, umso glücklicher scheinen alle zu sein.«
»Das Gefühl kenne ich.«
Wo war das jetzt hergekommen? Ach ja. Ich spähte in mein halbleeres Glas. Vielleicht hatte er mich ja nicht gehört.
Er starrte ins Feuer. Jetzt, wo er mich nicht mehr ansah, schlug mein Herz ein bisschen langsamer. Ich entspannte mich etwas. Knoten lösten sich. Ich dachte an das, was ich sagen wollte, und reduzierte es auf so wenige Worte wie möglich.
»S-s-sie hielten es f-f-für richtig, dass ich blieb. Manchmal werden S-S-Sachen … a-a-also habe ich … e-e-es war einfacher. Besser. Ich lese. Ich lerne. Ich habe meinen A-A-Abschluss gemacht, weißt du«, sagte ich und versuchte verzweifelt, für jemanden interessant zu wirken, der an einem Tag mehr unternahm als ich in einem ganzen Jahr.
Er war überhaupt nicht enttäuscht. »Aber du hättest so vieles machen können. Das könntest du noch immer. Ich sage ja nicht, geh nach London, Leeds oder Bristol, aber sicherlich …«, er verstummte. »Entschuldige, das geht mich nichts an. Es kommt mir nur so vor, als würdest du dein Leben vergeuden.«
Etwas in mir krümmte sich zusammen, und einen Moment lang war ich wieder zurück in diesen langen dunklen Tagen, als meine Welt so klein war, dass ich nicht einmal aufrecht in ihr stehen konnte. Und dann diese langen dunklen Nächte, in denen ich mich fragte, weshalb ich so unbedeutend war und was nur aus mir werden würde, und ich versuchte, diese Panik zu unterdrücken …
Das musste sich auf meinem Gesicht spiegeln, denn da kam auch schon Thomas ins Zimmer galoppiert, um sich neben mich zu stellen, mit seiner beständigen, beruhigenden und beschützenden Präsenz. Mein Schutzschild gegen die Welt. Er blies mir Wärme und Beschwichtigung ins Haar.
Russell stellte Tasse und Untertasse bereits weg, sah mich dabei nicht an. »Mir scheint, ich richte heute Abend ganz schön viel Schaden an, nicht nur an meiner Person. Ich muss mich wirklich entschuldigen, Jenny. Manchmal denke ich, es sollte mir verboten sein, mich unter anständige Leute zu mischen.«
Ganz unvermittelt sagte ich: »Ich kenne das Gefühl.«
Er setzte sich wieder hin. »Ja, das kennst du. Und du kommst sehr viel besser damit zurecht als ich.«
»Nein. Nein, tue ich nicht. Aber w-w-wenigstens kämpfst du dagegen an. Du g-g-gehst da raus und sch-sch-schaffst es, dass man dich w-w-wahrnimmt. Du bist f-f-frei … zu kommen und zu gehen, w-w-wie es dir gefällt. Du hast s-s-soziale Kompetenzen. Du k-k-kannst sein, was immer du sein willst. Ich s-s-sitze jeden Tag nur in meinem Z-Z-Zimmer, hasse es, kann aber nicht gehen, weil ich z-z-zu viel … Angst vor den K-K-Konsequenzen habe.«
Himmel! Hatte ich das gerade alles gesagt? Hatte ich das wirklich alles gesagt?
Er stürzte sich darauf. »Was für Konsequenzen?«
Ach, zum Teufel aber auch. Ich kippte den restlichen Drink hinunter, genoss das warme, angenehme Gefühl. »E-e-entweder ich lebe bei meiner Familie, oder ich muss in eine Art A-A-Anstalt. Das ist die A-A-Abmachung.«
Er war verblüfft. »Aber warum? Was ist los mit dir?«
Entnervt starrte ich ihn an.
»Nein, so meine ich das nicht. Als ich das letzte Mal davon gehört habe, war ein leichtes Stottern überhaupt kein Grund, jemanden in einer sicheren Anstalt unterzubringen.«
»Na ja, ich g-g-glaube nicht, dass sie dabei an B-B-Broadmoor gedacht haben.«
»Sie sollten an gar nichts denken. Das ist völliger Schwachsinn, Jenny. Ich bin mir sicher, dass sie es gut meinen, aber es gibt da so etwas wie einen zu stark ausgeprägten Beschützerinstinkt, und es würde dir überhaupt nicht schaden, ein bisschen mehr rauszukommen. Du redest mit mir. Ich kann dich ganz einfach verstehen. Du solltest rausgehen und mehr üben. Mit Leuten in Läden reden. Jemanden nach der Uhrzeit fragen. Das finde ich wirklich. Du wirst ängstlich, weil du nicht richtig sprechen kannst, und du kannst nicht richtig sprechen, weil du ängstlich wirst. Durchbrich diesen Teufelskreis.«
»So e-e-einfach ist es nicht. Wenn es sich nicht während der K-K-Kindheit einrenkt, dann sind die Ch-Ch-Chancen …«
»Mir doch egal, wie die Chancen sind. Mach deine eigenen Chancen. Du redest doch gerade mit mir.«
»Das liegt am Alkohol.«
»Da ist doch fast keiner drin! Also wirklich! Glaub ein bisschen mehr an dich selbst, Mädchen. Oder fang den Tag einfach mit ein paar Wodkas an. Bei mir funktioniert’s.«
Ich versuchte, Thomas ins Gesicht zu sehen, aber er hatte sich abgewandt. Lachte er etwa?
»Ja klar«, sagte ich sarkastisch. »S-s-statt dass ich jeden M-M-Morgen aufwache und mich frage, w-w-womit ich die nächsten Stunden zubringen werde, k-k-kann ich auch eine F-F-Flasche unterm Kopfkissen vorziehen und …« Ich hielt inne. Und was? Was würde ich tun, wenn ich könnte? Wenn ich die Wahl hätte, was würde ich dann machen? Erschreckende Klüfte taten sich zu meinen Füßen auf. Deshalb blieb ich in meinem Zimmer.
»Ich will damit ja nicht sagen, dass du durch Indien trampen sollst, also wirklich. Fang mit kleinen Sachen an. Ich habe da eine Idee. Was weißt du von Eimern?«