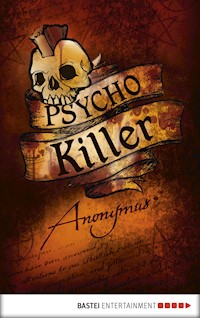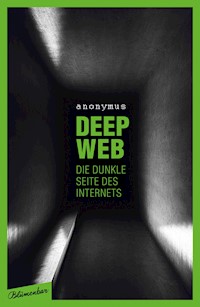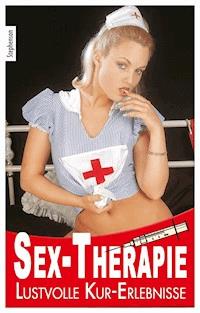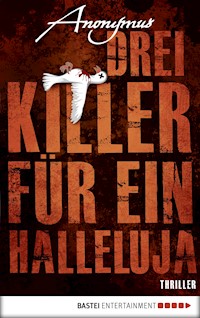
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Man nennt ihn den Roten Mohikaner. Wann immer er auftaucht, trägt er eine Maske mit einem roten Irokesenschnitt - und hinterlässt ein Blutbad. Rodeo Rex bekommt den Auftrag, den Mohikaner auszuschalten, denn der will als nächstes angeblich den Papst höchstpersönlich ermorden. Und es kommt noch besser: Rex soll nicht allein auf diese Jagd gehen. Zwei Auftragskiller, deren Ruf in puncto Wahnsinn dem Mohikaner in nichts nachsteht, sind mit von der Partie - der legendäre Elvis und der zu spontanen Gewaltexzessen neigende Bourbon Kid. Eine Höllentour im Namen des Heiligen Vaters beginnt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
♦ INHALT
♦ ÜBER DAS BUCH
Man nennt ihn den Roten Mohikaner. Wann immer er auftaucht, trägt er eine Maske mit einem roten Irokesenschnitt – und hinterlässt ein Blutbad. Rodeo Rex bekommt den Auftrag, den Mohikaner auszuschalten, denn der will als nächstes angeblich den Papst höchstpersönlich ermorden. Und es kommt noch besser: Rex soll nicht allein auf diese Jagd gehen. Zwei Auftragskiller, deren Ruf in puncto Wahnsinn dem Mohikaner in nichts nachsteht, sind mit von der Partie – der legendäre Elvis und der zu spontanen Gewaltexzessen neigende Bourbon Kid. Eine Höllentour im Namen des Heiligen Vaters beginnt …
♦ ÜBER DEN AUTOR
Anonymus hat im Verlauf der Jahrhunderte zahllose Bücher veröffentlicht. Es wäre unmöglich, sie hier aufzuzählen. Was er sonst noch gemacht hat, wo er wohnt, ob er verheiratet ist, Kinder hat und wie er so lange überleben konnte, ist leider unbekannt.
ANONYMUS
Drei Killerfür ein Halleluja
THRILLER
Aus dem Englischen vonThomas Schichtel
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © The Bourbon Kid 2014
Titel der englischen Originalfassung: »The Plot to kill the Pope«
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dr. Frank Weinreich, Bochum
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
Unter Verwendung eines Motives von © Markus Weber
E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-732-52273-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
»Du hast Selbsterkenntnis erlangt, wenn dir klar wird,dass alle anderen dich für einen Idioten halten.«
– Anonymus
♦ PROLOG
Die Nachtfahrt
Zur Hölle mit diesem Regen!
Diane Crawford folgte der langen, kurvenreichen Landstraße jetzt schon seit über vierzig Meilen, ohne auf eine Spur von Zivilisation gestoßen zu sein. Und es regnete, wie sie es zu Hause nie erlebt hatte. Man könnte fast denken, es würde ein Unsichtbarer auf der Motorhaube ihres Autos stehen und fortlaufend Eimer voll Wasser auf der Windschutzscheibe ausschütten. Die Sicht war auf das absolute Minimum geschrumpft. Wenn sie auf dieser entsetzlichen Straße im Nirgendwo einen Unfall hatte und dabei starb, würde kein Mensch sie vor dem Morgen finden. Und es wäre ihre eigene beschissene Schuld. Nur eine Verrückte fuhr bei solchem Wetter. Oder jemand wie Diane, für die es noch furchterregender war, in einem abgelegenen Landstrich ohne jede Beleuchtung am Straßenrand zu halten. Was sie brauchte war ein Hotel oder eine Tankstelle; einfach einen Platz, um anzuhalten und über alles nachzudenken, während sich das Wetter beruhigte.
Es war zwei Uhr früh, als endlich eine alte Tankstelle vor ihr auftauchte. Ein leuchtend gelbes Schild prangte davor, das bei Tageslicht betrachtet vermutlich zu grell war, doch in der Nacht erwies es sich als Segen, etwas so Buntes am Straßenrand zu sehen. Die roten Buchstaben auf dem gelben Grund waren leicht zu lesen:
Barneys Tankstelle und Laden
Rund um die Uhr geöffnet
Diane lenkte ihren Audi A3 von der Straße und in den Außenbereich der Tankstelle. Obwohl das Schild behauptete, hier wäre rund um die Uhr geöffnet, sah es nicht danach aus. Kein Licht brannte im Geschäft, alles wirkte verlassen.
Sie hielt vor einer Zapfsäule und schaltete den Motor ab. Die Armaturenbeleuchtung erlosch, abgesehen von der Digitaluhr, die 02:02 Uhr anzeigte. Diane musste noch nicht unbedingt tanken, aber da sie sich danach sehnte anzuhalten, war sie willens, hier dreißig Dollar zu versenken. Außerdem befand sie sich in einer Gegend, die man nur als hinterste Provinz bezeichnen konnte. Es bestand mit hoher Wahrscheinlichkeit die Chance, dass sie noch hundert weitere Meilen fahren musste, bis sie erneut auf eine Tankstelle stieß. Vermutlich war es also gar keine schlechte Idee nachzufüllen. In der letzten Stadt hatte ihr ein älterer Typ diese Abkürzung genannt, aber allmählich hegte sie den Verdacht, dass er sie auf einem Umweg zum Set einer Stephen-King-Verfilmung geschickt hatte. An diesem Ort war alles gruselig, schlecht beleuchtet und von hohen Bäumen und dichtem Gebüsch umstanden.
Sie nahm den Regenmantel vom Beifahrersitz und hatte damit zu kämpfen, sich das Ding anzuziehen. Der Mantel war ein zerknitterter, dünner gelber Plastikanorak, der nicht viel Wärme bot. Doch er hielt Feuchtigkeit ab und war sehr gut sichtbar. Diane zog die Kapuze über den Kopf und zupfte an den Schnüren, um sie zu schließen, damit ihr der Regen nicht in die Haare lief. Kurz bevor sie ausstieg, betrachtete sie sich im Rückspiegel. In dem gelben Anorak erweckte sie den Eindruck, als wollte sie gleich zusammen mit Walter White Crystal Meth kochen. Sie stieß die Wagentür auf und kämpfte beim Aussteigen gegen den Wind an. Eine kräftige Bö blies die Tür hinter ihr zu und ersparte ihr die Mühe sie zuzuschlagen.
Die Zapfsäule, neben der sie gehalten hatte, war abgeschaltet, also lief sie zum Geschäft, um einen Tankwart zu suchen. Am Fenster der Tür hing ein Schild:
Nach 10 Uhr abends die Klingel betätigen, wenn Sie Hilfe brauchen.
Diane suchte am Türrahmen und entdeckte eine graue Plastikklingel. Sie war alt und verstaubt und von einem Spinnennetz umgeben, das vom Regen glänzte. Sie drückte fest zu und hielt den Knopf gedrückt. Kein Klingelton war zu hören, doch sie spürte die Taste unter ihrem Finger leicht vibrieren. Nach etwa fünf Sekunden ließ Diane los, brachte das Gesicht näher ans Fenster und schirmte es seitlich mit den Händen ab, um einen besseren Blick ins Innere zu erhalten. Fast sofort flackerte Licht im Geschäft auf.
Sie wich ein Stück weit zurück und wartete, dass jemand kam. Im Inneren befand sich eine Theke, von der man den Außenbereich sehen konnte. Ein junger Mann tauchte dort hinter einem Streifenvorhang neben den Zigarettenregalen auf.
Er blickte forschend durchs Fenster, um nachzusehen, wer geklingelt hatte. Nach Dianes Schätzung konnte er kaum älter als sechzehn oder siebzehn sein. Er hatte zerzauste braune Haare. Diane ging der Gedanke durch den Kopf, dass sie ihn vielleicht geweckt hatte, aber andererseits war er ein Teenager, also war es durchaus möglich, dass die Frisur so aussehen sollte. Diane hatte selbst zwei Söhne im Teenageralter, und beide bestanden auf dubiose Vogelnestfrisuren, die sie – woran Diane keinerlei Zweifel hegte – in späteren Jahren bereuen würden. Dieser Junge hier sah genauso aus, nur ein bisschen schmuddeliger als Dianes Söhne, die für männliche Teenager recht reinlich waren.
Der Tankwart entdeckte sie und winkte ihr zu. Er kam hinter der Ladentheke zum Vorschein, ging zur Tür und entriegelte diese an drei verschiedenen Stellen, ehe er sie öffnete.
»Treten Sie ein, bevor Sie noch weggeweht werden!«, sagte er lächelnd.
»Danke«, erwiderte Diane, betrat das Geschäft und schob die Kapuze nach hinten. »Ich wollte fragen, ob ich hier Benzin bekommen kann. Ich fahre schon die ganze Nacht und glaube, dass ich es in etwa fünfzig Meilen bedauern werde, wenn ich jetzt nicht nachtanke.«
»Kluge Maßnahme«, erwiderte der Junge. »Auf mindestens fünfzig Meilen finden Sie keine weitere Tankstelle. Und ich kann Ihnen versprechen, dass es das Risiko nicht wert ist. Mir ist auf einer Fahrt in diese Richtung mal das Benzin ausgegangen.« Er wies in die Richtung, in die Diane unterwegs war. »Der schlimmste Fehler, den ich je gemacht habe.«
»Ich hoffe, das Wetter war nicht so schlimm wie heute«, sagte Diane.
»Zum Glück nicht. Aber trotzdem, so was riskiere ich nie wieder.« Der Junge schloss die Tür hinter Diane. Ihr fiel auf, dass der Name Steven in seinen Jeansarbeitsanzug eingenäht war.
»Heißen Sie so? Steven?«, fragte sie.
Er blickte am Arbeitsanzug herab. »Richtig. Mein Dad ist ein Depp, der sich die Namen seiner Kinder nicht merken kann, wenn sie nicht in die Kleidung eingenäht sind.«
»Ist Ihr Dad Barney, der Geschäftsführer?«
»Ja, aber lassen Sie sich nicht von meiner Mom erwischen, wenn Sie das laut sagen!«, witzelte er. »Ich denke, Dads einziger Beitrag sind die Namensschilder.«
Diane lächelte höflich.
»Ich hole mal die Schlüssel für die Zapfsäulen«, sagte Steven und ging hinter die Ladentheke zurück. »Hätten Sie gern einen Kaffee? Ich hab gerade eine Kanne aufgesetzt.«
Der Gedanke an Kaffee um zwei Uhr früh wäre Diane normalerweise nie gekommen, aber nun lechzte sie nach Koffein, das sie in Gang hielt. »Das wäre toll, danke.«
Eine Auswahl Schokoriegel war an der Theke zum Verkauf ausgelegt, neben der Kasse stand eine Kanne Kaffee auf einer Warmhalteplatte. Steven duckte sich hinter die Theke und tauchte einen Augenblick später mit einem weißen Kaffeebecher aus Plastik wieder auf. Er stellte ihn auf die Theke und goss eine sehr dunkle Brühe aus der Kanne hinein. »Milch und Zucker?«, fragte er.
»Nur etwas Zucker, das wäre prima«, sagte Diane. »Wie viel schulde ich Ihnen?«
»Der Kaffee geht aufs Haus. Eine Menge Leute brauchen ihn um diese Uhrzeit, und sei es nur, um noch die nächsten fünfzig Meilen auf der Straße durchzuhalten.« Er bemerkte, wie Diane kritisch den Kaffee ins Auge fasste, den er ihr eingeschenkt hatte. »Keine Sorge«, beruhigte er sie, »der ist frisch. Ich habe ihn vor gerade mal zwanzig Minuten aufgesetzt.«
»Sieht gut aus.«
»Ich gehe kurz Zucker holen«, sagte Steven und verschwand hinter dem Streifenvorhang, nur um eine Sekunde später wieder den Kopf hervorzustecken. »Es dauert keine Minute. Ich muss auch noch die Schlüssel für die Zapfsäulen holen.«
Diane sah sich im Laden um. Er erinnerte sie mehr an einen Baumarkt als einen üblichen Nachbarschaftsladen. Das Angebot an Gartengeräten und Säcken voller Düngemittel war größer als das Sortiment aus Lebensmitteln und überdimensioniertem Junk Food, das man normalerweise in einem solchen Geschäft erwarten konnte.
Nachdem er ordentlich Krach gemacht hatte, tauchte Steven wieder aus dem Hinterzimmer auf und brachte einen Schlüsselbund und vier Tütchen Zucker mit. Er reichte Diane die Tütchen. »Genug?«, fragte er.
»Ich brauche nur zwei, danke.«
»Okay, lassen Sie den Rest einfach auf der Theke liegen. Ich tanke inzwischen Ihr Auto nach. Wie viel hätten Sie denn gern?«
»Oh, Sie brauchen nicht für mich zu tanken«, sagte Diane. »Das kann ich selbst machen.«
»Davon bin ich überzeugt. Leider ist das hier aber das vorgeschriebene Verfahren. Wir betanken die Autos selbst. Früher haben wir es den Kunden überlassen, haben aber viel zu häufig erlebt, dass Leute einfach weggefahren sind, ohne zu bezahlen. Und hier draußen können wir in solchen Fällen nicht viel ausrichten. Ich glaube zwar, dass Sie niemand sind, der weiterfahren würde, aber so halten wir es hier nun mal, verstehen Sie?«
Diane nickte. »Ist okay. Ich nehme für dreißig Dollar unverbleites Benzin.«
»Kein Problem, Ma’am. Brauche ich Ihre Wagenschlüssel?«
Diane kramte die Schlüssel aus ihrer Manteltasche hervor und reichte sie ihm. Er nahm sie an sich und ging zur Tür. Kaum hatte er sie geöffnet, drangen die Geräusche von Wind und Wetter in den Laden. Steven kämpfte sich ins Freie und zog die Tür hinter sich zu, damit sie nicht erneut aufgeweht wurde. Er schaltete eine Außenlampe ein und lief in geduckter Haltung zu Dianes Auto. Weder Wind noch Regen gaben irgendeinen Hinweis darauf, dass sie nachlassen wollten, und so wurde die Frisur des armen Kerls noch stärker zerzaust, während der Sturm alles durchrüttelte.
Diane nahm einen kräftigen Schluck Kaffee. Er war traumhaft. Vermutlich handelte es sich im Grunde um billigen Mist, aber unter den herrschenden Bedingungen schmeckte er himmlisch. Wenn das Benzin eine ähnliche Wirkung auf das Auto zeigte, war es das Geld wert. Das Koffein schlug sofort ein und belebte Diane, machte sie fit für den Rest der Fahrt zum Haus ihrer Schwester auf dem Land.
Steven war inzwischen fertig damit, ihren Wagen zu betanken, und kämpfte sich durch Wind und Regen zurück ins Geschäft. Seine Jeans war klatschnass. Für den Pulli galt das vermutlich auch, aber das war schwerer zu erkennen. Er öffnete die Tür und sprang förmlich in den Laden, ehe er sie im Kampf gegen den Sturm wieder zuschob.
»Ganz schön verrückt da draußen«, befand er und fuhr sich mit der Hand durch die nassen Haare.
»Das brauchen Sie mir nicht zu sagen«, bemerkte Diane. »Ich fahre schon den ganzen Abend durch dieses Wetter.«
»Haben Sie noch eine lange Strecke vor sich?«
»Ich fahre für eine Woche zu meiner Schwester. Falls ich nicht mehr falsch abbiege, müsste ich in circa zwei Stunden dort eintreffen.«
»Zwei Stunden?«, fragte Steven, während er zurück hinter die Theke ging. »In welcher Gegend wohnt sie denn?«
»Es nennt sich Knots County. Laut meinem Navi sind das noch etwa fünfzig Meilen.«
»Eher siebzig.«
Diane nahm einen weiteren Schluck Kaffee. »Umso besser, dass ich diesen Kaffee hatte. Wenn ich Glück habe, hält er mich gerade lange genug wach, um dort anzukommen.«
Steven lächelte sie an, sagte aber nichts. Das brachte sie auf die Idee, dass er vermutlich noch anderes zu tun hatte.
»Dreißig Dollar, richtig?«, fragte sie und stellte den leeren Kaffeebecher auf die Ladentheke.
»Tatsächlich sind es nur achtundzwanzig. Ich habe versucht, noch für weitere zwei Dollar einzufüllen, aber in Ihrem Tank war kein Platz mehr. Sie sind vollgetankt, Miss.«
Diane griff in ihre Manteltasche, um die Geldbörse zu zücken. »Sie bekommen trotzdem dreißig, weil Sie so ehrlich waren. Das hätte ich nie überprüft.«
Sie holte ihre Visakarte hervor und reichte sie Steven. Er stand vor der Kasse, einen Schlüsselbund in der Hand, und sah aus, als überlegte er, die Kasse zu öffnen.
»Hier ist meine Karte«, sagte Diane.
Zu ihrer Überraschung nahm er sie nicht entgegen. Er starrte über Dianes Schulter hinweg auf etwas im Außenbereich. Er sah verwirrt aus.
»Was zum Teufel ist das?«, brummte er, gerade laut genug, dass Diane es hörte. Er folgte mit dem Blick etwas, das sich dort draußen bewegte. Diane war es ein bisschen peinlich, wie sie hier vor ihm stand, die Hand mit der Visakarte ausgestreckt, während er sie ignorierte.
Und dann hörte sie hinter sich den Wind und Regen erneut rauschen, als die Eingangstür aufging. Jemand hatte den Laden betreten. Stevens verwirrte Miene wich rasch einem Ausdruck des Erschreckens, die Augen weit aufgerissen angesichts dessen, was hinter Diane durch die Tür gekommen war. Sie drehte sich um, um nachzusehen – und wusste sofort, warum Steven so erschrocken wirkte.
Der Neuankömmling war groß und fast so breit wie die Tür, aber am auffälligsten an ihm waren seine knallrote Lederjacke und eine scheußlich gelbe Schädelmaske mit einem Streifen roter Haare entlang des Scheitels. Er trug auf dem Rücken Waffen oder Gartengeräte. Schwer zu sagen, worum genau es sich handelte, aber Diane konnte über jeder seiner Schultern einen Metallgriff aufragen sehen. Sie wusste aus einem Artikel, den sie kürzlich gelesen hatte, wer dieser Mann war. Es handelte sich um den Roten Irokesen.
Sie wich zurück, bis sie mit den Füßen an ein Display voller Kompostsäcke stieß. Der Rote Irokese ignorierte sie und trat an die Theke, wo Steven ihn immer noch entgeistert anstarrte. Als der Irokese an Diane vorbeikam, erhielt sie einen besseren Blick auf die beiden Gerätschaften, die er sich auf den Rücken geschnallt hatte. Überkreuz trug er dort einen Baseballschläger und ein silbernes Schwert, beide in braunen Lederscheiden.
Er griff über die Theke, packte Steven an den Haaren, und ehe der junge Mann reagieren konnte, wurde er halb über den Tisch gezerrt, bis er mit dem Oberkörper über die andere Seite hing. Den Bauch flach auf der Theke, trat er mit den Beinen nach hinten aus in Richtung der Zigarettenregale und kämpfte darum, sich aus dem Griff des Roten Irokesen zu befreien.
Steven konnte nicht viel mehr tun, als aus Leibeskräften zu brüllen: »Was zur Hölle?«
Der Irokese erklärte sein Handeln mit keinem Wort. Er griff sich lediglich über die Schulter und zog das Schwert aus der Scheide. Dann drückte er Steven mit einer Hand fest auf die Theke und holte mit der sechzig Zentimeter langen Klinge über seinem Kopf aus.
So töricht es auch scheinen mochte, musste Diane doch an die Möglichkeit denken, dass sie soeben Zeugin eines Streichs für eine Show im Kabelfernsehen wurde. Das hier konnte einfach nicht wahr sein. Die Realität wurde ihr erst bewusst, als der Rote Irokese zustieß und Stevens Rücken auf halber Höhe durchbohrte. Ein grausam matschender Laut war zu hören, als die Stahlklinge ins Fleisch stieß, sie durchbohrte den Rumpf und grub sich tief in die Tischfläche. Eine Blutfontäne spritzte aus der Eintrittswunde.
Und Steven brüllte.
Diane hatte noch nie jemanden so schreien gehört. Der Laut brannte ihr in den Ohren und zerrte an ihren Nerven. Das war der Schrei eines Jungen, der ums Leben kämpfte und der sich verzweifelt wünschte, dass jemand ihn hören und zu seiner Rettung kommen würde. Doch Diane war nicht dieser Jemand. Sie war nicht so tapfer. Aber andererseits, wer wäre das in dieser Situation schon gewesen?
Nachdem Steven die Luft ausgegangen war – was sehr schnell passierte –, saugte er japsend das bisschen Sauerstoff ein, das er noch schaffte, und schrie erneut.
Der Rote Irokese hatte zunächst gar nicht auf Diane geachtet, aber während er darauf wartete, dass Steven mit seinem Geschrei aufhörte, drehte er langsam den Kopf und blickte sie an. Hinter den Gucklöchern der gelben Schädelmaske sah sie ein Paar Augen, das sie nie wieder vergessen würde. Augen, die für sie die vollkommene Verkörperung des Bösen darstellten. Diane erstarrte auf der Stelle, gelähmt von Schock und Angst, obwohl sie tief in ihrem Inneren wusste, dass sie vor diesem Mann so weit weglaufen sollte, wie sie nur konnte.
Zum Glück für Diane war der Irokese jedoch gar nicht an ihr interessiert. Er wandte sich wieder seinem verwundeten Opfer zu. Steven kämpfte verzweifelt, vergeblich bemüht, sich zu befreien, tastete mit den Händen herum und hoffte, etwas packen zu können, irgendetwas, das ihm vielleicht half. Die Klinge, mit der er auf die Theke geheftet worden war, machte es ihm jedoch unmöglich, etwas zu erreichen, das ihm genützt hätte. Ein Snickers-Riegel war das Einzige in Reichweite, und Diane war sicher, dass der in der aktuellen Notlage keine Hilfe war, selbst wenn der Kerl in der Maske zufällig allergisch auf Nüsse sein sollte.
Der Rote Irokese griff nach dem Radio hinter der Theke und schaltete es ein. Diane kannte den Song, der daraufhin ertönte. Es war Rush Hour von Jane Weidlin. Aus Gründen, die sie sich nicht erklären konnte, erwies sich das als Auslöser, die Trance abzuschütteln, in der sie bislang die Vorgänge verfolgt hatte. Sie löste sich aus ihrer Starre, sprintete zum Ausgang und rannte unterwegs einen Gartenzwerg um.
Als sie die Tür erreichte, fragte sie sich noch für eine Sekunde, ob sie Steven vielleicht irgendwie helfen konnte. Doch der Gedanke verschwand fast wieder so schnell aus ihrem Kopf, wie er dort aufgetaucht war. Sie war nicht in der Lage, sich einem maskierten, mit einem Schwert bewaffneten Killer in den Weg zu stellen.
Sie riss die Tür auf, und sofort schlug ihr eine Sturmbö ins Gesicht, begleitet von Regentropfen und einem Kälteschwall. Der Wind brachte sie aus dem Gleichgewicht, sie schwankte, drehte sich noch mal um und erhielt eine perfekte Aussicht auf das, was an der Ladentheke geschah. Der Rote Irokese hatte nun den Baseballschläger aus der Scheide gezogen und hinter Steven Stellung bezogen, wo er den Kopf des Jungen mit dem Schläger anvisierte. Steven war nicht in der Verfassung, sich zu wehren, und hatte die vergeblichen Versuche eingestellt. Er schluchzte, hatte nicht mehr die Kraft, auch nur zu seinem Peiniger aufzublicken. Sein Kopf hing schlaff über die Kante der Ladentheke, und Blut troff aus seinem Mund auf den Fußboden. Auch auf der Theke breitete sich eine Blutlache aus, die beständig größer wurde, gespeist aus der Schwertwunde am Rücken.
Diane zuckte zusammen und schloss die Augen, als der Irokese den Baseballschläger auf Stevens Kopf schmetterte. Selbst mit geschlossenen Augen glaubte sie, den Aufprall zu sehen. Eine kleine Menge Erbrochenes schoss in ihren Mund hoch. Sie hatte genug gesehen und stürmte aus dem Laden in Wind und Regen hinein.
Sie war nur noch wenige Zoll von ihrem Wagen entfernt, als ihr etwas siedend heiß einfiel: Steven hatte ihre Wagenschlüssel. Sie konnte also nicht losfahren. Sie konnte nicht mal ins Auto steigen! Sie packte den Türgriff, rüttelte daran, aber nichts rührte sich. Steven musste wieder abgeschlossen haben, nachdem er aufgetankt hatte.
Verzweiflung drehte ihr das Herz um und quetschte jedes bisschen Hoffnung aus ihr heraus. Ihr Kopf fühlte sich schwer an. Dann wurde ihr schwindlig, als Angst, echte Todesangst, von ihr Besitz ergriff. Das Schwindelgefühl raste einer Stromladung gleich durch ihre Adern. Sie fiel auf die Knie und rang nach Luft.
Steh auf!, schrie ihre innere Stimme. Steh auf und renn los!
Sie stieß sich mit den Handflächen vom Boden ab und versuchte, sich aufzurappeln. Der Boden war nass vom Regen und von kleinen Steinen übersät, die sich ihr schmerzhaft in die Handflächen bohrten, ihr aber wenigstens zeigten, dass sie noch lebte. Je angestrengter Diane sich hochstemmte, um auf die Beine zu kommen, desto schwächer fühlte sie sich. Die Kraft schwand ihr aus Armen und Beinen und entwich mit jedem ausgehenden Atemzug aus ihr. Plötzlich fiel Diane ein, dass sie bislang zwei Mal im Leben ohnmächtig geworden war. Und wenn es jetzt zum dritten Mal geschah, dann fürchtete sie, dass es das letzte Mal sein würde.
Sie legte eine Hand auf die Rückseite des Autos, um sich Halt zu verschaffen, hatte jedoch keine Kraft mehr. Diane rutschte zurück auf den Boden, schaffte es, sich in eine sitzende Haltung zu drehen, und lehnte sich gegen den Wagen. Die Nässe des Erdbodens drang ihr durch den Rock bis auf die Haut, dass ihr eiskalt wurde.
Durch das Ladenfenster konnte sie beobachten, wie der Rote Irokese wiederholt mit dem Baseballschläger auf Stevens Kopf einschlug. Sogar durch Wind und Regen hindurch hörte sie den Aufprall.
Während ihr die Sicht verschwamm, schwand ihr auch das Gehör. Nachdem der Baseballschläger in dem Geschäft zum vierten Mal auf Knochen getroffen war, kippte ihr Kopf gegen das Auto. Sie rutschte auf die Seite, hatte nicht mehr genug Kraft im Rückgrat, um aufrecht sitzen zu bleiben. Als ihr Gesicht schließlich in einer Pfütze am Boden landete, war sie bereits bewusstlos.
Der Wandschrank
Der Junge würde nie wieder das Geräusch des Autos vergessen, das quietschend in der Einfahrt vor ihrem Haus zum Stehen kam. Er und sein Vater waren gerade dabei gewesen, ein Lego-Haus zu bauen, und beim Geräusch der über das Pflaster rutschenden Reifen sprang sein Vater auf, stürmte ans Fenster und blickte durch die Jalousie. In diesem Augenblick änderte sich die ganze Welt.
Der Vater des Jungen trat vom Fenster zurück. Jede Farbe war aus seinem Gesicht gewichen. Obwohl der Junge erst sieben Jahre alt war, wusste er, dass etwas nicht stimmte. Sein Vater lief zu ihm und hob ihn vom Boden auf. Er drückte ihn fest an seine Brust und trug ihn durch den Flur ins Hauptschlafzimmer, setzte den Jungen vor dem Wandschrank ab. Er öffnete das Möbel und wies seinen Sohn an hineinzusteigen.
»Was ist denn los, Daddy?«
»Nichts. Wir spielen verstecken. Du bleibst da drin, bis deine Mutter dich findet, verstanden?«
»Okay.«
Der Vater wirkte hektisch, war durch irgendwas nervös geworden, aber der Junge verstand den Grund nicht. Neben ihm lag ein alter tragbarer CD-Spieler mit einem Kopfhörer. Sein Vater bückte sich und hob ihn auf.
»Ich möchte, dass du im Wandschrank bleibst und dir die Musik anhörst. Kein Mucks, okay?«
»Okay, Dad.«
Dem Vater fielen die Haare ins Gesicht, aber er strich sie nicht zurück. Er legte dem Jungen die Hände auf die Schultern und blickte ihm in die Augen. »Egal, was passiert«, sagte er, »egal, was du siehst oder hörst, du bleibst bei der Musik, konzentrierst dich auf die Musik. Auf nichts anderes. Und steig erst wieder aus dem Wandschrank, wenn ich es sage, okay?«
»Was ist denn los, Dad?«
Der Vater setzte ihm den Kopfhörer auf. »Hör einfach der Musik zu, Junge. Konzentrier dich auf sie. Der Herr wird dich beschützen.« Er küsste den Jungen auf die Stirn und flüsterte: »Ich liebe dich, Sohn, und deine Mutter tut es auch. Immer.«
Der Vater des Jungen drückte eine Taste am Walkman und schloss die Schranktür. Es war dunkel hier drinnen. Das einzige Licht fiel in dünnen Streifen zwischen den Holzlatten der Tür herein.
Konzentrier dich auf die Musik.
Der Junge folgte den Anweisungen des Vaters, auch wenn ihm die Wendung »Der Herr wird dich beschützen« Kopfzerbrechen bereitete. Vor was beschützen? Er stellte sich diese Frage nur ein Mal, ehe ihn die Musik ablenkte. Seine Mutter spielte diese Stücke fortwährend ab. Es handelte sich um eine Zusammenstellung ihrer liebsten katholischen Kirchenlieder, aufgeführt vom örtlichen Kirchenchor. Das Lied, das ihm durch die Kopfhörer bis in die Seele drang, war Stille Nacht. Dem Jungen gefiel dieses Lied, denn es war das Lieblingslied seiner Mutter. Sie sang es ihm immer vor dem Schlafengehen vor, wenn Weihnachten näher rückte. Er war allerdings inzwischen sieben Jahre alt, und die Zeiten, in der er auf dem Schoß seiner Mutter gesessen und ihrer schönen Stimme zugehört hatte, gehörten der Vergangenheit an. Lego und Spielzeugwaffen waren jetzt seine Welt.
Nach der ersten Hälfte von Stille Nacht hörte er einen lauten Knall und fuhr zusammen. Ein Knall bedeutete gewöhnlich das Ende von irgendwas, das Platzen eines Ballons oder eines Reifens. Der Junge hatte beides schon mal gehört, aber beides war nicht so laut gewesen wie der Knall, aufgrund dessen er jetzt im Wandschrank zitterte.
Konzentrier dich auf die Musik.
Die Worte des Vaters fielen ihm wieder ein. Der Junge bemühte sich sehr, den Text zu verstehen und alle anderen Gedanken auszusperren. Manche der Worte schienen für ihn keinen Sinn zu ergeben und hatten dies auch noch nie getan. Es waren die wohltuenden Stimmen der Sänger, die dem Lied seine Schönheit verliehen, nicht der Text. Während ruhigerer Liedpassagen hörte er Schreie aus dem Wohnzimmer – die Schreie einer Frau. War seine Mutter früher von der Arbeit gekommen?
Konzentrier dich auf die Musik, Junge.
Eine Träne lief ihm über die Wange. Ihm war nicht klar, was genau ihn zum Weinen brachte, aber er wusste, dass er Angst hatte. Er fand dieses Spiel mit seinem Vater jetzt nicht mehr so schön wie den Unfug, den sie sonst trieben. Die Luft im Wandschrank war dick und muffig. Die Lichtbalken, die durch die Schlitze in der Tür hereinfielen, hoben die Staubflocken hervor, die rings um den Jungen tanzten. Er war allein, und nur die Stimmen des Kirchenchors leisteten ihm Gesellschaft.
Als Stille Nacht zu Ende war, blieb es zwei Sekunden lang still, ehe das nächste Lied einsetzte. In diesen beiden Sekunden hörte der Junge einen Mann im angrenzenden Zimmer schreien. Er hätte nicht sagen können, ob es die Stimme seines Vaters war.
Das nächste Lied auf der CD war Amazing Grace. Es war ein Lied, das er für mehrere Jahre nicht mehr hören würde. Denn es würde ihn stets an den Tag erinnern, an dem seine Eltern ermordet wurden. Und an den Augenblick, in dem er ihrem Mörder in die Augen blickte.
Ein kleiner untersetzter Mann in blauem Trainingsanzug und mit einer schwarzen Skimütze über dem Gesicht betrat das Schlafzimmer. In der Hand hielt er ein langes scharfes Messer, ganz von rotem Blut befleckt. Dem Blut der Eltern des Jungen.
Die stechenden grünen Augen des Mannes mit der Skimütze streiften durch das Zimmer und blieben schließlich auf der Tür des Wandschranks ruhen. Diese Augen starrten den Jungen durch die Ritzen direkt an. Der Mann tat einen Schritt auf den Schrank zu, ehe ihn etwas ablenkte. Dem Jungen würde erst später klar werden, dass es der Klang einer Polizeisirene war, nur einige Häuserblocks entfernt. Der Mann mit der Skimütze warf noch einen letzten Blick auf den Wandschrank, drehte sich dann um und verschwand aus dem Zimmer. Wie ein Schatten, der sich in der Dunkelheit auflöste.
Der Junge blieb im Schrank sitzen und konzentrierte sich noch zehn weitere Minuten auf die Musik, bis erneut ein Mann das Schlafzimmer betrat. Es war Devon Pincent, ein Freund seines Vaters. Er hielt eine Pistole in der Hand und bewegte sich ganz vorsichtig, für den Fall, dass der Eindringling noch im Haus war. Das traf jedoch nicht zu. Er hatte sich längst verzogen.
Devon sah sich im Schlafzimmer um und zielte mit der Pistole auf alles, was er ins Auge fasste. Schließlich blieb sein Blick wie zuvor der des Mannes mit der Skimütze auf dem Wandschrank ruhen. Er näherte sich zögernd mit angelegter und schussbereiter Waffe. Er streckte die freie Hand aus und öffnete die Schranktür. Als er den Jungen erblickte, steckte er die Pistole ins Holster unter der Jacke. Er nahm dem Jungen die Kopfhörer ab.
»Hallo, Joey«, sagte er. »Du musst jetzt mit mir kommen. Du musst dabei aber die Augen geschlossen halten, okay?«
Devon hob ihn auf und trug ihn aus dem Haus zu einer bereitstehenden Ambulanz. Aber Joey hielt die Augen nicht geschlossen. Er sah alles.
Die Nonne
Schwester Claudia spazierte eines kalten Morgens im September ins Lokal The Orient Express und erwartete wenig mehr als ein schnelles Frühstück mit ihrem alten Freund Pete. Es lag genau sechs Monate zurück, dass sie ihn zuletzt gesehen hatte; ein Zeitraum, der sich zur Routine entwickelt hatte, seit sie vor drei Jahren nach Boston umgezogen war.
Der Orient Express war einer dieser effektheischenden Diner, die in den mittleren Neunzigern überall in der Stadt emporgeschossen waren, wenngleich sich niemand so richtig erinnern konnte, weshalb eigentlich. Das Besondere dieses Ladens bestand darin, dass er von außen wie ein Eisenbahnzug aussah. Wenn man eingetreten war, wurde man vor die Wahl gestellt, sich einen von zwei Waggons auszusuchen, die beiderseits der Theke platziert waren. Wie jedoch jeder bestätigen kann, der jemals in der zweiten Klasse eines Zuges gegessen hat, ist diese Form des Speisens eher eine schlechte und ungemütliche Wahl. Im Orient Express aß man nur deshalb besser als in einem echten Zug, weil es nicht mit hundert Meilen pro Stunde durch die Gegend bretterte, während man versuchte, seine Mahlzeit zu verdauen.
Claudia hatte dieses Diner seit ihrer letzten Begegnung mit Pete nicht mehr betreten. Es gefiel ihr hier nicht, weil es stets geschäftig und lärmend zuging. Der heutige Tag bildete da keine Ausnahme. Die meisten der Tische in beiden Waggons waren besetzt, und die Kunden hielten einen nervtötenden Geschwätzpegel aufrecht. Der CD-Spieler auf dem Tresen spielte den Song Fast Train von Solomon Burke; ja, einer der ärgerlichsten Aspekte dieses Ladens war die Musik. Hier liefen nur Stücke mit dem Wort Train im Titel, was bedeutete, dass die gleiche Handvoll Songs fortlaufend heruntergedudelt wurden. Claudia hatte Fast Train schon oft gehört. Heute tat sie das mit Sicherheit zum letzten Mal.
Sie entdeckte Pete an einem Tisch ganz hinten in einem der Waggons. Er trug die selbe alte engsitzende braune Lederjacke, in der er schon seit zehn Jahren quasi wohnte, und eine Stoffmütze, die eine neue Errungenschaft seines gewohnten Looks darstellte. Er entdeckte Claudia und winkte sie heran. Selbst aus der Distanz erkannte sie, dass er abgenommen hatte, wenigstens im Gesicht. Vor sechs Monaten hatte er noch ein verschwollenes rotes Gesicht gehabt, die Folge von Biergenuss zum Frühstück, Mittag- und Abendessen. Heute zeigte er sich als gesund wirkender kleiner Bursche in den frühen Fünfzigern. Viel hatte sich sonst an ihm jedoch nicht verändert. Der Ausdruck von Verschlagenheit, die struppigen Augenbrauen und die gelben lückenhaften Zähne erweckten immer noch den Eindruck, dass er die Sorte Typ war, die eine alte Dame mit vorgehaltenem Messer ausraubte, wenn sich eine günstige Gelegenheit bot.
Claudia manövrierte sich auf den Platz ihm gegenüber, was keine leichte Sache ist, wenn man einen langen schwarzen Nonnenhabit trägt. Unter dem Tisch bestand nur minimale Beinfreiheit, und sobald sie Pete direkt gegenübersaß, stellte Claudia fest, dass sie mit ihren Knien gegen seine stieß.
»Guten Morgen, Pete. Schön, dich zu sehen«, sagte sie.
»Ja, ja, du siehst auch gut aus«, erwiderte Pete und erinnerte sie daran, dass er in Sachen Small Talk beschissen abschnitt.
»Hast du etwas für mich?«, fragte Claudia.
Pete griff in seine Jacke und holte einen dicken gelben Umschlag hervor. Er schob ihn über den Tisch zu Claudia hinüber. Der Umschlag war nicht geschlossen, sodass man den Inhalt leicht erkennen konnte. Und er enthielt das, was Claudia gehofft hatte: einen Haufen schmutziger Fünfzig-Dollar-Scheine.
»Zwanzigtausend«, sagte Pete. »Du brauchst nicht nachzuzählen.«
Claudia nahm den Umschlag zur Hand und blätterte durch die Scheine; nicht um sie zu zählen, sondern mehr zur Prüfung, ob wirklich alles Fünfziger waren. Es sah danach aus, also enthielt der Umschlag fast mit Sicherheit zwanzigtausend Dollar, vielleicht ein paar hundert mehr oder weniger.
»Bleibst du heute für ein Getränk?«, fragte Pete sie.
»Natürlich.«
Claudia steckte den Umschlag in eine Tasche ihres Habit, während Pete die Bedienung heranwinkte. Eine kleine kurvenreiche Dame tauchte neben Claudia auf.
»Bitte einen Kaffee für meine Freundin, Trudie«, sagte Pete.
»Sonst noch etwas?«
Claudia hätte sich die Speisekarte gerne gründlicher angesehen, aber sie wusste, dass Trudie wenig Geduld für Personen aufbrachte, die sich für ihre Bestellung Zeit nahmen. »Ich hatte einen guten Zitronenkuchen, als ich zuletzt hier war«, sagte Claudia. »Ich hätte gern ein Stück davon, wenn ihr den nach wie vor habt.«
Trudie hielt die Bestellung auf ihrem Notizblock fest, steckte sich den Stift hinters Ohr und kehrte zur Theke zurück. Pete blickte ihr über Claudias Schulter nach und bewunderte ihren Hintern, ohne auch nur eine Spur von Diskretion zu zeigen.
»Sie ist verheiratet«, sagte Claudia. »Mit einem hiesigen Gangster.«
Pete schien sie nicht zu verstehen. »Diese Frau hat einen tollen Arsch«, sagte er.
»Wie ich sagte, sie ist verheiratet.«
Pete sah Claudia an. »Das ist unwichtig.«
»Vielleicht für dich, aber für Trudie ist es wichtig. Du hast keine Chance. Außerdem ist sie vierunddreißig. Viel zu jung für dich.«
»Hält mich nicht davon ab, sie anzustarren.«
»Irgendwelche Nachrichten von zu Hause?«
Pete schien von der Frage überrascht. »Was zum Beispiel?«
»Wie geht es meinem Bruder?«
»Keine Ahnung. Ich sehe ihn nie.«
»Hörst du irgendwas von ihm?«
»Nur, dass er viel reist. Zumeist in Europa.«
»Hat er jemanden kennengelernt?«
»Ich denke mal, dass er viele Leute kennengelernt hat. Was ist das denn für eine Frage?«
»Ich meine eine Frau. Ich dachte immer, er hätte sich inzwischen häuslich niedergelassen.«
Pete runzelte die Stirn. »Ist das wirklich das, was du mich fragen möchtest?«
»Vermutlich nicht. Ich wollte nur wissen, ob da irgendwas ist. Weißt du etwas, das ich deiner Meinung nach erfahren müsste? Ob er zum Beispiel mit diesem Besitz, den ich ihm gegeben habe, Geld machen konnte.«
»Ich weiß einen Scheiß. Ich bin niemand, den sie informieren. Ich bin der Typ, der die Päckchen überbringt.«
»Ich weiß, aber …« Gespiegelt in einem Fenster in der Nähe sah Claudia, wie Trudie zurückkam. Die Kellnerin trug ein Tablett mit einer Tasse Kaffee und einem Stück Zitronenbiskuit-Torte. Sie blieb am Tisch stehen und stellte das Tablett vor Claudia, nahm den Becher Kaffee und stellte ihn auf den Tisch.
»Danke, Trudie.«
»Kein Problem.« Trudie platzierte den Kuchenteller neben dem Kaffee. »Frank sagt, der Zitronenkuchen geht heute aufs Haus.«
Als er hörte, dass es den Kuchen kostenlos gab, entwickelte Pete ebenfalls unvermittelt Interesse daran. »Kannst du mir auch ein Stück bringen?«, fragte er.
»Tut mir leid«, sagte Trudie. »Das war das letzte Stück. Wir waren kurz davor, den Kuchen wegzuwerfen. Er müsste noch okay sein. Aber wenn er zu trocken ist, lass ihn einfach stehen.«
Claudia lächelte. »Ich bin überzeugt, dass er schmeckt, danke.«
Trudie nahm noch einige Servietten vom Tablett und legte sie auf den Tisch. Claudia entdeckte einen kleinen weißen Briefumschlag auf dem Tablett, der bislang von den Servietten verdeckt gewesen war. Darauf standen in blauer Tinte zwei Wörter notiert, die sie regelrecht ansprangen:
Schwester Claudia
»Ist das für mich?«, fragte sie und deutete darauf.
Trudie schien ebenso überrascht, den Umschlag zu sehen, wie Claudia. Sie nahm ihn zur Hand und brauchte ein Zeitalter, um die beiden Wörter darauf zu lesen.
»Dein Name steht drauf«, stellte sie schließlich fest. »Ich weiß aber nicht, woher er kommt.« Sie reichte ihn an Claudia.
Pete sah den Umschlag neugierig an. »Was ist das?«, fragte er.
»Es ist ein Briefumschlag«, sagte Claudia. »Wofür hast du es denn gehalten? Für einen Löffel?«
»Nicht nötig, sarkastisch zu werden.«
Trudie hob das Tablett auf und wandte sich ab, um zur Theke zurückzugehen. Pete packte sie am Arm und hielt sie fest.
»Von wem stammt der?«, wollte er wissen.
Trudie entzog ihm ihren Arm und machte deutlich, dass sie nicht darauf stand, von einem Kunden begrabscht zu werden. »Das weiß ich so wenig wie du«, sagte sie abwehrend. »Jemand muss ihn aufs Tablett gelegt haben, als ich gerade nicht hingesehen hab. Ich frag mal Frank, ob er von ihm stammt.«
Sie kehrte zur Theke zurück, während Pete erneut einige Sekunden lang ihren Arsch anglotzte. Claudia räusperte sich und unterbrach seine Konzentration.
»Das ist schräg, findest du nicht?«, fragte sie.
»Vielleicht ein heimlicher Verehrer?«
»Gibt nur eine Möglichkeit das herauszufinden.«
Claudia öffnete den Umschlag. Ein weißer Zettel, einmal gefaltet, steckte darin. Sie holte ihn hervor und klappte ihn mit zitternden Fingern auf. Auf dem Zettel stand eine kurze handschriftliche Mitteilung. Sie lautete:
Eine der Personen in diesem Diner wird dich gleich umbringen.
Rate mal, wer?
Drei Killer für ein Halleluja
»Der Papst wird in einer Woche ermordet.«
Rodeo Rex knallte seine Flasche Bier der Marke Shitting Monkey auf den Tresen. »Ach, komm schon!«, blaffte er. »Du denkst dir diesen Scheiß doch aus! Du erwartest doch nicht wirklich, dass ich das glaube?«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!