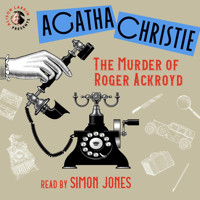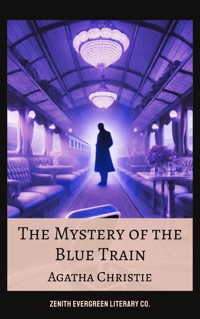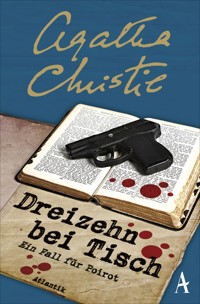
9,99 €
Mehr erfahren.
Die verwöhnte Schauspielerin Jane Wilkinson will sich von ihrem Ehemann Lord Edgware scheiden lassen und bittet Hercule Poirot um Beistand. Als ihr Gatte kurz darauf tot aufgefunden wird, scheint die Sachlage klar. Doch nach und nach tauchen immer mehr Ungereimtheiten auf. Jane dinierte zur Tatzeit mit 12 Freunden, gleichzeitig gibt es Zeugen, die sie am Tatort gesehen haben wollen. Hercule Poirot braucht seinen ganzen detektivischen Spürsinn, um dem Komplott der Dreizehn bei Tisch auf die Schliche zu kommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Agatha Christie
Dreizehn bei Tisch
Ein Fall für Poirot
Aus dem Englischen von Giovanni und Ditte Bandini
Atlantik
Für Dr und Mrs Campbell Thompson
1Ein Theaterabend
Das Publikum hat ein kurzes Gedächtnis. Schon sind das lebhafte Interesse und die Aufregung um den Mord an George Alfred St Vincent Marsh, dem 4. Baron Edgware, verflogen und vergessen. Neuere Sensationen sind an seine Stelle getreten.
Mein Freund Hercule Poirot wurde nie explizit mit dem Fall in Zusammenhang gebracht. Dies entsprach, wie ich versichern kann, durchaus seinem Wunsch. Er zog es vor, in der Berichterstattung nicht vorzukommen. Die Ehre wurde anderen zuteil – und genau so wünschte er es. Hinzu kam, dass der Fall, aus Poirots persönlicher Sicht, zu seinen Misserfolgen gehörte. Er schwört immer wieder, auf die richtige Fährte habe ihn nur die zufällige Bemerkung eines Unbekannten auf der Straße gebracht.
Wie dem auch sei, es war sein Genie, das die Wahrheit ans Licht brachte. Ohne Hercule Poirot wäre das Verbrechen nach meinem Dafürhalten wohl nie aufgeklärt worden.
Daher glaube ich, dass für mich die Zeit gekommen ist, alles, was ich über die Angelegenheit weiß, zu Papier zu bringen. Ich bin mit dem Fall bestens vertraut, und ich darf hinzufügen, dass ich, indem ich das tue, dem Wunsch einer äußerst faszinierenden Dame entspreche.
Ich habe oft an den Tag in Poirots peinlich sauberem kleinen Wohnzimmer zurückgedacht, an dem mein kleiner Freund uns, einen bestimmten Streifen Teppich auf und ab schreitend, sein meisterhaftes, verblüffendes Resümee des Falles vortrug. Ich werde meine Erzählung dort einsetzen lassen, wo er damals selbst begann – in einem Londoner Theater im Juni vergangenen Jahres.
Damals war Carlotta Adams der Stern am Londoner Theaterhimmel. Im Jahr zuvor hatte sie ein paar Matineen gegeben, die ein rauschender Erfolg gewesen waren. Dieses Jahr hatte sie ein dreiwöchiges Gastspiel absolviert, das mit dem nächsten Abend auslaufen würde.
Carlotta Adams war ein amerikanisches Mädchen mit einem erstaunlichen Talent für Soloszenen, bei denen sie völlig ohne Maske oder Requisiten auskam. Sie schien jede Sprache perfekt zu beherrschen. Ihr Sketch »Ein Abend in einem internationalen Hotel« erregte allgemeine Bewunderung. Nacheinander huschten amerikanische Touristen, deutsche Reisende, brave englische Bürgerfamilien, Damen von zweifelhaftem Ruf, verarmte russische Aristokraten und müde verbindliche Kellner über die Bühne.
Die Stimmung ihrer Szenen wechselte von tragisch zu komisch und wieder zurück. Ihre in einem Krankenhaus sterbende Tschechin schnürte einem die Kehle zu. Eine Minute später bogen wir uns vor Lachen angesichts eines Zahnarztes, der, während er seinem Handwerk nachging, leutselig auf seine Opfer einplauderte.
Ihr Programm endete mit »Einigen Imitationen«.
Auch hier bewies sie eine erstaunliche Begabung. Ohne jegliche Maske schienen ihre Gesichtszüge plötzlich zu zerfließen und sich zu denen eines namhaften Politikers oder einer berühmten Schauspielerin oder einer Schönheit der feinen Welt wieder zusammenzufügen. In jeder Rolle hielt sie eine kurze, charakteristische Ansprache. Diese Monologe waren übrigens bemerkenswert intelligent. Sie schienen jede Schwäche der dargestellten Person auf den Punkt zu bringen.
Eine der letzten Persönlichkeiten, die sie imitierte, war Jane Wilkinson – eine in London sehr bekannte, talentierte junge amerikanische Schauspielerin. Sie machte es wirklich sehr geschickt. Sie gab die größten Plattitüden von sich, doch mit so bedeutungsschwangerem Ausdruck, dass man wider besseres Wissen das Gefühl hatte, tiefsinnige Wahrheiten zu vernehmen. Ihre Stimme, von exquisiter Intonation und rauchiger Tiefe, war berückend. Die beherrschten, aber stets seltsam bedeutungsvollen Gesten, die sich leicht wiegende Gestalt, ja selbst der Eindruck großer physischer Schönheit – wie sie das alles zuwege brachte, ist mir ein Rätsel!
Ich bin von jeher ein Bewunderer der schönen Jane Wilkinson gewesen. Sie hatte mich in ihren sentimentalen Rollen bezaubert, und ich hatte all denen gegenüber, die zwar ihre Schönheit einräumten, aber erklärten, sie sei keine Schauspielerin, stets beteuert, sie besitze beachtliche darstellerische Fähigkeiten.
Es war ein bisschen unheimlich, diese wohlbekannte, leicht rauchige Stimme und die fatalistisch abfallende Satzmelodie, die mich so oft bewegt hatte, zu hören und diese scheinbar schmerzvolle Geste zu sehen, wie sie die Hand langsam ballte und wieder öffnete, und die jähe Bewegung, mit der sie den Kopf in den Nacken warf und dabei das Haar aus dem Gesicht schüttelte, mit der sie, wie mir jetzt aufging, jede dramatische Szene grundsätzlich beendete.
Jane Wilkinson war eine dieser Schauspielerinnen, die nach ihrer Heirat die Bühne verlassen hatten, nur um ein paar Jahre später zu ihr zurückzukehren.
Drei Jahre zuvor hatte sie den wohlhabenden, aber leicht exzentrischen Lord Edgware geheiratet. Einem Gerücht zufolge hatte sie ihn schon kurz darauf verlassen. Jedenfalls drehte sie achtzehn Monate nach der Hochzeit in Amerika einen Film und war in dieser Saison in einem erfolgreichen Bühnenstück in London aufgetreten.
Während ich Carlottas gekonnte, wenn auch möglicherweise leicht boshafte Imitation verfolgte, drängte sich mir die Frage auf, was die jeweiligen Opfer von solchen Nachahmungen wohl halten mochten. Freute es sie, so bekannt zu sein, dass man sie schon imitierte – und sie dadurch noch bekannter wurden? Oder fühlten sie sich bloßgestellt und ärgerten sich darüber? Verhielt sich Carlotta Adams nicht wie ein Zauberkünstler, der über die Darbietung eines Kollegen sagt: »Ach, das ist ein uralter Trick! Kinderleicht. Ich zeige Ihnen, wie das geht!«
Ich entschied, dass ich mich in einer solchen Lage sogar sehr geärgert hätte. Ich hätte meinen Ärger natürlich überspielt, aber gefallen hätte es mir ganz gewiss nicht. Man musste schon sehr tolerant sein und einen ausgeprägten Sinn für Humor haben, um eine so unbarmherzige Bloßstellung würdigen zu können.
Ich war gerade zu dieser Schlussfolgerung gelangt, als das entzückende rauchige Lachen von der Bühne hinter mir widerhallte.
Ich drehte mich abrupt um. Auf dem Platz direkt hinter mir saß, mit leicht geöffneten Lippen und nach vorn gebeugt, der Gegenstand der präsentierten Imitation: Lady Edgware, besser bekannt als Jane Wilkinson.
Ich begriff augenblicklich, dass ich mit meinen Schlussfolgerungen gänzlich auf dem Holzweg gewesen war. Sie lehnte sich nach vorn, in den Augen einen Ausdruck begeisterten Vergnügens.
Als die Nummer endete, spendete sie laut Beifall und wandte sich lachend ihrem Begleiter zu, einem großgewachsenen äußerst gutaussehenden Mann, Typ griechischer Gott, dessen Gesicht das Publikum eher von der Leinwand als von der Bühne her kannte. Es war Bryan Martin, der momentan beliebteste Filmheld überhaupt. Er und Jane hatten in mehreren Hollywood-Produktionen gemeinsam die Hauptrollen gespielt.
»Ist sie nicht wundervoll?«, sagte Lady Edgware.
Er lachte.
»Jane – Sie sind ja ganz aus dem Häuschen!«
»Na ja, sie ist wirklich umwerfend! Um Längen besser, als ich angenommen hatte.«
Bryans belustigte Erwiderung bekam ich nicht mehr mit. Carlotta hatte mit einer neuen Improvisation begonnen.
Was später geschah, wird mir immer als eine kuriose Koinzidenz in Erinnerung bleiben.
Nach dem Theater gingen Poirot und ich zum Souper ins Savoy.
An unserem Nebentisch saßen Lady Edgware, Bryan Martin und zwei weitere Personen, die ich nicht kannte. Gerade als ich Poirot auf sie aufmerksam machte, kam ein anderes Paar herein und nahm wiederum einen Tisch weiter Platz. Das Gesicht der Frau kam mir vertraut vor, trotzdem konnte ich es im ersten Moment seltsamerweise nicht unterbringen.
Dann ging mir plötzlich auf, dass die Frau, die ich anstarrte, Carlotta Adams war! Den Mann kannte ich nicht. Er war gepflegt und hatte ein fröhliches, ziemlich nichtssagendes Gesicht. Nicht die Sorte Mensch, die ich sonderlich schätze.
Carlotta trug ein ausgesprochen unscheinbares schwarzes Kleid. Ihr Gesicht war keines, das einem augenblicklich auffiel oder das man auf Anhieb wiedererkannte. Es war eines dieser wandelbaren, empfindsamen Gesichter, die sich hervorragend für die Kunst der Nachahmung eignen. Es konnte spielend fremde Merkmale annehmen, aber es besaß keinen sehr ausgeprägten eigenen Charakter.
Ich teilte Poirot diese Überlegungen mit. Er hörte, den eiförmigen Kopf leicht zur Seite geneigt, aufmerksam zu, während er die zwei fraglichen Tische mit einem scharfen Blick bedachte.
»Das da ist also Lady Edgware? Ja, ich erinnere mich – ich habe sie spielen sehen. Sie ist eine belle femme.«
»Und eine gute Schauspielerin dazu.«
»Möglicherweise.«
»Sie klingen nicht sehr überzeugt.«
»Ich denke, das wäre von der Situation abhängig, mein Freund. Wenn sie der Mittelpunkt des Stücks ist, wenn sich alles um sie dreht – ja, dann könnte sie ihre Rolle spielen. Ich bezweifle aber, dass sie imstande wäre, eine kleine Rolle – oder selbst das, was man eine Charakterrolle nennt – angemessen zu spielen. Das Stück muss über sie und für sie geschrieben sein. Sie scheint mir zu der Sorte Frauen zu gehören, die sich ausschließlich für sich selbst interessieren.« Er schwieg kurz und fügte dann ziemlich unerwartet hinzu: »Solche Menschen führen ein Leben in ständiger Gefahr.«
»Gefahr?«, sagte ich verblüfft.
»Ich habe ein Wort gebraucht, das Sie, wie ich sehe, überrascht, mon ami. Ja, Gefahr. Denn, verstehen Sie, eine Frau wie diese sieht nur eins – sich selbst. Solche Frauen sehen nichts von den Gefahren und Risiken, die sie umgeben – den Millionen widerstreitenden Interessen und Beziehungen des Lebens. Nein, sie sehen nur den Weg, der vor ihnen liegt. Und so – früher oder später – Katastrophe!«
Mein Interesse war geweckt. Ich gestand mir ein, dass ich nicht darauf gekommen wäre, die Sache so zu betrachten.
»Und die andere?«
»Miss Adams?«
Sein Blick schweifte zu ihrem Tisch.
»Nun?«, sagte er mit einem Lächeln. »Was möchten Sie von mir über sie hören?«
»Nur, welchen Eindruck sie auf Sie macht.«
»Mon cher, bin ich heute Abend die Wahrsagerin, die aus der Hand liest und den Charakter deutet?«
»Sie könnten es bestimmt besser als die meisten«, gab ich zurück.
»Es ist sehr hübsch, dass Sie so von mir überzeugt sind, Hastings. Es rührt mich. Wissen Sie denn nicht, mein Freund, dass jeder von uns ein dunkles Geheimnis ist, ein Labyrinth von widerstreitenden Leidenschaften und Begehrlichkeiten und Einstellungen? Mais oui, c’est vrai. Man fällt seine kleinen Urteile – aber in neun von zehn Fällen liegt man falsch.«
»Nicht Hercule Poirot«, sagte ich lächelnd.
»Selbst Hercule Poirot! Ach! Ich weiß sehr wohl, dass Sie immer diese kleine fixe Idee haben, ich sei eingebildet, aber in Wirklichkeit, versichere ich Ihnen, bin ich ein sehr bescheidener Mensch.«
Ich lachte.
»Sie – bescheiden!«
»So ist es. Sieht man davon ab – ich gestehe es –, dass ich ein bisschen stolz auf meinen Schnurrbart bin. Nirgendwo in London habe ich etwas beobachtet, was sich mit ihm vergleichen ließe.«
»Sie können beruhigt sein«, sagte ich trocken. »Das werden Sie auch nicht. Sie wollen also kein Urteil über Carlotta Adams riskieren?«
»Elle est artiste!«, sagte Poirot schlicht. »Damit ist doch fast alles gesagt, nicht?«
»Wie auch immer, Sie glauben also nicht, dass sie gefährdet durchs Leben geht?«
»Das tun wir alle, mein Freund«, sagte Poirot feierlich. »Überall kann das Unheil darauf lauern, über uns hereinzubrechen. Aber was Ihre Frage betrifft, so glaube ich, dass Miss Adams Erfolg haben wird. Sie ist begabt, und sie ist mehr als das. Ihnen ist doch gewiss nicht entgangen, dass sie Jüdin ist?«
Das war es tatsächlich. Aber jetzt, wo er es sagte, nahm ich die schwachen Anzeichen einer semitischen Abstammung wahr. Poirot nickte.
»Das prädestiniert sie zum Erfolg. Eine mögliche Gefahrenquelle – da Gefahr nun unser Thema ist – sehe ich allerdings doch.«
»Und zwar?«
»Liebe zum Geld. Die Liebe zum Geld könnte so eine Person vom Weg der Klugheit und der Vorsicht ablenken.«
»Das gilt für jeden von uns«, sagte ich.
»Wohl wahr, aber auf alle Fälle würden Sie oder ich die damit verbundene Gefahr erkennen. Wir könnten das Für und Wider abwägen. Wenn einem aber zu viel am Geld liegt, dann sieht man nur noch das Geld, alles andere liegt im Schatten.«
Ich lachte über seinen feierlichen Ernst.
»Esmeralda, die Zigeunerkönigin, ist in allerbester Form«, spöttelte ich.
»Die Psychologie des Charakters ist ein interessantes Gebiet«, entgegnete Poirot ungerührt. »Man kann sich nicht für das Verbrechen interessieren, ohne sich auch für Psychologie zu interessieren. Was den Fachmann fesselt, ist nicht die bloße Mordtat, es ist das, was sich dahinter verbirgt. Können Sie mir folgen, Hastings?«
Ich sagte, das könne ich durchaus.
»Mir ist aufgefallen, dass, wenn wir gemeinsam an einem Fall arbeiten, Sie mich fortwährend zu physischem Handeln drängen. Sie möchten, dass ich Fußabdrücke vermesse, Zigarettenasche analysiere, mich auf den Bauch lege, um noch die kleinsten Details zu begutachten. Sie begreifen einfach nicht, dass man mit geschlossenen Augen in einem Sessel zurückgelehnt jedem Problem weit eher auf den Grund kommen kann. Dann sieht man die Lösung mit dem geistigen Auge.«
»Ich nicht«, sagte ich. »Wenn ich mich mit geschlossenen Augen in einem Sessel zurücklehne, dann passiert nur eins, ohne Ausnahme!«
»Das ist mir schon aufgefallen!«, sagte Poirot. »Es ist merkwürdig. In solchen Augenblicken müsste das Gehirn eigentlich fieberhaft arbeiten, nicht in schlaffe Ruhe versinken. Die Aktivität des Geistes ist etwas so Interessantes, so Stimulierendes! Den kleinen grauen Zellen zu tun zu geben ist ein geistiger Hochgenuss. Sie und nur sie können einen zuverlässig durch den Nebel zur Wahrheit führen …«
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mir angewöhnt habe, sobald Poirot seine kleinen grauen Zellen erwähnt, an etwas anderes zu denken. Das habe ich alles schon bis zum Überdruss gehört.
In diesem speziellen Fall schweifte meine Aufmerksamkeit zu den vier Personen ab, die am Nachbartisch saßen. Als Poirots Monolog sich seinem Ende zuneigte, bemerkte ich schmunzelnd:
»Sie haben eine Eroberung gemacht, Poirot. Die liebliche Lady Edgware kann den Blick nicht von Ihnen wenden.«
»Zweifelsohne hat man sie über meine Identität informiert«, sagte Poirot, erfolglos um eine bescheidene Miene bemüht.
»Ich glaube, es liegt an dem berühmten Schnurrbart«, sagte ich. »Sie ist von seiner Schönheit berückt.«
Poirot liebkoste verstohlen sein Schmuckstück.
»Es stimmt schon, dass er einmalig ist«, räumte er ein. »Ach, mein Freund, Ihre ›Bürste‹, wie Sie sie nennen – sie ist ein Graus – ein Gräuel – eine mutwillige Verstümmelung der Gaben der Natur! Trennen Sie sich von ihr, mein Freund, ich flehe Sie an!«
»Beim Zeus«, sagte ich, Poirots Appell keine Beachtung schenkend. »Die Dame steht auf. Ich glaube gar, sie will uns ansprechen. Bryan Martin erhebt Einwände, aber sie hört nicht auf ihn.«
Und tatsächlich erhob sich Jane Wilkinson ungestüm von ihrem Platz und rauschte an unseren Tisch. Poirot stand auf und verneigte sich, und ich stand ebenfalls auf.
»M. Poirot, nicht wahr?«, sagte die weiche, rauchige Stimme.
»Zu Ihren Diensten.«
»M. Poirot, ich möchte mit Ihnen sprechen. Ich muss mit Ihnen sprechen.«
»Aber gewiss, Madame, möchten Sie nicht Platz nehmen?«
»Nein, nein, nicht hier. Ich will ungestört mit Ihnen reden. Wir gehen direkt hinauf in meine Suite.«
Bryan Martin war ihr gefolgt und sagte jetzt mit einem missbilligenden Lachen:
»Sie müssen sich noch ein bisschen gedulden, Jane. Wir sind mitten beim Essen. M. Poirot ebenfalls.«
Aber Jane Wilkinson ließ sich nicht so leicht von ihrem Entschluss abbringen.
»Na und, Bryan, was macht das schon? Wir lassen uns eben oben in der Suite auftragen. Veranlassen Sie das, seien Sie so gut. Ach und, Bryan –«
Als er sich schon abwandte, folgte sie ihm und schien ihm irgendetwas einzuschärfen. Ich hatte den Eindruck, dass er damit nicht einverstanden war – er schüttelte den Kopf und runzelte die Stirn. Sie jedoch sprach umso eindringlicher auf ihn ein, und schließlich gab er achselzuckend nach.
Ein, zwei Mal während ihrer Ansprache hatte sie kurz zum Tisch hinübergeschaut, an dem Carlotta Adams saß, und ich fragte mich, ob das, was sie sagte, etwas mit dem amerikanischen Mädchen zu tun haben mochte.
Nachdem sie sich durchgesetzt hatte, kam Jane strahlend zurück.
»Wir gehen jetzt hinauf«, sagte sie und bezog mich mit einem betörenden Lächeln mit ein.
Die Frage, ob wir mit ihrem Plan einverstanden waren, schien ihr überhaupt nicht in den Sinn zu kommen. Ohne ein Wort der Entschuldigung übernahm sie einfach das Kommando.
»Es ist ein unglaubliches Glück, dass ich Sie heute Abend hier treffe, M. Poirot«, sagte sie, während sie zum Lift vorausging. »Es ist wunderbar, wie sich alles für mich zu fügen scheint. Gerade zermarterte ich mir noch das Gehirn, was in aller Welt ich wohl tun sollte, und da schaue ich auf und sehe Sie am nächsten Tisch sitzen. Und ich sage zu mir: ›M. Poirot wird mir raten, was zu tun ist.‹«
Sie unterbrach sich, um dem Lift-Boy »Zweiter Stock!« zu befehlen.
»Wenn ich Ihnen behilflich sein kann –«, setzte Poirot an.
»Ganz bestimmt können Sie das. Ich habe mir sagen lassen, Sie seien der allerwunderbarste Mann, der je existiert hat. Jemand muss mich aus dem Schlamassel herausholen, in dem ich stecke, und ich habe das sichere Gefühl, Sie sind genau der Richtige dafür.«
Wir stiegen im zweiten Stock aus, und sie ging uns den Korridor entlang voraus, blieb kurz vor einer Tür stehen und trat in eine der luxuriösesten Suiten des Savoy.
Ihre weiße Pelzstola auf einen Stuhl und ihr juwelenbesetztes Handtäschchen auf den Tisch werfend, ließ sich die Schauspielerin in einen Sessel fallen und rief aus:
»M. Poirot, irgendwie muss ich einfach meinen Mann loswerden!«
2Ein Abendessen
Nach einem sprachlosen Augenblick hatte Poirot sich wieder gefasst.
»Aber Madame«, sagte er blinzelnd, »Ehemänner loswerden ist nicht meine Spezialität.«
»Nun, das ist mir natürlich bekannt.«
»Was Sie brauchen, ist ein Anwalt.«
»Und genau da irren Sie sich. Von Anwälten habe ich die Nase voll. Ich hatte ehrliche Anwälte und Winkeladvokaten, und nicht einer von ihnen hat mir irgendetwas genützt. Rechtsanwälte kennen nur das Gesetz, so etwas wie gesunden Menschenverstand scheinen sie nicht zu besitzen.«
»Im Gegensatz zu mir, glauben Sie?«
Sie lachte.
»Ich habe mir sagen lassen, dass Sie es faustdick hinter den Ohren haben, M. Poirot.«
»Comment? Faustdick hinter den Ohren? Ich verstehe nicht.«
»Also – dass Sie ein ganz Gewiefter sind.«
»Madame, ich mag Köpfchen haben oder auch nicht – und tatsächlich ist Ersteres der Fall – wozu leugnen? Aber Ihre Angelegenheit fällt nicht in mein Ressort.«
»Ach, und wieso nicht? Es ist ein Problem.«
»Ah! Ein Problem?«
»Und zwar ein schwieriges«, fuhr Jane Wilkinson fort. »Wie ich Sie einschätze, sind Sie kein Mann, der sich von Schwierigkeiten abschrecken lässt.«
»Ich darf Sie zu Ihrem Scharfblick beglückwünschen, Madame. Aber trotz und alledem: Ich führe keine Ermittlungen in Scheidungssachen durch. Es ist nicht hübsch – ce métier-là.«
»Guter Mann – ich bitte Sie nicht, für mich den Spion zu spielen. Das würde zu nichts führen. Aber ich muss einfach den Mann loswerden, und ich weiß, Sie können mir sagen, wie ich das am besten anstelle.«
Hier schwieg Poirot einen Moment. Als er wieder das Wort ergriff, klang seine Stimme ganz und gar verändert.
»Sagen Sie mir zunächst eins, Madame: Warum sind Sie so erpicht darauf, Lord Edgware ›loszuwerden‹?«
Ihre Antwort kam ohne das leiseste Zögern. Sie kam, wie aus der Pistole geschossen.
»Na, das versteht sich doch von selbst. Ich will wieder heiraten. Was für einen Grund könnte ich sonst haben?«
Sie vollführte einen großen blauen unschuldigen Augenaufschlag.
»Aber eine Scheidung wäre doch gewiss mit Leichtigkeit zu erwirken?«
»Da kennen Sie meinen Ehemann schlecht, M. Poirot. Er ist – er ist –« Sie erschauderte. »Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Er ist ein komischer Mensch – er ist nicht wie andere Leute.«
Nach kurzem Schweigen fuhr sie fort:
»Er hätte niemals heiraten dürfen – wen auch immer. Ich weiß, wovon ich rede. Ich kann ihn einfach nicht beschreiben, aber er ist – komisch. Seine erste Frau, müssen Sie wissen, ist ihm weggelaufen. Hat ein drei Monate altes Baby zurückgelassen. Er hat sich nie von ihr scheiden lassen, und sie ist irgendwo im Ausland elendiglich gestorben. Dann heiratete er mich. Tja – und irgendwann war’s zu viel für mich. Er machte mir Angst. Ich verließ ihn und ging in die Staaten. Ich habe keinen Scheidungsgrund, und obwohl ich ihm selbst einen gegeben habe, weigert er sich, davon Gebrauch zu machen. Er ist irgendwie – ein Fanatiker.«
»In bestimmten amerikanischen Bundesstaaten könnten Sie eine Scheidung erzwingen, Madame.«
»Das würde mir nichts nützen, solange ich in England lebe.«
»Sie wollen in England leben?«
»Ja.«
»Wer ist der Mann, den Sie zu ehelichen gedenken?«
»Das ist genau das Problem. Der Herzog von Merton.«
Ich schnappte nach Luft. Am Herzog von Merton hatte sich bislang noch jede kuppelwillige Mutter die Zähne ausgebissen. Ein junger Mann von mönchischer Veranlagung, ein eingefleischter Anglo-Katholik, stand er Gerüchten zufolge gänzlich unter der Fuchtel seiner Mutter, der ehrfurchteinflößenden Herzoginwitwe. Er führte ein Leben äußerster Sittenstrenge. Er sammelte chinesisches Porzellan, und man sagte ihm einen tiefen Sinn für das Schöne nach. Es hieß, er mache sich nichts aus Frauen.
»Ich bin einfach verrückt nach ihm«, sagte Jane gefühlvoll. »Er ist anders als jeder andere, den ich je gekannt habe, und Merton Castle ist zu hinreißend. Die ganze Sache ist das Romantischste, was man sich nur vorstellen kann. Dazu sieht er auch noch unglaublich gut aus – wie ein verträumter Mönch irgendwie.«
Sie hielt inne.
»Nach meiner Heirat werde ich das Theater aufgeben. Es bedeutet mir ohnehin nichts mehr.«
»Bedauerlicherweise«, sagte Poirot trocken, »steht Lord Edgware diesen romantischen Träumen im Wege.«
»Ja – und das treibt mich zum Wahnsinn.« Sie lehnte sich nachdenklich zurück. »Natürlich, wären wir in Chicago, könnte ich ihn problemlos kaltmachen lassen, aber hierzulande ist es offenbar nicht so üblich, sich an Killer zu wenden.«
»Hierzulande«, sagte Poirot lächelnd, »hängen wir der Vorstellung an, dass jeder Mensch ein Recht zu leben hat.«
»Tja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, ohne einige unserer Politiker wären wir weit besser dran, und so wie ich Edgware kenne, würde ich sagen, um ihn wär’s nicht schade – ganz im Gegenteil.«
Es klopfte an der Tür, und ein Kellner trat mit den Servierplatten ein. Ohne seine Anwesenheit zur Kenntnis zu nehmen, fuhr Jane Wilkinson fort, sich über ihr Problem zu verbreiten.
»Aber ich verlange von Ihnen nicht, dass Sie ihn für mich umbringen, M. Poirot.«
»Merci, Madame.«
»Ich dachte, vielleicht könnten Sie ihm ein paar gescheite Argumente unterbreiten. Ihn dazu bringen, sich mit dem Gedanken an die Scheidung anzufreunden. Ich bin sicher, dass Sie das könnten.«
»Ich glaube, Sie überschätzen meine Überzeugungskraft, Madame.«
»Ah! Aber irgendetwas können Sie sich doch bestimmt einfallen lassen, M. Poirot!« Sie lehnte sich nach vorn. Wieder öffneten sich ihre blauen Augen weit. »Sie möchten doch, dass ich glücklich bin, oder?«
Ihre Stimme war weich, sanft und unendlich verführerisch.
»Ich möchte, dass alle glücklich sind«, sagte Poirot ausweichend.
»Ja, aber ich hatte nicht an alle gedacht. Ich dachte da speziell an mich.«
»Ich könnte mir vorstellen, das tun Sie immer, Madame.«
Er lächelte.
»Sie halten mich für eigensüchtig?«
»Oh! Das habe ich nicht gesagt, Madame.«
»Vermutlich bin ich es. Aber Sie müssen verstehen, es ist mir so zuwider, unglücklich zu sein. Es färbt sogar auf meine Schauspielerei ab. Und ich werde ganz schrecklich unglücklich sein, wenn er nicht in die Scheidung einwilligt – oder stirbt.
Alles in allem«, fuhr sie nachdenklich fort, »wäre es viel besser, wenn er sterben würde, ich meine, ich hätte dann das Gefühl, ihn endgültiger los zu sein.«
Sie blickte Poirot Mitgefühl heischend an.
»Sie werden mir doch helfen, nicht wahr, M. Poirot?« Sie erhob sich, nahm die weiße Stola auf und blickte ihm flehentlich ins Gesicht. Ich hörte Stimmen draußen auf dem Korridor. Die Tür war nur angelehnt. »Wenn nicht –«, fuhr sie fort.
»Wenn nicht, Madame?«
Sie lachte.
»Dann werde ich mir ein Taxi nehmen, hinfahren und ihn eigenhändig kaltmachen müssen.«
Lachend verschwand sie durch eine Tür in ein angrenzendes Zimmer, gerade als Bryan Martin zusammen mit dem amerikanischen Mädchen, Carlotta Adams, und deren Begleiter sowie den zwei Personen, die mit ihm und Jane Wilkinson gespeist hatten, den Raum betrat. Letztere wurden mir als Mr und Mrs Widburn vorgestellt.
»Hallo!«, sagte Bryan. »Wo ist Jane? Ich möchte ihr sagen, dass ich den Auftrag, den sie mir erteilt hat, erfolgreich erledigt habe.«
Jane erschien in der Tür zum Schlafzimmer. Sie hielt einen Lippenstift in der Hand.
»Haben Sie sie mitgebracht? Ausgezeichnet. Miss Adams, ich habe Ihre Darbietung so bewundert! Ich wusste, ich würde Sie einfach kennenlernen müssen. Kommen Sie hier herein und plaudern Sie mit mir, während ich mir das Gesicht zurechtmache. Ich sehe absolut grauenvoll aus.«
Carlotta Adams nahm die Einladung an. Bryan Martin ließ sich in einen Sessel fallen.
»Nun, M. Poirot«, sagte er. »Sie sind plangemäß eingefangen worden. Hat unsere Jane Sie schon dazu überredet, ihre Schlacht für sie auszufechten? Sie können ebenso gut gleich nachgeben. Das Wort ›nein‹ versteht Jane einfach nicht.«
»Vielleicht ist es ihr noch nie begegnet.«
»Jane ist ein sehr interessanter Charakter«, sagte Bryan Martin. Er lag zurückgelehnt in seinem Sessel und blies träge Zigarettenrauch gegen die Decke. »Tabus haben keinerlei Bedeutung für sie. Keinen Funken Moral. Womit ich nicht sagen will, sie sei direkt unmoralisch – das ist sie nicht. ›Amoralisch‹ trifft es, glaube ich, am besten. Sieht im Leben einfach nur eins: Was Jane will.«
Er lachte.
»Ich bin davon überzeugt, sie könnte kaltlächelnd jemand umbringen – und sich ungerecht behandelt fühlen, wenn man sie schnappte und dafür hängen wollte. Das Problem ist – man würde sie erwischen. Sie hat ein Spatzenhirn. Ihre Vorstellung von einem Mord wäre, im Taxi vorzufahren, sich unter ihrem wirklichen Namen melden zu lassen, hereinzurauschen und zu schießen.«
»Da wüsste ich doch gern, warum Sie das jetzt sagen«, murmelte Poirot.
»Was?«
»Sie kennen sie gut, Monsieur?«
»Das kann ich wohl behaupten.«
Wieder lachte er, und ich fand, dass sein Lachen ungewöhnlich bitter klang.
»Sie geben mir doch recht, oder?«, fragte er gleichgültig die anderen.
»Oh, Jane ist eine Egoistin!«, bestätigte Mrs Widburn. »Bei einer Schauspielerin geht es allerdings nicht anders. Wenn sie ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen will, meine ich.«
Poirot schwieg. Seine Augen ruhten auf Bryan Martins Gesicht, verweilten dort mit einem seltsam nachdenklichen Blick, den ich nicht recht deuten konnte.
In dem Augenblick kam Jane aus dem Nebenzimmer hereingerauscht, in ihrem Kielwasser Carlotta Adams. Ich gehe davon aus, dass Jane ihr Gesicht inzwischen zu ihrer Zufriedenheit »zurechtgemacht« hatte – was immer dieses Wort bedeuten mochte. In meinen Augen sah es exakt so aus wie vorher, und absolut nicht mehr steigerungsfähig.
Beim nun folgenden Abendessen herrschte durchaus eine fidele Atmosphäre, doch meinte ich mitunter gewisse Untertöne wahrzunehmen, die ich nicht zu deuten wusste.
Jane Wilkinson sprach ich ohne Bedenken von jeder Subtilität frei. Sie war offenkundig eine junge Frau, die immer nur eine Sache auf einmal sah. Sie hatte sich ein Gespräch mit Poirot gewünscht und hatte ihr Ziel ohne Umschweife angesteuert und ohne Verzögerung erreicht. Jetzt war sie offensichtlich bester Laune. Ihren Wunsch, Carlotta Adams in die Tischrunde einzubeziehen, befand ich für eine bloße Laune. Es hatte sie einfach maßlos, ja geradezu kindisch amüsiert, sich so gekonnt nachgeahmt zu sehen.
Nein, die Unterströmungen, die ich wahrnahm, hatten nichts mit Jane Wilkinson zu tun. Aus welcher Richtung kamen sie?
Ich nahm mir die Gäste der Reihe nach vor. Bryan Martin? Er benahm sich fraglos nicht ganz natürlich. Aber das, sagte ich mir, konnte einfach Merkmal eines Filmstars sein. Die übertriebene Selbstbefasstheit eines eitlen Mannes, der zu sehr daran gewöhnt war, eine Rolle zu spielen, um sie ohne weiteres ablegen zu können.
Carlotta Adams jedenfalls verhielt sich vollkommen normal. Sie war ein stilles Mädchen mit einer angenehmen, leisen Stimme. Jetzt, wo ich Gelegenheit hatte, sie so aus der Nähe zu betrachten, tat ich es mit einiger Aufmerksamkeit. Sie war, wie ich fand, durchaus reizvoll, doch ihr Reiz war gewissermaßen negativer Natur: Er bestand in der Abwesenheit jeglicher schrillen oder misstönenden Eigenschaft. Sie kam mir irgendwie vor wie die personifizierte Fügsamkeit. Schon ihre äußere Erscheinung war von unausgeprägter Beschaffenheit. Weiches dunkles Haar, ziemlich farblose blassblaue Augen, ein blasses Gesicht und ein beweglicher feinfühliger Mund. Ein Gesicht, das einen ansprach, das man aber nur mit Mühe wiedererkennen würde, sollte man seiner Trägerin, sagen wir, in anderer Kleidung begegnen.
Sie schien sich über Janes Liebenswürdigkeit und schmeichelhafte Äußerungen zu freuen. Wie sich jedes Mädchen gefreut hätte, dachte ich – und dann – just in dem Moment – geschah etwas, was mich veranlasste, dieses recht voreilige Urteil zu revidieren.
Carlotta sah über den Tisch hinweg ihre Gastgeberin an, die sich gerade abwandte, um Poirot etwas zu sagen. Der Blick des Mädchens hatte etwas seltsam Musterndes – es erschien wie ein nüchternes Bilanzziehen, und gleichzeitig fiel mir auf, dass in diesen blassblauen Augen eine unzweideutige Feindseligkeit lag.
Einbildung vielleicht. Oder möglicherweise der Neid der Konkurrentin. Jane war eine erfolgreiche Schauspielerin, die ganz unzweifelhaft den Gipfel des Erfolgs erreicht hatte. Carlotta kraxelte ihm noch mühsam entgegen.
Ich sah die drei übrigen Mitglieder der Tischgesellschaft an. Mr und Mrs Widburn, wie stand’s mit denen? Er war ein langer, düsterer, ausgemergelter Mann, sie eine dralle blonde, übersprudelnde Person. Sie schienen reiche Leute mit einer Passion für alles zu sein, was mit dem Theater zusammenhing. Tatsächlich waren sie nicht bereit, über irgendein anderes Thema zu reden. Da ich erst seit kurzem wieder in England war, erwies ich mich als erschreckend wenig auf dem laufenden, und am Ende zeigte mir Mrs Widburn eine fleischige kalte Schulter und verbannte mich endgültig aus ihrem Gedächtnis.
Das letzte Mitglied der Tafelrunde war der brünette junge Mann mit dem runden vergnügten Gesicht, der Carlotta Adams begleitete. Ich hatte vom ersten Augenblick an den Verdacht gehabt, dass der junge Mann nicht ganz so nüchtern war, wie er hätte sein können. Dass er jetzt so ausgiebig dem Champagner zusprach, machte die Sache keinesfalls besser.
Er schien unter einem tiefen Gefühl von Gekränktheit zu leiden. Während der ersten Hälfte der Mahlzeit schwieg er verdrossen. Im weiteren Fortgang schüttete er mir, offenbar unter dem Eindruck, ich sei einer seiner ältesten Freunde, sein Herz aus.
»Was ich damit sagen will«, sagte er. »Ist es nicht. Nein, mein lieber alter Junge, ist es nicht –«
Die leicht nuschelnde Diktion lasse ich hier unberücksichtigt.
»Ich will damit sagen«, fuhr er fort, »ich bitt’ Sie? Ich meine, wenn Sie ein Mädchen nehmen – nun ja, ich meine –, das ständig dazwischenredet. In einem fort alles durcheinanderbringt. Nicht, dass ich je ein Wort zu ihr gesagt hätte, das nicht angebracht gewesen wäre. Die Sorte ist sie nicht. Sie wissen schon – puritanische Vorväter – die Mayflower – der ganze Kladderadatsch. Zum Kuckuck, das Mädchen ist in Ordnung. Was ich meine, ist – wo war ich noch mal stehengeblieben?«
»Dass es kein Zuckerschlecken war«, sagte ich beschwichtigend.
»Na also, zum Kuckuck mit allem, das ist es. Zum Kuckuck, ich musste mir das Geld für diese Fete von meinem Schneider pumpen. Sehr gefälliger Bursche, mein Schneider. Schuld ihm schon seit Jahren Geld. Verbindet uns auf eine gewisse Weise. Geht nichts über eine Bindung, oder hab ich unrecht, mein lieber alter Knabe. Sie und ich. Sie und ich. Wer zum Teufel sind Sie übrigens?«
»Mein Name ist Hastings.«
»Was Sie nicht sagen. Also ich hätte schwören können, dass Sie ein Knabe namens Spencer Jones sind. Guter alter Spencer Jones. Hab ihn in Eton und Harrow gekannt und mir einen Fünfer von ihm gepumpt. Was ich meine ist: Ein Gesicht ähnelt wie ein Ei dem anderen – meine Rede. Wenn wir ein Haufen Gelbe wären, könnten wir uns schon gar nicht mehr auseinanderhalten.«
Er schüttelte wehmütig den Kopf, lebte dann unvermittelt auf und leerte noch ein Glas oder zwei.
»Jedenfalls«, sagte er. »Bin kein verdammter Nigger.«
Dieser Gedanke schien ihn so sehr zu ermuntern, dass er sogleich dazu überging, mehrere Äußerungen hoffnungsvoller Natur zu machen.
»Sehen Sie es positiv, mein Junge«, forderte er mich auf. »Was ich meine ist, sehen Sie es positiv. Eines schönen Tages – wenn ich fünfundsiebzig bin oder so, werde ich ein reicher Mann sein. Wenn mein Onkel stirbt. Dann kann ich meinen Schneider bezahlen.«
Bei dem Gedanken saß er selig lächelnd da.
Der junge Mann hatte etwas seltsam Liebenswertes an sich. Er hatte ein rundes Gesicht und einen absurd kleinen schwarzen Schnurrbart, der einem den Eindruck vermittelte, mitten in einer Wüste gestrandet zu sein.
Carlotta Adams, fiel mir auf, hatte ein Auge auf ihn, und nach einem weiteren Blick in seine Richtung stand sie auf und gab damit das Zeichen zum allgemeinen Aufbruch.
»Es war einfach reizend von Ihnen heraufzukommen«, sagte Jane. »Ich liebe es, Dinge aus der Laune des Augenblicks heraus zu machen, Sie auch?«
»Nein«, sagte Miss Adams. »Ich muss gestehen, dass ich immer sorgfältig plane, bevor ich etwas tue. Das erspart einem – Ärger.«
Es klang nicht uneingeschränkt liebenswürdig, wie sie das sagte.
»Nun, die Resultate geben Ihnen jedenfalls recht«, lachte Jane. »Ich weiß nicht, wann mir zuletzt etwas so großen Spaß gemacht hat wie Ihre Vorstellung heute Abend.«
Das Gesicht des amerikanischen Mädchens entspannte sich.
»Das ist sehr reizend von Ihnen«, sagte sie mit Wärme. »Und ich weiß es zu schätzen, dass Sie das sagen. Ich kann Ermutigung gebrauchen. Jeder braucht das.«
»Carlotta«, sagte der junge Mann mit dem schwarzen Schnurrbart. »Jetzt geben Sie fein Händchen und sagen Tante Jane danke für das Essen, und dann kommen Sie.«
Wie er es geradeaus durch die Tür schaffte, war ein Wunder an menschlicher Willenskraft. Carlotta folgte ihm schnell nach draußen.
»Was war das eben«, sagte Jane, »was da vorbeigewirbelt kam und mich Tante Jane titulierte? Ich hatte ihn gar nicht bemerkt.«
»Meine Liebe«, sagte Mrs Widburn. »Achten Sie nicht weiter auf ihn. Brillierte seinerzeit in der Oxforder Dramatischen Gesellschaft. Würde man gar nicht glauben, wenn man ihn jetzt sieht, nicht? Ich finde es immer betrüblich, wenn aus jungen Hoffnungen nichts wird. Aber Charles und ich müssen uns jetzt wirklich von dannen machen.«
Die Widburns machten sich, wie versprochen, von dannen, und Bryan Martin schloss sich ihnen an.
»Nun, M. Poirot?«
Er lächelte ihr zu.
»Eh bien, Lady Edgware?«
»Gütiger Himmel, nennen Sie mich bloß nicht so! Gestatten Sie mir, diesen Namen zu vergessen, wenn Sie nicht als der hartherzigste kleine Mann in ganz Europa gelten wollen!«
»Aber nein, aber nein, ich bin nicht hartherzig.«
Poirot, befand ich, hatte definitiv genug Champagner konsumiert, möglicherweise auch ein Gläschen zu viel.
»Dann werden Sie meinen Mann aufsuchen? Und dafür sorgen, dass er tut, was ich will?«
»Ich werde ihn aufsuchen«, versprach Poirot vorsichtig.
»Und wenn er Sie abblitzen lässt – was er mit Sicherheit tun wird –, dann denken Sie sich einen schlauen Plan aus. Man sagt, Sie wären der schlaueste Mann in ganz England, M. Poirot.«
»Madame, wenn ich hartherzig bin, dann sprechen Sie von Europa. Aber wenn’s um Intelligenz geht, dann sagen Sie nur England.«
»Wenn Sie das zuwege bringen, dann werde ich vom ganzen Universum sprechen!«
Poirot hob abwehrend die Hand.
»Madame, ich verspreche nichts. Im Interesse der psychologischen Forschung werde ich mich bemühen, eine Unterredung mit Ihrem Herrn Gemahl zu erwirken.«
»Psychoanalysieren Sie ihn, so viel wie Sie möchten. Vielleicht täte es ihm gut. Aber Sie müssen die Sache schaukeln – mir zuliebe. Ich muss meinen romantischen Willen bekommen, M. Poirot!«
Träumerisch fügte sie hinzu: »Überlegen Sie doch nur, wie das einschlagen wird!«
3Der Mann mit dem Goldzahn
Ein paar Tage später, wir saßen gerade beim Frühstück, schob Poirot mir einen Brief zu, den er soeben geöffnet hatte.
»Nun, mon ami«, sagte er. »Was halten Sie davon?«
Das kurze Schreiben kam von Lord Edgware, der in steifen, förmlichen Wendungen seine Bereitschaft erklärte, ihn am folgenden Tag um elf zu empfangen.
Ich muss sagen, dass ich sehr überrascht war. Ich hatte Poirots in einem geselligen Augenblick leichthin geäußerte Worte nicht weiter beachtet und ahnte nicht, dass er tatsächlich Schritte unternommen hatte, um sein Versprechen einzulösen.
Poirot, der von sehr rascher Auffassungsgabe war, erriet meine Gedanken, und seine Augen blinzelten belustigt.
»Aber ja, mon ami, es war nicht nur der Champagner.«
»Das habe ich nicht gemeint.«
»Oh doch, oh doch, Sie dachten bei sich: Das arme Alterchen, ihm ist die Geselligkeit zu Kopf gestiegen, er macht Versprechungen, die er nicht halten können wird – die er überhaupt nicht zu halten beabsichtigt. Aber, mein Freund, Hercule Poirots Versprechen sind heilig!«
Als er die letzten Worte sprach, warf er sich würdevoll in die Brust. »Natürlich. Natürlich. Das weiß ich doch«, beeilte ich mich zu sagen. »Aber ich dachte, Ihre Urteilskraft wäre womöglich – wie soll ich’s sagen – von etwas beeinflusst gewesen.«
»Es ist nicht meine Angewohnheit, meine Urteilskraft, wie Sie es zu nennen belieben, ›beeinflussen‹ zu lassen, Hastings. Der beste und trockenste Champagner, die goldhaarigsten und verführerischsten Frauen – nichts beeinflusst Hercule Poirots Urteilskraft. Nein, mon ami, mein Interesse ist geweckt – das ist alles.«
»An Jane Wilkinsons Liebeshandel?«
»Das nicht gerade. Ihr ›Liebeshandel‹, wie Sie die Sache nennen, ist eine sehr triviale Angelegenheit. Er ist eine Stufe der erfolgreichen Laufbahn einer sehr schönen Frau. Besäße der Herzog von Merton weder einen Adelstitel noch Geld, würde seine romantische Ähnlichkeit mit einem verträumten Mönch die Dame nicht weiter interessieren. Nein, Hastings, was mich fasziniert, ist der psychologische Aspekt der Sache. Das Wechselspiel der Charaktere. Ich ergreife dankbar die Gelegenheit, Lord Edgware aus nächster Nähe zu studieren.«
»Sie erwarten nicht, bei Ihrer Mission erfolgreich zu sein?«
»Pourquoi pas? Jeder Mann hat seine Schwachstelle. Glauben Sie ja nicht, Hastings, nur weil ich den Fall unter einem psychologischen Aspekt betrachte, würde ich nicht mein Bestes tun, um die mir anvertraute Aufgabe erfolgreich zum Abschluss zu führen. Es ist mir stets ein Vergnügen, meinen Einfallsreichtum zu erproben.«
Ich hatte schon eine Anspielung auf die kleinen grauen Zellen gewärtigt und war dem Schicksal dankbar, dass es sie mir ersparte.
»Dann begeben wir uns also morgen um elf zur Regent Gate?«, sagte ich.
»Wir?« Poirot hob fragend die Augenbrauen.
»Poirot!«, rief ich. »Sie werden mich doch nicht zu Hause lassen. Ich begleite Sie immer.«
»Wenn es ein Kriminalfall wäre, eine mysteriöse Vergiftung, ein Meuchelmord – ah! Das sind die Dinge, an denen sich Ihre Seele ergötzt. Aber wenn es um eine bloße Änderung des Familienstands geht?«
»Kein Wort mehr!«, sagte ich entschieden. »Ich komme mit.«
Poirot lachte freundlich, und in diesem Moment wurde uns die Ankunft eines Herrn gemeldet.
Zu unserer großen Überraschung erwies sich unser Besucher als Bryan Martin.
Der Schauspieler sah bei Tageslicht älter aus. Er war nach wie vor schön, aber es war eine irgendwie verwüstete Schönheit. Mir schoss der Gedanke durch den Kopf, dass er vielleicht Drogen nahm. Ihn umgab eine nervöse Anspannung, die diese Möglichkeit nahelegte.
»Guten Morgen, M. Poirot«, sagte er munter. »Sie und Captain Hastings frühstücken ja zu einer vernünftigen Uhrzeit, wie ich mit Vergnügen sehe. Apropos, Sie sind zur Zeit vermutlich sehr beschäftigt?«
Poirot lächelte ihn liebenswürdig an.
»Nein«, sagte er. »Momentan gibt es praktisch nichts von Belang, was meine Aufmerksamkeit beanspruchen würde.«
»Jetzt kommen Sie schon«, lachte Bryan. »Keine Beratertätigkeit für Scotland Yard? Keine delikaten Ermittlungen für das Königshaus? Es fällt mir schwer, das zu glauben.«
»Sie verwechseln Dichtung mit Wahrheit, mein Freund«, sagte Poirot lächelnd. »Ich bin, das darf ich Ihnen versichern, momentan gänzlich arbeitslos, wenngleich noch nicht auf die staatliche Wohlfahrt angewiesen. Dieu merci.«
»Na, da habe ich ja Glück«, sagte Bryan mit einem weiteren Lachen. »Vielleicht übernehmen Sie dann etwas für mich.«
Poirot betrachtete den jungen Mann nachdenklich.
»Sie haben ein Problem für mich – ja?«, sagte er nach kurzem Schweigen.
»Tja – es ist so: ja und nein.«
Diesmal klang sein Lachen recht nervös. Ihn weiterhin nachdenklich betrachtend, wies Poirot auf einen Stuhl. Der junge Mann nahm Platz. Er saß uns beiden gegenüber, denn ich hatte mich neben Poirot gesetzt.
»Und jetzt«, sagte Poirot, »erzählen Sie uns alles.«
Bryan Martin schien noch immer nicht ganz den Anfang finden zu können.
»Das Problem ist, dass ich Ihnen nicht so viel erzählen kann, wie ich eigentlich möchte.« Er zögerte. »Es ist schwierig. Sie müssen wissen, die ganze Angelegenheit hat in Amerika angefangen.«
»In Amerika? Ja?«
»Es war reiner Zufall, dass ich überhaupt auf die Sache aufmerksam wurde. Tatsache ist, dass ich im Zug unterwegs war und mir ein bestimmter Mann auffiel. Hässlicher kleiner Kerl. Glatt rasiert, Brille und ein Goldzahn.«
»Ah! Ein Goldzahn.«
»Exakt. Das ist der springende Punkt.«
Poirot nickte mehrere Male.
»Ich beginne zu verstehen. Erzählen Sie weiter.«
»Nun, wie ich sagte. Der Bursche fiel mir einfach nur auf. Ich war übrigens unterwegs nach New York. Sechs Monate später war ich in Los Angeles, und da entdeckte ich den Burschen wieder. Weiß selbst nicht, warum – aber ich bemerkte ihn. Noch immer nichts weiter dabei.«
»Fahren Sie fort.«
»Einen Monat später musste ich nach Seattle fahren, und wen sehe ich kurz nach meiner Ankunft? Wieder meinen Freund, nur dass er diesmal einen Bart trug.«
»Ausgesprochen merkwürdig.«
»Nicht wahr? Natürlich kam ich da noch nicht auf die Idee, dass es etwas mit mir zu tun haben könnte, aber als ich den Mann, bartlos, in Los Angeles wiedersah, in Chicago mit einem Schnurrbart und anderen Augenbrauen und in einem Bergdorf als Landstreicher verkleidet – tja, da fing ich an, mir Gedanken zu machen.«
»Verständlich.«
»Und schließlich – so seltsam es auch erschien – war kein Zweifel mehr möglich: Ich wurde, wie man so sagt, ›beschattet‹.«
»Höchst bemerkenswert.«
»Nicht wahr? Danach erhärtete sich mein Verdacht. Wohin ich auch ging, stets war irgendwo in der Nähe mein Beschatter, in jeweils anderer Verkleidung. Zum Glück konnte ich ihn wegen des Goldzahns immer wiedererkennen.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: