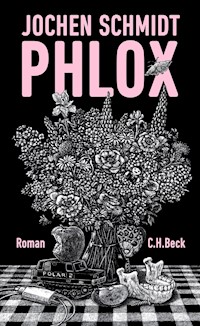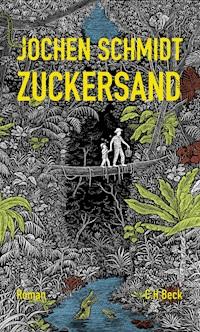9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Zwei Deutschlands und zwei Jungen, fast zeitgleich geboren, nur nicht im selben Staat. Der eine wächst im Westen auf, unweit der Bundeshauptstadt Bonn, der andere im Osten: in Berlin, der Hauptstadt der DDR. Sie spielen in der Wohnung, im Garten, zwischen Plattenbauten oder auf Baustellen und warten darauf, dass endlich das Fernsehprogramm beginnt. Sie fahren Rad mit Freunden, klauen ihren Geschwistern Süßigkeiten und streiten sich mit ihnen auf der Rückbank des Familienautos um den besten Platz. Sie träumen von der Fußballnationalmannschaft, üben wieder nicht Klavier und hören in der Schule, «"drüben» sei die Welt schlechter. Zwei der erstaunlichsten Schriftsteller ihrer Generation erzählen von der Kindheit: Jochen Schmidt, Jahrgang 1970, lebte in einem Neubaugebiet in Ost-Berlin, David Wagner, Jahrgang 1971, in einem Einfamilienhaus am Rhein. Von Kindheitsraum zu Kindheitsraum – Kinderzimmer, Wohnzimmer, Küche, Spielplatz, Viertel, Schule, bei Freunden, in den Ferien – durchmessen die beiden Meister der literarischen Alltagsbeobachtung ihre Vergangenheit. In unnachahmlich präzisen, aufeinander zu geschriebenen Erzählungen zeigen sie, was die eigene Kindheit links oder rechts der innerdeutschen Grenze ausgemacht hat: Alles war politisch, aber was weiß ein Kind davon. So entsteht das deutsch-deutsche Panorama zweier Kindheiten, die sich voneinander unterscheiden und doch auch wieder nicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jochen Schmidt • David Wagner
Drüben und drüben
Zwei deutsche Kindheiten
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Zwei Deutschlands und zwei Jungen, fast zeitgleich geboren, nur nicht im selben Staat. Der eine wächst im Westen auf, unweit der Bundeshauptstadt Bonn, der andere im Osten: in Berlin, der Hauptstadt der DDR. Sie spielen in der Wohnung, im Garten, zwischen Plattenbauten oder auf Baustellen und warten darauf, dass endlich das Fernsehprogramm beginnt. Sie fahren Rad mit Freunden, klauen ihren Geschwistern Süßigkeiten und streiten sich mit ihnen auf der Rückbank des Familienautos um den besten Platz. Sie träumen von der Fußballnationalmannschaft, üben wieder nicht Klavier und hören in der Schule, «drüben» sei die Welt schlechter.
Zwei der erstaunlichsten Schriftsteller ihrer Generation erzählen von der Kindheit: Jochen Schmidt, Jahrgang 1970, lebte in einem Neubaugebiet in Ost-Berlin, David Wagner, Jahrgang 1971, in einem Einfamilienhaus am Rhein. Von Kindheitsraum zu Kindheitsraum – Kinderzimmer, Wohnzimmer, Küche, Spielplatz, Viertel, Schule, bei Freunden, in den Ferien – durchmessen die beiden Meister der literarischen Alltagsbeobachtung ihre Vergangenheit. In unnachahmlich präzisen, aufeinander zu geschriebenen Erzählungen zeigen sie, was die eigene Kindheit links oder rechts der innerdeutschen Grenze ausgemacht hat: Alles war politisch, aber was weiß ein Kind davon? So entsteht das deutsch-deutsche Panorama zweier Kindheiten, die sich voneinander unterscheiden und doch auch wieder nicht.
Über Jochen Schmidt • David Wagner
Jochen Schmidt, 1970 in Ost-Berlin geboren, veröffentlichte die Romane «Müller haut uns raus» und «Schneckenmühle» sowie die Erzählbände «Triumphgemüse» und «Meine wichtigsten Körperfunktionen». Außerdem erschienen von ihm die Bücher «Schmidt liest Proust», «Dudenbrooks» und «Schmythologie». Jede Woche liest er in der von ihm mitgegründeten Berliner Lesebühne «Chaussee der Enthusiasten». Jochen Schmidt lebt in Berlin.
David Wagner, 1971 in Andernach am Rhein geboren, veröffentlichte die Romane «Meine nachtblaue Hose» und «Vier Äpfel» sowie den Erzählungsband «Was alles fehlt», das Prosabuch «Spricht das Kind» sowie die Essaysammlungen «Welche Farbe hat Berlin» und «Mauer Park». Für sein Buch «Leben» wurde ihm 2013 der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen. David Wagner lebt in Berlin.
David WagnerDrüben und drüben
Kinderzimmer
Ich stand auf dem Bett und hüpfte auf und ab. Mein Zimmer leuchtete gelb, die Wände waren frisch gestrichen, am Wandstück neben mir hingen meine Messer. Ich hüpfte auf der grünen Frotté-Tagesdecke, die Liegefläche federte, unter der Matratze war kein Lattenrost, sondern ein aus Draht geknüpftes Gewebe: ein Trampolin aus federnden Metallringen. Das Bett ächzte, es war weich. Lag ich in ihm, fühlte ich mich sicher, denn unter meiner Matratze spannte sich Kettenhemdstoff, den kein Pfeil durchdringen konnte. Kettenhemden kannte ich aus den Ritterburgen am Rhein – schwere, aus winzigen Metallringen gefertigte Schutzkleidung, die Schwerthieben standhielt. Von unter dem Bett hätte mich niemand erdolchen können.
Die Messer an der Wand hingen an Nägeln, die ich selbst eingeschlagen hatte, die meisten krumm. Unser Haus war nicht gemauert, sondern aus Beton gegossen und anschließend ausgehärtet. So stellte ich es mir vor, und so sah ich es auf den Baustellen im Neubaugebiet: Verschalungsbretter wurden zu Formen gezimmert und Hohlräume mit Flüssigbeton gefüllt. Auf den nackten Wänden, so war es auch in manchen Räumen unseres Hauses, blieb später die grobe Maserung der Verschalungsbretter zurück, eine Zeitlang dachte ich, Beton sei eine Art versteinertes Holz. Waren da nicht sogar Astlöcher zu sehen? Und, zweite Frage, wohnten wir in einem Bunker?
Ich schaute mich um. Links von mir lagen Bücher auf dem Boden, die ich aus der Stadtbücherei ausgeliehen hatte, auch eigene waren dabei, Lustige Taschenbücher etwa, Donald Duck las ich jeden Tag. Vielleicht lagen da auch Die Insel der Abenteuer von Enid Blyton oder Die drei Fragezeichen und der tanzende Teufel, das nicht Alfred Hitchcock geschrieben hatte, wie ich von meiner ältesten Schwester wusste, obwohl sein Name und ein stilisiertes Schwarz-Weiß-Porträt von ihm auf den Umschlag gedruckt waren. Das Fußende meines Bettes zeigte Richtung Schreibtisch, über ihm hingen Regale mit weiteren Büchern. Eigentlich hatte ich zwei Schreibtischplatten, das Zimmer war groß oder kam mir groß vor, lag voll von allen möglichen Dingen, die im Kinderzimmer eines Grundschülers herumliegen können: Stifte, Pinsel, Blöcke, Papiere, Schulbücher, Zettel, Munition für Spielzeugpistolen, Steine, Murmeln, eine kaputte Erbsenpistole, eine Zwille, Dartpfeile, andere Malutensilien, Süßigkeitenpapiere, eine aufgebrochene Sparbüchse, Taschenmesser, eine Uhr, noch eine Uhr, Bilder, eine Blockflöte, ein Springseil und so fort. Dahinter das Doppelfenster, das hinunter – mein Zimmer lag im ersten Stock – auf den Garten ging, auf den Rasen, den ich jede Woche mähen musste, und die Bäume. Dem Haus am nächsten stand der Kirschbaum, dessen Kirschen im Frühsommer gegen die Vögel verteidigt werden mussten, dann kamen der Apfel- und der Pfirsichbaum, dahinter der Walnussbaum, die große Blutbuche stand schon einen Garten weiter.
Ich wippte leicht hin und her und auf und ab, nicht wild, nein, ich hüpfte nicht ausgelassen, denn ich stand mit einem Messer in der Hand auf meinem Bett, wollte mir alles noch einmal ansehen, wollte mir mein Zimmer einprägen, den grauen Teppichboden und den weißen Schrank, der die meinem Bett gegenüberliegende Wand komplett ausfüllte, ein riesiger Kleiderschrank mit fünf oder sechs Türen – «der Interlübke», wie meine Mutter sagte, um ihn von dem anderen Kleiderschrank in ihrem Schlafzimmer zu unterscheiden. Meine Anziehsachen belegten dort nur ein Segment, Spielzeug ein zweites, hinter den anderen Türen hingen ältere Kleidungsstücke meiner Eltern, Mäntel, Pullover, Skianzüge, Wintersachen. Der Schrank, seine Türen waren mit Bildern von Burgen, Flugzeugträgern und Raubvögeln beklebt, zog sich bis zum Fenster, dort blieb ein schmaler Spalt zur Wand, zu schmal, um sich hineinzuzwängen. Hin und wieder warf ich Papiere und leere Süßigkeitenverpackungen dort hinein und baute einen Sichtschutz aus Büchern und Spielsachen davor, die Verpackungen der mitunter geklauten Süßigkeiten hätten im Papierkorb ja auffallen können, dachte ich mir – aber natürlich war das Problem, als diese private Müllhalde eines Tages entdeckt wurde, dann viel größer.
Auf der Fensterbank stand mein Fernglas, da lagen auch ein paar Holzstücke und Äste, an denen ich gerne herumschnitzte, und, wenn ich den nicht unten im Garten gelassen hatte, mein selbstgebauter Bogen und ein paar Pfeile. Manchmal schoss ich durch das offene Fenster hinunter auf den Rasen, Richtung Spatzen.
Ich stand mit dem Dolch in der Hand auf dem Bett und wippte, die Klinge pikste mich auf Nabelhöhe durch den Stoff meines roten Cord-Hemds, ein Winterhemd, es war Februar. Ich war zehn, fast elf Jahre alt und wollte es wissen, wollte mich in den Dolch stürzen, den unsere Nachbarin mir aus Marokko mitgebracht hatte, wollte wissen, was es mit diesem Leben auf sich hatte. Müsste sich, dachte ich, doch herausfinden lassen.
Die Lustigen Taschenbücher neben meinem Bett gehörten fast alle meiner ältesten Schwester. Manchmal kam sie in mein Zimmer und forderte sie zurück.
«Die sind aber schon so lange bei mir», sagte ich dann. «Das sind jetzt meine.»
Wovon sie sich nicht beeindrucken ließ. Andere hatte ich von meinen Cousinen geliehen und bisher nicht zurückgegeben – es würde wohl auch nicht mehr passieren. Die restlichen stammten vom Flohmarkt, oder sie waren Freunden abgekauft.
Innen hatten sie abwechselnd eine kolorierte und eine schwarz-weiße Doppelseite, also war nur jede zweite Doppelseite farbig. Musste der Ehapa-Verlag Farbe sparen? Oder sollte ich diese Seiten ausmalen? Sobald ich in die Geschichte versunken war, fiel mir das gar nicht mehr auf, vielleicht mochte ich die schwarz-weißen Seiten sogar lieber. Gute Geschichten brauchten ja keine Farbe.
Lustige Taschenbücher waren teuer und wurden immer teurer. In Bahnhofsbuchhandlungen klebten nicht selten neue Preisaufkleber über den aufgedruckten Preisen. Ach, das war diese sogenannte Inflation! Das Gerede kannte ich ja: Alles wird immer teurer!
Nur zu besonderen Anlässen bekam ich ein neues, vor einer langen Bahnfahrt vielleicht – so lautete auch der Slogan der Reklame: Nicht nur auf langen Bahnfahrten. Den Preis eines Lustigen Taschenbuchs rechnete ich schon bald in Lesezeit um, die reine Lesezeit war bei einem neu gekauften teuer. Ich brauchte ja nie lange, um es durchzulesen. Eine Stunde? Zwei?
Es lagen auch Asterix-Hefte neben dem Bett. Asterix bei den Schweizern – wer sein Brotstückchen zum dritten Mal im Käsefondue verliert, wird mit Gewichten im See versenkt. Asterix bei den Goten fand ich nicht so lustig, ich hatte bereits verstanden, dass die Witze darin auf unsere, auf deutsche Kosten gingen.
Spielzeug lag nicht nur in meinem Zimmer, Spielzeug sammelte sich auch im Keller, Spielkeller genannt. Wir hatten viel gekauft, vererbt, geschenkt bekommen: Bauklötze, Lego, Spielzeugsoldaten, -cowboys und -indianer sowie ein Kasperletheater mit Handpuppen aus Kunststoff und älteren, holzgeschnitzten Puppen – wir besaßen zwei Krokodile und zwei Wachtmeister, die gegeneinander antreten konnten, einer der Wachtmeister hieß immer Dimpflmoser. Ich hatte Play-BIG-Figuren, die etwas größer waren als Playmobil-Figuren und ihre Füße bewegen konnten, außerdem frühe Playmobil-Figuren und ein Playmobil-Polizeiauto, die Playmobil-Welt war noch schlicht, sie war erst dabei, sich zu entwickeln, Playmobil gab es noch nicht lange, seit 1974 erst. Für meine älteste Schwester blieb Playmo, wie wir es schon bald abkürzten, «Spielen wir Playmo?», immer das neue Spielzeug, ihr gefiel Lego besser. Sie baute sich Lego-Puppenhäuser und ließ die batteriebetriebene Lego-Eisenbahn fahren, auf blauen Lego-Schienen, die mit Lego-Schwellen zusammengesetzt werden mussten.
Die Legosteine, alte und neue gemischt, steckten zusammen in großen Tonnen, sie verteilten sich in meinem Zimmer auf dem Boden, im Esszimmer und im Wohnzimmer, die Schiffe, Flugzeuge und Flugzeugträger, die ich konstruierte, mussten ja durchs ganze Haus. Es gab das Lego-Geräusch, das Lego-Rasseln, wenn wir in den Tonnen wühlten oder die Steine auskippten, in meinem Zimmer versuchte ich jedoch immer, einen Pfad von meinem Bett bis zur Tür freizuhalten, ich wusste ja, wie weh es tat, nachts barfuß auf dem Weg ins Bad auf einen Legostein zu treten.
Ich hatte viel und wünschte mir immer mehr, Spielzeug hatte ich nie genug. Ich wünschte mir mehr Piraten und das Wikingerschiff von Play-BIG, mehr Ritter für die Ritterburg und Weichen, Waggons, Signale und Lokomotiven für die LGB, meine Eisenbahn, Spurweite fünfundvierzig Millimeter. Die LGB war eine große Modellbahn, eine Groß-Bahn, zu Weihnachten und zum Geburtstag bekam ich Gleise und Waggons. Das erste Paket hatte ich ebenfalls zu Weihnachten bekommen, es war ein Starter-Paket und bestand aus einem Schienenkreis, einige Geraden gab es extra. Später kamen Weichen, Signale und eine Kreuzung hinzu.
Mir war schon damals klar, wie teuer diese Eisenbahn war, ein Waggon kostete über fünfzig Mark, aber anscheinend – waren wir so reich, war ich ein verwöhntes Kind? – konnten meine Eltern sich das leisten.
Mein Vater ließ mich mit meiner Eisenbahn allein, ich baute und baute, er baute nicht mit. Die größere der beiden Dampflokomotiven konnte aus dem Schornstein qualmen, ich musste bloß Dampföl einfüllen. Ich liebte den Kranwagen, die Kupplungen und die Rücklichter der Lokomotive. Die Eisenbahn auf-, um- und wieder abzubauen war das eigentliche Spiel, Gleisbauarbeiten, immer wieder neue Strecken planen und errichten. Das andere wichtige Eisenbahnspiel hieß «Zugunglück»: Die Lok und ihre Wagen entgleisen lassen, etwas auf die Schienen legen und den Unfall herbeispielen, die LGB hielt das aus, ich konnte sie im Garten über die Wiese fahren lassen, der Rasen wurde zur Prärie. Indianerüberfälle, ein Bandit entführt den Zug, er möchte das Gold aus dem Güterwagen rauben, das Gold hatte ich selbst hergestellt: kleine weiße Kieselsteine, mit Goldfarbe angepinselt. Es sollten Nuggets sein.
Die Westernstadt baute ich am einen, die Ritterburg am anderen Ende der Strecke auf. Später gefiel mir das nicht mehr, Ritterburgen und Ritter in Rüstungen passten nicht zu Eisenbahnen, in der Ritterzeit hatte es doch noch keine Eisenbahnen gegeben. Andererseits: Fuhr die Eisenbahn am Rhein nicht auch an Ritterburgen vorbei?
Die Westernstadt, die im Größenverhältnis so gut zur LGB passte, bestand aus fünf oder sechs Häusern, es gab ein zweistöckiges Hotel, einen Saloon mit Schwingtüren, eine Post und ein Gebäude, in dem der Sheriff sein Büro hatte und das gleichzeitig ein Gefängnis war. Die aus schmalen, dunkel gebeizten Rundhölzchen und Sperrholz zusammengeleimte Stadt wirkte nie echter und überzeugender als in dem Augenblick, als ich sie beim größten und zugleich letzten Indianerangriff im Garten Feuer fangen und vollständig abbrennen ließ. Die Plastikcowboys, die sich auf dem Flachdach des Gefängnisses verschanzt hatten, verteidigten sich bis zur letzten Patrone und schmolzen dahin. Von meiner Westernstadt blieb, fast wie im Film, nur Asche.
Rings um meine Ritterburg aus Hartplastik, die ich, hätte sie sich anzünden lassen, wohl ebenfalls verbrannt hätte, stellte ich Rittergeschichten nach: Angriff auf Burg Katz, der Kampf um die Feindlichen Brüder, die Eroberung der Burg Drachenfels, König Richard Löwenherz’ Gefangenschaft und Ivanhoe. Die Ritterschlachten folgten mir bis in den Schlaf, ein oder zwei Lieblingsritter nahm ich mit ins Bett, aus der Bettdecke ließen sich felsige Burgen mit Verliesen und hohen Zinnen im Nu errichten und wieder zerstören.
Im Spielkeller fand die LGB schließlich einen festen Ort. Meine Mutter ließ vom Schreiner eine Pressholzkonstruktion errichten, die drei Viertel des Raumes ausfüllte, eine Modellbauplatte mit einer Öffnung in der Mitte, in der ich stehen konnte, sodass ich mich inmitten meiner Modellbaulandschaft aus Kaninchendraht und Pappmaché befand, Hügel, Berge und Tunnel hatte ich mir gebaut, dazu eine Rampe, die über ein schmales Brett an der Wand entlang in die Höhe führte. Die kleinere meiner beiden Lokomotiven schaffte es gerade so hinauf.
Im Spielkeller stand ein Radioapparat, der mir eine Antiquität aus der Radio-Vorzeit zu sein schien, ein Gerät mit elfenbeinfarbenen Tasten, Stoffbespannung und einer Skala, die, wenn eingeschaltet, honig-bernsteingolden leuchtete. Manchmal, wenn ich keine Lust mehr auf die Eisenbahn, Legobauarbeiten oder Fischer-Technik-Konstruktionen hatte, spielte ich an diesem Radio herum, drehte an dem großen, runden, am Rand geriffelten Senderknopf, und der rote Strich bewegte sich. Die mechanische Übertragung war zu spüren, über die Skala und ihre seltsamen Ortsnamen hinweg: Stuttgart, Hilversum, Beromünster, Monte Ceneri – wo lagen diese Orte? Und konnte ich mich mit diesem Gerät von Telefunken vielleicht dorthin transportieren lassen? Teleportieren? Ich drehte und hörte es rauschen, ich hörte es fiepen, hörte Stimmen und fremde Sprachen, war das Italienisch? Ich hörte Sphärengeräusche, redeten da die Toten? Waren sie in dem Wellendurcheinander zu hören? Sprach meine Großmutter zu mir, in deren Wohnzimmer das Radio einmal gestanden hatte? Schwebten längst gehaltene Reden, längst gesungene Lieder durch den Raum? Ließen sie sich mit diesem Empfänger wieder einfangen?
Es gab den Eisenbahn- und Puppenkeller und den Raum, in dem im Winter die Tischtennisplatte stand. Der Weg in den Vorrats- und Weinkeller führte am Schuhregal und dem Verschlag unter der Treppe vorbei, in dem alte Decken, Luftmatratzen, ein Schlauchboot und müffelnde Zelte lagerten. Aus dem Vorratskeller drang der Duft von Äpfeln und Kartoffeln, an denen oft noch ein wenig Erde klebte, sie kamen zentnerweise von einem Bauernhof. Ein Kühlschrank mit Tiefkühler und eine große Tiefkühltruhe standen dort, in ihr suchte ich zwischen tiefgefrorenen vorgekochten Mahlzeiten und Gefrierbeuteln mit Beeren nach Eis. Hatten wir nicht noch eine Zehn-Liter-Vorratspackung aus der Metro? Auf Metallregalen lagerten Konservendosen, etliche Packungen Haferflocken, Eingemachtes, Mehl, Reis und andere Grundnahrungsmittel, lange haltbare Vorräte stapelten sich, der Atomkrieg wurde ja erwartet, wer weiß, vielleicht müssten wir monatelang im Keller bleiben? Ich hätte dort immerhin die Eisenbahn gehabt, mir wäre sicher nicht langweilig geworden – oder vielleicht doch? Einige der Konservendosen auf den Regalen waren sehr alt, sie standen schon immer da, ich wusste, sie waren älter als ich. Ob wir auch die dann würden essen müssen? In einer, sie wirkte uralt, steckte ein ganzes Huhn.
Ganz oben im Haus, unter dem Dach, im Arbeitszimmer meines Vaters, gab es auf einem Tisch vor seinen Bücherregalen eine weitere Modelleisenbahn, eine Minitrix, meine Mutter hatte sie ihm geschenkt. Er schien sich über das Geschenk zu freuen – aufbauen, einrichten und betreuen musste diese Anlage jedoch ich. Nun hatte ich die große Eisenbahn im Keller und eine viel kleinere, miniaturisierte unter dem Dach, eine Modelleisenbahn meiner Modelleisenbahn gewissermaßen. Mein Vater spielte nie mit ihr, jedenfalls sah ich ihn nie damit spielen – hatte ich sie ihm nicht gut genug aufgebaut? Oder spielte er heimlich, spätnachts, wenn ich schlief?
Während der Modelleisenbahn-Aufbauarbeiten stieß ich in seinem langgezogenen Arbeitszimmer mit Dachschräge, die Sonne schien durch die Dachluken, zwischen langweiligster Fachliteratur auf zwei Sex-Bücher. Das eine war voller Schwarz-Weiß-Abbildungen, zwei Malermodellpuppen übten Stellungen, öde. Das andere jedoch, ich sah es mir immer wieder an, war ein Foto-Porno-Roman: Zwei Paare spielen erst Karten und ziehen sich dann aus, treiben es wild miteinander und durcheinander, ficken, lecken, blasen, mit allem Pipapo. Nach dieser Entdeckung ging ich oft am frühen Nachmittag hinauf ins Arbeitszimmer meines Vaters, nicht um mit seiner Eisenbahn zu spielen, sondern weil ich mir wieder diesen Foto-Roman ansehen wollte. Eine Szene spielte in einem Buchenwald: Das Paar, das anfangs nicht zusammengehörte, fickt unter Bäumen, sie lehnt sich an den Stamm, sein Schwanz steckt in ihr. Ich wusste noch nicht, ich war elf Jahre alt, warum mich das so faszinierte – bemerkte allerdings, dass ich immer, wenn ich diese Bilder ansah, eine Erektion bekam.
Später, als ich mit einer meiner Schwestern das Zimmer getauscht hatte, stand ein Radiorekorder am Kopfende meines Bettes. Für mich hieß es Radiorekorder, ein Jahrzehnt zuvor noch Kofferradio. Von einem Kofferradio – in unserer Küche stand eines von Nordmende – unterschied mein Radiorekorder sich durch den eingebauten Kassettenrekorder, mit dem ich, war ich schnell genug, Lieder, die mir gefielen, oder den einen, langersehnten Song aus dem laufenden Radioprogramm mitschneiden konnte. Leider quatschte der Moderator nicht selten in den Schluss der Aufnahme hinein, sein Gerede, ein abgebrochener Satz, blieb dann für immer auf dem Band.
Ich erinnere mich an die so oft im Halbschlaf ausgeführte Bewegung, die nötig war, um meinen Radiorekorder an- oder auszuschalten: Den Arm im Liegen über den Kopf hinweg zu dem kleinen Schiebeschalter strecken, hinauf mit ihm, und das Radio ging an. Manchmal rutschte der Radiorekorder zwischen Bett und Wand nach unten, ich hatte ihn nur eingeklemmt. Heftige Bettbewegungen ließen ihn Richtung Teppichboden sacken.
Mir kommt es vor, als könnte ich diesen Radiorekorder, ein Modell von 1982 oder 1983, mit jener damals so oft ausgeführten Bewegung auch heute jederzeit wieder einschalten. Dabei gibt es diesen Sanyo-Radiorekorder schon lange nicht mehr. Auch das Bett nicht, in dem ich damals lag. Das Zimmer, ja selbst das Haus gibt es nicht mehr, es wurde abgerissen, ein Apartmenthaus steht nun an seiner Stelle, und von dem Garten, in dem ich gespielt habe, ist nicht viel übrig. Und ja, sogar das Land, in dem das Haus stand, gibt es so nicht mehr – es ist jetzt viel größer und hat seit vielen Jahren eine andere Hauptstadt.
Wir hatten reihum die Zimmer getauscht: Ich war nun in dem zur Straße, das meine jüngste Schwester bewohnt hatte, mein Bruder war ins ehemalige Arbeitszimmer meiner Mutter gezogen, meine zweitjüngste Schwester in mein altes Zimmer und meine jüngste Schwester ins frühere Schlafzimmer meiner Eltern. «Die Alten», wie wir sie inzwischen nannten, zogen hinauf in den zweiten Stock, meine älteste Schwester war bereits ausgezogen.
Hin und wieder hackte ich – offenbar war ich wütend? – mit dem Bajonett, das ein Onkel mir passender- oder unpassenderweise zur Konfirmation geschenkt hatte, auf meinem Bett herum. Ich malträtierte einen armen Bettpfosten, gegen Ende meiner Schulzeit spaltete ich ihn dann mit einem Hieb von oben nach unten. Gehen in Teenagergehirnen nicht häufig seltsame Sachen vor sich? Bringt die sich verändernde Biochemie sie nicht durcheinander? Den Bettpfosten klebte ich mit Kreppband wieder zusammen, ich wickelte ihm einen Verband, verbrauchte eine halbe Rolle, das Klebeband hatte fast die Farbe des Holzes.
Ich kratzte Umrisse in den Putz der Wand neben meinem Bett, Seekarten unbekannter Inseln. Klopften die Heizungsrohre in der Mauer, schlug ich mit einem Messergriff dagegen. Nach ein paar Jahren, stetes Klopfen höhlt den Stein, hatte die Wand ein Loch. Ein ziemlich großes Loch. Ich klebte ein Bild davor, eine selbstgemalte Weltkarte.
Stand das Fenster in der Nacht offen, hörte ich vom Bett aus die Schiffe auf dem Rhein, hörte die Schiffsdiesel tuckern. Ich hörte auch die Güterzüge auf der anderen Rheinseite, eher selten ein Auto, wir wohnten in einer ruhigen Straße.
Das grüne Licht des Radioweckers leuchtete von meinem Nachttisch bis zu mir im Bett. Seine Digitalanzeige schimmerte mir zu, der Nachttisch war eigentlich ein Regal, in dem sich Bücher stapelten, die ich schon lange nicht mehr angerührt hatte. Die Leuchtziffern schauten mich bis kurz vor acht mit mir schon bekannten Jahreszahlen an: Zwölf vor sieben war 1848, Waterloo war da schon dreiunddreißig Minuten oder Jahre vorbei. Der Erste Weltkrieg begann um vierzehn nach sieben und dauerte bis achtzehn nach sieben, der Zweite tobte von neunzehn Uhr neununddreißig bis Viertel vor acht. 19:59 war die letzte vertraute Jahreszahl, dann kam die Zukunft, folgten die Jahreszahlen der Futurologen und der Science-Fiction. Um acht begann das ferne Jahr 2000. 20:02 mochte ich aus Liebe zur Symmetrie, 20:20 der Wiederholung wegen. Kurz danach schlief ich meist ein. Bis 21:21 kam ich erst im dritten Schuljahr, 22:22 sah ich nur zu besonderen Gelegenheiten, an Silvester (noch über anderthalb Stunden bis zum Jahreswechsel) oder wenn ich heimlich mit Taschenlampe unter der Bettdecke las. Wecken ließ ich mich von diesem Radio nie, ich wurde von selbst wach. Oder mein Vater weckte mich, «Freund, steh auf!» – so sein Ruf am Morgen.
Wohnzimmer
Ging ich am frühen Nachmittag ins Wohnzimmer, bildete ich mir ein, diesen Raum – eigentlich waren es zwei, die ineinander übergingen – zu überraschen. Ich bildete mir ein, spüren zu können, wie sehr dieses Zimmer den Vormittag über in Frieden gelassen worden war, die Luft schien sich beruhigt zu haben, die Teppiche hatten sich erholt. Meist ging ich ins Wohnzimmer, um herauszufinden, ob etwas im Fernsehen lief, zu besonderen Anlässen wurde ja auch nachmittags mal etwas im Fernsehen übertragen. Oder ich betrat es, um kurz, sehr kurz Klavier zu üben. Oder um auf die Terrasse zu gehen und nach dem Hund zu sehen, mit der Leine in der Hand, weil ich mit ihm hinausgehen sollte. Oder ich wollte bloß in den Garten, um Messer zu werfen.
Um ins Wohnzimmer zu gelangen, musste ich den Raum durchqueren, den meine Mutter Musikzimmer nannte, weil dort das Klavier stand und ein oval gerahmtes Porträtbild von Richard Wagner sowie Bilder von Beethovens und Chopins Totenmaske hingen. Ein paar Blockflöten, Sopran- und Altflöten, hingen ebenfalls an der Wand, auch eine Triangel. Die Triangel durfte mein Vater spielen, zu Weihnachten, meine Schwester gab ihm die Einsätze, sonst spielte er kein Instrument. Er konnte auch nicht richtig singen, «dein Vater ist leider unmusikalisch», sagte meine Mutter oft.
Das Zimmer hätte auch Bibliothek heißen können, denn die beiden langen Wände und die neben dem Fenster waren mit Bücherregalen zugebaut. Vor dem Fenster stand ein Biedermeiertisch mit zwei passenden Stühlen, meine Mutter hatte ihn von ihrer Großmutter geerbt, aufstützen sollte ich mich nicht darauf. Die glänzend polierte Tischplatte aus Kirschholz in Fast-Kleeblatt-Form schmückte ein Spitzendeckchen, auf dem eine geschliffene Glasschale stand, angeblich wertvoll, weshalb ich in der Umgebung dieses Ensembles nicht herumtoben durfte. In dieser Schale lagen oft einige Stückchen kandierter Ingwer, die Kristallzuckerschicht drum herum verführte mich immer wieder zu probieren, es schmeckte jedoch fürchterlich – das war die einzige Süßigkeit, die meine Streif- und Raubzüge durch das Haus überstand.
Durch einen breiten Wanddurchbruch ging es weiter ins eigentliche Wohnzimmer – «Durchbruch» war eine Zeitlang das Lieblingswort meiner Mutter. «Hier möchte ich noch einen Durchbruch haben, hier noch einen», und wieder musste eine Wand weg. Meine Mutter wollte große, weite, offene Räume schaffen, Wände und Mauern störten sie.
Meist versuchte ich, ohne den Boden zu berühren, bis ins Wohnzimmer zu gelangen, «Nicht den Boden berühren» war mein Lieblingsspiel. Vorher ein paar Stühle aufstellen, sodass ich vom einen zum anderen springen konnte. Zählen Teppiche als Inseln? Dann konnte es einfach sein, musste aber vorher abgemacht werden. Wer den Boden berührt, stirbt. Ich spielte es in meinem Zimmer, im Wohnzimmer und durchs ganze Haus, im Flur hinter dem Musikzimmer konnte ich mich jedoch nie lange auf der Fußleiste halten, ich fiel in die Teppichbodentiefe, stürzte ab.
Der Fernseher – erst der kleine Sony, er wanderte später nach oben, dann der große Sony Trinitron – und die Anlage standen auf einer Art Sideboard aus dunkel gebeiztem Holz. Um mit Ton fernzusehen, musste der Verstärker der Anlage eingeschaltet werden, der Fernsehton kam dann aus den Lautsprecherboxen, die unser Hund hin und wieder mit Bäumen verwechselte. Er hatte, my father was not pleased, schon öfter an einer Box sein Bein gehoben. Wollte er sein Revier markieren? Oder gefiel ihm bloß nicht, was aus ihnen an Geräuschen kam? Hunde können doch so viel besser hören als Menschen. Auf dem schwarzen Metallschutzgitter bildete sich jedenfalls ein weißlicher chromatographischer Urinrand. Mein Vater kaufte eine Spraydose mit schwarzer Farbe und besprühte seine Lautsprecherboxengitter neu, er machte das im Garten, auf dem Rasen. Nach dieser Aktion stellte er die Spraydose in die Garage, ins Werkzeug- und Farbendurcheinander – ein paar Jahre später fand ich sie dort und sprühte mit ihr mein erstes Schablonenbild auf die Schulmauer.
«Wo ist die Fernbedienung?» Manchmal rutschte sie zwischen die Polster. Wer die Fernbedienung hatte, hatte die Macht, weshalb die Fernbedienung in unserem Wohnzimmer «die Macht» hieß. Und nein, es stand keine Schrankwand im Wohnzimmer, kein Gelsenkirchener Barock. Es gab die Polstermöbellandschaft und einen Glastisch auf Couchhöhe mit einer sehr dicken Scheibe. «Ist das Panzerglas?», fragte ich meine Mutter. Sie hielt mich immerhin aus, diese Scheibe, wenn ich auf ihr saß, was ich natürlich nicht sollte.
Erst zwei oder drei Bilder, dann immer mehr hingen im Wohnzimmer, abstraktes Zeug, außerdem ein Wandteppich und zwei antike Uhren: der «Kindersarg», wie mein Vater die eine nannte, ein Regulator aus dunklem Holz, sowie eine Standuhr aus Schottland, ein Schiffschronometer, auf dem Zifferblatt stand «Edinburgh». Der Kindersarg schlug zu jeder vollen Stunde, es war durchs ganze Haus zu hören.
In den Phonomöbelelementen, später fand in ihnen auch der Videorekorder Platz, standen die Platten meiner Eltern, ihre Beatles-Alben, die Peter-Handke-Musik und die Klassik, darunter der gesamte Bach und die Opern in dicken, buchrückenbreiten Plattenkartons: Rheingold, Walküre, Siegfried, Götterdämmerung, Die Meistersinger, Tristan und Isolde, Parsifal, Beethovens Klavierkonzerte und Schuberts Impromptus. Mein Vater hörte sie eine Zeitlang jeden Sonntag bei offener Terrassentür, es schallte in den Garten hinaus bis zur hinteren Schaukel.
Auf oder zwischen diesen Platten war die Elternvergangenheit aufgehoben. Waren sie etwa auch mal jung gewesen? Manchmal hörte ich Sergeant Pepper oder Abbey Road, und auch wenn ich noch nicht verstand, was da gesungen wurde, sang ich mit. Die Beatles waren noch gar nicht lange auseinander – ihr letztes Album war nicht einmal zehn Jahre alt, also fast noch frisch –, und trotzdem waren sie für mich eine Band aus der Vorzeit. 1980 wurde John Lennon erschossen, ich erinnere mich, wie meine Schwester davon sprach und – war das nicht Getue? – sehr bestürzt tat. Sie führte sich auf, als wäre John Lennon ihr bester Freund gewesen.
Auf der Wohnzimmeranlage spielte ich meine ersten Singles, in meinem Zimmer hatte ich ja bloß einen Radiorekorder, die eigene Anlage kam später. Wo war das schwarze Ding, mit dem sich das größere Loch in der Mitte einer Single zu einem kleineren machen ließ? Don’t You Want Me von The Human League hörte ich sicher hundertmal, I Ran (So Far Away) von A Flock of Seagulls nicht weniger oft. Warum hatte ich mir die gekauft? Wegen der Frisur des Sängers? War der nicht Friseur? So wollte ich aussehen! Immer wieder dieselben Platten auflegen, so viele hatte ich ja noch nicht, zusehen, wie der Tonarm sich automatisch hebt, Richtung Plattenteller wandert, über dem Plattenrand stehenbleibt und sich absenkt, die Platte hatte schon begonnen, sich zu drehen. Bei dem alten Plattenspieler, mit dem ich in meinem Zimmer Märchenplatten gehört hatte (Hänsel und Gretel, König Drosselbart, Der kleine Däumling), musste der Tonarm noch mit der Hand abgesetzt werden. Knallte fast immer.
«Kannst du mir die bitte überspielen?» Auf eine C90-Leerkassette passte auf jede Seite eine LP. Chromdioxid II, BASF, Maxell, TDK – wie hießen die anderen Fabrikate? War noch Platz, kamen ein oder zwei Bonuslieder hinzu, sie sollten aber zu dem davor aufgenommenen Album passen. Guten Freunden oder Freundinnen in spe wurden die Titel der Songs auf den gefalteten Karton geschrieben, der in der Kassettenhülle lag, vielleicht beschriftete ich sogar die beiliegenden Aufkleber für die Kassette. Mit vielen Kassettenhüllen gab ich mir mehr Mühe als mit meinen Hausaufgaben, von verschiedenen Freunden oder Freundinnen gestaltete Kassettenhüllen ergaben eine Sammlung unterschiedlichster Schriften und Stiftfarben. Heute kommt es mir seltsam vor, dass in einem Kästchen, ungefähr so groß wie eine dieser Tonkassetten, nun Tausende Alben, Filme, Bücher und das halbe Weltwissen stecken können.
Kam ich besonders früh aus der Schule zurück oder hatte ich frei, half ich unserer Haushälterin Frau Seel beim Saugen. Staubsaugen gefiel mir, es machte Krach, ein Staubsauger war fast ein Presslufthammer, ich stellte mir vor, ich wäre Bauarbeiter oder Astronaut auf dem Mond. Ich fuhr die Teppichmuster nach und schob Streifen in den Teppichboden, mochte das schlürfende Rasseln, das die hinaufgesogenen Krümel und Steinchen im Saugrüssel des Staubsaugers erzeugten.
Aus irgendeinem Grund war es unter uns Kindern sehr beliebt, die Fransen des großen Perserteppichs zu kämmen, oft stritt ich mich mit einer Schwester nach dem Staubsaugen darum, wer die Teppichfransen kämmen durfte. Was ja, so gesehen, eine sinnlose Tätigkeit war, denn war der Hund im Wohnzimmer – er bellte oft, jaulte, wollte hinein, wollte zu uns, kratzte an der Tür, also ließen wir ihn herein –, dann waren die Fransen bald wieder durcheinandergewirbelt. Gekämmt wurden sie mit einem großen dunkelblauen Kunststoffkamm, der Fransenkamm hieß. Nach und nach verlor er immer mehr Zinken, einige standen schon einzeln, er sah aus wie ein Lückengebiss, ein Kammgebiss mit Lücken.
Der Perserteppich, um dessen Fransen es ging, lag im Durchbruch, halb im einen, halb im anderen Raum, er bildete eine Brücke. Ein anderer, ein besonders schöner Teppich, hing über der Grastapete an der Wand.
Es gab Perser und Perser. Es dauerte, bis ich das verstanden hatte. Die Eltern eines Freundes waren Perser, die – Verwirrung! – auch mit Persern handelten. Zwei oder drei Teppiche hatte mein Vater bei ihnen gekauft, andere in Köln, über einen Kollegen, der eine Quelle hatte. Ein- oder zweimal wurde ein Teppich auch wieder verkauft, weil meine Mutter Geld für einen weiteren Umbau brauchte. Diese Teppiche waren also Wertanlagen, wir liefen auf Geld herum – deshalb sollten wir, wenn wir aus dem Garten kamen, die Schuhe ausziehen oder zumindest sorgfältig abstreifen.
Freitagmittags studierte meine älteste Schwester das Fernsehprogramm der kommenden Woche, denn freitags lag der Tageszeitung eine Programmzeitschrift bei. Sie studierte es ausgiebig, sie kreuzte Sendungen an, die sie interessierten, unterstrich die Namen mancher Schauspieler (den von Cary Grant immer, auch die von Grace Kelly, Marilyn Monroe und Rock Hudson) und schrieb kleine Kommentare neben die Programmspalten: Schon wieder! Kam erst letztes Jahr im März! Guter Film! Muss ich sehen! Sich mit dem Fernsehprogramm zu beschäftigen war eine Ersatzbeschäftigung, im Fernsehen kam ja nachmittags noch nichts, nur das Testbild. IWZ hieß diese Programmbeilage der Tageszeitung, «Hast du die IWZ gesehen?» Nie hatten wir eine eigene Fernsehzeitschrift, wie andere Familien sie kauften, nie den Gong oder die Hörzu. «So einen Quatsch brauchen wir nicht», sagte meine Mutter.
Freitagabends schaute ich Väter der Klamotte, später Western von gestern, manchmal auch Schüler-Express, wurde das nicht aus einem Studio in Berlin gesendet, im Wechsel mit Pfiff, der Jugendsportsendung? Schüler-Express gefiel mir besser, es gab da die Rubrik Wunschfilm – ich bilde mir ein, es hätte «Wunschvideo» geheißen, «Video» war jedoch noch kein gängiger Begriff für kurze Filme. Drei Ausschnitte wurden angespielt, dann wurde per Postkarte abgestimmt, welcher Film in der folgenden Sendung ganz zu sehen sein sollte. Einmal wurde ein Teil von The Wall gezeigt, Pink Floyds Another Brick in the Wall war daraufhin jahrelang mein Ohrwurm. Ohne den Text richtig zu können, sang ich das Lied, wenn ich mit dem Hund unterwegs war, ich mochte den Part mit dem Schülerchor, den satten, fetten Klang mit dem Bass darunter. Das hätten wir mit dem Unterstufenchor (montags, 6. Stunde) mal singen sollen, we don’t need no thought control – der Fernseher hieß bei uns auch Glotzophon.
Wohnzimmer, Ort der Niederlagen, denn nach den Nachrichten musste ich ins Bett. Manchmal blieb ich einfach sitzen oder versteckte mich hinter dem Polster, gab keinen Laut von mir, unterdrückte jedes Husten oder Lachen. Manchmal merkte meine Mutter nichts, manchmal blieb ich so eine Viertelstunde oder länger unentdeckt. War ich doch entdeckt worden, versuchte ich zu diskutieren: «Jetzt will ich aber wissen, wie es ausgeht! Da lerne ich doch etwas, das machen wir in der Schule!» Nur wenn ein Feuer im Kamin brannte und der Fernseher nicht lief, durfte ich noch ein wenig aufbleiben, meist war ich ja fürs Feuerschüren zuständig. Auf der Wetterkarte war unser Deutschland, die Bundesrepublik, das große Schnitzel, die DDR war nur ein kleines Schnitzel. Das eigentliche Schnitzel-Land war jedoch Österreich – «Halbschuh-Österreich», wie mein Vater sagte. «Warum Halbschuh, Papa?» – «Schau dir den Umriss an», sagte der, «na, wie schaut’s aus?»
Um 21:45 Uhr begannen Die Profis, eine Serie, die ich so gern gesehen hätte. Ich versuchte mir vorzustellen, was in der Folge wohl passierte, die Programmzeitschrift gab ein paar Hinweise. Manchmal schaute ich heimlich oben, auf dem anderen Fernseher in Mamas Arbeitszimmer. Dallas begann ebenfalls um 21:45 – das war die Serie, von der die älteren Mädchen in der Schule so oft sprachen. Ich merkte mir die Titelmelodie, die hatte ich schon gehört und pfiff sie in der Pause möglichst beiläufig vor mich hin, damit es den Anschein hatte, als hätte ich am Vortag eine Folge gesehen. Wurde ich dann gefragt, wie ich es gefunden hätte, antwortete ich unverbindlich, gab vielleicht wieder, was ich in der Programmzeitschrift gelesen hatte, oder wandelte ab, was ich einen anderen hatte sagen hören. Es gab ja noch kein Internet mit Foren, in denen der Inhalt jeder Folge jeder Serie haargenau nacherzählt wird.
An Samstagabenden waren meine älteste Schwester und ich dann und wann allein zu Hause. Ausnahmsweise durften wir vor dem Fernseher essen, auf großen Tellern lagen vorgeschmierte Brote. Wir sahen Am laufenden Band mit Rudi Carrell, später lief vielleicht Über den Dächern von Nizza oder, noch besser, mein Lieblingsfilm, Der unsichtbare Dritte.
In den Sommermonaten aßen wir meist unter der Überdachung auf der Terrasse, manchmal sogar bei Regen, wir blieben trocken. Morgens, mittags, abends draußen essen. «Essen wir draußen? Ja?» – dann musste alles hinausgetragen werden. Was auf den Teewagen passte, wurde aus der Küche über den Flur und durch beide Wohnzimmer auf die Terrasse geschoben, bugsiert, manövriert. Einmal verlor der Teewagen bei einem Manöver ein Rad, kippte und stürzte mit Geschirr und Aufschnittplatten um. Mein Vater schrie: «Diese Scheißkonstruktion», nahm das Gefährt, trug es in den Garten, hob es über die Schultern und zertrümmerte es auf den Waschbetonplatten, die von der Terrasse an den Heckenrosen vorbei zum Hundezwinger führten – das Splittern des Holzes hörte sich nach einer Saloon-Schlägerei in einem Western an. Er trampelte noch ein wenig darauf herum und warf das Teewagengerippe dann auf den Holzstapel hinter dem Komposthaufen.
«Hast du dich jetzt abreagiert?», fragte meine Mutter.
Als wir das nächste Mal ein Feuer machten, wurden die Teewagenreste verbrannt, die Räder hatte ich mir da schon gesichert – aber natürlich habe ich mir dann nie etwas aus ihnen gebaut.
Eines Abends fing der Hund auf der Terrasse eine Maus. «Da macht er doch glatt mal etwas Nützliches», sagte mein Vater. Plötzlich war er da, sein Killer-Instinkt war erwacht, angeblich waren Mittelschnauzer ja einst auf Burgen gehalten worden, um Ratten zu fangen. «Bravo.» Meine Mutter war stolz auf ihn.
Es war nicht üblich, jedenfalls nicht vorgeschrieben, im Haus die Schuhe auszuziehen. Wir sollten nicht mit den Gartenschuhen durchs Wohnzimmer latschen, klar, sondern sie entweder ausziehen oder außen herum gehen und das Haus durch die Haustür betreten, die an der Seite lag. Manchmal, weil sie halt herumstanden, zog ich Papas Lederschlappen an, die Papa-Pantoffeln. Sie waren mir zu groß, gefielen mir aber gut: vorne und hinten offen, mit flachem Absatz, bequem, sie klapperten so schön und waren weich. Nach und nach eignete ich sie mir an. Der Absatz des linken Pantoffels löste sich, ich nagelte ihn wieder fest, unten in der Garage, an der Werkbank, die keine war, sondern nur ein breites Regalbrett. Hielt aber nicht besonders gut, mein Schusterversuch, außerdem scheuerten die leicht herausstehenden Nagelköpfe den Stoff meiner Socken auf, an den Fersen hatten sie bald alle Löcher.
Küche
Ich ging so gern an den Kühlschrank in der Küche. Er war das heimlich leuchtende Zentrum des Hauses, sein Mittelpunkt, die Energiequelle, und in ihm befand sich mein Gral, die heilige Nachtischschüssel, an der ich immer wieder naschte, möglichst unbemerkt. Die Stelle, an der ich meinen Finger in die Quarkspeise oder Creme steckte, musste wieder glattgestrichen werden, was ich ebenfalls mit dem Finger erledigte. Naschte ich zu viel, blieb rings eine Spur am Rand, die weggewischt werden musste – mit dem Finger. Ich keimte alles ein.
Einbauküchen waren, das hatte ich schon verstanden, ein Statussymbol. «Wir bekommen eine neue Küche», hörte ich die Mutter eines Klassenkameraden zu einer anderen Mutter sagen. «Mit Umluftherd und Glaskeramikkochfeld ohne Platten. Lässt sich viel leichter reinigen.» Dass etwas sich einfacher sauber machen und sauber halten ließ, war ein wichtiges Kriterium. Abwaschbar war praktisch.
Unser erstes Cerankochfeld, ja, auch wir hatten so einen Herd, zerbrach, als mir ein heißer Topf aus der Hand rutschte. «Eine Herdplatte hätte das ausgehalten», sagte Frau Seel, ein gewöhnlicher Herd wäre nicht kaputtgegangen.
Schon einige Zeit zuvor hatte mein Vater einen Mikrowellenherd mitgebracht. Zuerst wussten wir nicht viel mit ihm anzufangen, dann lernten wir: Darin wurde alles sehr schnell heiß. Tiefgefrorenes ließ sich problemlos auftauen (auf Defrost stellen!), anderes rasch erhitzen. Der Mikrowellenherd war von Sharp wie einer von Papas Computern. Was bauten die noch? Kam eigentlich alles Neue aus Japan? Ein paar Jahre darauf fuhr meine Mutter einen Mitsubishi Pajero, einen Jeep, dessen Verdeck sich abnehmen ließ. Mitsubishi hieß, das wusste ich bald, «drei Diamanten».
«Stell’s doch in die Mikro», sagte meine Mutter nicht selten, oder sie schrieb: «Bitte im Mikrowellenherd aufwärmen!», auf kleine Zettel, die mittags neben den mit Klarsichtfolie überzogenen Essenstellern lagen. Manchmal machte ich mir ein überbackenes Käsebrot, der Käse brutzelte so herrlich, schien zu leben, zu atmen durch die heißen Blasen, eine Art Raclette-Brot, ich aß es mit schön viel Ketchup. Unser Ketchup war immer das von Heinz, aus der Glasflasche, uns kam kein anderes ins Haus.
Für mich war es ein großes Geheimnis, wie dieser Mikrowellenherd funktionierte. Die Teller mit Goldrand durften wir nicht hineinstellen, überhaupt nichts aus Metall, aber natürlich machte ich es dann doch, um herauszufinden, was passieren würde: Es funkelte und blitzte erstaunlich hell, es bildete sich ein Funkenring. Einige Experimente später war der Mikrowellenherd kaputt, ich tat, als hätte ich nichts damit zu tun. Wir bekamen einen neuen von Sanyo. Japaner waren einfach besser.
Unsere Einbauküche hatte viele Fronten, alle in demselben grellgrünen Farbton, meine Mutter hatte ihn 1976 ausgesucht. Sieben Jahre später hatte sie ihn über, sie ließ alle Fronten abmontieren und cremeweiß umspritzen, es war, als hätten wir eine neue Küche. Von all den vielen Kästen, Schränken, Schubladen und Schubfächern war die Cornflakes-Schublade mir die liebste. In ihr standen neben den Cornflakes von Kellogg’s auch Frosties und Smacks, Müslipackungen sowie Haferflocken: Billighaferflocken, No-Name-Flocken von Aldi, für den Hund und die Markenhaferflocken von Kölln. Nie im Leben wäre es mir eingefallen, von den Hundehaferflocken zu essen.
Manchmal war ich es, der dem Hund das Futter machte: Haferflocken in den alten Topf, der sein Fressnapf war, hinzu kamen Chappi, Wasser, Ei und Aufschnittreste, die vielleicht schon nicht mehr so gut rochen, manchmal gab ich ihm auch Pansen, der sehr seltsam roch und wie gekochte Bienenwaben aussah. Ich wollte nicht glauben, dass das Fleisch sein sollte, der Konsistenz nach hätte es auch ein Kunststoff sein können. Pansen ist, hatte ich gelernt, der siebente Magen der Kuh, der Wiederkäuermagen. Manchmal bereitete mein Vater einen kleinen Teil des Pansens, den er für den Hund kochte, für sich selbst zu. Der Geruch zog durchs ganze Haus, ich verstand nicht, dass er das aß.
In der Schublade unter den Cornflakes lagen Bundeswehrpakete mit Tagesverpflegungen, so genannte Nato-Notrationen, die mein Vater von Reserve-Wehrübungen mitbrachte. Darin befanden sich, tarngrün verpackt und schlicht serifenlos beschriftet, Margarine in der Tube, Dosenfleisch und Hering in Tomatensauce. Wenn es gar keine anderen Süßigkeiten im Haus gab, wenn überhaupt nirgendwo etwas aufzutreiben war, dann aß ich die Bundeswehrkekse, die es in diesen Notrationen ebenfalls gab, weitgehend geschmacksneutrale Dinger, bröckelig, hart, oder ich machte mich über die Schokoladentäfelchen her, die zwar nicht gut schmeckten, immerhin aber war es Schokolade. Meine älteste Schwester, obwohl schon früh sehr antimilitaristisch eingestellt, freute sich immer besonders über diese Pakete. Sie mochte Bundeswehrschokolade. Für sie war das Papa-Schokolade.
In den Schränken der Küche befanden sich die Geräte: der elektrische Eierkocher, der nur sonntags benutzt wurde, die Küchenmaschine, die in immer wieder neuen Variationen zusammengebaut werden konnte – mit Rührschüssel und Knethaken oder als Häckselmaschine oder als Mixer zur Milchshakeproduktion. Ein Handrührgerät nannte sich ebenfalls Mixer, mit ihm schlug ich samstags und sonntags die Sahne zum Kuchen. Sahneschlagen war meine Aufgabe, mit einem Päckchen Vanillezucker und einer Prise Salz. «Eine Prise Salz, aber bloß eine Prise», sagte meine Mutter. Die Sahne, mein Vater sagte «Schlagobers», füllte ich in eine Glasschüssel, zu ihr gehörte der Sahnelöffel, ein Silberlöffel, der nur für diesen Zweck verwendet wurde.
Wir hatten einen elektrischen Dosenöffner, praktisch, um die Ravioli- und Hundefutterdosen zu öffnen, ein starker Magnet hielt die Konserven in der Schwebe. Mich beeindruckte auch die mechanische Küchenwaage, meine Mutter hatte mir das mit dem Tariergewicht, das hin und her geschoben werden musste, mehrfach erklärt. Weitere elektrische Geräte waren der Crêpe-Macher, der, tunkte ich ihn kopfüber in den Teig, hauchdünne Crêpes backen konnte, zwei Waffeleisen für runde, aus Herzen zusammengesetzte Waffeln, und der Sandwichtoaster, der Sandwich-Muscheln herstellte. Das Problem war, dass ich, hatte ich einmal angefangen, Schinken-Tomaten-Käse-Muscheln zu essen, nicht damit aufhören konnte.
Die Fritteuse und das Gerät, das angeblich Joghurt machen sollte, und viele andere elektrische Geräte, die selten oder nie benutzt wurden, landeten im Keller, im Museum der ausgemusterten Apparate.
So weit ich zurückdenken konnte, hatten wir eine Brotschneidemaschine mit Kurbel in der Küche stehen. «Schneidest du noch Brot?», lautete die Bitte jeden Abend vor dem Abendessen. Machte ich gerne – ich durfte den Brotlaib nur nicht zu fest gegen das Messerblatt drücken, «Drehen, nicht drücken, Freund!», die Stimme meines Vaters. Eines Tages begann die Diskussion: Brauchen wir eine neue, eine elektrische? Meine Schwester war dagegen. Die elektrische Brotschneidemaschine von Braun kaufte mein Vater dann doch. War allerdings gefährlich: «Schneid dir nicht die Finger ab!», hieß es von da an.
Einen elektrischen Wasserkocher gab es auch, aus England mitgebracht. Er stand fast immer draußen auf der braunen Arbeitsfläche, wurde ja ständig benutzt. Die Küchenarbeitsfläche war nicht ganz glatt, sie hatte kleine Vertiefungen, eine Mikrostruktur, Saugnäpfe hafteten nicht. Mit den Fingernägeln darüberzufahren verursachte ein raspelndes Geräusch, es kitzelte an den Fingerkuppen.
Mama war ein Kriegskind, weshalb es manchmal Kriegs- oder eher Nachkriegsessen gab, Mahlzeiten aus Resten, etwas ohne Fleisch, Mehlsuppe, Graupensuppe. Oft gab es Spinat, Kartoffeln, Spiegelei, Milchreis oder Kartoffelpuffer. Meine Mutter entdeckte irgendwann ein neues Gemüse, kam aus Italien, es hieß Zucchini. Auf einmal kochte sie sehr oft Zucchinipfanne oder mit Hackfleisch gefüllte Zucchini. Dann gab es Auberginen, dann nur noch Brokkoli statt Blumenkohl und zum Glück keinen Rosenkohl mehr, plötzlich lagen Kiwis in der Obstschale. Das sollten große Stachelbeeren sein? Ich erinnere mich an meine erste Artischocke: Um sie zu essen, durften wir die Blätter über die Zähne ziehen. Es gefiel mir, wie Artischocken gegessen wurden, herrliche Sauerei. Und sie schmeckten.
Aufläufe gab es oft. Nudelauflauf zum Beispiel. Wurde ich im Jahrzehnt der Aufläufe groß? Spiralnudeln, Schinken, Sahne, Ei – es ging auch raffinierter. Fleisch kaufte mein Vater nur beim Metzger, dort bestellte er außer Pansen viel zu oft Suppenfleisch, Rindfleisch, das dann in Stücken, meist mit weißem oder elfenbeinfarbenem Fettrand, in einer Brühe schwamm. Ich kaute darauf herum, es war zäh, ich kaute weiter darauf herum und ekelte mich vor der faserigen Konsistenz. So oft es ging, täuschte ich einen Hustenanfall vor und spuckte den Brocken heimlich in die vor den Mund gehaltene Serviette. Der Hund freute sich später über meine angekauten Klumpen.
Ein Mitschüler, der in den Sommerferien zu Verwandten in die DDR fahren musste, erzählte, er habe dort einige Male Wildschwein gegessen. Wildschwein, sagte er, schmecke fabelhaft. War die DDR so eine Art Gallien der Asterix-Hefte? Wurden da Wildschweine gejagt? War die Versorgungslage drüben wirklich so schlecht?
Oft hatte ich nicht lange nach dem Mittagessen schon wieder Hunger. Ich ging an die Cornflakes-Schublade oder öffnete die größere Backschublade, suchte überall im Haus nach Schokolade, ich kannte ja alle Verstecke. Ich ging in den Keller oder zu dem Schrank ganz oben im Treppenhaus, in dem Ersatzglühbirnen und Sicherungen lagen, auch dort hatte meine Mutter schon Kekse versteckt. Langweilte ich mich bei meinen Hausaufgaben oder beim Nicht-Anfertigen meiner Hausaufgaben, lief ich hinunter zum Kühlschrank, um nachzusehen, ob der sich seit dem Mittagessen nicht auf magische Weise mit neuen essbaren Dingen gefüllt hatte, ich wollte an den Zauberkühlschrank glauben, ich träumte von der Tischlein-deck-dich-Kühlung.
Fand ich weder in der Küche noch unten im Vorratskeller etwas – hatten wir nicht noch Eis? –, begann ich, Zutaten aus der Backschublade miteinander zu vermengen, ganze Mandeln, geriebene Nüsse, Rosinen, Brocken von Kuvertüre, und versuchte, einen neuen Nachtisch, eine neue Süßspeise zu erfinden. Zitronat sah gut aus, schmeckte nur leider nicht.
Oder ich fing an, Kuchen zu backen, um möglichst viel Kuchenteig naschen zu können, manchmal aß ich so viel davon, dass der gebackene Kuchen eher klein ausfiel und ich mich wunderte, wie schlecht mir war. Kam Mama nach Hause und fand einen angeschnittenen Apfelkuchen in der Küche, probierte sie immer, das war ihr Spiel, ganz vorsichtig davon, ein kleines Stückchen nur, kaute prüfend, dann erst hellte ihr Gesicht sich auf, und sie schaute erfreut und sagte: «Oh, der ist gut! Jetzt müssen wir sonntags ja keinen Kuchen mehr kaufen.» Von der ungespülten Rührschüssel, den verklebten Knethaken der Küchenmaschine und den Teigschabern im Backofen sagte ich nichts.
Und natürlich griff ich, wenn ich Durst hatte, einfach nach einer Sprudelflasche, trank daraus und stellte sie in die Kühlschranktür zurück – obwohl es doch immer hieß: «Trink nicht aus der Flasche! Nimm dir ein Glas!» Ein Glas aber hätte ich ja aus dem Schrank nehmen und danach in die Spülmaschine stellen müssen, wie anstrengend, und außerdem: War das nicht Wasser- und Energieverschwendung, ein Glas spülen zu lassen, nur weil ich ein wenig Wasser, drei oder vier Schluck, daraus getrunken hatte? Aus aufgeschnittenen Apfelsaftpackungen zu trinken, ohne sich zu bekleckern, war schwieriger.
Einmal entdeckte ich in einem Fach der Kühlschranktür ein Gläschen mit grünen, seltsam geformten Kügelchen in Flüssigkeit. Was war das? «Sind das Tiere?», fragte ich meine Mutter. «Sind das kleine tote Krebse?»
«Nein», sagte sie, «das sind Kapern.»