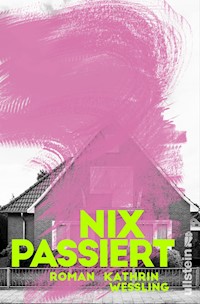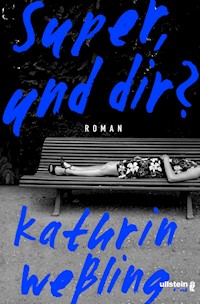9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das «fulminante Debüt» (WDR WestART) von Kathrin Weßling, neu versehen mit einem Vorwort der Autorin. Ida steht zum wiederholten Mal in ihrem Leben vor der Tür einer psychiatrischen Klinik, mit einem Zettel, auf dem ihr Name und der Grund für ihren Aufenthalt genannt sind. F 32.2. Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome. «Drüberleben» erzählt von den Tagen nach diesem Tag, von den Nächten, in denen die Monster im Kopf und unter dem Bett wüten, den Momenten, in denen jeder Gedanke ein neuer Einschlag im Krisengebiet ist. Es erzählt von Gruppen, die merkwürdige Namen tragen, von Kaffee in ungesund großen Mengen, von Rückschlägen und kleinen Fortschritten, von Mitpatienten und von Therapeuten. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die sich zehn Wochen in eine Klinik begibt und dort lernt, zu kämpfen. Gegen die Angst und gegen das Tiefdruckgebiet im Kopf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kathrin Weßling
Drüberleben
Depressionen sind doch kein Grund, traurig zu sein
Über dieses Buch
Das «fulminante Debüt» (WDR Westart) von Kathrin Weßling, neu versehen mit einem Vorwort der Autorin.
Ida steht zum wiederholten Mal in ihrem Leben vor der Tür einer psychiatrischen Klinik, mit einem Zettel, auf dem ihr Name und der Grund für ihren Aufenthalt genannt sind. F32.2: schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome. «Drüberleben» erzählt von den Tagen nach diesem Tag, von den Nächten, in denen die Monster im Kopf und unter dem Bett wüten, den Momenten, in denen jeder Gedanke ein neuer Einschlag im Krisengebiet ist. Es erzählt von Gruppen, die merkwürdige Namen tragen, von Kaffee in ungesund großen Mengen, von Rückschlägen und kleinen Fortschritten, von Mitpatienten und von Therapeuten. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die sich zehn Wochen in eine Klinik begibt und dort lernt zu kämpfen. Gegen die Angst und gegen das Tiefdruckgebiet im Kopf.
«Mit ihrem Erstlingswerk hat Kathrin Weßling einen Nerv der Zeit getroffen.» ARTE Yourope
«Interessant, klug und stellenweise sehr witzig.» stern
«Ein sehr gutes Buch.» ZDF Bauerfeind
«Provozierend, rotzig, ironisch und sensibel. Ein Bestseller.» emotion
Vita
Kathrin Weßling ist Autorin und Social-Media-Expertin. Ihre Postings und Beiträge verfolgen über 70000 Menschen. Ihr Buch Super, und dir? wurde von Presse und Leser:innen als «der Roman ihrer Generation» gefeiert. Sie schreibt außerdem regelmäßig für ZEIT ONLINE, SPIEGEL, ZEIT u.v.m. Kathrin Weßling lebt in Berlin.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2012 bei Goldmann, München.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2025
Copyright der Neuausgabe © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Lübbeke Naumann Thoben, Köln
ISBN 978-3-644-01832-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
Als Erstes: Ich persönlich hasse es, Vorworte zu lesen, deshalb: Du kannst das hier überspringen, Du wirst dieses Buch fühlen und verstehen, auch ohne ein Vorwort. Falls Du aber gerade ein bisschen Hoffnung brauchst: Lies das Vorwort. Es ist nur für Dich geschrieben.
Dieses Vorwort zu schreiben, ist eines der schwierigsten Dinge, die ich jemals getan habe. Weil dieses Buch entstanden ist zu einer Zeit, in der ich ein völlig anderer Mensch war. Deshalb möchte ich jetzt nicht ewig über mich sprechen, sondern über die Kathrin, die ich damals war. Ein verwundeter, kaputter Vogel, voller Angst, voller Gefühle, voller Abgrund und Dunkelheit, voller Hoffnung und Enttäuschung. Ich war schwer depressiv, ich habe Teile von Drüberleben noch in der Klinik geschrieben. Ich hatte schreckliche Angst, vor allem. Am meisten vor mir selbst, weil ich nicht verstand, was mit mir passierte. Ich fühlte mich völlig allein. Ich war einsam, so einsam, dass ich innerlich den ganzen Tag geschrien habe. Ich hatte Angst rauszugehen, ich hatte Angst, in den Supermarkt gegenüber zu gehen, ich hatte Angst, mich mit jemandem zu treffen, ich hatte Angst, dass ich einfach ohnmächtig werden würde, ich hatte Angst, Angst, Angst. Und ich war traurig. Ich war so haltlos und abgrundtief traurig. Ich war Mitte zwanzig, und ich war gefangen in einem Körper, der mir nicht mehr gehorchte, der plötzlich achtzigtausend Kilo schwer war und der mir bis in die Seele wehtat.
Ich war zu Hause eingesperrt, ich war verstört, und ich wollte nicht mehr leben. Es war eine schlimme Zeit, die viele Jahre ging. Der Erfolg von Drüberleben änderte daran gar nichts. Was wirklich etwas änderte: am Leben zu bleiben. Am Leben zu bleiben und weiterzumachen. Nach Lösungen zu suchen, nach Hilfe, nach Antworten, nach Liebe. Und deshalb möchte ich kein schlaues Vorwort schreiben, voller Zahlen und Fakten, voller Ermutigungen über einen offenen Umgang mit psychischer Gesundheit und all dem Blabla, das wir alle schon hundertmal gelesen haben. Ich möchte Dir dieses Vorwort widmen, Du, die das hier gerade liest. Ich erzähle Dir all das nämlich, damit Du mindestens eine andere Person kennst, der es gerade geht wie Dir. Damit Du weißt, dass Du nicht alleine bist. Damit Du mir glaubst, dass diese Kathrin 15 Jahre später Dir heute sagt und schreibt: Es ist nicht schön, es fühlt sich an, als hätte man als einziger Mensch allein verstanden, dass alles vollkommen sinnlos ist. Es ist niederschmetternd, und es ist kalt und eklig und dunkel in diesem beschissenen Loch, ich weiß, ich weiß es so gut. Aber ich verspreche Dir hier und heute: Es bleibt nicht für immer so. Es wird besser. Nicht schlagartig und nicht einfach so. Du musst um Dein Leben kämpfen. Du musst einatmen, und Du musst ausatmen. Und das war’s, mehr musst Du nicht tun. Du wirst das hier überstehen. Es wird aufhören, es wird eines Tages vorbei sein. Ich verspreche es Dir. Denn ich lebe noch. Und wenn ich noch lebe, dann schaffst Du es auch. Ich sehe Dich. Und ich glaube an Dich.
Fallen
Prolog
Ich bin ein menschlicher Verkehrsunfall. Irgendwann bin ich einfach stehen geblieben, und dann sind Erlebnisse wie Lkws in mich hineingefahren. Man kann sich vorstellen, dass das zu großen Problemen führt. Wenn man nicht ausweicht, geht das einfach immer weiter. Der Unfall wird immer größer, immer unübersichtlicher, und irgendwann stehst du auf der Gegenfahrbahn und fragst dich, was eigentlich zum Teufel gerade passiert ist.
Das ist der Moment, in dem du aussteigen solltest. Nicht das Aussteigen, das in den Büchern steht, die man in Buchhandlungen grundsätzlich in der Ratgeberecke findet. Nicht diese Art Aussteigen, die etwas mit Kofferpacken und In-den-Bauch-Atmen zu tun hat.
Dieses Aussteigen passiert einfach von allein. Erst mal merkst du überhaupt nichts. Du räumst die Wohnung auf, die Flaschen weg, und du atmest weiter ein, und du atmest weiter aus, und du isst weiter dein Essen und rufst weiter die Nummern in deinem Telefon an, und du gehst weiter nach draußen, und du gehst weiter in dein Büro und in dein Bett, wenn es Zeit dafür ist. Du bemerkst die Schäden, aber weil alles andere noch steht, weil die Autos noch fahren, die Busse noch für dich halten, die Verkäuferin noch mit dir spricht, weil du noch ausscheidest und schwitzt und dir die Schuhe zubinden kannst und weil du keine einzige blutende Wunde zu versorgen hast und weil kein einziger Schlauch in dir steckt, denkst du, dass du noch ein bisschen weitermachen kannst.
Du bewegst dich langsam, aber du bewegst dich, und dass sich das nicht ändert, beruhigt dich. Du putzt dir die Zähne, und du duschst deinen müden Körper, und du bekommst manchmal Kopfschmerzen, aber alles bewegt sich, alles geht doch weiter, der Fernseher läuft doch noch, so schlimm kann es doch nicht gewesen sein. Unmerklich wirst du Woche für Woche ein bisschen mehr zu Zement, ein bisschen mehr zu Beton, ein bisschen mehr zu dem Schatten hinter dir. Aber du gehst weiter, denn das Gehen fühlt sich gut an, im Gehen fühlst du dich sicher, im Gehen hörst du deinen Atem und grüßt auch manchmal irgendwen, denn du kennst ja Menschen, du hast ja Freunde, du hast ja wen. Manchmal merkst du, dass etwas passiert ist, dass dir etwas zugestoßen ist, dass etwas wehtut, dass sich etwas verschoben hat, dass du nicht mehr so bist, wie du vorher mal warst – aber weil du nie aufgeschrieben hast, wer das jetzt noch mal genau gewesen sein soll, kann dir keiner beweisen, dass das stimmt. Also stimmt es vielleicht auch einfach nicht.
Du trinkst. Du trinkst Wein, weil der so gut zum Essen schmeckt, und das erste Glas zum Kochen und das zweite Glas auf das Essen und das dritte auch und das vierte auf die Liebe und das fünfte auf das Leben und das sechste auf das sechste und das siebte auf die Flasche Wein.
Du schläfst jetzt immer schlechter, und du träumst von diesem Unfall, der natürlich kein Verkehrsunfall war, sondern nur ein unscheinbarer, winziger Moment in deinem Leben, der gar nichts hätte bedeuten müssen. Vielleicht war es einfach nur der Moment, in dem du gemerkt hast, dass es jetzt schon sieben Jahre sind. Oder dieser Moment, in dem der Sarg in dem Loch liegt und du die Erde darauf geschmissen hast. Oder dieser Moment, als sie dir gesagt haben, dass es vorbei ist. Oder dieser Moment, als du es nicht geschafft hast. Oder dieser Moment, als du gefallen bist. Oder dieser eine Traum. Oder dieser andere Traum. Oder dieser eine Mann. Oder dieser eine Wunsch. Dieser eine, verfluchte Wunsch. Vielleicht war es nur einer dieser Momente. Vielleicht war es auch keiner. Manchmal reicht nur ein winziger Augenblick aus, um zu begreifen, dass nichts jemals wieder so sein wird, wie es war.
Und eines Morgens stehst du dann vor dem Spiegel und siehst dich an und siehst das fahle Grau in deinen roten Augen, und du bleibst vor dem Spiegel stehen, du bleibst einfach stehen und bewegst dich keinen Zentimeter mehr weiter.
Und damit fängt es an.
Es ist ja nicht so, als würde irgendetwas helfen. Es ist ja nicht so, als würde es helfen, zu schreien oder zu beten oder zu weinen oder zu laufen oder zu tanzen oder mit jemandem zu reden. Doch, doch, bestimmt, du kannst reden. Du kannst unfassbar viel reden. Du kannst dabei in weichen Sesseln sitzen, und jemand vor dir bekommt ein bisschen Geld dafür, dass er dir zuhört, oder du kannst auf harten Stühlen in vollgestellten Küchen sitzen und all dein Gerede über all die Gründe auf die Tische vor dir schmeißen, du kannst es dahinrotzen, dahinschmeißen, es zerlegen, sezieren, du kannst jeden verdammten Augenblick auseinandernehmen und untersuchen, du kannst nächtelang darüber reden, wann es passiert ist, wann es noch mal passiert ist, dass du dich so furchtbar erschrocken hast vor der Welt, vor den Menschen, vor diesem Unfall, vor diesem einen Moment, dass du seitdem ständig das Gefühl hast, nicht mehr richtig gehen zu können, nicht mehr schnell genug sprechen zu können, nicht mehr beschützt zu sein, nichts mehr einfach so machen zu können, nichts mehr einfach so machen zu können – «einfach»?, nie gehört. Du kannst immerzu und an jedem Ort darüber sprechen, kannst Worte erbrechen, kannst behaupten und vermuten, kannst laut denken und leise sprechen, kannst es flüstern und kannst einfach deinen Mund nicht halten, aber niemals wird dir jemand sagen können, warum du, genau du in diesem Moment einfach nicht mehr funktionierst, warum du an diesem Tag diese eine Sache gemacht hast, die diese andere Sache ausgelöst hat, die wiederum diese weitere Sache hervorgerufen hat, und warum all diese Sachen dich zu diesem Moment gebracht haben, der dazu geführt hat, dass sich die Schwere und die Stille in dein Leben geschlichen haben, wie geruchloses Gas in eine Wohnung, in der du ruhig schläfst und nichts riechst und nichts schmeckst und gar nicht bemerkst, wie du vergiftet wirst.
Niemand kann es dir sagen, und kein Wort wird helfen, versprochen.
Du sitzt bloß da und redest. Du sitzt bloß da und redest und vermutest, und manchmal vermutet jemand mit, und manchmal glaubt sogar jemand, und immer öfter weiß auch mal jemand etwas zu sagen, das du dann aufgreifst, angreifst, mitnimmst, ausprobierst, dir in den Gedanken-Tank kippst, denn du willst ja nicht so sein, du willst ja schneller sein, du willst ja nicht immer müde sein, immer traurig sein, immer ängstlich sein, immer so am Ende sein, immer heulen, immer wieder von vorne anfangen müssen. Du willst ja nicht jeden Morgen das Gefühl haben, dass du schon wieder ganz neu beginnen musst, dass jeder Tag so unvorstellbar riesig und unbezwingbar groß ist, dass du ihn gar nicht besiegen kannst, diesen Tag, du willst nicht jeden Morgen aufwachen und das Gefühl haben, dass du viel zu klein für so große Tage und für so große Aufgaben bist, du willst lieber einfach weitermachen, so wie die anderen, du willst in diesen warmen Fluss zurück, in dem man einfach herumschwimmt und mitschwimmt und mitmacht und morgens aufwacht und einfach aufsteht und weitermacht. Keine Neuanfänge mehr, sondern nur noch Anschlüsse an das Gestern, an das Vorgestern, an irgendwann letzten Monat.
Du nimmst jeden Ratschlag, jede Meinung, jeden Tipp, all diese Worte nimmst du mit nach Hause, und du probierst sie alle aus.
Du gehst mal wieder raus.
Du machst mal wieder Sport.
Du isst keinen Weizen mehr, keinen Zucker, keine Milchprodukte, kein Fleisch, keine künstlichen Zusatzstoffe.
Du trinkst keinen Alkohol, keinen Kaffee und nur noch Wasser aus Vulkansteinquellen.
Du machst Yoga.
Du liest Bücher.
Du redest darüber.
Du fährst in den Urlaub.
Du hast mal wieder Sex.
Du gehst spazieren.
Du streichelst Tiere.
Du meditierst.
Du bist nett.
Du bist so verdammt nett.
Du hast eine Struktur.
Du hast einen Tagesplan.
Du hast also Pläne, und du probierst alles aus. Das machst du. Und du hast Hoffnung. Du hast echt verdammt viel Hoffnung, dass das eines Tages wieder weggehen wird. Die Angst. Die Müdigkeit. Diese ständige, bleierne Müdigkeit.
Bis hierhin hat schon mindestens einer von Therapie gesprochen. Dass ihm das «echt viel gebracht» hat. Dass das «gar nicht so schlimm» ist, «wie alle immer sagen». Er könne dir da auch eine Telefonnummer geben. Einfach mal hingehen. Ein bisschen reden. Du siehst so müde aus in letzter Zeit. Du siehst so abgekämpft aus in letzter Zeit. Du siehst so aus, als bräuchtest du echt mal jemanden zum Reden. Du hast genickt. Ja, warum nicht. Jeder braucht ja mal jemanden zum Reden. Manchmal hast du dich gefragt, warum du nicht einfach mit den anderen weiterreden kannst. Wo die doch schon mal da waren. Aber du hast weiter genickt. Immer alles abgenickt. Hilfe, hast du gedacht, kriegt man ja überall. Wieso nicht einfach alles nehmen, was man kriegen kann. Wieso nicht alles kriegen, was man nehmen kann.
Die Erde dreht sich trotzdem weiter mit 0,463 km/s. Sie rotiert vierundzwanzig Stunden am Tag. Je näher man dem Äquator kommt, desto leichter kann man in das Weltall abheben. Auch du rotierst jeden Tag um die immer gleiche Achse, drehst dich um dich selbst und in der immer gleichen Bahn. Deine Gedanken kommen dir vor wie Planeten, die sich um deine Erde drehen, und deine Haltlosigkeiten wie missglückte Versuche, einmal anzuhalten, stillzustehen, die zu nahe in die Nähe deiner Mitte geraten und dann einfach ins All geschleudert worden sind. Diese Mitte, auf der die Oberfläche nur ein winziges Stückchen größer ist als auf dem ganzen Rest, die hast du sowieso längst verloren, die ist irgendwie überall und morgens in deinen Füßen, und abends liegt sie irgendwo zwischen deinem linken Ohrläppchen und deinem rechten Mundwinkel. Ständig bist du damit beschäftigt, die Dinge in die Nähe dieser Mitte zu rücken, in die Nähe dieser Position, in der du vermutest, dass dort vielleicht «richtig» und «genug» und «genau» liegen könnte, aber sobald du dich in der Nähe wähnst, fliegen dir diese Versuche einfach davon. Ein Paradoxon, das dir schwer zu schaffen macht.
Du weißt ja, dass du deine Mitte nicht findest. Du weißt ja, dass, wenn du sie suchst, dir die Dinge entgleiten, die Versuche einer klaren Struktur, eines geregelten Tagesablaufs, dass sie jedes Mal einfach so davonfliegen, als würde dieser Vorgang einem Naturgesetz folgen, dem du dich verzweifelt entgegenstemmst, das du aber einfach nicht zu bezwingen vermagst. Eine Sisyphos-Tortur, die schon beinahe lächerlich wirkt, die du aber immer und immer wiederholst und die im Grunde nichts anderes bedeutet als: Jeder Versuch, einen Tag so zu verbringen, dass er mit dem eines Menschen vergleichbar wäre, dem die anderen nicht raten würden, psychiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen, scheitert schon bei dem kläglichen Unterfangen, vor dreizehn Uhr das Bett zu verlassen.
Eins
Hier liegt Müll. Seit Wochen liegt hier Müll. Hier liegen Flaschen. Seit Wochen liegen hier Flaschen. Ich bin vierundzwanzig Jahre alt und lebe auf einer Müllkippe, auf der ein Bett schwimmt, in dem ich liege. Menschenmüll. Das rechte Auge nimmt den Müll wahr, das linke bleibt stoisch zu und will nicht begreifen. Will die Kopfschmerzen nicht begreifen und den Tag nicht und will nicht begreifen, was das rechte Auge schon längst sieht.
Das fahle Licht des grauen Himmels vor den Fenstern lässt erahnen, dass Morgen sein muss, dass Herbst sein muss, dass wieder eine Nacht vorbei ist in dieser Stadt, in der ich mich winde vor Langeweile und Apathie. Der Atem ist flach, und der Hals schmerzt gerade genug, um zu wissen, dass das die Zigaretten sein müssen und keine Krankheit, die verhindern könnte, was heute passieren wird. Was heute passieren muss. Was heute auf jeden Fall und unabänderlich zu dem Tag macht, an dem ich für viele Wochen zum letzten Mal in diesem Bett aufwache.
Ich halte den Kopf still, die Hände, den ganzen Körper in seiner Rückenlage und versuche, flach zu atmen. Versuche, den Schmerz, der sich langsam zwischen den Schläfen ausbreitet und bei jeder Bewegung explodieren könnte, mit diesem Ein- und Ausatmen vorsichtig in Schach zu halten. Es ist warm im Bett, viel zu warm für die Möglichkeit, dass nur ein Körper in der Lage wäre, eine solche Wärme zu produzieren. Ganz langsam, nur im Nebel einiger Sinneseindrücke, beginnt der Kopf wahrzunehmen, was das linke Auge nicht sehen wollte, eigentlich nicht sehen wollte.
Ein leises Schnarchen neben mir drängelt sich in den ansonsten völlig stillen Raum und macht deutlich, dass der Körper heute Nacht offensichtlich nicht allein gewesen ist. Ich schließe beide Augen und seufze leise, so leise, dass es einem Atemzug ähnlich bleibt. Kein weiteres Geräusch wäre jetzt erträglich, kein «Guten Morgen», kein «Wer bist du?», kein «Was tust du hier?», kein «Was zum Teufel tust du hier eigentlich?».
Wie würde die Antwort auf solche Fragen auch lauten. Im Grunde wäre nur Schweigen die richtige Antwort, die richtige Alternative zu jeder erdenklichen anderen Form des Sichrechtfertigens. Im Grunde (und das wissen mein Gewissen und mein Körper schmerzlich genau) gibt es keine einzige wohlklingende Erklärung für das, was passiert ist.
Ich hatte getrunken, und ich hatte auch etwas in meinen Drink geschüttet, womit ich sagen will, dass ich mir in Wahrheit etwas durch die Nase gezogen hatte, aber etwas in den Drink geschüttet (bekommen) klingt – seien wir ehrlich – einfach mehr danach, als träfe mich weder daran noch an allem anderen auch nur die geringste Schuld. Und doch war es meine Schuld gewesen, dass ich die Tabletten mit Alkohol gemischt und meinen Verstand darin so lange ertränkt hatte, bis er blau anlief und erschöpft aufgab. Ich stand in der Bar und zitterte vor Angst. Das ist die Wahrheit. Ich hatte Angst vor den Menschen, die sich um mich drängten, und ich hatte noch mehr Angst vor der Vorstellung, dass irgendwer bemerken könnte, dass ich Angst vor der Vorstellung hatte, dass jemand bemerken könnte, dass ich furchtbare Angst hatte.
Ich war in die Bar gegangen, um Michael zu treffen, einen Bekannten, der mir am Telefon wenige Stunden zuvor versprochen hatte, den letzten Abend mit mir zu verbringen, und bei dem ich hätte wissen müssen, dass er mich versetzen würde, denn von den ungefähr zehn Malen, die wir bisher verabredet waren, hatte er geschlagene acht Mal kurz vor oder nach der verabredeten Zeit abgesagt. So stand ich um zehn nach neun Uhr allein in der Bar, spürte das Vibrieren meines Telefons in der Tasche und musste es nicht einmal herausholen, um zu wissen, wer mir geschrieben hatte.
Die gute Nachricht war: Ich hatte somit auch das letzte Argument erhalten, mich besinnungslos zu betrinken, mich selbst dabei einsam an der Theke sitzend zu bemitleiden, und wurde dabei von absolut niemandem mahnend angeschaut, eine Rolle, die meine Bekannten in der letzten Zeit mit einem Eifer übernahmen, der mir beinahe unheimlich war. Die schlechte Nachricht: Ich war einer dieser Menschen, die sich alleine in einer Bar sehr hilflos und auch irgendwie abstoßend vorkommen, und ich kam nicht mit dem Gedanken zurecht, alleine einen ganzen Abend lang auf das sich immer wieder füllende Glas zu starren. Die trübsinnigen Gedanken, die einem dabei kommen, waren nicht das Problem. Es war eher das Beitrübsinnigen-Gedanken-alleine-an-der-Theke-sitzen-und-dabei-von-Fremden-beobachtet-werden-Gefühl, das mir unbehaglich war.
Ich beschloss dennoch, mich zumindest probeweise an die Theke zu setzen, und bestellte einen Gin, um herauszufinden, ob ich schon so weit war, so weit am Bodensatz meines Drangs nach Eskapismus und Verflüchtigung der Gedanken, dass ich alleine an dieser gottverdammten Theke sitzen konnte.
Es ging erstaunlich einfach. Ich musste nicht mehr tun als trinken und starren und möglichst meinen Blick auf das Glas geheftet lassen, um nicht mitzubekommen, dass mich jemand ansah. Ohnehin kam mir der Gedanke, beobachtet zu werden, mit einem Male recht größenwahnsinnig vor, schließlich war ich nicht im Mindesten die Art Mensch, die permanent angestarrt wurde – ich war eher die Art Mensch, die sehr zufrieden mit einem Glas Gin und einer Zitrone und depressiven Gedanken sein konnte.
Ich fand heraus, dass ich ebenfalls sehr zufrieden mit einem Glas Wodka sein konnte und dass die Wahl des Getränkes sowieso keinen Unterschied machte, solange es kein Bier war, denn mit Bier allein an der Bar, das kam mir dann doch ein bisschen bemitleidenswert vor.
Die Angst schlich sich immer wieder zwischen zwei Schlucke und zwischen zwei Gedanken und zwischen Herz und Kopf und Lunge, aber ich schluckte sie tapfer hinunter, desinfizierte sie geradezu mit jedem Promille mehr, bis sie völlig frei war von Gedanken und Bewertungen und ich mir meine nackte, hässliche Angst ansah und sie sehr lächerlich fand. Sowieso fiel es mir in den letzten Monaten zunehmend leichter, jede aufkommende Panik so lange zu ertränken, bis sie nur noch ein fernes, weißes Rauschen war, das ich zwar wie einen störenden Tinnitus wahrnahm, bei dem ich aber durchaus in der Lage war, es zu ignorieren, solange ich nur laut genug schrie oder lange genug trank.
Dass ich beobachtet wurde, bemerkte ich erst, als ich doch einmal einen Blick zur Seite wagte, um herauszufinden, wie viele Schritte mich von der Toilette trennten. Er stand am anderen Ende der Theke und sah unverwandt zu mir herüber, gerade so, als würden wir uns kennen. Er sah mich an, und obschon er seinen Blick nicht abwendete und ich im schummrigen Licht der Bar glaubte zu sehen, dass er nicht einmal blinzelte, nahm ich seinen Blick nicht als ein Starren wahr, sondern eher als ein Staunen. Und plötzlich stand er neben mir.
«Ich bin Johannes.»
«Du hast mich angeschaut.»
«Du hast mich angeschaut.»
«Das stimmt.»
«Was trinkst du?»
«Wasser.»
«Dein Wasser riecht nach Wodka.»
«Deine Stimme auch.»
«Deine klingt müde.»
«Ich bin müde.»
«Warum bist du dann nicht zu Hause?»
«Weil ich jemanden hier treffen musste.»
«Mich vielleicht.»
«Würdest du das gerne hören?»
«Nein. Wir kennen uns ja nicht. Es wäre komisch.»
«Ich bin sehr komisch.»
«Alle sind immer sehr komisch.»
«Ich bin komischer.»
«Du wirkst nicht so.»
«Wie wirke ich denn?»
«So, als wärest du müde und hättest schon viel von diesem Wasser getrunken.»
«Wie heißt du?»
«Johannes.»
«Das kommt mir irgendwie bekannt vor.»
«Das liegt daran, dass ich es dir gerade schon einmal gesagt habe.»
«Ich vergesse ziemlich viel in der letzten Zeit.»
«Du solltest mehr Wasser trinken.»
«Ich bin so müde.»
«Warum gehen wir dann nicht zu dir und legen uns in dein Bett?»
«Weil ich komisch bin.»
«Du wirkst nicht komisch.»
«Ich bin sehr komisch.»
«Bestimmt nicht mehr als ich.»
«Ich werde morgen in eine Klinik gehen. So komisch bin ich.»
«Eine Klinik? Was fehlt dir denn?»
«Verstand. Schlaf. Am meisten Verstand.»
«Du gehst in eine Klinik, um Verstand zu bekommen?»
«Ja, irgendwie schon.»
«In so eine Klinik möchte ich auch.»
Die Erinnerungen der letzten Nacht laufen wie lachende Kinder viel zu laut schreiend und polternd durch meinen schmerzenden Kopf und beweisen, jede für sich, dass es wahr ist, dass es passiert ist, dass es schon wieder passiert ist und diese Situation kein Produkt eines schönen Abends war, sondern der gegärte Abfall aus Wein und Geschichten und Idiotie.
Johannes also. Der Wodka also. Die Langeweile also. Locken und Nähe oder der klägliche Versuch derselben also. Johannes. Ich versuche, an seinem Kopf vorbei die Uhrzeit zu erkennen. Auf dem kleinen Nachttisch zeigt der Radiowecker 8:05 Uhr. Es ist Zeit. Es ist nur eine verdammte Uhrzeit. Zeit, das Gepäck im Flur zu nehmen und den Müll zu verlassen. Endlich diesen Müll zu verlassen.
Leise stehe ich auf und schleiche auf Zehenspitzen und über Berge von Kleidung und Zeitungen steigend aus dem Zimmer. Der Kopf hämmert und schlägt die Sekunden im Takt. Das Licht über dem Spiegel lässt meine Pupillen für einen Moment winzig klein werden, bevor sie mich wieder aus roten Augen fixieren und sehen können, dass ich nackt bin, dass die Schminke längst verlaufen ist und in grauen Schatten unter meinen Augen hängend von dieser Nacht erzählt, wie von etwas, das noch gar nicht vorbei ist.
Ich wasche das Gesicht und auch die Hände, wasche den Schmutz unter den Fingernägeln fort, wie einen Zeugen all der Dinge, in die ich mich festgegraben habe. Kein Abschiedsschmerz, kein trauriger Blick zurück, keine Geschichten mehr unter den Fingernägeln, die brennen und auch noch morgen von dieser Nacht berichten würden, auch, wenn die Botschaft niemand außer mir verstehen würde. Nachdem ich mich geschminkt habe, stecke ich alles in den kleinen Beutel, der schon halb gepackt auf der Ablage liegt, und schleppe ihn und mich aus dem Badezimmer.
Johannes liegt unverändert in meinem Bett, nur sein Schnarchen ist einem schweren Atmen gewichen. Ich hebe vorsichtig ein paar Kleidungsstücke auf und rieche daran. Die meisten Kleider sind schon in der Reisetasche, und ich entscheide mich für das Kleid, an dem noch der Geruch von Zigaretten und Schweiß und Johannes hängt. Ich betrachte Johannes’ schlafenden Körper, der sich in der Zwischenzeit in die Mitte des Bettes bewegt hat und dort liegt, als sei es sein Bett und mit einer ihm eigenen Selbstverständlichkeit, sich diesen Raum zu erobern, und in einer Gleichgültigkeit, als sei er schon immer hier gewesen.
Sein Gesicht sieht nicht friedlich aus. Es zuckt und bebt ein wenig, und eigentlich sieht es so aus, als bereite ihm der Schlaf Schmerzen, so zusammengekniffen sind seine Augen. Sein Mund ist geöffnet, und manchmal schmatzt er zwischen zwei Atemzügen, als äße er im Traum. Seine Anwesenheit in diesem Raum, in dieser Wohnung, an diesem Morgen widerspricht grundlegend all den Vorstellungen, die ich von den letzten Momenten auf dieser Müllhalde der Vernachlässigung gehabt habe. Sie widerspricht dem dringenden Wunsch, diese letzten Augenblicke hier allein zu verbringen, allein mit einem Abschied, der nur temporär, aber von so großer Bedeutung ist, dass ich ihn auf keinen Fall hätte teilen wollen.
Ich erinnere mich an seinen fragenden Blick, als er das Gepäck im Flur sah, und daran, wie ich «Klinik» murmelte und er für einen kurzen Moment die Lippen aufeinanderpresste. Ich erinnere mich daran, wie er mich schnell küsste, um die Stille zwischen uns vor dem Gepäck stehend nicht zu laut werden zu lassen. Ich erinnere mich an seine gierigen Hände, die den Worten allen Platz nahmen und so völlig ohne ein Zögern und ohne einen Zweifel meinen Körper ergriffen. Wie sie mich wegzogen aus dem Flur in das Schlafzimmer und wie schnell sie die Tür hinter uns schlossen.
Ich erinnere mich an diesen einen Gedanken, an diesen einen Satz, der sich in einer Endlosschleife in meinem Kopf wiederholte, einem hässlichen Mantra gleich, das ich wie besessen immer und immer wieder vor mich hin dachte: Morgen ist es endlich vorbei. Morgen ist es endlich vorbei. Morgen ist es endlich vorbei. Morgen ist es endlich vorbei.
Ich setze mich vorsichtig auf die Bettkante am Fußende und betrachte die Hinterlassenschaft einer Einzelhaft, die viele Monate gedauert hat. Die Wände haben sich beinahe unmerklich gelblich gefärbt, und es riecht nach mir, nach diesem stinkenden Wrack, das sich in seinen sechzehn Quadratmetern eine Höhle gebaut und sich selbst bewiesen hat, dass Einsamkeit auch als ein Zustand der völligen Ignoranz der äußeren Welt gewertet werden konnte; dass genau diese Ignoranz sogar die Einsamkeit zu einer erträglichen Alltäglichkeit werden lassen konnte.
Ich beobachte ihn eine ganze Weile, bis ich endlich beschließe, ihn zu wecken. Ich rüttle unsanft an seiner Schulter, bis er die Augen erschrocken aufreißt und mich irritiert ansieht. Er murmelt müde ein «Hallo» und richtet sich ein wenig im Bett auf, sodass er sich auf seinem Ellbogen abstützen kann.
«Ja, hallo», antworte ich ihm und stehe hektisch auf. «Ich muss los. Ich muss wirklich los jetzt», sage ich schnell und beginne, nervös an den Ärmeln meines Kleides zu zupfen.
Er sieht mich belustigt an und antwortet: «Wenn du meinst.»
Ich spüre den Graben zwischen uns, der sich zwischen Wachsein und Schlaf und wieder Wachsein aufgetan hat und der nur verdeckt war von einer dünnen Schicht aus täuschend echter Nähe und dem Wunsch, dass wir nicht zwei Fremde sind, die im Grunde keine Ahnung voneinander haben.
Aus einem versöhnlichen Bedürfnis nach einem Abschied, der nicht das fahle Gefühl von Gleichgültigkeit zurücklässt, heraus versuche ich, ihn zum Lächeln zu bringen. «Ich muss jetzt wirklich gehen. Mach einfach die Tür hinter dir zu, wenn du gehst. Und es wäre nett, wenn du meinen Computer nicht klauen würdest.»
Er sieht mich irritiert an, und ich verziehe mein Gesicht zu einem verzerrten Grinsen, das ein Lächeln imitieren soll, aber nur grotesk und wahnsinnig wirken muss.
Ich drehe mich um und sage: «Mach’s gut.»
Dann schließe ich vorsichtig die Tür zum Schlafzimmer, nehme meinen Mantel und die zwei Taschen, die im Flur stehen, und verlasse den Müll, diesen ganzen verfluchten Müll, ohne einen einzigen Blick zurückzuwerfen.
Zwei
In der U-Bahn sitzen graue Menschen mit grauen Gesichtern und grauen Jacken. Vor dem Fenster rauschen Stadtteile und Wohnungsausschnitte wie in einem Videoclip vorbei. Manchmal kann man in die Wohnungen der Menschen sehen, und einen winzigen Augenblick befindet man sich in ihren Wohnzimmern, sieht ihre Bücherregale, ihren Esstisch, ihre unaufgeräumte Küche oder ihr nicht gemachtes Bett. Die U-Bahn fährt große Teile der Strecke überirdisch und manchmal so nah an den Häusern vorbei, dass man bisweilen sogar sehen kann, was auf den Tischen liegt und welches Muster ihre Bettwäsche hat. Ich fahre an geräumigen Wohnungen vorbei und an beengten, an leeren und an solchen, in denen Menschen gerade frühstücken. Ich denke an meine Wohnung und wie gut es ist, dass niemand von einem U-Bahnfenster einfach in mein Schlafzimmer schauen kann.
Wenn ich in diese Fenster blicke, stelle ich mir das Leben vor, das ich einmal führen könnte, würde ich in einer dieser großen, alten Wohnungen leben. Ich stelle mir vor, wie ich morgens an einem großen Tisch gesunde Dinge frühstücke, zusammen mit meinen gesunden Kindern und meinem gesunden Mann, der danach zu seinem Job mit gesunden Arbeitszeiten fährt, und ich bringe die Kinder in den Kindergarten, erledige ein paar gesunde Einkäufe und setze mich danach in mein Arbeitszimmer, um dort ein paar Texte für eine große, renommierte Zeitung zu verfassen, die unfassbar gut bezahlt werden, mache mir gesunde Gedanken, nämlich keine, hole danach die Kinder ab, und wir essen ein gesundes Mittagessen, spielen Spiele, und abends kommt der Mann von der Arbeit, wir trinken Rotwein in gesunden Mengen, er sagt den Kindern Gute Nacht, weil er eine gesunde Work-Life-Balance pflegt und ihm so etwas wichtig ist, und danach haben wir schmutzigen Sex auf dem Wohnzimmerteppich, weil so ein bisschen Ausbrechen aus dem Alltag ja auch mal gesund ist. Alles wäre so verdammt gesund. Gesunde Menschen mit gesunden Köpfen und gesunden Gedanken. Wir wären so gesund vor Glück, so gesund und glücklich, so gesund ohne Grund, dass wir nie auch nur eine Minute darüber nachdenken würden, dass Mama mal in einer U-Bahn saß und sich das alles nur vorgestellt hat und dass Mama eigentlich eine kranke Irre ist, die die meiste Zeit nur kranke Scheiße im Kopf hatte, weil das alles so schön lange her ist, dass wir alle gar nicht daran denken müssten, außer Mama, die weiß, ganz tief drinnen, dass sie eigentlich ein kleiner Zombie ist, der sich nur ein Menschenkostüm angezogen hat und Kinder bekommen hat und jetzt endlich glücklich ist, in dieser riesigen Wohnung in einem hübschen Stadtteil mit hübscher Aussicht und hübschen Menschen.
Es ist der letzte Augenblick, in dem ich noch umkehren könnte. Es ist der letzte Augenblick, der die Möglichkeit zur Flucht noch bereithält, der mir die Wahl zwischen Flucht oder Bleiben lässt. Es ist der letzte Moment einer Autonomie, die ich mit dem Schließen der Türen abgeben werde, die ich verlieren werde, nach der ich lauthals schreien werde, wenn ich sie erst einmal so bereitwillig verschenkt habe.
Ich könnte jetzt einfach nach Hause in eine hoffentlich wieder leere Wohnung fahren, könnte die Weinflaschen wegbringen, mal wieder lüften, mal wieder aufräumen, mal wieder Rechnungen bezahlen, mal wieder ans Telefon gehen, mal wieder duschen, mal wieder Sport machen, mal wieder arbeiten, mal wieder aufhören, so verdammt durchzudrehen. Ich könnte jetzt einfach nach Hause fahren und es selbst hinkriegen. Ich könnte mich einfach zusammenreißen, mich selbst nicht so ernst nehmen, nicht immer so schrecklich verzweifelt sein, nicht immer gleich alles so dramatisieren, ich könnte ein paar Tabletten nehmen, ich könnte mal wieder mehr lesen und den Fernseher, den Fernseher wollte ich ja auch endlich mal entsorgen, ich könnte Freunde anrufen, die bestimmt schon gar nicht mehr glauben, dass ich noch lebe, ich könnte aufhören, Musik von Selbstmördern zu hören, ich könnte aufhören, Bücher von Selbstmördern zu lesen, ich könnte aufhören, mir Reportagen über Selbstmord anzusehen, ich könnte aufhören mit dem Schnaps und mit dem Rauchen, und ich könnte mich einfach mal ein bisschen am eigenen Schopf aus dem Dreck ziehen, die Lungen mit viel mehr richtiger Luft und mit viel weniger heißer Luft und mit viel weniger kaltem Rauch füllen, ich könnte die Vorhänge aufziehen und Rohkostsalate essen und meditieren, zweimal täglich, und etwas gegen die Angst nehmen und für das Vergessen und für das Ertragen und gegen das Nicht-aushalten-Können, und ich könnte weinen, bis nichts mehr übrig ist von dem ganzen Dreck, ich könnte mir die Augen aus dem Kopf weinen, bis ich wieder richtig sehen kann, ich könnte mir die schmutzigen Gedanken mit den ganzen Tränen einfach abwaschen, und dann könnte ich mir weiße Westen anziehen und mal wieder tanzen gehen, und ich könnte spazieren gehen und Kalorien zählen und abnehmen, und ich könnte glücklich werden und mich verlieben und alles alleine schaffen, und ich könnte, wenn ich wollte, ich könnte das alles einfach machen, ich könnte, wenn ich müsste, wenn ich ginge, dann würde ich, ich würde, ich würde …
Ich würde nach Hause gehen und mich betrinken. Ich würde überhaupt nichts machen. Ich würde ein paar Tabletten nehmen und hoffen, dass ich vergesse, dass ich ich bin, dass das mein Körper, mein Leben, dass diese ganze klägliche Scheiße mein Verdienst ist und dass sich daran niemals etwas ändern wird. Ich atme aus, und ich atme ein, und ich lasse die Tür hinter mir ins Schloss fallen und lasse mich fallen, lasse mich fallen in diese Möglichkeit, in diesen letzten ersten Tag, in dieses Boot, in dem ich nun sitze und das auf einem Ozean voll Angst und Irrsinn und Scheiße und stinkendem Dreck schwimmt, dieses Boot, das Klinik heißt und dessen Insasse ich gleich bin.
Drei
Das Gebäude ist ein grauer Block aus Beton, Stein und Stahl. Er liegt am Rande des Krankenhausgeländes, das nicht viel mehr als fünf solcher Blöcke, die kreisförmig errichtet wurden, umfasst. Jeder dieser fünfstöckigen Krankenkästen beinhaltet zwei bis drei Fachbereiche, nur der meinige ist einzig und allein Menschen vorbehalten, die ihren Kopf nicht mehr zu gebrauchen wissen, die den Weg nur noch dorthin, aber zu keinem anderen Punkt mehr finden können, der sich außerhalb des Wunsches befindet, «das alles» möge endlich und schnell zu Ende sein.
In dem Block wohnen Selbstmörder und Menschen, die das Waschen ihrer Hände für etwas so Essentielles halten, dass ihnen irgendwann keine Zeit mehr für etwas anderes geblieben ist. In dem Block wohnen Menschen, die manchmal leise schreien und weinen und sich winden und nicht mehr weiterwissen und die sich grämen, so sehr grämen, dass ihnen schon ein Lächeln als etwas erscheint, das weit außerhalb ihrer Vorstellungskraft liegt. In diesem Block leben Geister und Dämonen, zwischen den Stühlen und den Betten, dort wohnen die Trauer und die giftige Galle, dort wohnt mehr Menschenmüll, als ich in den Bars in den langen Nächten finden konnte.
Und trotzdem wohnt dort auch dieser Wille, dieses unbedingte Streben nach irgendetwas, das hilft, und schlussendlich sogar eine – wenn auch abstrakte und über alle Maßen individuelle – Vorstellung davon, dass alles, irgendwann, irgendwie und sowieso wieder gut werden kann, dass die Verstrickungen nur Knoten einiger Entscheidungen waren, die durch neue, durch gesündere wieder zu entwirren sein müssen. Dort wohnt das Leben, das nicht am Ende, sondern am Anfang steht, das Leben, das sich zwar in Tränen ersaufen will, das sich in Klagen ergehen und in Jammern und Schaudern zerreißen will, das aber da ist, so sehr da ist, dass es wehtut. Kurz: In diesem Block fünf, auf den sich mein schwerfälliger Körper zubewegt, wohnt genau das Leben, das es überall gibt, das auf den Straßen liegt und in den Cafés sitzt, das mittendrin, das immer da, das nie verschwunden war. Es ist kein fremdes Leben, es ist nur das obsessive Trauern einiger Menschen, die kein bisschen anders sind als all die anderen Menschen, als du, als ich, deren einzige, winzige Andersartigkeit nur darin besteht, dass sie eine Krankheit, einen Makel, einige Anlagen besitzen, die dazu geführt haben, dass sie ein paar Wochen hier und ein paar Jahre bei einem Therapeuten verbringen müssen.
Nachdem ich mich – wie mit der Verwaltungssekretärin telefonisch verabredet – pünktlich zur genannten Zeit mit Gepäck im Aufnahmebüro eingefunden habe, wird mir zunächst ein Platz angeboten, und ich werde aufgefordert, den Einweisungsschein und die Versichertenkarte abzugeben. Die hektische junge Frau, die sich um meine Papiere kümmert, ist nur unwesentlich älter als ich und trägt ein nervöses Zucken im Gesicht, das sie versucht zu verbergen, indem sie den Blick starr auf ihren Computer gerichtet hält und es vermeidet, mich anzusehen.
Nach einer Weile schiebt sie den Packen Papier, der zuvor in einzelnen Blättern schier endlos langsam aus dem Drucker gefallen kam, als müsste sich dieser Drucker nach all den Jahren jedes einzelne dieser Formulare mühsam herauspressen, diesen Packen jedenfalls schiebt sie über den Tisch und legt einen Kugelschreiber und einen auffordernden Blick obendrauf. Ich sehe sie verständnislos an, das Zucken ihres rechten Auges, die zitternden Mundwinkel, und warte auf Instruktionen.
«Lesen», sagt sie. Und «unterschreiben» und «bei Fragen einfach fragen». Ich lese viele Imperative, viele Sätze, die immer mit «Ich versichere, dass» beginnen und immer mit Eventualitäten aufhören. Ich versichere, dass ich die Kosten selbst übernehme, falls meine Krankenkasse sie nicht zahlt oder ich gar nicht erst versichert bin.
Ich lese und unterschreibe, versichere und schiebe die Papiere zurück. Sie nickt, reißt an den Blättern und reicht mir die Durchschläge. Anschließend schickt sie mich in die Halle zurück, in der ich warten soll, bis ich abgeholt werde.
Ich setze mich auf einen der vielen Stühle im Wartebereich und sehe mich um. An der Wand stehen ein Kaffeeautomat und ein Wasserspender, daneben ein Mülleimer, in dem sich leere Papier- und Plastikbecher stapeln. Auf einem kleinen Tisch in der Mitte liegen alte Zeitschriften, deren jüngste Ausgabe vom Januar dieses Jahres ist. Die Seiten sind zerknickt und befleckt, einige herausgerissen, andere bloß eingerissen, die Rätsel gelöst, der Psychotest ausgefüllt.
Auch ich hatte mich einem Psychotest unterzogen, hatte vor einer Woche alle Fragen beantwortet in einem Telefonat mit Kropka, einem alternden Professor, dessen Telefonnummer ich von meinem Therapeuten erhalten hatte, der sich nicht in der Lage sah, mich in meinem jetzigen Zustand weiterzubehandeln. Zu schlecht ginge es mir, sagte er, zu heftig seien meine Ausbrüche, zu instabil sei meine Stimmung. Widerwillig hatte ich schließlich zugestimmt und Kropka angerufen.
«Ja, hallo, also es geht um … es geht um einen Platz bei Ihnen, weil … es mir nicht so gut geht. Und ich vielleicht … Hilfe bräuchte.»
Dieses Gespräch entwickelte sich schnell zu einer einzigen Tortur aus Stottern, Relativieren der offensichtlichen Tatsachen und einem zunehmenden Schmerz in meiner linken Schläfe. Ich rieb unablässig mit der einen Hand über meine Strumpfhose, versuchte, den Telefonhörer mit der anderen zu halten und dabei zu rauchen, was mir schwerlich gelang, und Professor Dr. med. Robert Kropka, leitender Oberarzt und stellvertretender Direktor der Klinik für Psychiatrie in H., zu erklären, was mein Anliegen war.
Das Gespräch dauerte genau sieben Minuten und zweiunddreißig Sekunden, in denen Kropka mich müde fragte, was genau denn nun der Grund meines Anrufes wäre, warum gerade ich denn nun Hilfe benötigen würde, warum gerade er mir denn genau bei diesen Problemen helfen könne, warum ich gerade ausgerechnet diese Klinik ausgewählt hätte und ob mir bewusst sei, um was für eine Art der Klinik, Behandlung und Behandlungsmethode es sich denn hier handeln würde. Seine Fragen stellte er knapp, routiniert, ohne eine Spur Freundlichkeit erkennen zu lassen, und die Tonalität ließ darauf schließen, dass das Stellen dieses Katalogs an Fragen ihn über die Jahrzehnte dermaßen zu langweilen begonnen hatte, dass ihm selbst simple Höflichkeitsformen darin verloren gegangen waren.
Ich würgte Antworten und Daten hervor, ich erklärte mit brüchiger Stimme und um Kürze bemüht, was in den letzten Monaten geschehen war, ich versuchte, aus den fragmentarischen Trümmern in meinem Kopf Sätze zu bauen, die für einen Außenstehenden verständlich sein konnten, ich kämpfte gegen die erstaunliche Arbeit der Spiegelneuronen an, die die Müdigkeit des Professors auf wunderliche Weise auf mich übertrugen und meine Gedankengänge um ein Vielfaches zu verlangsamen schienen, ich quälte meinen schmerzenden Kopf zu jenen Punkten zurück, an denen die Erinnerungen lagen, die den Grund meines Anrufes plausibel machten.
Nachdem ich alle Fragen halbwegs stotternd beantwortet hatte und langsam begann, mich zu fragen, ob ich mich in irgendeiner Weise rechtfertigen musste, ja, ob ich vielleicht etwas Falsches gesagt oder getan hatte, ob es vielleicht sogar Unrecht war, diesen Mann zu stören und ihn um einen Termin zu bitten, nannte er mir Zeit und Datum, wünschte mir einen guten Tag und legte auf.
Drei Tage später betrat ich zum ersten Mal die Klinik. Kropkas Büro lag im Erdgeschoss gleich neben den beiden Büros der Anmeldung.
Ich klopfte. Ich wartete. Es passierte nichts. Ich klopfte noch einmal, als von innen mit einem heftigen Ruck die Tür aufgerissen wurde und sich vor mir ein kleiner Mann aufbaute, der mir seine winzige Hand entgegenstreckte und mit einer dunklen, gelangweilten Stimme sagte:
«Guten Tag, Sie müssen Frau Schaumann sein. Bitte.» Mit einer Armbewegung signalisierte er mir, den Raum zu betreten, und schloss die Tür hinter mir.
Das Büro des Professors war beinahe leer. Einzig ein Schreibtisch in der Mitte des Raumes, drei dazugehörige Stühle und ein Bücherregal befanden sich in dem Zimmer. Kropka setzte sich an den Tisch, bat mich, mich ebenfalls zu setzen, und sah mich an. Wir schwiegen. Er trug ein hellblaues Hemd, darüber einen blauen Pullover mit V-Ausschnitt und eine schlichte, blaue Krawatte. Sein Haar war grau und spärlich und sein Gesicht blass und alt. Ein alter, kleiner, grauer Mann, der mich mit seinen winzigen Augen fixierte.
Endlich durchbrach er die Stille. «Nun, was führt Sie hierher? Sie sprachen am Telefon eine Diagnose an. Dürfte ich erfahren, um welche Diagnose es sich hier handelt?»
«Ich habe Probleme. Richtige Probleme. Die Art Probleme, bei denen man sich besser behandeln lässt. Glaube ich.»
«So, Sie glauben?»
«Ja, also ich weiß es. Das hat jemand gesagt. Ärzte. Ärzte haben das gesagt. Mehrere Ärzte. Und Therapeuten. Ich war bei mehreren Ärzten und Therapeuten und in mehreren Kliniken. Deshalb. Und wegen anderer Sachen. Aber hauptsächlich deshalb.»
«Verstehe. Und wie äußern sich diese Probleme?»
Nun, normalerweise betrinke ich mich, wenn es finanziell möglich ist, täglich und für gewöhnlich ab mittags. Außerdem versuche ich, wenig zu essen, damit man auch sieht, wie verdammt schlecht es mir geht, und außerdem bleibt dann mehr Geld für den Schnaps und die Zigaretten. Bevor Sie fragen: Ich rauche ungefähr zwei Schachteln täglich. Manchmal auch nur eine, das liegt dann am Husten und an den Halsschmerzen, die kriegt man, wenn man diese billigen Dinger vom Discounter raucht. In der Regel schalte ich als Erstes meinen Computer an, wenn ich aufwache. Das ist nicht schwierig, denn der liegt noch neben dem Bett, wo ich ihn in der Nacht liegen gelassen habe, wenn ich mir Pornos und anderen Dreck angesehen habe, um mich nicht so alleine und so verdammt ausgetrocknet zu fühlen. Wissen Sie, für ein Mädchen in meinem Alter ist das schon eine ganz schön schwierige Sache, immer so alleine zu sein, da muss man sich ab und an den Finger reinstecken, sonst bekommt man das Gefühl, dass da gar nichts mehr passiert, und leider ist das aber so, dass man