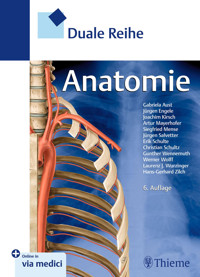
Duale Reihe Anatomie E-Book
89,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Duale Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Mischung macht's - dual genial Anatomie lernen
Anatomie in der beliebten Dualen Reihe, das heißt: Lehrbuch und Kurzlehrbuch in einem. Das Besondere: die anatomischen Fakten werden funktional eingeordnet. So lernst du besonders effizient. Viele praxis- und klinikorientierte Bezüge, exzellente PROMETHEUS-Grafiken und zahlreiche Helferlein sorgen dafür, dass das Lernen sogar Spaß macht!
Enthalten ist auch ein virtueller Präparierkurs. Dieses Lernprogramm beinhaltet zahlreiche Fotos von Original-Präparaten. Sie ermöglichen interaktives Lernen und dienen zudem der Vor- und Nachbereitung der praktischen Arbeit im Präparierkurs.
Gut zu wissen: Buchinhalt und Präpkurs-Lernprogramm stehen dir ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform eRef und in via medici zur Verfügung (Zugangscode im Buch). Mit der kostenlosen eRef App hast du viele Inhalte auch offline immer griffbereit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2996
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Duale Reihe Anatomie
Reihe herausgegeben von
Alexander Bob, Konstantin Bob
Herausgegeben von
Georg Thieme Verlag KG
Gabriela Aust, Werner Wolff, Laurenz J. Wurzinger, Hans-Gerhard Zilch, Jürgen Engele, Joachim Kirsch, Artur Mayerhofer, Siegfried Mense, Jürgen Salvetter, Erik Schulte, Christian Schultz, Gunther Wennemuth
6., vollständig überarbeitete Auflage
1795 Abbildungen
Vorwort
„Anatomie war eines der wichtigsten Fächer in meinem ganzen Studium“. Diese Ansicht äußerten junge Ärztinnen und Ärzte im Rückblick auf ihr Studium fast einstimmig in einer im Deutschen Ärzteblatt schon vor einigen Jahren veröffentlichten Umfrage. Das Fach Anatomie rangiert damit gleichauf mit großen klinischen Fächern wie der Inneren Medizin, Chirurgie oder Pharmakologie. Gleichzeitig ist das Fach Anatomie ein zentrales Bindeglied zu den klinischen Fächern und zur späteren ärztlichen Tätigkeit. Solide anatomische Kenntnisse sind Voraussetzung für jede körperliche Untersuchung, für das Verständnis bildgebender Verfahren und selbstverständlich für alle operativen Fächer. Anatomie ist schlichtweg die Grundlage des Arztberufes.
„Anatomie ist ein schwieriges Paukfach“. Das ist eines der am häufigsten geäußerten Missverständnisse. Zweifellos ist die Anatomie faktenreich. Das gilt jedoch für klinische Fächer in gleicher Weise. Die Anatomie hat aber auch eine besondere eigene Systematik. Deren Verständnis hilft, Ordnung in die zahlreichen Strukturen zu bringen, damit man „vor lauter Bäumen den Wald nicht übersieht“.
Genau hier setzt die Duale Reihe Anatomie an. Sie erklärt Funktionszusammenhänge, wo immer es nötig und möglich ist, und erfüllt anatomische Strukturen dadurch mit Leben. Zugleich schlägt sie die Brücke zur klinisch-ärztlichen Tätigkeit. „Klinik“-Kästen verbinden anatomisches Wissen direkt mit möglichen pathologischen Veränderungen. Ein „Klinik“-Kasten zum Thema Schädelbruch erläutert beispielsweise, wie Frakturlinien mit dem Bau des knöchernen Schädels zusammenhängen, und bei der Darstellung der Milz wird erklärt, warum dieses Organ heutzutage nicht mehr unbedingt entfernt werden muss, wenn es zum Beispiel nach einer stumpfen Bauchverletzung gerissen ist. Eine weitere Verbindung zur Klinik stellen die „Streckenpläne“ her. Anhand dieser besonderen Form von Fallbeispielen lässt sich Schritt für Schritt nachvollziehen, wie man von den Symptomen zur Diagnose und von dort zu einer erfolgreichen Therapie kommt. Anatomie wird auf diese Weise fast automatisch „klinisch“.
Auch für die 6. Auflage wurde der einheitliche Kapitelaufbau mit einer kurzen Funktionszusammenfassung anatomischer Strukturen am Anfang des Kapitels beibehalten. Lernhilfen wie „Merke“-Kästen sowie das Charakteristikum der Duale-Reihe-Lehrbücher, das integrierte Kurzlehrbuch am Seitenrand, haben sich für die rasche Orientierung und vor allem bei der effizienten Wiederholung zur Prüfungsvorbereitung sehr bewährt.
Die 6. Auflage enthält wieder einen virtuellen Präparierkurs. Dieses Lernprogramm steht online zur Verfügung und beinhaltet zahlreiche Fotos von Original-Präparaten. Sie ermöglichen interaktives Lernen und dienen zudem der Vor- und Nachbereitung der praktischen Arbeit im Präparierkurs.
Ein Anatomie-Lehrbuch lebt von Illustrationen. Die reichhaltige Bebilderung des Buches setzt diese Überzeugung mit plastischen Grafiken anatomischer Strukturen um. Zusätzlich werden anatomische Sachverhalte durch eindrucksvolle Darstellungen moderner bildgebender Verfahren ergänzt, wo es sinnvoll ist. Schematische Zeichnungen erklären in didaktisch eingängiger Weise funktionelle und topografische Zusammenhänge. Abbildungen aus dem klinischen Alltag machen darüber hinaus die Leserinnen und Leser mit dem vertraut, was im Laufe des Studiums und später bei der ärztlichen Tätigkeit erwartet wird.
Die Nomenklatur des Buches orientiert sich vorwiegend an der Terminologia anatomica von 1998, die durch die sog. „Fribourg-Terminologie“ 2023 ergänzt und aktualisiert wurde. Je nach Kontext ist die dort zu entnehmende lateinische oder die in der Klinik häufig verwendete eingedeutschte Schreibweise gewählt. Einige Begriffe werden in der anatomischen Terminologie offiziell nicht mehr verwendet, sind jedoch weiterhin in der Klinik nützlich und gebräuchlich. Diese Begriffe sind ebenfalls im Buch genannt.
Unser besonderer Dank gilt zuerst Herrn Karl Wesker und Herrn Markus Voll, deren qualitativ hochwertige Grafiken aus dem PROMETHEUS LernAtlas (Schünke, Schulte, Schumacher) sehr dazu beitragen, dass die in der Dualen Reihe Anatomie beschriebenen Inhalte so plastisch veranschaulicht werden können. Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen haben sie Anpassungen und Erweiterungen, die durch die Einbindung der Grafiken in ein Lehrbuch notwendig wurden, perfekt umgesetzt. Gedankt sei auch den Studierenden und den Fachkolleginnen und -kollegen für Anregungen zur Verbesserung des Lehrtextes und für Korrekturen. Kritische Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge sind weiterhin herzlich willkommen. Allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Georg Thieme Verlags danken wir für ihren Beitrag zur Verwirklichung des Buches, insbesondere Frau Hannah Fischer und Frau Sabine Bartl für ihre engagierte und kompetente redaktionelle Arbeit.
Wir alle hoffen, dass die Duale Reihe Anatomie weiterhin ein kompetenter Begleiter und zuverlässiger Ratgeber in der Anatomie und später auch in der Klinik ist, und dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass Sie als Leserinnen und Leser sagen: „Anatomie ist total spannend!“
„Alles ist schwer - bevor es leicht wird“ (Konfuzius)
Im Sommer 2024
Die Autorin und die Autoren
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Vorwort
Teil I Grundlagen anatomischer Strukturen und ihrer Darstellung
1 Allgemeine Grundlagen
1.1 Einleitung
1.2 Teilgebiete der Anatomie
1.2.1 Makroskopische Anatomie
1.2.2 Mikroskopische und molekulare Anatomie
1.2.3 Embryologie
1.3 Anatomische Fachsprache
1.4 Gliederung des Körpers
1.5 Oberflächenanatomie
1.6 Achsen, Ebenen, Richtungs- und Lagebezeichnungen
1.6.1 Achsen
1.6.2 Ebenen
1.6.3 Richtungs- und Lagebezeichnungen
1.6.4 Bewegungsrichtungen
1.7 Äußere Gestalt des Körpers
1.7.1 Körpermaße
1.7.2 Proportionen
1.7.3 Akzeleration
1.7.4 Körperbau
1.7.5 Norm und Variabilität
1.7.6 Einfluss von Alter und Geschlecht
1.8 Präparierkurs
2 Zytologie und Histologie – Grundlagen
2.1 Die Zelle
2.1.1 Zellkern (Nucleus)
2.1.2 Zytoplasma
2.1.3 Oberflächendifferenzierungen
2.1.4 Zellkontakte
2.2 Das Gewebe
2.2.1 Epithelgewebe
2.2.2 Binde- und Fettgewebe
2.2.3 Knorpelgewebe
2.2.4 Knochengewebe
2.2.5 Muskelgewebe
2.2.6 Nervengewebe
2.3 Histologische Techniken
2.3.1 Routinetechniken
2.3.2 Färbetechniken
3 Embryologie – Grundlagen
3.1 Einleitung
3.2 Konzeption bis Implantation
3.2.1 Konzeption (Befruchtung)
3.2.2 Entwicklung zur Morula
3.2.3 Blastozysten-Stadium
3.2.4 Implantation
3.3 Bildung der Keimscheiben und extraembryonaler Hohlräume
3.3.1 Zweite Entwicklungswoche
3.3.2 Dritte Entwicklungswoche
3.4 Differenzierung der Keimblätter
3.4.1 Neurulation und Somitenbildung (18. Tag)
3.5 Entstehung der Körperhöhlen
3.5.1 Trennung von Thorax- und Abdominalraum durch Entwicklung des Zwerchfells
3.5.2 Entstehung von Perikard- und Pleurahöhle
3.5.3 Entstehung der Abdominalhöhle
3.6 Plazenta, Nabelschnur und Eihäute
3.6.1 Dezidua und Chorion
3.6.2 Plazenta
3.6.3 Nabelschnur (Funiculus umbilicalis)
3.6.4 Eihäute
4 Bildgebung – Grundlagen
4.1 Einleitung
4.2 Standardverfahren
4.2.1 Röntgendiagnostik
4.2.2 Schnittbildverfahren
4.3 Kontrastmittel
4.4 Darstellung der Blutgefäße
4.4.1 Angiografie
4.4.2 CT- und MRT-Angiografie
4.4.3 Doppler- und Duplexsonografie
Teil II Einführung in funktionelle Systeme
5 Herz-Kreislauf-System – Grundlagen
5.1 Einführung
5.2 Funktion und Bauprinzip
5.2.1 Funktion des Herz-Kreislauf-Systems
5.2.2 Bauprinzip des Herz-Kreislauf-Systems
5.3 Funktionelle Gliederung des Blutkreislaufs
5.3.1 Kleiner und großer Kreislauf
5.3.2 Hoch- und Niederdrucksystem
5.3.3 Vasa privata und Vasa publica
5.3.4 Endstrombahn
5.4 Unterschiede zwischen prä- und postnatalem Kreislauf
5.4.1 Vorgeburtlicher Kreislauf
5.4.2 Kreislaufumstellung bei der Geburt
5.5 Feinbau und Funktion der Blutgefäße
5.5.1 Allgemeiner Wandbau
5.5.2 Bau unterschiedlicher Abschnitte des Gefäßsystems
5.5.3 Vasomotorik
5.6 Lymphgefäßsystem
5.6.1 Funktion
5.6.2 Organisation
6 Blut und lymphatische Organe – Grundlagen
6.1 Einleitung
6.2 Blut
6.2.1 Blutbildung (Hämatopoese)
6.2.2 Bestandteile des Blutes
6.3 Lymphatische Organe
6.3.1 Primäre lymphatische Organe
6.3.2 Sekundäre lymphatische Organe
7 Nervensystem – Grundlagen
7.1 Einführung
7.2 Funktion und Gliederung
7.2.1 Funktion
7.2.2 Gliederung
7.3 Funktionelle und physiologische Grundlagen
7.3.1 Umformung des Reizes in neuronale Signale
7.3.2 Axonaler Transport
7.4 Morphologische Einteilung des Nervensystems
7.4.1 Zentrales Nervensystem (ZNS)
7.4.2 Peripheres Nervensystem (PNS)
7.5 Funktionelle Einteilung des Nervensystems
7.5.1 Somatisches Nervensystem
7.5.2 Autonomes Nervensystem
8 Bewegungssystem – Grundlagen
8.1 Einführung
8.2 Knochen
8.2.1 Funktion
8.2.2 Aufbau und Knochentypen
8.2.3 Funktioneller Aufbau der Knochen
8.2.4 Knochenmark (Medulla ossium)
8.2.5 Blutversorgung des Knochens
8.2.6 Periost und Endost
8.3 Knochenverbindungen (Juncturae)
8.3.1 Synarthrosen
8.3.2 Diarthrosen
8.4 Skelettmuskulatur
8.4.1 Aufbau von Muskeln
8.4.2 Muskeltypen
8.4.3 Sehnen
8.4.4 Hilfseinrichtungen von Muskeln und Sehnen
8.4.5 Muskelmechanik
Teil III Rumpfwand
9 Rücken
9.1 Wirbelsäule (WS)
9.1.1 Funktionelle Aspekte und Bauprinzip
9.1.2 Wirbel (Vertebrae)
9.1.3 Zwischenwirbelscheiben (Disci intervertebrales)
9.1.4 Bänder der Wirbelsäule
9.1.5 Kopfgelenke
9.1.6 Mechanik der Wirbelsäule
9.2 Rückenmuskulatur
9.2.1 Funktionelle Bedeutung
9.2.2 Einteilung und Aufbau der Rückenmuskulatur
9.3 Gefäßversorgung und Innervation des Rückens
9.3.1 Gefäßversorgung
9.3.2 Innervation
9.4 Topografische Anatomie des Rückens
9.5 Entwicklung von Wirbelsäule und Rückenmuskeln
9.5.1 Normale Entwicklung
9.5.2 Varianten und Fehlbildungen
10 Brustwand und Brustkorb (Thorax)
10.1 Funktionelle Aspekte und Bauprinzip
10.2 Knöcherner Thorax
10.2.1 Costae (Rippen)
10.2.2 Sternum (Brustbein)
10.3 Gelenke und Bandapparat des Thorax
10.3.1 Kostovertebralgelenke (Articulationes costovertebrales)
10.3.2 Sternokostalgelenke (Articulationes sternocostales)
10.3.3 Mechanik der Thoraxgelenke (Atemmechanik)
10.4 Muskulatur des Thorax
10.4.1 Brustwandmuskulatur
10.4.2 Diaphragma (Zwerchfell)
10.5 Gefäßversorgung und Innervation der Thoraxwand
10.5.1 Gefäßversorgung
10.5.2 Innervation
10.6 Topografische Anatomie der Thoraxwand
10.7 Entwicklung der Thoraxwand
10.7.1 Normale Entwicklung
10.7.2 Varianten und Fehlbildungen
11 Bauchwand
11.1 Funktionelle Aspekte und Bauprinzip
11.2 Muskeln und Bindegewebsstrukturen der Bauchwand
11.2.1 Bauchmuskulatur
11.2.2 Bindegewebsstrukturen
11.3 Leistenkanal (Canalis inguinalis)
11.3.1 Verlauf und Begrenzungen des Leistenkanals
11.3.2 Öffnungen des Leistenkanals und Innenrelief der Bauchwand
11.4 Gefäßversorgung und Innervation der Bauchwand
11.4.1 Gefäßversorgung der Bauchwand
11.4.2 Innervation der Bauchwand
11.5 Topografische Anatomie der Bauchwand
11.6 Entwicklung von Bauchwand und Leistenkanal
11.6.1 Entwicklung der Bauchmuskeln
11.6.2 Entwicklung des Canalis inguinalis
12 Beckenwände, Beckenboden und Dammregion
12.1 Becken (Pelvis)
12.1.1 Funktionelle Aspekte und Bauprinzip
12.1.2 Beckenknochen
12.1.3 Form des Beckens
12.1.4 Gelenke und Bandapparat des Beckens
12.1.5 Mechanik des Beckens
12.2 Beckenboden
12.2.1 Funktionelle Aspekte und Bauprinzip
12.2.2 Diaphragma pelvis
12.2.3 „Diaphragma urogenitale“
12.2.4 Sphinkter- und Schwellkörpermuskulatur
12.3 Dammregion (Regio perinealis)
12.3.1 Gliederung der Dammregion
12.3.2 Damm (Perineum)
12.4 Gefäßversorgung und Innervation
12.4.1 Gefäßversorgung
12.4.2 Innervation
Teil IV Untere Extremität
13 Hüfte, Oberschenkel und Knie
13.1 Funktionelle Aspekte und Bauprinzip
13.2 Hüftgelenk (Articulatio coxae)
13.2.1 Gelenktyp und Gelenkkörper
13.2.2 Gelenkkapsel und Bandapparat
13.2.3 Mechanik des Hüftgelenks
13.2.4 Hüftmuskulatur
13.2.5 Entwicklung von Hüfte und Oberschenkel
13.3 Kniegelenk (Articulatio genus)
13.3.1 Gelenktyp und Gelenkkörper
13.3.2 Bandapparat und Gelenkkapsel des Kniegelenks
13.3.3 Gelenkkapsel und Gelenkhöhle
13.3.4 Mechanik des Kniegelenks
13.3.5 Muskulatur des Kniegelenks
13.4 Gefäßversorgung und Innervation von Hüfte, Oberschenkel und Knie
13.4.1 Gefäßversorgung
13.4.2 Innervation
13.5 Topografische Anatomie von Hüfte, Oberschenkel und Knie
13.5.1 Regionen
13.5.2 Orientierungspunkte und -linien
13.5.3 Kniekehle (Fossa poplitea)
13.5.4 Achsen der unteren Extremität
14 Unterschenkel und Fuß
14.1 Überblick
14.2 Funktionelle Aspekte und Bauprinzip
14.3 Knochen von Unterschenkel und Fuß
14.3.1 Unterschenkelknochen (Ossa cruris) und ihre Verbindungen
14.3.2 Fußknochen (Ossa pedis)
14.4 Gelenke von Unterschenkel und Fuß
14.4.1 Sprunggelenke
14.4.2 Weitere Gelenke des Fußes
14.5 Muskulatur von Unterschenkel und Fuß
14.5.1 Muskulatur des Unterschenkels
14.5.2 Kurze Fußmuskeln
14.6 Funktionelle Anatomie des Fußes
14.6.1 Lastübertragung
14.6.2 Aufbau und Sicherung der Fußgewölbe
14.7 Gefäßversorgung und Innervation von Unterschenkel und Fuß
14.7.1 Gefäßversorgung von Unterschenkel und Fuß
14.7.2 Innervation von Unterschenkel und Fuß
14.8 Topografische Anatomie von Unterschenkel und Fuß
Teil V Obere Extremität
15 Schulter, Oberarm und Ellenbogen
15.1 Einführung
15.2 Schulter
15.2.1 Funktionelle Aspekte und Bauprinzip der Schulter
15.2.2 Schultergürtel
15.2.3 Schultergelenk (Articulatio glenohumeralis/humeri)
15.3 Ellenbogengelenk (Articulatio cubiti)
15.3.1 Gelenktyp und Gelenkkörper
15.3.2 Gelenkkapsel und Bandapparat
15.3.3 Gelenkmechanik
15.3.4 Muskulatur des Ellenbogengelenks
15.4 Gefäßversorgung und Innervation von Schulter, Oberarm und Ellenbogen
15.4.1 Gefäßversorgung von Schulter, Oberarm und Ellenbogen
15.4.2 Innervation von Schulter, Oberarm und Ellenbogen
15.5 Topografische Anatomie von Schulter, Oberarm und Ellenbogen
15.5.1 Regionen
15.5.2 Orientierungspunkte und -linien
15.5.3 Achsen der oberen Extremität
16 Unterarm und Hand
16.1 Einführung
16.2 Funktionelle Aspekte und Bauprinzip
16.3 Knochen von Unterarm und Hand
16.3.1 Knochen des Unterarms und ihre Verbindungen
16.3.2 Handskelett
16.4 Gelenke der Hand
16.4.1 Proximales und distales Handgelenk
16.4.2 Weitere Gelenke der Hand
16.5 Muskulatur von Unterarm und Hand
16.5.1 Muskulatur des Unterarms
16.5.2 Kurze (intrinsische) Handmuskeln
16.5.3 Bindegewebige Hilfsstrukturen der Muskulatur
16.6 Gefäßversorgung und Innervation von Unterarm und Hand
16.6.1 Gefäßversorgung
16.6.2 Innervation
16.7 Topografische Anatomie von Unterarm und Hand
16.7.1 Regionen und Konturen
16.7.2 Orientierungspunkte und -linien
16.8 Entwicklung von Unterarm und Hand
Teil VI Grundlagen zum Aufbau der Körperhöhlen und ihrer Organe
17 Der Aufbau der Körperhöhlen
17.1 Definition einer Körperhöhle
17.2 Einteilung
17.3 Seröse Höhlen
17.3.1 Funktion seröser Höhlen
17.3.2 Aufbau seröser Höhlen
17.3.3 Gefäßversorgung und Innervation seröser Häute
17.3.4 Entwicklung seröser Höhlen
18 Grundlagen zum Aufbau innerer Organe
18.1 Einführung
18.2 Allgemeiner Aufbau innerer Organe
18.3 Charakteristika von Hohlorganen
18.3.1 Schleimhaut (Tunica mucosa, Mukosa)
18.3.2 Muskulatur der Hohlorgane
Teil VII Brusthöhle
19 Gliederung der Brusthöhle
19.1 Einführung
19.2 Funktionelle Aspekte
19.3 Einteilung
19.3.1 Mediastinum
19.3.2 Pleurahöhlen
20 Atmungsorgane und Pleura
20.1 Einführung
20.2 Luftröhre und Hauptbronchien
20.2.1 Funktion
20.2.2 Aufbau, Gefäßversorgung und Innervation
20.3 Lunge (Pulmo)
20.3.1 Funktion der Lunge
20.3.2 Form, Abschnitte und Lage der Lunge
20.3.3 Aufbau der Lunge
20.3.4 Gefäße und Innervation der Lunge
20.4 Pleura
20.4.1 Funktion von Pleura und Pleurahöhle
20.4.2 Abschnitte und Lage der Pleura
20.4.3 Aufbau der Pleura
20.4.4 Gefäßversorgung und Innervation
20.5 Atmung
20.5.1 Bedeutung von äußerer und innerer Atmung
20.5.2 Respiration
20.6 Topografische Anatomie von Atmungsorganen und Pleura
20.6.1 Ausdehnung von Pleura und Lunge
20.7 Darstellung von Lunge und Pleura mit bildgebenden Verfahren
20.8 Entwicklung der Atmungsorgane
21 Herz und Herzbeutel
21.1 Einführung
21.2 Herz (Cor)
21.2.1 Funktion des Herzens
21.2.2 Form, Abschnitte und Lage des Herzens
21.2.3 Organisation des Herzens
21.2.4 Wandbau des Herzens
21.2.5 Erregungsbildungs- und -leitungssystem des Herzens
21.2.6 Gefäßversorgung und Innervation des Herzens
21.2.7 Mechanische Herzaktion
21.2.8 Elektrische Herzaktion: Das Elektrokardiogramm (EKG)
21.3 Herzbeutel (Pericardium)
21.3.1 Funktion von Perikard und Perikardhöhle
21.3.2 Lage und Aufbau des Perikards
21.3.3 Gefäßversorgung und Innervation
21.4 Topografie von Herz und Herzbeutel
21.4.1 Projektion auf die Thoraxwand
21.5 Darstellung des Herzens mit bildgebenden Verfahren
21.5.1 Herzdarstellung im Röntgenthorax
21.5.2 Weitere bildgebende Verfahren zur Darstellung des Herzens
21.6 Entwicklung des Herzens
21.6.1 Bildung der Herzschleife
21.6.2 Entstehung der Herzbinnenräume
22 Leitungsbahnen und topografische Beziehungen im Mediastinum
22.1 Einführung
22.2 Gefäße im Mediastinum
22.2.1 Arterien im Mediastinum
22.2.2 Venen im Mediastinum
22.2.3 Lymphgefäße im Mediastinum
22.3 Nerven und Nervengeflechte im Mediastinum
22.3.1 Anteile des vegetativen Nervensystems
22.3.2 Anteile des somatischen Nervensystems
22.4 Beziehungen von Leitungsbahnen zu Organen im Mediastinum
22.4.1 Topografische Beziehungen zu Trachea und Hauptbronchien
22.4.2 Topografische Beziehungen zum Ösophagus
22.5 Topografische Orientierungspunkte zur Projektion
22.6 Entwicklung der großen Gefäße
22.6.1 Arterielle Gefäße – Differenzierung der Aortenbögen
22.6.2 Venöse Gefäße – Differenzierung des Kardinalvenensystems
Teil VIII Bauch- und Beckenraum – Gliederung
23 Peritoneal- und Lageverhältnisse der Organe im Bauch- und Beckenraum
23.1 Einführung
23.2 Gliederung des Bauch-Becken-Raums
23.3 Peritoneum und seine Beziehung zu Organen
23.3.1 Peritoneum (Bauchfell)
23.3.2 Lagebeziehung der Organe zum Peritoneum
23.4 Peritonealverhältnisse in der Cavitas peritonealis
23.4.1 Mesos intraperitonealer Organe
23.4.2 Recessus der Peritonealhöhle
23.4.3 Peritonealverhältnisse in der Cavitas peritonealis abdominis
23.4.4 Peritonealverhältnisse in der Cavitas peritonealis pelvis
23.5 Kleines Becken
23.5.1 Etagengliederung des kleinen Beckens
23.5.2 Spatium extraperitoneale pelvis
24 Entwicklung der Peritonealverhältnisse
24.1 Einführung
24.2 Entwicklung der Peritonealhöhle, des Darmrohrs und zugehöriger „Mesos“
24.3 Entwicklung des Oberbauchsitus
24.3.1 Magendrehung
24.3.2 Entwicklungen im Mesogastrium ventrale
24.3.3 Entwicklungen im Mesogastrium dorsale
24.3.4 Entwicklung der Bursa omentalis
24.4 Entwicklung des Unterbauchsitus
24.4.1 Bildung, Wachstum und Drehung der Nabelschleife
24.4.2 Verlagerung einzelner Kolonabschnitte nach retroperitoneal
Teil IX Verdauungssystem
25 Rumpfdarm – Ösophagus und Gastrointestinaltrakt
25.1 Funktion und Einteilung des Verdauungssystems
25.2 Allgemeiner Aufbau des Rumpfdarms
25.2.1 Wandschichten
25.2.2 Enterisches Nervensystem (Plexus entericus)
25.3 Speiseröhre (Ösophagus)
25.3.1 Funktion des Ösophagus
25.3.2 Abschnitte, Lage und Form des Ösophagus
25.3.3 Wandbau des Ösophagus
25.3.4 Gefäßversorgung und Innervation
25.3.5 Bedeutung der Ösophagusperistaltik für den Schluckakt
25.3.6 Entwicklung des Ösophagus
25.4 Magen (Gaster)
25.4.1 Funktion des Magens
25.4.2 Abschnitte, Form und Lage des Magens
25.4.3 Wandbau des Magens
25.4.4 Gefäßversorgung und Innervation
25.4.5 Chymusbildung
25.5 Dünndarm (Intestinum tenue)
25.5.1 Charakteristika des gesamten Dünndarms
25.5.2 Duodenum (Zwölffingerdarm)
25.5.3 Jejunum und Ileum
25.6 Dickdarm (Intestinum crassum)
25.6.1 Zäkum und Kolon
25.6.2 Rektum und Analkanal
25.7 Darstellung des Verdauungskanals mit bildgebenden Verfahren
25.7.1 Radiologische Verfahren ohne und mit Kontrastmittel
25.7.2 Sonografie
25.7.3 Endoskopie
26 Hepatobiliäres System und Pankreas
26.1 Einführung
26.2 Hepatobiliäres System
26.2.1 Leber (Hepar)
26.2.2 Gallenwege
26.2.3 Gallenblase (Vesica biliaris)
26.2.4 Entwicklung des hepatobiliären Systems
26.3 Bauchspeicheldrüse (Pankreas)
26.3.1 Funktion des Pankreas
26.3.2 Abschnitte, Form und Lage des Pankreas
26.3.3 Aufbau des Pankreas
26.3.4 Gefäßversorgung und Innervation des Pankreas
26.3.5 Entwicklung des Pankreas
26.4 Darstellung von hepatobiliärem System und Pankreas mit bildgebenden Verfahren
26.4.1 Sonografie
26.4.2 Schnittbildverfahren
26.4.3 Spezifische Verfahren zur Darstellung von Gallen- und Pankreasgängen
Teil X Urogenitalsystem und Nebenniere
27 Der Harnapparat: Niere und ableitende Harnwege
27.1 Einführung
27.2 Niere (Ren, Nephros)
27.2.1 Funktion der Niere
27.2.2 Form, Abschnitte und Lage der Niere
27.2.3 Aufbau und morphologische Gliederung der Niere
27.2.4 Feinbau und funktionelle Gliederung der Niere
27.2.5 Gefäße und Innervation der Niere
27.3 Ableitende Harnwege
27.3.1 Nierenbecken (Pelvis renalis)
27.3.2 Harnleiter (Ureter)
27.3.3 Harnblase (Vesica urinaria)
27.4 Darstellung der Harnwege mit bildgebenden Verfahren
27.4.1 Konventionelle radiologische Verfahren ohne und mit Kontrastmittel
27.4.2 Schnittbildverfahren und Sonografie
28 Nebenniere (Glandula suprarenalis)
28.1 Funktion der Nebenniere
28.2 Größe, Form und Lage der Nebenniere
28.3 Aufbau der Nebenniere
28.3.1 Nebennierenrinde
28.3.2 Nebennierenmark
28.4 Gefäßversorgung und Innervation der Nebenniere
28.4.1 Gefäßversorgung
28.4.2 Innervation
28.5 Entwicklung der Nebenniere
29 Weibliches Genitale
29.1 Übersicht
29.2 Innere weibliche Genitalorgane
29.2.1 Eierstock (Ovarium)
29.2.2 Eileiter (Tuba uterina), Salpinx
29.2.3 Gebärmutter (Uterus)
29.2.4 Scheide (Vagina)
29.3 Äußere weibliche Genitalorgane
29.3.1 Aufbau des äußeren weiblichen Genitales
29.3.2 Gefäßversorgung und Innervation des äußeren weiblichen Genitales
29.4 Urethra feminina (weibliche Harnröhre)
29.5 Zyklusbedingte Veränderungen – hormonelle Steuerung
29.5.1 Zyklische Reifung der Follikel
29.5.2 Zyklische Veränderungen an den Organen
29.6 Konzeption, Schwangerschaft und Geburt
29.6.1 Sexuelle Reaktion der Frau
29.6.2 Spermienwanderung im weiblichen Genitaltrakt
29.6.3 Schwangerschaft (Graviditas)
29.6.4 Geburt
29.6.5 Wochenbett (Puerperium)
29.7 Das weibliche Genitale in verschiedenen Lebensphasen
29.7.1 Postnatale Entwicklung und Kindheit
29.7.2 Pubertät
29.7.3 Phase der körperlichen Reife (Reproduktionsphase, Geschlechtsreife)
29.7.4 Klimakterium
29.7.5 Senium
30 Männliches Genitale
30.1 Übersicht
30.2 Innere männliche Genitalorgane
30.2.1 Hoden (Testis, Didymis)
30.2.2 Nebenhoden (Epididymis)
30.2.3 Samenleiter (Ductus deferens)
30.2.4 Akzessorische Geschlechtsdrüsen
30.3 Äußere männliche Genitalorgane
30.3.1 Penis (Glied)
30.3.2 Urethra masculina (männliche Harnröhre)
30.3.3 Skrotum (Hodensack)
30.4 Fertilität und sexuelle Reaktion des Mannes
30.4.1 Spermatogenese (Samenzellbildung)
30.4.2 Sexuelle Reaktion
30.4.3 Befruchtung
31 Entwicklung des Urogenitalsystems
31.1 Übersicht
31.2 Entwicklung des Harnapparats
31.2.1 Entwicklung der harnbereitenden Anteile – Nierenentwicklung
31.2.2 Entwicklung der harnableitenden Wege
31.3 Entwicklung des Genitales
31.3.1 Entwicklung des inneren Genitales
31.3.2 Entwicklung des äußeren Genitales
Teil XI Leitungsbahnen im Bauch- und Beckenraum
32 Leitungsbahnen im Bauchraum
32.1 Einführung
32.2 Gefäße im Bauchraum
32.2.1 Arterien des Bauchraums – Aorta abdominalis und ihre Äste
32.2.2 Venen des Bauchraums
32.2.3 Lymphgefäße und -knoten des Bauchraums
32.3 Nerven und Nervengeflechte im Bauchraum
32.3.1 Anteile des vegetativen Nervensystems
32.3.2 Anteile des somatischen Nervensystems
32.4 Entwicklung der großen Blutgefäße im Bauch- und Beckenraum
33 Leitungsbahnen im Beckenraum
33.1 Einführung
33.2 Gefäße im Beckenraum
33.2.1 Beckenarterien
33.2.2 Beckenvenen
33.2.3 Lymphgefäße und -knoten im Beckenraum
33.3 Nerven und Nervengeflechte im Beckenraum
33.3.1 Anteile des vegetativen Nervensystems
33.3.2 Anteile des somatischen Nervensystems
33.4 Durchtrittsstellen der Leitungsbahnen aus dem Beckenraum
Teil XII Hals
34 Hals – Gliederung, Muskulatur und Leitungsbahnen
34.1 Funktionelle Bedeutung und Bauprinzip
34.1.1 Funktionelle Bedeutung des Halses
34.1.2 Begrenzung und Gliederung des Halses
34.2 Muskulatur des Halses mit Zungenbein
34.2.1 Zungenbein (Os hyoideum) und Zungenbeinmuskulatur
34.2.2 Oberflächliche und tiefe Halsmuskulatur
34.3 Leitungsbahnen im Halsbereich
34.3.1 Gefäße
34.3.2 Nerven
34.4 Topografische Anatomie des Halses
34.4.1 Konturen und tastbare Knochenpunkte
34.4.2 Regionen des Halses mit Halsdreiecken und Skalenuslücken
34.4.3 Faszienräume im Halsbereich
35 Halsorgane
35.1 Übersicht
35.2 Pharynx (Rachen, Schlund)
35.2.1 Funktion des Pharynx
35.2.2 Abschnitte, Lage und Aufbau des Pharynx
35.2.3 Gefäßversorgung und Innervation des Pharynx
35.2.4 Schluckakt
35.3 Larynx (Kehlkopf)
35.3.1 Funktion und Lage des Larynx
35.3.2 Aufbau des Larynx
35.3.3 Gefäßversorgung und Innervation des Larynx
35.3.4 Entwicklung des Larynx
35.4 Trachea (Luftröhre)
35.4.1 Funktion der Trachea
35.4.2 Abschnitte, Form und Lage der Trachea
35.4.3 Aufbau der Trachealwand
35.5 Schilddrüse und Nebenschilddrüsen
35.5.1 Schilddrüse (Glandula thyroidea)
35.5.2 Nebenschilddrüsen (Glandulae parathyroideae)
35.5.3 Gefäßversorgung und Innervation von Schilddrüse und Nebenschilddrüsen
35.5.4 Entwicklung von Schilddrüse und Nebenschilddrüsen
Teil XIII Kopf
36 Kopf – Schädel und mimische Muskulatur
36.1 Schädel (Cranium)
36.1.1 Funktion und Gliederung des Schädels
36.1.2 Hirnschädel (Neurocranium)
36.1.3 Gesichtsschädel (Viscerocranium)
36.1.4 Funktionelle Anatomie des Schädels
36.1.5 Topografische Anatomie des Schädels
36.2 Mimische Muskulatur
36.2.1 Funktion, Lage und Anordnung
36.2.2 Gefäßversorgung und Innervation
36.3 Topografische Anatomie des oberflächlichen Kopfbereichs
36.3.1 Regionen und Proportionen
36.3.2 Tastbare Knochenpunkte im Kopfbereich
36.4 Entwicklung des Kopfbereichs
36.4.1 Entwicklung des Schädels
36.4.2 Entwicklung und Differenzierung der Schlundbögen
36.4.3 Entwicklung des kraniofazialen Systems
37 Leitungsbahnen im Kopfbereich
37.1 Einführung
37.2 Gefäße im Kopfbereich
37.2.1 Arterien des Kopfes
37.2.2 Venen des Kopfes
37.2.3 Lymphabfluss aus dem Kopfbereich
37.3 Nerven im Kopfbereich – Hirnnerven (Nervi craniales)
37.3.1 Nervus olfactorius (I) und Nervus opticus (II)
37.3.2 Hirnnerven zu Augenmuskeln (III, IV und VI)
37.3.3 Nervus trigeminus (V)
37.3.4 Nervus facialis (VII)
37.3.5 Nervus vestibulocochlearis (VIII)
37.3.6 Nervus glossopharyngeus (IX)
37.3.7 Nervus vagus (X)
37.3.8 Nervus accessorius (XI) und Nervus hypoglossus (XII)
38 Mundhöhle und Kauapparat
38.1 Mundhöhle (Cavitas oris)
38.1.1 Funktionelle Bedeutung der Mundhöhle
38.1.2 Gliederung der Mundhöhle
38.1.3 Gaumen (Palatum)
38.1.4 Zunge (Lingua)
38.1.5 Mundboden mit Unterzungenregion
38.1.6 Speicheldrüsen (Glandulae salivariae)
38.1.7 Zähne (Dentes)
38.2 Kiefergelenk und Kaumuskulatur
38.2.1 Kiefergelenk (Articulatio temporomandibularis)
38.2.2 Kaumuskulatur (Musculi masticatorii)
38.2.3 Gefäßversorgung und Innervation von Kiefergelenk und Kaumuskulatur
38.2.4 Topografische Anatomie des Bereichs um Kiefergelenk und Kaumuskulatur
39 Nase und Nasennebenhöhlen
39.1 Funktion der Nase und der Nasennebenhöhlen
39.2 Aufbau von Nase und Nasennebenhöhlen
39.2.1 Äußere Nase (Nasus externus)
39.2.2 Nasen- und Nasennebenhöhlen
39.3 Gefäßversorgung und Innervation von Nase und Nasennebenhöhlen
39.3.1 Gefäßversorgung
39.3.2 Innervation
39.4 Entwicklung von Nase und Nasennebenhöhlen
40 Auge – Sehorgan
40.1 Funktion und Einteilung des Auges
40.2 Orbita (Augenhöhle)
40.2.1 Form und Aufbau der Orbita
40.2.2 Inhalt der Orbita mit Leitungsbahnen
40.3 Hilfsapparat des Auges
40.3.1 Bewegungen des Augapfels durch äußere Augenmuskeln
40.3.2 Augenlider und Bindehaut
40.3.3 Tränenapparat
40.4 Augapfel (Bulbus oculi) – Orientierungslinien und Schichtenfolge
40.4.1 Tunica fibrosa bulbi (äußere Augenhaut)
40.4.2 Tunica vasculosa bulbi (Uvea, Gefäßhaut)
40.4.3 Tunica interna bulbi (Retina, Netzhaut)
40.4.4 Fundus oculi (Augenhintergrund)
40.5 Augapfel (Bulbus oculi) – Linse und Augenkammern
40.5.1 Linse (Lens)
40.5.2 Augenkammern – Begrenzungen und Inhalt
40.6 Entwicklung des Auges
41 Ohr – Hör- und Gleichgewichtsorgan
41.1 Funktion und Einteilung des Ohres
41.2 Äußeres Ohr (Auris externa)
41.2.1 Ohrmuschel (Auricula)
41.2.2 Äußerer Gehörgang und Trommelfell
41.3 Mittelohr (Auris media)
41.3.1 Paukenhöhle (Cavitas tympani)
41.3.2 Antrum mastoideum, Cellulae mastoideae und Tuba auditiva
41.4 Innenohr (Labyrinth)
41.4.1 Labyrinthus cochlearis mit Hörorgan
41.4.2 Labyrinthus vestibularis mit Gleichgewichtsorgan
41.5 Hörvorgang und Gleichgewicht
41.5.1 Umwandlung akustischer Reize in elektrische Signale
41.5.2 Umwandlung von Beschleunigungen in elektrische Signale
41.6 Entwicklung des Ohres
41.6.1 Entwicklung des äußeren Ohres
41.6.2 Entwicklung des Mittelohres
41.6.3 Entwicklung des Innenohres
Teil XIV ZNS
42 ZNS – Aufbau und Organisation
42.1 Einführung
42.2 Rückenmark (Medulla spinalis)
42.2.1 Lage, Form und Abschnitte des Rückenmarks
42.2.2 Aufbau des Rückenmarks – graue und weiße Substanz
42.3 Gehirn (Encephalon)
42.3.1 Hirnstamm (Truncus encephali)
42.3.2 Kleinhirn (Cerebellum)
42.3.3 Zwischenhirn (Diencephalon)
42.3.4 Großhirn
42.4 Hüllen des ZNS (Meningen) und Liquorsystem
42.4.1 Meningen
42.4.2 Liquorsystem
42.5 Gefäßversorgung von Gehirn, Rückenmark und Meningen
42.5.1 Arterielle Versorgung
42.5.2 Venöser Abfluss
42.5.3 Blut-Hirn-Schranke (BHS)
42.6 Entwicklung des ZNS
42.6.1 Entwicklung des Rückenmarks
42.6.2 Entwicklung des Gehirns und der Ventrikel
42.7 Darstellung des ZNS mit bildgebenden Verfahren
42.7.1 Konventionelle Röntgendiagnostik
42.7.2 Schnittbildverfahren
42.7.3 Angiografie
42.7.4 Neurosonografie
42.7.5 Nuklearmedizinische Verfahren
43 ZNS – funktionelle Systeme
43.1 Einführung
43.2 Motorisches System
43.2.1 Motorische Kortexareale
43.2.2 Motorische Bahnen und Kerngebiete
43.2.3 Motorische Endstrecke
43.2.4 Entstehung von Willkürbewegungen
43.3 Sensorische Systeme
43.3.1 Somatosensorik und Viszerosensorik
43.3.2 Visuelles System
43.3.3 Auditorisches System
43.3.4 Vestibuläres System
43.3.5 Olfaktorisches System
43.3.6 Gustatorisches System
43.4 Limbisches System
43.4.1 Funktion des limbischen Systems
43.4.2 Strukturen des limbischen Systems
43.5 Neuroendokrines System
43.5.1 Hypophyse
43.6 Funktionskreise der Formatio reticularis
43.6.1 Beeinflussung der Bewusstseinslage
43.6.2 Beeinflussung motorischer Funktionen
43.6.3 Beeinflussung von Kreislauf und Atmung
43.7 Cholinerges und monaminerges System
43.7.1 Cholinerge Gruppen
43.7.2 Monaminerge Gruppen
43.8 Höhere integrative Funktionen
43.8.1 Lernen und Gedächtnis
43.8.2 Sprache
Teil XV Haut und Hautanhangsgebilde
44 Haut (Integumentum commune)
44.1 Definition
44.2 Funktion, Größe und Gewicht der Haut
44.3 Aufbau der Haut
44.3.1 Felder- und Leistenhaut
44.3.2 Hautschichten
44.3.3 Hautrezeptoren
44.4 Gefäßversorgung und Innervation der Haut
45 Hautanhangsgebilde
45.1 Definition
45.2 Haare und Nägel
45.2.1 Haare (Pili)
45.2.2 Finger- und Zehennägel (Ungues)
45.3 Drüsen der Haut (Glandulae cutis)
45.3.1 Talgdrüsen (Glandulae sebaceae holocrinae)
45.3.2 Kleine und große Schweißdrüsen (Glandulae sudoriferae eccrinae und apocrinae)
45.3.3 Brustdrüse (Glandulae mammariae)
Teil XVI Antwortkommentare klinische Fälle
46 Antwortkommentare klinische Fälle
46.1 Lungenembolie
46.2 Muskeldystrophie Typ Duchenne
46.3 Infektexazerbierte COPD
46.4 Myokardinfarkt
46.5 Metastasiertes Karzinoid
46.6 Diabetes mellitus
46.7 Akute prärenale Niereninsuffizienz
46.8 Ösophagusvarizenblutung bei Leberzirrhose
46.9 Hyperthyreose bei Struma
46.10 Schlaganfall
46.11 Parkinson-Krankheit
46.12 Morbus Cushing
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum/Access Code
Teil I Grundlagen anatomischer Strukturen und ihrer Darstellung
1 Allgemeine Grundlagen
2 Zytologie und Histologie – Grundlagen
3 Embryologie – Grundlagen
4 Bildgebung – Grundlagen





























