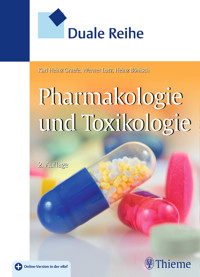
Duale Reihe Pharmakologie und Toxikologie E-Book
69,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Duale Reihe
- Sprache: Deutsch
Wie verhalten sich Moleküle in unserem Körper, wie ist die Rückwirkung auf den menschlichen Organismus und wann ist ein Gift ein Gift?
Die Pharmakologie und Toxikologie zählt zu den wichtigsten Grundlagenfächern der Medizin. Mit der Dualen Reihe Pharmakologie und Toxikologie lernst du alles, was du im klinischen Studienabschnitt zu diesen Themen wissen musst.
- Alle prüfungsrelevanten und klinisch wichtigen Aspekte in leicht verständlicher Sprache - inkl. der für das Verständnis notwendigen Zusammenhänge.
- Maximaler Praxisbezug durch viele Klinik-Bezüge, interessante Fallbeispiele und konkrete Behandlungsempfehlungen für die wichtigsten Erkrankungen.
- Zahlreiche Merke-Kästen und Übersichtstabellen helfen Dir beim Einprägen der wichtigsten Inhalte.
- Hochwertige Grafiken erleichtern das Verständnis der Wirkungsmechanismen wichtiger Wirkstoffe, die vielen klinischen Abbildungen schlagen eine Brücke zu den klinischen Fächern.
- Aktuelle und übersichtliche Handelsnamen-Wirkstoff-Liste.
Die 2. Auflage wurde vollständig aktualisiert und überarbeitet. Das bewährte Duale-Reihe-Konzept mit ausführlichem Lehrbuch und integriertem Kurzlehrbuch ermöglicht dir sowohl das gründliche und vertiefende Lernen als auch die gezielte und effektive Prüfungsvorbereitung. Sei gerüstet für die Medikamentenverordnung. Die Duale Reihe Pharmakologie und Toxikologie hilft dir, die Arzneimittellehre zu verstehen und Wirkstoffe richtig anzuwenden.
Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform eRef zur Verfügung (Zugangscode im Buch). Mit der kostenlosen eRef App haben Sie zahlreiche Inhalte auch offline immer griffbereit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2203
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Duale Reihe Pharmakologie und Toxikologie
Karl Heinz Graefe, Werner Lutz, Heinz Bönisch
2., vollständig überarbeitete Auflage
425 Abbildungen
Vorwort zur 2. Auflage
In der 2. Auflage des Lehrbuches „Pharmakologie und Toxikologie“ wurde der gesamte Inhalt komplett überarbeitet und aktualisiert. Berücksichtigt wurden dabei insbesondere wichtige Arzneistoff-Neuzulassungen, z.B. zur Behandlung kardiovaskulärer Erkrankungen und viraler Infektionen. Unverändert bleibt das didaktische Konzept der Gliederung des Stoffes in die allgemeine Pharmakologie (Teil A), die klinische Pharmakologie übergreifender Systeme (Teil B), die klinische Pharmakologie einzelner Organsysteme und wichtiger Indikationsgebiete (Teil C) und die Toxikologie (Teil D). Da im Lehrbuch aus Gründen der Objektivität und Unabhängigkeit die Handelsnamen nicht genannt werden, befindet sich am Ende des Buches eine Tabelle mit den besprochenen Arzneistoffen und einer Auswahl an Handelsnamen sowie der zugehörigen Wirkstoffgruppe (Teil E).
Die Mitarbeiter des Thieme Verlags, insbesondere die Fachredakteurin Frau Amelie Knauß und der Programmplaner Dr. med. Jochen Neuberger haben uns bei der Erstellung dieser neuen Auflage engagiert und verständnisvoll betreut. Ein herzliches Dankeschön für maßgebliche Beiträge zur Aktualisierung des Teiles Toxikologie geht an Herrn Dr. med. Hugo Kupferschmidt und Frau Dr. med. Katharina Schenk-Jäger von Tox Info Suisse, sowie an Frau Dr. Cornelia Brehmer (Drogen).
Da uns sehr an der Zufriedenheit unserer Leser gelegen ist, möchten wir diese ermuntern, uns Ihre konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge unter www.thieme.de/service/feedback.html mitzuteilen.
Würzburg/Bonn im Februar 2016Karl Heinz GraefeWerner LutzHeinz Bönisch
Vorwort zur 1. Auflage
Die Pharmakologie und die Toxikologie sind wichtige interdisziplinäre Grundlagenfächer der Medizin. Da in nahezu jedem Fachgebiet der Medizin Arznei- und damit auch potenzielle Giftstoffe angewendet werden, sind solide Kenntnisse über die Wirkungsweise solcher Stoffe und über pharmakologische und toxikologische Zusammenhänge für jeden Arzt unerlässlich. Dieses Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie ist in erster Linie für Studierende der Medizin konzipiert, richtet sich aber auch an Studierende der Pharmazie, Biomedizin und Biologie. Darüber hinaus ist es als Informationsquelle für Ärzte und Apotheker geeignet, die sich für eine rationale Arzneimitteltherapie interessieren. Im Vordergrund unserer Ausführungen steht neben der Prüfungsrelevanz die klinisch-praktische Bedeutung der besprochenen Arzneistoffe und toxischen Substanzen, wobei den pharmakotherapeutischen Aspekten häufiger Erkrankungen eine besonders große Bedeutung beigemessen wird.
Im Teil Pharmakologie haben wir Wert auf eine klare Gliederung gelegt. Nach Vermittlung der Grundlagen der allgemeinen Pharmakologie (Teil A) wird zunächst die klinische Pharmakologie übergreifender Systeme (Teil B) vorgestellt, also von Systemen, die im ganzen Organismus gleichermaßen vorkommen, wie z.B. das Gefäß-, Immun- oder schmerzverarbeitende System. Danach wird die klinische Pharmakologie einzelner Organsysteme und spezieller Indikationsgebiete behandelt (Teil C). Bei den Arzneistoffgruppen werden die für die Anwendung relevanten pathophysiologischen Grundlagen, Wirkmechanismen, erwünschten und unerwünschten Wirkungen sowie die Indikationen der Arzneistoffe besprochen. Außerdem sind die für die Klinik und Praxis wichtigen Dosierungen und pharmakokinetischen Daten (meist in Tabellenform) sowie die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Pharmaka beschrieben. Der Bezug zur Klinik und Praxis wird durch entsprechende Abbildungen und Fallbeispiele hergestellt. Unsere kritischen Empfehlungen zur Pharmakotherapie häufiger Erkrankungen beruhen auf Leitlinien der zuständigen medizinischen Fachgesellschaften und der fachspezifischen angloamerikanischen Literatur. Das vorliegende Lehrbuch ist daher auch ein kritischer und auf „Evidence-based Medicine“ beruhender Leitfaden für medizinisches Fachpersonal.
Auch im Teil Toxikologie wurden neue Wege beschritten. Das Ziel war, nicht nur examensrelevante Inhalte abzudecken, sondern auch Kenntnisse zu vermitteln, die im Alltag von Klinik und toxikologischer Beratung nützlich sind. Einleitend werden allgemeine Fragen zur Risikobewertung, Festlegung und Interpretation von Grenzwerten sowie zur Abklärung individueller Belastungen durch Gefahrstoffe beantwortet. Eine Übersicht über die Möglichkeiten der Interaktion eines Gefahrstoffs mit seinem biologischen Ziel führt in die Mechanismen toxischer Wirkungen ein. Ein zentrales Kapitel zur Vorbereitung auf Examina behandelt die Grundlagen der Vergiftungsbehandlung unter besonderer Berücksichtigung von Symptomkomplexen. Abgerundet wird dieser Abschnitt durch aktuelle Übersichtstabellen über „Antidote und ihre Anwendung“. Abschließend werden Stoffe und Belastungen, die bezüglich Häufigkeit von Vergiftungen und/oder Schweregrad des Verlaufs besonders problematisch sind, vertieft charakterisiert.
Das Verfassen eines Lehrbuchs ist ohne Hilfe anderer nicht möglich. Ein besonderer Dank gebührt unseren Gattinnen Ingrid, Ursula und Angelika, die nicht nur durch Verzicht auf gemeinsame Zeit, sondern auch durch kritisches Lesen maßgeblich zum Verständnis der Texte beigetragen haben. Ein herzliches Dankeschön geht auch an Dr. med. Hugo Kupferschmidt, der als Direktor und Chefarzt des Schweizerischen Toxikologischen Informationszentrums in Zürich wichtige persönliche Informationen und Quellenverweise gegeben hat. Auch Herrn Dr. med. Johannes-Martin Hahn, der uns die Arzneimittelliste im Anhang zur Verfügung gestellt hat, sei herzlich gedankt. Eine ganz besondere Anerkennung verdienen die Mitarbeiter des Thieme Verlags, insbesondere die Fachredakteure Herr Dr. med. Benjamin Roll, Frau Dr. med. Marie Trendelenburg, Frau Claudia Seitz, Frau Dr. med. Kathrin Feyl und der Programmplaner Herr Dr. med. Jochen Neuberger, die uns engagiert betreut und unsere Manuskripte mit konstruktiven Vorschlägen zur gelungenen Ausgestaltung geführt haben. In diesem Zusammenhang möchten wir die Arbeit des projektverantwortlichen Redakteurs Dr. Benjamin Roll insbesondere wegen seines klaren Konzeptes zur Strukturierung des umfangreichen Stoffes besonders hervorheben. Auch der Herstellerin Frau Elsbeth Elwing, Frau Anja Jahn von der Grafikabteilung sowie dem Grafiker Herrn Dr. Wilhelm Kuhn danken wir ganz herzlich.
Nun hoffen wir, dass unser Konzept eines modernen, klinisch orientierten und gleichzeitig bewältigbaren Lehrbuchs für Pharmakologie und Toxikologie unseren Lesern das Lernen der beiden Fächer erleichtern und dem Buch zum Erfolg verhelfen wird. Da uns sehr an der Zufriedenheit unserer Leser gelegen ist, möchten wir Sie herzlich ermuntern, uns Ihre konstruktive Kritik und Ihre Verbesserungsvorschläge unter www.thieme.de/service/feedback.html mitzuteilen.
Im August 2011Karl Heinz GraefeWerner LutzHeinz Bönisch
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 2. Auflage
Vorwort zur 1. Auflage
Teil I Allgemeine Pharmakologie
1 Grundbegriffe und Gebiete der Pharmakologie
1.1 Grundbegriffe
1.2 Gebiete der Pharmakologie
2 Pharmakodynamik
2.1 Definition
2.2 Mechanismen der Pharmakonwirkung
2.2.1 Rezeptorvermittelte Wirkungen
2.2.2 Durch rezeptorähnliche Proteine vermittelte Wirkungen
2.2.3 Anders vermittelte Wirkungen
2.3 Quantitative Aspekte der Pharmakonwirkung
2.3.1 Kinetik der Pharmakon-Rezeptor-Interaktion
2.3.2 Quantitative Konzentrations- bzw. Dosis-Wirkungs-Kurven
2.4 Qualitative Dosis-Wirkungs-Kurven
2.5 Pharmakodynamische Ursachen der Variabilität von Pharmakonwirkungen
2.5.1 Pharmakodynamische Toleranz
2.5.2 Pharmakodynamische Sensibilisierung und Potenzierung
2.5.3 Pharmakodynamische Wechselwirkungen
3 Pharmakokinetik
3.1 Überblick
3.2 Von der Applikation des Arzneimittels bis zum Eintritt des Pharmakons in den systemischen Kreislauf
3.2.1 Applikation des Arzneimittels und Freisetzung des Pharmakons
3.2.2 Resorptionsmechanismen
3.2.3 Zusammenspiel von Applikationsart und Resorption
3.3 Verteilung
3.3.1 Verteilungsräume und Verteilungsmechanismen
3.3.2 Einflüsse auf das Verteilungsmuster von Pharmaka
3.4 Elimination
3.4.1 Elimination durch Metabolisierung (Biotransformation)
3.4.2 Elimination durch Ausscheidung (Exkretion)
3.5 Klinische Pharmakokinetik
3.5.1 Bioverfügbarkeit
3.5.2 Plasma-Halbwertszeit
3.5.3 Clearance
3.5.4 Verteilungsvolumen
3.5.5 Lineare und nicht lineare Kinetik
3.5.6 Pharmakokinetische Berechnungen
3.6 Beziehung zwischen Pharmakokinetik und Pharmakodynamik
3.6.1 Zeitverlauf der Pharmakonwirkung
3.6.2 Determinanten der Wirkdauer von Pharmaka
3.7 Pharmakokinetische Ursachen der Variabilität von Pharmakonwirkungen
3.7.1 Pharmakokinetische Toleranz
3.7.2 Pharmakogenetik
3.7.3 Pharmakokinetische Wechselwirkungen
4 Besonderheiten der Pharmakotherapie in bestimmten Lebensabschnitten
4.1 Pharmakotherapie in Schwangerschaft und Stillperiode
4.1.1 Schwangerschaft
4.1.2 Stillperiode
4.2 Pharmakotherapie im Kindesalter
4.3 Pharmakotherapie beim alten Menschen
4.3.1 Hohe Anzahl verordneter Pharmaka
4.3.2 Altersbedingte Veränderungen der Pharmakodynamik
4.3.3 Altersbedingte Veränderungen der Pharmakokinetik
5 Entwicklung und Anwendung von Arzneimitteln
5.1 Arzneimittelentwicklung
5.1.1 Präklinischer Abschnitt der Entwicklung
5.1.2 Klinischer Abschnitt der Entwicklung
5.2 Zulassung, Anwendung und Überwachung von Arzneimitteln
5.2.1 Zulassung
5.2.2 Anwendung und Überwachung
5.3 Rezeptieren von Arzneimitteln
5.3.1 Privatrezept
5.3.2 Kassenrezept und Betäubungsmittelrezept
6 Besondere (alternative) Therapierichtungen
6.1 Phytotherapie
6.2 Antiempirische Therapiesysteme
6.2.1 Homöopathische Arzneitherapie
6.2.2 Anthroposophische Arzneitherapie
Teil II Klinische Pharmakologie übergreifender Systeme
7 Autonomes Nervensystem
7.1 Überblick
7.2 Sympathisches Nervensystem
7.2.1 Klinische Bedeutung
7.2.2 Anatomische und physiologische Grundlagen
7.2.3 Sympathomimetika
7.2.4 α-Rezeptor-Antagonisten
7.2.5 β-Rezeptor-Antagonisten
7.2.6 Antisympathotonika
7.3 Parasympathisches Nervensystem
7.3.1 Klinische Bedeutung
7.3.2 Anatomische und physiologische Grundlagen
7.3.3 Parasympathomimetika
7.3.4 Muskarinrezeptor-Antagonisten
7.3.5 Periphere Muskelrelaxanzien
8 Gewebshormone
8.1 Überblick
8.2 Histamin
8.2.1 Klinische Bedeutung
8.2.2 Physiologische Grundlagen
8.2.3 Hemmstoffe der IgE-vermittelten Mastzellaktivierung
8.2.4 Histaminrezeptor-Antagonisten
8.3 Serotonin
8.3.1 Klinische Bedeutung
8.3.2 Physiologische Grundlagen
8.3.3 5-HT-Rezeptor-Agonisten
8.3.4 5-HT-Rezeptor-Antagonisten
8.4 Arachidonsäure-Metabolite
8.4.1 Klinische Bedeutung
8.4.2 Physiologische Grundlagen
8.4.3 Prostaglandine und Prostaglandin-Analoga
8.4.4 COX-Hemmstoffe
8.4.5 Leukotrienrezeptor-Antagonisten
9 Ionenkanäle
9.1 Klinische Bedeutung
9.2 Physiologische Grundlagen
9.3 Na+-Kanalblocker
9.3.1 Lokalanästhetika
9.3.2 Antikonvulsiva und Klasse-I-Antiarrhythmika
9.4 Ca2+-Kanalblocker
9.4.1 Spannungsabhängige Ca2+-Kanäle und ihre physiologische Bedeutung
9.4.2 L-Kanalblocker
9.4.3 Antikonvulsiva (Antiepileptika)
9.5 Pharmaka mit Wirkung auf K+-Kanäle
9.5.1 K+-Kanäle und ihre physiologische Bedeutung
9.5.2 Kv-Kanalblocker
9.5.3 KATP-Kanalöffner
9.5.4 KATP-Kanalblocker
10 Gefäßsystem
10.1 Anatomische und physiologische Grundlagen
10.1.1 Regulation des Gefäßtonus
10.2 Pharmaka mit Wirkung auf das Gefäßsystem
10.2.1 Hemmstoffe des Angiotensin-Konversionsenzyms (ACE)
10.2.2 AT1-Rezeptor-Antagonisten
10.2.3 Fixe Kombination aus Valsartan und Sacubitril
10.2.4 Aliskiren
10.2.5 Nitrovasodilatatoren
10.2.6 Hemmstoffe der Typ-5-Phosphodiesterase (PDE5)
10.2.7 Stimulatoren der löslichen Guanylatcyclase
10.2.8 Endothelinrezeptor-Antagonisten
10.2.9 Dihydralazin
10.3 Pharmakotherapie ausgewählter Erkrankungen des Gefäßsystems
10.3.1 Arterielle Hypertonie, koronare Herzkrankheit, Herzinsuffizienz
10.3.2 Pulmonal-arterielle Hypertonie (PAH)
11 Immunsystem
11.1 Physiologische und pathophysiologische Grundlagen
11.1.1 Komponenten des Immunsystems
11.1.2 Immunallergische Überempfindlichkeitsreaktionen
11.2 Immunsuppressiva
11.2.1 Zytotoxische Immunsuppressiva
11.2.2 Immunsuppressiva mit hemmender Wirkung auf die antigeninduzierte T-Zell-Aktivierung
11.2.3 Immunsuppressiva mit hemmender Wirkung auf den IL-2-Rezeptor und seine Signaltransduktion
11.2.4 Immunsuppressiva mit unklarem Wirkungsmechanismus
11.2.5 Immunologisch wirkende Immunsuppressiva
11.3 Immunstimulanzien
11.3.1 Antigenspezifische Immunstimulation
11.3.2 Unspezifische Immunstimulation
11.4 Mediatoren des Immunsystems
11.4.1 Immunglobuline (Antikörper)
11.4.2 Interferone (IFN)
11.4.3 Aldesleukin
11.5 Antagonisten von Mediatoren oder Rezeptoren des Immunsystems
11.5.1 TNF-α-Antagonisten
11.5.2 Omalizumab
11.5.3 Anakinra
11.5.4 Tocilizumab
11.6 Pharmakotherapie ausgewählter (Auto)-Immunerkrankungen
11.6.1 Rheumatoide Arthritis (RA)
11.6.2 Systemischer Lupus erythematodes (SLE)
11.6.3 Multiple Sklerose (MS)
11.6.4 IgE-vermittelte Erkrankungen
11.6.5 Akutes rheumatisches Fieber
12 Nozizeptives System
12.1 Physiologische Grundlagen
12.1.1 Mechanismen der Schmerzentstehung und -verarbeitung
12.1.2 Schmerzformen
12.1.3 Möglichkeiten der Pharmakotherapie von Schmerzen
12.2 Opioid-Analgetika und andere Opioidrezeptor-Agonisten
12.2.1 Nomenklatur und Einteilung
12.2.2 Struktur und Wirkungsmechanismus
12.2.3 Wirkungen
12.2.4 Pharmakokinetik
12.2.5 Indikationen
12.2.6 Unerwünschte Wirkungen
12.2.7 Kontraindikationen
12.2.8 Wechselwirkungen
12.3 Opioidrezeptor-Antagonisten
12.4 Antitussiva
12.5 Nichtopioid-Analgetika: Antipyretische Analgetika
12.5.1 Wirkprofil der gesamten Wirkstoffgruppe
12.5.2 Allgemeine Aspekte der therapeutischen Anwendung
12.5.3 Antipyretische Analgetika ohne antiphlogistische Wirkung
12.5.4 Antipyretische Analgetika mit antiphlogistischer Wirkung
12.6 Nichtopioid-Analgetika: Andere Substanzen
12.6.1 Flupirtin
12.6.2 Ketamin
12.6.3 Capsaicin
12.6.4 Ziconotid
12.7 Adjuvante Schmerztherapeutika
12.7.1 Antidepressiva
12.7.2 Antikonvulsiva
12.7.3 Glukokortikoide
12.7.4 Bisphosphonate
12.8 Pharmakotherapie ausgewählter Schmerzsyndrome
12.8.1 Grundlagen
12.8.2 Kopfschmerzen
12.8.3 Andere akute Schmerzsyndrome
12.8.4 Andere chronische Schmerzsyndrome
Teil III Klinische Pharmakologie einzelner Organsysteme und wichtiger Indikationsgebiete
13 Zentrales Nervensystem
13.1 Physiologische Grundlagen
13.1.1 Dopaminerges System
13.1.2 Glutamaterges System
13.1.3 GABAerges System
13.1.4 Glycinerges System
13.2 Narkose
13.2.1 Allgemeine Grundlagen
13.2.2 Narkotika
13.2.3 Andere injizierbare Wirkstoffe in der Anästhesie
13.3 Angststörungen und Spannungszustände
13.3.1 Anxiolytika
13.4 Schlafstörungen
13.4.1 Hypnotika
13.5 Epilepsie
13.5.1 Antikonvulsiva
13.6 Parkinson-Syndrom
13.6.1 Grundlagen
13.6.2 Antiparkinsonmittel
13.6.3 Therapie des Parkinson-Syndroms
13.7 Demenzen
13.7.1 Grundlagen
13.7.2 Pharmakotherapie von Demenzen
13.8 Schizophrenie
13.8.1 Grundlagen
13.8.2 Neuroleptika (Antipsychotika)
13.8.3 Pharmakotherapie der Schizophrenie
13.9 Affektive Störungen
13.9.1 Depression
13.9.2 Manie und bipolare Störung
13.10 Abhängigkeit (Sucht)
13.10.1 Klinische und pathophysiologische Grundlagen
13.10.2 Suchterzeugende Stoffe
13.10.3 Pharmakotherapie des Abhängigkeitssyndroms
14 Hormonelle Systeme
14.1 Hypothalamus und Hypophyse
14.1.1 Physiologische Grundlagen
14.1.2 Hormone des Hypothalamus und ihre klinische Anwendung
14.1.3 Hormone der Hypophyse und ihre klinische Anwendung
14.2 Schilddrüse
14.2.1 Grundlagen
14.2.2 Wirkstoffe
14.2.3 Pharmakotherapie ausgewählter Schilddrüsenerkrankungen
14.3 Nebennierenrinde
14.3.1 Grundlagen
14.3.2 Wirkstoffe
14.4 Keimdrüsen
14.4.1 Grundlagen
14.4.2 Wirkstoffe
14.4.3 Wichtige Anwendungsgebiete für Sexualhormone
15 Stoffwechsel
15.1 Überblick
15.2 Diabetes mellitus
15.2.1 Pathophysiologische Grundlagen
15.2.2 Wirkstoffe zur Behandlung des Diabetes mellitus
15.2.3 Pharmakotherapie des Diabetes mellitus
15.3 Fettstoffwechselstörungen
15.3.1 Pathophysiologische Grundlagen
15.3.2 Hemmstoffe der Cholesterolsynthese (Statine)
15.3.3 Hemmstoffe des LDL-Rezeptor-Abbaus
15.3.4 Hemmstoffe der intestinalen Cholesterolresorption
15.3.5 Colestyramin
15.3.6 Fibrate
15.3.7 Pharmakotherapie der Adipositas
15.4 Gicht (Hyperurikämie)
15.4.1 Pathophysiologische Grundlagen
15.4.2 Pharmaka mit Wirkung gegen Gicht
15.4.3 Rasburicase
15.5 Knochenstoffwechselstörungen
15.5.1 Physiologische Grundlagen
15.5.2 Hemmstoffe der Knochenresorption (antiresorptive und antikatabol wirkende Stoffe)
15.5.3 Die Knochenneubildung fördernde, osteoanabole Stoffe
15.5.4 Pharmakotherapie ausgewählter Erkrankungen des Knochens
16 Blutbildendes System
16.1 Erythropoese
16.1.1 Pathophysiologische und klinische Grundlagen
16.1.2 Eisen und Eisenmangelanämie
16.1.3 Vitamin B12 und Vitamin-B12-Mangel-Anämie
16.1.4 Folsäure und Folsäuremangelanämie
16.1.5 Erythropoetin (EPO) und renale Anämie
16.2 Leukopoese
16.2.1 Granulozyten-koloniestimulierender Faktor (G-CSF)
16.3 Plasmaersatzstoffe
16.3.1 Gelatine
17 Gerinnungssystem
17.1 Physiologische Grundlagen
17.1.1 Thrombozyten-Aktivierung
17.1.2 Blutgerinnung
17.2 Hemmstoffe der Thrombozytenaggregation
17.2.1 Acetylsalicylsäure (ASS)
17.2.2 ADP-Rezeptor-Antagonisten
17.2.3 Glykoprotein (GP)-IIb/IIIa-Antagonisten
17.3 Antikoagulanzien
17.3.1 Direkt wirkende Antikoagulanzien
17.3.2 Indirekt wirkende Antikoagulanzien (Cumarin-Derivate)
17.4 Fibrinolytika (Thrombolytika)
17.4.1 Direkte Fibrinolytika
17.4.2 Indirekte Fibrinolytika
17.5 Antifibrinolytika
18 Niere
18.1 Grundlagen
18.2 Diuretika
18.2.1 Carboanhydrase-Hemmstoffe
18.2.2 Schleifendiuretika
18.2.3 Thiazid-Diuretika (Thiazide)
18.2.4 Kaliumsparende Diuretika
18.2.5 Andere Diuretika
19 Kardiovaskuläres System
19.1 Arterielle Hypertonie
19.1.1 Grundlagen
19.1.2 Allgemeine Therapieoptionen
19.1.3 Klinisch-therapeutisches Vorgehen
19.1.4 Antihypertensive Therapie bei besonderen Patientengruppen
19.2 Koronare Herzkrankheit (KHK)
19.2.1 Klinische und pathophysiologische Grundlagen
19.2.2 Pharmakotherapie der koronaren Herzkrankheit
19.2.3 Primär- und Sekundärprävention der KHK
19.3 Herzrhythmusstörungen
19.3.1 Tachykarde Rhythmusstörungen
19.4 Herzinsuffizienz
19.4.1 Klinische und pathophysiologische Grundlagen
19.4.2 Wirkstoffe
19.4.3 Therapie der chronischen Herzinsuffizienz
20 Respiratorisches System
20.1 Obstruktive Atemwegserkrankungen
20.1.1 Pathophysiologische und klinische Grundlagen
20.1.2 Therapieprinzipien
20.1.3 Wirkstoffgruppen
20.1.4 Therapie des Asthma bronchiale
20.1.5 Therapie der COPD
21 Gastrointestinales System
21.1 Magensäureassoziierte Erkrankungen
21.1.1 Physiologische Grundlagen der Magensaftsekretion
21.1.2 Wirkstoffe
21.1.3 Pharmakotherapie der Ulkuskrankheit
21.1.4 Pharmakotherapie der Refluxösophagitis
21.2 Gastrointestinale Motilitätsstörungen
21.3 Obstipation
21.3.1 Pathophysiologische Grundlagen
21.3.2 Laxanzien
21.3.3 Behandlung der Obstipation
21.4 Diarrhö
21.4.1 Pathophysiologische Grundlagen
21.4.2 Antidiarrhoika
21.4.3 Behandlung der Diarrhö
21.5 Übelkeit und Erbrechen
21.5.1 Pathophysiologische Grundlagen
21.5.2 Wirkstoffe
21.5.3 Pharmakotherapie ausgewählter Syndrome mit Übelkeit und Erbrechen
21.6 Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
21.6.1 Pathophysiologische und klinische Grundlagen
21.6.2 Wirkstoffe
21.6.3 Therapie der chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen
22 Bakterielle Infektionen
22.1 Grundlagen
22.1.1 Grundprinzipien einer antibakteriellen Pharmakotherapie
22.2 Antibakterielle Wirkstoffe
22.2.1 Antibiotika
22.2.2 Antibakteriell wirkende Chemotherapeutika
22.2.3 Antimykobakterielle Stoffe
22.3 Pharmakotherapie ausgewählter bakterieller Infektionen
22.3.1 Pneumonien
22.3.2 Harnwegsinfektionen
22.3.3 Tuberkulose
23 Pilzinfektionen
23.1 Grundlagen
23.2 Antimykotika
23.2.1 Polyen-Makrolide
23.2.2 Azole
23.2.3 Echinocandine
23.2.4 Flucytosin
23.2.5 Terbinafin
23.2.6 Weitere topische Antimykotika
23.3 Pharmakotherapie ausgewählter Pilzinfektionen
23.3.1 Dermatomykosen
23.3.2 Pilzinfektionen der Schleimhäute
23.3.3 Systemische Mykosen
24 Virusinfektionen
24.1 Grundlagen
24.2 Virustatika
24.2.1 Wirkstoffe gegen Herpesviren
24.2.2 Wirkstoffe gegen Influenzaviren
24.2.3 Wirkstoffe gegen hepatotrope Viren
24.2.4 Antiretrovirale Wirkstoffe
24.3 Pharmakotherapie ausgewählter Virusinfektionen
24.3.1 Chronische Hepatitis B
24.3.2 Chronische Hepatitis C
24.3.3 HIV-Infektion
25 Protozoeninfektionen
25.1 Malaria
25.1.1 Grundlagen
25.1.2 Antimalariamittel
25.1.3 Pharmakotherapie/-prophylaxe der Malaria
25.2 Toxoplasmose
25.2.1 Grundlagen
25.2.2 Wirkstoffe gegen Toxoplasmen
25.2.3 Pharmakotherapie der Toxoplasmose
25.3 Amöbiasis
25.3.1 Grundlagen
25.3.2 Wirkstoffe
25.3.3 Pharmakotherapie der Amöbiasis
25.4 Flagellateninfektionen
25.4.1 Wirkstoffe und Pharmakotherapie
26 Wurmerkrankungen
26.1 Grundlagen
26.2 Wirkstoffe gegen Würmer (Anthelminthika)
26.2.1 Praziquantel
26.2.2 Mebendazol und Albendazol
26.2.3 Niclosamid
26.2.4 Pyrviniumhemiembonat
26.2.5 Pyrantelembonat
26.3 Pharmakotherapie ausgewählter Wurmerkrankungen
26.3.1 Askariasis
26.3.2 Echinokokkose
26.3.3 Schistosomiasis (Bilharziose)
27 Maligne Tumoren
27.1 Grundlagen
27.2 Unselektiv zytotoxische Chemotherapeutika (Zytostatika)
27.2.1 Antimetabolite
27.2.2 Alkylierende Zytostatika
27.2.3 Topoisomerase-Hemmer
27.2.4 Mitosehemmer
27.2.5 Zytostatisch wirkende Antibiotika
27.2.6 Sonstige Zytostatika
27.3 Zielgerichtete Tumortherapeutika
27.3.1 Monoklonale Antikörper
27.3.2 Tyrosinkinase-Hemmer
27.3.3 Hormone und Hormon-Antagonisten
27.4 Sonstige Tumortherapeutika
27.5 Pharmakotherapie ausgewählter Tumorerkrankungen
Teil IV Toxikologie
28 Allgemeine Toxikologie
28.1 Überblick
28.2 Grundlegende Begriffe
28.3 Erkennen von Gefahrstoffen
28.3.1 Epidemiologische Studien
28.3.2 Fallberichte
28.3.3 Toxizitätsprüfung am Tier
28.4 Toxikologische Risikocharakterisierung
28.4.1 Abgrenzung der Begriffe „Gefahr“ und „Risiko“
28.4.2 Abschätzung der Potenz für toxische Wirkungen
28.4.3 Probleme bei Persistenz von Gefahrstoffen
28.4.4 Dosis-Wirkungs-Beziehungen
28.4.5 Individuelle Empfindlichkeit
28.4.6 Zeitfenster der Empfindlichkeit
28.4.7 Toxizität von Gemischen
28.5 Begrenzung von Gefahrstoffbelastungen
28.5.1 Bereiche der Grenzwertsetzung
28.5.2 Grenzwerte für den Arbeitsplatz
28.5.3 Referenzdosen für Lebensmittel
28.5.4 Gefahrstoffe in Bedarfsgegenständen
28.5.5 Grenzwerte für die Luft (Umwelt und Innenraum)
28.5.6 Schadstoffanalysen
28.5.7 Probleme der Grenzwertsetzung
28.6 Biomarker
28.6.1 Biomarker der Exposition
28.6.2 Biomarker für Effekte
28.6.3 Biomarker der individuellen Empfindlichkeit
29 Mechanismen toxischer Wirkung
29.1 Überblick
29.2 Interaktionen zwischen Gefahrstoff und Zielstruktur
29.2.1 Nicht kovalente Bindung
29.2.2 Kovalente (chemische) Bindung
29.2.3 Photoaktivierung
29.2.4 Radikalbildung
29.3 Toxikokinetik
29.3.1 Aufnahme von Gefahrstoffen
29.3.2 Metabolische Aktivierung/Inaktivierung
29.4 Mechanismen akuter Toxizität
29.4.1 Organotropie toxischer Wirkungen
29.4.2 Akute Neurotoxizität
29.4.3 Zytotoxizität
29.4.4 Enzyme als Toxine
29.4.5 Immunreaktionen
29.4.6 Reaktionen der Haut
29.5 Mechanismen irreversibler Wirkungen
29.5.1 Entwicklungsstörungen
29.5.2 Neurotoxizität
29.5.3 Mutagenese und Kanzerogenese
30 Grundlagen der Vergiftungsbehandlung
30.1 Überblick
30.1.1 Vergiftungsepidemiologie
30.1.2 Erste Schritte bei Vergiftungen
30.2 Diagnostik und symptomatische Behandlung
30.2.1 Anamnese und Umfeld
30.2.2 Status und Symptomatik
30.2.3 Labor- und apparative Untersuchungen
30.2.4 Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen
30.3 Vom Symptom zum Gefahrstoff
30.3.1 Cholinerges (parasympathomimetisches) Syndrom
30.3.2 Anticholinerges (parasympatholytisches) Syndrom
30.3.3 Syndrom der Opioid-, Sedativa- oder Alkohol-Intoxikation
30.3.4 Sympathomimetisches Syndrom
30.3.5 Weitere Toxidrome
30.3.6 Prädiktivität von Toxidromen
30.4 Prinzipien der Vergiftungsbehandlung
30.4.1 Primäre Dekontamination bei oraler Aufnahme
30.4.2 Sekundäre Dekontamination und Dekorporationsantidote
30.4.3 Funktionelle Antidote
30.4.4 Spezifische Therapieansätze
30.5 Übersicht konkreter Therapiemaßnahmen bei Vergiftungen
30.5.1 Übersicht: Gefahrstoffe und Therapieoptionen
30.5.2 Übersicht: Antidote und ihre Anwendung
31 Akute Vergiftungen
31.1 Überblick
31.2 Medikamente
31.2.1 Antidepressiva
31.2.2 Hypnotika
31.2.3 Neuroleptika
31.2.4 Analgetika
31.2.5 Antikonvulsiva
31.2.6 Kardiovaskuläres System
31.2.7 H1-Antihistaminika
31.2.8 Weitere Wirkstoffe
31.3 Drogen
31.3.1 Grundlagen
31.3.2 Wirkstoffe und Gruppen
31.4 Produkte und Stoffe in Haushalt und Gewerbe
31.4.1 Grundlagen
31.4.2 Produkte
31.4.3 Stoffgruppen
31.5 Vergiftungen durch Gase und Rauch
31.5.1 Stickgase
31.5.2 Reizgase
31.5.3 Gasgemische
31.6 Produkte für Landwirtschaft, Gartenbau und Bauwesen
31.6.1 Herbizide
31.6.2 Insektizide
31.6.3 Fungizide
31.6.4 Rodentizide
31.7 Pflanzliche Gift- und Inhaltsstoffe
31.7.1 Nikotin in Tabak
31.7.2 Koffein, Theobromin, Theophyllin in Getränken
31.8 Giftpilze, Pilzgifte
31.9 (Gift-)Tiere
31.9.1 Giftschlangen
31.9.2 Nesseltiere und Stachelhäuter
31.10 Nahrungsmittel (akute Ereignisse)
31.10.1 Mikrobielle Kontamination
31.10.2 Toxine in Muscheln und Fischen
31.10.3 Glykoside
31.10.4 Fermentationsprodukte, Glutamat
32 Chronische Toxizität
32.1 Überblick
32.2 Krebs und Krebsrisikofaktoren
32.2.1 Krebsepidemiologie
32.2.2 Tabakrauchen
32.2.3 Alkoholische Getränke
32.2.4 Ernährung
32.2.5 Belastungen am Arbeitsplatz
32.2.6 Luftverschmutzung
32.2.7 Geophysik/Strahlung
32.2.8 Unerwünschte Therapieeffekte
32.2.9 Infekte
32.2.10 Sexualverhalten und Fortpflanzung
32.2.11 Genetische Krebsrisikofaktoren
32.2.12 Krebsrisiko und Vermeidbarkeit
32.3 Metalle
32.3.1 Arsen
32.3.2 Blei
32.3.3 Cadmium
32.3.4 Quecksilber
32.3.5 Behandlungsoptionen bei Metallvergiftungen
32.4 „Umweltkrankheiten“
Teil V Anhang
33 Freinamen der Wirkstoffe, deren Handelsnamen als Arzneimittel und Einordnung in Indikations- und Substanzgruppe
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum
Teil I Allgemeine Pharmakologie
1 Grundbegriffe und Gebiete der Pharmakologie
2 Pharmakodynamik
3 Pharmakokinetik
4 Besonderheiten der Pharmakotherapie in bestimmten Lebensabschnitten
5 Entwicklung und Anwendung von Arzneimitteln
6 Besondere (alternative) Therapierichtungen
© Stefan Redel – Fotolia.com
1 Grundbegriffe und Gebiete der Pharmakologie
1.1 Grundbegriffe
Die Pharmakologie beschäftigt sich mit der Wirkung eines Arzneistoffs auf Mensch oder Tier. Ein Pharmakon (Arzneistoff) dient der Verhinderung, Heilung oder Linderung von Krankheiten.
Die Pharmakologie beschreibt die Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln und Mensch oder Tier. Genauer gesagt geht es dabei um den im Arzneimittel enthaltenen Wirkstoff, das Pharmakon. Ein Pharmakon (Arzneistoff) ist ein Wirkstoff, der dazu dient, Krankheiten zu verhüten, zu lindern bzw. zu heilen oder sie zu erkennen. Pharmaka werden entweder durch chemische Verfahren hergestellt oder aus der Natur gewonnen.
Arzneimittel enthalten den Arzneistoff in einer geeigneten Zubereitungsform (Formulierung). Meist enthalten sie auch verschiedene Hilfsmittel.
Zur Anwendung bei Mensch oder Tier werden Pharmaka vom Pharmazeuten in geeignete Zubereitungsformen (Formulierungen) überführt, wie z. B. Tabletten oder Zäpfchen, die als Arzneimittel bezeichnet werden. Arzneimittel enthalten neben dem Arzneistoff eine unterschiedliche Anzahl von Hilfsstoffen.
Die Hersteller vermarkten Arzneimittel unter geschützten Markennamen. Von der WHO werden für alle Pharmaka Freinamen (generic name) festgelegt. Generika sind Arzneimittel, die günstig unter dem Freinamen vermarktet werden. Dies ist erst nach Ablauf des Patentschutzes möglich.
Vom Hersteller erhalten Arzneimittel geschützte Fantasienamen (Markennamen), die in aller Regel mit dem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgelegten Freinamen (generic name) der Pharmaka nichts zu tun haben. In diesem Lehrbuch werden nur die Freinamen der Pharmaka verwendet. Die Markennamen für die wichtigsten Pharmaka sind aber ▶ im Anhang des Lehrbuchs tabellarisch zusammengefasst. Erst nach Ablauf des Patentschutzes für ein neu zugelassenes Arzneimittel kommen Zubereitungsformen des Pharmakons in den Handel, die den Freinamen tragen. Solche Arzneimittel sind meist billiger als die erstzugelassenen Varianten und werden als Generika bezeichnet.
1.2 Gebiete der Pharmakologie
Die Allgemeine Pharmakologie beschreibt Gesetzmäßigkeiten, die für alle Pharmaka gleichermaßen gelten. Die Spezielle Pharmakologie beschäftigt sich mit Aspekten der einzelnen Pharmaka. Die Experimentelle Pharmakologie beinhaltet Versuche an Tieren oder isolierten Zellen. Die Klinische Pharmakologie untersucht die Wirkung am Menschen.
Die pharmakologische Forschung zu den einzelnen Pharmaka (Spezielle Pharmakologie) hat zur Formulierung von Gesetzmäßigkeiten geführt, die für alle Pharmaka gelten (Allgemeine Pharmakologie). In der frühen Phase der Entwicklung von Arzneimitteln spielt die Experimentelle Pharmakologie eine wichtige Rolle. Sie schließt Tierversuche und Untersuchungen an isolierten Zellen oder Zellbestandteilen und Geweben oder Organen ein. Die Klinische Pharmakologie dagegen beschäftigt sich mit der Anwendung von Arzneimitteln beim Menschen.
© Schlierner – Fotolia.com
2 Pharmakodynamik
2.1 Definition
Definition
Die Pharmakodynamik beschreibt den Aspekt der Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln bzw. Pharmaka und Mensch oder Tier, der sich mit den Pharmakonwirkungen beschäftigt. Sie untersucht Art und Ort der Pharmakonwirkungen und widmet sich den Wirkungsmechanismen.
2.2 Mechanismen der Pharmakonwirkung
Meist entsteht die Wirkung durch Bindung des Pharmakons an zelluläre Proteine (v. a. Rezeptoren).
Die meisten Pharmakonwirkungen werden durch Bindung des Pharmakons an zelluläre Proteine vermittelt. Diese lassen sich in Rezeptoren und rezeptorähnliche Proteine (z. B. Enzyme, Transporter) unterteilen. Nur wenige Pharmaka wirken ohne Mithilfe eines körpereigenen Proteins.
2.2.1 Rezeptorvermittelte Wirkungen
Rezeptoren vermitteln Wirkungen körpereigener Signalstoffe. Sie haben zwei Funktionen:
Bindung des Signalstoffs
Initiation eines Signals, das zelluläre Funktionen anregt oder hemmt.
Agonisten aktivieren Rezeptoren, Antagonisten unterdrücken ihre Funktion. Es gibt membranständige und intrazelluläre Rezeptoren ( ▶ Abb. 2.1).
Rezeptoren gehören zu einer Familie zellulärer Proteine, deren Aufgabe es ist, Wirkungen körpereigener Signalstoffe (z. B. Transmitter, Hormone, Wachstumsfaktoren) zu vermitteln. Sie haben zwei Funktionen:
Sie binden den Signalstoff.
Sie initiieren über rezeptorspezifische Transduktionswege ein Signal, das zelluläre Funktionen anregt oder hemmt.
Über viele solche Rezeptoren wirken auch Pharmaka. Man unterscheidet dabei Agonisten, die Rezeptoren aktivieren, von Antagonisten, die Rezeptoren nicht aktivieren und/oder in ihrer Funktion unterdrücken. Die verschiedenen Gruppen von Rezeptoren sind schematisch in ▶ Abb. 2.1 dargestellt. Man kennt membranständige und intrazelluläre Rezeptoren.
2.2.1.1 Membranständige Rezeptoren
Verschiedene Typen sind in ▶ Abb. 2.1 (Nr. 1 – 4) dargestellt.
Man unterscheidet G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, Ionenkanal-Rezeptoren, Enzymrezeptoren und Rezeptoren mit assoziierter Tyrosinkinase (Nr. 1 – 4 in ▶ Abb. 2.1).
G-Protein-gekoppelte Rezeptoren
Synonym
Metabotrope Rezeptoren.
Diese Rezeptoren (Nr. 1 in ▶ Abb. 2.1) werden aufgrund ihrer Struktur auch als heptahelikale Rezeptoren bezeichnet. Der Signaltransduktionsweg verläuft in vier Phasen:
Der Agonist löst durch Bindung an den Rezeptor eine Konformationsänderung aus ( ▶ Abb. 2.2).
Dies aktiviert das intrazellulär assoziierte G-Protein.
Dieses zerfällt in zwei Proteinuntereinheiten (Gβγ und Gα in ▶ Abb. 2.2), welche die Konzentration intrazellulärer Botenstoffe steigern oder senken können.
Das Signal endet durch Hydrolyse von GTP, das G-Protein wird wieder inaktiv.
Diese Rezeptoren sind Membranproteine mit sieben transmembranären α-Helices sowie extrazellulärem N- und intrazellulärem C-Terminus (Nr. 1 in ▶ Abb. 2.1). Sie werden auch als heptahelikale Rezeptoren bezeichnet. Sie vermitteln Wirkungen von vielen Transmittern und Hormonen. Der Signaltransduktionsweg dieser Rezeptoren verläuft in vier Phasen:
Merke
Die Komplexität des Transduktionsmechanismus von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren erklärt, warum es sich um relativ „langsame“ Rezeptoren handelt. Trotzdem kommen die durch solche Rezeptoren vermittelten Wirkungen innerhalb von Sekunden zustande.
Schema der G-Protein-vermittelten Signaltransduktion
Abb. 2.2
(nach Behrends et al., Duale Reihe Physiologie, Thieme, 2012)
Wichtige G-Protein-gekoppelte Rezeptoren s. ▶ Tab. 2.1.
Es gibt eine Vielzahl von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren. Hier sollen exemplarisch einige erwähnt werden, und zwar geordnet nach der Art der assoziierten G-Protein-Familie ( ▶ Tab. 2.1).
Tab. 2.1
Familien von G-Proteinen und die von ihnen angesteuerten Effektorproteine
G-Protein
Aktivierung z. B. durch Bindung von
aktivierte G-Protein-Untereinheit
Auswirkung auf Effektorproteine und Second Messenger
Gs
Noradrenalin an β-Rezeptoren
Histamin an H2-Rezeptoren
α
Aktivierung der Adenylatcyclase (cAMP↑)
Gi/o
Noradrenalin an α2-Rezeptoren
Acetylcholin an M2-Muskarinrezeptoren
Morphin an µ-Opioidrezeptoren
α
Hemmung der Adenylatcyclase (cAMP↓)
βγ
Öffnung von einwärtsgleichrichtenden K+-Kanälen
Blockade spannungsabhängiger neuronaler Ca2+-Kanäle
Aktivierung der Isoenzyme β2 und β3 der Phospholipase Cβ (IP3↑ und DAG↑)
Gq/11
Noradrenalin an α1-Rezeptoren
Acetylcholin an M1-Muskarinrezeptoren
Serotonin (5-HT) an 5-HT2-Rezeptoren
α
Aktivierung der Isoenzyme β1 und β4 der Phospholipase Cβ (IP3↑ und DAG↑)
Gs-Protein-assoziierte Rezeptoren Der Rezeptoragonist (s. ▶ Tab. 2.1) stimuliert über das Gs-Protein die Adenylatcyclase. Die gesteigerte cAMP-Konzentration aktiviert die Proteinkinase A (PKA). Deren Substrate sind:
Ca2+-Kanäle in Herzmuskelzellen → positiv inotrope Wirkung
Enzyme des Fett- und Glykogenstoffwechsels → Glukosebereitstellung
Myosinkinase in glatten Gefäßmuskelzellen → Erschlaffung
Gs-Protein-assoziierte Rezeptoren Die Bindung eines Agonisten an den Rezeptor (Beispiele s. ▶ Tab. 2.1) stimuliert über die α-Untereinheit des Gs-Proteins die Adenylatcyclase, wodurch die Synthese von zyklischem Adenosin-3´,5´-monophosphat (cAMP) zunimmt. Der Anstieg der intrazellulären cAMP-Konzentration führt zur Aktivierung der cAMP-abhängigen Proteinkinase A (PKA), die Serin- und Threoninreste verschiedener Proteine phosphoryliert. PKA-Substrate sind beispielsweise:
L-Typ-Ca2+-Kanäle in Herzmuskelzellen, deren Phosphorylierung die Öffnungswahrscheinlichkeit der spannungsabhängigen Kanäle erhöht und zum Einstrom von Ca2+ führt, der letztlich für eine positiv inotrope Wirkung sorgt;
Enzyme des Fett- und Glykogenstoffwechsels in Leber- und Muskelzellen, deren Phophorylierung zur vermehrten Bereitstellung von Glukose führt;
eine spezielle Myosinkinase in glatten Gefäßmuskelzellen, deren Phosphorylierung zur Erschlaffung glatter Muskelzellen führt.
Klinischer Bezug
Choleratoxin, das Toxin des gramnegativen Bakteriums Vibrio cholerae, blockiert in Enterozyten die GTPase der α-Untereinheit von Gs. Dies führt zu einer persistierenden Aktivierung dieses G-Proteins und damit auch der Adenylatcyclase und der PKA. Als Folge scheiden die Enterozyten große Mengen von Chlorid, gefolgt von Wasser, ins Darmlumen aus. So kommt es zu massiven wässrigen Durchfällen, die unbehandelt zum hypovolämischen Schock mit Nierenversagen und dadurch zum Tode führen. Deshalb ist die frühzeitige Therapie durch orale und intravenöse Zufuhr der sog. WHO-Lösung sehr wichtig. Sie setzt sich zusammen aus 20 g Glukose, 3,5 g NaCl, 3 g Natriumcitrat und 1,5 g KCl in 1 l Wasser.
Gi/o-Protein-assoziierte Rezeptoren Der stimulierte Rezeptor (s. ▶ Tab. 2.1) hemmt die Adenylatcyclase (cAMP↓). Die Blockade neuronaler Ca2+-Kanäle hemmt die Transmitterfreisetzung, die Öffnung einwärtsgleichrichtender K+-Kanäle beeinträchtigt die zelluläre Erregbarkeit. Gi/o-Proteine erhöhen die katalytische Aktivität der Phospholipase Cβ (PIP2 → IP3 + DAG). IP3 setzt Ca2+ aus intrazellulären Speichern frei, DAG aktiviert die Proteinkinase C (PKC), die Zellwachstum und Zelldifferenzierung fördert.
Gi/o-Protein-assoziierte Rezeptoren Nach Bindung eines Agonisten an den Rezeptor (Beispiele s. ▶ Tab. 2.1) hemmt die α-Untereinheit der Gi/o-Proteine die Adenylatcyclase, wodurch die Synthese von cAMP abnimmt. Der βγ-Komplex von Gi/o kann mehrere Effektoren ansteuern und blockieren oder aktivieren ( ▶ Tab. 2.1). Die Blockade neuronaler Ca2+-Kanäle führt zur Hemmung der Transmitterfreisetzung, die Öffnung einwärtsgleichrichtender K+-Kanäle (z. B. in Herzmuskelzellen oder Neuronen) beeinträchtigt die zelluläre Erregbarkeit. Der βγ-Komplex aktivierter Gi/o-Proteine erhöht aber auch die katalytische Aktivität einiger membranständiger Enzyme. Das gilt insbesondere für die Phospholipase Cβ (PLCβ). Dieses Enzym katalysiert die Hydrolyse von Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat (PIP2) zu Inositol-1,4,5-trisphosphat (IP3) und Diacylglycerol (DAG). Letztere fungieren als Second Messenger: IP3 setzt Ca2+ aus intrazellulären Speichern frei, DAG aktiviert verschiedene Isoenzyme der Proteinkinase C (PKC). Die PKC phosphoryliert Serin- und Threoninreste von Proteinen, die für das Zellwachstum und die Zelldifferenzierung von Bedeutung sind.
Klinischer Bezug
Pertussistoxin, das Toxin des gramnegativen Bakteriums Bordetella pertussis, des Keuchhustenerregers, blockiert irreversibel die rezeptorvermittelte Aktivierung der Familie der Gi/o-Proteine. Die funktionellen Konsequenzen sind vielfältig. So setzen z. B. die B-Zellen der Langerhans-Inseln vermehrt Insulin frei (Folge: Neigung zu Hypoglykämien) und die Lymphozytenmigration wird gehemmt (Folge: Lymphozytose, ein typischer Befund bei Keuchhusten). Der Husten ist Folge der bakteriellen Entzündung der mit Flimmerepithelien ausgestatteten Schleimhaut der Atemwege.
Gq/11-Protein-assoziierte Rezeptoren Nach Aktivierung des Rezeptors ( ▶ Tab. 2.1) stimuliert die α-Untereinheit die Phospholipase Cβ (mit o. g. Folgen).
Gq/11-Protein-assoziierte Rezeptoren Nach Bindung eines Agonisten an den Rezeptor (Beispiele s. ▶ Tab. 2.1) stimuliert die α-Untereinheit der Gq/11-Proteine die Phospholipase Cβ. Die Folge ist eine vermehrte Bildung von IP3 und DAG mit den oben beschriebenen Konsequenzen.
Ionenkanal-Rezeptoren
Synonym
Ionotrope Rezeptoren.
Ionenkanal und Rezeptor liegen in einem Proteinkomplex (Nr. 2 in ▶ Tab. 2.1). Die Bindungsstellen für Liganden befinden sich extrazellulär.
Ionenkanal und Rezeptor sind Teil ein und desselben Proteinkomplexes (Nr. 2 in ▶ Tab. 2.1). Dieser besteht meist aus 5 Untereinheiten, die so in der Membran angeordnet sind, dass ihre α-helikalen Strukturen selbst oder zusätzlich ausgebildete kanalbildende Domänen eine zentrale Pore umschließen. Die Bindungsstellen für den endogenen Agonisten (z. B. Transmitter) finden sich extrazellulär an einer der Kanaluntereinheiten.
Beispiele:
Nikotinischer Acetylcholinrezeptor ( ▶ Abb. 2.3): Löst über Na+ und K+ eine Depolarisation und zelluläre Erregung aus.
GABAA-Rezeptor: Verursacht über den Einstrom von Cl–-Ionen eine Hyperpolarisation und Abnahme der zellulären Erregbarkeit.
5-HT3-Rezeptor: Führt über den Einstrom von Na+ und Ausstrom von K+ zu zellulärer Erregung.
Typische Beispiele sind:
Nikotinischer Acetylcholinrezeptor: Er erhöht die transmembranäre Leitfähigkeit für Na+ und K+ (Beispiel: der nikotinische Rezeptor der motorischen Endplatte, ▶ Abb. 2.3). Die Aktivierung des Rezeptors führt zur Depolarisation und zur zellulären Erregung.
GABAA-Rezeptor: Dieser Rezeptor für γ-Aminobuttersäure (GABA) erhöht die transmembranäre Leitfähigkeit für Cl–-Ionen. Die Aktivierung des Rezeptors führt zum Einstrom von Cl–, zur Hyperpolarisation und zur Abnahme der zellulären Erregbarkeit.
Serotoninrezeptor vom Typ 5-HT3 (5-HT3-Rezeptor): Er erhöht die transmembranäre Leitfähigkeit für Na+ und K+ und ruft eine zelluläre Erregung hervor.
Merke
Ionotrope Rezeptoren sind „sehr schnelle“ Rezeptoren. Wenn sie durch Bindung eines Agonisten erregt werden, treten die vermittelten Wirkungen innerhalb von Millisekunden auf.
Der nikotinische Acetylcholinrezeptor der motorischen Endplatte
Abb. 2.3 Der Rezeptor besteht aus 5 Untereinheiten (2-mal α1 und jeweils 1-mal β1, δ und ε), die alle die Membran viermal durchdringen und zusammen einen Kanal bilden. Die Bindung von Acetylcholin (Ach) an die beiden α1-Untereinheiten erhöht die Öffnungswahrscheinlichkeit des Kanals und bewirkt so einen Einstrom von Na+ und einen Ausstrom von K+ und damit eine Depolarisation der motorischen Endplatte.
Enzymrezeptoren
Enzymrezeptoren besitzen eine inhärente Enzymaktivität (Nr. 3 in ▶ Abb. 2.1). Sie besitzen intrazellulär eine Guanylatcyclase-Aktivität ( ▶ Abb. 2.4b), verantwortlich für die Bildung des Second Messenger cGMP. cGMP-abhängige Proteinkinasen (PKG) führen zur Erschlaffung glatter Gefäßmuskulatur über die Phosphorylierung verschiedener Proteinsubstrate: IP3-Rezeptoren und ein assoziiertes Protein, die Myosin-Leichtketten-Phosphatase und Ca2+-aktivierte K+-Kanäle.
Rezeptoren mit inhärenter Enzymaktivität (Nr. 3 in ▶ Abb. 2.1) nennt man Enzymrezeptoren. Typische Beispiele sind Rezeptoren für natriuretische Peptide ( ▶ Abb. 2.4b). Die extrazelluläre Domäne dieser Rezeptoren bindet den Agonisten. Die intrazelluläre Domäne besitzt Guanylatcyclase-Aktivität. Die membrangebundene Guanylatcyclase (GC) wird auch partikuläre GC (GCp) genannt, zur Unterscheidung von der löslichen GC (GCs), die durch Stickstoffmonoxid (NO) aktiviert wird. Die Stimulation der GC führt zur Bildung des Second Messenger cGMP. cGMP-abhängige Proteinkinasen (PKG) phosphorylieren in glatten Gefäßmuskelzellen ganz verschiedene Proteinsubstrate und bewirken so eine Erschlaffung der glatten Gefäßmuskulatur. Typische Proteinsubstrate sind:
IP3-Rezeptor und ein IP3-Rezeptor-assoziiertes Protein: Dadurch wird die IP3-induzierte Freisetzung von Ca2+ aus dem endoplasmatischen Retikulum der Muskelzellen reduziert.
Myosin-Leichtketten-Phosphatase: Dadurch wird das Enzym aktiviert und die leichte Kette des Myosins vermehrt dephosphoryliert.
Ca2+-aktivierte K+-Kanäle: Dadurch werden diese Kanäle aktiviert, die Muskelzellen durch den vermehrten Ausstrom von K+ hyperpolarisiert und spannungsabhängige Ca2+-Kanäle geschlossen.
Beispiele für Rezeptoren mit assoziierter (a) oder inhärenter (b) Enzymaktivität
Abb. 2.4a Insulinrezeptor. Y-Kinase: Tyrosinkinase; IRS: Insulinrezeptor-Substrat; PI3-Kinase: Phosphatidylinositol-3-Kinaseb ANP-Rezeptor. ANP: atriales natriuretisches Peptid; GC: Guanylatcyclase
(a nach Behrends et al., Duale Reihe Physiologie, Thieme, 2012; b nach Rassow et al., Duale Reihe Biochemie, Thieme, 2012)
Insulinrezeptor Seine Aktivierung bewirkt die Autophosphorylierung der β-Untereinheiten ( ▶ Abb. 2.4a). Dadurch entstehen Bindungsstellen für IRS (Insulinrezeptor-Substrate), die ebenfalls tyrosinphosphoryliert werden. Die phosphorylierten IRS binden an Effektormoleküle und aktivieren über das kleine G-Protein Ras die Proteinkinasen B und C, welche für insulinbedingte Änderungen im ▶ Kohlenhydrat-, Lipid- und Eiweißstoffwechsel verantwortlich sind.
Insulinrezeptor Er besteht aus 2 α- und 2 β-Untereinheiten ( ▶ Abb. 2.4a). Insulin bindet an die 2 extrazellulären α-Untereinheiten und bewirkt eine Konformationsänderung der beiden transmembranären β-Untereinheiten. Dadurch wird die Tyrosinkinase (Y-Kinase) in den β-Untereinheiten aktiviert und phosphoryliert Tyrosinreste der β-Untereinheiten. Diese Autophosphorylierung generiert an den β-Untereinheiten Bindungsstellen für die Adapterproteine IRS (Insulinrezeptor-Substrate), die ebenfalls tyrosinphosphoryliert werden. Die phosphorylierten IRS binden an Effektormoleküle (z. B. die Phosphatidylinositol-3-Kinase [PI3-Kinase]) sowie weitere Adapterproteine, die das kleine (monomere) G-Protein Ras aktivieren (Ras steht für Rattensarkomvirus). Die aktivierte PI3-Kinase aktiviert die Proteinkinase B (PKB) und C (PKC), die für insulinbedingte Änderungen im ▶ Kohlenhydrat-, Lipid- und Eiweißstoffwechsel verantwortlich sind. So sorgt die PKB z. B. für die vermehrte Translokation des Glukosetransporters GLUT 4 in die Plasmamembran von Skelettmuskelzellen und damit für die insulininduzierte Glukoseaufnahme in den Skelettmuskel. Die Ras-Kaskade induziert über die Expression zahlreicher Gene das Wachstum und die Differenzierung von Zellen.
Rezeptoren mit assoziierter Enzymaktivität
Rezeptoren für Erythropoetin, Interferon β, viele andere Zytokine und Insulin haben keine inhärente Enzymaktivität.
Rezeptoren für Erythropoetin, Interferone, viele andere Zytokine und Insulin haben keine inhärente Enzymaktivität. Sie binden ihre Agonisten und aktivieren dann eine mit dem Rezeptorprotein assoziierte Tyrosinkinase, die den Rezeptor selbst und weitere intrazelluläre Substrate tyrosinphosphoryliert (Nr. 4 in ▶ Abb. 2.1).
2.2.1.2 Intrazelluläre Rezeptoren
Steroidhormonen, Schilddrüsenhormonen, Vitamin D und Retinoide binden an intrazelluläre Rezeptoren (Nr. 5 in ▶ Abb. 2.1). Der Agonist-Rezeptor-Komplex gelangt nach Dimerisierung in den Zellkern und steuert dort die Transkription bestimmter Zielgene.
Steroidhormone, Schilddrüsenhormone, Vitamin D und Retinoide sind so lipophil, dass sie Zellmembranen leicht durchdringen können. Sie binden an intrazelluläre Rezeptoren (Nr. 5 in ▶ Abb. 2.1), die im Zytosol an inaktivierende Proteine gebunden vorliegen. Die Bindung des Agonisten (z. B. Steroidhormon) an den Rezeptor führt zunächst zur Ablösung der inaktivierenden Proteine. Der Agonist-Rezeptor-Komplex bindet dann an einen anderen Agonist-Rezeptor-Komplex und gelangt als Dimer in den Zellkern. Dort bindet der dimere Komplex an für den Agonisten spezifische DNA-Sequenzen und fördert oder hemmt die Transkription bestimmter Zielgene. Intrazelluläre Hormonrezeptoren steuern auf diesem Wege die Expression zahlreicher Gene.
Merke
Wirkungen, die durch Aktivierung solcher intrazellulärer Rezeptoren vermittelt werden, zeigen typischerweise einen um mehrere Minuten verzögerten Beginn und eine auffällige Persistenz der Wirkung. Die Wirkung hält auch dann noch an, wenn das die Wirkung auslösende Pharmakon längst aus dem Körper verschwunden ist.
2.2.2 Durch rezeptorähnliche Proteine vermittelte Wirkungen
Beispiele für „rezeptorähnliche Proteine“:
Enzyme: Na+-K+-ATPase (Hemmung durch Digitalisglykoside), lösliche Guanylatcyclase (Aktivierung durch Nitrovasodilatatoren, s. ▶ Abb. 10.4).
Ionenkanäle: Na+-Kanäle, die durch ▶ Lokalanästhetika blockiert werden, ATP-empfindliche K+-Kanäle (s. ▶ Abb. 9.7) (Aktivierung durch KATP-Kanalöffner).
Transporter: Noradrenalin- oder Serotonintransporter (Hemmung durch Antidepressiva), renale Elektrolyttransporter (Hemmung durch Diuretika).
Zelluläre Strukturproteine: Mikrotubuli (Funktionsbeeinträchtigung durch Vinca-Alkaloide/Taxane).
Der Begriff „rezeptorähnliche Proteine“ umfasst zelluläre Proteine, die nicht die Wirkungen von Transmittern, Hormonen oder Zytokinen vermitteln, sondern andere Aufgaben in der Zelle haben. Die Funktion dieser Proteine kann durch Bindung von Pharmaka verändert werden. Zu ihnen gehören:
Enzyme, wie z. B. die Na+-K+-ATPase, die durch Digitalisglykoside gehemmt wird, oder die lösliche zytoplasmatische Guanylatcyclase (s. ▶ Abb. 10.4), die durch Nitrovasodilatatoren aktiviert wird.
Ionenkanäle, wie z. B. spannungsabhängige Na+-Kanäle, die durch ▶ Lokalanästhetika blockiert werden, oder ATP-empfindliche einwärtsgleichrichtende K+-Kanäle (s. ▶ Abb. 9.7), die durch KATP-Kanalöffner aktiviert werden.
Transporter, wie z. B. die neuronalen Noradrenalin- oder Serotonintransporter, die durch bestimmte Antidepressiva blockiert werden, und Elektrolyttransporter in den Tubuluszellen der Niere, die durch Diuretika blockiert werden.
Zelluläre Strukturproteine, wie z. B. Mikrotubuli, deren vielfältige Funktionen durch Vinca-Alkaloide (z. B. Vinblastin) oder Taxane (z. B. Paclitaxel) blockiert werden.
2.2.3 Anders vermittelte Wirkungen
Bei wenigen Pharmaka wird die Wirkung nicht zelluläre Proteine vermittelt. Beispiele sind Antazida, osmotisch wirkende Diuretika und Laxanzien, Aktivkohle und Colestyramin sowie Schwermetallantidote.
Es gibt nur einige wenige Pharmakonwirkungen, die nicht durch Wechselwirkungen mit zellulären Proteinen zustande kommen. Dazu gehören z. B.:
Antazida: Sie wirken durch Neutralisation der Magensäure.
osmotisch wirkende Diuretika und Laxanzien: Sie wirken durch Bindung von Wasser.
Aktivkohle und Colestyramin: Beide wirken durch Bindung von Pharmaka oder Gallensäuren im Magen-Darm-Kanal.
Schwermetallantidote (z. B. EDTA, Deferoxamin): Sie wirken durch Chelatbildung.
2.3 Quantitative Aspekte der Pharmakonwirkung
2.3.1 Kinetik der Pharmakon-Rezeptor-Interaktion
Es existieren zwei Modelle ( ▶ Abb. 2.5):
Bimolekulares Modell ( ▶ Abb. 2.5a): Die Interaktion von Pharmakon und Rezeptor ist reversibel. Im ersten Schritt erfolgt die Bindung, im zweiten Schritt die Aktivierung des Rezeptors, s. a. Kap. ▶ „Mechanismen der Pharmakonwirkung“.
Modell der zwei Konformationszustände des Rezeptors ( ▶ Abb. 2.5b): Ein inaktiver (Ri) und ein aktiver (Ra) Zustand des Rezeptors stehen in einem Gleichgewicht. Eine Pharmakonbindung ist an beide Zustände möglich und verändert das Gleichgewicht.
Für die Interaktion zwischen Pharmakon und Rezeptor (oder rezeptorähnlichen Proteinen) gibt es zwei hypothetische Modellvorstellungen ( ▶ Abb. 2.5):
Das bimolekulare Modell ( ▶ Abb. 2.5a) beschreibt die Interaktion zwischen Pharmakon und Rezeptor als reversible Bindung des Pharmakons an den Rezeptor. Es geht von der Hypothese aus, dass die Bildung des Pharmakon-Rezeptor-Komplexes zur Aktivierung des Rezeptors führt und über eine Änderung der Funktion nachgeschalteter Effektorproteine die Pharmakonwirkung hervorruft. Bindung an den Rezeptor und Aktivierung des Rezeptors sind zwei aufeinander folgende Schritte beim Zustandekommen rezeptorvermittelter Wirkungen. Die molekularen Mechanismen der Rezeptoraktivierung schließen die im Kap. ▶ „Mechanismen der Pharmakonwirkung“ besprochenen Effektorsysteme ein.
Beim Modell der zwei Konformationszustände des Rezeptors ( ▶ Abb. 2.5b) stehen ein inaktiver (Ri) und ein aktiver (Ra) Konformationszustand des Rezeptors auch in Abwesenheit von Pharmaka in einem Gleichgewicht, das abhängig von der Art des Gewebes oder Organs Ri in unterschiedlichem Ausmaß bevorzugt. Pharmaka können über eine reversible Bindung an die beiden Rezeptorzustände dieses Gleichgewicht verändern. Das Ausmaß der Aktivierung des Rezeptors wird in diesem Modell von der relativen Affinität des Pharmakons für Ri und Ra bestimmt.
Kinetische Modelle der Pharmakon-Rezeptor-Interaktion
Abb. 2.5a Bimolekulares Modell. P: Pharmakon; PAgonist: Agonist; PAntagonist: Antagonist; R: Rezeptor; PR: Pharmakon-Rezeptor-Komplex; k1: Geschwindigkeitskonstante für die Assoziation des Pharmakons an den Rezeptor; k– 1: Geschwindigkeitskonstante für die Dissoziation des Pharmakons vom Rezeptor.b Modell der zwei Konformationszustände des Rezeptors. Ri: inaktiver Konformationszustand des Rezeptors; Ra: aktiver Konformationszustand des Rezeptors.
Merke
Die Bindung des Pharmakons an den Rezeptor wird von der Affinität des Pharmakons zum Rezeptor bestimmt. Für die Intensität der Rezeptoraktivierung ist die intrinsische Aktivität ausschlaggebend.
2.3.1.1 Affinität
Definition
Als Affinität bezeichnet man die Stärke, mit der das Pharmakon an das Rezeptorprotein bindet.
In Rezeptor-Bindungs-Experimenten kann die Stärke der Pharmakonbindung an den Rezeptor direkt gemessen werden ( ▶ Abb. 2.6). Die maximal gebundene Pharmakonmenge sagt etwas über die Rezeptordichte auf den untersuchten Membranen aus.
Sättigungskinetik der Bindung eines Pharmakons an einen Rezeptor
Abb. 2.6 Das Ausmaß der prozentualen Rezeptorbesetzung ist als Funktion der Pharmakonkonzentration dargestellt. Die Dissoziationskonstante KD ist die Pharmakonkonzentration, bei der die Hälfte (50 %) der verfügbaren Rezeptoren mit dem Pharmakon besetzt ist.a Lineare Skala der Abszisse.b Logarithmische Skala der Abszisse.
Merke
Die Dissoziationskonstante KD – die Pharmakonkonzentration, bei der 50 % der verfügbaren Rezeptoren mit dem Pharmakon besetzt sind – ist ein Maß für die Affinität, mit der das Pharmakon an den Rezeptor bindet: je niedriger KD, umso höher die Affinität (Affinität ~1/KD).
Eselsbrücke: Ein niedriger KD-Wert geht mit einer niedrigen Dissoziationsgeschwindigkeit des Rezeptor-Pharmakon-Komplexes einher, d. h. das Pharmakon „klebt am Rezeptor“ (bindet mit hoher Affinität).
2.3.1.2 Intrinsische Aktivität
Synonym
Intrinsic activity, relative efficacy.
Definition
Die intrinsische Aktivität eines Pharmakons ist eine relative Größe, in der das Maximum der Wirkungsintensität des Pharmakons in Bezug gesetzt wird zu der im untersuchten Gewebe (an den dort vorhandenen Rezeptoren) maximal möglichen Wirkungsintensität. Mit anderen Worten, die intrinsische Aktivität eines Pharmakons ergibt einen Wert kleiner oder gleich 1,0:
Die Konzentrations-Wirkungs-Kurve ( ▶ Abb. 2.7) beschreibt die steigende Wirkung eines Pharmakons bei steigender Konzentration bis zum Erreichen des Wirkungsmaximums. Die intrinsische Aktivität hängt vom Pharmakon sowie von der Rezeptordichte des Organs ab.
Das Ausmaß der Wirkung eines Pharmakons nimmt mit steigender Pharmakonkonzentration bis zum Erreichen des Wirkungsmaximums zu. Diese Beziehung wird Konzentrations-Wirkungs-Kurve ( ▶ Abb. 2.7) genannt. Dabei hängt die Intensität der Wirkung, die die Rezeptoren im untersuchten Gewebe vermitteln, nicht nur von der Art und der Konzentration des Pharmakons ab, sondern wird auch von der Rezeptordichte im untersuchten Gewebe mitbestimmt. Die intrinsische Aktivität ist also eine Eigenschaft des Pharmakons und des untersuchten Gewebes oder Organs.
Konzentrations-Wirkungs-Beziehung
Abb. 2.7a Messung. Gemessen wird das Ausmaß der Gefäßverengung eines Gefäßfragments nach Zusatz unterschiedlicher Konzentrationen eines vasokonstriktorischen Wirkstoffs (für jeweils 1 Minute). Das Gefäß ist so mit einem Schreiber verbunden, dass der Verengungsgrad als Ausschlag auf Millimeterpapier aufgezeichnet und so quantifiziert werden kann. Das Ausmaß der Gefäßverengung nimmt mit steigender Pharmakonkonzentrationen zu.b Darstellung. Konzentrations-Wirkungs-Kurven, einmal mit linearer und einmal mit logarithmischer Skalierung der x-Achse
(nach Lüllmann et al., Taschenatlas Pharmakologie, Thieme, 2014)
Je nach intrinsischer Aktivität unterscheidet man vier Wirkstoffgruppen ( ▶ Abb. 2.8a):
Nach der Höhe der intrinsischen Aktivität unterscheidet man vier Gruppen von Pharmaka, die schematisch mit ihren Konzentrations-Wirkungs-Kurven in ▶ Abb. 2.8a gezeigt sind:
Volle Agonisten: Sie rufen die maximal mögliche Wirkungsintensität hervor (s. ▶ Abb. 2.8b) und haben eine intrinsische Aktivität von 1,0 ( ▶ Abb. 2.8a). ▶ Abb. 2.8c zeigt mit Phenylephrin ein Beispiel für eine sehr effiziente Rezeptorbesetzung. Im Modell der zwei Rezeptor-Konformationszustände ( ▶ Abb. 2.5b) sind volle Agonisten durch eine sehr hohe Affinität zu Ra relativ zu Ri charakterisiert.
Volle Agonisten rufen die maximal mögliche Wirkungsintensität hervor (siehe z. B. der α-Rezeptor-Agonist Phenylephrin in ▶ Abb. 2.8b). Sie haben also die höchstmögliche intrinsische Aktivität, die per definitionem 1,0 beträgt ( ▶ Abb. 2.8a). Sie sind meist auch besonders effizient, was die Koppelung zwischen Rezeptorbesetzung und Aktivierung der zellulären Effektorsysteme angeht. Das ist in ▶ Abb. 2.8c dargestellt, wo gezeigt ist, dass der volle Agonist Phenylephrin nur 7 % der vorhandenen Rezeptoren besetzen muss, um eine halbmaximale Wirkung zu erzielen. Im Modell der zwei Konformationszustände des Rezeptors ( ▶ Abb. 2.5b) sind volle Agonisten durch eine sehr hohe Affinität zu Ra relativ zu Ri charakterisiert und verschieben das Gleichgewicht zwischen Ra und Ri ganz auf die Seite von Ra.
Partielle Agonisten: Ihre Wirkung liegt unter der maximal möglichen Wirkungsintensität (s. ▶ Abb. 2.8b), ihre intrinsische Aktivität liegt zwischen 0 und 1 ( ▶ Abb. 2.8a). Auch bei Besetzung aller verfügbaren Rezeptoren sind sie ineffizienter als die vollen Agonisten (s. ▶ Abb. 2.8c), auch ist ihre Affinität zu Ra relativ zu Ri geringer. Sie wirken immer auch als ▶ kompetitive Antagonisten.
Partielle Agonisten rufen eine geringere als die maximal mögliche Wirkungsintensität hervor (siehe die α-Rezeptor-Agonisten Oxymetazolin und Naphazolin in ▶ Abb. 2.8b), haben also eine intrinsische Aktivität, die zwischen 0 und 1 liegt ( ▶ Abb. 2.8a). Auch bei Besetzung aller verfügbaren Rezeptoren ist bei partiellen Agonisten die Rezeptor-Effektor-Kopplung wesentlich ineffizienter als bei vollen Agonisten (siehe Oxymetazolin und Naphazolin in ▶ Abb. 2.8c). Das ist auch der Grund, warum die intrinsische Aktivität partieller Agonisten mit zunehmender Rezeptordichte zunimmt und von Organ zu Organ variiert. Ihre Affinität zu Ra relativ zu Ri ist geringer als die der vollen Agonisten. Die Folge ist, dass partielle Agonisten immer auch ▶ kompetitive Antagonisten sind. Sie reduzieren (antagonisieren) nämlich rezeptorvermittelte Wirkungen, wenn diese über die partiell-agonistische Eigenwirkung dieser Stoffe hinausgehen. Das gilt auch für Wirkungen, die als Folge einer Rezeptoraktivierung durch hohe Konzentrationen eines endogenen Agonisten zustande kommen. So vermindert z. B. der partielle β-Rezeptor-Agonist Pindolol die erhöhte Herzfrequenz bei körperlicher Belastung, nicht aber die Ruheherzfrequenz.
Merke
Partielle Agonisten sind immer auch kompetitive Antagonisten.
Antagonisten: Sie binden an den Rezeptor, ohne ihn zu aktivieren. Ihre intrinsische Aktivität beträgt Null ( ▶ Abb. 2.8a) und sie haben die gleiche Affinität zu Ri wie zu Ra (s. ▶ Abb. 2.5b). Antagonisten verhindern durch ihre Bindung an den Rezeptor eine mögliche Wirkung durch Agonisten.
Antagonisten binden an den Rezeptor, ohne ihn zu aktivieren. Ihre intrinsische Aktivität ist Null ( ▶ Abb. 2.8a). Antagonisten haben die gleiche Affinität zu Ri wie zu Ra, sodass das für jedes Gewebe charakteristische Gleichgewicht zwischen Ri und Ra (das in Abwesenheit von Agonisten normalerweise Ri bevorzugt; s. ▶ Abb. 2.5b) nicht verändert wird. Durch Bindung an den Rezeptor verhindern Antagonisten eine Rezeptoraktivierung durch volle oder partielle Agonisten und eine Rezeptordeaktivierung durch inverse Agonisten.
Inverse Agonisten: Bei Rezeptoren mit konstitutiver (spontaner) Aktivität unterdrücken sie die Rezeptoraktivierung. Sie besitzen eine negative intrinsische Aktivität ( ▶ Abb. 2.8a) und ihre Affinität zu Ra relativ zu Ri ist sehr niedrig. Sie reduzieren als ▶ kompetitive Antagonisten die Wirkung voller und partieller Agonisten ( ▶ Abb. 2.8a).
Inverse Agonisten gibt es nur in Systemen mit konstitutiver (spontaner) Rezeptoraktivität, d. h. Rezeptoraktivität trotz Abwesenheit agonistischer Liganden. Rezeptoren mit konstitutiver Aktivität sind z. B. Histaminrezeptoren, Cannabinoidrezeptoren im ZNS, manchmal auch kardiale β-Rezeptoren und somatisch mutierte TSH-Rezeptoren in der Schilddrüse. Inverse Agonisten unterdrücken die spontane Rezeptoraktivierung. Sie haben eine negative intrinsische Aktivität ( ▶ Abb. 2.8a), und ihre Affinität zu Ra relativ zu Ri ist sehr niedrig, d. h. sie binden bevorzugt an Ri. Deshalb arretieren sie Rezeptoren im inaktiven Konformationszustand und antagonisieren als ▶ kompetitive Antagonisten die Wirkung voller und partieller Agonisten. Wie ▶ Abb. 2.8a zeigt, reduzieren sie die Rezeptoraktivierung über das Niveau der spontanen Rezeptoraktivität (die horizontale Linie) hinaus auf Null. Typische Beispiele für inverse Agonisten sind Antagonisten von H1- und H2-Histaminrezeptoren.
Pharmaka mit Unterschieden bezüglich ihrer intrinsischen Aktivität
Abb. 2.8a Intensität der Rezeptoraktivierung als Funktion der Pharmakonkonzentration (log. Skala): Die intrinsische Aktivität des vollen Agonisten ist 1,0. Die intrinsischen Aktivitäten der übrigen Pharmaka sind relativ zu der des vollen Agonisten angegeben. Außerdem sind die relativen Affinitäten der verschiedenen Pharmaka zur aktiven (Ra) bzw. inaktiven (Ri) Rezeptorkonformation gezeigt (s. a. ▶ Abb. 2.5b). Die horizontale lilafarbene Linie für einen Antagonisten gibt auch das Niveau der konstitutiven (spontanen) Rezeptoraktivität wieder.b Vasokonstriktorische Wirkung verschiedener α-Rezeptor-Agonisten in Abhängigkeit von der Wirkstoffkonzentration: Gemessen wurde die vasokonstriktorische Wirkung von Phenylephrin, Naphazolin und Oxymetazolin an der Aorta der Ratte.c Vasokonstriktorische Wirkung verschiedener α-Rezeptor-Agonisten in Abhängigkeit von der Rezeptorbesetzung: Die Prozentzahlen an der waagrechten gestrichelten Linie entsprechen der prozentualen Rezeptorbesetzung durch die drei Agonisten, bei der die halbmaximale Wirkung von Phenylephrin beobachtet wird.
2.3.2 Quantitative Konzentrations- bzw. Dosis-Wirkungs-Kurven
2.3.2.1 Agonisten
Die Konzentrations/Dosis-Wirkungs-Kurve dient der Beschreibung einer Pharmakonwirkung. Das Ausmaß agonistischer Wirkungen wird meist in % der maximalen Wirkung des Pharmakons ausgedrückt ( ▶ Abb. 2.9a).
Die Bindung von Pharmaka an Rezeptorproteine kann direkt gemessen werden. Trotzdem ist es in der Regel die Art der Wirkung am isolierten Gewebe im Organbad (in vitro) oder im Gesamtorganismus (in vivo), an der Ärzte interessiert sind. Zur exakten Beschreibung einer Pharmakonwirkung dient die Konzentrations- bzw. Dosis-Wirkungs-Kurve. Auch wenn das Ausmaß agonistischer Wirkungen quantifizierbar ist, wird es meist in % der maximalen Wirkung des Pharmakons ausgedrückt und gegen den Logarithmus der Konzentration oder Dosis aufgetragen ( ▶ Abb. 2.9a). Es ergeben sich typischerweise S-förmige Kurven. Bei einer linearen Skala auf der Abszisse haben diese Kurven (wie die Bindungskurve in ▶ Abb. 2.6) die Form hyperbolischer Sättigungskurven.
Konzentrations-Wirkungs-Kurven
Abb. 2.9a Agonist: Die EC50 ist die effektive Konzentration, die eine halbmaximale Wirkung hervorruft. b Antagonist: Die IC50 ist die inhibitorische Konzentration, die eine halbmaximale Wirkung hervorruft.
Mithilfe von Konzentrations- bzw. Dosis-Wirkungs-Beziehungen lassen sich Wirksamkeit und Potenz agonistischer Pharmaka beschreiben und vergleichen.
Konzentrations- bzw. Dosis-Wirkungs-Beziehungen sind die wichtigste Grundlage für die Beschreibung der Wirkung eines Agonisten und für den Vergleich agonistischer Pharmaka in Bezug auf zwei pharmakodynamische Eigenschaften: Wirksamkeit und Potenz. Die Wirksamkeit ist auf der Ordinate der Konzentrations- bzw. Dosis-Wirkungs-Beziehung ablesbar, die Potenz auf der Abszisse.
Wirksamkeit
Synonym
Effektivität.
Definition
Die Wirksamkeit eines agonistischen Pharmakons bemisst sich am Maximum der absoluten Wirkung, die dieses Pharmakon hervorruft. Das Pharmakon hat eine hohe Wirksamkeit, wenn das Maximum seiner absoluten Wirkung weit entfernt ist vom Ordinatenursprung der Konzentrations- bzw. Dosis-Wirkungs-Kurve.
In vitro bestimmt v. a. die intrinsische Aktivität die maximale Pharmakonwirkung. In vivo entsteht die Wirkung meist aus vielen verschiedenen Effekten.
Bei In-vitro-Versuchen hängt das Maximum der Wirkung hauptsächlich von der intrinsischen Aktivität des Pharmakons, also auch von der Rezeptordichte im untersuchten Gewebe ab. Unter den weitaus komplexeren In-vivo-Bedingungen ist die beobachtete Wirksamkeit häufig das Integral vieler, zum Teil gegenläufiger Effekte.
Merke
Pharmaka, die sich im Maximum ihrer Wirkung nicht unterscheiden, sind äquieffektiv. Man spricht beim Vergleich verschiedener Pharmaka auch von äquieffektiven Dosierungen, wenn das Ausmaß der Wirkung dieser Dosierungen identisch ist.
Potenz
Synonym
Potency.
Definition
Die Potenz (häufig auch „Wirkstärke“ genannt) eines agonistischen Pharmakons bezeichnet den Konzentrations- oder Dosisbereich, in dem das Pharmakon wirkt. Je niedriger die Pharmakonkonzentration oder -dosis, die 50 % der maximalen Wirkung hervorruft (EC50 oder ED50; EC: effective concentration, ED: effective dose), umso höher ist die Potenz des Pharmakons.
Zur EC50 s. ▶ Abb. 2.9a, zur ED50 s. ▶ Abb. 2.10.
Die EC50 ( ▶ Abb. 2.9a) oder ED50 ( ▶ Abb. 2.10) ist deshalb ein Maß für die Potenz eines agonistischen Pharmakons. Die Potenz entspricht dem reziproken Wert der EC50 bzw. ED50:
Merke
Pharmaka, deren EC50- bzw. ED50-Werte identisch sind, werden als äquipotent bezeichnet. Ist der ED50-Wert eines Agonisten 1 geringer als der eines Agonisten 2, ist Agonist 1 potenter als Agonist 2 ( ▶ Abb. 2.10).
Der pD2-Wert dient der Quantifizierung der Potenz agonistischer Pharmaka und entspricht dem negativen dekadischen Logarithmus der ED50 bzw. EC50.
Ein in der experimentellen Pharmakologie gebräuchlicher Wert zur Quantifizierung der Potenz agonistischer Pharmaka ist der pD2-Wert. Dieser Wert entspricht dem negativen dekadischen Logarithmus der ED50 bzw. EC50. Er ist hoch bei hoher Potenz und niedrig bei niedriger Potenz. Für eine EC50 von 10– 10 mol/l ergibt sich ein pD2-Wert von 10 und für eine EC50 von 10– 5 mol/l ein pD2-Wert von 5.
Dosis-Wirkungs-Kurven zweier Agonisten mit unterschiedlicher Potenz
Abb. 2.10 Die ED50 ist die Pharmakondosis, die eine halbmaximale Wirkung hervorruft.
Merke
Für den Vergleich der Potenzen zweier agonistischer Pharmaka zieht man äquieffektive Konzentrationen/Dosierungen der beiden Pharmaka heran (z. B. die EC50-/ED50-Werte der beiden Pharmaka).
Die Potenz eines Agonisten und somit die EC50/ED50-Werte sind gewebe- bzw. organabhängig. Für volle Agonisten gilt meist: EC50 < KD. Es besteht eine „Rezeptorreserve“, d. h., dass die maximale Wirkung bereits auftritt, wenn nur ein Bruchteil der verfügbaren Rezeptoren besetzt ist (s. ▶ Abb. 2.8c). Partielle Agonisten besitzen keine Rezeptorreserve (s. ▶ Abb. 2.8c).
Die Potenz eines Agonisten hängt von seiner Affinität zum Rezeptor und von einigen anderen Faktoren ab, unter anderem auch von der Rezeptordichte im untersuchten Gewebe. Die EC50 bzw. ED50 ist also auch gewebe- bzw. organabhängig. In aller Regel besteht zwischen dem Ausmaß der Rezeptorbesetzung und der Intensität der Wirkung keine direkte Proportionalität. Der EC50-Wert (die Konzentration, bei der die Wirkung halbmaximal ist) entspricht also in der Regel nicht dem KD-Wert (die Konzentration, bei der 50 % der Rezeptoren besetzt sind). Für volle Agonisten gilt meist: EC50 < KD. Die Mechanismen, die Rezeptorbesetzung und Wirkung miteinander koppeln, können nämlich bei vollen Agonisten so effizient sein, dass beim Maximum der Wirkung nur ein Bruchteil der verfügbaren Rezeptoren besetzt ist (siehe Phenylephrin in ▶ Abb. 2.8c). Dieses Phänomen wird als Rezeptorreserve bezeichnet. Partielle Agonisten haben im Gegensatz zu vollen Agonisten keine Rezeptorreserve (siehe Oxymetazolin und Naphazolin in ▶ Abb. 2.8c).
In vivo herrscht am Rezeptor nicht die gleiche Konzentration des Pharmakons wie im Blutplasma.
Unter In-vivo-Bedingungen können neben der Rezeptordichte im untersuchten Gewebe noch viele andere Faktoren für Unterschiede zwischen EC50 und KD verantwortlich sein. So entsprechen z. B. die Pharmakonkonzentrationen im Blutplasma praktisch nie den Konzentrationen am Wirkort (Rezeptor).
2.3.2.2 Antagonisten
Die Konzentrations/Dosis-Wirkungs-Kurve für Antagonisten ist in ▶ Abb. 2.9b dargestellt. Auch bei Antagonisten unterscheidet man Wirksamkeit und Potenz.
Die Konzentrations- bzw. Dosis-Wirkungs-Kurve für eine antagonistische Wirkung wird auf ähnliche Weise erstellt, wie das für Agonisten in ▶ Abb. 2.7 illustriert ist. Um beim Beispiel eines Gefäßpräparats im Organbad zu bleiben: Ein durch einen α-Rezeptor-Agonisten kontrahiertes Gefäßfragment wird durch steigende Konzentrationen eines α-Rezeptor-Antagonisten zunehmend relaxiert. Es ergibt sich eine Konzentrations-Wirkungs-Beziehung, wie sie in ▶ Abb. 2.9b dargestellt ist. Auch bei Antagonisten unterscheidet man zwischen Wirksamkeit und Potenz.
Definition
Als Wirksamkeit (Effektivität) eines antagonistischen Pharmakons bezeichnet man das Ausmaß, in dem dieses Pharmakon die Aktivierung der Rezeptoren eines Gewebes reduzieren kann. Hemmt ein Antagonist 1 die Rezeptoraktivierung durch einen Agonisten in einem größeren Ausmaß als ein Antagonist 2, so hat Antagonist 1 eine höhere Wirksamkeit als Antagonist 2.
Die Potenz (potency) eines antagonistischen Pharmakons bezeichnet den Konzentrations- oder Dosisbereich, in dem dieses Pharmakon seine antagonistische Wirkung entfaltet. Je niedriger die Pharmakonkonzentration/-dosis, die 50 % der maximalen inhibitorischen Wirkung hervorruft (IC50/ID50; IC: inhibitory concentration, ID: inhibitory dose), umso höher ist die Potenz des Pharmakons.
Die IC50 ( ▶ Abb. 2.9b) oder ID50 beschreibt die Potenz eines Antagonisten.
Die IC50 ( ▶ Abb. 2.9b) oder ID50ist deshalb ein Maß für die Potenz eines antagonistisch wirkenden Pharmakons. Die Potenz entspricht dem reziproken Wert der IC50/ID50:
Ist die IC50/ID50 eines Antagonisten 1 niedriger als die eines Antagonisten 2, so hat Antagonist 1 eine höhere Potenz als Antagonist 2.
Antagonisten werden unterteilt in kompetitive, nicht-kompetitive und funktionelle Antagonisten.
Neben Wirksamkeit und Potenz interessieren bei Antagonisten weitere pharmakologische Eigenschaften. Man unterscheidet nämlich zwischen kompetitiven und nicht-kompetitiven Rezeptor-Antagonisten sowie funktionellen Antagonisten.
Kompetitive Rezeptor-Antagonisten
Reversible kompetitive Antagonisten konkurrieren mit Agonisten um die gleichen Rezeptor-Bindungsstellen. Die antagonistische Wirkung kann durch eine höhere Agonistenkonzentration wieder aufgehoben werden, es erfolgt eine Verschiebung der Konzentrations/Dosis-Wirkungs-Kurven für Agonisten parallel nach rechts, ohne Verminderung der maximalen Wirkung des Agonisten ( ▶ Abb. 2.11a). Beispiele für reversible kompetitive Antagonisten sind Prazosin, Propranolol, Atropin und Spironolacton.
Kompetitive Rezeptor-AntagonistenSie binden meist selektiv an einen bestimmten Typ von Rezeptor und verhindern die Bindung von Agonisten und die Aktivierung des Rezeptors. Man unterscheidet reversible und irreversible kompetitive Antagonisten:
Reversible kompetitive Antagonisten konkurrieren mit Agonisten um die gleiche Bindungsstelle am Rezeptor. Die Rezeptorbesetzung durch Agonisten und ihre Wirkung werden reduziert. Diese antagonistischen Wirkungen können aber durch Erhöhung der Agonistkonzentration wieder aufgehoben werden. Fixe Antagonistkonzentrationen verschieben die Konzentrations- bzw. Dosis-Wirkungs-Kurven für Agonisten parallel nach rechts, ohne die maximale Wirkung des Agonisten zu vermindern ( ▶ Abb. 2.11a). Das Ausmaß der Rechtsverschiebung hängt von der Affinität des Antagonisten zum Rezeptor ab und nimmt linear mit der Antagonistkonzentration zu. Aus dieser linearen Beziehung kann der KD-Wert (bei Antagonisten auch Ki-Wert genannt) berechnet werden. Der Ki-Wert und auch die IC50/ID50-Werte sind nicht gewebe- bzw. organabhängig. In der Literatur wird häufig der pA2-Wert angegeben; er entspricht dem negativen dekadischen Logarithmus der Antagonistkonzentration, die die Konzentrations-Wirkungs-Kurve für Agonisten um den Faktor 2 nach rechts verschiebt (entspricht dem negativen dekadischen Logarithmus von Ki). Beispiele für reversible kompetitive Antagonisten sind der α1-Rezeptor-Antagonist Prazosin, der β-Rezeptor-Antagonist Propranolol, der Muskarinrezeptor-Antagonist Atropin und der Aldosteronrezeptor-Antagonist Spironolacton.
▶ Partielle Agonisten sind immer auch kompetitive Antagonisten ( ▶ Abb. 2.12).
▶ Partielle Agonisten sind immer auch kompetitive Antagonisten. Die Konzentrations-Wirkungs-Kurve eines vollen Agonisten wird in Gegenwart einer fixen Konzentration eines partiellen Agonisten parallel nach rechts verschoben ( ▶ Abb. 2.12). Wie die Abbildung zeigt, gilt das nur für Wirkungen des vollen Agonisten, die über die Eigenwirkungen des partiellen Agonisten hinausgehen.
Einfluss von Antagonisten auf die Konzentrations-Wirkungs-Kurven eines Agonisten
Abb. 2.11a Reversibler kompetitiver Antagonist: In Anwesenheit eines Antagonisten verschieben sich die Konzentrations-Wirkungs-Kurven für einen Agonisten parallel nach rechts, d. h. es ist eine höhere Konzentration des Agonisten erforderlich, um die gleiche Wirkungsintensität zu erzielen. Das Maximum der Wirkung bleibt aber gleich. Das Ausmaß der Rechtsverschiebung ist von der Rezeptoraffinität des Antagonisten abhängig und nimmt linear mit dessen Konzentration zu.b Nicht-kompetitiver Antagonist: Je höher die Konzentration eines nicht-kompetitiven Antagonisten, desto geringer sind die Steigung der Konzentrations-Wirkungs-Kurve und das Maximum der Wirkung eines Agonisten. Durch Dosissteigerung des Agonisten kann die Wirkung des nicht-kompetitiven Antagonisten nicht wieder aufgehoben werden.
Kompetitiv-antagonistische Wirkung eines partiellen Agonisten
Abb. 2.12 Dargestellt sind die Konzentrations-Wirkungs-Kurve für einen vollen Agonisten (blau) und die Konzentrations-Wirkungs-Kurve für den gleichen Agonisten in Gegenwart einer fixen Konzentration eines partiellen Agonisten (rot). Der partielle Agonist hat in der untersuchten Konzentration eine agonistische Wirkung von etwa 25 % der maximalen Wirkung des vollen Agonisten. Seine antagonistische Wirkung tritt erst bei relativ hohen Konzentrationen des vollen Agonisten auf und zeigt sich in Form einer parallelen Rechtsverschiebung der roten Kurve.
Irreversible kompetitive Antagonisten binden kovalent an den Rezeptor, worauf dieser funktionell inaktiv wird. Bei niedrigen Konzentrationen verhält sich der gleiche Antagonist kompetitiv ( ▶ Abb. 2.11a) und bei hohen Konzentrationen nicht-kompetitiv ( ▶ Abb. 2.11b). Beispiel ist Phenoxybenzamin.
Irreversible kompetitive Antagonisten besitzen reaktive Gruppen und binden kovalent an das Rezeptorprotein. Kovalent modifizierte Rezeptoren sind funktionell inaktiv. Dieser Typ von Antagonist kann sich bei niedrigen Konzentrationen wie ein kompetitiver Antagonist ( ▶ Abb. 2.11a) und bei hohen Konzentrationen wie ein nicht-kompetitiver Antagonist ( ▶ Abb. 2.11b) verhalten. Die scheinbar kompetitive antagonistische Wirkung von niedrigen Konzentrationen solcher Stoffe wird bei einer großen Rezeptorreserve beobachtet. Unter diesen Bedingungen kann ein hoher Prozentsatz von Rezeptoren durch kovalente Modifikation inaktiviert sein, ohne dass das Maximum der Agonistwirkung reduziert wird. Typisches Beispiel ist der α-Rezeptor-Antagonist Phenoxybenzamin.
Klinischer Bezug
Es gibt zwei Indikationen für die Anwendung des irreversiblen α1- und α2-Rezeptor-Antagonisten Phenoxybenzamin: Zum einen wird er zur vorübergehenden Behandlung neurogener Störungen der Harnblasenentleerung angewendet (10 – 30 mg/d p. o.), um den α-Rezeptor-vermittelten Spasmus des Blasensphinkters zu durchbrechen. Zum anderen wird er prä- und intraoperativ beim Phäochromozytom (einem Tumor, der Katecholamine produziert und sezerniert) angewendet (2 × 20 – 40 mg/d p. o.), um Blutdruckkrisen vorzubeugen. Die Wirkungen von Phenoxybenzamin halten 2 – 3 Tage an, weil es der Neusynthese von α-Rezeptoren bedarf, um die Wirkung zu beenden. Ein Nachteil von Phenoxybenzamin ist, dass die Blutdrucksenkung mit einer starken Tachykardie einhergeht. Diese Tachykardie ist einerseits eine Barorezeptor-vermittelte Reflextachykardie und andererseits Folge der Unterbrechung des α2-Rezeptor-vermittelten Regelkreises der Noradrenalinfreisetzung (das stark vermehrt freigesetzte Noradrenalin trifft nämlich im Herzen auf β-Rezeptoren und ruft eine starke Tachykardie hervor).
Nicht-kompetitive Rezeptor-Antagonisten
beinträchtigen die Rezeptorfunktion auf allosterischem Wege oder
wirken über eine Hemmung der Signaltransduktion.
Ihre Wirkung kann nicht durch Erhöhung der Agonistkonzentration aufgehoben werden ( ▶ Abb. 2.11b). Beispiele sind Memantin und Ketamin, Ca2+-Kanalblocker oder ▶ Irbesartan und Telmisartan.
Nicht-kompetitive Rezeptor-Antagonisten
Sie binden an einer Stelle des Rezeptors, die nicht identisch ist mit dem Bindungsort für Agonisten und beeinträchtigen die Rezeptorfunktion auf allosterischem Wege.
Oder sie hemmen die Signaltransduktion oder noch weiter vom Rezeptor entfernte Schritte, die für die Agonistwirkung mitverantwortlich sind.
Diese Art von antagonistischen Wirkungen kann durch Erhöhung der Agonistkonzentration nicht wieder aufgehoben werden. Erstellt man nämlich Konzentrations-Wirkungs-Kurven für einen Agonisten in Gegenwart steigender Konzentrationen eines nicht-kompetitiven Antagonisten, so nehmen die Steigung der Kurve und das Maximum der Wirkung mit steigender Antagonistenkonzentration immer mehr ab ( ▶ Abb. 2.11b). Typische Beispiele sind ▶ Memantin und Ketamin, die den Ionenkanal des ▶ ionotropen NMDA-Rezeptors für Glutamat blockieren, Ca2+-Kanalblocker, die die blutdruckerhöhende Wirkung von Noradrenalin und Angiotensin II reduzieren sowie einige nicht-kompetitive AT1-Rezeptor-Antagonisten, z. B. ▶ Irbesartan, Telmisartan.
Funktionelle Antagonisten Sie beeinträchtigen über verschiedene Mechanismen die Wirkungen anderer Stoffe. Beispiele sind: ▶ Omeprazol antagonisiert die HCl-Sekretionssteigerung von Histamin; Histamin antagonisiert die Bronchodilatation von ▶ β2-Rezeptor-Agonisten; Ca2+-Kanalblocker antagonisieren die durch K+-Ionen ausgelöste Vasokontraktion.
Funktionelle Antagonisten Diese Stoffe rufen über verschiedene Mechanismen oder Rezeptoren Wirkungen hervor, die die anderer Wirkstoffe konterkarieren. So ist z. B. der Protonenpumpen-Inhibitor ▶ Omeprazol, der die HCl-Sekretion der Magenschleimhaut hemmt, ein funktioneller Antagonist von Histamin, das die HCl-Sekretion steigert. Der Bronchokonstriktor Histamin ist ein funktioneller Antagonist der ▶ β2-Rezeptor-Agonisten, die eine Bronchodilatation hervorrufen. Die vasodilatierend wirkenden Ca2+-Kanalblocker sind in glatten Gefäßmuskelzellen funktionelle Antagonisten von K+-Ionen, die Gefäßmuskelzellen kontrahieren, weil sie diese Zellen depolarisieren und durch Öffnung spannungsabhängiger Ca2+-Kanäle einen Einstrom von Ca2+ hervorrufen.
2.4 Qualitative Dosis-Wirkungs-Kurven
Da sich die Patienten bezüglich der Schwere der Erkrankung und der Empfindlichkeit gegenüber einer Arznei unterscheiden, ist die klinische Aussagekraft der quantitativen Dosis-Wirkungs-Kurven begrenzt. Für die Klinik besser geeignet ist die qualitative Dosis-Wirkungs-Kurve bzw. Dosis-Häufigkeits-Beziehung, die sich aus der benötigten Dosis für eine vorher festgelegte Wirkung ergibt.
Die klinische Relevanz quantitativer Dosis-Wirkungs-Kurven für den einzelnen Patienten ist häufig begrenzt. Das liegt vor allem an der meist großen Variabilität unter den Patienten in Bezug auf die Schwere der zu behandelnden Erkrankung und die Empfindlichkeit für erwünschte Arzneimittelwirkungen. Dieser Problematik kann Rechnung getragen werden, indem man die Dosis eines Arzneimittels zu finden versucht, die für eine vorher definierte Wirkung benötigt wird. Dabei handelt es sich um qualitative „Ja-oder-nein“-Effekte, wie z. B. die Verhinderung eines Ereignisses (Schlaganfall, Myokardinfarkt), die Verminderung der Schmerzintensität um 50 % oder die Unterdrückung der Abwehrreaktion auf einen standardisierten Schmerzreiz. Trägt man in der untersuchten Patientenpopulation die kumulative prozentuale Häufigkeit für das Auftreten von „Ja“-Antworten gegen den Logarithmus der Dosis auf, erhält man eine qualitative Dosis-Wirkungs-Kurve, die auch als Dosis-Häufigkeits-Beziehung bezeichnet werden kann. Je einheitlicher die untersuchte Patientenpopulation ist, desto steiler ist die qualitative Dosis-Wirkungs-Kurve.
Qualitative und quantitative Dosis-Wirkungs-Kurven sehen gleich aus, Erstere gibt jedoch Informationen zur Variabilität der Arzneimittelwirkung und Letztere lässt Aussagen über die Wirksamkeit und Potenz von Arzneimitteln zu.
Qualitative und quantitative Dosis-Wirkungs-Kurven sehen identisch aus. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass die Ordinate der qualitativen Dosis-Wirkungs-Kurve die kumulative Häufigkeit für das Auftreten einer Wirkung zeigt und dass die ED50 eine völlig andere Bedeutung hat. Sie entspricht nämlich der Dosis, bei der 50 % der untersuchten Patienten eine „Ja“-Antwort gegeben haben. Damit liegt der wichtigste Unterschied zwischen der qualitativen und der quantitativen Dosis-Wirkungs-Kurve in der Art der Information, die diese Kurven erbringen. Erstere gibt Informationen zur Variabilität der Arzneimittelwirkung, während Letztere Aussagen über die Wirksamkeit und Potenz von Arzneimitteln zulässt. Qualitative Dosis-Wirkungs-Kurven eignen sich für das Ausloten des Spielraums für die Sicherheit von Arzneimitteln.
Definition
Der Abstand der qualitativen Dosis-Wirkungs-Kurven für eine erwünschte und eine unerwünschte Arzneimittelwirkung auf der Abszisse stellt die therapeutische Breite dar. Sie entspricht dem Quotienten der ED50-Werte für die unerwünschte und die erwünschte Wirkung.
Ein Problem der Bestimmung der therapeutischen Breite ( ▶ Abb. 2.13) ist, dass die Dosis-Wirkungs-Kurven für erwünschte und (v. a. für schwere) unerwünschte Wirkungen häufig nicht parallel verlaufen. Deshalb ist die therapeutische Breite eines Pharmakons nur selten präzise bekannt. Bei der Einschätzung der therapeutischen Breite hilft die klinische Erfahrung mit dem jeweiligen Wirkstoff.
Diese Information ist z. B. in den Dosis-Wirkungs-Kurven der ▶ Abb. 2.13 enthalten, mit deren Hilfe die schmerzstillende und die atemdepressive Wirkung von Morphin in zwei Gruppen von Patienten untersucht wurde. Die Häufigkeit des Auftretens von bestimmten unerwünschten Wirkungen ist eine für die Klinik sehr wichtige Information. Ein





























