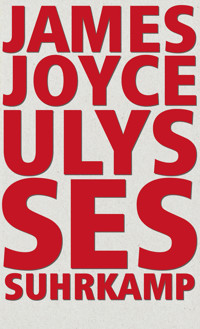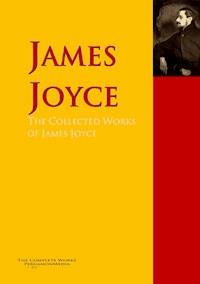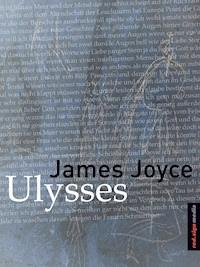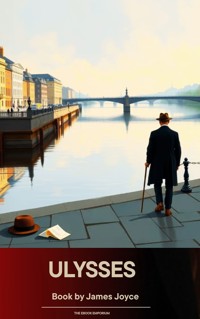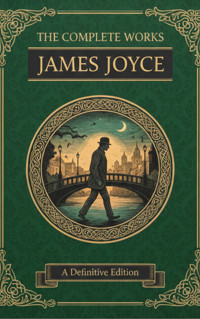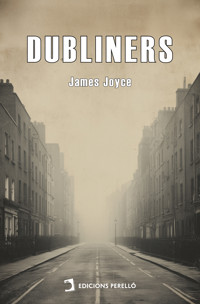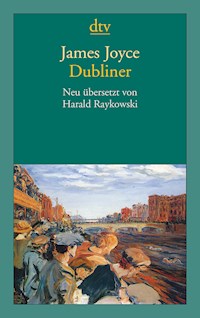
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fünfzehn Kurzgeschichten Die fünfzehn in diesem Band versammelten Kurzgeschichten sind das erste Prosawerk des weltberühmten Schriftstellers. Mit seinen realistisch-psychologischen Miniaturen wirft er einen kritischen, gleichwohl nie denunziatorischen Blick auf seine Heimatstadt Dublin. Die kleinen Meisterwerke bilden einen Episodenzyklus, der von der Beengtheit des Lebens und der Sehnsucht nach der großen weiten Welt zu Beginn des 20. Jahrhunderts erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
James Joyce
Dubliner
Neu übersetzt und mit einem Nachwort, Anmerkungen und einer Zeittafelvon Harald Raykowski
Deutscher Taschenbuch Verlag
Neuübersetzung 2012
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
© für die deutschsprachige Ausgabe:
Deutscher Taschenbuch Verlag, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital - die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
eBook ISBN 978-3-423-40978-0 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-14069-0
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website
www.dtv.de/ebooks
Die Schwestern
Eine Begegnung
Arabia
Eveline
Nach dem Rennen
Zwei feine Herren
Die Pension
Eine kleine Wolke
Gegenstücke
Erde
Ein trauriger Fall
Efeu-Tag im Sitzungszimmer
Eine Mutter
Gnade
Die Toten
Nachwort
Anmerkungen
Die Schwestern
Eine Begegnung
Arabia
Eveline
Nach dem Rennen
Zwei feine Herren
Die Pension
Eine kleine Wolke
Gegenstücke
Erde
Ein trauriger Fall
Efeu-Tag im Sitzungszimmer
Eine Mutter
Gnade
Die Toten
Zeittafel
Karten
[Informationen zum Buch]
[Informationen zum Autor]
DIE SCHWESTERN
Diesmal gab es für ihn keine Hoffnung mehr: Es war sein dritter Schlaganfall. Abend für Abend war ich an dem Haus vorbeigegangen (es war Ferienzeit) und hatte das erleuchtete Fensterviereck studiert; und Abend für Abend war es in derselben Weise erleuchtet, schwach und gleichmäßig. Wenn er tot wäre, dachte ich, würde ich den Widerschein von Kerzen auf dem dunklen Rouleau sehen, denn ich wusste, dass am Kopf eines Leichnams zwei Kerzen aufgestellt werden müssen. Er hatte oft zu mir gesagt: Ich bin nicht mehr lange von dieser Welt*, aber ich hatte das für leere Worte gehalten. Jetzt wusste ich, dass sie wahr waren. Jeden Abend, wenn ich zu dem Fenster hinaufsah, flüsterte ich das Wort Paralyse*vor mich hin. Es hatte in meinen Ohren stets sonderbar geklungen, so wie das Wort Gnomon*bei Euklid oder das Wort Simonie*im Katechismus. Aber jetzt hörte es sich für mich an wie der Name eines bösen* und sündhaften Wesens. Es erfüllte mich mit Furcht, und zugleich wünschte ich ihm, näherzukommen und sein tödliches Werk zu betrachten.
Der alte Cotter saß am Kamin und rauchte, als ich zum Abendessen herunterkam. Während meine Tante mir Haferbrei auf den Teller schöpfte, sagte er, so als knüpfe er an eine frühere Bemerkung an:
– Nein, ich würde nicht behaupten, dass er ... aber er hatte etwas Sonderbares ... er hatte etwas Unheimliches an sich. Ich will Ihnen sagen, was ich meine ...
Er begann mit seiner Pfeiffe zu paffen und dabei legte er sich zweifellos seine Meinung zurecht. Unausstehlicher alter Dummkopf! Als wir ihn erst kurze Zeit kannten und er von Schlempe und Kühlschlangen erzählte, fand ich ihn noch ganz interessant, aber bald hatte ich genug von ihm und seinen endlosen Geschichten von der Brennerei.
– Ich hab da meine eigene Theorie, sagte er. Ich denke, es war einer dieser ... eigenartigen Fälle ... Aber es ist schwer zu sagen ...
Er begann wieder an seiner Pfeife zu paffen, ohne uns seine Theorie zu verraten. Als mein Onkel sah, dass ich große Augen machte, sagte er zu mir:
– Tja, du wirst sicher traurig sein, aber dein alter Freund ist nicht mehr.
– Wer?, fragte ich.
– Father Flynn.
– Ist er tot?
– Mr Cotter hier hat es uns gerade erzählt. Er kam zufällig am Haus vorbei.
Ich wusste, dass ich genau beobachtet wurde, deshalb aß ich weiter, als interessierte mich die Nachricht nicht. Erklärend sagte mein Onkel zum alten Cotter:
– Der Junge und er waren dicke Freunde. Der Alte hat ihm nämlich eine Menge beigebracht, wissen Sie, und es heißt, er war sehr um ihn bemüht.
– Möge Gott seiner Seele gnädig sein, sagte meine Tante fromm.
Der alte Cotter sah mich eine Weile an. Ich spürte, dass seine stechenden schwarzen Augen mich musterten, aber ich wollte ihm den Gefallen nicht tun, von meinem Teller aufzusehen. Er wandte sich wieder seiner Pfeife zu und spuckte schließlich geringschätzig in den Kamin.
– Ich würde es nicht gerne sehen, sagte er, wenn meine Kinder sich zu viel mit so jemandem abgeben würden.
– Was meinen Sie damit, Mr Cotter?, fragte meine Tante.
– Ich meine damit, sagte der alte Cotter, dass es Kindern nicht guttut. Meiner Meinung nach sollte ein junger Bursche mit gleichaltrigen Burschen herumrennen und spielen, anstatt ... Hab ich nicht recht, Jack?
– Das ist auch mein Grundsatz, bestätigte mein Onkel. Er soll lernen, sich durchzuboxen. Das sage ich diesem Rosenkreuzer* da auch immer: Beweg dich! Als ich so jung war, habe ich jeden Morgen kalt gebadet, winters wie sommers. Das kommt mir jetzt noch zustatten. Bildung ist ja schön und gut ... Vielleicht möchte Mr Cotter etwas von der Hammelkeule, sagte er dann zu meiner Tante gewandt.
– Nein, nein, vielen Dank, sagte der alte Cotter.
Meine Tante holte die Platte aus dem Vorratsschrank und stellte sie auf den Tisch.
– Aber warum meinen Sie, dass es für Kinder nicht gut ist, Mr Cotter?, fragte sie.
– Es ist schlecht für sie, erklärte der alte Cotter, weil sie so leicht zu beeinflussen sind. Wenn Kinder so was sehen, wissen Sie, dann hat das Folgen ...
Ich stopfte mir den Mund mit Haferbrei voll, aus Angst, ich könnte vor Wut etwas sagen. Unausstehlicher rotnasiger alter Trottel!
Es war spät, als ich einschlief. Obwohl ich auf den alten Cotter wütend war, weil er von mir wie von einem Kind sprach, zerbrach ich mir meinen Kopf, um in seinen unvollendeten Sätzen eine Bedeutung zu finden. In der Dunkelheit meines Zimmers bildete ich mir ein, wieder das aufgedunsene, graue Gesicht des Paralytikers vor mir zu sehen. Ich zog mir die Decke über den Kopf und versuchte an Weihnachten zu denken. Aber das graue Gesicht verfolgte mich. Es murmelte, und ich begriff, dass es etwas beichten wollte. Ich fühlte, wie sich meine Seele in eine angenehme und böse Region zurückzog, und auch dort wartete es schon auf mich. Es begann, mir mit murmelnder Stimme zu beichten, und ich überlegte, warum es wohl andauernd lächelte und warum die Lippen so feucht von Speichel waren. Dann fiel mir ein, dass es an Paralyse gestorben war, und ich merkte, dass auch ich schwach lächelte, als wollte ich den Simonisten von seiner Sünde lossprechen.
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück ging ich hin, um mir das kleine Haus unten in der Great Britain Street anzusehen. Es war ein bescheidener Laden, der unter der verschwommenen Bezeichnung Tuchwaren geführt wurde. Die Tuchwaren bestanden hauptsächlich aus wollenen Kinderschühchen und Schirmen, und an gewöhnlichen Tagen hing immer ein Schild im Fenster mit der Aufschrift Neubespannung von Schirmen. Jetzt war kein Schild zu sehen, denn die Fensterläden waren angebracht. Ein Trauerbukett war mit Bändern am Türklopfer befestigt. Zwei arme Frauen und ein Telegrammbote lasen gerade die Karte, die an das Bukett geheftet war. Ich ging auch hin und las:
l. Juli 1895
Pfarrer James Flynn
(vormals S. Catherine’s Church, Meath Street),
im Alter von 65 Jahren.
R.I.P.
Das Lesen dieser Karte überzeugte mich davon, dass er tot war, und ich war verstört, weil ich mich damit zufriedengab. Wäre er nicht tot gewesen, wäre ich in das dunkle kleine Zimmer hinter dem Laden gegangen, wo ich ihn in seinem Sessel am Kaminfeuer gefunden hätte, halb versunken in seinem Überzieher. Vielleicht hätte mir meine Tante ein Päckchen High Toast für ihn mitgegeben, und dieses Geschenk hätte ihn aus seinem wie betäubten Dahindämmern aufgeweckt. Immer war ich es, der das Päckchen in seine schwarze Schnupftabaksdose entleerte, denn seine Hände zitterten zu sehr, um dies tun zu können, ohne die Hälfte des Schnupftabaks auf den Boden zu schütten. Selbst wenn er seine große zitternde Hand zur Nase hob, rieselten Wölkchen von Tabak zwischen seinen Fingern hindurch auf seinen Rock. Er war vielleicht dieser fortwährende Schnupftabaksregen, der seinem alten Priesterrock sein grünlich verschossenes Aussehen verlieh, denn das rote Taschentuch, immer geschwärzt von den Tabakflecken einer ganzen Woche, mit dem er die herabgefallenen Krümel wegzuwischen versuchte, war völlig wirkungslos.
Ich wäre gern hineingegangen, um ihn zu sehen, aber ich hatte nicht den Mut anzuklopfen. Langsam ging ich auf der sonnigen Seite der Straße davon und las im Vorbeigehen alle Theateranzeigen in den Schaufenstern. Ich fand es befremdlich, dass weder ich noch der Tag in Trauerstimmung waren, und ich war sogar verärgert, ein Gefühl der Freiheit in mir zu entdecken, als hätte mich sein Tod von etwas befreit. Ich grübelte darüber, denn er hatte mir, wie mein Onkel am Abend zuvor gesagt hatte, eine Menge beigebracht. Er hatte am Irischen Kolleg in Rom studiert und mir beigebracht, das Lateinische richtig auszusprechen. Er hatte mir Geschichten über die Katakomben und über Napoleon Bonaparte erzählt, er hatte mir die Bedeutung der verschiedenen Zeremonien während der Messe erklärt und die der verschiedenen Gewänder, die der Priester trägt. Manchmal hatte er sich einen Spaß daraus gemacht, mir schwierige Fragen zu stellen, zum Beispiel, wie man sich unter bestimmten Umständen zu verhalten habe oder ob es sich bei dieser oder jener Sünde um eine Todsünde oder eine lässliche Sünde oder nur um eine menschliche Verfehlung handele. Seine Fragen machten mir klar, wie komplex und geheimnisvoll gewisse kirchliche Bräuche waren, die ich bis dahin für ganz einfache Handlungen gehalten hatte. Die Pflichten des Priesters gegenüber der Eucharistie und gegenüber dem Beichtgeheimnis* erschienen mir so schwerwiegend, dass ich mich fragte, wie jemand den Mut aufbringen konnte, sie auf sich zu nehmen; und es überraschte mich nicht, als er mir sagte, die Kirchenväter hätten Bücher geschrieben, so dick wie das städtische Adressbuch und so eng gedruckt wie die Gerichtsmitteilungen in der Zeitung, in denen sie all diese verwickelten Fragen erörterten. Oftmals, wenn ich daran dachte, brachte ich entweder gar keine oder nur eine ganz dumme und zögernde Antwort zustande, worauf er für gewöhnlich lächelte und zwei- oder dreimal nickte. Manchmal ging er die Antworten in der Messe mit mir durch, die er mich hatte auswendig lernen lassen; und während ich sie hersagte, lächelte er versonnen und nickte, und von Zeit zu Zeit schob er eine riesige Prise Schnupftabak abwechselnd in jedes Nasenloch. Beim Lächeln entblößte er seine großen, verfärbten Zähne und ließ die Zunge auf der Unterlippe liegen – eine Angewohnheit, die mir Unbehagen bereitet hatte zu Beginn unserer Bekanntschaft, bis ich ihn näher kennenlernte.
Während ich im Sonnenschein dahinging, erinnerte ich mich an die Worte des alten Cotter, und ich versuchte mich zu erinnern, was in dem Traum sonst noch geschehen war. Ich erinnerte mich, dass mir lange Samtvorhänge aufgefallen waren und eine Hängelampe von altertümlichem Aussehen. Ich hatte das Gefühl, ich wäre sehr weit weg gewesen, in einem Land mit fremdartigen Bräuchen – in Persien, dachte ich. Aber an das Ende des Traums konnte ich mich nicht erinnern.
Am Abend nahm mich meine Tante mit zum Besuch im Trauerhaus. Es war nach Sonnenuntergang, aber die Fensterscheiben der Häuser, die nach Westen schauten, spiegelten das dunkle Gold einer großen Wolkenbank wider. Nannie empfing uns in der Diele, und da es unschicklich gewesen wäre, laut mit ihr zu reden, drückte meine Tante stellvertretend für alle ihr nur die Hand. Die alte Frau deutete fragend nach oben, und als meine Tante nickte, führte sie uns mühsam die enge Treppe hinauf, den Kopf fast bis auf die Höhe des Geländers heruntergebeugt. Auf dem ersten Treppenabsatz blieb sie stehen und winkte uns ermunternd zur offen stehenden Tür des Totenzimmers. Meine Tante ging hinein, und als die alte Frau sah, dass ich zögerte einzutreten, wiederholte sie ihre Handbewegung mehrmals.
Ich ging auf Zehenspitzen hinein. Das Zimmer war von dem Licht, das unter dem Spitzenbesatz des Rouleaus hereindrang, in dämmriges Gold getaucht, in dem sich die Kerzen wie blasse dünne Flammen ausnahmen. Er war in den Sarg gelegt worden. Wir folgten Nannies Beispiel, und zu dritt knieten wir am Fußende des Bettes nieder. Ich tat, als ob ich betete, aber ich konnte meine Gedanken nicht sammeln, da mich das Gemurmel der alten Frau ablenkte. Mir fiel auf, wie unordentlich ihr Rock hinten zugehakt war und wie abgetreten die Absätze ihrer Leinenstiefel auf einer Seite waren. Ich glaubte den alten Priester lächeln zu sehen, wie er da in seinem Sarg lag.
Aber nein. Als wir aufstanden und zum Kopfende des Bettes traten, sah ich, dass er nicht lächelte. Da lag er, feierlich und füllig, eingekleidet für den Altar, seine großen Hände hielten lose einen Kelch. Sein Gesicht war sehr grimmig, grau und massig, mit Nasenlöchern wie schwarze Höhlen und von einem spärlichen weißen Pelz eingesäumt. Es hing ein schwerer Duft in dem Raum – die Blumen.
Wir bekreuzigten uns und gingen. In dem kleinen Zimmer im Erdgeschoss fanden wir Eliza, die auf seinem Sessel thronte. Ich tastete mich zu meinem gewohnten Stuhl in der Ecke, während Nannie zum Büfett ging und eine Sherry-Karaffe und einige Weingläser hervorholte. Sie stellte sie auf den Tisch und lud uns ein, ein Gläschen zu trinken. Dann, auf Bitten ihrer Schwester, goss sie den Sherry in die Gläser und reichte sie herum. Sie drängte mich, auch ein paar Sahnecracker zu nehmen, aber ich lehnte ab, da ich dachte, beim Kauen zu viel Geräusch zu machen. Sie schien über meine Ablehnung ein wenig enttäuscht und ging still zum Sofa, wo sie hinter ihrer Schwester Platz nahm. Niemand sprach: Wir starrten alle in den leeren Kamin.
Meine Tante wartete, bis Eliza seufzte, und sagte dann:
– Ach ja, er ist in einer besseren Welt.
Eliza seufzte noch einmal und neigte ihren Kopf zustimmend. Meine Tante drehte den Stiel ihres Weinglases zwischen den Fingern, ehe sie ein wenig daran nippte.
– Ist er ... friedlich?, fragte sie.
– Oh, ganz friedlich, Ma’am, sagte Eliza. Man hat gar nicht gemerkt, wann er den letzten Atemzug getan hat. Es war ein schöner Tod, Gott sei gelobt.
– Und alles ...?
– Father O’Rourke war am Dienstag bei ihm und hat ihm die Letzte Ölung gespendet und ihn vorbereitet und alles.
– Er wusste also?
– Er war ganz gefasst.
– Er sieht ganz gefasst aus, sagte meine Tante.
– Das sagte die Frau auch, die da war, um ihn zu waschen. Sie sagte, er sähe so aus, als ob er nur schliefe, so friedlich und gefasst sähe er aus. Niemand hätte gedacht, dass er eine so schöne Leiche abgeben würde.
– Das ist wahr, sagte meine Tante.
Sie nippte ein wenig kräftiger an ihrem Glas und sagte:
– Nun, Miss Flynn, jedenfalls muss es ein großer Trost für Sie sein, zu wissen, das Sie alles für ihn getan hatten, was Sie konnten. Sie waren beide sehr gut zu ihm, das muss man sagen.
Eliza glättete ihr Kleid über ihren Knien.
– Ach, der arme James!, sagte sie. Gott weiß, dass wir alles getan haben, was wir konnten, so arm, wie wir sind – wir wollten es ihm an nichts fehlen lassen, solange er noch da war.
Nannie hatte den Kopf an das Sofakissen gelehnt und schien gleich einzuschlafen.
– Arme Nannie, sagte Eliza und sah sie an, sie ist ganz fertig. All die Mühen, die wir hatten, sie und ich, die Leichenwäscherin zu holen und ihn aufzubahren und dann den Sarg und dann die Messe in der Kapelle zu bestellen. Wenn Father O’Rourke nicht gewesen wäre, ich weiß nicht, was wir gemacht hätten. Er war’s, der uns all die Blumen und die zwei Kerzenleuchter da aus der Kapelle mitgebracht und die Anzeige für den Freeman’s General geschrieben und sich um die Papiere für den Friedhof gekümmert hat und um die Versicherung unseres armen James.
– War das nicht nett von ihm?, sagte meine Tante.
Eliza schloss die Augen und schüttelte langsam ihren Kopf.
– Ach, es geht eben nichts über alte Freunde, da kann man sagen, was man will, sagte sie. Auf die anderen ist kein Verlass.
– Da haben Sie Recht, sagte meine Tante. Und ich bin sicher, jetzt, wo er seinen ewigen Lohn erhält, wird er Sie nicht vergessen und alles, was Sie ihm Gutes getan haben.
– Ach, der arme James!, seufzte Eliza. Er war für uns keine große Last. Nie hat man im Haus mehr von ihm gehört als jetzt. Aber ich weiß, er ist von uns gegangen in den ...
– Wenn erst alles vorüber ist, wird er Ihnen fehlen, sagte meine Tante.
– Ich weiß schon, sagte Eliza. Ich werde ihm nie mehr seine Tasse Fleischbrühe hineintragen, und Sie, Ma’am, werden ihm keinen Schnupftabak mehr schicken. Ach, armer James!
Sie schwieg, als hielte sie Zwiesprache mit der Vergangenheit, und dann sagte sie listig:
– Ich muss sagen, in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass irgendwas Sonderbares an ihm war. Jedes Mal, wenn ich ihm seine Suppe brachte, lag sein Brevier auf dem Boden, und er weit zurückgelehnt in seinem Sessel und mit offenem Mund.
Sie legte einen Finger an die Nase und runzelte die Stirn. Dann fuhr sie fort:
– Und trotzdem hat er immer wieder gesagt, noch ehe der Sommer vorbei sei, würde er sich an einem schönen Tag aufmachen, um das alte Haus drunten in Irishtown wiederzusehen, wo wir alle geboren sind, und mich und Nannie würde er mitnehmen. Wenn wir doch mal eins von diesen neumodischen Fahrzeugen kriegten, die keinen Lärm machen, von denen ihm Father O’Rourke erzählt hat, mit rheumatischen Reifen*, billig für einen Tag – hat er gesagt, von Johnny Rush nebenan, und wir drei zusammen an einem Sonntagabend hinfahren könnten. Das hatte er sich in den Kopf gesetzt ... Armer James!
– Möge der Herr seiner Seele gnädig sein!, sagte meine Tante.
Eliza holte ihr Taschentuch hervor und wischte sich damit die Augen. Dann steckte sie es wieder in ihre Tasche und starrte eine Zeit lang auf die leere Feuerstelle, ohne ein Wort zu sprechen.
– Er war immer viel zu gewissenhaft, sagte sie. Die Pflichten des Priesteramts waren zu viel für ihn. Und dann wurde sein Leben ja sozusagen durchkreuzt.
– Ja, sagte meine Tante, er war ein enttäuschter Mann. Das hat man ihm angemerkt.
Ein Schweigen ergriff Besitz von dem kleinen Zimmer, und in seinem Schutz näherte ich mich dem Tisch, trank etwas von meinem Sherry und ging dann leise zu meinem Stuhl in der Ecke zurück. Eliza schien in tiefes Nachdenken versunken zu sein. Wir warteten höflich, dass sie das Schweigen bräche, und nach langer Zeit sagte sie langsam:
– Es war dieser Kelch, den er zerbrochen hat ... Damit fing es an. Natürlich, man sagt, es war nicht schlimm, es war ja nichts drin, meine ich. Aber trotzdem ... Man sagt, es war der Fehler des Jungen. Aber der arme James war ja so unsicher*, der Herr erbarme sich seiner!
– Ach, das war es also?, sagte meine Tante. Ich hörte etwas ...
Eliza nickte.
– Das hat sein Gemüt angegriffen, sagte sie. Von da an war er ganz trübselig, hat mit keinem mehr geredet und ist ganz allein herumgewandert. Eines Nachts sollte er einen Hausbesuch machen, aber er war nicht zu finden. In jeder Ecke und Ritze haben sie nach ihm gesucht, und nirgends konnten sie ihn entdecken. Da hat dann der Küster vorgeschlagen, in der Kapelle nachzusehen. Da haben sie die Schlüssel geholt und die Kapelle aufgeschlossen, und der Küster und Father O’Rourke und noch ein Priester, der gerade da war, nahmen eine Kerze und suchten nach ihm ... Und was soll ich Ihnen sagen: Da war er, allein im Finstern in seinem Beichtstuhl, hellwach und als ob er still in sich hineinlachte.
Sie brach unvermittelt ab, wie um zu lauschen. Auch ich lauschte, aber es gab kein Geräusch im Haus, und ich wusste, dass der alte Priester still in seinem Sarg lag, so wie wir ihn gesehen hatten, feierlich und grimmig im Tode, auf seiner Brust ein leerer Kelch.
Eliza fuhr fort:
– Hellwach und als ob er still in sich hineinlachte ... Und dann, natürlich, als sie das sahen, da sind sie auf den Gedanken gekommen, dass mit ihm irgendwas nicht mehr stimmte ...
EINE BEGEGNUNG
Es war Joe Dillon, der uns mit dem Wilden Westen bekannt machte. Er hatte eine kleine Bibliothek, die aus alten Ausgaben von The Union Jack, Pluck und The Halfpenny Marvel*bestand. Jeden Abend nach der Schule trafen wir uns bei ihm im Garten hinter dem Haus und trugen dort Indianerkämpfe aus. Er und sein dicker jüngerer Bruder Leo, der Faulenzer, verteidigten den Dachboden über dem Stall, während wir anderen ihn im Sturm zu erobern versuchten; oder wir lieferten uns eine heftige Schlacht auf dem Rasen. Aber so gut wir auch kämpften, wir gewannen niemals eine Belagerung oder eine Schlacht, und alle unsere Gefechte endeten mit Joe Dillons Kriegstanz des Siegers. Seine Eltern gingen an jedem Morgen zur Acht-Uhr-Messe in der Gardiner Street, und der friedliche Duft Mrs Dillons beherrschte die Diele des Hauses. Aber er spielte zu ruppig für uns, die jünger und ängstlicher waren. Er sah wirklich einem Indianer ähnlich, wenn er, auf dem Kopf einen alten Teewärmer, im Garten Bocksprünge vollführte, mit seiner Faust auf eine Blechdose einschlug und brüllte:
– Ya! yaka, yaka, yaka!
Keiner konnte es glauben, als berichtet wurde, er fühle sich zum Priester berufen. Doch es war wahr.
Ein Geist der Aufsässigkeit breitete sich unter uns aus, und unter seinem Einfluss wurden Unterschiede der Bildung oder des Temperaments ausgeblendet. Wir rotteten uns zusammen, manche aus Mut, manche aus Spaß und manche fast aus Furcht: Und von dieser letzteren Schar, den widerwilligen Indianern, die fürchteten, für streberhaft oder schwächlich gehalten zu werden, war ich einer. Die Abenteuer, die in der Literatur des Wilden Westens erzählt wurden, waren meinem Wesen sehr fremd, aber immerhin öffneten sie Tore zur Flucht. Mir gefielen manche amerikanischen Detektivgeschichten besser, in denen ab und zu verwilderte leidenschaftliche und schöne Mädchen umherstreiften. Obwohl an diesen Geschichten nichts auszusetzen war und obwohl sie zuweilen literarische Ansprüche erhoben, wurden sie in der Schule nur heimlich herumgereicht. Eines Tages, als Father Butler uns gerade vier Seiten römische Geschichte abfragte, wurde der unbeholfene Leo Dillon mit einem Heft des Halfpenny Marvel erwischt.
– Diese Seite oder diese? Diese? Also los, Dillon, steh auf! Kaum war der Tag ... Weiter! Welcher Tag? Kaum war der Tag angebrochen ... Hast du es gelernt? Was hast du da in der Tasche?
Jedem klopfte das Herz, als Leo Dillon das Heft herausgab, und jeder setzte eine Unschuldsmiene auf. Father Butler blätterte stirnrunzelnd.
– Was ist das für ein Schund?, fragte er. Der Häuptling der Apachen! Und so was liest du, anstatt deine römische Geschichte zu lernen! Lass mich nie wieder etwas von diesem erbärmlichen Zeug in diesem College* finden! Der Mann, der das geschrieben hat, ist wahrscheinlich irgendein erbärmlicher Schreiberling, der so etwas für ein Glas Bier hinschmiert. Ich muss mich wundern, dass Jungen wie ihr, gebildete Jungen, solchen Schund lesen. Ich könnte es verstehen, wenn ihr Schüler der ... der National School* wärt. Also, Dillon, ich rate dir eindringlich, mach dich an deine Arbeit, sonst ...
Diese Rüge während der nüchternen Schulstunden ließ viel vom Glorienschein des Wilden Westens für mich verblassen, und Leo Dillons verstörtes, pausbäckiges Gesicht weckte in mir eines von meinen Gewissen. Doch wenn die Schule mit ihrem zügelnden Einfluss etwas ferner war, setzte erneut der Hunger ein nach wilden Sensationen, nach Flucht, wie sie mir anscheinend nur diese Chroniken der Gesetzlosigkeit bieten konnten. Die Kriegsspiele am Abend wurden mir schließlich ebenso langweilig wie der eintönige Unterricht am Morgen, denn ich wollte wirkliche Abenteuer erleben. Aber wirkliche Abenteuer, überlegte ich mir, erlebt man nicht, wenn man zu Hause bleibt: Sie müssen draußen gesucht werden.
Die Sommerferien waren zum Greifen nahe, als ich beschloss, wenigstens einen Tag lang aus dem Einerlei des Schullebens auszubrechen. Mit Leo Dillon und einem Jungen namens Mahony plante ich, einen Tag zu schwänzen. Jeder von uns hatte sich Sixpence* angespart. Wir wollten uns um zehn Uhr morgens an der Canal Bridge treffen. Mahonys große Schwester sollte ihm eine Entschuldigung schreiben, und Leo Dillon sollte von seinem Bruder ausrichten lassen, er sei krank. Wir verabredeten, die Wharf Road hinunterzugehen bis zu den Schiffen, dort mit der Fähre überzusetzen und dann hinauszuwandern, um uns das Pigeon House* anzusehen. Leo Dillon hatte Angst, wir könnten Father Butler oder sonst jemandem aus dem College begegnen; doch Mahony fragte sehr vernünftigerweise, was Father Butler denn draußen am Pigeon House treiben sollte. Wir waren beruhigt: Und ich brachte den ersten Teil unserer Verschwörung zum Abschluss, indem ich von den anderen zwei die Sixpence einsammelte und ihnen gleichzeitig meine eigenen Sixpence zeigte. Als wir am Abend davor die letzten Vorbereitungen trafen, waren wir alle irgendwie aufgeregt. Wir schüttelten einander lachend die Hände, und Mahony sagte:
– Bis morgen, Kumpels!
In dieser Nacht schlief ich schlecht. Am Morgen war ich der Erste bei der Brücke, weil ich am nächsten wohnte. Ich versteckte meine Schulbücher im hohen Gras an der Abfallgrube hinten im Garten, wo nie jemand hinkam, und eilte am Kanalufer entlang. Es war ein lauer, sonniger Morgen in der ersten Juniwoche. Ich setzte mich auf das Brückengeländer, betrachtete wohlgefällig meine dünnen Leinenschuhe, die ich noch am Abend sorgfältig mit Pfeifenton geweißt hatte, und beobachtete die folgsamen Pferde, die eine mit Geschäftsleuten besetzte Trambahn die Steigung hinaufzogen. Alle Äste der hohen Bäume, die die Promenade säumten, wirkten fröhlich mit den kleinen hellgrünen Blättchen, und die Sonnenstrahlen fielen schräg durch sie hindurch auf das Wasser. Die Granitsteine der Brücke begannen sich zu erwärmen, und ich begann, den Takt einer Melodie, die mir im Kopf herumging, mit den flachen Händen darauf zu klopfen. Ich war sehr glücklich.
Als ich fünf oder zehn Minuten dort gesessen hatte, sah ich Mahonys grauen Anzug sich annähern. Er kam strahlend die Steigung herauf und schwang sich neben mich auf die Brüstung. Während wir warteten, zog er die Steinschleuder hervor, die aus seiner Innentasche ragte, und erklärte mir einige Verbesserungen, die er daran vorgenommen hatte. Als ich wissen wollte, warum er die Schleuder mitgebracht habe, antwortete er, er wolle sich mit den Vögeln mal eine tolle Nummer* machen. Mahony war mit seiner Wortwahl nicht zimperlich, und Father Butler hieß bei ihm der Bunsenbrenner. Wir warteten eine weitere Viertelstunde, aber noch immer war von Leo Dillon nichts zu sehen. Mahony sprang schließlich von der Brüstung und sagte:
– Komm! Ich wusste ja, dass der Fettsack sich drückt.
– Und seine Sixpence ...?, sagte ich.
– Die werden zur Strafe eingesackt!, beschloss Mahony. Umso besser für uns – ’n Shilling und ’n Sixpence statt ’n Shilling.
Wir gingen die North Strand Road entlang, bis wir zu den Vitriolwerken kamen, und bogen dort nach rechts in die Wharf Road ein. Mahony fing an, den Indianer zu spielen, sobald uns niemand mehr sehen konnte. Er jagte hinter einer Schar zerlumpter Mädchen her, seine nicht geladene Steinschleuder schwingend, und als zwei zerlumpte Jungen anfingen, aus Ritterlichkeit mit Steinen nach uns zu werfen, schlug er vor, wir sollten sie attackieren. Ich wandte ein, dass die Jungen noch zu klein seien, und so setzten wir unseren Weg fort, während der zerlumpte Trupp: Blauköpfe! Blauköpfe! hinter uns herschrie, da sie uns für Protestanten hielten, denn Mahony, der einen dunklen Teint hatte, trug das silberne Abzeichen eines Kricket-Klubs an seiner Mütze. Als wir das Smoothing Iron* erreichten, wollten wir Belagerung spielen, aber es war ein Reinfall, weil man dazu mindestens zu dritt sein muss. Wir rächten uns dafür an Leo Dillon, indem wir ihn einen Drückeberger nannten und darüber spekulierten, wie viele Hiebe er um drei Uhr von Mr Ryan bekommen würde.
Wir kamen dann in die Nähe des Flusses. Wir verbrachten eine lange Zeit damit, in den lauten, von hohen Steinmauern gesäumten Straßen herumzulaufen, verfolgten die Arbeit der Lastkräne und Maschinen und wurden öfter von den Fahrern ächzender Lastwagen angebrüllt, weil wir ihnen im Weg standen. Es war zwölf Uhr, als wir die Quays erreichten, und da die Arbeiter alle Mittagspause zu machen schienen, kauften wir uns zwei dicke Rosinenbrötchen und setzten uns auf irgendwelche Metallrohre am Flussufer, wo wir sie verzehrten. Wir genossen das Schauspiel des Dubliner Handels – die Lastkähne, die durch ihren gekräuselten, wolligen Rauch von Weitem zu sehen waren, die braune Fischereiflotte, die jenseits von Ringsend lag, das große weiße Segelschiff, das gerade am gegenüberliegenden Quay entladen wurde. Mahony sagte, es wäre doch allererste Sahne, auf einem dieser großen Schiffe durchzubrennen, und selbst ich, als ich die hohen Masten betrachtete, sah oder bildete mir ein, dass die Geographie, die man mir in der Schule in spärlichen Mengen verabreicht hatte, vor meinen Augen allmählich Gestalt annahm. Schule und Elternhaus schienen in weite Ferne zu rücken, und ihr Einfluss auf uns schien nachzulassen.
Wir bezahlten unser Fahrgeld und überquerten die Liffey auf der Fähre in Gesellschaft zweier Arbeiter und eines kleinen Juden mit einer Tasche. Wir waren ernsthaft bis hin zur Feierlichkeit, aber einmal während der kurzen Überfahrt trafen sich unsere Blicke, und wir mussten lachen. Als wir wieder an Land waren, sahen wir zu, wie die Ladung des stattlichen Dreimasters, den wir schon vom anderen Quay gesehen hatten, gelöscht wurde. Einer der Umstehenden sagte, es sei ein norwegisches Schiff. Ich lief zum Heck und versuchte, die Aufschrift zu entziffern, doch als mir das nicht gelang, kam ich zurück, um zu sehen, ob einer von den fremden Seeleuten grüne Augen hätte, denn mir spukte so etwas im Kopf herum ... Die Augen der Matrosen waren blau und grau und sogar schwarz. Der einzige Seemann, dessen Augen man hätte grün nennen können, war ein groß gewachsener Mann, der die Menge am Quay damit erheiterte, dass er jedes Mal, wenn die Planken fielen, fröhlich ausrief:
– Recht so! Recht so!
Als wir davon genug hatten, schlenderten wir nach Ringsend hinein. Der Tag war schwül geworden, und in den Schaufenstern der Lebensmittelläden lagen vor sich hin bleichend muffige Kekse. Wir kauften uns einige Kekse und etwas Schokolade, die wir nach und nach aufaßen, während wir durch die verdreckten Straßen wanderten, in denen die Familien der Fischer wohnen. Wir konnten keinen Milchhändler finden, und deshalb gingen wir in einen Krämerladen und jeder kaufte sich eine Flasche Himbeerlimonade. Nach dieser Erfrischung jagte Mahony eine Katze durch eine Gasse, aber sie entwischte in ein großes Feld. Wir waren beide ziemlich müde, und sobald wir das Feld erreichten, steuerten wir auf eine Böschung zu, von deren Kamm aus wir den Dodder sehen konnten.
Es war zu spät und wir waren zu müde, um unseren Plan, das Pigeon House zu besuchen, noch auszuführen. Wir mussten vor vier Uhr zu Hause sein, damit unser Abenteuer nicht entdeckt würde. Mahony betrachtete enttäuscht seine Steinschleuder, und erst als ich vorschlug, auf dem Heimweg den Zug zu nehmen, wurde seine Stimmung etwas besser. Die Sonne verschwand hinter einigen Wolken und überließ uns unseren verdrießlichen Gedanken und den Krümeln unseres Proviants.
Außer uns war niemand auf dem Feld. Nachdem wir eine Zeit lang ohne zu sprechen auf der Böschung gelegen hatten, sah ich einen Mann vom anderen Ende des Feldes näherkommen. Ich beobachtete ihn träge, während ich an einem dieser grünen Stängel kaute, mit denen Mädchen die Zukunft voraussagen. Er kam an der Böschung entlang, ganz langsam. Er ging, die eine Hand in die Hüfte gestemmt, und hielt in der anderen einen Stock, mit dem er leicht auf den Boden klopfte. Er war schäbig gekleidet mit einem grünlich-schwarzen Anzug, und er trug einen hohen steifen Hut von der Sorte, die wir »Koks« nannten. Er schien ziemlich alt, denn sein Schnurrbart war aschgrau. Als er vor unseren Füßen vorüberging, streifte er uns mit einem flüchtigen Blick und setzte dann seinen Weg fort. Wir folgten ihm mit unseren Augen und sahen, dass er sich nach etwa fünfzig Schritten umwandte und denselben Weg zurückschritt. Er kam sehr langsam auf uns zu, wobei er fortwährend mit seinem Stock auf den Boden klopfte, so langsam, dass ich dachte, er suche etwas im Gras.
Er blieb stehen, als er auf unserer Höhe war, und wünschte uns Guten Tag. Wir erwiderten den Gruß, und er setzte sich zu uns auf die Böschung, langsam und sehr bedächtig. Er fing an, vom Wetter zu reden, und sagte, es werde einen sehr heißen Sommer geben, und er fügte hinzu, die Jahreszeiten hätten sich sehr geändert, seit er ein Junge gewesen sei – vor langer Zeit. Er sagte, die glücklichste Zeit im Leben sei zweifellos die Schulzeit, und er gäbe alles dafür, wieder jung zu sein. Während er diese sentimentalen Gedanken äußerte, die uns ein wenig langweilten, schwiegen wir. Dann fing er an, über die Schule und über Bücher zu reden. Er fragte uns, ob wir die Gedichte von Thomas Moore und die Werke von Sir Walter Scott und Lord Lytton* gelesen hätten. Ich tat so, als hätte ich jedes Buch gelesen, das er erwähnte, sodass er schließlich sagte:
– Ah, ich merke, du bist genauso ein Bücherwurm wie ich. Aber, und dabei deutete er auf Mahony, der uns mit großen Augen ansah, der ist anders; der macht sich mehr aus Spielen.
Er sagte, er habe sämtliche Werke von Sir Walter Scott und sämtliche Werke von Lord Lytton zu Hause und werde nie müde, darin zu lesen. Allerdings, sagte er, gebe es gewisse Werke von Lord Lytton, die Jungen nicht lesen sollten. Mahony fragte, warum Jungen sie denn nicht lesen sollten – eine Frage, die mich schmerzlich und peinlich berührte, weil ich befürchtete, der Mann könnte mich für genauso dumm halten wie Mahony. Der Mann lächelte aber nur. Ich sah, dass in seinem Mund große Lücken zwischen seinen gelben Zähnen klafften. Dann fragte er uns, wer von uns die meisten Liebchen habe. Mahony gab locker an, er habe drei Schnepfen. Der Mann fragte mich, wie viele ich hätte. Keine, erwiderte ich. Er glaubte mir nicht und sagte, eine hätte ich doch bestimmt. Ich blieb still.
– Sagen Sie mal, sagte Mahony frech zu dem Mann, wie viele haben Sie denn selbst?
Der Mann lächelte wie zuvor und sagte, in unserem Alter habe er eine Menge Liebchen gehabt.
– Jeder Junge, sagte er, hat ein kleines Liebchen.
Seine Einstellung in diesem Punkt kam mir für einen Mann seines Alters sonderbar freizügig vor. Im meinem Innersten fand ich das, was er über Jungen und Liebchen sagte, ganz vernünftig. Aber aus seinem Mund kommend widerstrebten mir die Worte, und ich fragte mich, warum er ein- oder zweimal erschauerte, als ob er vor etwas Angst hätte oder es ihn plötzlich fröstelte. Als er weiterredete, fiel mir seine gehobene Aussprache auf. Er fing an, über Mädchen zu sprechen, und sagte, dass sie so schönes, weiches Haar und so zarte Hände hätten, dass sie aber nicht alle so brav seien, wie sie täten – wenn man’s ihnen nur ansähe. Es gebe für ihn nichts, sagte er, das schöner sei, als ein hübsches junges Mädchen zu betrachten, seine weißen Hände und sein schönes, weiches Haar. Es kam mir so vor, als ob er etwas wiederholte, das er auswendig gelernt hatte, oder als drehten sich seine Gedanken, magnetisiert von etwas in seinen eigenen Worten, wieder und wieder langsam in derselben Kreisbahn. Zuweilen sprach er so, als beziehe er sich bloß auf eine allgemein bekannte Tatsache, und mitunter senkte er seine Stimme und sprach geheimnisvoll, als ob er uns etwas anvertrauen wollte, das sonst niemand erfahren durfte. Er wiederholte seine Sätze immer und immer wieder, wandelte sie ab und umgab sie mit seiner monotonen Stimme. Ich starrte weiter zum Fuße der Böschung hinunter, während ich ihm zuhörte.
Nach einer langen Zeit brach sein Monolog ab. Er stand langsam auf und sagte, er müsse uns mal für eine Minute oder so, für wenige Minuten, verlassen, und ohne meine Blickrichtung zu ändern, sah ich, wie er sich langsam entfernte und zum nahe gelegenen Rand des Feldes ging. Wir schwiegen, nachdem er fortgegangen war. Nach einigen Minuten des Schweigens hörte ich, wie Mahony ausrief:
– He! Sieh doch mal, was der da macht!
Als ich weder antwortete noch meine Augen hob, rief Mahony noch einmal:
– He! ... Das ist vielleicht ein komischer Heiliger!
– Falls er nach unseren Namen fragt, sagte ich, dann bist du einfach Murphy, und ich bin Smith.
Mehr sprachen wir nicht miteinander. Ich überlegte noch, ob ich weggehen sollte oder nicht, als der Mann zurückkam und sich wieder zu uns setzte. Kaum hatte er sich gesetzt, da sprang Mahony auf, der die Katze entdeckt hatte, die ihm entwischt war, und verfolgte sie quer über das Feld. Der Mann und ich beobachteten die Jagd. Die Katze entwischte wieder, und Mahony fing an, die Mauer mit Steinen zu bewerfen, die sie erklommen hatte. Als er davon abgelassen hatte, begann er, am entfernten Ende des Feldes ziellos umherzustreifen.
Nach einer Weile sprach der Mann mich an. Er sagte, mein Freund sei ein sehr grober Junge, und fragte, ob er in der Schule oft den Stock bekäme. Ich wollte schon empört entgegnen, wir gingen doch nicht auf eine National School, wo man den Stock bekommt*, wie er das nannte; aber ich schwieg. Er fing an, sich über die Züchtigung von Jungen auszulassen. Seine Gedanken schienen, abermals wie magnetisiert von seinen Worten, wieder und wieder langsam um diesen neuen Mittelpunkt zu kreisen. Er sagte, dass Jungen dieser Art Prügel verdienten, und zwar richtige Prügel. Bei einem Jungen, der rüpelhaft und ungezogen sei, helfe nur eine gute, saftige Tracht Prügel. Ein Klaps auf die Finger oder eine Ohrfeige würden da nichts ausrichten: So einer brauche einfach eine schöne, derbe Portion Prügel. Ich war erstaunt über derartige Ansichten und sah unwillkürlich zu seinem Gesicht auf. Als ich das tat, traf mich ein stechender Blick aus einem Paar flaschengrüner Augen, die mich unter einer zuckenden Stirn hervor anstarrten. Ich wandte meine Augen wieder ab.
Der Mann setzte seinen Monolog fort. Er schien seine eben noch so freizügige Einstellung vergessen zu haben. Er sagte, dass er einen Jungen, falls er ihn je dabei erwischte, mit Mädchen zu reden oder ein Mädchen als Liebchen zu haben, windelweich prügeln würde; und das würde ihn lehren, nicht mehr mit Mädchen zu reden. Und wenn ein Junge ein Mädchen als Liebchen habe und Lügen darüber erzähle, dann bekäme der von ihm Prügel über Prügel, wie sie noch kein Junge auf dieser Welt bekommen habe. Er sagte, dass es nichts auf dieser Welt gäbe, was er so gerne tun würde. Er beschrieb mir, wie er einen solchen Jungen durchprügeln wolle, so als ob er ein schwer zu ergründendes Mysterium enthüllen würde. Er würde so etwas lieben, sagte er, mehr als alles andere auf dieser Welt; und während er mich monoton durch dieses Mysterium geleitete, nahm seine Stimme fast einen zärtlichen Ton an und schien mich flehentlich zu bitten, ihn doch zu verstehen.
Ich wartete, bis sein Monolog wieder abbrach. Dann stand ich abrupt auf. Um nicht zu zeigen, wie aufgeregt ich war, blieb ich noch einen Augenblick und tat so, als bände ich meinen Schuh fester; und dann erklärte ich, ich müsse nun aufbrechen, und verabschiedete mich. Ich stieg die Böschung ohne Hast hinauf, aber mein Herz schlug heftig, vor Angst, der Mann könnte mich an den Fußgelenken packen. Als ich oben auf der Böschung angekommen war, drehte ich mich um, und ohne nach ihm zu schauen, rief ich laut über das Feld:
– Murphy!
Meine Stimme hatte einen Ton erzwungener Tapferkeit, und ich schämte mich meiner läppischen Kriegslist. Ich musste den Namen noch einmal rufen, bevor Mahony mich entdeckte und mir mit Hallo-Rufen Antwort gab. Wie mein Herz schlug, als er über das Feld auf mich zu rannte! Er rannte, als wollte er mir zu Hilfe kommen. Und ich war reumütig, denn in meinem Herzen hatte ich ihn immer ein wenig verachtet.
ARABIA
North Richmond Street, eine Sackgasse, war eine stille Straße, ausgenommen zu der Stunde, wenn die Schule der Christian Brothers* die Jungen in die Freiheit entließ. Ein unbewohntes zweistöckiges Haus stand am Ende der Sackgasse, etwas abseits von seinen Nachbarn, auf einem quadratischen Grundstück. Die anderen Häuser waren sich des gutbürgerlichen Lebens in ihrem Innern bewusst und sahen einander gleichmütig mit braunen Gesichtern an.
Der frühere Mieter unseres Hauses, ein Priester, war in dem nach hinten gelegenen Wohnzimmer gestorben. Überall hing Modergeruch, da die Luft in allen Zimmern lange eingesperrt gewesen war, und in der Rumpelkammer hinter der Küche lag allerhand altes Papier umher. Dort fand ich einige kartonierte Bücher, deren Seiten gewellt und feucht waren: Der Abt von Walter Scott, Das fromme Kommunionkind und Die Memoiren des Monsieur Vidocq.* Das Letztere gefiel mir am besten, weil seine Seiten vergilbt waren. In der Mitte des verwilderten Gartens hinter dem Haus stand ein Apfelbaum, und unter einem der ausladenden Büsche fand ich die verrostete Fahrradpumpe des verstorbenen Mieters. Er war ein sehr wohltätiger Priester gewesen; in seinem Testament hatte er sein Geld verschiedenen Heimen vermacht und seiner Schwester die Hauseinrichtung.
Als die Wintertage kürzer wurden, war es schon dämmrig, bevor wir unser Abendessen beendet hatten. Wenn wir uns dann auf der Straße trafen, standen die Häuser düster da. Das Stück Himmel über uns nahm immer neue Tönungen von Violett an, und ihm reckten sich die kraftlosen Straßenlaternen entgegen. Die Kälte war beißend, und wir spielten, bis unsere Körper über und über glühten. Unsere Rufe hallten in der stillen Straße wider. Im Verlauf unseres Spiels gelangten wir über die dunklen, aufgeweichten Pfade hinter den Häusern, wo uns die wilden Banden aus den ärmlichen Hütten zusetzten, zu den Gattern am hinteren Ende der dunklen, feucht tropfenden Gärten, wo Gestank aus den Abfallgruben aufstieg, und zu den stinkenden Ställen, wo ein Kutscher sein Pferd striegelte und kämmte oder die Schnallen am Zaumzeug melodisch klirren ließ. Wenn wir in die Straße zurückkamen, erfüllte das Licht aus den Küchenfenstern die Luftschächte vor dem Souterrain. Wenn jemand meinen Onkel um die Ecke kommen sah, versteckten wir uns im Schatten, bis wir ihn sicher im Haus wussten. Oder wenn Mangans Schwester auf der Türschwelle erschien, um ihren Bruder zum Essen zu rufen, dann beobachteten wir aus dem Schatten, wie sie die Straße hinauf- und hinunterspähte. Wir warteten ab, ob sie stehen blieb oder wieder hineinging, und wenn sie blieb, kamen wir aus dem Schatten hervor und gingen schicksalsergeben hinüber zu Mangans Haustür. Sie wartete auf uns, und gegen das Licht aus der halb geöffneten Tür sah man den Umriss ihrer Figur. Ihr Bruder neckte sie immer ein wenig, bevor er ihr folgte, und ich stand am Gitterzaun vor dem Haus und sah sie an. Ihr Kleid folgte den Bewegungen ihres Körpers, und ihr weicher Zopf schwang hin und her.
Jeden Morgen lag ich auf dem Boden des vorderen Wohnzimmers und beobachtete ihre Tür. Die Jalousie war bis auf einen zwei Finger breiten Spalt über dem Fenstersims heruntergezogen, sodass man mich nicht sehen konnte. Wenn sie aus der Tür trat, machte mein Herz einen Sprung. Ich eilte in die Diele, griff meine Schulbücher und folgte ihr. Ich behielt ihre braune Gestalt fest im Auge, und wenn wir uns der Stelle näherten, an der sich unsere Wege trennten, beschleunigte ich meine Schritte und überholte sie. Das wiederholte sich Morgen für Morgen. Ich hatte nie mit ihr gesprochen, abgesehen von ein paar beiläufigen Worten, und doch wirkte ihr Name wie eine gebieterische Einladung an all mein törichtes Blut.
Ihr Bild begleitete mich sogar an Orte, die jeder Romantik zutiefst feind sind. An Samstagabenden, wenn meine Tante auf den Markt ging, musste ich mitkommen und einige der Pakete tragen. Wir gingen durch die flackernden Straßen, angerempelt von betrunkenen Männern und feilschenden Frauen, umgeben vom Fluchen von Arbeitern, den schrillen Litaneien von Ladenjungen, die bei Fässern mit Schweinebacken Wache hielten, dem näselnden Singsang von Straßensängern, die die Moritat von O’Donovan Rossa* vortrugen oder eine Ballade über das Leid unserer Heimat*. Diese Geräusche verschmolzen in mir zu einem einzigen Lebensgefühl: Ich stellte mir vor, meinen Kelch sicher durch eine Horde von Feinden zu tragen. Mitunter kam mir ihr Name in sonderbaren Gebeten und Hymnen, die ich selbst nicht verstand, auf die Lippen. Oft füllten sich meine Augen mit Tränen (warum, wusste ich nicht), und manchmal war es, als ob sich eine Flut aus meinem Herzen in meine Brust ergoss. Ich dachte selten an die Zukunft. Ich wusste nicht, ob ich je mit ihr sprechen würde, und wenn doch, wie ich ihr meine wirre Anbetung offenbaren sollte. Aber mein Körper war wie eine Harfe, und ihre Worte und Gesten waren wie Finger, die über die Saiten glitten.
Eines Abends ging ich in das hintere Wohnzimmer, in dem der Priester gestorben war. Es war ein dunkler, regnerischer Abend, und im Haus regte sich nichts. Durch eine der zerbrochenen Fensterscheiben hörte ich, wie der Regen auf die Erde schlug und die Wassernadeln unablässig in den aufgeweichten Rabatten tanzten. Eine ferne Lampe oder ein erleuchtetes Fenster schimmerte irgendwo unter mir. Ich war dankbar, dass ich nicht viel sehen konnte. Meine Sinne schienen sich in Schleier hüllen zu wollen, und als ich spürte, wie ich ihnen entglitt, presste ich meine Handflächen aneinander, bis sie zitterten, und murmelte immer wieder: O Liebste, o Liebste! Viele Male.
Schließlich sprach sie mich an. Als sie die ersten Worte an mich richtete, war ich so verwirrt, dass ich nicht wusste, was ich antworten sollte. Sie fragte mich, ob ich zum »Arabia« ginge. Ich weiß nicht mehr, ob ich Ja oder Nein antwortete. Es werde gewiss ein schöner Basar, sagte sie; sie würde zu gerne hingehen.
– Und warum kannst du nicht?, fragte ich.
Während sie sprach, drehte sie einen silbernen Armreif unablässig um ihr Handgelenk. Sie könne nicht gehen, sagte sie, weil in dieser Woche in ihrer Klosterschule Exerzitien* stattfänden. Ihr Bruder und zwei andere Jungen balgten sich um ihre Mützen, und ich stand allein am Gitterzaun. Sie hielt sich an einer der spitzen Stangen und beugte ihren Kopf zu mir. Der Lichtschein der Laterne gegenüber unserer Haustür floss über ihren gewölbten weißen Hals, ließ ihr Haar hell schimmern, das sich an den Hals schmiegte, und fiel hell auf die Hand am Gitterzaun. Er floss über die eine Seite ihres Kleides und ließ den Saum ihres Unterrocks hell schimmern, der ein wenig hervorsah, während sie so unbefangen dastand.
– Du hast es leicht, sagte sie.
– Wenn ich hingehe, sagte ich, bring ich dir etwas mit.
Welche unzähligen Torheiten besetzten von diesem Abend an meine Gedanken im Wachen und im Schlaf! Am liebsten hätte ich die dazwischen liegenden öden Tage ausgelöscht. Ich sträubte mich gegen die Schularbeiten. Nachts in meinem Schlafzimmer und tags im Klassenzimmer schob sich ihr Bild zwischen mich und die Seite, die ich zu lesen versuchte. Ich vernahm die Silben des Wortes Arabia durch die Stille hindurch, in der meine Seele schwelgte, und erlag seinem orientalischen Zauber. Ich bat um Erlaubnis, am Samstagabend den Basar besuchen zu dürfen. Meine Tante war überrascht und hoffte, es handle sich nicht um eine freimaurerische Veranstaltung. Im Unterricht beantwortete ich selten eine Frage. Ich beobachtete, wie sich die Freundlichkeit im Gesicht meines Lehrers in Strenge verwandelte; er hoffte, dass ich nicht anfing zu faulenzen. Es gelang mir nicht, meine schweifenden Gedanken zusammenzuhalten. Ich hatte nur noch wenig Geduld mit der ernsten Arbeit des Lebens, die mir jetzt, da sie zwischen mir und meinem Verlangen stand, als eine Kinderei erschien, eine abstoßende, eintönige Kinderei.
Am Samstagmorgen erinnerte ich meinen Onkel daran, dass ich am Abend zum Basar gehen wollte. Er war am Garderobenständer beschäftigt, wo er nach einer Hutbürste suchte, und sagte nur kurz:
– Ja, Junge, ich weiß.
Da er sich in der Diele befand, konnte ich nicht in das vordere Wohnzimmer gehen und mich ans Fenster legen. Ich verließ das Haus schlecht gelaunt und ging langsam zur Schule. Die Luft war unbarmherzig kalt, und jetzt schon ließ mein Herz mich Böses ahnen.
Als ich zum Abendessen nach Hause kam, war mein Onkel noch nicht da. Noch war es früh. Eine Zeit lang saß ich da und starrte die Uhr an, und als ihr Ticken mir auf die Nerven ging, verließ ich das Zimmer. Ich stieg die Treppe hinauf, bis ich den oberen Teil des Hauses erreichte. In den hohen, kalten, leeren, düsteren Räumen fühlte ich mich befreit, und singend ging ich von Zimmer zu Zimmer. Vom vorderen Fenster aus sah ich meine Kameraden unten auf der Straße spielen. Ihre Rufe erreichten mich nur gedämpft und undeutlich, und während ich meine Stirn an die kalte Scheibe lehnte, sah ich hinüber zu dem dunklen Haus, in dem sie wohnte. So stand ich vielleicht eine Stunde lang und sah nichts, außer ihrer braun gekleideten Gestalt, wie meine Phantasie sie zeichnete, vom Schein der Straßenlampe zart am gewölbten Hals berührt, an der Hand, die sich am Gitterzaun festhielt, und an dem Saum unter ihrem Kleid.