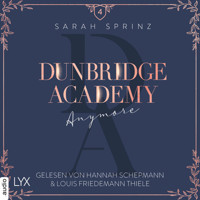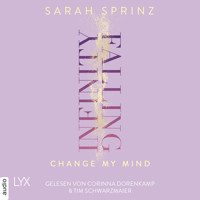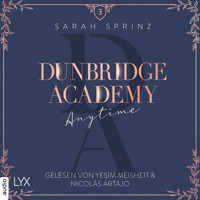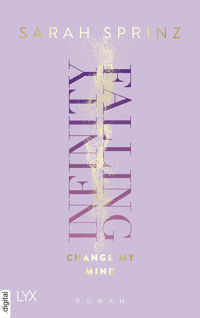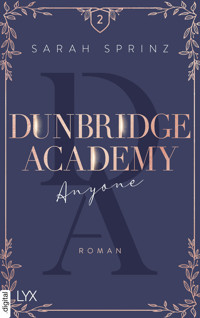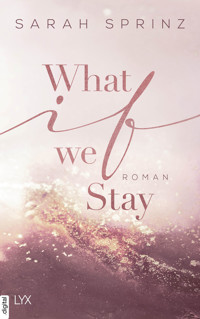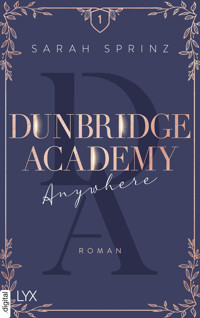
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dunbridge Academy
- Sprache: Deutsch
Er könnte überall sein, aber er ist hier bei mir ...
Sich zu verlieben, das stand nicht auf Emmas Agenda, als sie für ein Auslandsjahr an der schottischen DUNBRIDGE ACADEMY angenommen wird - dem Internat, an dem sich ihre Eltern kennengelernt haben. Hier will sie Hinweise auf ihren Vater finden, der die Familie vor Jahren verlassen hat. Ablenkung von ihrem Plan kann sie dabei nicht gebrauchen, aber als sie Schulsprecher Henry trifft, weiß Emma sofort, dass sie ein Problem hat. Während geheimer Mitternachtspartys und nächtlicher Spaziergänge durch die alten Gemäuer der Schule wachsen Gefühle zwischen ihnen, gegen die Emma schon bald machtlos ist. Doch Henry hat eine Freundin und Emma kein Bedürfnis, sich das Herz brechen zu lassen ...
"Ich bin hoffnungslos verliebt - in die DUNBRIDGE ACADEMY, aber vor allem in Emma und Henry. Ihre Geschichte ist berührend, echt und geht einem so nah, als wäre man ein Teil ihrer Welt." LENA KIEFER, SPIEGEL-Bestseller-Autorin
Auftaktband der DUNBRIDGE-ACADEMY-Reihe von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Sarah Sprinz
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Playlist
Irgendwohin
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Epilog
Danke
Die Autorin
Die Romane von Sarah Sprinz bei LYX
Impressum
Sarah Sprinz
Dunbridge Academy
ANYWHERE
Roman
ZU DIESEM BUCH
Als Emma für ein Austauschjahr an die Dunbridge Academy nach Schottland kommt, hat sie nur ein Ziel: ihren Vater aufzuspüren. Hinweise für ihre Suche hofft sie in ihrer neuen Schule zu finden – dem Internat, an dem sich ihre Eltern damals kennengelernt haben. Schon auf ihrem Weg nach Edinburgh begegnet sie Henry, der nicht nur Schulsprecher an der Dunbridge Academy, sondern auch absolut umwerfend ist. Ach, und er hat eine Freundin – was Emma sehr recht ist, schließlich ist sie nicht nach Schottland gekommen, um sich zu verlieben. Aber Henry ist überall – in ihren Leistungskursen, bei den Morgenläufen, auf den Mitternachtspartys. Und als er ihr auch noch anbietet, bei der Suche nach ihrem Vater zu helfen, muss Emma sich eingestehen: Sie ist auf dem besten Weg, sich in Henry zu verlieben. Auch dieser kann nicht leugnen, dass er sich zu der deutschen Austauschschülerin hingezogen fühlt. Bald schon sind sie machtlos gegen die Gefühle, die mit jedem Tag stärker werden. Doch gerade, als ein Happy End für Emma und Henry in greifbare Nähe rückt, schlägt das Schicksal unbarmherzig zu …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält Elemente, die triggern können.
Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Sarah und euer LYX Verlag
Für alle, die immer nur rennen.
Ich hoffe, ihr findet jemanden,
für den es sich lohnt, anzuhalten.
Everything I’ve never done,
I want to do with you.
William Chapman
PLAYLIST
baby luv – nilüfer yanya
apricots – may-a
older – shallou and daya
hope is a dangerous thing for a woman – lana del rey
stone – jaymes young
all three – noah cyrus
happier than ever – billie eilish
edge of midnight (midnight sky remix) – miley cyrus feat stevie nicks
meet me in the hallway – harry styles
a. m. – one direction
wonderland – taylor swift
runaway – aurora
perfectly out of place – dreams we’ve had
talk – hozier
sweat – zayn
a little death – the neighbourhood
fine line – harry styles
my tears are becoming a sea – m83
mind over matter (reprise) – young the giant
the beach – wolf alice
run boy run – woodkid
right where you left me – taylor swift
ready to run – one direction
IRGENDWOHIN
»Es tut mir leid«, sage ich, und es ist nicht das, was ich eigentlich sagen will. Nicht im Geringsten. Es ist Kapitulieren auf die schlimmste Art, weil ich keine andere Wahl habe.
Meine Stimme hat noch nie so tonlos geklungen. Als wäre mir egal, was das gerade bedeutet, aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist alles, aber nicht egal.
Was hast du getan, was hast du getan, was hast du getan?
Das Richtige, das war es doch. Oder etwa nicht? Gerade eben war ich mir dessen noch sicher, aber jetzt überkommen mich Zweifel.
Ich drehe mich um, ich ergreife den Knauf aus schwerem, schwarzem Eisen. Ich weiß nicht, wie mich meine Beine tragen. Ich weiß nicht, wie ich die dunkelbraune Holztür aufdrücken, das Rektorat verlassen und dabei Haltung wahren kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß nichts mehr.
Ich höre die Stimmen auf dem Flur, das Lachen, das von den hohen Wänden widerhallt. Die Geräusche schneller Schritte auf den alten, unebenen Fliesen in den Arkaden. Sonnenstrahlen fallen durch die Fensterscheiben der Spitzbögen, Staub glitzert in der Luft.
Gesichter wenden sich mir zu, Mitschülerinnen und Mitschüler lächeln mich an, grüßen, so wie sie mich immer grüßen, und ich grüße nicht zurück, weil ich nicht mehr kann. Ich laufe an ihnen vorbei, und ich habe kein Ziel. Ich muss weg, aber ich weiß nicht wohin, denn ich habe kein Zuhause mehr.
Der Gedanke gleicht einem Faustschlag mitten in die Magengrube, aber er ist wahr. Für einen Moment habe ich das Gefühl, stehen bleiben und mich krümmen zu müssen. Doch ich laufe weiter.
Meine Füße fliegen über die Fliesen, nehmen Wege, die ich mit geschlossenen Augen gehen könnte. Über den Innenhof zu meinem Schlaftrakt, braune Backsteinfassaden, an denen der Efeu hinaufrankt. Hohe Sprossenfenster, dunkle Dächer, spitze Türme. Ich sehe das alles, aber ich fühle nichts mehr. Ausgetretene Treppenstufen, aus dem ersten Stock kommen mir die Neuntklässler entgegen, werden langsamer, als sie mich erkennen, nur um dann noch schneller nach unten zu laufen, sobald sie an mir vorbei sind. Die schwere dunkle Holztür zu unserem Flügel ist geschlossen, ich muss mich mit meinem ganzen Gewicht dagegenstemmen, greife nach dem Schlüssel in meiner Hosentasche, öffne die Zimmertür.
Stille.
Und dann ziehe ich meinen Koffer neben dem Schrank hervor und beginne zu packen.
1. KAPITEL
EMMA
Er hat nicht geklingelt. Mein verfluchter Wecker, er hat einfach nicht geklingelt. Er ist stumm geblieben, weil mein Handy tot ist. Wie kann man vergessen, es über Nacht aufzuladen, wenn man am nächsten Morgen nach Schottland fliegt, um ein Austauschjahr an einem Internat anzutreten? Wie? Vermutlich klingt es wie ein schlechter Scherz, aber leider muss ich klarstellen, dass es keiner ist.
Ich habe eiskalt verschlafen. An meinem Abreisetag. Und Mama darf davon unter keinen Umständen erfahren, sonst kriegt sie die Krise. Als gestern sicher war, dass sie es wegen dieses beschissenen Streiks des Bodenpersonals in Frankreich nicht rechtzeitig zurückschaffen würde, um mit mir wie geplant nach Edinburgh zu fliegen, war sie total skeptisch. So als wäre eine Siebzehnjährige nicht in der Lage, allein zum Flughafen zu kommen und nach Schottland zu reisen.
Nun, was soll ich sagen? Offensichtlich hatte sie recht.
Normalerweise verbinde ich mein Handy vor dem Schlafengehen immer mit dem Ladekabel, aber anscheinend habe ich das gestern vergessen. Es kommt schließlich nicht allzu häufig vor, dass man sich bis tief in die Nacht die Augen aus dem Kopf heult, weil einem schlagartig bewusst wird, dass es vielleicht doch eine beschissene Idee ist, für ein Jahr nach Schottland zu gehen. Vielleicht wollte mir mein Unterbewusstsein eine letzte Möglichkeit gewähren, doch noch zur Besinnung zu kommen. Den Flug nicht anzutreten, morgen nicht die Neue an der Dunbridge Academy zu sein, sondern den Rest der Sommerferien zu genießen und Anfang September in die elfte Klasse am Heinrich-Heine-Gymnasium zu gehen, so als hätte ich nicht beinahe einen riesigen Fehler gemacht. Aber das geht nicht mehr, denn alle meine Freunde wissen, dass ich ein Jahr weg sein werde. Ich kann mir nicht die Blöße geben und kneifen. Es sähe aus, als wüsste ich nicht, was ich will. Dabei weiß ich ganz genau, was ich will. Und dafür muss ich nach Edinburgh.
Achtlos werfe ich die letzten Dinge in meinen Waschbeutel, während ich mir die Zähne putze.
Ich muss dorthin. Ich weiß es, seit ich diese Kassette gefunden und bis zum Morgengrauen wach gelegen habe, um auf meinem alten Walkman diesen Song zu hören. »For Emma«. Ein Titel wie ein Versprechen, das mich verhöhnt.
Zweieinhalb Monate ist das her, und insgeheim bin ich mir sicher, dass ich nur so kurzfristig an dieser Schule angenommen wurde, weil Mama irgendwelche Kontakte hat spielen lassen. Das kann sie ausgesprochen gut. Als Anwältin scheint man fast überall jemanden zu haben, der einem noch einen Gefallen schuldet. Eigentlich war ich mir wirklich sicher, dass ich das Richtige tue. Auch wenn Mama nicht verstanden hat, warum ich plötzlich doch an dieses Internat wollte, nachdem ich all die Jahre abgelehnt habe, wenn sie es mir vorgeschlagen hat. Ich kann ihr nicht davon erzählen, dass ich meinen Vater finden muss. Dass seine Stimme auf dem Tape ganz anders klingt als in meiner Erinnerung. Dass sie sich so nah angehört hat, als hätten seine Lippen die ganze Zeit über das Mikro gestreift, während er »For Emma« gesungen hat. Dass ich diesen Song mit Gänsehaut und einem flatternden Herzen angehört habe. Eine ganze Nacht lang und dann nie wieder.
Dass »For Emma« nicht mehr verschwunden ist, auch nicht, während ich seinen Namen gegoogelt habe, zum ersten Mal seit Jahren. Jacob Wiley, der noch immer auf seinen großen Durchbruch wartet, noch immer ein Mann mit Gitarre und ohne Gewissen, denn ich bin mir sicher, man kann keins haben, wenn man für einen Traum seine Familie verlässt und kein einziges Mal zurückblickt.
Jacob Wiley (geboren in Glasgow) ist ein schottischer Singer-Songwriter.
Und er lebt wieder dort, zumindest steht das in seinem Wikipedia-Eintrag. Er ist in Schottland, also muss ich auch nach Schottland. Ich wusste es, als ich zum ersten Mal freiwillig die Website der Dunbridge Academy aufgerufen habe.
»Flughafen, bitte«, keuche ich, als ich wenig später in das Taxi steige. Ich will die Augen schließen, um die Uhrzeit nicht sehen zu müssen, aber leider leuchtet sie mir vorwurfsvoll entgegen, sobald ich nach meinem Handy greife. Das wird verflucht eng. Ich bin so bescheuert. Ich muss zur Gepäckaufgabe, die hoffentlich überhaupt noch geöffnet hat, durch die Sicherheitskontrolle und zu meinem Gate. Alles innerhalb einer Stunde und zwanzig Minuten, dann soll die Maschine abheben – im besten Fall mit mir an Bord.
Keine Ahnung, was ich mache, wenn es nicht klappt. Bestimmt geht später noch eine andere Verbindung nach Edinburgh, aber wird man einfach umgebucht, wenn man seinen Flug verpasst und komplett selbst daran schuld ist?
Mama weiß so was. Aber solange es nicht unbedingt sein muss, wird sie nichts davon erfahren, dass ich sogar zu unfähig bin, meinen Flug zu erwischen. Am Ende interpretiert sie es als Zeichen, dass ich eigentlich doch nicht an die Dunbridge Academy will. Und es ist kein Zeichen. Es ist nur ein dummer, dummer Zufall.
Ich schicke ihr per WhatsApp eine Nachricht, in der ich behaupte, dass ich gerade auf dem Weg zu meinem Gate bin. Im Grunde stimmt es ja sogar.
Es ist halb acht an einem Sonntagmorgen, aber der Verkehr in Frankfurt kennt keine Gnade. Ich schließe die Augen, als das Taxi langsamer und immer langsamer wird. Gott, ich bin so was von aufgeschmissen. Ich werde den Flug verpassen und zu spät im Internat ankommen. Ich werde von Anfang an die Neue sein, die es nicht mal geschafft hat, pünktlich zum Schulbeginn zu sein.
Mein Puls rast, als ich eine halbe Ewigkeit später endlich aus dem Taxi springe, nach meinem Gepäck greife und den Fahrer bezahle. Ich bin schon oft geflogen, aber der Frankfurter Flughafen ist und bleibt eine Zumutung, selbst wenn man ausreichend Zeit mitbringt.
Ich beginne zu rennen. Überall stehen Menschen mit Koffern in der Abflughalle. Die wenigsten machen mir Platz, obwohl sie sehen, dass ich mich beeilen muss. In den Innenseiten meiner Oberschenkel zieht der Muskelkater vom Training am Freitag. Ein letztes Mal Koordination und Tempoläufe mit den Mädels aus meinem Verein. Du wirst es lieben, Emmi, ich war an der Dunbridge auch im Track and Field Team. Ich höre Mamas Stimme in meinem Kopf und bete, dass sie recht behält.
Meine Beine sind schwer, es ist anstrengend, zwei Koffer zu schieben, und ich spüre leichtes Seitenstechen. Es ist mühsamer als sonst, die Sohlen vom Boden zu lösen, aber ich halte nicht an. Ich halte nie vor meinem eigentlichen Ziel an. Es ist die einzige Sache, die ich wirklich durchziehe. Weiterlaufen, selbst dann, wenn ich vor Anstrengung fast kotzen muss. Weiterlaufen, weiterlaufen, egal wohin. Mein Vater in diesem roten Waggon des DB-Regio-Express, der immer schneller und schneller wird, während ich ihm immer schneller und schneller nachlaufe. Nur nie schnell genug.
Ich muss so verzweifelt aussehen, dass die Airline-Mitarbeiter einen neuen Schalter öffnen und ich meinen ersten Koffer auf das Band wuchte. Die Frau hinterm Tresen mustert die Zahl auf der digitalen Anzeige mit erhobenen Augenbrauen, doch dann befestigt sie das selbstklebende Etikett wortlos an meinem Gepäck. Vielleicht hat sie Mitleid. Hoffentlich hat sie Mitleid.
»Sie müssen sich beeilen, das Gate schließt jetzt, aber ich gebe den Kollegen Bescheid, dass Sie auf dem Weg sind.«
»Danke«, presse ich hervor, greife nach meinen Dokumenten, drehe mich um und tue das Einzige, was ich wie im Schlaf beherrsche.
Ich renne, so schnell ich kann.
2. KAPITEL
HENRY
Ich hasse Rennen.
Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es.
Es ist schon anstrengend genug, wenn man nicht gerade nach einem verspäteten Zehn-Stunden-Flug von einem Ende dieses gigantischen Flughafens ans andere hetzen muss. Ich weiß, warum ich es normalerweise vermeide, in Frankfurt umzusteigen, denn anderthalb Stunden Transitzeit reichen nie. Schon gar nicht, wenn der Flieger Verspätung hatte. Ich möchte es mir irgendwo dick und fett aufschreiben, damit ich mich beim nächsten Mal daran erinnere, wenn ich den Rückflug von Nairobi nach Edinburgh buche.
»Entschuldigung, sorry …« Verfluchte Scheiße, warum ist es so schwer, sich an die Rechts-stehen-links-gehen-Regel auf diesen endlos langen Fahrsteigen zu halten? »Anschlussflug, tut mir leid.«
Ich remple gegen Ellbogen und ignoriere das Stechen in meiner Brust. Es ist so peinlich, dass ich keine fünf Minuten am Stück laufen kann, ohne das Gefühl zu haben, gleich einen Asthma-Anfall zu bekommen. Der Rucksack auf meinen Schultern wiegt plötzlich eine Tonne, mein Hoodie ist viel zu warm, aber natürlich ist mir das erst aufgefallen, als ich vorhin mit den anderen Passagieren im engen Mittelgang der Boeing stand und darauf gewartet habe, endlich aussteigen zu können. Am liebsten würde ich anhalten und mir den Pulli vom Körper reißen, aber erstens habe ich keine Zeit, und zweitens ist es jetzt auch egal.
Ich strauchle, als ich am Ende des Fahrsteigs den ersten Schritt auf festem Boden mache. Mein Körper will weiter nach vorn, meine Muskeln schaffen es kaum, die fehlende Beschleunigung abzufangen, und Gott, ich muss wieder regelmäßiger laufen gehen, wenn das mit meiner Sportnote was werden soll. Vielleicht sollte ich mir ein Beispiel an Theo nehmen. Mein älterer Bruder ist fürs Lernen immer aufs Laufband im Fitnessraum des Internats gegangen. Das Gehirn speichert neue Inhalte im Gehen viel schneller, das ist Wissenschaft, Henry. Und es ist Wissenschaft, dass mir mein Herz jeden Moment aus der Brust springt, wenn ich nicht langsamer mache und …
Moment. Gate B 20. B.
Ich bleibe so abrupt stehen, dass sich ein Schwall deutsch klingender Flüche über mich ergießt. Mein Puls trommelt weiter in meinen Ohren, während ich die Schilder über mir anstarre. Vielleicht kriegt mein Kopf zu wenig Blut, und ich habe Halluzinationen. Oder da steht wirklich Gate C–D.
Fuck. Wo bin ich falsch abgebogen? Warum befindet sich mein Anschlussgate immer am anderen Ende des Flughafens, egal wo ich umsteige, und wieso …
Der dumpfe Laut, der noch in der Sekunde ertönt, in der ich mich, ohne zu schauen, umdrehe, hört sich nicht gut an. Und er fühlt sich auch nicht gut an. Ich habe vergessen, dass es einem die gesamte Luft aus der Lunge presst, wenn jemand mit voller Wucht in einen hineinrennt. Ich lande auf den glatten Fliesen zwischen den Knien eines Mädchens. Eine Schnalle meines Rucksacks springt auf, und der Inhalt verteilt sich vor uns auf dem Boden. Wasserflasche, Kopfhörer, Kaugummis, das Tütchen Mini-Salzbrezeln aus dem Flugzeug, Handyladekabel und mein Pass. Aber ich sehe nichts davon. Ich sehe nur hellblonde, kinnlange Haare und sehr graublaue Augen.
»Sorry, sorry …«, beginnt sie und redet weiter. Dass ich sie nicht verstehe, liegt hoffentlich nicht daran, dass ich mir bei dem Sturz den Kopf gestoßen habe. Die Worte hören sich deutsch an, aber aus ihrem Mund klingen sie weniger hart.
»Bist du okay?«, frage ich zurück. Eigentlich erwarte ich, dass sie stockt, sobald ihr klar wird, dass sie auf Englisch antworten muss, damit ich sie verstehe. Doch sie wechselt die Sprache, ohne eine Sekunde zu zögern, und Himmel, warum ist das so attraktiv?
»Ja, ja, ich denke schon«, sagt sie. »Und du? Tut mir leid, ich hätte nicht so rennen sollen, aber …«
»Nein, schon gut. Ich hab nicht aufgepasst.« Mein Gehirn springt wieder an. Ich beuge mich reflexartig zu meiner Flasche, die gefährlich in Richtung der vorbeieilenden Menschen rollt. Während ich danach greife, huscht ihr Blick über meine Sachen. Fast so, als wöge sie stumm ab, ob sie mir nun beim Aufsammeln helfen muss oder nicht.
»Tut mir leid, ich …« Sie stockt, als ich sie wieder ansehe. »Ich bin superspät dran, mein Flieger geht gleich und …«
Die blecherne Stimme der Flughafendurchsage unterbricht sie. Sie springt hektisch auf, während die deutschen Worte aus den Lautsprechern hallen. Dann halte ich den Atem an, als sie auf Englisch wiederholt werden.
»Letzter Aufruf für Passagiere Bennington und Wiley. Bitte begeben Sie sich unverzüglich zu Gate B 20. Letzter Aufruf.«
»Tut mir leid …« Das Mädchen wirft mir einen ebenso entschuldigenden wie verzweifelten Blick zu.
»Bist du das?«, frage ich, und sie nickt. »Edinburgh?«
»Du auch?«
»Ja«, antworte ich.
Sie zögert. Dann bückt sie sich zu meinen Sachen. »Okay, wir müssen uns beeilen.«
Es sind drei Handgriffe für jeden von uns, ich stopfe die Kopfhörer zuoberst in den Rucksack und springe ebenfalls auf. Meinen Reisepass behalte ich direkt in der Hand.
»Wiley?«, frage ich und sehe sie an.
»Emma«, sagt sie und deutet in die Richtung, aus der ich eben gekommen bin. Wir beginnen zu laufen. »Und du?«
»Henry. Freut mich.« Ich kann nur noch einzelne Wörter sagen, weil meine Lunge schon wieder in Flammen steht. Oder immer noch, beides ist möglich. »Ist es weit?«, presse ich hervor, während ich langsam hinter ihr zurückfalle. Emma. Das Graue-Augen-Mädchen. Und Himmel, sie ist schnell.
»Weiß ich nicht.« Sie wirft einen Blick über die Schulter und hält die Riemen ihres Rucksacks fest. »Wir müssen schneller laufen.«
»Ich kann nicht schneller laufen.«
»Doch, kannst du.«
Verflucht, sie irrt sich. Sie kann das vielleicht.
Und sie lässt es völlig mühelos aussehen.
»Nein, wir müssen hier lang.« Kurz vor dem nächsten Fahrsteig packt sie mein Handgelenk und zieht mich nach rechts.
Tatsächlich. Gate B 35–1 steht auf dem Schild. Hier muss ich vorhin einfach vorbeigelaufen sein.
Emma murmelt Wörter, die sich sehr deutsch und entschuldigend anhören, während wir an Menschen mit Handgepäcktrolleys vorbeirennen und kleinen Kindern ausweichen.
Ich bin richtig peinlich außer Atem, während Emma, deren Brust sich zwar ebenfalls deutlich hebt und wieder senkt, nur ein bisschen gerötete Wangen hat. Vermutlich sind es bloß ein paar Hundert Meter, doch dieser Flughafengang kommt mir unendlich lang vor.
B 31
B 29
B 27
An B 24 hat gerade das Boarding begonnen, und die Leute stehen überall. Mitten im Weg. Ich danke ihnen von Herzen, weil ich deshalb ein paar Schritte gehen muss. Emma verschwindet vor mir zwischen den Wartenden, und ich zwinge mich weiterzulaufen.
Unser Gate ist leer. Es fällt so richtig auf zwischen den anderen Wartebereichen, die alle bis auf den letzten Platz besetzt sind. Hinter den Glasscheiben sehe ich die Maschine, doch niemand steht mehr am Schalter.
Emma wird langsamer, als sie ebenfalls erkennt, dass wir zu spät sind.
Verdammt … Ich spüre Seitenstiche und presse mir eine Hand an die Flanke.
»Echt jetzt?«, murmelt Emma. Ihre Stimme klingt viel zu normal für den Sprint, den wir hinter uns haben. »Sie haben uns doch gerade noch ausgerufen und …«
»LH 962 nach Edinburgh?«, ruft ein Mann.
Ich würde dem Flugbegleiter, der in diesem Moment aus dem Gang zum Flieger hervortritt, am liebsten um den Hals fallen.
»Ja!«
»Sehr gut, kommen Sie bitte.«
Ich versuche, das Keuchen zu unterdrücken, während ich mein Handy aus der Kängurutasche des Hoodies ziehe. Mit Sicherheit ist mein Gesicht knallrot. Emma sieht kaum angestrengt aus. Wie zur Hölle kann sie ein Mensch sein?
Ich öffne die Bordkarte auf dem Handy und reiche dem Flugbegleiter meinen Reisepass. Nachdem er ihn mir zurückgegeben hat, warte ich ein paar Schritte weiter vorne auf sie. Emma hat einen auf Papier ausgedruckten Boardingpass, und etwas daran bringt mich zum Lächeln. Es ist irgendwie süß.
Sie bedankt sich, und ihre Wangen sind doch ein bisschen rot, als sie zu mir schaut. Ich glaube, es überrascht sie, dass ich gewartet habe. Und in diesem Moment passiert es. Ihr Blick wandert von meinem Gesicht zu meiner Brust. Ich sehe, wie sie auf das weiße, gestickte Logo auf dem dunkelblauen Sweatshirtstoff meines Hoodies starrt. Die ineinander verschlungenen Initialen der Dunbridge Academy mittig in dem simplen Wappen, das von Efeuranken eingerahmt ist. Emma kennt es. Ich sehe es in ihren Augen, und noch bevor sie ein Wort gesagt hat, gehe ich in Gedanken alle acht Jahrgangsstufen durch. Aber nein, es ist unmöglich. Sie muss neu sein, sonst hätte ich sie schon einmal gesehen. Ich weiß vielleicht nicht die Namen aller vierhundertzweiunddreißig Schülerinnen und Schüler an der Dunbridge. Aber ich kenne ihre Gesichter. Und die vergesse ich nicht.
»Du gehst auf die Dunbridge Academy?«, fragt Emma, und ihre Stimme klingt so ehrfurchtsvoll, dass ich mir absolut sicher bin.
Sie ist so was von neu. Nur jemand, der das Internat bislang lediglich von den glänzenden Berichten im Netz kennt, würde das fragen.
»Ja«, sage ich, und der Flugbegleiter taucht hinter Emma auf.
»Beeilung bitte!« Er ist ganz Lächeln mit strahlend weißen Zähnen, aber er tut das auf diese eindringlich-freundliche Art, die uns beide sofort dazu bewegt weiterzulaufen. Emmas Blick klebt noch immer an mir. Es gefällt mir nicht, dass sie auf einmal so gehemmt wirkt.
»Ist es dein erstes Jahr?«
»Ja.« Emma lächelt schmal, und plötzlich würde ich sie am liebsten in den Arm nehmen. Also, wenn ich nicht total verschwitzt wäre. Und selbst dann eigentlich nicht. Wir kennen uns schließlich nicht. Aber warum ist sie allein hier? Die Neuen werden eigentlich immer von ihren Eltern gebracht. Selbst wenn sie aus Saudi-Arabien oder Mexiko kommen. Und Deutschland ist nun wirklich nicht die am weitesten entfernte Nation, die an unserer Schule vertreten ist.
»Ich mache nur ein Austauschjahr«, sagt sie, während wir den langen Gang entlanglaufen. Die Wände sind nah, der Teppichboden verschluckt unsere Schritte. Ich mag nicht, dass sie zu Boden sieht, während sie das sagt. Sie wirkt irgendwie … nicht glücklich.
»Wie cool. Dein Englisch ist super.«
Ich merke sofort, dass ich offensichtlich etwas Falsches gesagt habe, als sie den Blick hebt. »Danke«, murmelt sie.
Ich will sie alles Mögliche fragen. Woher genau sie kommt, ob sie aufgeregt ist, all so was, aber ich komme nicht dazu, weil wir in dem Moment die Flugzeugtür erreichen. Eine Flugbegleiterin wartet bereits auf uns.
»Willkommen an Bord«, grüßt sie und lächelt ungeduldig.
»Wo sitzt du?«, frage ich Emma. Alle anderen Passagiere sind bereits angeschnallt. Starren auf Smartphones, die gleich in den Flugmodus geschaltet werden müssen, oder genervt in unsere Richtung.
»Siebenundzwanzig D«, sagt Emma und wirft mir einen Blick über die Schulter zu. »Und du?«
Schade … Einen Moment lang denke ich wirklich darüber nach, wie unverschämt es wäre, jetzt noch jemanden zu fragen, ob wir die Plätze tauschen können.
»Hier«, antworte ich, als wir an Zweiundzwanzig C vorbeikommen. Der Platz am Gang, neben dem natürlich nichts mehr frei ist. Die Frau in der Mitte hat bereits dicke Noise-Cancelling-Kopfhörer auf und sieht nicht so aus, als würde sie angesprochen werden wollen.
»Ah, okay.« Emma bleibt nicht stehen. »Dann guten Flug. Man sieht sich, Henry.«
»Ja.« Ich schlucke. »Dir auch.«
EMMA
Der Mittelsitz in meiner Reihe ist frei. Natürlich ist er das. Er ist auf Mamas Namen reserviert, aber Mama sitzt irgendwo in Nizza und nicht hier neben mir.
Es fällt mir erst ein, als Henry bereits Platz genommen hat und eine Flugbegleiterin mich bittet, den Sicherheitsgurt nicht mehr zu lösen, bis wir die Reiseflughöhe erreicht haben.
Also sitze ich da, ignoriere die Sicherheitsanweisungen des Kabinenpersonals und versuche stattdessen, Henry mit meinen Blicken zu beschwören, damit er sich zu mir umdreht.
Es klappt nicht. Er ist am Handy, ich sehe ihn tippen und schuldbewusst hochschauen, als die Flugbegleiterin ihm vermutlich sagt, dass er den Flugmodus einschalten soll.
Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um.
Ich könnte ihm ein Zeichen geben, dass er später nach hinten kommen und sich zu mir setzen soll. Also falls er das wollen würde. Keine Ahnung. Ist ja eigentlich auch egal. Ich weiß nicht mal, ob ich es will. Nein, das stimmt nicht. Ich weiß es. Ich will es nicht. Auf gar keinen Fall. Er wirkt nett, aber das sollte mir egal sein. Er ist ein Mann. Und was das bedeutet, wissen wir ja. Gebrochene Herzen und vergossene Tränen, die wir nie wieder zurückbekommen. Sechs Monate mit jemandem zusammen sein, nur um dann aus dem Nichts diese Textnachricht zu erhalten, dass er es irgendwie nicht mehr fühlt. Ich habe genug von Typen wie Noah aus der Parallelklasse oder meinem Vater, der weggegangen ist und sich nie wieder gemeldet hat. Und trotzdem sitze ich hier, fliege nach Schottland, um ihn zu suchen, und kann nicht aufhören, in Henrys Richtung zu schauen. Warum mache ich das?
Henry dreht sich nicht um, und je länger ich es hoffe, desto lächerlicher komme ich mir vor. Wer weiß, ob wir überhaupt in derselben Stufe sind. Dieses Internat ist groß, vielleicht haben wir nie wieder was miteinander zu tun. Was schade wäre … Gott, Emma! Genug jetzt.
Ich starre seine Schulter in diesem dunkelblauen Hoodie an und frage mich, wie alt er ist. Bestimmt Abschlussklasse. Er hat so was an sich. So was Selbstbewusstes und Gelassenes. So wie die Abiturienten bei uns durch die Flure laufen, weil sie so erwachsen sind, so lässig, als würde ihnen die ganze verfluchte Schule gehören. Aber vielleicht sind an diesem Internat ja auch alle so. Ich werde es bald erfahren.
Jedenfalls dreht er sich nicht mehr um. Nicht dass es von Bedeutung wäre. Ich ziehe meine Kopfhörer aus der Tasche und mache einen alten Song von One Direction an, weil wir gleich starten und ich ein bisschen Seelenfrieden gut brauchen kann.
Warum dreht er sich nicht um? Wenn er neben mir sitzen würde, könnte ich schon mal damit beginnen, ihm Fragen zum Internat zu stellen. Oder andere Fragen. Warum er überhaupt von Frankfurt nach Edinburgh fliegt, wenn er so offensichtlich britisch klingt, dass ich gar nicht mehr herausfinden muss, woher er kommt. War er im Urlaub? Wie ist es so im Internat, und kennst du zufällig einen Jacob Wiley? Nein? Schade, aber auch nicht weiter wichtig …
Ich bin so besessen.
Das Flugzeug bleibt stehen, und dann werden die Triebwerke lauter. Ich werde in den Sitz gedrückt, und weil mir Starts und Landungen nie ganz geheuer sind, schließe ich die Augen. Nur für ein Weilchen. Nur bis wir die Reiseflughöhe erreicht haben und ich mir halbwegs sicher sein kann, dass wir alle überleben werden. Wobei ich irgendwo gehört habe, dass Landungen risikoreicher sind als Starts. Egal … Nicht darüber nachdenken. Ich höre meine Musik, alles andere spielt keine Rolle. One Direction werden von Taylor Swift abgelöst, Taylor von Lana del Rey.
Ich blinzle nur manchmal. Falls Henry sich umdreht. Aber alles, was ich sehe, ist sein Ellbogen auf der Armlehne des Sitzes und seine Hand, mit der er das Gesicht abstützt. Und ich sehe, dass er verflucht müde sein muss, denn alle zwanzig Sekunden sackt sein Kopf leicht nach vorne.
Hat er einen Nachtflug hinter sich? Die dunklen Schatten unter seinen Augen und die Jogginghose, die er trägt, deuten darauf hin.
Als er sich die Kapuze seines Hoodies aufsetzt und mit verschränkten Armen den Hinterkopf gegen den Sitz lehnt, wende ich den Blick ab. Es ist unhöflich, Fremden beim Schlafen zuzusehen, aber unter der Kapuze kringeln sich seine braunen Locken, und seine Augen, die waren wirklich ziemlich grün. Dunkles Moosgrün. Wie das Grün im Tartan-Muster der Schuluniform, die ich ab morgen tragen werde. Dunkelblauer Blazer mit blau und grün kariertem Innenfutter und dem aufgestickten Wappen der Schule an der Brusttasche. Weiße Hemden und farblich passende Krawatten.
Ich kann nicht aufhören, mir Henry in dieser Schuluniform vorzustellen, die ihm schätzungsweise sehr gut steht, während sein Kopf mit jeder Minute etwas weiter in Richtung seiner Schulter sinkt. Wenn er neben mir sitzen würde, könnte er ihn auf meiner …
Himmel, Wiley. Ich schließe die Augen wieder, und Lana singt »Hope is a dangerous thing for a woman«. Sie weiß gar nicht, wie recht sie hat. Oder doch. Wer solche Lieder schreibt, weiß, wie es läuft. Noah, am nächsten Tag in der Schule. Wie er sagt, dass es doch sowieso keinen Sinn mehr macht. Wie ich nicke, ganz ruhig, keine Gefühle, keine Tränen. Alles, um nicht die hysterische Ex zu sein, die ihn anfleht zu bleiben. Weil ich es hätte wissen müssen. Weil sich immer alles wiederholt, immer, immer, immer, und man das nicht mehr rausbekommt, egal wie sehr man an das Gute in den Menschen glauben möchte. Wenn es schwierig wird, gehen sie einfach, und niemand kann sie daran hindern.
Wir brauchen keine Männer in unserem Leben, Emmi-Maus. Mamas Stimme, und ein Teil von mir will ihr glauben. Weil sie wirklich keine Männer braucht, nur ihren Job und viel zu tun, damit sie vergisst, wie weh es tut. Ich kann es nicht vergessen. Weil ich nicht atmen konnte, als ich meine Kleidung gegen Laufsachen getauscht habe, obwohl es ein Ruhetag war. Aber ein Noah-hat-Schluss-gemacht-Tag kann unmöglich ein Ruhetag sein. Es war ein Tag, an dem ich laufen musste, um nicht den Verstand zu verlieren. Weil meine Gedanken nur dann stillstehen, wenn ich an ihrer Stelle renne. Aber jetzt kann ich nicht rennen. Ich kann mich zwingen, nicht in Henrys Richtung zu schauen. Zum Glück sitzt er nicht neben mir. Es wäre fatal. Er darf auf gar keinen Fall neben mir sitzen, einschlafen und seinen Kopf auf meine Schulter legen. Ich habe für so was keine Zeit. Noah hat sich getrennt, und ich habe ein Ziel. Es ist ganz einfach. Ein Jahr, eine Mission. Alles in Schottland ist für mich mit einem Ablaufdatum versehen. Ich muss mir das wieder und wieder sagen, damit ich es nicht vergesse.
Ich blinzle.
Und nein, er hat sich nicht umgedreht.
3. KAPITEL
EMMA
Von Frankfurt nach Edinburgh sind es zwei Flugstunden, und nach fünfzig Minuten stehe ich auf, um zur Toilette zu gehen. Kann sein, ich bin besessen, aber es reicht nicht mehr, in meinen Sneakern die Zehen auf und ab zu bewegen und nervös mit dem Fuß zu wippen. Normalerweise habe ich kein Problem damit, mehrere Stunden am Stück still zu sitzen, aber normalerweise fliege ich auch nicht nach Schottland, um die Neue an einem Eliteinternat zu sein. Ich frage mich, ob es wirklich so sein wird wie auf dieser unfassbar nobel aussehenden Website der Schule. Lächelnde Schülerinnen und Schüler, die mit ihren Lehrbüchern auf dem Rasen sitzen oder in Uniform über das Gelände laufen. Hochmoderne Geräte, die in den Klassenzimmern uralter Gebäude stehen. Gemeinschaftsgefühl statt Leistungsdruck und Konkurrenz. Nicht dass es das an meiner alten Schule gegeben hätte. Dafür war der Unterricht den meisten ein wenig zu egal, aber wenn ich Mamas Erzählungen Glauben schenken darf, ist das im Internat anders. Dunbridge verpflichtet. Ein seltsamer Spruch, aber irgendwie passt er auch zu meiner Vorstellung von dieser Schule. Und zu Henry. Er ist bestimmt sehr pflichtbewusst, aber ohne dass es streberig wirkt. Ich nehme mir jedenfalls vor, mich wirklich anzustrengen und das Beste aus meiner Zeit in Schottland zu machen, während ich den Mittelgang des Flugzeugs entlanggehe.
Leider gibt es nur einen einzigen. In den großen Maschinen auf längeren Flügen kann man durch die kleinen Bordküchen auf die andere Seite der Sitzreihen huschen und ein paar Runden gehen. Jetzt gibt es nur einen Hin- und Rückweg zur Toilette, aber das ist besser als nichts.
Ich schließe die Tür der kleinen Kabine und starre mir selbst im Spiegel entgegen, während es in meinem Kopf dröhnt. In dem grellen Licht sehen meine blonden Haare beinahe weiß aus. Ich streiche mir eine Strähne meines Bobs hinter das Ohr und drücke die Spülung, obwohl ich nicht auf der Toilette war. Dann wasche ich mir die Hände, trockne sie mit den steifen Papiertüchern, die das Wasser nicht aufsaugen, sondern abweisen, und rüttle an der Tür. Sie öffnet sich mit einem komplizierten Faltmechanismus nach innen, und weil mich das so fasziniert, sehe ich zu spät, dass Henry da draußen steht.
»Oh, hi«, sagt er, und seine Stimme klingt bei dem Dröhnen des Flugzeugs irgendwie anders. Er lächelt, aber er sieht auch müde aus. Gerade erst aufgewacht, mit leicht verquollenen Augen und wirren Haaren, die unter der Kapuze seines Pullis hervorschauen.
»Gut geschlafen?«, frage ich und bereue es auf der Stelle, weil er jetzt weiß, dass ich ihn beobachtet habe.
Henry zögert, dann verändert sich sein Lächeln. Er zuckt mit den Schultern und weicht einen Schritt zur Seite, als sich eine andere Passagierin an ihm vorbeischiebt. Ich verstehe nicht, was sie sagt, es ist schnelles, undeutliches Englisch, auf das Henry mit noch schnellerem undeutlichem Englisch antwortet. Mir fällt plötzlich wieder ein, dass ich die nächsten zehn Monate in einem fremden Land leben werde. Einem fremden Land, das zwar irgendwie auch meine Heimat ist, aber machen wir uns nichts vor. Ich bin noch nie dort gewesen.
DubistMuttersprachlerin,dukannstesdochschonsoperfekt. Isis Stimme in meinem Kopf, und mein Magen krampft sich zusammen. Ich habe den englischen Nachnamen meines Vaters und einen deutschen Akzent, weil ich nicht mehr regelmäßig spreche, seit ich elf bin. So alt war ich, als er gegangen ist. Kann sein, dass ich im Englischunterricht einer deutschen Schule immer noch hervorragend bin, aber die Frage, woher ich so gut Englisch kann, ist trotzdem jedes Mal ein Schlag in die Magengrube.
»Wolltest du nicht …?«, frage ich, um mich von meinen Gedanken abzulenken. Ich deute zur Toilettentür, die gerade von der Frau zugezogen wird.
Henrys Blick geht wieder zu mir. »Nein, ich … ich wollte mir nur etwas die Beine vertreten.«
»Ach so.« Ich schlucke.
»Bist du aufgeregt?«
Er will sich unterhalten. In dieser kleinen Bordküche am hinteren Ende einer Flugzeugkabine, und ich bin damit einverstanden. Ich habe gelesen, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Flugzeugabsturz zu überleben, am größten ist, wenn man ganz hinten sitzt. Ja, sitzt … Wir stehen. Wir sind nicht mal angeschnallt. Ich muss aufhören zu denken.
»Nein«, sage ich und will eigentlich Ja sagen.
Henry nickt, als wüsste er das. »Es wird super«, meint er. Er darf nicht so lächeln. Es ist unfair. »Alle sind total nett.« Er dreht sich leicht zur Seite und hält sich eine Hand vor den Mund, weil er gähnen muss. »Sorry …«
»Jetlag?«, frage ich, und Henry nickt. Dann schüttelt er den Kopf.
»Nein, eigentlich nicht. Es gibt ja keine Zeitverschiebung.«
»Wo warst du denn?«
»Nairobi«, erklärt er. »Das sind nur drei Stunden Unterschied. Aber es war ein Nachtflug.«
»Konntest du nicht schlafen?«
Er schüttelt den Kopf. »Neben mir saß eine Frau mit ’nem Baby auf dem Arm und, na ja, es war ein bisschen anstrengend.«
»Was hast du in Nairobi gemacht?«, frage ich und fahre mit den Fingerspitzen über die Metallschubladen neben mir. Sie sind erstaunlich kalt. Henrys Blick folgt meiner Hand, und für einen Moment bin ich mir nicht sicher, ob er meine Frage gehört hat. Dann reißt er den Blick los und schaut mich wieder an.
»Ich habe meine Eltern besucht. Sie arbeiten für Ärzte ohne Grenzen.« Er sagt es, so wie man Sätze sagt, die man Hunderte Male gesagt hat. So wie ich sage, dass ich meinen Vater kaum kenne, weil er weg ist, seit ich elf bin.
»Oh, krass.«
Henry nickt und lächelt. »Was machen deine Eltern?«
»Meine Mutter ist Anwältin«, erwidere ich. Henry fragt nicht nach meinem Vater. Im Stillen danke ich ihm dafür. Er betrachtet mich einen kurzen Moment lang, als hätte er etwas verstanden, das sonst niemand versteht.
»Wolltest du nicht, dass sie dich bringt?«, fragt er stattdessen.
»Ins Internat?« Ich zögere. »Doch«, gebe ich dann zu. »Aber sie konnte nicht kommen. Sie ist wegen ihres Jobs gerade in Nizza, und in Frankreich streikt das Bodenpersonal.«
»Schade«, sagt er, und ich zucke schnell mit den Schultern.
»Nicht schlimm.« Ich lächle, aber Henry schaut mich dabei so an, als würde er mir nicht recht glauben. »Okay, vielleicht ein bisschen schlimm, aber es macht nichts.«
»Eigentlich ist es besser, dann musst du dich nachher auch von niemandem verabschieden.« Er lehnt sich mit der Schulter gegen die Wand neben uns.
»Stimmt.« So habe ich mich von gar niemandem verabschiedet. Auch nicht von Isi, die nicht vorgeschlagen hat, mit zum Flughafen zu kommen, was ich irgendwie seltsam finde, denn wenn meine beste Freundin für ein Jahr weggehen würde, hätte ich das getan. Aber ich wollte keinen Streit anfangen, und der Flug ging ja auch sehr früh.
»Das fand ich immer am schlimmsten«, meint Henry. »Wenn Mum und Dad uns früher ins Internat gebracht haben und wieder gefahren sind. Diese halbe Stunde danach … nicht so schön. Bis man dann sein Zimmer bezieht und seine Freunde trifft und vergisst, dass man eigentlich traurig ist.«
Ich nicke, auch wenn ich keine Freunde habe, die ich treffen kann. An der Dunbridge Academy ist niemand, der mich in Empfang nehmen wird, und plötzlich sorgt diese Vorstellung für ein enges Gefühl in meiner Brust. Vielleicht kann Henry Gedanken lesen, denn er spricht gleich weiter.
»Ich kann dir nachher alles zeigen, wenn wir da sind.« Er lächelt. »Manchmal würde ich auch gerne noch mal zum ersten Mal ins Internat kommen. Es ist alles so aufregend. Es ist so, als würdest du nach Hause kommen, auch wenn du das noch nicht weißt.«
Ich habe da so meine Zweifel, und selbst wenn er recht behalten sollte, ich werde nur ein Jahr bleiben. Eigentlich sollte ich ihm das noch mal sagen, aber etwas in mir wehrt sich dagegen. Vielleicht weil ich Angst habe, dass er dann nicht mehr so mit mir spricht, als wären wir irgendwie im gleichen Team.
»Ich zeige dir alles«, wiederholt Henry.
Ich kann nichts mehr erwidern, denn eine Flugbegleiterin kommt auf uns zu.
»Bitte nehmen Sie wieder Ihre Plätze ein, wir beginnen gleich mit dem Landeanflug.«
Henry nickt sofort. Sein Blick streift mich, und ich folge ihm durch den Gang zu unseren Sitzen.
Während sich das Flugzeug im Sinkflug befindet, spüre ich langsam, aber sicher die Nervosität. Wenn wir gleich auf dem Rollfeld aufsetzen, bin ich in einer fremden Stadt. Dann ist es wirklich wahr. Meine neue Realität.
Alle Passagiere springen auf, sobald das Flugzeug die Parkposition eingenommen hat. Stehende Menschen im Mittelgang verstellen mir den Blick auf Henry, und als ich endlich ebenfalls aufstehe und meinen Rucksack aus dem Gepäckfach nehme, ist er weg. Natürlich ist er weg. Was dachte ich denn? Dass er jetzt den Babysitter für mich spielt und wartet? Andererseits wollte er mir im Internat alles zeigen, wir haben denselben Weg dorthin, da könnte man schon erwarten, dass er bei mir bleibt, oder etwa nicht?
Ich laufe durch den Gang nach vorne und mache im Kopf eine To-do-Liste. Es ist ganz einfach. Zum Gepäckband gehen, dann durch die Passkontrolle und nach draußen. Diesen Shuttlebus finden, der Schülerinnen und Schüler am Flughafen einsammelt und zur Dunbridge Academy bringt.
Nimmt Henry auch den Bus? Bestimmt wüsste er, wo …
»Hey.« Ich zucke zusammen, als ich ihn draußen im Gang zum Flughafengebäude stehen sehe. Er hat gewartet. »Da bist du ja endlich.«
Ich spüre, wie meine Wangen warm werden. »Danke, dass du gewartet hast.«
»Natürlich.« Er lächelt, und mein klopfendes Herz beruhigt sich wieder etwas.
Während wir durch den Flughafen laufen, erfahre ich, dass Henry seit der fünften Klasse ins Internat geht und dieses Jahr zum ersten Mal Schulsprecher ist. Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich finde, es passt zu ihm.
Sich mit Henry zu unterhalten fühlt sich nicht an, als würden wir uns erst seit zwei Stunden kennen. Zwei Stunden, von denen wir einen Großteil getrennt voneinander verbracht haben. Er macht es einem denkbar leicht, ihn zu mögen, und etwas daran gefällt mir nicht. Das hier könnte gefährlich für mich werden, wenn ich nicht aufpasse. Henry ist nett, ja, aber vermutlich ist er genau deshalb auch Schulsprecher. Ich muss mir nichts darauf einbilden. Mit Sicherheit ist er einfach zu allen so freundlich.
Während wir am Gepäckband auf unsere Sachen warten, schicke ich Mama eine kurze Nachricht, dass ich gelandet bin. Ich zögere, als ich Isis Chat unter ihrem sehe. Aber dann rufe ich ihn auf und schicke ihr die gleichen Worte noch einmal. Meine beste Freundin und ich unterhalten uns nicht viel übers Handy, weshalb es sich während der Ferien manchmal so angefühlt hat, als würden wir uns irgendwie voneinander entfernen. Wenn wir uns täglich im Unterricht gesehen haben, war das anders. Und was das für das kommende Jahr bedeutet, darüber denken wir jetzt lieber nicht nach.
Henrys und meine Koffer gehören zu den ersten, was wohl daran liegt, dass sie zuallerletzt in den Frachtraum des Flugzeugs geladen worden sind. Henry wirkt fast schon überrascht, dass sein Gepäck es bei der knappen Umsteigezeit überhaupt mitgeschafft hat.
Nachdem wir die Passkontrolle passiert haben, fällt mir wieder ein, dass ich mich gefragt habe, wie er zum Internat kommt. Ich will ihn gerade ansprechen, als wir die Ankunftshalle betreten. Henrys Blick huscht über die Wartenden, eine Gestalt löst sich aus der Menge, und dann passiert es alles einfach.
Das Mädchen ist in unserem Alter. Sie hat etwas Feenhaftes und unglaublich Elegantes an sich, während sie auf Henry zuläuft. Er lässt seinen Koffer los. Ein paar Sekunden später liegt sie in seinen Armen.
»Hey, du«, höre ich ihn sagen und wende den Blick ab, als sie sich küssen. Ich weiß nicht, warum ich mich plötzlich so absolut überflüssig fühle.
Er hat eine Freundin. Und sie ist wunderschön und hat diese glänzenden dunklen Locken und leuchtenden braunen Augen, mit denen sie ihn anstrahlt, bevor sie ihm eine Strähne aus der Stirn streicht und ihn noch mal küsst.
»Entschuldigung bitte!«
Ich weiche erschrocken zur Seite, als sich ein paar Menschen an uns vorbeidrängeln. Rasch mache ich Platz, Henry greift nach seinem Koffer. Sein Blick klebt auf dem Mädchen, ich verstehe nicht, was er zu ihr sagt. Vielleicht wegen des Flughafenlärms, vielleicht wegen des Rauschens in meinen Ohren.
Plötzlich wird mir klar, dass ich in Edinburgh bin. Komplett allein, niemand hat mich hergebracht. Und niemand ist hier, um mich so zu empfangen, wie Henry von seiner Freundin empfangen wird. Auch nicht mein Vater, denn er hat keinen blassen Schimmer, dass ich in seiner Heimat bin und ihn suchen werde. Ich lege die Finger fester um die Griffe meiner Koffer. Was tue ich hier überhaupt?
Ich will Henry und seine Freundin nicht stören, aber irgendwie fühlt es sich falsch an, jetzt einfach weiterzugehen und den Bus zu suchen, wie ich es eigentlich vorgehabt hatte. Als ich den beiden einen unsicheren Blick zuwerfe, dreht Henry sich gerade zu mir. Einen Moment lang schaut er sich suchend um, dann sieht er mich.
Er lächelt dieses warme, offene Lächeln, in das ich nichts hineininterpretieren sollte.
»Grace, das ist Emma.« Er zieht sie an der Hand mit sich, während er auf mich zukommt. »Sie macht ein Austauschjahr bei uns.«
»Hi, Emma! Wie schön, dich kennenzulernen.« Grace strahlt, und ich weiß nicht, wie mir geschieht, als sie mich umarmt. »Und herzlich willkommen.«
Etwas überrumpelt nicke ich. »Danke.«
»Woher kennt ihr euch?«, fragt sie, und ihre Stimme ist frei von jeglichem Argwohn.
»Aus Frankfurt, wir waren beide superspät für den Flug dran.« Henry zuckt mit den Schultern. »Ich dachte wirklich schon, dass ich den Anschluss nicht mehr erwische.«
»Jetzt hat ja zum Glück alles geklappt.« Grace lächelt Henry an, dann sieht sie zu mir. »Fährst du auch mit dem Bus, Emma?«
Ich zögere. »Ja, ich … das hatte ich vor.«
Sie greift nach einem meiner Koffer. »Super. Ich nehme den, okay? Mr Burgess hat mich zum Glück mitfahren lassen, nachdem ich ihm vorgejammert habe, dass ich unbedingt Henry überraschen muss. Der Shuttle ist eigentlich nur für die Schüler, die auch im Internat wohnen.« Ich runzle die Stirn, doch da redet Grace auch schon weiter. »Ich besuche die Dunbridge als externe Schülerin und lebe bei meinen Eltern in Ebrington.«
»Das ist der Nachbarort«, erklärt Henry. »Aus der Umgebung gehen die meisten in Edinburgh zur Schule, aber wer Glück hat, bekommt ein Stipendium fürs Internat.«
Ich nicke und folge den beiden. Normalerweise bin ich niemand, der schnell mit neuen Leuten ins Gespräch kommt, doch Henry und Grace geben mir nicht das Gefühl, eine Fremde zu sein. Vielleicht ist es tatsächlich so, wie Mama immer erzählt hat. Dass auf die Dunbridge Academy zu gehen bedeutet, mit unzähligen Geschwistern aufzuwachsen. Teil einer Gemeinschaft zu sein, und zwar so richtig. Nicht so, wie ich auch am Heinrich-Heine-Gymnasium Teil von einer war. Ich denke, keiner meiner Schulfreunde hat das wirklich so empfunden, egal wie oft unser Rektor auch davon gesprochen hat. Es war Schule, nicht mehr. Ein Ort, an den man sich unter der Woche hinquält, bemüht, möglichst unsichtbar zu sein und keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Es muss ziemlich ätzend sein, neu an meine Schule zu kommen. Zumindest kann ich mir kaum vorstellen, dass man dort gleich auf so offene und nette Menschen wie Henry und Grace treffen würde.
Und ohne deren Hilfe hätte ich niemals den Weg gefunden. Ich folge ihnen den nicht enden wollenden Bussteig außerhalb des Flughafens entlang, und mein Herz schlägt schneller, als ich die ersten Doppeldeckerbusse entdecke. Sie sind zwar nicht rot wie in meiner Vorstellung, sondern pink und blau, aber trotzdem erinnern sie mich zuverlässig daran, dass das hier nicht Frankfurt ist. Der Shuttle der Dunbridge Academy ist ein kleiner dunkler Bus, auf dem in Weiß das Logo der Schule prangt und den ich garantiert übersehen hätte.
»Kommst du?«, fragt Henry, als ich zögere. Grace unterhält sich mit dem Fahrer, der Henrys und meine Koffer im Frachtraum verstaut, und steigt dann ein.
»Muss man etwas bezahlen?«, frage ich mit gedämpfter Stimme.
Henry schaut mich einen Moment lang irritiert an, dann lacht er. »Nein, Emma«, meint er und greift nach meinem Handgelenk. »Du bist Internatsschülerin. Du musst nur einsteigen.«
»Ach so«, murmle ich, während ich einen Fuß auf das Trittbrett stelle. Die vorderen Plätze sind bereits fast alle besetzt. Henry begrüßt die Schülerinnen und Schüler und winkt ihnen zu. Sie scheinen aus aller Welt zu kommen, um dieses Internat zu besuchen. Die meisten sehen etwas erschöpft aus, als hätten sie eine ähnlich lange Anreise hinter sich wie Henry. Ich lächle ihnen zu, während wir nach hinten durchgehen.
»Alle, die am Flughafen ankommen, können vorab im Internat Bescheid geben, damit sie abgeholt werden«, sagt Henry.
»Oh.« Ich zögere. »Ich hab nicht …«
»Das macht nichts«, unterbricht er mich. »Es ist ja noch genügend Platz.«
Ich nicke und folge ihm. Grace deutet voller Stolz auf die Rückbank, die breit genug für uns drei ist. Erstaunlicherweise sieht Grace nicht genervt aus, dabei könnte ich mir vorstellen, dass sie jetzt lieber mit Henry allein in einer der Zweierreihen sitzen würde. Um sich ungestört mit ihm zu unterhalten. Er war bei seinen Eltern, sie haben sich wochenlang nicht gesehen und sich garantiert eine Menge zu erzählen. Aber sie tun es nicht. Stattdessen deuten sie in alle möglichen Richtungen, sobald wir losfahren, und erklären mir, wo es nach Edinburgh geht und wo zum Meer. Das Internat liegt knappe dreißig Autominuten außerhalb der Stadt, und zunächst sieht die stark bebaute Gegend einfach nur sehr grau aus. Dann verlassen wir das Stadtgebiet, und fahren durch eine hügelige grüne Landschaft. Dass Edinburgh nicht weit entfernt ist, kann man hier draußen erstaunlich schnell vergessen. Außer weiten Feldern, Wäldern und ein paar Seen gibt es nicht besonders viel. Eine ganze Weile folgen wir einer schmalen Landstraße durchs Nirgendwo, dann dreht sich Henry zu mir.
»Nach der nächsten Kurve dort oben auf dem Hügel kannst du das Internat zum ersten Mal sehen.« Obwohl er diesen Anblick zur Genüge kennen muss, klingt er ein bisschen aufgeregt. »Es ist jedes Mal so, als würde man heimkommen« murmelt er, während er sich wieder zum Fenster dreht und Grace lächelnd nickt.
Wir erreichen die Hügelkuppe und passieren die Kurve. Die Straße vor uns schlängelt sich durch das Tal entlang eines Flusses, der in der Ferne ins Meer mündet. Und dann sehe ich es. Das Gelände der ehemaligen Klosteranlage samt dem großen Kirchenschiff in der Mitte ist von einer dunklen Mauer umgeben. Auf den verwinkelten Dächern ragen spitze Türme in den blauen Himmel. Die Sonne glitzert auf der glatten Oberfläche eines kleinen Sees, und im Hintergrund sind die Häuser des Nachbardorfs zu erkennen.
»Wow«, murmle ich.
Henry nickt. »Oder?« Er wirft mir einen Blick über die Schulter zu. Seine verfluchten, sehr grünen Augen leuchten. »Willkommen zu Hause, Emma aus Deutschland.«
4. KAPITEL
HENRY
Es ist das vorletzte Mal, Henry. Das vorletzte Mal nach den Sommerferien in der Dunbridge Academy ankommen, mit diesem vorfreudigen Kribbeln im Bauch aus dem Bus steigen und den gepflasterten Innenhof betreten. Ich wünschte wirklich, ich wäre mir dieser Tatsache nicht so bewusst, während ich mich umsehe.
Ich entdecke auf der Stelle mindestens fünf Leute, die ich dringend begrüßen muss, während ich darauf warte, dass mein Koffer ausgeladen wird. Stimmen und Lachen erfüllen die Luft, Eltern unterhalten sich, Lehrer laufen zwischen den Grüppchen und Gepäckbergen hin und her. Die Neuankömmlinge erkennt man gleich daran, dass sie etwas verschüchtert aussehen.
Ich schaue mich nach Emma um, die bereits von Tori aus dem Begrüßungskomitee belagert wird, als Grace nach meinem Arm greift.
»Du kommst doch zum Mittagessen, oder? Mum freut sich riesig«, sagt Grace. Schon eben auf der Fahrt hat sie danach gefragt, und diesmal komme ich nicht um eine Antwort herum.
»Jetzt gleich?« Ich blicke noch mal verstohlen in Emmas Richtung. Eigentlich wollte ich ihr alles zeigen. Damit sie nicht auf die Idee kommt, Heimweh zu kriegen.
»Wir können noch deine Sachen aufs Zimmer bringen und dann los«, schlägt Grace vor. Ich zögere, dabei haben wir das immer so gemacht. »Oder willst du nicht?«
»Doch«, sage ich schnell. Ihr Gesicht ist gebräunter als vor meiner Abreise, ihre Haare länger. Nur der Pony, der ist neu. »Ich muss aber spätestens um vier zurück sein. Rektorin Sinclairs Willkommensansprache«, erkläre ich, als Grace die Stirn runzelt.
»Stimmt, fast vergessen, Mr Schulsprecher.«
Ich muss lächeln. Dann hebe ich die Hand und verwuschle ihre Ponysträhnen. »Süß übrigens.«
»Ja, magst du’s?« Sie streicht die Haare wieder glatt. »Es war eine Kurzschlusshandlung, die ich womöglich bereuen werde. Neues Schuljahr, neues Ich, du weißt schon.«
»Na, ihr Turteltäubchen?«, ruft Sinclair, bevor ich etwas erwidern kann. Kurz darauf umarme ich meinen besten Freund, der ebenso wie Tori in einem der dunkelblauen Polos der Schule steckt. »Soll ich dir den Weg zu deinem Flügel zeigen?«
»Halt’s Maul, Alter.«
Grace verdreht die Augen, bevor sie ihn ebenfalls begrüßt.
»Entschuldige bitte? Muss ich meine Mutter darüber informieren, dass ihr neuer Schulsprecher flucht?«
»Nur, wenn er Jetlag hat«, sage ich.
»Jetlag? Ich dachte, es ist kein Jetlag, wenn …«
»Ist es auch nicht«, bemerkt Grace und greift nach meinem Koffer. »Kommst du?«
Ich werfe Sinclair einen entschuldigenden Blick zu, auf den er mit einem Schulterzucken antwortet.
»Wir sehen uns, Henry Harold Bennington«, ruft er, bevor ich Grace folge. Auf dem Weg zum Ostflügel, in dessen drittem Obergeschoss sich dieses Jahr mein Zimmer befindet, bleiben wir noch ein paarmal stehen, weil ich Leute aus unserer Stufe sehe. Ich begrüße Omar und Gideon aus dem Rugbyteam, Inés, Salome und Amara, mit denen ich in denselben Kursen sitze. Grace wirft einen ungeduldigen Blick auf die Uhr, als ich meinen Koffer endlich über die Schwelle der Tür schiebe und das alte Gemäuer betrete.
»Du kannst auch schon los, und ich komme nach«, schlage ich ihr vor.
»Nein, nein.« Sie winkt ab. »Oder willst du erst noch auspacken?«, fragt sie.
Eigentlich wollte ich das tatsächlich. Duschen, auspacken, vielleicht sogar kurz schlafen, auch wenn ich weiß, dass ich das besser nicht sollte.
»Du kannst bei mir duschen«, bietet Grace an, als hätte sie meine Gedanken gelesen. »Dann musst du nicht in die Gemeinschaftsduschen.«
»Elfte Klasse«, erinnere ich sie, während ich meinen Koffer die Stufen hinauftrage. Und was das bedeutet, weiß jeder an dieser Schule seit der fünften Klasse. Endlich keine Schlafsäle und geteilten Räume mehr, sondern Einzelzimmer mit eigenem Bad.
»Ihr Glücklichen.« Grace seufzt, dabei genießt sie den Luxus eines eigenen Zimmers schon lange. Ich würde nicht mit ihr tauschen wollen. Klar, oft war es auch anstrengend, mit so vielen Jungs ein Zimmer zu teilen, aber ich würde die Erinnerungen um nichts in der Welt missen wollen. Ich denke, es sagt alles, dass Sinclair nicht bei seinen Eltern in Ebrington lebt, sondern seit der fünften Klasse die gemeinsamen Nächte in den Schlafsälen vorzieht. Als Sohn der Rektorin kann man es sich praktischerweise aussuchen. Besonders die letzten beiden Jahre mit Sinclair, Omar und Gideon in unserem Viererzimmer haben uns so richtig zusammengeschweißt. Es ist fast ein bisschen traurig, dass wir von nun an jeder ein eigenes Zimmer haben. Zumindest sind wir alle auf demselben Flur.
Ich melde mich bei Mr Acevedo, unserem diesjährigen Flügelbetreuer, der mir die Schlüssel für mein neues Zimmer aushändigt. Vom Fenster aus, das gen Osten geht, blickt man über die Sportanlage. Ansonsten unterscheidet es sich nur wenig von den anderen Räumen, die ich bisher bewohnt habe, außer dass es natürlich viel kleiner ist.
Ich dusche tatsächlich und fühle mich anschließend fast wie neugeboren.
»Bist du so weit?«, fragt Grace, als ich fertig bin. Sie springt von meinem Bett auf, geht zur Tür und greift bereits nach der Klinke. »Mum will wissen, wo wir bleiben. Ich glaube, sie und Dad haben dich mehr vermisst als ich«, scherzt sie, und ich lächle, aber irgendwie spüre ich dabei einen Stich in der Brust. Vielleicht weil ich während der fünf Wochen in Kenia tatsächlich nicht halb so oft an Grace gedacht habe, wie ich es vermutlich hätte tun sollen. In den letzten Jahren haben wir oft stundenlang geskyped, während ich weg war. Diesmal sind ganze Tage vergangen, an denen wir uns nicht einmal eine Nachricht geschickt haben. Und ich kann nicht gerade sagen, dass mir das viel ausgemacht hätte. Es ist mir wohl einfach etwas egal gewesen, schätze ich, und das gefällt mir nicht.
Andererseits wollte ich mich ganz auf die Zeit mit meiner Familie konzentrieren. Früher sind Mum und Dad in den Ferien immer nach Schottland gekommen. Seit ein paar Jahren aber besuchen Theo, Maeve und ich sie im Sommer an ihrem jeweiligen Einsatzort. Seit letztem Herbst ist das ein internationales Krankenhaus etwas außerhalb von Nairobi. Natürlich waren wir nicht die gesamten fünf Wochen dort, Mum und Dad hatten frei, sodass wir zusammen nach Südafrika reisen konnten. Ich erinnere mich vage an die Zeit in Johannisburg vor einigen Jahren, als ich noch nicht an der Dunbridge Academy war, sondern immer dort zur Schule gegangen bin, wo meine Eltern gerade gearbeitet haben. Vermutlich ist es nicht normal, schon mit zwölf auf ein Internat zu gehen und seine Eltern nur wenige Wochen im Jahr zu sehen. Ohne meine älteren Geschwister, die gleichzeitig mit mir hierhergekommen sind und mittlerweile in St Andrews studieren, wäre es bestimmt sehr viel schlimmer gewesen. Vor allem ohne Maeve … Einen neuen Freundeskreis hatte sie zwar ebenso schnell wie Theo, aber sie hat mir trotzdem nie das Gefühl gegeben, sie zu nerven.
Und auch wenn mir der Start hier nicht ganz leichtgefallen ist, die Dunbridge Academy war die erste Konstante in meinem Leben. Ein Ort, der immer da war und sich nie verändert hat, wenn ich nach den Ferien zurückgekommen bin. Bekannte Gesichter, Freundinnen und Freunde, die meine Sprache sprechen.
In diesem Moment denke ich wieder an Emma und bekomme so etwas wie ein schlechtes Gewissen. Weil ich weiß, wie es ist, neu zu sein und sich verloren und überfordert zu fühlen. Ich wollte eigentlich ein bisschen auf sie aufpassen, aber was mache ich stattdessen?
Ich schlucke.
Das, was ich sollte. Mit meiner Freundin, die ich wochenlang nicht gesehen habe, zu ihrer Familie gehen.
EMMA
Der Innenhof der Dunbridge Academy gleicht einem Bienenstock. Überall stehen große Landrover, dunkle SUVs und Limousinen, aus denen Eltern Reisetaschen und Koffer wuchten, während sich die Schülerinnen und Schüler begeistert begrüßen. Manche von ihnen tragen bereits die Schuluniform, die meisten haben aber noch Freizeitkleidung an.
Henry habe ich längst aus den Augen verloren. Nachdem wir aus dem Bus gestiegen sind, wurden er und Grace sofort von Dutzenden Leuten begrüßt. Die beiden scheinen so gut wie jeden hier zu kennen. Anders als ich, aber ich will nun auch nicht wie eine Klette an ihnen hängen.
»Du siehst aus, als wärst du neu.«
Ich drehe den Kopf und schaue in das mit Sommersprossen übersäte Gesicht eines Mädchens in meinem Alter. Ihre langen kupferroten Haare sind zu einem ordentlichen Zopf geflochten, der ihr über die Schulter fällt. »Ich bin Tori, hi. Elfte Klasse und für die Neuankömmlinge zuständig.«
Mein Herz macht einen erfreuten Satz. Elfte Klasse. So wie ich.
»Ich bin Emma«, stelle ich mich vor. Man muss mir meine Erleichterung anhören, denn Tori schenkt mir ein beruhigendes Lächeln, bevor wir uns die Hände schütteln. Sie trägt ein Poloshirt mit dem gestickten Schulwappen oberhalb der linken Brust. Darunter ist ein Namensschild angebracht.
»Freut mich, Emma. Willkommen an der Dunbridge.«
Ich denke, das ist der Moment, in dem ein Teil von mir, der sich bisher nicht komplett sicher war, versteht, dass das gerade wirklich passiert. Bevor ich mich entscheiden kann, ob ich diese Tatsache gut oder schlecht finde, spricht Tori auch schon weiter.
»Kann ich dir mit deinem Gepäck helfen? In welche Klasse gehst du? Dann stelle ich dich deiner Flügelbetreuerin vor.«
»In die elfte.« Ich schlucke. »Ich mache ein Austauschjahr.«
»Oh, wie cool! Dann sind wir in derselben Stufe. Ich bringe dich rüber.« Tori sieht zu meinen Koffern. »Bist du ganz allein hergekommen?«
Ich nicke und lächle verkrampft. »Meine Mutter wollte mich bringen, aber das hat nicht geklappt.«
»Oh, verstehe.«
»Nicht schlimm«, sage ich schnell, ohne es wirklich zu wollen. Doch noch weniger will ich, dass alle sofort Mitleid mit mir bekommen.
»Jetzt bist du hier«, meint Tori gut gelaunt und greift nach einem meiner Koffer. »Mir nach.«
Ich folge ihr durch die Arkaden, über die die alte Kirche im Zentrum des Internats zu beiden Seiten hin mit den länglichen Gebäuden verbunden ist, die das Gelände einmal ganz umschließen. Tori hält sich links, bis wir eine geschwungene Treppe aus glattem Stein erreichen. Überall laufen Schülerinnen und Schüler herum, manche in Grüppchen, manche mit ihren Eltern. Immer wieder winkt Tori jemandem zu. Sie scheint verflucht viele Leute zu kennen.
»Nachher zeige ich dir alles in Ruhe, wenn du willst. Ich bin seit der fünften Klasse hier und kenne jeden Winkel.« Sie deutet in die Richtung, aus der wir gekommen sind. »In der alten Kirche befindet sich der Speisesaal, gegenüber kommst du zu den Unterrichtsräumen im Südflügel. Hier im Westflügel ist der Mädchenschlaftrakt, die Jungs sind gegenüber im Ostflügel untergebracht. Ab der neunten Klasse gibt es ein Stockwerk pro Jahrgang, die Jüngeren bis zur achten Klasse haben ihre Schlafsäle drüben im Nordflügel.« Am Fuße der Treppe bleibt Tori stehen. »Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute: Unsere Zimmer sind fast ganz oben, nur die Zwölftklässler direkt unterm Dach haben einen besseren Ausblick. Die schlechte ist, es gibt keinen Fahrstuhl.«
»Oh.« Ich zögere, als sie nach meinem Gepäck greift. »Du musst das nicht machen, ich kann auch einfach zweimal …«, beginne ich, doch Tori hebt missbilligend die Augenbrauen.
»Ich bitte dich! Natürlich helfe ich dir. Du bist jetzt Familie.«
Sie lächelt, und für einen kurzen Moment habe ich das Gefühl, in Tränen ausbrechen zu müssen. Es klingt nicht wie eine Floskel, besonders wenn ich daran denke, wie herzlich Tori eben die anderen Schülerinnen und Schüler begrüßt hat.
»Wir fragen gleich bei Ms Barnett, welches Zimmer dir zugeteilt wurde.« Tori keucht leise, während sie mit dem kleineren meiner Koffer die ausgetretenen Steinstufen hochsteigt. »Sie ist für den dritten Stock zuständig und deine direkte Ansprechpartnerin.«
»Meine Flügelbetreuerin also?«, vermute ich, während ich Tori folge. Die schnellen Schritte einer Gruppe jüngerer Mädchen, die uns auf der Treppe entgegenkommen, hallen von den unverputzten Wänden wider.
»Du lernst schnell.« Tori grinst und deutet in den Flur im ersten Obergeschoss. »Im ersten Stock sind die Zimmer der Neuntklässlerinnen, im zweiten die der Zehnten und so weiter.«