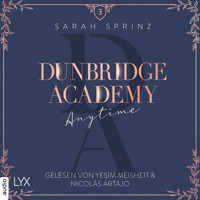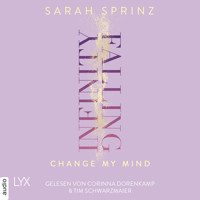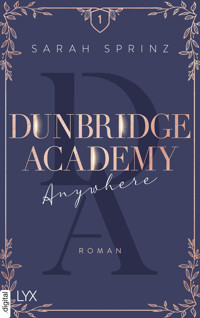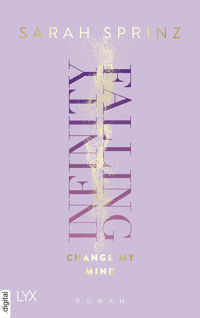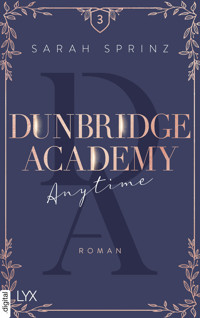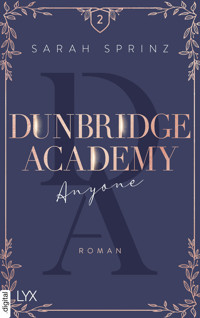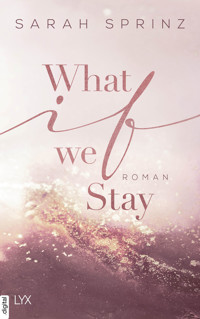12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ansel und Emil: die erste große Liebe und eine unvergessliche Reise mit Momenten voller Glück - und Traurigkeit.
Emil wird sterben. Es ist das Erste, was Ansel über ihn erfährt, als er ihn bei seinem Praktikum auf der Intensivstation kennenlernt. Eine Tatsache, die sich nur zu leicht ignorieren lässt, während sich die beiden Hals über Kopf ineinander verlieben und sich in ihrem gemeinsamen Universum verlieren. Da zählt nur noch Emils Wunsch, den Ansel erfüllen möchte: einen Roadtrip bis nach Schottland. Auf dieser Reise wächst Ansel über sich hinaus und ist schließlich doch kein bisschen bereit für das Unausweichliche ...
Eine der schönsten Liebesgeschichten für Jugendliche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Emil wird sterben. Es ist das Erste, was Ansel über ihn erfährt, als er ihn bei seinem Praktikum auf der Intensivstation kennenlernt. Eine Tatsache, die sich nur zu leicht ignorieren lässt, während sich die beiden Hals über Kopf ineinander verlieben und sich in ihrem gemeinsamen Universum verlieren. Da zählt nur noch Emils Wunsch, den Ansel erfüllen möchte: einen Roadtrip bis nach Schottland. Auf dieser Reise wächst Ansel über sich hinaus und ist schließlich doch kein bisschen bereit für das Unausweichliche ...
Die Autorin
© Privat
Sarah Sprinz wurde 1996 geboren. Bereits während des Medizinstudiums hat sie sich mit ihren Büchern für junge Erwachsene auf die SPIEGEL-Bestsellerliste geschrieben. »In unserem Universum sind wir unendlich« ist ihr erster Roman für Jugendliche. Die Autorin lebt am Bodensee.
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Thienemann auch!Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor*innen und Übersetzer*innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator*innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher, Autor*innen und Illustrator*innen:www.thienemann.de
Thienemann auf Facebook:www.facebook.com/thienemann.esslinger
Thienemann auf Instagram:www.instagram.com/thienemann_esslinger_verlag/
Viel Spaß beim Lesen!
Für Simon.
Danke, Universum.
EINS
Alles war möglich nach dem Abitur. Weltreise, Work and Travel, Au-pair, FSJ, Umzug in die Unistadt, zum ersten Mal alleine wohnen, zum ersten Mal leben. Einen Sommer lang an Fließbändern irgendwelcher Firmen stehen, großes Geld für große Pläne. Oder unbezahlt auf einer Intensivstation im Krankenhaus arbeiten, so wie ich. Weil es mit dem Medizinstudium nicht geklappt hatte wie geplant. Es war ernüchternd, wenn man begriff, dass es dort draußen niemanden interessierte, wie sehr man etwas wollte. Da warst du keine Person, sondern nur deine Abiturnote, entweder sie war gut genug oder eben nicht. Träume starben, Menschen auch. Einfach so. Einfach so …
Unter der Woche klingelte mein Wecker, bevor die ersten Sonnenstrahlen über den Horizont kletterten. Früh also. Wir hatten September, es dämmerte bereits um kurz nach sechs. Sehr, sehr früh.
Manchmal war ich um diese Zeit gleichzeitig online wie Ella und Henning, die von Partys kamen, die ich am Abend zuvor spätestens gegen elf verlassen hatte. Aufstehen um vier Uhr fünfundvierzig war keine schöne Sache. Erst recht nicht, wenn meine Freunde währenddessen den Sommer nach dem Abschluss genossen. Freiheit, bevor es für sie alle weiterging. Für jeden außer mir.
Ich lief nach unten in die Küche, als ich im Flur ein Geräusch hörte. Es war Noah, der gerade nach Hause kam. Mein großer Bruder, dem alles ein bisschen egaler war als mir. Eine Charaktereigenschaft, für die ich ihn beneidete, aber das würde ich ihm nie sagen.
Obwohl es draußen regnete, waren Noahs Haare trocken, denn was uns beide voneinander unterschied, war in erster Linie das Auto, das er besaß. Na ja, und noch ein paar andere Dinge.
»Hey!« Er gab sich nicht einmal Mühe, leise zu sein. »Von wo kommst du?«
Fast hätte ich gelacht. War das sein Ernst?
»Ich gehe«, sagte ich und Noah schien sich zu erinnern.
»Ach, stimmt ja.«
»Und du? Von wo kommst du?«, fragte ich und warf mir meinen Rucksack über die Schulter.
»Von Natalies Geburtstag.«
Ich hatte ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, wer Natalie war – im Zweifel war sie hübsch und bald nicht mehr Single –, nickte aber trotzdem.
»Soll ich dich fahren?« Überrascht hob ich den Kopf. »Draußen ist es furchtbar. Da fährst du doch nicht echt mit dem Fahrrad?«
»Lieber als jetzt noch mit dir Auto«, entfuhr es mir. Noah hob eine Braue.
»Ich trinke nicht, wenn ich fahre«, sagte er und klang so kühl, dass ich mich schämte. Ich schaffte es immer wieder, wenn ich den Mund aufmachte, einen Keil zwischen mich und meinen Bruder zu treiben. Als müsste ich ihn permanent daran erinnern, dass uns zwei nicht mehr verband als der gemeinsame Nachname. Mit Sicherheit war er froh darüber, dass höchstwahrscheinlich niemand, der uns beide sah, auf die Idee käme, dass wir Geschwister sein könnten. Noah, der garantiert keinen Tag seines aufregenden Lebens damit verschwendete, über die Zukunft zu grübeln. Er lebte einfach. Trug diese weiten Holzfällerhemden mit einer Selbstverständlichkeit und einen viel zu lässigen Haarschnitt. Brach Ausbildungen ab, die ihm nicht gefielen, und fuhr mit selbst ausgebauten Campervans durch Europa, einfach weil er es konnte. Natürlich wollte ich insgeheim sein wie er, aber weil wir beide wussten, dass daraus nichts wurde, hatte ich beschlossen, das exakte Gegenteil zu sein. Ob das klug war, musste ich noch herausfinden. Möglich, dass er mehr vom Leben hatte.
»Also?« Noah sah mich erwartungsvoll an. »Ja oder nein?«
Ich nickte. Als ich neben Noah aus dem Regen in den Van kletterte, dankte ich ihm im Stillen. Er ließ den Motor an und der Wagen erwachte unter uns röchelnd zum Leben. Ich warf einen verstohlenen Blick über die Schulter. Noah hatte den Platz hinter den beiden Vordersitzen zu einer Sitzecke mit schmaler Küchenzeile umfunktioniert. Weiter hinten lag eine große Matratze auf einer Holzvorrichtung, zu der man über die Hecktüren Zugriff hatte und unter der man eine erstaunliche Menge an Dingen verstauen konnte.
Noah jagte den Van in halsbrecherischer Geschwindigkeit die engen, regennassen Straßen hinab. Ich bekam ein bisschen Angst, aber er schien den Wagen im Griff zu haben. Als er mich fünf Minuten später überpünktlich am Krankenhaus absetzte, war ich trotzdem froh, dass ich aussteigen konnte.
»Danke«, sagte ich und Noah machte eine wegwerfende Geste.
»Kein Thema.« Ich hatte die Hand bereits am Türöffner. »Wie kommst du heim? Soll ich dich abholen?«
Ich hätte gerne Ja gesagt, stattdessen sagte ich: »Ich kann laufen. Wenn es nicht mehr so regnet. Sonst fahre ich Bus.«
Toll, Ansel. Ganz toll. Warum war ich so?
»Gut, dann …« Ich spürte Noahs Blick im Nacken. »Viel Spaß heute.«
»Danke.« Ich stieß die Tür auf und das laute Prasseln des Regens drang ins Wageninnere. Ich sprang heraus, schlug die Tür zu und machte, dass ich wegkam.
Im Foyer schüttelte ich mich wie ein nasser Hund. Plötzlich fielen mir eine Menge Dinge ein, die ich noch hätte zu Noah sagen können. Wie läuft die Ausbildung? Hast du mal Lust, was zu zweit zu machen? Tut mir leid, dass ich immer so blöd bin.
Ich würde es ihm heute Mittag sagen. Oder nie. Mal sehen. In der Umkleide im Keller schlüpfte ich in die blaue Klinikkleidung, starrte meinem Spiegelbild entgegen und ging dann nach oben. Alles war wie immer. Die Intensivstation ruhig, das Personal aus der Nachtschicht müde, der Kaffee heiß und meine Zunge verbrannt.
Ich mochte die Arbeit. Sie kam mir sinnvoll vor. Die meiste Zeit verstand ich zwar recht wenig von den Medizinwörtern, die die Pflegekräfte und Ärzte benutzten, aber manchmal schlug ich die Begriffe abends im Internet nach, einfach, weil es mich interessierte.
Ich mochte auch den Großteil der Belegschaft hier. Insbesondere Stationsleitung Brigitte, sie war streng, aber ich glaube, sie schätzte mich. Bei ihr durfte ich auch Dinge wie Medikamente richten üben und musste nicht nur Bettzeug wechseln und den Patienten beim Waschen helfen.
Ich machte meine Morgenrunde mit dem Fieberthermometer, brachte das Blut ins Labor, verteilte das Frühstück. Die Ärzte kamen zur Visite vorbei, Brigitte schickte mich mit, damit ich etwas lernte, was ich in der Regel nur tat, wenn Doktor Meller, die Oberärztin der Neurochirurgie, Dienst hatte. Vermutlich hatte sie Mitleid mit mir, denn sie war immer nett und ignorierte mich nicht. Manchmal bot sie mir sogar an, später mit in den OP zu kommen, um zuzusehen.
An diesem Morgen kam sie zu spät. Die anderen Ärzte waren bereits in Zimmer drei und Doktor Meller lächelte mich nicht an. Sie wirkte gestresst, irgendwie abwesend, während sie neben mir an der Wand gelehnt stand und der Übergabe lauschte. Als die Visite beendet war, kratzte ich all meinen Mut zusammen.
»Gibt es heute vielleicht etwas Spannendes im OP?«, fragte ich, während die anderen Ärzte bereits wieder verschwanden.
Doktor Meller sah so irritiert in meine Richtung, als hätte sie mich bis eben überhaupt nicht bemerkt. Ich bereute meine Frage sofort.
»Oh, Ansel. Ich glaube, heute ist kein guter Tag dafür«, sagte sie.
Ich wollte fragen, warum das so war, aber ich besaß genügend Einfühlungsvermögen, um mir sicher zu sein, dass ich es besser einfach sein ließ. Hatte ich etwas falsch gemacht? Vielleicht war sie genervt von mir, im Grunde konnte ich ihr das nicht verübeln, schließlich bedeutete es immer zusätzliche Arbeit, wenn sie mich mitnahm und alles erklären musste. Außerdem war ich hier, um zu arbeiten. Als Pflegepraktikant, und die hatten im OP nichts verloren.
Ich wollte mich gerade entschuldigen, als Doktor Mellers Telefon zu klingeln begann. Sie sah nicht mehr zu mir, bevor sie sich umdrehte und es im Gehen aus ihrer Kitteltasche nahm.
Ich kam mir recht lästig vor und fragte Katrin, die heute zusammen mit Brigitte Frühdienst hatte, ob ich ihr bei etwas helfen konnte. Tatsächlich hatte sie ausreichend Aufgaben, um mich bis zur Frühstückspause zu beschäftigen. Als ich schließlich neben den beiden im Aufenthaltsraum saß, war es draußen unbemerkt hell geworden. Ich mochte das, wenn die Nacht dem Morgen wich, Menschen aufwachten, zur Arbeit fuhren, diese alltäglichen Dinge taten, während ich hier drin in einer anderen, sterilen Welt lebte und nichts davon mitbekam. Es gab keine Blicke aufs Handy, keine Nachrichten, es gab nur mich und sehr viel zu tun. Ich sah im Aufenthaltsraum herum, betrachtete die Postkarten an der Wand, die Abschiedsschreiben von Patienten oder deren Familien, fast immer lag eine Schachtel teure Schokolade auf dem Tisch als Dank von irgendwem. Man aß sie zum Frühstück oder vor dem Frühstück oder als Frühstück, jede Gelegenheit musste ergriffen werden, etwas in den Magen zu bekommen, man wusste nie, wann es wieder so weit sein würde. Hatte man nur fünf Minuten nichts zu tun, empfahl es sich, sofort auf die Toilette zu gehen, egal ob man musste oder nicht, das hatte ich inzwischen auch gelernt. Mein Blick glitt über den Bildschirm mit den Patientenwerten, von denen ich nicht allzu viel verstand, zu Katrin. Zwischen einem Bissen Brezel und einem Schluck Kaffee sah sie zu Brigitte.
»Heiko hat gerade angerufen, sie bringen Emil Meller aus dem OP direkt zu uns. Der Aufwachraum ist gerade voll belegt.«
Brigitte sah von ihrer Kurve auf. »Doktor Mellers Sohn? Warum ist er diesmal hier?« Sie musste diesen Teil der Übergabe heute Morgen ebenso verpasst haben wie ich, als ich meinen Botengang ins Labor erledigt hatte.
»Er hatte Sehstörungen, sie resezieren noch mal um den Sehnerv herum.«
Brigittes Seufzen sagte alles und nichts. Eine seltsame Stimmung legte sich zwischen Katrin und sie. Ein vielsagendes Schweigen, das ich nicht verstand, wohl aber begriff, dass ich besser nicht nachfragte.
Doktor Meller hatte einen Sohn. Es überraschte mich, obwohl es das nicht müsste, warum sollte sie keinen haben? Sie dürfte etwas jünger sein als meine Mutter, Anfang vierzig vielleicht und einen Ehering trug sie auch. Ich schluckte. Hoffentlich war es nichts Schlimmes.
»Waren sie erfolgreich?«, fragte Brigitte und ich spitzte die Ohren.
»Ich weiß es nicht, Heiko klang nicht besonders enthusiastisch.«
»Warum lassen sie den Jungen nicht einfach in Frieden?«, murmelte Brigitte. Ich bekam ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Das klang nicht so, als würde es sonderlich rosig für ihn aussehen.
»Du würdest es genau so wollen, wenn du die Möglichkeit hättest, deinen Sohn vielleicht doch zu retten.« Katrin dämpfte die Stimme. Sie sprachen leise miteinander, fast so als befürchteten sie ständig, gehört zu werden. Ich musste mir vorstellen, wie das ganze Krankenhaus über Doktor Meller und ihren kranken Sohn redete und bekam erst recht ein schlechtes Gewissen. Kein Wunder, dass sie eben so durcheinander gewesen war.
»Du hast schon recht.« Brigitte seufzte. »Ich nehme ihn wieder, du hast heute genug Patienten. Außerdem habe ich ja tatkräftige Unterstützung. Ansel«, sagte sie plötzlich zu mir und ich zuckte zusammen, »bist du so lieb und richtest ein Infusionssystem und bereitest den Platz vor?«
»Klar.« Ich wollte gerade aufstehen, doch Brigitte hielt mich zurück, während Katrin nach draußen ging.
»Trink erst aus, so eilig ist es nicht.«
»Ist das der Sohn von Doktor Meller aus der Neuro?« Ich wusste nicht, warum ich fragte. Es ging mich nichts an.
Brigitte nickte.
»Was hat er?«
»Einen Hirntumor, ein Grad IV Astrozytom, das vor etwa anderthalb Jahren entdeckt wurde. Schlimme Geschichte, gerade weil die Familie selbst genau weiß, wie schlecht es aussieht.«
Ich schluckte. »Wie schlecht denn?«
»Der Tumor ist extrem bösartig und sitzt nahe eines wichtigen Zentrums für Sprache. Wenn du magst, können wir uns nachher die Bilder anschauen. Mit Chemo, Bestrahlung und zwei OPs sah es erst erstaunlich gut für Emil aus, doch der Tumor kam zurück. Emil hat noch ein paar Monate, wenn das Schicksal auf seiner Seite ist. Wenn nicht, eher Wochen.«
Mir wurde kalt. Schnell nahm ich einen weiteren Schluck Kaffee.
»Er dürfte etwa so alt sein wie du«, sagte Brigitte. »Kennt ihr euch?«
Ich schüttelte den Kopf, während ich in meinem Hirn kramte. Emil Meller, Emil Meller … Noch nie gehört.
Ich wusste nichts Angemessenes zu sagen und wurde erlöst, als Katrins Stimme durch den Flur zu uns drang.
»Brigitte? Sie kommen.«
»Oh.« Sie sprang auf. »Doch schneller als erwartet.«
Ich folgte ihrem Beispiel und verschluckte mich fast an meinem Rest Kaffee. Ich rieb meine Hände an meiner Hose trocken, aus mir unersichtlichen Gründen hatten sie zu schwitzen begonnen. Den Kopf voll wirrer Gedanken tastete ich nach dem Desinfektionsmittelspender, wollte zum Medikamentenschrank abbiegen, da wurde es bereits laut auf dem Flur. Unter das Zischen der Schiebetüren mischte sich gleichmäßiges Piepen der Maschinen. Mehrere Menschen liefen neben dem Intensivbett, das aus dem OP-Bereich hergeschoben wurde. Ich erkannte Heiko aus der Anästhesie und neben ihm, ebenfalls noch mit OP-Haube und Mundschutz, Doktor Meller. Ihr Blick lag auf ihrem Sohn, der von alldem nichts mitbekam.
Er war wirklich kaum älter als ich, braune Haare, die Augen geschlossen und Haut, so pergamentpapierblass, dass ich die bläulich schimmernden Venen darunter selbst auf die Entfernung erkennen konnte. Mein Herz stolperte. Während der letzten Wochen auf dieser Intensivstation hatte ich alles Mögliche gesehen, doch noch nie so jemand Junges wie Emil Meller. Und es gab keine Hoffnung für ihn.
Ich begriff nicht, was passierte, stand nur wie festge-froren da und starrte ungeniert. Dann legte sich eine Hand auf meine Schulter. Erschrocken fuhr ich herum. Katrins aufmerksamer Blick ruhte auf mir. Ich hatte keine Ahnung warum, doch mir schoss sofort die Hitze in die Wangen.
»Geh ruhig mit rein und hör bei der Übergabe zu, ich erledige das hier. Du willst doch was lernen.«
Ich nickte mechanisch, bewegte mich nicht vom Fleck, bis Katrin mir einen sanften Schubs verpasste. Zögerlich folgte ich Brigitte und den Ärzten in das Zimmer, hielt mich an der Wand, um nicht im Weg zu stehen, während Doktor Mellers Sohn in Windeseile mit allen Geräten verkabelt wurde. Heiko sprach, ich verstand kein Wort, konnte nur Emil ansehen. Er regte sich nicht.
Brigitte bemerkte mich und deutete Richtung Blutdruckmanschette. Ich verstand und folgte ihrer Aufforderung stumm.
Meine Gedanken standen still. Das Ratschen des Klettverschlusses war unerträglich laut. Doktor Mellers Sohn blinzelte. Und dann sah er mich an. Tiefbraune, leicht verschleierte Augen und ich konnte plötzlich nicht mehr atmen.
»Hi«, brachte ich heraus und schluckte das Kratzen in meiner Kehle herunter. Ich hatte das Bedürfnis, mich vorzustellen. »Ich bin Ansel.« Unbeholfen hob ich die Blutdruckmanschette etwas hoch und hoffte, dass er begriff, was ich von ihm wollte. »Darf ich?«
Er nickte stumm, dann teilten sich seine Lippen und formten fast lautlos seinen Namen. Ich bekam sofort ein schlechtes Gewissen.
»Du musst nicht reden«, murmelte ich, seine Lider schlossen sich flatternd. Ich zögerte, als Emil sich nicht weiter regte, dann fiel mir wieder ein, dass die frisch operierten Patienten oft zu müde waren, um mir den Arm entgegenzuheben. Meine Finger bebten, als ich sie unter die Decke schob und Emil von der Manschette aus dem OP befreite. Sein Arm lag tonnenschwer in meiner Hand, ich merkte, wie er versuchte zu helfen, es aber nicht schaffte.
»Schon gut«, murmelte ich leise, um die Übergabe nicht zu stören, sein Arm wurde schwer. Als ich zurück in sein Gesicht schaute, waren seine Augen immer noch zu und meine ruhten zu lange auf ihm. Er war tatsächlich verdammt jung.
Heikos Stimme drang wieder zu mir durch, ich hörte ihn Medikamente nennen, von denen ich keine Ahnung hatte. Mittel gegen Übelkeit, Krampfanfälle, Emils niedrigen Blutdruck und weiß der Geier was. Ich drehte den Kopf und blickte geradewegs in Doktor Mellers blasses, aber gefasstes Gesicht.
Mir stieg erneut die Hitze in die Wangen, ich wusste nicht warum, doch ich fühlte mich plötzlich ertappt.
Rasch trat ich von Emils Bett zurück. Das kurze Lächeln, das sie mir schenkte, erreichte ihre Augen nicht, aber beruhigte mich trotzdem. Ich verharrte an der Wand, um dem restlichen Gespräch zu lauschen. Brigitte huschte fast lautlos um Emils Bett herum, tauschte EKG-Elektroden aus, ich glaubte, er war wieder eingeschlafen. Eine halbe Ewigkeit verging, ich stand nur reglos da, während Brigitte, Heiko, inzwischen auch Katrin und ein weiterer Arzt nach einem kurzen Blick auf Emil schweigend aus dem Zimmer gingen. Nur Doktor Meller blieb. Sie legte ihm eine Hand an die Wange, dann siegte der mickrige Rest meines Verstandes und ich drehte mich weg.
Auf dem Stationsflur herrschte bedrückende Stille. Heiko schrieb etwas auf sein Narkose-Protokoll, im Normalfall hätte ich gefragt, ob er es mir erklärte, doch jetzt konnte ich keinen klaren Gedanken fassen. Brigitte war zum Wartebereich gegangen, wo ein Mann saß, groß und schlank, dunkle Haare, Emils Augen. Die Beine übereinandergeschlagen und die Finger so fest ineinander verschränkt, dass die Knöchel weiß hervortraten. Neben ihm saß ein vielleicht vierzehnjähriges Mädchen, das verunsichert zwischen ihm und Brigitte hin und her sah.
Ich verstand nicht, was sie zu ihnen sagte, der Mann fuhr sich nach den ersten Sätzen mit beiden Händen übers Gesicht. Seine Schultern hoben und senkten sich zitternd, er nickte, sah das Mädchen an. Sie gingen den Weg in Emils Zimmer, ohne dass Brigitte ihn ihnen zeigen musste. Sie schienen nicht zum ersten Mal hier zu sein.
Doktor Meller sah auf, in ihren Augen schimmerten Tränen, sie hob die Hand nach dem Mädchen, es drängte sich an ihre Seite, der Mann küsste sie auf die Schläfe, dann griff er nach Emils Hand. Brigitte schloss lautlos die Schiebetür.
Ernüchtert stand ich da und fühlte mich wie ein ungebetener Gast auf einer nicht sehr fröhlichen Party. Brigitte seufzte leise, ehe sie sich an einem Platz an der Schwesternstation niederließ und eine neue Kurve für die Patientenwerte heranzog. Ich setzte mich unschlüssig neben sie, wollte die seltsame Stille füllen, doch wusste nichts zu sagen. Brigitte schrieb Blutdruck- und Pulswerte auf, Medikamente und andere Dinge. Ich sah stumm zu, dann loggte sie sich am Computer ein, tippte Emils Namen in ein Feld, öffnete aus einem Meer an Dokumenten einen Ordner und winkte mich zu sich.
»Hier.« Später erinnerte ich mich oft daran, wie sie das gesagt hatte. An dieses Hier, das so schrecklich endgültig klang, die MRT-Aufnahme eines durchgeschnittenen Schädels und selbst ich konnte erkennen, dass hier etwas ganz gewaltig nicht stimmte. An das lautlose Fuck, das in meinem Kopf dröhnte. Immer wieder, Endlosschleife, Fuck Fuck Fuck. Ich starrte wortlos auf das Bild, diesen großen grellweißen Fleck mitten in einem Gehirn, der alles um sich herum verdrängte, einfach auffraß und zerstörte. Es sah böse aus, ohne Zweifel, und es würde ihn das Leben kosten, ich glaubte es ihr jetzt. Meller, Emil, stand in der linken oberen Ecke, 22.01.2003, hatte eine tickende Zeitbombe im Kopf und es war nur eine Frage von Wochen, bis sie hochgehen und alles um ihn herum mit sich in die Luft jagen würde. Besser also, ich hielt mich möglichst fern.
ZWEI
Emil Meller tippten meine Finger und es fühlte sich nicht gerade nach Fernhalten an. Eher, als täte ich etwas Verbotenes. Ich drückte Enter und Sekunden später spuckte mir die Suchmaschine unzählige Ergebnisse aus. Wie gelähmt lag ich bäuchlings auf meinem Bett. Den Rucksack hatte ich nur achtlos in die Ecke geworfen und mir den Laptop geschnappt, kaum dass ich von der Arbeit nach Hause gekommen war. Emil Meller, wer hätte es erwartet, schien ein häufiger Name zu sein. Also musste ich konkreter werden. Emil Meller Friedrichshafen gab ich ein und wurde ernüchtert. Der Emil, nach dem ich suchte, schien nicht zu existieren. Dachte ich zumindest.
Meller, Emil, Jahrgang 2003 las ich auf der zweiten Seite und mir wurde eiskalt. Ich rief den Link auf. Schule Schloss Salem entzifferte ich und fast hätte ich laut gelacht. Kein Wunder, dass ich Emil noch nie begegnet war. Das renommierte Eliteinternat befand sich zwar nur wenige Orte weiter, aber kam mir seit jeher vor wie das Tor zu einer völlig anderen Welt. Ich sah mir das Bild unter der Überschrift an.
Er war es tatsächlich. Emil. Lässig auf einem schnittigen, weißen Segelboot. Salem-Absolvent segelt erneut zum Sieg – Emil Meller fährt seinen vierten Bodensee-Regatta-Sieg ein. Mehr las ich nicht. Ich konnte nur ihn ansehen. Emil, der dastand wie das blühende Leben, marineblaue Shorts, weißes Polo, das Logo seiner wichtigen Schule auf der Brust, braun gebrannt, wirres Haar, durch das der Wind hindurchstrich und es ihm in die Stirn wehte. Und dieses Lächeln. Er strahlte, so sehr wie ich noch nie jemanden hatte strahlen sehen, und plötzlich war da ein Zwicken in meiner Brust. Als hätte man mir einen schmalen Dolch zwischen die Rippen gestoßen.
Das war nicht der Emil, den ich heute Morgen gesehen hatte. Der meine ganze Schicht verschlafen hatte, so erschöpft war er gewesen. Dieser Mensch hatte mit Segel-Emil absolut nichts mehr gemeinsam.
Nur die Augen … Tiefbraun, unendlich, wie bitterer Kaffee, fast schwarz. Er hatte mich nur einen kurzen Moment lang angesehen, aber seitdem wollte ich so viele Dinge wissen.
Ich konnte nicht sagen, wie lang ich da lag, sein Bild analysierte, die beiden Grübchen in seinen damals volleren Wangen, die dunkelbraunen, von der Sonne schon leicht ausgeblichenen Locken, die sich in seiner Stirn kringelten. Es war wie ein Zwang, dabei war ich mir nicht einmal sicher, ob das überhaupt erlaubt war. Sich Namen von Patienten zu merken, um sie im Internet zu stalken, eigentlich ziemlich daneben, doch ich konnte nicht anders. Emil Meller, dachte ich, würde sterben, offenbar konnte das keiner verhindern und plötzlich kam es mir vor wie die größte Ungerechtigkeit auf dieser ganzen verfluchten Welt.
Emil Meller war blass, aber nicht mehr ganz so blass wie gestern, als ich am nächsten Morgen auf Station einen Blick in sein Zimmer warf. Er hatte sich auf der Seite Richtung Tür zusammengerollt, die Augen noch geschlossen, immerhin war es erst kurz vor sechs und seine Nacht vermutlich ähnlich unruhig gewesen wie meine. Weil ich ihn unter keinen Umständen stören wollte, lief ich schnell zur Übergabe in den Aufenthaltsraum.
Während das Personal vom Nachtdienst berichtete, hörte ich nur halb zu. Die Kurve mit Emils Herzschlag zitterte unerbittlich am Monitor neben der Tür vor sich hin. Meine Augen klebten fest auf den kleinen und großen Zacken. Sie würden irgendwann einfach stillstehen. Und zwar nicht irgendwann-in-sechzig-Jahren-so-wie-wohl-beimir-auch, sondern irgendwann bald. Schenkte man den anderen hier Glauben, dann sogar sehr bald.
»Ansel?« Ich zuckte zusammen und blickte in Brigittes Richtung. »Würdest du dich heute um Emil kümmern? Es wäre sicher schön für ihn, mit jemandem in seinem Alter zu tun zu haben.«
Dessen war ich mir nicht so sicher, aber gut, Brigitte war die Expertin. Und sie machte sich schätzungsweise keine Vorstellung, wie unangenehm es sein konnte, einer gleichaltrigen Person beim Waschen und Anziehen zu helfen, wenn man achtzehn und sehr verwirrt war.
Ich nickte trotzdem. »Ja, klar.« Dass ich bis in die Abendstunden das Internet nach Emil Meller und seinem dummen Tumor durchforstet hatte, konnte sie schließlich nicht ahnen. Ich musste mich normal verhalten. Als wäre es mir egal. Na ja, nicht egal, aber eben auch nicht so wichtig. Emil Meller, sein Leben und seine Gesundheit gingen mich nichts an.
»Er darf normal frühstücken«, sagte Brigitte. »Du kannst ihm dann was zum Frischmachen bringen, er darf sitzen und auch kurz aufstehen, wenn er will. Falls du Bedenken hast, hol mich einfach dazu, ja?«
Ich nickte, Brigitte lächelte, dann widmete sie sich dem nächsten Thema. Als die Übergabe beendet war und sich alle an die Arbeit machten, startete auch ich meinen allmorgendlichen Rundgang mit Patientenkurven und dem Fieberthermometer. Mein Herz klopfte lauter, je näher ich Emils Zimmer kam. Schließlich gingen mir die Gründe aus, das Betreten weiter hinauszuzögern. Allerdings schlief er immer noch und am liebsten hätte ich ihn gelassen. Zu ihm zu gehen und ihn zu wecken, kam mir vor, als würde ich eine Grenze überschreiten und in das kleine bisschen Privatsphäre vordringen, das er hier mühsam um sich herum aufrechthielt.
Innerlich lachte ich auf. Ich war bereits vorgedrungen. Gestern Nacht, als ich sein Facebookprofil gefunden hatte. Die wenigen Bilder, die er veröffentlicht hatte, verrieten mir, dass er eigentlich in Wien studierte und auf Kunst und Museen stand. Eine Freundin hatte ich nirgends entdecken können. Vielleicht war ihr das mit dem Krebs-Ding zu viel geworden und sie konnte das mit dem Fernhalten besser als ich.
»Alles in Ordnung, Ansel?«
Brigittes Stimme holte mich zurück in die Realität. Jetzt musste ich wohl wirklich. Ihre Worte schienen Emil aus dem Schlaf gerissen zu haben. Er blinzelte in meine Richtung, ehe er sich auf den Rücken drehte und versuchte, etwas wacher auszusehen.
»Hey.« Ich bemühte mich so zu klingen, als wäre er nur irgendein Patient und mir das hier nicht unangenehm. »Wie geht’s dir heute?«
Emil antwortete nicht sofort. Stattdessen musterte er mich beinahe skeptisch und ich verstand. Er erinnerte sich nicht an gestern. Wie auch? Er war ja kaum in der Lage gewesen zu sprechen.
»Bist du nicht etwas jung für einen Intensivpfleger?« Seine Stimme war kratzig, ein kleines bisschen nur, klang nach Schlaf und Gerade-erst-aufgewacht-Sein. Um darüber hinwegzutäuschen, räusperte er sich und dann legte er den Kopf etwas schief, was seinen Worten die Schärfe nahm.
»Ich bin Ansel«, stellte ich mich erneut vor. Emil nickte, als hörte er das zum ersten Mal. »Ich mache hier gerade ein Praktikum.«
Er seufzte. »Den Praktikanten? Wirklich?« Er rollte die Augen, mir wurde kalt. Dann sah ich seine zuckenden Mundwinkel und die Belustigung in seinem Gesicht. Ich lachte überfordert. Es war ein surreales Gefühl.
»Emil«, sagte er dann, als wüsste ich das nicht längst. Segel-Emil, Internats-Emil. Emil mit dem Hirntumor. »Und das eben war ein Scherz.«
»Ich weiß«, erklärte ich rasch und kam etwas näher.
»Dafür sahst du gerade ganz schön verängstigt aus.«
Ich stieß die Luft aus. »Ich sah gar nicht …«
»Doch.« Emil lächelte. Als ich ihn nur weiter anstarrte, erkannte ich plötzlich, dass da etwas übrig geblieben war. Das Leuchten in seinen Augen, es war noch da. Selbst in diesem Krankenhausbett, mit Dutzenden Schläuchen im Arm hatte er sie noch. Diese verfluchte Ausstrahlung.
»Du tust es sogar schon wieder.«
»Es ist früh«, sagte ich knapp. Es klang unfreundlicher als gewollt. Schnell blickte ich zu Emil, doch das feine Grinsen lag noch immer auf seinen blassen Lippen. Sie erinnerten mich daran, weshalb ich hier war. Um nach seinen Vitalwerten zu schauen. Emil schien das längst zu ahnen. Sein Blick wanderte von der Blutdruckmanschette an seinem Oberarm zum Monitor neben dem Bett.
»Das ist ein bisschen niedrig«, murmelte ich.
Emil nickte nur. »Das ist bei mir immer so.«
Ich konnte mich irgendwie ganz schlecht konzentrieren, verrutschte mehrmals in der Zeile, bevor ich seine Blutdruckwerte endlich an der richtigen Stelle eingetragen hatte. Ich hob den Kopf, als Emil weitersprach.
»Zweiundsiebzig.«
Verwirrt sah ich ihn an. »Bitte?«
»Die Herzfrequenz.« Er erwiderte meinen Blick und da wurde uns beiden wohl bewusst, dass er sich hier deutlich besser auskannte, als ich es je tun würde. »In Rot auf die Kurve«, half er mir auf die Sprünge. »Zweiundsiebzig. Und die Sauerstoffsättigung beträgt sechsundneunzig Prozent.«
Kurz spielte ich mit dem Gedanken, so zu tun, als hätte ich das alles längst notiert. Doch Emil sah nicht aus wie jemand, dem man etwas vormachen konnte. Also lachte ich nervös und schlug den Blick nieder, während ich schrieb. »Danke.«
»Bitte, gerne.«
»Und hast du Schmerzen?«, begann ich. »Auf einer Skala von null …«
»… bis zehn ist es heute eine solide sechs.« Emil sagte es so beiläufig, sodass ich erneut den Kopf hob, ihn ansah und mich daran erinnerte, dass er gestern eine Hirn-OP gehabt hatte.
»Meinst du Kopfschmerzen, oder …?«
»Mir ist ein bisschen schlecht.« Dafür klang er erschreckend unbekümmert. »Vielleicht kann ich noch so eine Vomex wie beim letzten Mal …?«
»Ich frage Brigitte«, versprach ich. Vermutlich meinte er diese kleinen Tabletten, deren Namen ich andauernd vergaß. »Ich darf keine Medikamente ausgeben.«
»Tatsächlich?« Wieder dieses herausfordernde Grinsen. Es brachte mich um den Verstand.
»Was vermutlich auch besser so ist«, fügte ich lahm hinzu.
»Bist du Pflegeschüler?«, fragte Emil und obwohl sie mich das oft fragten, wunderte es mich doch, dass es ihn interessierte. Wir führten irgendwie ein richtiges Gespräch und etwas daran war sehr schön.
Ich schüttelte den Kopf. »Ich mache das Pflegepraktikum fürs Medizinstudium«, erklärte ich und meinte, dass sich etwas über Emils Miene legte. Ein Schatten, ein kleiner nur. Ich schämte mich sofort dafür, über Dinge wie ein Studium zu sprechen, während er hier liegen musste und seines vielleicht nie beenden konnte. Was hieß vielleicht. Mit ziemlicher Sicherheit nie. Außer hier geschah irgendein verfluchtes Wunder.
»Welches Semester?«, wollte er wissen.
Ich schluckte. »Noch gar keins«, gab ich zu und es klang erbärmlich. »Ich bin diesen Winter nicht zugelassen worden.«
»Hm«, machte Emil und sagte nichts mehr. Andere hätten jetzt nachgebohrt. Ob mein Abi zu schlecht gewesen sei, oder woran es gelegen hatte. Mir fiel wieder ein, dass seine Mutter Ärztin war und er womöglich wusste, wie schwer es war, einen Platz für Medizin zu bekommen. Emil sah aus, als wollte er noch etwas sagen, doch ich kam ihm zuvor.
»Ich frage Brigitte wegen der Tablette und bringe dann gleich das Frühstück, okay?«
Emil nickte, ich wartete seine weitere Antwort nicht ab und verließ das Zimmer fast fluchtartig. Draußen fiel mir auf, dass ich vergessen hatte, seine Temperatur zu messen. Ich hätte ihm dafür recht nah kommen müssen, vielleicht also besser so. Brigitte, die gerade ihre Runde machte, um allen Patienten Blut abzunehmen, kam vorbei. Ich ergriff meine Chance.
»Brigitte«, begann ich und versuchte, die Stimme dabei so weit zu dämpfen, dass Emil es nicht hören konnte. »Gehst du zu Emil? Ihm ist schlecht, er hat gefragt, ob er was dagegen kriegen kann.«
Sie nickte. »Ich sehe ihn mir gleich an.«
Ich zögerte. »Und ich habe die Temperatur vergessen und bin gerade schon mit dem Frühstück beschäftigt. Vielleicht kannst du …?«
»Ich erledige es«, versprach sie und warf einen Blick auf den großen silbernen Essenswagen, der bereits im Gang stand und darauf wartete, dass ich die Tabletts verteilte. »Danke, Ansel.«
Ich schnitt Marmeladenbrote für andere Patienten in liebevolle kleine Quadrate, umsorgte alle, als wären sie in einem Vier-Sterne-Hotel. Dann wartete nur noch ein einziges Tablett darauf, an seinen Platz gebracht zu werden. Ich spähte in Emils Zimmer und verharrte. Er war tatsächlich wieder eingeschlafen. Vielleicht war er doch noch nicht so fit, wie ich vorhin gedacht hatte.
Wie lang war ich beschäftigt gewesen? Die Uhr zeigte bereits kurz nach halb acht. Auf dem Stationstresen lagen die vollen Blutröhrchen fürs Labor, die ich nach unten bringen sollte. Ich hatte ordentlich getrödelt.
Schuldbewusst ging ich zum Wagen, goss Emil eine große Portion Kaffee ein, er konnte sie offensichtlich gebrauchen, und brachte das Tablett dann in sein Zimmer. Er schien die verstohlenen Blicke nicht zu bemerken, die ich ihm dabei zuwarf, sah schlafend so müde und klein aus, dass ich mich fragte, wie er vorhin noch mit mir hatte Späße machen können. Er schien sich unheimlich gut zusammenreißen und über seinen wahren Zustand hinwegtäuschen zu können. Fast beeindruckte es mich, doch ich spürte noch etwas anderes. Und das gefiel mir nicht, denn es war Sorge. Ich sorgte mich um ihn. Das hier wurde allmählich gefährlich für mich.
Mit einem Fuß zog ich den fahrbaren Nachttisch zu mir, stellte das Tablett ab, ich war äußerst leise, doch Emil zuckte trotzdem zusammen. Jetzt, wo sein Blick für Sekunden orientierungslos durch den Raum glitt, konnte ich all die Erschöpfung ganz deutlich sehen. Sie verschwand aus seinen Augen, als er mich bemerkte und ich fühlte mich in meinem Verdacht bestätigt. Er tat nur so, als ginge es ihm gut!
»Ich hoffe, du trinkst Kaffee«, sagte ich und Emil nickte benommen.
»Danke«, murmelte er.
Ich schob den Nachttisch etwas näher heran.
»Soll ich das Bett etwas aufrichten, damit du besser …?«, begann ich, doch sein Kopfschütteln ließ mich innehalten.
»Ich mach dann schon.«
Einen Moment lang blieb ich unschlüssig stehen. Emil machte nicht den Eindruck, als würde er auch nur irgendetwas tun, außer gleich wieder einzuschlafen.
»Du solltest etwas essen«, hörte ich mich sagen, obwohl ich wusste, dass ich damit zu weit ging. Er war erwachsen, er konnte tun und lassen, was er wollte.
Der Anflug eines Lächelns zuckte an Emils Lippen. »Du wirst ein guter Arzt«, sagte er. »Du klingst schon jetzt wie meine Mutter.«
Hitze stieg mir in die Wangen.
»Ansel lernt schnell, nicht wahr?« Ich erstarrte, als eine Stimme hinter mir erklang. Doktor Meller strich mir im Vorbeigehen kurz über die Schulter. Rückblickend könnte es auch ein Luftzug gewesen sein, direkt über mir war schließlich ein Lüftungsschlitz in der Decke eingelassen. Sie trat zu Emil ans Bett. Das müde Strahlen kam zurück, sie küsste ihn auf die Stirn und ich fühlte mich völlig fehl am Platz, als ich das leise »Wie hast du geschlafen, Hase?« hörte, das sie Emil zuflüsterte.
»Gut«, antwortete er und Doktor Meller richtete sich auf. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihm das glaubte.
»Die Visite kommt demnächst«, erklärte sie, schenkte auch mir ein Lächeln und ich war zu überfordert mit allem, um es angemessen zu erwidern. Ich verschwand unauffällig, drückte mich draußen an der Theke herum und wartete angestrengt auf die restlichen Ärzte. Ausgerechnet heute ließen sie sich natürlich Zeit. Ich musste mich davon abhalten, ständig ungeniert in Emils Zimmer zu starren und ihn mit seiner Mutter zu beobachten. Was musste sie von mir denken? Ich wusste doch selbst nicht, wieso sich das alles hier so schrecklich verboten anfühlte. Emil war der erste Patient, der ungefähr so alt war wie ich und aus irgendeinem Grund wollte ich alles über ihn erfahren. Vermutlich erkannte ich mich in ihm wieder. Garantiert war es das. Ganz sicher. Oder etwa nicht?
DREI
Immer, wenn ich dachte, es könnte schlimmer nicht kommen, hatte ich Tagdienst mit Silvia. Sie war eine der ältesten Intensivpflegerinnen, hatte graues Haar und chronisch schlechte Laune, die sie mit Vorliebe an mir ausließ. Dass die alten Patienten sie konsequent mit Schwester anredeten und mich mit Herr Doktor, so als befähige mich allein mein Geschlecht zu Höherem, half auch nur bedingt, Sympathiepunkte bei ihr zu sammeln. Es wäre alles halb so schlimm gewesen, hätte ich nicht morgens noch vor dem ersten Kaffee erfahren, dass Brigitte für eine kranke Kollegin eingesprungen war und heute die Nachtschicht übernahm. Ich würde also mit Silvia und Erik, einem rundlichen Pflegeschüler, allein hier sein und wir wussten alle, was das für mich bedeutete. Drecksarbeit und diese passiv aggressive Atmosphäre, die meine ohnehin schon dünnen Nerven heute gefährlich strapazierten. Nichts konnte ich Silvia recht machen, alles war falsch, zu langsam oder zu unordentlich, wenn ich mich daraufhin beeilte. Für meine Morgenrunde in Rekordzeit hatte sie kein nettes Wort übrig, schickte mich dafür gleich los, die Patientenbetten neu zu beziehen und Urinbeutel zu leeren. Während ich auf Knien neben den Betten herumrobbte, half Erik Silvia bei den interessanten Arbeiten. Ich sah ja ein, dass er als Auszubildender Vorrang hatte, aber wieso wir nicht beide zusehen konnten, wenn etwas Spannendes passierte, verstand ich nicht. Bei Brigitte war das nie ein Problem.
»Ansel?« Silvias Stimme tönte aus dem Flur.
Ich schloss genervt die Augen. Vielleicht konnte ich mich tot stellen oder unter dem Bett verstecken.
»Anseeel?!«
»Hm?« Ich tauchte hinter dem Bett auf, stieß ans Gestell, Urin tropfte vom Beutel auf meine Hose. Großartig. Ich konnte also anschließend erst mal nach unten in die Wäscherei, um mir neue Kleidung zu holen.
»Hast du die Kissen in den pinken Wäschesack gesteckt?« Silvia erschien vor der geöffneten Tür, hielt den rosafarbenen Plastiksack demonstrativ hoch, als hätte ich ihn noch nie in meinem Leben gesehen.
Ich schüttelte sofort den Kopf. »Nein, ich …«
»Wenn du etwas nicht weißt, dann frag doch einfach nach. So machst du uns allen nur noch mehr Arbeit.«
Ich öffnete den Mund, doch sie beachtete mich gar nicht. Ich war es nicht gewesen! Vielleicht war Erik der Fehler passiert, er war erst seit zwei Wochen auf der Station, so etwas passierte eben ab und zu. Er sah erschrocken in unsere Richtung. Und ich war mir sicher.
»Hast du die Werte abgelesen?«, fuhr Silvia im gleichen Moment fort und deutete zum Urinbecher.
»Ja, es sind dreihundertfünfzig …«
»Diese Werte schreibt man sich immer auf, Ansel. So schnell kommt dir etwas dazwischen und dann ist die ganze Bilanzierung ungültig, wenn du herumrätst.«
Mir klappte der Mund auf. Ich hatte hier noch nie herumgeraten. »Es sind dreihundertfünfzig Milliliter«, beharrte ich. In mir brodelte eine gefährliche Wut, die in der Regel darin mündete, dass ich heimlich auf der Toilette heulte, anstatt mich zu behaupten. Wundervolles Praktikum in Form von unbezahlter Erniedrigung. Erik stand noch immer wortlos da. Eigentlich hätte ich ihn jetzt verpfeifen sollen, er hatte es verdient, der Verräter. Er hätte auch zugeben können, dass er einen Fehler gemacht hatte, anstatt sich darauf zu verlassen, dass ich die Schuld schon auf mich nehmen würde. Nichts Neues. Mit mir konnte man es ja machen.
Silvia hatte sich weggedreht. Ich musste einen armseligen Anblick abgeben. Es war mir plötzlich unangenehm, dass die Patienten mitbekamen, wie ich gedemütigt wurde. Keiner würde mehr Respekt vor mir haben.
Silvia schnipste mit den Fingern und deutete zur Seite. »Gut, hoffen wir, dass das stimmt. Der Messbecher kommt in den Steri.«
Was du nicht sagst.
Ich verkniff mir jede Reaktion. Mechanisch ging ich in den Sterilisationsraum, hier drin hatte ich wenigstens für ein paar Sekunden meine Ruhe. Auch wenn es nach Pipi roch. Der perfekte Ort zum Heulen.
»Ach, und Ansel …«
Ich schloss die Augen.
»Frau Schmidt braucht dringend neues Bettzeug. Ich dachte, du wärst schon bei ihr gewesen?«
»Noch nicht, ich …«
»Danach kannst du die Wägen auffüllen. Du weißt ja, wo alles ist.«
Silvia drehte sich endgültig weg und ging davon. Meine beschissenen Finger zitterten vor unterdrückter Wut, während ich stumm vor mich hinarbeitete. Mit jeder Minute wuchs meine Wut, ich zog mir die blöden Plastikhandschuhe aus, desinfizierte mir die Hände und ging Richtung Wäschewagen. Er stand in der Ecke der Station, ein paar Sekunden Blick zur Wand, endlich ein Moment Ruhe, mir stiegen die Tränen in die Augen. Ich war so erbärmlich und je mehr ich mich über mich selbst ärgerte, desto schlimmer wurde es. Ich kniete vor diesem Wäschewagen, suchte mir Leintücher, Bettwäsche, Kissenbezüge zusammen und ließ mir extra Zeit dabei. Ich musste mich beherrschen, nicht die Schranktüren zu knallen, als ich irgendwann so weit war. Dann hörte ich eine Stimme.
»Paralleluniversum.«
Ich riss den Kopf hoch. Sah zur Seite, durch die geöffnete Schiebetür in eines der Zimmer. Emil hockte im Bett, hatte die Knie an den Körper gezogen. Und mich anscheinend beobachtet. Schnell raffte ich meine Sachen zusammen und kam schwankend auf die Beine.
»Bitte?«, brachte ich heraus.
Er zögerte, ich kam automatisch näher. Bis zu seiner Zimmertür. »Ich stelle mir dann immer vor, ich wäre woanders.« Emils dunklen Augen hielten mich fest. »In einem Paralleluniversum, irgendwo, wo keiner dumme Sachen zu mir sagt.«
Ich schluckte. War das so offensichtlich gewesen? Er musste alles mitbekommen haben.
»Dann geht es mir besser.«
»Paralleluniversum«, wiederholte ich. »Okay.«
Emil lächelte. »Es gibt auch eins, in dem Silvia nicht existiert.«
Ich musste lachen, bekam dann sofort Angst, dass sie uns gehört haben konnte. Als ich zur Seite sah, war niemand in Sicht.
»Lass dir nicht alles gefallen. Sie macht das hier mit jedem, der ihr kein Kontra gibt. Zu mir ist sie nur nett, weil ich der Sohn der Oberärztin bin.«
Ich schwieg. Lass dir nicht alles gefallen. Wundervoll, vielen Dank. Als wäre es so einfach, das zu beherzigen.
Aber wenn Emil mich so ansah wie in diesem Moment, glichen diese Worte dem besten Ratschlag meines Lebens. Ein feines Grinsen trat auf seine Lippen. Ich konnte den Blick nicht mehr abwenden.
»Ansel?« Ich fuhr herum.
»Hm?«
»Gibt es ein Problem?«
»Nein, nein, ich …«
»Er hat mir beim Aufstehen geholfen.« Emils Miene war glatt und todernst, als Silvia neben mich trat. Ich nickte schnell, obwohl ich die Arme voller frischem Bettzeug hatte.
»Darfst du überhaupt aufstehen?«, fragte Silvia nach einem kritischen Blick.
Emil blinzelte sie unschuldig an. »Meine Mutter hat es so angeordnet, oder nicht?«
Ich biss mir auf die Unterlippe, während sich ihre Lider verengten.
»Ansel, ich möchte nicht, dass du mit den Patienten allein herumfuhrwerkst. Dafür bist du nicht ansatzweise ausgebildet. Hol beim nächsten Mal Erik dazu.«
Sie war verschwunden, bevor ich wusste, wie mir geschah. Ich drehte den Kopf zur Seite, sah Emil schuldbewusst die Mundwinkel verziehen.
»Sorry«, murmelte er.
»Und jetzt komm bitte«, rief Silvia. »Die Bettwäsche wechselt sich nicht von selbst!«
Ich schloss für einen kurzen Moment die Augen, atmete tief ein. Paralleluniversum, sagte ich mir in Gedanken. Ein Paralleluniversum, in dem Silvia nicht existierte. Als ich sie wieder öffnete, sah Emil mich an. Ruhig, fast stolz.
»Danke.«
Er schmunzelte, dann deutete er zum Flur. Ich drehte mich um, sah noch einmal zurück, in meinem Kopf war ich in unserem anderen Universum. Silvia konnte mir nichts. Emil Meller hatte dafür gesorgt.
Zwei Tage später saß Emil Meller vor mir am Rand seines Bettes, hielt sich mit beiden Händen an der Kante fest und sah reichlich blass aus.
»Geht’s?«, fragte ich unnötigerweise. Geht’s? – das war auch die dümmste Frage, die man stellen konnte. Ganz offensichtlich ging es ja nicht. Doch Emil nickte mit gesenktem Kopf, atmete ein paarmal tief durch, dann straffte er kaum merklich die Schultern. Mein Blick huschte von ihnen zum Instrumententisch neben seinem Bett. Ein mir unbekannter Arzt aus der Neurologie kleidete sich mit Brigittes Hilfe soeben in steriles Blau, seine desinfizierten Hände tauchten elegant in die weißen Handschuhe, die sie ihm hinhielt, dann überblickte er seine Materialien konzentriert und begann, Anweisungen zu verteilen.
Brigitte hatte mir aufgetragen, während der Lumbalpunktion vor Emil zu stehen. Ich war schon bei mehreren dabei gewesen und wusste, was ich zu tun hatte – und trotzdem war nun alles anders. Auch Emil schien das Vorgehen zu kennen. Er beugte sich unaufgefordert vor, machte den Rücken rund und verharrte in seiner Position, als der Arzt begann, die richtige Stelle zwischen Emils Wirbelkörpern ausfindig zu machen. Ich wusste nicht genau, warum er diese Untersuchung überhaupt bekam. Es war ein halber Vormittag vergangen, dann ging es recht schnell, der Arzt kam zu Brigitte und meinte, er wolle nun bitte zügig damit anfangen, Emils Nervenwasser zu untersuchen. Jetzt fasste er zur ersten Spritze, die bereitlag.
»Es kommt die lokale Betäubung«, drang es hinter seinem Mundschutz hervor. »Nicht erschrecken.«
Die Nadel war lang, doch Emil zuckte nicht mal, er ließ sich überhaupt nichts anmerken. Ich sah nur, wie sich seine Finger am Bettrand verkrampften. Er senkte den Kopf ein ganz klein wenig.
»Sehr schön«, murmelte der Arzt, während ich mich fragte, was schön daran sein sollte, jemandem eine Nadel in den Rücken zu schieben. Emil schloss genervt die Augen, mit Sicherheit fragte er es sich ebenfalls. Ich spürte jede seiner Emotionen. Oder ich bildete sie mir ein. »Alles in Ordnung, Herr Meller?«
»Alles bestens«, presste Emil zwischen zwei Atemzügen hervor. Wie konnte er so ruhig klingen?
Wir warteten ein paar Minuten, bis die Betäubung wirkte. Emil durfte sich noch mal aufrecht hinsetzen, er neigte den Kopf einmal zur linken und zur rechten Seite, atmete durch, dann öffnete er die Augen und unsere Blicke trafen sich unvorbereitet.
Ich musste wegsehen, weil es so intensiv war, ich konnte nicht anders, dann zuckte mein Blick zu ihm zurück. Er sah noch immer her. Dunkelbraun, bitterer Kaffee. Ich erkannte nichts in seinen Augen und irgendwie alles. Emils Miene war hart geworden, so als wappnete er sich für einen kleinen Kampf, doch ich spürte auch seine Angst. Die hilflose Erwartung, das Wissen, dass es wehtun würde, auch mit Anästhesie. Das Flehen, das Bitte nicht noch mal. Und das Wissen, dass man ihn nicht hören würde.
Paralleluniversum, schoss es mir durch den Kopf. Paralleluniversum, das konnte er nun gebrauchen. Ich wollte es ihm sagen, doch da standen zwei erwachsene Menschen neben uns und es hätte ziemlich komisch gewirkt. Also schwieg ich, dachte an ein Paralleluniversum und versuchte dieses Wort mit meinen nicht vorhandenen telepathischen Fähigkeiten auf Emil zu übertragen. Natürlich klappte es nicht.
Der Arzt begann und Emil musste sich wieder vorbeugen. Er stützte die Unterarme auf den Oberschenkeln ab, Brigitte gab mir einen Wink und ich trat unsicher vor. Ich wusste genau, was ich tun musste, doch jetzt zögerte ich. Ich legte die Hand an Emils Schulter, spürte wie sich die Muskeln unter meinen Fingern anspannten.
»Du kannst dich bei mir anlehnen«, sagte ich ihm leise, meinte, sein Nicken wahrzunehmen, er wusste das sicher, der Arzt drückte an seinem Rücken herum, dann ruhte sein behandschuhter Finger an einem Punkt und er verlangte nach der anderen Nadel. Die erste war nichts gewesen gegen diese hier.
Ich konnte nicht hinsehen. Zum allerersten Mal ging es nicht, also starrte ich auf die Kuhle zwischen Emils Hals und seinem rechten Schlüsselbein. Sein ganzer Körper spannte sich an, als die Nadel zwischen seine Wirbel glitt. Tiefer, immer tiefer, fast glaubte ich, sie müsse gleich auf der anderen Seite aus ihm heraustreten.
»Schön weiteratmen, Emil«, meinte Brigitte. Sie sagte es auf ihre Brigitte-Art, es beruhigte selbst mich.
Emil nickte.
»Nicht bewegen«, wurde er daraufhin sofort vom Arzt ermahnt und verkrampfte erneut. Ich stand direkt vor ihm, ganz dicht und legte reflexartig die zweite Hand an seine andere Seite. Ich dachte nicht mehr nach, es geschah einfach. Ich spürte seine Körperwärme unter den Fingerspitzen, spürte jede Bewegung. Der Arzt stocherte, Emil entwich ein gequältes Stöhnen und dann plötzlich sank sein Kopf nach vorn und ich spürte ihn an meinem Bauch. Mein Griff wurde fester.
»Paralleluniversum«, murmelte ich, und Emil spannte sich an. »Es gibt da eins ohne Nadeln und den ganzen Scheiß.« Ich hatte leise gesprochen, in der Hoffnung, dass der Arzt oder Brigitte es nicht hörten, doch Emil hatte verstanden. Er konnte nicht nicken, nichts sagen, oder mir sonst ein Zeichen geben, aber irgendwie wusste ich es trotzdem.
Mein Puls stieg und unter den blauen Plastikhandschuhen begannen meine Finger zu schwitzen. Der Arzt hantierte herum, Brigitte reichte ihm Dinge, er fing sogar an, mir etwas zu erklären und ich nickte mechanisch, ohne ein einziges Wort zu verstehen. Alles, was noch zu mir durchdrang war das Gefühl von Emils Stirn, die gegen meinen Körper lehnte, seine harten Muskeln, die Schmerzen, die er haben musste, dieser Arzt sollte sich einfach verdammt noch mal beeilen. Ehe ich begriff, was sie taten, strichen meine Finger beruhigend über Emils Schultern. Ich konnte spüren, wie er sich zwang, das Zittern zu unterdrücken, still zu halten, damit es schnell vorbei war, doch es gelang ihm kaum. Mein Herz krampfte sich zusammen, es war schrecklich und ich konnte nichts tun, um ihm zu helfen.
»Mir wird schwindelig«, hörte ich ihn mit wackliger Stimme sagen. Brigitte deutete rasch zur Seite, ich begriff. Möglichst ohne Emil dabei loszulassen, beugte ich mich hinüber und angelte nach der Sauerstoffmaske.
»Tief durchatmen, Emil«, sagte Brigitte und sie schaffte es, laut und ruhig zu klingen. Ich wusste nicht, ob Emil sie hörte, er drückte sich die Maske gegen das Gesicht und nahm ein paar Atemzüge.
»Noch zwei Minuten«, versprach der Arzt.
Ich glaube, Emil und ich wussten beide, dass, wenn sie zwei Minuten sagten, noch mindestens zehn vergehen würden, bis es so weit war. Nach sechs Minuten begann Emil unter meinen Händen zu zittern. Das Piepsen am Monitor wurde schneller.
»Ich seh nix mehr«, flüsterte er und ich warf Brigitte einen hilflosen Blick zu, sah ihr beruhigendes Nicken und versuchte, es gedanklich auf Emil zu übertragen. Er hielt durch, eine halbe Ewigkeit lang hielt er weiter durch, dann endlich beendete der Arzt seine Prozedur und Emils Schultern senkten sich.
»Dann flott jetzt.« Brigittes Stimme klang energisch.
»Hörst du?« Emils Hand mit der Maske sank in seinen Schoß. Ich hielt sie fest. »Wir sind fertig.«
Ich wusste nicht, was sie noch so lange taten, Emil war kreidebleich, als er sich endlich hinlegen durfte. Katrin eilte herbei, es brach keine Hektik aus, aber es fehlte nicht mehr viel. Zu dritt wurstelten sie an Emil herum. Katrin bat mich, vorsichtshalber den Notfallwagen hereinzuholen.
Ich stürzte nach draußen auf den Flur, löste die Bremsen und zog ihn mit mir. Mein Herz raste, ich kam atemlos zurück. Genau im richtigen Moment, nämlich dem, als Brigitte fluchte und Emil Meller das Bewusstsein verlor.
VIER
»Und dann saß ich fast drei Stunden im Wartebereich wegen diesem dummen Visum, drei Stunden! Das ist unfassbar, oder?« Ella sah mich kopfschüttelnd an und strich sich ein paar ihrer dunklen Ponysträhnen aus der Stirn. »Als hätte ich zurzeit nichts anderes zu tun. Eine Weltreise zu planen ist der pure Wahnsinn.«
»Würde lieber ’ne Reise planen als einen Umzug«, grummelte Henning, der neben ihr lag. In vertrauter Pose, rücklings auf der Picknickdecke, die Arme hinterm Kopf verschränkt, den Blick nach oben in den dämmrigen Himmel gerichtet.
Alles war wie immer. Abends spontan mit meinen besten Freunden an den See, weiße Jollen, die mit den letzten Sonnenstrahlen zurück in die Jachthäfen glitten.
Nichts war wie immer. Auf einem dieser Boote hätte Emil stehen können.
»Ansel?«
»Hm?« Ich sah zur Seite, direkt in Ellas Gesicht. Ihr Blick war aufmerksam, die Sommersprossen hoben sich stark gegen ihre helle Haut ab. Ella wurde nicht braun. Sie wurde gesprenkelt, das sagte sie selbst.
»Anselchen, was ist los mit dir? Du wirkst irgendwie … abwesend.«
»Ach, nichts«, beeilte ich mich zu sagen und sah zurück aufs Wasser, zurück auf die beruhigenden Farben. »Es war heute nur viel los im Krankenhaus.«