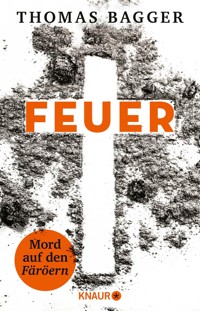9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für die Task Force 14
- Sprache: Deutsch
Der 3. Teil der außergewöhnlichen und hochspannenden dänischen Thriller-Reihe um die Sonderermittler der Task Force 14 Ein Kampf gegen das organisierte Verbrechen und den Boss eines rumänischen Verbrechersyndikats, dessen Netzwerk bis ins korrupte Skandinavien reicht. Nachdem David Flugt den Mord an Serienmörder William Grandberg vertuscht hat, zieht er sich mit dessen Ex-Frau Theresa und ihrer Tochter in eine abgelegene Hütte mitten im norwegischen Nirgendwo zurück. Doch dann erfährt David, dass sein Undercover-Alias aufgeflogen ist. Mafiaboss Volos, in dessen Drogen- und Menschenhandelskartell David eingeschleust war und der Verbindungen bis in die dänische Polizei hinein hat, wird ihn töten lassen – wenn er ihm nicht zuvorkommt. Während er Theresa in Norwegen sicher glaubt, begibt sich David zurück in die Hölle von Temeswar, um sich dort seinem Widersacher zu stellen. Ohne Back-up oder Unterstützung hat er als wandelnde Zielscheibe einen einzigen Vorteil: Er hat nichts zu verlieren … »Atemlose Spannung. Verschnaufen? Durchatmen? Pustekuchen!« n-tv.de über NACHT Nach NACHT und FEUER legt der dänische Bestsellerautor Thomas Bagger mit DUNKEL den dritten Teil seiner skandinavischen Thriller-Reihe um die Kopenhagener Sonderermittlungseinheit vor. Ein packender Pageturner, in dem ein Abgrund den nächsten jagt. Düsterer Nervenkitzel und nichts für Zartbesaitete – ein skandinavischer Thriller der Extraklasse! »Wow! Das hier gehört zum Besten der dänischen Krimiszene.« Berlingske
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Thomas Bagger
DUNKEL
Die Todgeweihten von Temeswar
Thriller
Aus dem Dänischen von Maike Dörries
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Sonderermittler David Flugt undercover – gejagt vom Boss eines internationalen Verbrechersyndikats
Nachdem Sonderermittler David Flugt den Mord an einem Serienmörder vertuscht hat, zieht er sich mit dessen Ex-Frau Theresa und ihrer Tochter in eine abgelegene Hütte mitten im norwegischen Nirgendwo zurück.
Doch dann erfährt er, dass sein Alias aus einem früheren Undercover-Einsatz aufgeflogen ist. Der rumänische Mafiaboss Volos, in dessen Drogen- und Menschenhandelskartell er eingeschleust war und der Kontakte bis in die dänische Polizei hinein hat, wird ihn töten lassen – wenn David ihm nicht zuvorkommt.
David beschließt, in die Hölle von Temeswar zurückzukehren, um sich dort seinem Widersacher zu stellen. Ohne Back-up und Unterstützung hat er als wandelnde Zielscheibe einen einzigen Vorteil: Er hat nichts zu verlieren …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
99. Kapitel
100. Kapitel
101. Kapitel
102. Kapitel
103. Kapitel
104. Kapitel
105. Kapitel
Epilog
1
Bald war der dunkelste Punkt der Nacht erreicht.
Die Straße war leer gefegt, keine Menschenseele weit und breit. Nebel zog in Schleierfetzen durch die Luft, am Straßenrand dauerparkten rostige und verbeulte Autowracks wie sommerliches Fallobst. Über den Asphalt verteilt lag eine Streu aus Glasscherben, zerbrochenen Dachziegeln, Rattenkot und durchfeuchtetem Abfall.
In der aschgrauen Stille der Straße flackerte eine einzelne Birne. Die übrigen Straßenlaternen waren längst gezielten Steinwürfen, dem unbarmherzigen Frost oder dem selbstmörderischen Appetit der Nager auf Kabelgummi zum Opfer gefallen. Und in diesem Teil der Stadt würden auch keine Birnen mehr ausgetauscht werden. Offiziell deklariert als Sparmaßnahme von Temeswars Verkehrsaufsichtsbehörde, da der gewissenlose Vandalismus der Bewohner große Löcher in die Kommunalkasse riss. Inoffiziell beließ man manche gesellschaftlichen Probleme besser im Dunkeln.
Dieser einsame Laternenpfahl aber hatte jahrelangen Steinbewurf und Pistolenschüsse überlebt. War bei Sonnenuntergang treu angegangen, wenn die Straße sich den Regeln der Nacht beugte. Und jahrelang hatte sein goldenes Licht den Schauplatz für Schießereien und Prügeleien beleuchtet, darunter zwei Hinrichtungen, ungezählte Vergewaltigungen und ein einzelnes Ereignis unbeschreiblicher Grausamkeit.
Das war die Funktion des Laternenpfahls: Licht zu spenden, ohne zu urteilen, egal was sich unter ihm abspielte.
In dieser Nacht jedoch verabschiedete sich das Licht in kurzen Zuckungen wie eine im Meer versinkende Münze. Die Birne gab den letzten Rest an Energie frei, die der angefressene Halbleiter noch transportierte. Aber bevor die Glühbirne sich in die finstere Parade der Straßenlaternen einreihte, setzte sie noch ein letztes Drama in Szene.
Es hatte den ganzen Tag geregnet, bevor ein plötzlicher Wind die Wolken auseinandergerissen und einen sternlosen Mitternachtshimmel freigelegt hatte. Ein widerlich süßer Gestank stieg aus den Gullydeckeln auf, und die Lokale im Plopi-Viertel hatten längst die Hoffnung auf einen abendlichen Umsatz aufgegeben und die Türen zu den ausgestorbenen Straßen geschlossen.
Radu Romanescu versuchte mit Macht, nicht daran zu denken, dass er alleine war.
Alleine mit den schwarzen Trainingsanzügen.
Die Luft, die einige Grade unter dem Gefrierpunkt war, stach wie Nadeln in den Lungen. Seine Kleidung war schweißnass, klamm und kalt wie das Handtuch in seiner Sporttasche, die er irgendwo auf der Straße von sich geworfen hatte. Seine locker sitzenden Stiefel klammerten sich vergeblich an seine Fersen und zwangen ihn zu einem kräftezehrenden Trampelstil.
Aus dem Augenwinkel suchte er nach möglichen Verstecken. Einem Treppenhaus. Einem Park. Er konnte es nicht mehr ignorieren. Seine Beine wurden schwächer. Wie auf den letzten Bahnen im Becken, wenn die fließenden Schwimmzüge zunehmend brachialer wurden in dem zähflüssigen, wie Treibsand bremsenden Wasser. Auf den letzten fünf, sechs Bahnen, bevor der Körper kurzschloss.
Er biss die Zähne aufeinander. Jetzt ging es nur noch um eins. Ausdauer.
Vor ein paar Minuten war er mit brennenden Muskeln und einer Chlorwolke um den Kopf aus dem Hallenbad gekommen. Auf dem Weg zum Parkplatz hatte er einen kurzen Lichtblitz wahrgenommen. Wie Licht, das von einer Armbanduhr reflektiert wird. Er hatte sie weder gesehen noch gehört. Fünf Männer in schwarzen Trainingsanzügen. Neben einem Lieferwagen unter einem der kaputten Laternenpfähle.
Radu hatte sich auf die Jackentaschen geklopft, als hätte er was vergessen, und war zum erleuchteten Hallenbadeingang zurückgegangen. In einer Autoscheibe hatte er ihre Schatten zwischen den Fahrzeugen hervorgleiten und sich von hinten nähern sehen. Als er sich zu ihnen umgedreht hatte, waren sie stehen geblieben. Lässig entspannte Körpersprache, offene Handflächen, keine hastigen Bewegungen. Aber Radu hatte ihre Augen gesehen, die Informationen sammelten, die Situation analysierten, ihn analysierten.
Sie waren nicht entspannt. Sie waren vorbereitet.
Radu war normalerweise rund um die Uhr bewaffnet, außer beim Schwimmtraining, wenn er seine Dienstwaffe nicht im Spind in der Umkleidekabine liegen lassen wollte.
Der größte der Männer hatte angefangen zu reden. Radu hatte der irren, aber klaren Logik gelauscht und gedacht, dass seine müden Muskeln jetzt besser um ihr Leben laufen sollten.
Er hatte nach seiner Tasche gegriffen wie nach einer Schusswaffe. Die Männer waren auf seinen Bluff hereingefallen und zur Seite gesprungen, und Radu war losgestürmt.
Die Straße machte eine scharfe Kurve. Er rannte über den nassen Asphalt. Die Stiefel stauchten sich über seinen Knöcheln. Er schüttelte sie ab und lief auf Socken weiter.
Die Straße vor ihm sah aus wie der Eingang zu einem eingestürzten Tunnel. Autowracks, ausgeschossene Straßenlaternen, und dahinter ein schwarzes Loch. Er hielt das Tempo, auch als die Sicht auf wenige Meter schrumpfte. Der Verwesungsgestank war überwältigend. Er tastete sich zwischen den Wracks vor, die er mehr ahnte als sah. Etwas Spitzes bohrte sich durch seine Socken und weiter in die Haut.
Radu stöhnte vor Schmerz. Der Abfall war mit Glassplittern durchsetzt. Das Blut breitete sich warm unter seinen Fußsohlen aus.
Er beschwor ein inneres Bild von Alina herauf, ihre schönen Augen, ihre freundliche, lebensbejahende Art. Sie würde es ihm niemals verzeihen, wenn er sie zur Witwe machte.
Kämpf, du Idiot!
Aber sein Körper verweigerte den Dienst. Er schlang die Arme um einen Laternenpfahl und holte keuchend Luft, ohne die geringste Ahnung, wo er sich befand.
Er atmete tief ein und aus. Sein Herzschlag wurde langsamer. Um sich herum hörte er das Rascheln von Nagern auf ihrer nächtlichen Jagd.
Er schob die Hand in seine Tasche, um das Handy herauszunehmen, als dasselbe metallische Geräusch ertönte, wie wenn sein Onkel Mihai eine leere Bierdose an der Stirn zerdrückte.
Radu stierte auf die undurchdringliche, dunkle Wand vor sich. Da war etwas Großes da draußen.
Er hörte ihre knirschenden Stiefel. Die Gruppe pirschte sich heran, hatte Beute gewittert, verstand, dass sie Verstecken spielten.
Die Schritte verstummten.
Er hielt die Luft an. Lauschte.
Die Schritte setzten sich wieder in Gang, entfernten sich.
Radu atmete aus.
Im nächsten Augenblick badete er in Licht. Er starrte ungläubig zu dem gelben Auge der Straßenlaterne hoch, in der offenbar doch ein Rest Leben steckte.
»On je tamo!«, rief einer der schwarzen Trainingsanzüge.
Radu zögerte nicht. Er warf sich mit der Schulter gegen die Umrisse einer Tür, hörte das trockene Knacken der Angeln und landete auf dem Boden eines verrotteten Treppenaufgangs. Der Gestank von Urin und Schimmel war betäubend.
Er stapfte die Stufen hoch, rutschte in seinem eigenen Blut aus, schürfte sich das Schienbein auf, spürte seine Zehennägel brechen ohne ein Schmerzsignal aus dem Gehirn, das nur schrie, dass er zu langsam war, dass seine Lungen Sauerstoff brauchten, dass seine Beine nicht mehr wollten.
Die Stimmen der Männer schallten durch den Treppenaufgang. Ein feindliches Echo, das ihm bis zu einer verbeulten Stahltür folgte. Unter einem samtschwarzen Himmel stolperte er ins Freie. Etwas Pelziges wischte über seine Füße, als er sich nach einem Fluchtweg umsah. Das Flachdach war von wirren Kabelsträngen und verrußten Lüftungskästen überzogen.
Es gab keinen anderen Ausgang.
Er hörte das Getrampel aus dem Treppenhaus. Wie eine große Maschine, die sich zu ihm hocharbeitete. Die schwarzen Trainingsanzüge würden nicht aufgeben. Selbst wenn er jetzt entkam, würden sie ihn weiter verfolgen. Womöglich auch Alina.
Das durfte nicht passieren.
Er musste ihnen einen Riegel vorschieben.
Er trat an die Dachkante und schaute in das dunkle Vakuum unter sich. Die Luft war wohltuend frisch. Der Puls pochte in seinen Schläfen, aber er war nicht mehr so atemlos. Es war schön hier, schön, am Leben zu sein. Vor ihm strahlte das Stadtzentrum. Die kleinen Lichter standen ganz still, so wie die Zeit für ihn gleich stillstehen würde.
Er umfasste den Anhänger um seinen Hals, ein Goldkreuz, und spürte Alinas Nähe. Er dachte an all die großen und kleinen Dinge, die er gerne noch mit ihr zusammen erlebt hätte. Zusammen reisen, Großeltern von einem Haufen reizender Enkel werden, miteinander faltiger und älter werden, ohne dass ihre Liebe alterte.
Gott, wie gerne hätte er noch ein bisschen länger gelebt. Nicht Jahre oder Stunden, nur ein paar Minuten.
Da hörte er sie hinter sich.
»Ne skaèi. Spring nicht.«
Radu drehte sich um. Die Blicke der Männer waren blanke Kreuze. Einer hielt seine Stiefel in den Händen. Radu verstand nicht, was sie damit wollten. So, wie er nicht verstand, was das hier zu bedeuten hatte. Er war ein tüchtiger Polizist, hatte das Herz auf dem rechten Fleck und ließ sich nicht bestechen. Aber ansonsten war er nichts Besonderes. Hatte sich nie besonders hervorgetan. Es gab größere und bedeutendere Fische bei der Polizei. Personen, deren Tod in den Medien sehr viel mehr Aufsehen erregen würde.
»Ne skaèi.« Die Stimme klang jetzt anders. Nicht mehr so schneidend. Auffordernd.
Radu schnaufte. Was spielte es für eine Rolle, ob er lebte oder nicht? Er hatte das große Messer mit den Blutrillen gesehen.
Aber sie würden ihn nicht kriegen. Er befand sich bereits im Fall, er war frei, auf dem Weg an einen Ort, an den Alina ihm eines Tages folgen würde und an dem sie sich wiedersahen.
Er schob seine blutigen Zehen über die Kante.
Die Lichter der Stadt streckten sich nach ihm aus. Er schloss die Augen. Und dann flog er. Die aufsteigenden Turbulenzen fühlten sich an wie eine große Hand, die ihm die Kleider vom Leib zerren wollte.
Er öffnete die Augen.
Jetzt war es nicht mehr hell. Die leere Dunkelheit saugte ihn auf, um ihn zu zerschmettern.
2
Polizeihauptmeister Marius Petrascu griff in das Handschuhfach des Streifenwagens. Die Papiertüte von seinem Bagel war fettig, ihm lief das Wasser im Mund zusammen bei dem Duft von Pastrami und Senf.
Achthundert mehr oder weniger leere Kalorien.
Der Gedanke hatte die vorwurfsvolle, schnarrende Stimme seiner Frau, und das leider nicht zu Unrecht. Er seufzte. Seine Uniform war wohl kaum in der Wäsche geschrumpft. Und neulich unter der Dusche hatte er zwei Kollegen ihn als »Krapfen« bezeichnen hören. Stand es wirklich so schlimm um ihn? Er drückte die Speckrolle, die über den Gürtel quoll. Ein Mann mit Sixpack in seinem Alter war nicht vertrauenswürdig. Andere würden meinen, dass es so nur mehr Liebenswertes an ihm gab.
Sein Blick streifte die andere Tüte im Handschuhfach: die Gemüsesnacks, die seine Frau ihm für die Nachtschicht geschnippelt hatte. Das war schon süß von ihr. Sie gab die Hoffnung nicht auf, wie es werden könnte.
Marius sollte besser nicht mit voller Tüte nach Hause kommen.
Er hielt Ausschau nach einem Mülleimer an der Straße. Es sah ungemütlich dunkel und kalt aus hinter dem Regenschleier auf der Windschutzscheibe.
Er drückte sein Hinterteil in das aufgewärmte Sitzpolster.
Das Hinterhältige an Reue war, dass sie immer erst einsetzte, wenn man befriedigt war.
Er biss genüsslich in seinen Seitensprung und fluchte laut, als ein dunkelgelber Senfstreifen auf seiner Uniform und dem Steinadleremblem landete. Das Federvieh sah jetzt aus, als würde es kotzen. Er wischte mit einer Serviette über den Fleck und hob instinktiv den Blick. War da ein Schatten in seinem Rückspiegel vorbeigehuscht? Er starrte auf die schmale Spiegelfläche, aber das Einzige, was er sah, war der schwarze, regennasse Asphalt.
Marius sah seinen Bagel an. Sein Appetit war weg. Stattdessen füllte Unruhe seinen Magen. Die Art Unruhe, die er von seinen einsamen Nachtdiensten kannte, wenn er ein verdächtiges Fahrzeug an den Straßenrand dirigiert und die knapp zwanzig Schritte durch die rote Auspuffwolke zum halb heruntergekurbelten Fahrerfenster mit dem unterschwellig rumorenden Gefühl zurückgelegt hatte, dass gleich etwas Schreckliches passieren würde.
Er checkte noch einmal den Rückspiegel. Alles leer. Dunkel. Nichts.
»Verdammt, verdammt!«
Er stieg aus. Die Straße rauschte wie ein Fluss. Aus den Gullygittern quoll eine übel riechende Bakteriensuppe auf die Fahrbahn. Der Tod im Rinnstein. Er konnte nur hoffen, dass sie nicht mit der überschwemmenden Kloake aufs Straßenniveau hochkamen. Es schüttelte ihn bei dem Gedanken an die missgestalteten Kreaturen, die er dort unten in der Finsternis gesehen hatte. Mehrere seiner Kollegen waren nach der verfluchten Aktion im letzten Jahr noch immer krankgeschrieben.
Der Nebel legte sich wie klammer Schweiß auf sein Gesicht. Er ging weiter bis zum Eingang der Gasse. Der Gestank steckte wie ein Korken zwischen den Mauern. Er stand reglos da. Lauschte auf das von der Dachtraufe klatschende Wasser. Da war niemand. Natürlich nicht. Verflixt, er war wirklich leicht zu erschrecken.
Marius wollte gerade kehrtmachen, als er seitlich eine Bewegung wahrnahm. Er sah mit zusammengekniffenen Augen in die Dunkelheit. Diesmal war er ganz sicher. Da war etwas in den schwarzen Schatten der Gasse. Etwas Großes. Ein Hund?
»H-Hallo?«
Beim Ton seiner Stimme verharrte das Geschöpf.
Marius griff nach seiner Taschenlampe. Der Lichtkegel landete auf dem Rücken eines vornübergebeugten Mannes, der die Arme an die Brust presste, als würde er frieren.
»Hallo, Polizei! Alles in Ordnung?«
Der Mann reagierte nicht. Marius leuchtete in die Gasse. Sie waren allein.
Er machte einen zögernden Schritt nach vorn und blieb ein paar Meter hinter dem Mann stehen.
»Alles okay mit Ihnen?«, stammelte er.
Der andere wimmerte leise.
Marius schluckte. Nichts an der Situation war bedrohlich, und innerhalb einer Sekunde könnte er seine Beretta Px4 ziehen. Warum zitterte dann die Taschenlampe in seiner Hand?
»Drehen Sie sich um«, sagte er heiser.
Angestrengt richtete der Mann sich auf. Seine Schultern waren breiter, als Marius erwartet hatte.
»Was ist mit Ihnen …«
Der Mann fuhr herum und streckte die Arme aus. Dabei stieß er ein durch Mark und Bein gehendes, tierisches Röcheln aus: »Oh Gott, hilf mir!«
Marius wich erschrocken nach hinten zurück und drückte sich mit dem Rücken gegen die Mauer. Die Taschenlampe fiel ihm aus der Hand und trudelte auf dem Boden um ihre eigene Achse. In albtraumartigen Sequenzen sah er den Mann, einen Fuß nachziehend, auf sich zukommen. Sein Gesicht war eine einzige offene Fleischwunde. Das gebrochene Nasenbein ragte wie eine weiße Antenne aus dem Knorpel. Marius wich den ausgestreckten Armen des Mannes aus. Beide Handgelenke waren gebrochen, die Hände hingen wie lose Handschuhe herunter.
Marius setzte sich in Bewegung, aber seine Beine gehorchten ihm nicht. Der vernunftgesteuerte Teil seines Gehirns konnte nicht einfach wegschieben, was er gesehen hatte.
Das schwache Licht reflektierte sich in einem Kettenanhänger, den der Mann um den Hals trug.
Marius erkannte den Schmuck sofort.
Er war dabei gewesen, als seine Schwester ihn gekauft hatte. So, wie er dabei gewesen war, als sie den Schmuck ihrem Mann zur Silberhochzeit geschenkt hatte.
Die verkrüppelte Gestalt sank auf dem Asphalt zusammen.
Marius starrte mit angehaltenem Atem auf sie herunter.
»Radu? Um Himmels willen. Was haben sie mit dir gemacht?«
3
David Flugt trat raus auf die Terrasse. Er gähnte und inhalierte die Frostwolke. Die Morgensonne sickerte durch die Tannen- und Kiefernzweige und opalisierte die Kristalle des frisch gefallenen Schnees.
Er schaute mit zusammengekniffenen Augen auf das Farbspiel, verschränkte die Finger und streckte die Arme über den Kopf, bis der erlösende Knacks kam. Die Hände im Kreuz, drehte er ein paar Mal den Kopf hin und her und weckte die schmerzende Nackenmuskulatur. Er war sich unschlüssig darüber, ob die Ansätze von Rost im Körper seinem fünfundvierzigsten Geburtstag geschuldet waren oder seiner treuen Paranoia.
Auf den ersten Blick schien der Wald verlassen. Aber irgendetwas lauerte dort draußen. Als er am Fuß eines Stammes einen kleinen blutfleckigen Krater im Schnee sah, suchte er instinktiv das Gelände nach größeren Fußspuren ab.
Aber da waren nur die Abdrücke seiner eigenen Stiefel.
Was nicht automatisch bedeutete, dass es keine nächtlichen Besucher gab. Nicht alles hinterließ Fußspuren.
David hatte den Albtraum verdrängt, der ihn in dieser Nacht geweckt hatte. Einerseits war er dankbar, aus seinem Traum aufgewacht zu sein, in dem ihn sein Unterbewusstsein in die Grotte mit den fauchenden Mäulern geführt hatte. Andererseits war es extrem zermürbend, jede Nacht im Eismeer der Panik schockanimiert zu werden.
Er wusste nicht viel über PTBS. Aber wenn zu den Symptomen Angst vorm Einschlafen und Angst vorm Aufwachen gehörte, dann war er auf dem besten Weg dorthin.
Vielleicht hielt er deshalb um die Hütte herum, die drei Kilometer dichter Nadelwald vom nächsten Nachbarn trennte, täglich Ausschau nach Fußspuren. Eine Zwangshandlung, um dem Gehirn einzutrichtern, dass dies ein sicherer Ort war, weit weg von allen Bedrohungen, die sein Leben okkupiert hatten.
Vielleicht.
Aber statt des erwünschten Effekts schälte sich immer klarer eine neue Frage heraus: Ab welchem Punkt war das gelebte Leben weniger wert als die Kraft, die es kostete, es zu leben?
In der Hütte knackte eine Diele. David befreite sich gereizt aus seinem Gedankenknäuel. Er grübelte einfach zu viel.
Außerdem wusste er doch, worum es in seinen Albträumen ging. Immer gegangen war.
Die Angst, nicht zu genügen. Nicht genug geben zu können.
David trat in den Flur. Allmählich wurden die Winternächte oben in den Bergen klirrend kalt. Und die Hüttenwände arbeiteten in der Kälte. Aber nicht die Minusgrade bereiteten ihm Sorge. Die rot gebeizte Holzhütte war winterfest gebaut. Eine Voraussetzung, wenn man sich in Åbygda niederließ, einer kleinen Schlafstadt an der zerklüfteten Küste Norwegens. In ein paar Monaten kam der Frühling. Wenn der Schnee schmolz, dehnte sich das Holz wieder aus und nahm wieder seinen natürlichen Zustand an.
Im Türrahmen zur Küche blieb er stehen. Die Sonne vergoldete die staubstumpfen Fenster. Theresa stand mit dem Rücken zu ihm und kochte Eier. Das Lämpchen der alten Kaffeemaschine blinkte, die letzten Tropfen zogen durch den Filter und landeten friedvoll tropfend im Kolben darunter. Ihr dicker gemusterter Wollpullover reichte ihr bis zu den Knien. Sie trug ihn tagsüber, und sie schlief darin. Nicht nur, um sich vor der Kälte zu schützen, sondern auch vor seinen Blicken. Auf die Brandnarben der Zigaretten, die auf ihrem Rücken und den Innenseiten ihrer Oberschenkel ausgedrückt worden waren. Auf die ihr von Männern zugefügten Schnittnarben, die keinen hochkriegten und sich auf andere Weise an ihr abreagiert hatten. Die vernarbte Blindenschrift auf ihrer Haut erzählte eine Geschichte von Leid und Ohnmacht, die so ganz und gar nicht in das ach so idyllische Skandinavien passte. Eine Tragödie, die sie zu einem tragischen Charakter machte.
Ein Zittern lief durch ihren Körper. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und schaute aus dem Fenster. David betrachtete die schokoladenfarbenen, im Nacken zusammengebundenen Locken. In Rumänien hatte sie das Haar offen getragen. Damals hatte er sich eingeredet, das täte sie nur für ihn. Dass er der einzige Mann wäre, dem sie gestattete, sein Gesicht in ihren wilden Locken zu begraben und ihren fraulichen Duft einzuatmen. Aber sie hatte sich auch für andere Männer hübsch gemacht.
Um zu überleben.
Die Erkenntnis traf ihn mit schmerzlicher Klarheit.
David hatte Theresa vor etwas über einem Jahr bei einer Undercover-Operation in Rumänien getroffen. Sie war eine der vielen entführten Frauen, die als Sexsklavinnen in einem verfallenen Wohnblock am Rand von Temeswar gefangen gehalten wurden, einer kleineren Industriestadt etwa fünfhundertfünfzig Kilometer westlich von Bukarest. Der Betonblock, auch die Fabrik genannt, war das Hauptquartier der Alliance, eines der bestorganisierten und steinreichsten osteuropäischen Verbrechersyndikate, das sich auf Ecstasy und Trafficking spezialisiert hatte.
Die Fabrik war gesichert wie eine Festung mit schwer bewaffneten Schützen, einem ferngesteuerten Aufzug, Überwachungskameras und kasernenähnlichen Verhältnissen. In der Kelleretage des Gebäudes hatte der Boss der Schmugglerzelle, Volos, seinen anschlagssicheren Bunkerpalast eingerichtet.
An diesem seelenlosen Ort hatte David sich in Theresa verliebt. Und wie ein liebesblinder Narr hatte er sich geweigert, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Dass die Fabrik eine Endstation war. Ein Ort, an den man kam und starb. Die Regeln waren brutal, aber einfach zu verstehen – lebe mit dem Schwert, stirb mit dem Schwert. Am sichersten war, wer nichts besaß, das ihm weggenommen werden konnte. David hatte sich wider alle Vernunft weiter mit Theresa getroffen. Und am Ende hatte die Fabrik ihn daran erinnert, wo er sich befand. Der Preis war ein Menschenleben. Das Leben eines unschuldigen Kindes.
Die Eier hackten in dem kochenden Wasser gegen den Topfboden. David ging zum Herd und drehte die Flamme runter.
»Alles in Ordnung?«, fragte er.
Sie sah ihn einen Augenblick ohne ein Zeichen des Wiedererkennens an. Dann kam Leben in sie.
»Holst du sie?«, sagte sie mit einem blassen Lächeln. »Das Frühstück ist fertig.«
David nickte und warf einen Blick aus dem Fenster. Jetzt dauerte es nicht mehr lange bis zum Frühjahr und zur Schneeschmelze. Aber er war sich nicht mehr so sicher, ob damit auch wieder Normalität einkehren würde.
David zog die Tür zu Siljas fensterlosem Zimmer einen Spaltbreit auf. Mit einem Fuß in der Tür, versuchten seine Augen, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen, die aromatisch nach Holz und einem Hauch Schweißfüße roch. Der Schreibtisch war mit Comics, Farbkreide, kleinen Notizblöcken und einem iPad beladen.
Die Decke in der unteren Schlafkoje bewegte sich. Eine blonde Haarsträhne war zu sehen.
»Muss ich aufstehen?«, fragte eine schlaftrunkene Mädchenstimme.
»Guten Morgen, Silja«, flüsterte David. »Darf ich Licht machen? Ich kann dich kaum sehen.«
»Warte noch, das Licht sticht so in den Augen.«
David schob die Tür ein bisschen weiter auf. »Es gibt Eier und frischen Saft.«
Silja blieb noch kurz liegen, dann stemmte sie sich auf die Ellbogen und rieb sich den Schlaf aus den Augen.
»Gehen wir heute raus?«, fragte sie.
»Das darfst du bestimmen.«
»Ich will zu dem großen Stein.«
»Dann machen wir das.«
Silja strampelte die Decke weg, schlüpfte direkt in ihre Hausschuhe und griff nach Davids ausgestreckter Hand. Zusammen gingen sie in die Küche.
»Hallo, Silja, setz dich und iss was, ehe es kalt wird.« Theresa streifte sie beide mit einem flüchtigen Blick, als sie mit einem hektischen Klappern Teller und Gläser aufdeckte.
Silja setzte sich ans Tischende, Theresa und David links und rechts von ihr. David schmierte eine Scheibe Roggenbrot mit Butter für Silja, die Saft in drei Gläser schenkte, sorgfältig drauf bedacht, nichts zu verschütten. Theresa schälte mit ähnlich konzentriertem Blick die Eier. David stellte wieder einmal fest, dass die Tochter die großen, leuchtenden Augen ihrer Mutter geerbt hatte. Aber auch das andere. Kleine Risse in einer zerschlagenen Unschuld, die jeder von ihnen auf unterschiedliche Weise von ein und demselben zerstörerischen Mann genommen worden war.
»Ich glaube, heute Nacht haben draußen Tiere miteinander gekämpft«, sagte Silja. »Hoffentlich ist Per nichts passiert.«
David lächelte. Silja hatte ein Eichhörnchen mit einem ausgeprägten weißen Fleck im Nacken, das irgendwo im Umkreis der Hütte lebte, Per getauft. Er hoffte auch, dass Per nichts mit dem Blutfleck zu tun hatte, den er eben draußen im Schnee entdeckt hatte.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte David. »Die anderen Tiere sagen, dass Per eine harte Nuss ist.«
Silja prustete in ihren Saft.
»Ach, Silja, du kleckerst ja alles voll«, blaffte Theresa gereizt und tupfte übertrieben mit der Serviette unter dem Glas herum.
»Ist doch nur Saft«, versuchte David, sie zu beruhigen.
»Warum schenkst du auch die Gläser so voll«, schimpfte sie weiter. »Das gibt Ringe auf der Tischplatte und …«
»Theresa, da ist nichts mehr.«
Sie überhörte ihn und wischte weiter mit der Serviette hin und her. Silja starrte wie gelähmt auf die Tischplatte.
David legte eine Hand auf Theresas Unterarm, fing ihren Blick ein.
»Alles gut.« Er lächelte Silja an. »Nicht traurig sein. Das war ein Missgeschick.«
Silja aß mit abgehackten, kontrollierten Kaubewegungen weiter.
Es versetzte David einen kleinen Schock, als er Theresas versteinertes Gesicht sah. Eine Maske ohne jede Gefühlsregung.
Er rang sich in seinem Unbehagen ein Lächeln ab. »Magst du uns zum Stein begleiten?«
»Was?«
»Der große Stein, den Silja neulich entdeckt hat. In der Nähe des Aussichtspunktes. Wir können ein Picknick mitnehmen und einen Ausflug machen.«
»Picknick? Ausflug?« Theresa zerknüllte die feuchte Serviette in ihrer Faust zu einer harten Kugel.
»Ich meine ja nur …«
»Ich weiß sehr gut, was du meinst. Dir scheint’s ja wieder richtig gut zu gehen.«
»Theresa, nicht jetzt.«
»Du hast uns zwei bei dir, genauso, wie du es dir gewünscht hast.«
»Du weißt, dass das nicht stimmt.«
»Ach nein? Darüber hättest du vielleicht nachdenken sollen, bevor du …«
David verzog das Gesicht. Sein Tinnitus begann in den Gehörgängen zu pfeifen wie immer bei Stress. Ein hochfrequentes weißes Rauschen.
»Lass uns später darüber reden«, sagte er.
»Du hörst nicht zu.« Ihre Wut kratzte an ihren Stimmbändern. »Diese Hütte, dieses … Leben. Dafür bist du verantwortlich. Es ist deine Wahl, die uns hierhergebracht hat.«
David rieb sich das Ohr. Sie wollte ihn provozieren, aus der Reserve locken.
»Und was soll ich deiner Meinung nach tun?«, fragte er.
»Du könntest damit anfangen, dich nicht den ganzen Tag in deinem verfluchten Büro zu verbarrikadieren.«
»Ich bin da, sobald du mich rufst.«
»Aber du sollst nicht kommen, wenn du gerufen wirst. Du sollst von dir aus da sein.«
»Das hier ist also nicht gut genug?«
»Weit entfernt.«
Davids Herz hämmerte. Sie machte wirklich alles kaputt.
»Was, bitte, versteh ich deiner Meinung nach nicht? Ich hab dich aus diesem Loch in Rumänien rausgeholt. Zurück nach Dänemark gebracht. Zu deiner Tochter.«
»Habe ich dich je darum gebeten?«
»Was willst du damit sagen?«
»Nichts.«
»Raus damit!«
»David, ich weiß, dass du mich gerettet hast, weil es für dich das einzig Richtige war.« Theresa sah ihn mit einer tiefen Furche zwischen den Augenbrauen an. »Aber manche Orte sind vielleicht nicht dafür vorgesehen, dass man von ihnen zurückkehrt.«
David zuckte zusammen, als hätte sie gegen seinen Stuhl getreten. Das Blut sackte ihm in die Füße. Er stützte sich schwindelig auf der Tischplatte ab und schloss die Augen.
Von ganz weit weg drang Theresas Stimme zu ihm durch.
»Silja?«
Und dann noch einmal, diesmal schwang Panik mit.
»Silja!«
David schlug die Augen auf. Theresa schaute zu der offenen Tür, durch die kalte Luft in die Hütte strömte. Er sprang auf, stieg in die Stiefel und stand in der nächsten Sekunde knietief im Schnee. Er schirmte mit einer Hand die Augen ab und suchte nach Fußspuren im sonnenglitzernden Schnee. Das Licht blendete ihn. Auf der Ostseite der Hütte hatte es den Schnee von ein paar tief hängenden Zweigen geschüttelt. Er pflügte los. Das Tal, in dem die Hütte lag, war nur aus südöstlicher und westlicher Richtung zu erreichen. Im Norden und Osten war der Wald eine undurchdringliche Wildnis mit so vielen Steilwänden und Felsspalten, dass der Hüttenbesitzer sie vorgewarnt hatte, dort herumzustreifen.
Er stürmte in ein braungrünes, dichtes Labyrinth aus Ästen und Zweigen, wo kein Schnee mehr lag, weil das Tannendach über ihm den Waldboden wie ein Sonnensegel abschirmte.
David kämpfte sich vorwärts. Die stacheligen Zweige kratzten seine Unterarme auf, und das Pfeifen in seinen Ohren schwoll zu einer Alarmsirene an.
Er war noch nicht sonderlich weit gekommen, als er aus dem Augenwinkel eine Bewegung in Bodenhöhe wahrnahm. Hinter einem dicken Stamm. Weißer Dampf.
Er atmete erleichtert aus.
Silja lehnte mit dem Rücken am Stamm und hatte die Knie an die Brust gezogen. Sie klapperte mit den Zähnen. Es versetzte David einen Stich, als er ihre blutigen, nackten Füße sah. Sie hatte nicht angehalten, weil sie ihren Entschluss bereute. Ihr Körper hatte gestreikt.
Er ging neben ihr in die Hocke.
»Komm mit mir zurück«, sagte er ruhig.
Das Mädchen funkelte ihn an. »Warum lasst ihr mich nicht gehen? Ich will nicht bei euch sein.«
»Das ist nicht so einfach, Silja. Wir haben doch darüber gesprochen.«
Sie starrte vor sich in die Luft. Unter der unkleidsam ernsten Maske waren ihre zehnjährigen, runden Gesichtszüge zu erahnen.
»Ich dachte, wir wären Freunde«, schluchzte sie. »In der Polizeiwache in Esbjerg damals warst du der Einzige, der mit mir geredet hat.«
»Ich bin dein Freund, Silja. Auch wenn es dir im Augenblick nicht so vorkommt.«
Sie sah ihn mit großen, anklagenden Augen an.
»Du bist schuld, dass Papa tot ist. Wir können niemals Freunde werden.«
David biss die Zähne aufeinander. Er sah den wahnsinnigen Blick von Siljas Vater vor sich, William Grandberg. Das Böse in seiner reinsten, unmenschlichsten Form.
»Was war mit Papa los?«, fragte Silja mit weinerlicher Stimme. »Warum hat er mir erzählt, dass Mama tot ist?«
»Ich …«
»Er hat mich mein ganzes Leben lang angelogen. Hat er mich nicht geliebt?«
David atmete tief ein. Er wusste, was das Mädchen in der folgenschweren Nacht in Süderjütland gesehen hatte, aber er hatte noch nicht herausgefunden, an wie viel sie sich tatsächlich erinnerte. Und wie viel sie verdrängt hatte.
»Wir müssen zurück«, sagte er und merkte, dass er selbst auch mit den Zähnen klapperte. »Du frierst.«
»Lass mich los! Ich will nicht mehr hier sein!«
Siljas Heulen bereitete David Kopfschmerzen, er konnte keinen klaren Gedanken fassen. Er legte sich die strampelnde Silja über die Schulter und ließ sich von ihren kleinen Fäusten den Rücken bearbeiten.
Theresa öffnete die Tür zu Siljas Zimmer. David setzte sich mit dem kratzenden und beißenden Mädchen aufs Bett und hielt sie so sanft wie möglich und so fest wie nötig im Arm, damit sie sich bei der noch immer durch ihren Körper schwappenden Wut nicht selbst verletzte.
»Ich will zu meinem Papa! Ich will nicht bei euch sein!«
Von früheren Gefühlsausbrüchen des Mädchens wusste David, dass er nichts anderes tun konnte, als sie im Arm zu halten, bis ihr Körper von der Raserei so erschöpft war, dass sie seinen Trost annehmen konnte. Er hatte irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Fluchtversuche diesem schon vorausgegangen waren. Und obwohl sie es heute besonders weit von der Hütte weggeschafft hatte, fühlte er eine seltsame Mischung aus Traurigkeit und Zuversicht. Ihr Aufbäumen war eine gesunde Reaktion. Es war ein Zeichen für einen starken Willen und dass sie sich auf ihren ureigenen Instinkt verließ. Sie sollte sich ihnen schließlich nicht unterordnen, sondern nur nach und nach akzeptieren, dass ihr Leben von nun an ein anderes war. Hoffentlich ein besseres.
Aber der konstante Wechsel ihrer Taktik war eine echte Herausforderung. Bisher basierten ihre Fluchtversuche auf spontanen Überraschungsmomenten, was zur Folge hatte, dass sie sie draußen immer an der Hand hielten und zu Hause zwischen sich ans Tischende setzten.
Sie hatte ihnen Honig um den Bart geschmiert, Interesse vorgetäuscht und neugierige Fragen gestellt, während sie nur den einen unaufmerksamen Augenblick abgewartet hatte. Und es hatte geklappt. David und Theresa hatten sich in ihre eigene Traumablase hineingesteigert und völlig vergessen, sie immer im Auge zu behalten, wie sie es sich angewöhnt hatten.
Wie er es sich angewöhnt hatte.
David konnte die Tatsache nicht länger verdrängen. Es war inzwischen überdeutlich, dass der Fluchtimpuls nicht nur in Silja rumorte. Theresa wollte auch nicht hier sein. Ihr Mutterinstinkt wollte einfach nicht anspringen. Aber es waren nicht Davids Arme, die Silja in diesen verzweifelten Momenten um sich spüren wollte. Wie jedes verirrte Tierjunge schrie Silja nach ihrer Mutter.
Er schaute zu der reglosen Silhouette im Türrahmen. Theresa betrachtete ihn und das schluchzende Mädchen mit bebenden Nasenflügeln.
»Ich ertrag das nicht länger!«, rief sie und knallte die Tür mit lautem Krachen zu. David konnte nicht sagen, ob das erschrockene Zucken von seinem oder Siljas Körper kam. Er fühlte nur die feuchte Wärme von der Schlafanzughose des Mädchens auf seinem Oberschenkel.
»Ich will nicht hierbleiben«, schluchzte sie. »Es gefällt mir hier nicht.«
David nickte. Er konnte nicht länger so tun, als ob sie unrecht hätte.
4
David stellte eine dampfende Tasse Tee vor Theresa und setzte sich ihr gegenüber an den Tisch. Sie legte die Hände um das heiße Porzellan, ohne ihn anzusehen, während er ihr Gesicht studierte und an Rumänien dachte. Jedes Mal, wenn sie die Tür zu seinem trostlosen Zimmer geöffnet hatte, war ihm von Neuem aufgegangen, wie schön sie war, und er hatte sich beherrschen müssen, ihretwegen nicht alles hinzuschmeißen. Bis er genau das schließlich getan hatte.
Die frische Bergluft und die festen Mahlzeiten verstärkten ihre Schönheit noch. Ihr Gesicht war etwas voller geworden, die Sommersprossen malten hübsche Muster auf ihre Wangen. Ihre Haare hatten auch eine andere Struktur, waren kräftiger, lebendiger.
»Sie schläft«, sagte David und tupfte die Kratzer auf seinen Unterarmen mit Haushaltspapier ab. »Wir dürfen diese Diskussionen nicht vor ihr führen. Das macht ihr Angst.«
»Ich kann nicht anders.«
»Siehst du denn nicht, dass wir …«
Theresas Augen weiteten sich. »Ich kann nicht aufhören, in ihrem Gesicht nach ihm zu suchen.«
David versteifte sich.
»Und er ist da. Ich sehe ihn.« Sie biss sich auf die Unterlippe. »Natürlich weiß ich, dass sie ein unschuldiges kleines Mädchen ist. Mein Mädchen … Und es erfüllt mich mit grenzenlosem Hass, wenn ich ihn in ihr sehe.«
»Gib euch mehr Zeit. Darum sind wir hier. Damit ihr euch wiederfindet. Damit es euch irgendwann besser geht.«
»Geht es dir wieder besser hier oben?«
»Ich gebe die Hoffnung für uns nicht auf.«
Sie sah ihn ausdruckslos an. »Manchmal ist es vielleicht ein Ausdruck größerer Stärke, die Hoffnungslosigkeit zu akzeptieren.«
David legte seine Hand auf ihre. »Ich gebe mir wirklich Mühe, Theresa. Aber es ist, als wärst du gar nicht hier.«
»In Rumänien war es anders. Dort warst du …« Sie zog ihre Hand weg.
»Ein anderer«, sagte David. Er verstand, was sie meinte.
In der Fabrik mit dem über ihnen schwebenden Todesurteil konnte Theresa Nicó Krause, Davids dortigen Alias, frei lieben. In Skandinavien, mit David Flugt, einem dänischen Polizisten, rückten ganz andere Dinge in den Vordergrund. Und so, wie das angehende Licht im Kinosaal die Vertraulichkeit der Dunkelheit vertreibt, standen sie sich plötzlich hilflos und wie Fremde gegenüber.
»Mag sein, dass ich ein anderer bin. Vielleicht sind wir das beide«, sagte er. »Aber das hier könnte ein Neuanfang sein. Aber nur, wenn wir uns beide darauf einlassen.«
Sie sah ihn mit reservierter Verletztheit an. »Nicht nur Rumänien quält mich, David.«
»Was heißt das?«
»Ich habe mit einem … Monster zusammengelebt. Über Jahre. Ich war so verdammt naiv.«
»William war ein komplett unberechenbarer Mensch.«
»Ich muss dauernd daran denken, wie viele Frauen er in unserer gemeinsamen Zeit umgebracht hat. Fünf? Zehn? Noch mehr?«
»Du hast ihn geliebt. Da sind solche Zeichen schwer zu erkennen.«
»Aber wenn ich Leben hätte retten können?«
»Das war seine Entscheidung.«
»Du sagst, dass man in Menschen, die man liebt, nur schwer das Böse erkennt. Aber was ist, wenn ich das Böse in ihm gesehen habe, aber nicht wahrhaben wollte?«
»Theresa …«
»Was, wenn ich alle Zeichen bewusst ignoriert oder verdrängt habe?«
»Glaubst du wirklich, dass es so war? Fühlst du dich für den Tod vieler unschuldiger Frauen verantwortlich?« Seine Stimme war leise, spröde.
»Nein, vielleicht, ich weiß nicht«, flüsterte sie. »Ich würde gerne ein Geständnis ablegen.«
»Du kannst mir alles erzählen. Ich kenne alle Details des Falls.«
»Das ist nicht dasselbe. Du bist …«
»Was bin ich?«
An ihrem Zusammenzucken merkte er, dass er die Stimme gehoben hatte.
»Lass uns später weiterreden«, murmelte sie. »Ich bin müde.«
David sah ihren flehenden Blick. Er war selbst furchtbar erschöpft. Müde, ständig wachsam zu sein, nicht zu genügen und trotzdem immer stark sein zu müssen.
»Ich glaube, du bist dir der Konsequenzen nicht ganz bewusst, wenn du damit an die Öffentlichkeit gehst, dass du lebst. Dass Silja lebt«, sagte er heiser, tonlos. »Das Jugendamt wird dir Silja auf der Stelle wegnehmen und sie in ein Heim oder eine Pflegefamilie stecken. Und bei dem Päckchen, das du mit dir herumschleppst, erwartet dich eine endlose Mühle psychologischer Untersuchungen, bis dir die Eignung als Mutter zuerkannt wird. Sie werden Silja nötigen, von ihren Erlebnissen hier oben zu erzählen. Egal, wie hehr unsere Absichten waren, werden wir wegen Entführung angezeigt werden. Ganz zu schweigen davon, dass ich spätestens dann als Mörder verdächtigt werde, wenn Silja sich an die letzte Auseinandersetzung zwischen ihrem Vater und mir erinnert. Und ich kann Williams Schuld nicht beweisen, weil ich in der Nacht persönlich dafür gesorgt habe, alle Spuren zu beseitigen.«
»Du hast doch mit eigenen Augen gesehen, was er getan hat.«
»Eine Sache ist, was ich gesehen habe, eine andere, was ich beweisen kann. Und das wird erst der Anfang der Probleme sein, Theresa. Ich werde als unglaubwürdig und instabil eingestuft werden. Meine Karriere bei der Polizei wird damit beendet sein.«
Theresas Gesicht war so weiß wie die Schneelandschaft vor dem Fenster. Er schluckte die aufsteigende Übelkeit hinunter. Die folgenden Worte waren der endgültige Faustschlag aufs Zwerchfell.
»Und dann die Presse. Die wird uns keine Sekunde in Ruhe lassen. Die Nachricht von deiner Wiederauferstehung, von Siljas und meiner Rolle dabei wird die Sensation schlechthin sein. Unser Konterfei wird überall aushängen. Verabschiede dich schon mal von deinem Leben in der Anonymität. Der Fall in Smøl Vold hat internationale Aufmerksamkeit erregt, unsere Fotos werden in allen europäischen Medien zu sehen sein. Unter anderem in Rumänien.« David holte Luft. »Und du weißt, wer in Rumänien nach uns sucht.«
Ihre Lippen bewegten sich stumm. Er brauchte den Namen nicht auszusprechen.
Volos.
»Wenn er meine wahre Identität herausfindet, wird er keine Sekunde zögern, sein Netzwerk an Killern und korrupten Polizisten zu aktivieren. Selbst, wenn wir ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden, sind wir nirgendwo auf der Welt sicher vor Maulwürfen.«
Theresa starrte auf die Tischplatte. David wollte ihre Hand in seine nehmen, aber er ließ es. Das hier war ihre Wirklichkeit. Das hier waren sie.
»Und was sollen wir jetzt machen?«, fragte sie nach einer ängstlichen Pause.
»Das, was wir schon eine Weile tun. Den Ball flach halten. Und Silja muss merken, dass wir für sie da sind. Alle beide.«
Theresa schüttelte langsam den Kopf.
»Warum weigerst du dich, der Realität ins Auge zu sehen?«
»Ich sehe sie. Aber ich bin nicht bereit, sie zu akzeptieren.«
»Ist das nicht fast schlimmer?«
David atmete tief ein.
»Willst du sie wirklich den Behörden überlassen?«
»Sie will nicht der Mensch sein, den du dir wünschst.«
»Sprichst du jetzt von Silja oder von dir?«
»Ich spreche von dir. Du glaubst, dass du die ganze Welt retten kannst.«
»Nein, nur dich.«
»Du hättest an jeder anderen Tür in der Fabrik klopfen können. Es war purer Zufall, dass du bei mir gelandet bist.«
»Hör auf, das zu sagen.«
»Aber das ist die Wahrheit. Zwei verlorene Seelen, die sich aus unterschiedlichen tragischen Notwendigkeiten gefunden haben. Und das sind wir immer noch.«
»Ich weiß, zu was du mich provozieren willst. Aber ich werde es nicht sagen.«
Bis jetzt war Theresa beherrscht gewesen, defätistisch. Aber plötzlich glänzten ihre Augen auf eine Weise, die er nicht deuten konnte.
»Wenn man so sehr um sein Leben gekämpft hat wie ich«, sagte sie, »dann weiß man, wann es vorbei ist. Diese Wahlmöglichkeit hast du mir genommen.«
»Ich bereue nicht, dich gerettet zu haben.«
»Gerettet?« Sie seufzte. »Das Einzige, was du getan hast, ist, mich von einem Gefängnis in ein anderes zu verfrachten.«
5
Krankenschwester Dorina Olinescu hasste die Nachtschichten auf der Intensivstation. Nicht, weil sie ihre gemütliche kleine Wohnung oder den vorwurfsvoll stierenden Empfang ihrer Katze vermisste. Und die paar Stunden an verpasstem Schlaf ließen sich immer nachholen. Auch wartete da draußen kein interessanter Mann auf sie. Sie hatte auf Tinder längst alle infrage kommenden Exemplare Temeswars durchgewischt.
Die wenigen attraktiven Männer in der App führten sich auf wie notgeile Idioten. Und die weniger attraktiven Männer führten sich genauso auf wie die notgeilen attraktiven Idioten, nur mit einer niedrigeren Erfolgsrate und in einem aggressiveren Ton. Sobald sie ihnen erzählte, dass sie als Krankenschwester im Romanian County Clinical Hospital arbeitete, kühlte die Stimmung blitzschnell ab. Was sie nicht sonderlich überraschte. Sie selbst fand Männer in Uniform sexy. Aber die Krankenschwesteruniform, die sie gerade trug, roch nach Achselschweiß, dem Durchfall eines bedauernswerten Patienten und dem Knoblauchdressing aus der Mittagspause.
Komm zu Mama!
Dorina bog um eine Ecke. Vor ihr lag der kahle Kellerkorridor. Das Geräusch ihrer Schritte wurde von den Wänden zurückgeworfen. Einen Augenblick lang klang es, als würde sie verfolgt. Warum zum Teufel hatten sie die Intensivstation in den Keller gelegt? Und warum zum Teufel hatte sie sich vor der Nachtschicht A Quiet Place 2 angesehen?
Sie bog um die nächste Ecke. Der Polizist auf dem Stuhl am Ende des langen Korridors sah aus wie eine Actionfigur, die sich, je näher sie kam, als durchtrainierter junger Mann entpuppte. Er schob eilig sein Handy in die Tasche, als er sie kommen hörte.
»Wie steht’s?«, fragte sie mit einem flirtenden Lächeln.
Er lachte verlegen. »3:0. Barca führt Cluj vor.«
Dorina hielt ihm ihr Blutprobenkit hin. »Ich habe das tagesaktuelle Passwort vergessen. Vertrauen Sie mir, Herr Polizist?«
»Alex.«
»Endlich mal ein Passwort, das man sich merken kann.«
Der Mann wurde rot. Auf Tinder war er Dorina noch nicht untergekommen.
Sie öffnete die Tür und trat in das dämmrige Krankenzimmer. Die Maschinen und Apparate um das Bett herum piepten gedämpft. Sie las den Wert für die Sauerstoffsättigung im Blut des Patienten vom Bildschirm ab und kontrollierte, ob der Urinbeutel gewechselt werden musste. Es sah alles okay aus. Er war stabil. Sie bereitete die Kanüle und die kleinen Glasampullen für die Blutproben vor und schielte zu dem Arm, der auf der Decke lag. Dorina atmete schneller. Die anderen Schwestern hatten sie gewarnt, nicht in sein Gesicht zu sehen. Aber es kam ihr unprofessionell vor, einem Patienten ohne Blickkontakt Blut abzunehmen. Und immerhin war der hier Polizist. So schlimm konnte es doch nicht sein. Der Kollege, der ihn gefunden hatte, hatte ihn schließlich erkannt. Oder hatte sie das falsch mitbekommen?
Sie dachte an die verzweifelte Frau des Patienten, die rastlos im Wartezimmer herumlief, weil sie zu ihm wollte. Der behandelnde Arzt hatte ihr erklärt, dass ein Besuch erst infrage käme, wenn sie sich einen Überblick über das Ausmaß seiner Verletzungen verschafft hatten. Was allerdings noch nicht erklärte, wieso der Patient selber sich jeglichen Besuch verbeten hatte. Eine typische Reaktion bei Patienten mit starken Gesichtstraumen. Das Gesicht ist der soziale Fingerabdruck des Menschen. Wenn einen eines Morgens aus dem Spiegel ein fremdes Gesicht anschaut, ist es gleichgültig, ob die Persönlichkeit noch intakt ist oder nicht. Da kann man schon panisch werden. Das will man nicht sehen. Die Angst vor einer ähnlichen Reaktion von einem Angehörigen ist daher ein nachvollziehbarer, natürlicher Schutzmechanismus.
Dorina seufzte.
Nur ein kurzer Blick.
Sie hob den Kopf. Und ballte im Schock die Hände zu Fäusten. Da waren nicht einmal ansatzweise menschliche Züge in dem eingedrückten Gesicht zu erkennen. Nur blutroter, platt gewalzter Brei. Unter den durchsichtigen Feuchtbandagen über der fleischigen Masse zeichnete sich kein Nasenbein ab.
Aber nicht das ließ Dorina nach Luft schnappen.
Aus dem verwüsteten Gesicht starrten sie weit offene Augen an.
Am liebsten wäre sie schreiend weggelaufen, doch sie blieb reglos stehen. Ganz ruhig.
Weil der Patient mit Grabesstimme etwas flüsterte.
Einen Namen.
6
David beugte sich vor, stützte die Hände auf den Knien ab. Vor seinem Mund stand der Frostatem, und er wischte sich Schweißtropfen von den Ohren. Er war vor dem Vorratsschuppen stehen geblieben, um kurz zu verschnaufen. Sein tägliches Training begann mit einer Laufstrecke im steilen Terrain, gefolgt von einem Dreikilometermarsch mit einem schweren Holzblock auf den Schultern und abschließenden Klimmzügen an einem Balken im Vorratsschuppen, bis er die Arme nicht mehr über Schulterhöhe heben konnte. Er lief gerne durch Tiefschnee, wo er permanent um die Körperbalance kämpfen und die Knie so weit hochziehen musste, dass die Milchsäure in die Oberschenkelmuskeln schoss. Er hatte sich noch nie in seinem Leben so tief in die Schmerzzone hineinbegeben, dem einzigen Ort, wo er sich alle Gedanken vom Leib halten konnte.
Er richtete sich auf. Der Schweiß auf seiner Haut war bis zum Gefrierpunkt abgekühlt. Er schaute zu der Rauchsäule, die sich aus dem Schornstein der Hütte emporringelte. Theresa hatte Feuer im Ofen gemacht. Er spekulierte, wie lange es dauern würde, bis seine Körperfunktionen so weit runtergekühlt waren, dass er gezwungen war, ins Warme zu gehen.
David warf seine Trainingsklamotten auf den Badezimmerboden. Es klopfte in den Leitungen, als er die Dusche aufdrehte, und es dauerte eine Weile, bis das Wasser einigermaßen temperiert war. Er taute langsam seine eingefrorenen Muskeln unter dem Wasserstrahl auf und rubbelte sich mit dem Handtuch trocken, während der Dampf den Spiegel wieder freigab, der wie ein verzögert hochgeladenes Bild bei schlechter WLAN-Verbindung seinen sehnigen, muskeldefinierten Körper zeigte, dessen Bauch so straff war, dass der Nabel einem erstaunt aufgerissenen Auge glich.
Er fuhr sich mit einer Hand über das kurze dunkle Haar, das knapp hundertneunzig Zentimeter über seinen Fußsohlen wuchs. Der grau melierte Bart rahmte das bis auf die glatte Stirn und die faltenlosen Augen markante, scharfkantige Gesicht ein. Als Kind war er von den anderen Jungen wegen seiner mandelförmigen, sanften Augen aufgezogen worden, deren dunkle Ränder nach zwei Jahrzehnten im Dienst seinem Blick etwas Instabiles und Wachsames gaben.
Sein Oberkörper war von inzwischen kaum noch sichtbaren Tattoos übersät, die er sich für die Glaubwürdigkeit seiner kriminellen Undercoveridentität hatte stechen lassen. Es fehlte noch eine letzte schmerzhafte Laserbehandlung, bis alles weg wäre. Bis auf das schlafende Kaninchenjunge auf seiner Hüfte, das wollte er behalten. Auch wenn die damit verbundenen Erinnerungen schmerzhafter waren als jede Laserbehandlung.
David zog sich eine Jeans und einen kratzenden Wollpullover an und ging raus auf den Flur. Er legte das Ohr an Siljas Tür und sah dann nach Theresa, die in eine Decke gewickelt auf dem Sofa lag. Sie atmete lautlos, schwer zu sagen, ob sie schlief oder nur die Augen geschlossen hatte, als sie ihn auf dem Flur gehört hatte.
Er begab sich in sein Arbeitszimmer und knipste die Schreibtischlampe ein. Im Lichtschein des verstaubten Lampenschirms materialisierten sich ein Drucker und ein Laptop, ein Stapel alter Polizeiberichte, Fotografien und Karten mit Routen- und Zeitmarkierungen. Dazu eine tausendeinhundert Seiten dicke Orts- und Familienchronik des Grandberg-Clans.
Er setzte sich und begann ein kurzes Wettstarren mit den zwei Fotografien an der Wand. Die eine stammte aus einer südjütländischen Lokalzeitung und zeigte William Grandberg bei der Überreichung einer Auszeichnung für seine Wohltätigkeitsarbeit mit jungen gefährdeten Frauen. David hatte das Bild wegen der unerträglichen Ironie gewählt. Um niemals zu vergessen.
Das andere Foto zeigte Lucas Stage. Heruntergeladen von einem internen Polizeiserver, da Lucas keinerlei Profile in sozialen Netzwerken hatte, noch sein Name mit irgendeiner Form von Suchalgorithmus verknüpft war. Davids Puls schnellte in die Höhe beim Anblick von Lucas’ chlorgebleichtem Haar und der fast pudrigen Blässe und kantigen Symmetrie seines Gesichts, die ihm etwas Spitzes und Aggressives verliehen. In seinen auf den ersten Blick hart und sarkastisch wirkenden gletscherblauen Augen schimmerte bei genauerem Hinschauen etwas Tieferliegendes durch, eine verborgene Ebene.
David hatte in den Stunden nach der schicksalhaften Abrechnung mit William einen kurzen Blick in diesen Abgrund erhascht. Aber er hatte gereicht. Gereicht, dass er wissen wollte, was diese zwei Männer miteinander verband, die sich nach seinen Recherchen nie persönlich begegnet waren.
Er schluckte. Das war jetzt mehrere Monate her. Aber der Schock steckte ihm noch immer in den Knochen.
David spazierte im Morgengrauen durch Esbjergs Zentrum. Er fühlte sich blutleer. Wie in einer Endlosschleife lief das albtraumhaft unwirkliche Erlebnis auf dem abgelegenen Hof immer noch vor seinem inneren Auge ab. Als hoffte ein Teil von ihm, gleich schweißgebadet aus dem Schlaf aufzuschrecken, dankbar und erleichtert, solch abgrundtiefe Boshaftigkeit ins Reich der Träume verbannen zu können.
Er wickelte sich fester in seine Jacke. Vor ihm schimmerte der flaschengrüne Wasserspiegel des Hafenbeckens. Er zog sein Telefon aus der Tasche. Um 22.14 Uhr gestern Abend hatte er Lucas angerufen und ihm eine unzweideutige Nachricht auf die Mailbox gesprochen: William Grandberg, Chef der Mordkommission für den Polizeidistrikt Süd- und Süderjütland, hatte achtzehn Morde begangen.
Aber da waren keine verpassten Anrufe.
Lucas Stage hatte noch immer nicht auf seine Nachricht reagiert.
David stand am Rand des Hafenbeckens. Mit einer raschen Bewegung zog er Williams Handy aus der Innentasche und holte zu einem schwungvollen Wurf aufs Wasser aus. Das erwartete Klatschen blieb aus. Instinktiv hatten seine Finger sich schützend um das Telefon gelegt.
David starrte auf das trübe Wasser. Von innen tickte etwas gegen seine Stirn.
Ein Name.
Er zog die Brauen hoch. Wieso dachte er plötzlich an Silja?
Von einem Container rollte das Echo eines lauten Dröhnens zu ihm rüber. Ihm war klar, warum William Silja in jener Nacht mitgenommen hatte. Als menschlichen Schutzschild gegen Davids und Jennys Falle. Aber sein Gehirn suchte noch nach dem Wie.
Wie hatte William die Falle durchschaut?
Das ging nur mit einem Maulwurf, einem unsichtbaren Virus. David klickte sich zu Williams Anrufliste durch. Der letzte Anruf war von gestern Abend. 22.21 Uhr.
David drückte die Nummer.
Nach drei Freizeichen kam die Antwort.
»Shit, warum meldest du dich erst jetzt? Alles im Griff?«
David beendete die Verbindung. Die Zigarette fiel ihm aus dem Mund, als er nach Luft schnappte. Lucas hatte Davids Voicemail abgehört. Aber seine Loyalität galt jemand anderem. William. Dem Monster.
David beugte sich nach vorn. Die Atemzüge ergossen sich aus seinem Mund. Er spürte die Angst, eine klaustrophobische Enge, ganz allein mit seinem Wissen zu sein, seiner Scham, seinen Albträumen. Aus denen es kein Erwachen gab. Dieser Albtraum war noch lange nicht zu Ende.
Und würde es vermutlich niemals sein.
David lockerte die bis zu den Ohren hochgezogenen Schultern. Das Gefühl jenes Morgens steckte ihm noch immer in den Knochen, bis zu dem Dröhnen des Containers. Er hatte die letzten Monate dazu genutzt, Williams und Lucas’ Bewegungen über die Polizeiberichte und Einsätze zu überprüfen, aber nach wie vor keine Bestätigung für eine existierende Verbindung zwischen den beiden Männern gefunden. Es war ihm nicht gelungen, sie zum selben Zeitpunkt an einem geografischen Ort zusammenzubringen. Zumindest nicht im Rahmen ihrer Polizeiarbeit.
Er griff nach dem Notizblock, auf dem er seine Ideen und Beobachtungen notiert hatte, warf ihn aber nach einem kurzen Blick frustriert wieder beiseite.
William war tot und Lucas offensichtlich aus einem dunklen Erdloch hervorgekrochen. Details über Lucas’ Privatleben und familiäre Verhältnisse waren ebenso wenig existent, wie seine gletscherblauen Augen, die ihn von der Fotografie anstrahlten, bar jeder Regung waren. Hin und wieder hatte David das Gefühl, dass Lucas Stage gar nicht existierte.
Davids Laptop vermeldete das Eintreffen einer E-Mail. Er las die Betreffzeile des Reiters, der sich von rechts in den Bildschirm geschoben hatte.
Absender: [email protected]
Betreff: Attention! Quick response
David öffnete die Mail. James Curtis war sein ehemaliger Chef bei Europol. Er schrieb, dass der rumänische Polizeikommissar Radu Romanescu nach einem brutalen Überfall auf offener Straße auf die Intensivstation eingeliefert worden war. Infolge seiner schweren Verletzungen war Radu noch nicht in der Verfassung für ein Verhör, um die Ursache dafür zu erklären. Normalerweise wurde in solchen Fällen landesintern ermittelt, aber Europols Informationssystem EIS, das konstant übereinstimmende Daten in den digitalen Fallakten der Mitgliedsländer sichtete, war auf ein entscheidendes Detail gestoßen. Radu war für einen kurzen Moment zu Bewusstsein gekommen und hatte in Anwesenheit einer Krankenschwester mehrfach hintereinander einen Namen gemurmelt. Die Schwester hatte den Polizeibeamten vor der Tür informiert, worauf der Name ins System eingespeist und von der EIS-Suchmaschine abgefangen worden war.
David starrte auf den Namen.
Nicó Krause.
Es gab viele Lecks bei der Polizei, Kollegen, die vertrauliche Informationen weiterleiteten, aus Langeweile, um mit Journalisten zu netzwerken oder für die Aufbesserung der Urlaubskasse. Aber David war sicher, dass diese Information nicht von einem von ihnen kam. Seine Undercoveridentität war Verschlusssache und von niemandem abrufbar. Normale Beamte hatten keinen Zugang zu dieser Art von Daten, und weder die Medien noch die Öffentlichkeit wussten etwas von seinem Geheimauftrag. Es gab nur einen einzigen Ort auf dem Erdball, an dem der rumänische Beamte den Namen aufgeschnappt haben konnte.
In der Fabrik.
Von Volos.
David hatte jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins war, sich umgehend mit Europol in Verbindung zu setzen und sich einen Überblick zu verschaffen, warum dieser rumänische Kommissar in Verbindung mit seinem Überfall von Nicó Krause gesprochen hatte. Es war ein offenes Geheimnis, dass die lokalen Polizeibeamten auf Volos’ Lohnliste standen. Davids ehemaliger Chef hatte sicher längst einen Überblick über das Risikolevel und eine effektive Strategie parat.
Und dann war da die zweite Möglichkeit, für die David sich entschied.
Er fuhr den Computer runter. Es durfte keine Spur zu dieser Hütte führen. Er horchte in sich hinein und fühlte sich nicht operativ verpflichtet. Solange er sich ruhig verhielt, musste er keine interne Ermittlung fürchten. Aber sobald er die Tür einen Spaltbreit öffnete, könnte er nicht mehr kontrollieren, was von der anderen Seite hereindrängte.
Wie Theresa sagte, gab es Orte, von denen keine Rückkehr vorgesehen war. Aber es gab verdammt noch mal auch Orte, an die man besser nie zurückkehrte. David wäre in unmittelbarer Lebensgefahr, sobald er einen Fuß auf Temeswarer Boden setzte. Volos hatte überall in der Stadt Augen. Solange nur von Nicó Krause die Rede war, war seine wahre Identität noch geschützt.
David stellte sich ans Fenster. Sein Blick fiel auf den blutigen Fleck im Schnee. Er dachte an den empfindlichen Lebenszyklus eines Beutetiers. Alles lief darauf hinaus, den fatalen Bruchteil der Sekunde zu vermeiden, in dem man sich in falscher Sicherheit wiegte. Um zu überleben, musste man zu jeder Zeit alles in die Waagschale werfen. Augen im Nacken haben. Das war der einzige Schutz des Beutetiers vor dem Raubtier. Der Überblick. Das Sammeln von Informationen.
Denn egal, wie still es im Wald war, irgendetwas lauerte immer dort draußen. Abwartend. Beobachtend.
Er nahm den Autoschlüssel vom Tisch und verließ die Hütte.
7
David parkte vor dem Baumarkt des kleinen Ortes Terråk. In den bunten Häusern auf der Landzunge, an deren Spitze die eisgrauen Wasserspiegel des Tosenfjords und Bindalsfjords aufeinandertrafen, lebten knapp sechshundert Norweger. Die Fahrt von der Hütte in Åbygda über die spiegelglatten Straßen mit den dicht stehenden Fichten zu beiden Seiten dauerte fünfundzwanzig Minuten.
Er stieg aus dem Wagen und lief in die offene Fjordlandschaft. Die salzige Eisschicht knirschte unter seinen Sohlen, als er sich gegen die kalten Windstöße lehnte, die bei ihnen im Wald nur als sanfte Böen ankamen. Ein Schild an einem von Frost überzogenen Haus verkündete, dass es hier wieder Waffeln gab, sobald das Thermometer in den zweistelligen Plusbereich kletterte.
Er wischte den Schnee von einer Bank und setzte sich, rieb sich die Hände an den Oberschenkeln warm und sah zu den hintereinander geschachtelten Berggipfeln des grauweißen Hochfjells. Natürlich war es übertrieben, bis hierher zu fahren, um seine GPS-Position zu verbergen. Aber seine besten Entscheidungen fällte er immer noch an genau dieser Schnittstelle zwischen Vernunft und Paranoia.
Er nahm sein Handy heraus.
»Good afternoon, James Curtis’ Büro«, sagte der Englisch sprechende Mann am anderen Ende der Verbindung.
David räusperte sich. »David Flugt. James erwartet meinen Anruf.«
»Sind Sie sicher, dass Sie die richtige Nummer gewählt haben, Sir?«
»Wie bitte? Sie haben sich doch gerade mit James Curtis’ Büro gemeldet.«
»Augenblick, Sir.« David hörte ihn etwas tippen. Im Hintergrund war Gemurmel zu hören wie in einem Callcenter. Dann war die Stimme wieder zurück. »Ich muss Sie um ein Passwort bitten, um Sie weiterleiten zu können.«
»Was soll das? Ich bin ein alter Freund.«
»So ist das Prozedere.«
David kniff genervt die Augen zusammen. Warum zum Teufel hatte er keine Privatnummer von James? Der Brite wurde den ganzen Tag mit Informationen überschüttet und schützte sich durch ein Passwort vor unangemeldeten Anrufen.
»Der Name seines Sohnes, soviel ich weiß«, sagte David unsicher. »Aber wie hieß der Bursche jetzt noch gleich wieder.«
»Haben Sie nicht gesagt, Sie wären ein Freund, Sir?«
»Ja, doch, geben Sie mir eine Sekunde. Allen, Andrew, An… Anton!«
»Einen Moment, bitte, ich verbinde.«
David bildete sich ein, den glucksenden Sog des unter dem Eis verborgenen Wassers zu hören.
»Verdammt noch mal«, ertönte eine hektische Männerstimme. »David! Lang ist’s her. Wie geht es dir?«
»Super. Und selbst?«
»Du klingst verschnupft. Bist du erkältet? Oder etwas verkatert etwa?«
»Ähm, ja«, antwortete David ausweichend.
»Ist die dänische Polizeiarbeit so erschöpfend?«
»Ich hab Urlaub.«
»Urlaub? Warum? Um mit den Kindern nach LEGOLAND zu fahren?«
»Du weißt schon, dass ich keine Kinder habe.«
»So was kann sich ändern. Ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört.«
»Und da habe ich in deiner Fantasie mal eben eine Familie gegründet?«
James lachte trocken. »Irgendwann musst du mir verraten, wie du das machst.«
»Was?«
»Du kommst einem vor wie ein alter Freund, aber man hat permanent Lust, dich neu kennenzulernen.«
»Ich habe deine Mail bekommen«, sagte David und sah vor sich, wie der abrupte Themenwechsel eine tiefe Furche zwischen den Augenbrauen des Briten hervorrief. James war ein distinguierter älterer Herr, immer tadellos gekleidet mit gebügeltem Hemd und Bügelfaltenhose. Elegant. Sein jüngeres Ich hatte für die britische Sondereinheit SAS gearbeitet. Die Elitesoldaten nahmen an Einsätzen in den gefährlichsten Kriegszonen der Welt teil. Aber im Gegensatz zu den meisten anderen Soldaten, mit denen David bei Europol zusammengearbeitet hatte, brachte selbst das größte Glas Whisky James nicht dazu, irgendwelche Details aus seiner Zeit beim Militär auszuplaudern. Eine Eigenschaft, die David sehr schätzte. Er wusste, wie schwer es berauschten Männern fiel, ihre Heldengeschichten in der Schublade zu behalten.
»Ich bin noch dabei, mir einen Überblick zu verschaffen«, sagte James. »Wir haben dazu ein bisschen tiefer im dark web gegraben. Volos hat es noch nicht aufgegeben, Nicó Krause aufzuspüren. Wir haben eine Reihe ZIP-Files mit Fotos von dir … sorry, von Nicó. Von den Überwachungskameras der Fabrik. Sie wurden an alle Einheiten des Syndikats in Osteuropa verschickt. Mit einem Kopfgeld.«
»Wie hoch?«
James zögerte.
»So schlimm?«, sagte David.
»Zweihunderttausend Euro. Tot oder lebendig.«
David glaubte wieder, ein Scharren unter dem Eis zu hören.
»Was ist mit dem Polizisten? Radu? Ich hab noch nie etwas von ihm gehört.«
»Die Daten lassen keine unmittelbare Verbindung von Radu zu irgendwas erkennen.«
»Und was ist deine persönliche Einschätzung?«
»Ich glaube, Volos hat gerade erst begonnen. Aber sicher bin ich mir nicht.«
»Warum nicht?«
»Weil du mir nie Bericht erstattet hast, was in der Fabrik eigentlich passiert ist.«
»Ich habe den Auftrag abgebrochen, weil mein Cover aufgeflogen ist.«
James seufzte. »David, lass uns vereinbaren, dass du aufhörst, mich zu unterschätzen und mir diese lauwarmen Lügen zu servieren. Dann bohre ich auch nicht weiter nach, was dort vorgefallen ist.«
»Hört sich fair an.«
»Anyway, ich finde nur wenig über Radu Romanescu. Ich habe mit seinem Chef in Temeswar gesprochen. Laut ihm ist er weder in irgendwelche Bestechungen noch in irgendwelche Disziplinarverfahren verwickelt. Er hatte bislang ausschließlich mit lokalen Ermittlungen zu tun. Diebstähle, ein paar Morde. Aber sein Chef hat in einem Nebensatz fallen lassen, dass er sich den anderen vielleicht etwas moralisch überlegen gefühlt hat.«
»In welcher Weise?«
»Sie haben ihn einmal bei einer Soloermittlung erwischt. Seine Begründung war, dass er schlicht und ergreifend die Einmischung von inkompetenten und korrupten Kollegen nicht erträgt.«
»Worum ging es in dem Fall?«