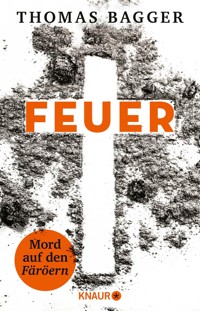
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für die Task Force 14
- Sprache: Deutsch
Vier tote Priester in einer Kirche: ritueller Selbstmord – oder etwas viel Grausameres? In »FEUER – Mord auf den Färöern«, dem 2. Teil der düsteren dänischen Thriller-Reihe um die Sonderermittler der Task Force 14, wartet auf Rechtsmedizinerin Sidsel Jensen ein Alptraum, aus dem es kein Erwachen gibt. Fluchtartig hat Rechtsmedizinerin Sidsel Jensen einst ihr Heimatdorf auf den Färöer Inseln verlassen – jetzt wird sie mit ihrem exzentrischen Kollegen Lucas Stage von der Task Force 14 genau in jene 100-Seelen-Gemeinde gerufen: In der Kirche des Dörfchens hat sich eine bizarre Bluttat ereignet. Auf den ersten Blick wirken die vier toten Priester, als hätten sie sich bei einem rituellen Selbstmord gegenseitig das Leben genommen. Doch es gibt Hinweise auf die Anwesenheit eines fünften Geistlichen. Lucas gerät schnell mit den misstrauischen Färöern aneinander, und der Fall scheint auf der Stelle zu treten. Bis Sidsel bereit ist, sich den Dämonen ihrer Vergangenheit zu stellen … Ihren ersten ebenso brutalen wie menschlich berührenden Fall löst die Task Force 14 in Thomas Baggers Thriller »NACHT – Die Toten von Jütland«. Die Thriller-Reihe aus Dänemark hat das Zeug zum Pageturner und bietet rasant-düsteren Nervenkitzel für Fans skandinavischer Thriller à la Stieg Larsson oder Faber / Pedersen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Thomas Bagger
FEUER
Mord auf den Färöern
Thriller
Aus dem Dänischen von Maike Dörries
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Fluchtartig hat Rechtsmedizinerin Sidsel Jensen einst ihr Heimatdorf auf den Färöer Inseln verlassen – jetzt wird sie mit ihrem exzentrischen Kollegen Lucas Stage von der Kopenhagener Task Force 14 genau in jene 100-Seelen-Gemeinde gerufen: In der örtlichen Kirche hat sich eine bizarre Bluttat ereignet. Es scheint, als hätten sich die vier Priester bei einem rituellen Selbstmord das Leben genommen. Doch es gibt Hinweise auf eine anwesende fünfte Person. Lucas Stage gerät schnell mit den misstrauischen Färöern aneinander, und die Ermittlungen drehen sich im Kreis. Bis Sidsel bereit ist, sich den Dämonen ihrer Vergangenheit zu stellen …
Rasant, brutal, nervenaufreibend – der zweite Fall für die Kopenhagener Task Force 14
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
Epilog
1
Die sich dunkel und schützend um den kleinen Ort schließenden Hänge öffneten sich nach vorne zum Fjord, der spiegelblank im Mondschein lag. Die ersten Siedler auf den Färöern hatten sich die Entstehung der gigantischen, ausgehöhlten Klüfte so vorgestellt, dass Gott mit seinem Zeigefinger über die Felsenlandschaft gefahren war, unbeschwert, wie durch perlenden Bierschaum. Und der Fjord vor dem kleinen Ort war eine Träne der Bewunderung aus seinem Auge für die schroffe Schönheit der Landschaft, in der nichts dafür sprach, dass dort jemals Leben entstehen oder gar bestehen könnte.
Aber die Menschen hatten Gott mit ihrem Überlebenswillen überrascht. Über Jahrhunderte hinweg hatten sie die Inselgruppe gezähmt und gelernt, sich von den kargen Bergen und den wilden Wassermassen des Meeres zu ernähren. Mit der Zeit hatten sie neue Fähigkeiten entwickelt, die ihnen den Raum für mehr als das pure Überleben gaben. Sie bauten Kirchen, züchteten Schafe und bewirtschafteten die Erde, sie sammelten sich im Windschatten der Schluchten in kleinen Gemeinschaften und gewöhnten sich daran, dass der Himmel ohne Vorwarnung von pechschwarzen Stürmen oder Nebeln so dicht wie Feuerrauch verschlungen werden konnte.
Und unausweichlich bohrte sich die Schroffheit der Natur unter die Haut der Menschen wie mikroskopische Pilzsporen und sonderte eine widerstandsfähige Substanz in ihre Blutbahnen und das Gehirngewebe ab, die die Menschen mit Leib und Seele mit den Klippen und dem Meer und nicht zuletzt mit ihrem Glauben an Gott verband.
Niemand konnte genau sagen, wann der Ort in dem Talkessel gegründet worden war, sicher war nur, dass in der bunten Ansammlung von Häusern der Wikingerhäuptling Tróndur beheimatet war, der sich gegen die Christianisierung der Färöer durch Sigmundur Brestisson aufgelehnt hatte und im Jahr 1000 von ebendem enthauptet wurde. So weit die lückenhaften Bruchstücke, die Hjalti Kjølbro sich tausend Jahre später aus seiner Schulzeit ins Gedächtnis rief.
Das Christentum war mit Blut auf die Färöer gekommen.
Der Gedanke ließ Hjalti unter seinem Flanellhemd frösteln. Vom Küchenfenster konnte er auf die Hauptstraße sehen. Und zu dem neuen Mast mit der Überwachungskamera, von dem ein grelles Licht schien. Das sollte die Tieraktivisten abschrecken und die jungen Leute auf dem Weg in den Ort daran erinnern, vom Gas zu gehen. Hjalti seufzte. Das Problem war nur, dass die jungen Leute gar nicht schnell genug von hier wegkommen konnten.
Sein Blick verlor sich in der Dunkelheit hinter dem Mast. Er hoffte, dass bald ein Paar Scheinwerfer auf der steilen Landstraße zu sehen war. Am letzten Tag war ihm nie ganz wohl. Es war nicht gut, in einem Ort ohne Frauen zu wohnen. Zu wissen, dass hinter den erleuchteten Fenstern auf der anderen Straßenseite nur Männer hockten. Männer mit kräftigen Händen und finsterem Gemüt.
Hjaltis Vater hatte immer gepredigt, dass die drei wichtigsten Dinge, die ein Färöer mit sich aufs Meer nahm, das Kreuz, seine Rettungsweste und die Gewissheit waren, dass an Land seine Frau auf ihn wartete. Und das Meer hatte immer das letzte Wort. Im Jahr 1913 waren alle Männer aus Skarð in einem Sturm ertrunken und hatten die Frauen, einen frisch geborenen Jungen und einen alten Mann allein zurückgelassen. Wenige Jahre später war Skarð ein Geisterort, in dem die verfallenen Ruinen wie eine Mahnung standen, dass die Gnade des Meeres nur geliehen war.
Die Häuser in Hjaltis Ort waren im traditionell färöischen Stil gebaut, mit Satteldächern und bunt gebeizten Außenwänden auf einem Natursteinfundament. Nicht wie in Tórshavn und den anderen, modernisierten Orten, wo die wiederkehrenden Orkane neue Baustile in Beton und Stahl erfordert hatten. Die traditionelle Bauweise war zu aufwendig und kostenträchtig geworden. Darüber lernte man nichts an den dänischen Universitäten. Das zumindest behaupteten die, die nach Hause zurückkehrten, weil sie keine Arbeit außerhalb der Färöer fanden, den Mund voll mit Fortschritt, dieser Seuche, die sie über ihrem Heimatboden auskotzten.
Hjalti hielt die Luft an. Auf dem Flur knarrten die Räder des Rollstuhls in einem langsamen, metallischen Walzer. Das Geräusch verursachte ihm eine Gänsehaut. Er spürte die Erleichterung, als die Räder über die Türschwelle ins Wohnzimmer holperten und es wieder still wurde im Haus.
»Au, verdammt …« Hjalti ließ den Kreuzanhänger seiner Halskette los, den er sich tief in den Handballen gedrückt hatte.
Das Wochenende war ihm länger vorgekommen als sonst. Am Freitag waren alle Frauen und Kinder der Tradition treu nach Tórshavn gefahren, um dort Neujahr zu feiern. Jetzt war Sonntagabend. Und die Stimmung der Männer war nach dem gestrigen Trinkgelage von Freiheit in Verlassenheit umgeschlagen. Das ungewohnte Gefühl des Katers erfüllte ihn mit einer bedrückenden Melancholie. Dies war der einzige Tag im Jahr, an dem er Sara anlog.
Nein, Schatz, wir haben nur ein paar Bier getrunken und sind früh schlafen gegangen.
Hjalti Kjølbro holte tief Luft.
Von nun an würde er seine Frau bis zu seinem Tod jeden Tag anlügen.
»Scha-atz? Wo steckst du?«
»Küche«, antwortete er, sorgsam darauf bedacht, dass seine Stimme nicht kippte.
»Hier bist du?«, sagte Sara mit einem Restlachen nach den Abschiedsumarmungen von den Freundinnen. »Warum sind alle Lichter im Haus an?«
»Es war plötzlich so dunkel.«
»Okay? Wo ist dein Vater?«
»Wohnzimmer. Fernsehen.«
Er hörte ihren zögernden Atem hinter sich.
»Habt ihr schon gegessen?«
»Ich hab keinen Hunger.«
»War es so wild gestern?«
»Nein, Schatz, wir haben nur ein paar Bier getrunken und sind früh schlafen gegangen.«
Sara seufzte. »Wo ist Ísakur?«
»Übernachtet im Fjell.«
»Schon wieder? Der Bursche ist zu viel mit sich allein. Der wird noch komisch im Kopf.« Sie stellte die Tragetaschen auf dem Küchentisch ab. »Gibt es nichts, worüber du mit mir reden willst?«
Hjalti betrachtete die Silhouette seiner Frau aus dem Augenwinkel.
»Was meinst du?«
Sie lachte. »Wie viel Geld ich ausgegeben habe?«
»Ich … ich muss dir was erzählen …«
»Hallo, Papa!« Ihre Tochter stürmte in die Küche. »Wie findest du das?«
Hjalti lächelte verkrampft, als Røskva sich in einem weißen Kleid vor ihm im Kreis drehte. »Sehr schick, Schatz.« Er spürte Saras skeptischen Blick auf sich. »Vielleicht ein bisschen kurz.«
»Entspann dich, Papa! Milja hat Hotpants gekauft, die wie angegossen an ihrem Kardashian-Arsch sitzen.«
»Na, na!« Hjalti lachte trocken, sein Blick flackerte und fand das schief hängende Kruzifix an der Wand.
Die Tochter musterte ihn mit ihren blaugrünen Augen, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte.
»Was ist los mit dir, Papa?«
»Was meinst du?«
»Du bist irgendwie seltsam. Und so blass. Hast du einen Kater?«
Das Unwohlsein äußerte sich als Glühen in Hjaltis Wangen.
»Vielleicht hatten wir gestern doch ein bisschen mehr als nur ein paar Bier.«
»Wenigstens einer, der es ein bisschen krachen lässt in diesem Kaff hier.« Seine Tochter blinzelte ihm zu und spazierte vor sich hin summend aus der Küche.
»Du wolltest mir was erzählen?«, fragte Sara.
»Wir, ähm …«
»Ja?«
Hjalti schüttelte den Kopf.
»Ich hab Vater gestern was trinken lassen.«
»Wie bitte?«
»Nicht viel. Wir …«
»Hjalti, du redest wirr. Erst sagst du ›ich‹, dann plötzlich ›wir‹? Entscheide dich.«
»Wir. Ich meinte wir.«
»Lass mich raten. Du und Shurdur?«
Hjalti nickte.
»Ihr hattet einen im Kahn, als dein Vater zu euch kam und ein Bier wollte, und da hat Shurdur gesagt, dass ein Bier ja wohl kaum schaden würde. Dein Vater nimmt ja auch nur dreimal am Tag Morphin.«
»Ja.«
»Ist noch Alkohol im Haus?«
Er nickte.
»Kipp ihn ins Klo. Alkohol setzt Männern Flausen in den Kopf, für die sie sich am nächsten Tag in Grund und Boden schämen.«
Der Schweiß juckte unter Hjaltis Flanellhemd.
Sara ging zu ihm und legte ihre warmen Handflächen an seine Wangen.
»Die Frauen und ich werden darüber beratschlagen, was wir im nächsten Jahr mit euch anfangen. Man kann euch einfach nicht alleine lassen.«
Hjalti seufzte. Saras Hände fühlten sich so weich, so vertraut an. Unverdient.
Hjalti und sein Vater saßen schweigend vor dem Fernseher. Die Stimme des Nachrichtensprechers lief wie eine gedämpfte Tonspur im Hintergrund. Der würzige Duft aus der Küche ließ Hjaltis Magen knurren. Er hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen, aber jetzt, da Sara und Røskva zurück waren und das Haus mit Licht und Lachen füllten, fühlte sich alles schon fast wieder normal an.
Hjalti schielte zu seinem Vater, der mit rot geränderten Augen grimmig auf den Bildschirm starrte. Der Rollstuhl wirkte zu klein für den langen Körper, auch wenn von der einstmals stattlichen Erscheinung seines Vaters nur noch eine zerbrechliche Hülle übrig war, als hätte er sich in Wasser aufgelöst. Der Brustkorb war eingefallen und sein Sweater grau verwaschen. Zwischendurch bewegten sich die Lippen in seinem struppigen Bart, aber die Worte verhakten sich im Mund, weil ein Blutpropf im Gehirn die Bereiche gelöscht hatte, die für die Sprache zuständig waren. Es passierte immer seltener, dass in seinem Kopf ein Licht anging und er Worte zu Sätzen zusammenbauen konnte.
Hjalti schloss die Tür zum Wohnzimmer und ging neben dem Rollstuhl in die Hocke. »Vater?«, flüsterte er.
Sein Vater starrte vor sich hin, stumm, in sich versunken. Hjalti wedelte mit einer Hand vor seinem Gesicht herum. Die Pupillen des Alten bewegten sich im Takt der Hand hin und her. Gut. Da war noch Leben.
»Vater, wir müssen über gestern reden.«
Der Vater atmete tief ein. Er konnte es nicht leiden, wenn er angesprochen wurde. Das hieß, dass man ihn ansah.
»Kannst du dich an das Bier erinnern, das du gestern bekommen hast? Shurdur war auch hier.«
Die Pupillen schwammen unter seinen schweren Lidern.
»Du hast uns etwas erzählt. Erinnerst du dich?«
Schweigen.
»Etwas über …« Hjalti senkte seine Stimme zu einem trockenen Flüstern. »Eivør.«
Der Vater stieß sauer auf. »Ei…vør. Männer … in der Nacht.«
»Was?«
Ein Funke blitzte in den Augen des Alten auf. Er griff mit seinen fahrigen, knochigen Fingern nach Hjaltis Arm.
»Sie huren … sie ficken …«
»Was? Wer?«
»Die schwarzen Vögel, tanzen auf dem Kreuz, tragen es nicht auf ihren Schultern.«
»Von wem redest du?«
»Zwei Männer in der Nacht.«
»Vater, ich …«
»Alles soll in Blut baden. Die schwarzen Vögel sollen in Blut baden.« Sein Vater war außer sich, Speicheltropfen spritzten von seinen Lippen.
»Ganz ruhig. Da sind keine Männer in der Nacht«, sagte Hjalti mit unruhigen Händen.
»Zwei Männer … alles soll …«
»Was ist hier los?«
Hjalti sah erschrocken zu Sara, die im Türrahmen stand.
»Wie lange stehst du schon da, Schatz?«
»Spielt das eine Rolle?«
Der Vater hustete, als hätte er Salzwasser geschluckt.
»Vater ist plötzlich wach geworden. Er, ähm …« Hjalti schaute zu dem Rollstuhl. Der Alte war wieder abwesend. Hjalti atmete beschämt auf. Sara hatte ja recht. Alkohol brachte Männer auf dumme Gedanken. Und jetzt ängstigten sie ihn zu Tode.
Im Haus kehrte Ruhe ein. Hjalti war gerade unter die Bettdecke gekrochen, als er Saras Stimme hörte.
»Licht.«
Seine Augenlider glitten wieder auf. Sie stand in ihrem Nachthemd am Fenster.
»Was meinst du, Schatz?«, fragte er seufzend. »Komm ins Bett.«
»In der Kirche ist Licht. In der Sakristei.«
Hjalti versteifte, als würde ein eisiger Wind durchs Schlafzimmer ziehen.
»Schatz, es ist spät.«
»Du hast recht. Es ist spät. Zu spät. Da sollte kein Licht sein.«
Hjalti ließ sich stöhnend zurück aufs Kissen fallen, ehe er die Decke aufschlug.
Im Flur stieg er in seine Stiefel und griff nach dem Schlüsselbund für die Kirche, aber seine Hand bekam einen leeren Haken zu fassen. Im nächsten Augenblick war hinter ihm ein Schlüsselklirren zu hören.
»Du hast sie auf den Küchentisch gelegt«, sagte Sara.
»Niemals«, murmelte er und verschwand durch die Tür.
Eine leichte Brise zog vom Fjord herüber und sättigte die Luft mit einem Duft nach Tang und Muscheln. Im Ort gab es keine Straßenlaternen, aber der bleich wie ein abgenagter Walknochen leuchtende Mond gab ein bisschen Sicht. Der Asphalt knirschte unter Hjaltis Stiefelsohlen, und in seiner Jackentasche klirrten die Schlüssel, die ihm und noch ein paar anderen Laien anvertraut worden waren, um Gottesdienste abzuhalten, wenn die wenigen Geistlichen des Landes in anderen Gemeinden Dienst taten.
Die Angeln des Eisentores ächzten, als er den Friedhof betrat. Er blieb kurz stehen und kniff die Augen zusammen. Die schwarz geteerten Holzwände der Kirche saugten das Mondlicht auf wie ein schwarzes Loch. Aber er wusste auch so, dass sie da waren, um ihn herum. Die Grabsteine. Die Toten.
Hjalti stieg die Stufen hoch zu der weiß gestrichenen, niedrigen Eingangstür, die kaum mehr als eine Luke war. Die Härchen auf seinem Unterarm stellten sich auf, als sich die offene Tür im Wind bewegte. Er war sich ganz sicher, sie abgeschlossen zu haben.
Er trat in die Waffenkammer, in der in vergangenen Zeiten die männlichen Bewohner des Ortes vor dem Gottesdienst ihre Waffen abgelegt hatten. Heute gab es hier nur noch Haken für Mäntel und Jacken. Er schaute in den dunklen Schlund des Kirchenraums, in dem die Stille schwer wie ein Briefbeschwerer lag.
»Hallo! Ist da jemand?«
Die einzige Antwort war das Echo seiner ängstlichen Stimme.
Er schaltete die mitgenommene Taschenlampe ein und leuchtete durch den Raum, in die dunklen Schneisen zwischen den Kirchenbänken, die alles Mögliche verbergen konnten. Der Duft von trockenem Holz und verlöschten Wachskerzen strömte ihm aus der verdichteten Mitternachtsversion der Kirche entgegen.
Die Angst legte sich wie eine Schlinge um seinen Hals. Er zwang seine Füße, zum Altar zu gehen. Die Bodenbretter knackten unter seinem Gewicht. Das Knacken setzte sich bis in die dunklen Winkel fort, und er schwenkte den Lichtkegel über Dinge, die nicht da waren. Vor dem Altar blieb er stehen und strahlte den gekreuzigten Jesus an. »Frau, warum weinst du?« war in den Holzfuß unter der Holzfigur geschnitzt. Für einen flüchtigen Augenblick übermannten ihn Erinnerungen aus seiner Kindheit, verborgen hinter dünnen Gardinen des Schreckens.
Er machte das Kreuzzeichen vor der Brust und flüsterte leise: »Im Namen des Vaters, des Sohnes und …«
Hjalti fuhr zusammen. Da war ein lautes Geräusch. Als würde jemand seine Faust auf einen Tisch hämmern.
Er starrte angststumm zu dem Gekreuzigten hoch. In einem ersten Impuls glaubte er, sich verhört zu haben. Aber dann hörte er das Echo durch den Kirchraum rollen. Eine akustische Täuschung hatte kein Echo. Das Herz im Hals, griff er nach dem Kerzenleuchter auf dem Altar und schwang ihn in den Händen. Die Leuchterarme durchschnitten leere Luft. Panisch suchte er mit dem Blick die Bänke ab.
Leer. Hier war niemand. Nur er.
Da krachte es wieder. Er sah sich verwirrt im Raum um. Das musste das alte Holz sein, das in dem kalten Windzug von der Tür arbeitete. Er versuchte, seine hektischen Atemzüge wieder zu beruhigen, und schielte zur Seite. Durch den unteren Spalt der Tür zur Sakristei schob sich ein undeutlicher Lichtstreifen. Er umfasste den Kerzenhalter fester, ging zu der Tür und spürte den Widerstand in der Klinke, der von seiner eigenen zitternden Hand kam, ehe er die Tür öffnete.
Hjalti Kjølbro konnte im Nachhinein nicht mehr sagen, ob er Sekunden oder Minuten in die Sakristei gestarrt hatte, aber das war auch völlig bedeutungslos bei dem Anblick, der sich ihm dort bot, so durch und durch grauenvoll, dass sich eine Leere in ihm entfaltete, die alles verdrängte, was er jemals über Hoffnung verstanden oder zu verstehen geglaubt hatte.
2
Guten Morgen, Schatz, stehst du schon lange da?«
Simon strahlte, als er Sidsel in der Türöffnung erblickte. Sie hatte ihm zugesehen, wie er eine schiefe Melodie pfeifend sich erst den Finger an der Pfanne verbrannt, ihn dann in den Mund geschoben und danach mit einem gezielten Schlag die Melone gespalten hatte.
»Guten Morgen, Simon.«
Sie schaute zu dem hübsch gedeckten Tisch – kleine Teller mit Würstchen, Bacon, Granola, einem Schälchen Rührei. Ihr Magen zog sich zusammen. Er hatte sogar ein Tischtuch aufgelegt. Das rot-weiß karierte. Von ihrem Picknick im Sommer.
»Du bist ja schon angezogen«, sagte er und schnitt Melonenschiffchen ab. »Ich hab dir ein T-Shirt aufs Bett gelegt. Hast du das nicht gesehen?«
»Doch, hab ich.«
»Und Schuhe hast du auch schon an?« Er musste ein bisschen herumfingern, bis er die Kaffeekapsel im vorgesehenen Fach hatte. Die Nespressomaschine saugte zischend Luft ein, und der Duft von Kaffee mischte sich unter die schräg durchs Fenster fallenden Sonnenstrahlen.
»Simon?«
»Ich hoffe, du hast Hunger. Ich hab Frühstück für eine ganze Armee gemacht.« Er schnitt die Schale von den Melonenschiffchen. Das Fruchtfleisch erinnerte an blasse, schleimige Schnecken.
»Simon, sei so gut und sieh mich an.«
»Ich hab gedacht, dass wir nach dem Frühstück …«
»Simon!«
Er legte das Messer auf das Schneidebrett. Die Flügel in seinen Augen waren bereits gebrochen, als er ihrem Blick begegnete. Er sah so gut aus mit seinem blonden Bart, den zerwuschelten Haaren, dem breiten Brustkorb aus seiner Zeit als Wettkampfschwimmer und seinen weißen Zähnen, die beim Lachen strahlten, dass es sie ganz schwindelig machte.
»Das war’s dann also?«, fragte er mit spröder Stimme. »Ich werde dich nicht wiedersehen?«
»Das muss nicht so sein.«
»Aber genauso ist es nun mal.«
»Simon …«
»Ich habe immer an uns geglaubt, Sidsel. Egal, wie oft ich deine Angst davor gesehen habe, mich einzusperren.«
Sie senkte den Blick.
Er schüttelte den Kopf. »Was war ich doch für ein Idiot. Ich hätte Angst haben sollen, dass ich dich einsperre.«
»Es tut mir so leid …«
»Das muss dir nicht leidtun. Verdammt, du warst gestern so kurz davor, es mir zu sagen.« Er hielt einen schmalen Streifen Luft zwischen Daumen und Zeigefinger. »Ich hab es in deinem Blick gesehen. Und ich bin als der glücklichste Mann auf der Welt eingeschlafen.«
Sidsel schüttelte sich. Der Duft der Würstchen und der Eier legte sich als dicker, zäher Film auf ihre Nasenschleimhäute.
»War das mit uns jemals echt?«, fragte er nach einer kurzen Pause. »Zu irgendeinem Zeitpunkt?«
Sie starrte auf die Bodenbretter. Simons gedämpfte, verletzliche Stimme klingelte in ihren Ohren. Er sollte sie schütteln, Teller zerschlagen, auf ihrem verrotteten Innern herumtrampeln. Aber da Simon einer der wenigen Männer war, dem eine Frau in ihrem Leben vielleicht ein- oder zweimal das Glück hatte zu begegnen, würde er sein Ego zurückstellen, um ihr das Gehen zu erleichtern.
Sie wusste das alles. Aus der Folge der vielen anderen Simons, die es in ihrem Leben gegeben hatte.
Und weil er der Stärkere von ihnen beiden war, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkte.
Sidsel lief zu ihrem Auto. Ein tropfender Wolkenteppich hatte die Sonne verschluckt. Der Gehweg war noch immer von dem Feuerwerk verdreckt, mehrmals rutschte sie fast auf den Knallerhülsen aus, die wie aufgelöste Klopapierrollen überall herumlagen.
Sie stieg kurzatmig ins Auto, in dem es eiskalt war. Ihre Hände zitterten. Die Schlüsselspitze klackerte gegen das Zündschloss, ohne den Schlitz zu treffen. Sie gab es auf und ließ ihren Gefühlen freien Lauf: den Tränen, der Trauer. Der Wut. Sie schlug mit den Händen auf das Lenkrad und schrie so laut, dass es das Wageninnere erfüllte: »Ich liebe dich, Simon! Ich liebe dich, liebe dich, liebe dich!«
Sie begegnete ihrem rot umrandeten Blick im Rückspiegel und schlug zu. Der Faustschlag riss den Rückspiegel aus der Halterung unter der Decke. Sie starrte auf das zersplitterte Spiegelglas, das noch an einem Kabel hing. Von ihrem Knöchel lief ein dünner Streifen Blut über den Handrücken. Ihre Hand zitterte nicht mehr. Sie bekam den Schlüssel ins Zündschloss und scherte auf den Blegdamsvej aus.
Es war Samstag, der 1. Januar. Sie hatte zwei Tage zum Weinen, bevor sie wieder zur Arbeit musste.
3
Lucas Stage rieb seine Hände unter dem lauwarmen Wasserstrahl. Die Seife schäumte auf, eine naturweiße Masse, die die Haut von Bakterien, Viren und DNA reinigte, während der aufgerissene Abflussschlund die infizierte Brühe schluckte. Ihn schluckte.
So trat er ihnen am liebsten gegenüber: sauber, im Reset-Modus.
Er begegnete seinem chlorblauen Blick im Spiegel. Das Haar platinblond und zum Anlass des Tages zurückgekämmt, was seine markante Kinnpartie und seinen breiten Mund nur noch stärker hervorhob. Seine Haut war das ganze Jahr über kreideweiß, da er sich meist in geschlossenen Räumen aufhielt und sich nur aus triftigem Grund der Sonne aussetzte. Die Frauen beklagten sich nicht über seinen weißen Körper, der mager, aber muskulös und von kleinen und mittelgroßen Tattoos übersät war. Eine seiner erinnerungswürdigeren Sexpartnerinnen hatte einmal gesagt, Sex mit ihm sei wie das Lutschen eines glatten Minzdrops.
Er sah im Spiegel, wie sich seine Mundwinkel bei dem Gedanken zu einem breiten Grinsen verzogen, der unbekümmert flapsigen Variante. Lucas zog die Augenbrauen einen Hauch nach oben, entspannte die Mundwinkel, und schon war da sein verständnisvolles Lächeln. Das Lächeln, das gleich Anwendung finden würde.
Wie ein Musiker ein feinfühliges Instrument, stimmte er die Saiten seiner Mimik so lange, bis er den passenden Ausdruck gefunden hatte, die emotionale Tangente, bei der die Leute sich seiner Agenda unterordneten.
Und Lucas Stage war ein Mann mit vielen Agenden.
Aber ihm fehlte die Fähigkeit, die Gefühle, die er aussandte, selbst zu empfinden. Der Arzt, bei dem er während seiner Kindheit in Behandlung gewesen war, hatte ihm die äußerst bildhafte Diagnose gestellt, dass er mehr Reptil als Säugetier war. Weil das limbische System seines Gehirns stark geschädigt und auf ein prozentual niedriges Niveau seiner Funktionsfähigkeit heruntergesetzt war. Unglücklicherweise war das limbische System sozusagen der Kontrollraum des Gehirns für Gefühle und instinktives Handeln. Wenn man das normale Gefühlsleben als welligen Bleistiftstrich darstellte, war Lucas’ mit dem Lineal gezogen.
Er wusste nicht, wie er die Diagnose werten sollte.
Aber zumindest kannte er die Ursache dafür: In einer Haschpsychose hatte seine Junkiemutter LSD in seine Milchflasche gegeben und ihren zwei Monate alten Sohn zwischen den Müllsäcken in einer Seitengasse der Skodsborggade abgelegt, in der Hoffnung, dass die Ratten oder die Drogen die verpasste Abtreibung nachholten, die sie dank ihres Mutterinstinkts oder was auch immer nicht durchgezogen hatte. Lucas hatte den Mann, der ihn zwischen dem Abfall gefunden hatte, nie kennengelernt, weil er damals seinen Namen in der Notaufnahme nicht angegeben hatte. Verständlich. Wer wollte schon ein Baby, das aus der stinkenden Fotze eines Müllschachts gezogen worden war.
Aber ansonsten war sein Leben, so empfand Lucas es selbst, absolut befriedigend. Im Laufe seiner Polizeikarriere hatte er gelernt, dass die meisten Verbrechen in emotional aufgeladenen Momenten begangen wurden. In der blutroten Sekunde, wenn die verzweifelten Kreaturen dem diabolischen Flüstern in ihren Köpfen nachgaben und ihre untreuen Partner töteten, vor einen Zug sprangen oder sich eine fatale Dosis Dreck in den Kreislauf schossen.
Und auf der Schattenseite, in seinem kriminellen Dasein, war sein kühler Kopf wie ein Leuchtturm, der ihn sicher durch eine Welt gewalttätiger, unberechenbarer Individuen navigierte, die längst ihre Seele an den Teufel verschachert hatten.
Aus diesem Grund spekulierte Lucas nie über seinen brutalen Start ins Leben. Er hatte ihn akzeptiert und sich in sein Dasein als evolutionshistorischer Geisterfahrer gefügt. Außerdem war das Reptil für seine extrem hohe Schmerzschwelle bekannt, und war das letzten Endes nicht die ultimative Voraussetzung fürs Überleben? Die Fähigkeit, der Wille, Schmerz auszuhalten. Der Gedanke weitete seinen Brustkorb. Einer der emotionalen Kicks, die sein Gehirn ihm hin und wieder gönnte.
Lucas zog sein Seidenhemd zurecht, das strahlte wie das Feuerwerk am Neujahrshimmel, und verließ die Herrentoilette.
»Ich versteh das nicht. Ich habe das einzig Richtige getan! Der verfluchte Satan hat sich an meinen Kindern vergriffen.«
»Ihre Ex-Frau kann nicht bestätigen, dass es …« Lucas nahm ein Blatt mit einem Zeitplan über die Verfügbarkeit des Verhörraums vom Tisch, »… Fummeleien und autoerotischen Kontakt mit ihren Kindern gegeben hat.«
»Ich weiß ja nicht mal, was das heißt.« Der Mann vergrub das Gesicht in seinen Händen. Schwarze Narben zogen sich über seine Knöchel, die Nägel waren gelb und rissig. Der Preis seiner jahrelangen Schnorcheltour durch Kopenhagens Drogenmilieu. »Meine Ex-Frau fixt nonstop, Mann. Die rafft nichts. Das Sofa, auf dem sie nach einem Schuss liegt, könnte genauso gut auf dem Mond stehen.«
Lucas legte drei Fotos auf den Tisch.
»Sie haben den neuen Lover Ihrer Frau mit einem Spalthammer erschlagen.«
Der Mann glotzte die Fotos an. »Das war Notwehr.«
»Dreißig Schläge? Der Rechtsmediziner hat irgendwann aufgegeben, die Schädelstruktur des Typen zu rekonstruieren.«
»Ich bin der Vater der Kinder. Das Schwein hat sie missbraucht!«
»Sie können Ihren Kindern kein Vater sein, wenn Sie lebenslänglich im Gefängnis sitzen.« Lucas setzte sein verständnisvolles Lächeln auf. »Aber ich verstehe Sie. Wenn sie Sie verlässt, ist sie für Sie … präsenter denn je. Ist es nicht so?«
Der Mann schluckte.
»Die einsamen Nächte, die Zimmerdecke über dem leeren Bett, die plötzlich zu einer Kinoleinwand wird. Die Bilder bohren sich in Ihren Kopf. Ihre Ex, ihr neuer Lover, nackt, eng umschlungen. Rammeln wie die Tiere. Das vertraute Gespräch hinterher, vielleicht reden sie über Sie. Sie lachen über Sie, der Neue macht sich über Ihre Fehler lustig, während Ihre Ex sich an ihn schmiegt wie eine läufige Hündin.«
Der Mann kniff die Augenlider zusammen.
»Ich kenne das«, sagte Lucas. »Frauen können einen Mann um den Verstand bringen, ihn für eine blutrote Sekunde Vergangenheit und Zukunft vergessen lassen.«
»Ich … ich …«
»Und für diese eine Sekunde sollen Sie nun für den Rest Ihres Lebens büßen. Das ist nicht gerecht, stimmt’s? Das waren schließlich Ihre Kinder, die von ihrem Neuen terrorisiert worden sind.«
»Sie … Sie glauben mir? Dass er meinen Kindern was angetan hat?«
»Ich glaube, dass wir manchmal edle Motive erfinden, um unsere grausamen Taten zu rechtfertigen.« Lucas drehte einen seiner Siegelringe an der Fingerwurzel. »Aber an diesem Tisch bin ich Polizist. Es geht mir nicht um das ›Warum‹. Es geht mir um die Tat.«
Der Mann schluchzte, biss sich auf die Lippe, Speichelfäden liefen über sein Kinn.
Lucas zog die Augenbrauen hoch, senkte die Stirn: sein Ich-sehe-dich-Ausdruck.
»Wenn Sie eine fahrlässige Tötung gestehen, bleibt Ihnen eine lebenslange Haftstrafe erspart, und Ihre Ex-Frau trägt nicht den Sieg davon. Und Ihre Kinder bekommen Zeit mit ihrem Vater.«
»Ich weiß nicht …«
»Gestehen Sie. Erleichtern Sie Ihr Gewissen.«
Lucas schob eine Hand über den Tisch und umfasste sein Handgelenk. Der Mann zuckte bei der Berührung zusammen, aber Lucas nahm die Hand nicht weg. Er stellte sich vor, wie die Reinheit seiner Haut in ihn strömte, ihn von seinen Sünden reinwusch.
»Der Schmerz ist ausdauernd«, sagte Lucas mit leiser Stimme. »Aber das ist Ihr Körper nicht. Lassen Sie ihn los, ehe er Sie bei lebendigem Leib auffrisst.«
Wie von einem Säbelhieb quer über den Bauch brach der Mann zusammen.
»Okay! Ich gestehe! Ich habe das Schwein umgebracht, habe ihm ins Gesicht geschlagen, bis …«
»Was ist passiert?«, fragte Henrik verdutzt und blieb stehen.
Lucas schloss die Tür zum Vernehmungsraum hinter sich und ging seinem Kollegen entgegen.
»Wir haben ein Geständnis.«
Henrik kniff die Augen zusammen, als ob der Dampf von den zwei Pappbechern in seiner Hand ihm in den Augen brannte.
»Hast du ihn ohne mich verhört?«
»Schreibst du das Protokoll?«
Lucas schnappte sich einen der Becher und gab ihm dafür den USB-Stick mit der Tonaufnahme.
»Was zum Teufel …«
»Ich habe uns soeben ein Geständnis besorgt, während du dreißig Minuten zum Kaffeeholen gebraucht hast. Hat die süße Kleine aus der Kantine dich aufgehalten?«
»Du kannst einen Verdächtigen nicht einfach allein verhören.«
Lucas seufzte. »Er heißt ab jetzt ›der Angeklagte‹. Er hat gestanden. Komm lieber in die Hufe und tipp das ab. Ich brauche den Bericht vor Feierabend im System.«
»Hallo!«, fuhr Henrik ihn mit feurigem Blick an. »Hat deine fucking Arroganz irgendeine Höchstgrenze?«
»Arroganz? Ich kenne einfach meine Rolle. Was bei dir ja offensichtlich nicht der Fall ist.«
»Ich hab auch was dazu beigetragen. Das Geständnis ist unser beider Verdienst.«
»Quatsch. Ohne mich kein Geständnis.«
Henrik machte einen Schritt nach vorn. »Wie wäre es, wenn du …«
Lucas schnappte sich einen Kugelschreiber aus der Brusttasche des Kollegen und schrieb ein paar Zahlen auf den Pappbecher.
»Was zum Teufel machst du da?«
»Wenn du so verzweifelt an ihre Nummer kommen willst, frag doch einfach mich.«
4
Die tief stehende Wintersonne glühte in den Fenstern des kreisrunden, von achtundachtzig französischen Kalksteinsäulen umrahmten Innenhofes von der Größe eines halben Fußballfelds. Nach außen hin präsentierte sich das massive, bunkerhafte Gebäude, das Kopenhagens Polizeipräsidium beherbergte, mit einer groben Mörtel- und Formsandfassade, während es innen hallende Kammern mit korinthischen Säulen, Bronzeskulpturen und grau gesprenkeltem Savonnière-Stein gab. Diese Pracht hatte im Zweiten Weltkrieg die nationalsozialistische Besatzungsmacht dazu verführt, ihr Hauptquartier im Polizeipräsidium einzurichten und dafür zweitausend dänische Polizisten in Konzentrationslager zu deportieren.
Lucas verschwendete weder einen Gedanken an die Nazis noch an die Architektur, als er den runden Innenhof durchquerte. Das Echo seiner Absätze klackerte zwischen den Säulen wie der klagende Geist der Klapperschlange, die ihr Leben für seine sauteuren Schuhe hatte lassen müssen. Er suchte Schutz im Ehrenhof, zündete sich eine Zigarette an und blies den Rauch in Richtung der Bronzestatue von dem Schlangentöter. Gerüchten zufolge hatten sie dem nackten Jungen ein Hakenkreuz in den Sack geritzt.
»Was geht dir durch den Kopf?«, fragte Jonas Riel.
Lucas blies den Rauch seinem Chef ins Gesicht, der aus einem toten Winkel gekommen war.
»Ob ich mir ein neues Tattoo stechen lasse.«
Riel verzog das Gesicht.
»Hast du noch Platz für mehr Frauennamen?«
»Ich nehme ja nur ihre Initialen.« Lucas hielt Jonas das Päckchen hin.
Riel fischte sich eine Zigarette heraus und legte die Hände schützend um die Flamme des Feuerzeugs in Lucas’ freier Hand.
»Henrik war heute bei mir«, sagte Riel. »Er meinte, du hättest den Verdächtigen alleine verhört.«
»Henrik sollte jetzt eigentlich gerade das Geständnis abtippen.«
»Das grenzt an Ungehorsam.«
»Dann schlage ich doch mal vor, dass du mit ihm redest.«
Riel musterte Lucas mit dem stumpfen, unbewegten Blick des ehemaligen Elitesoldaten, der in seinem Leben schon häufig Entscheidungen mit harten Konsequenzen für sich selbst und andere hatte fällen müssen. Und er hatte seinen tatkräftigen Militärinstinkt nicht mit dem Barett an den Nagel gehängt. Als im letzten Jahr ein Streifenwagen in Lyngby-Taarbæk ein Reh überfahren hatte, hatte er das Tier in der Herrendusche zerlegt und den Kollegen aus der Abteilung ein paar leckere Stücke mit nach Hause gegeben. Lucas schätzte seinen Chef und seinen Führungsstil durchaus, aber nicht in dem Maße, wie Riel es sich vermutlich einbildete.
»Die Task Force 14 hat eine neue Fallakte geschickt«, sagte Riel.
»Ich habe meine Überstunden von Smøl Vold noch nicht mal abgefeiert.«
»Der Polizeipräsident hat den Fall als rot eingestuft.«
»Ich habe heute Abend meinen Literaturklub.«
»Die Wahl ist auf dich gefallen, Lucas.«
»Warum?«
Riel verschränkte die Arme gegen die Kälte vor der Brust.
»Sieh es dir wenigstens an.«
Aus dem Augenwinkel registrierte Lucas zwei Dinge: Erstens, dass sein Chef in seiner North-Face-Jacke eigentlich nicht frieren dürfte. Zweitens, dass er seinen Chef noch nie hatte rauchen sehen.
»Welcher Polizeibezirk?«
Riel tippte die Asche ab, ehe er antwortete. »13.«
»Ich habe mich hoffentlich verhört.«
»Nein, hast du nicht. Und bevor du was sagst …«
»Nein.«
Riel drehte sich zu Lucas um.
»Es soll sehr schön sein auf den Färöern. Und du findest dort garantiert jede Menge Inspiration für neue Tätowierungen.«
Lucas blies den Rauch zwischen den zusammengepressten Zähnen aus.
»Sorry, Chef. Ich weiß, wie sehr es dir das Herz wärmt, der Tyrann in meinem Leben zu sein. Aber das hier geht zu weit. Ich bin in Süderjütland fast an Langeweile gestorben, und jetzt willst du mich nach Tórshavn schicken, diesem Dreckskaff mit höchstens zehntausend Einwohnern oder weniger?«
»Nein.«
»Nein?«
»Du sollst in einen kleinen Ort namens Gøta. Knapp hundert Einwohner.«
Lucas schnipste die Zigarettenkippe in einer Rauchspirale durch die Luft.
»Hast du schon mal Erfolg damit gehabt, jemanden von einer Mission zu überzeugen, indem du ihm vorher alle Nachteile aufzählst?«
Riel richtete seinen Blick auf die vier Meter hohe Statue.
»Wusstest du, dass der Schlangentöter den Kampf des Guten gegen das Böse symbolisiert?«
Lucas musterte das abgewandte Gesicht seines Chefs im Profil: die dunklen Augen, die faltige Haut mit der ledrigen Mattheit von den schlaflosen Sondereinsätzen. Ein Gesicht, das so ziemlich alles gesehen und ausgetestet hatte. Und das heute eine stumme Trauer verströmte.
»Was genau ist da auf den Färöern passiert?«, fragte Lucas.
Riel rieb seine Handflächen aneinander, die nicht warm werden wollten.
»Das Böse.«
5
Sidsel fuhr mit dem Wagen durch das elektrische Tor des kriminaltechnischen Instituts in Glostrup. Das Polizeiquartier Vestegnen beherbergte eins der zwei kriminaltechnischen Institute des Landes, und obgleich Sidsel seit der Einweihung 2018 als Forensikerin für die Abteilung arbeitete, war sie jedes Mal wieder verblüfft, dass der gelbe Backsteinkasten neben hypermodernsten Laboren, einem Ballistikraum, einer Brandwerkstatt und einem »Blutraum« auch die absolut mieseste Kantine des Landes hatte.
Sie fuhr auf ihren Parkplatz und schaltete den Motor aus. Warf einen Blick in den mit Gaffa-Tape festgeklebten Rückspiegel. Ihre roten Augen würde sie mit einer Januarerkältung entschuldigen können. Es war ihr schleierhaft, wie ein Mensch so viel heulen konnte wie sie an diesem Wochenende. Die vielen havarierten Beziehungen begannen an ihr zu zehren. An Körper und Seele. Sie hätte es sich ausrechnen können, dass das Versprechen, das sie sich als Vierzehnjährige gegeben hatte, einer Vierzigjährigen an die Substanz ging.
Sidsel überquerte den Parkplatz und betrat die Eingangshalle, nickte dem Security-Mann hinter der Panzerglasscheibe zu und nahm die Treppe hoch in den zweiten Stock. Ihre Turnschuhe quietschten auf dem Bodenbelag des fensterlosen Korridors mit den schwarzen Kameraaugen unter der Decke, und wie immer beschlich sie das Gefühl, sich in einem Geheimarchiv tief unter der Erde zu befinden.
Sidsel zog die Tür zu ihrem Büro hinter sich zu. Sie hatte sich vorgenommen, den Tag mit der Lektüre einiger wissenschaftlicher Artikel über Blutspurenmusteranalysen zu verbringen, die sie schon viel zu lange vor sich hergeschoben hatte. Und außerdem konnte sie die Tätigkeit hinter verschlossener Tür erledigen.
Die Blutspurenmusteranalyse war eine kontroversielle kriminaltechnische Disziplin. Da gab es diejenigen, die der Meinung waren, dass Blutpuren an einem Tatort subjektive Interpretationssache waren und in keinem Fall so definitiv wie DNA oder Fingerabdrücke. So weit stimmte Sidsel dem zu. Aber ansonsten war Blut ein faszinierendes Fluidum, das nahezu eine Persönlichkeit hatte, die eine Geschichte erzählte. Blut war dynamisch und hochsensibel, voller lebender Zellen und aktiver Enzyme, die selbst bei mikroskopischen Abweichungen der Rahmenbedingungen ihren Charakter änderten. Temperaturausschläge, Alkoholkonsum, Krankheit oder Drogensucht. Das Blut offenbarte jedes noch so kleine Geheimnis.
Wir waren unser Blut.
Eine Stunde später hatte Sidsel es immer noch nicht bis durch den ersten Abschnitt des Artikels geschafft. Sie war so in ihr eigenes bedrückendes Gedankenchaos vertieft, dass sie einen regelrechten Schock bekam, als ihre Abteilungsleiterin Lærke sich vor ihrem Schreibtisch räusperte.
»Was machst du hier?«, murmelte Sidsel verwirrt.
»Ich habe geklopft.«
»Aha.«
»Dreimal. Warum versteckst du dich in deinem Büro?«
»Ich muss was lesen.«
Lærke streckte den Hals und las die Überschrift.
»Blutspurenmusteranalyse. Na, so ein Zufall!«
Sidsel zog die Augenbrauen hoch. Falls das ironisch gemeint war, verstand sie die Anspielung nicht.
»Alle sind aus den Weihnachtsferien zurück. Du warst nicht beim gemeinsamen Frühstück heute Morgen.«
»Sorry, ich fühl mich nicht ganz frisch.«
»Du siehst tatsächlich ziemlich blass um die Nase aus. Bist du schwanger?«
»Was?« Sidsels plötzlicher Ausbruch erschreckte sie nicht weniger als ihre Chefin.
Lærke spitzte die lippenstiftroten Lippen.
»Wir haben einen Fall reinbekommen. Was Großes.«
»Ah ja?«, sagte Sidsel und versuchte, wenigstens Interesse zu heucheln.
»Auf den Färöern ist ein vierfacher, wenn nicht gar fünffacher Mord passiert. Wir wissen noch nicht, ob … Alles in Ordnung mit dir?«
Die Spucke in Sidsels Mund wurde zu Asche. Sie nahm einen glucksenden Schluck aus ihrer Wasserflasche.
»Auf den Färöern?«
»Ja. Und wie du dir denken kannst, haben die Polizeieinheiten dort nicht die Ressourcen für ein Verbrechen auf diesem Niveau. Die meisten Polizeibeamten arbeiten im Nebenjob als Touristenführer oder Kassiererin.«
Sidsels versteinertes Gesicht ließ Lærke das Lachen im Hals stecken bleiben.
»Du wirst dir ja sicher denken können, wieso ich ausgerechnet zu dir gekommen bin, Sidsel. Oder soll ich lieber Eivør sagen.«
6
Sidsels Herz begann zu hämmern, ihr Zwerchfell verkrampfte. Mit einem Wort hatte ihre Chefin eine Schleuse in den Weltraum geöffnet, dessen pechschwarzes Vakuum alle Luft aus dem Büro saugte.
Eivør.
Sidsel hatte ihren färöischen Namen das letzte Mal vor der Jahrtausendwende gehört. Und jetzt kam Lærke hereingerauscht wie eine mächtige Geisterbeschwörerin und erweckte den Namen zum Leben, den Fluch, und dann noch mit einer irritierend korrekten Aussprache: Ai-vør.
Sidsel holte rasselnd Luft.
»Woher kennst du den Namen?«
»Der färöische Polizist hat ihn benutzt.«
»Was? Welcher Polizist?«
»Jalle, Jari …«
»Hjalti.«
»Genau, Hjalti.« Lærke schnipste mit den Fingern. »Komischer Name! Er war der erste Anrufer, als ich heute Morgen ins Büro gekommen bin. Warum hast du nie erzählt, dass du einen Zwillingsbruder hast?«
Sidsel schob den Stuhl zurück.
»Ich gehe nicht auf die Färöer.«
»Hör zu, Sidsel, du bist die erste Wahl. Du sprichst die Sprache und kennst die Gepflogenheiten dort. Und die Polizeieinheit hat dezidiert nach dir gefragt. Auf Empfehlung deines Bruders.«
»Die sprechen astreines Dänisch auf den Färöern.«
Lærke überhörte ihren Einwand.
»Die Task Force 14 mischt ebenfalls mit. Sie schicken einen Experten. Das wird bestimmt irre spannend!«
»Es muss doch noch andere geben. Was ist mit Jonas?«
»Seine Frau hat demnächst ihren Termin.«
»Simone?«
»Ausgeschlossen. Ihre Tochter ist erst ein Jahr alt.«
Sidsel spürte eine angespannte Panik in ihrer Stimme.
»Kann sie ihr Kind nicht einfach mitnehmen?«
Lærkes Lächeln erstarrte.
»Ich biete dir da einen riesigen Fall an. Dein Bruder hat übrigens erwähnt, dass dein Vater auf den Färöern lebt. Nutz die Zeit, deine Familie zu treffen.«
»Ich bin hier in Dänemark zu Hause.«
Die beiden Frauen sahen sich stumm an.
»Also …« Lærke dämpfte die Stimme auf ein Niveau überzeugender Vertraulichkeit. »Hjalti hat schon vermutet, dass du ablehnen würdest. Darum hat er mich gebeten, dir zwei Dinge mitzuteilen.«
»Okay?«
»Dein Bruder sagt, dass dein Vater krank ist und nicht mehr viel Zeit hat.«
»Und das Zweite?«
»Das wirst du mir erklären müssen.«
»Was heißt das?«
»Ich soll dir sagen, dass eins der Opfer der Pastor aus dem Ort ist. Er heißt … oh Mann, diese Namen! Er fängt mit …«
»Jákup.«
»Exakt. Kennst du ihn?«
»Ich kenne niemanden auf den Färöern.«
Lærke lächelte mit zusammengekniffenen Augen.
»Deswegen brauchen wir dich aber trotzdem.«
»Ist das ein Befehl?«
»Der Task-Force-14-Agent startet heute Abend von Kastrup aus. Um achtzehn Uhr. Pack eine lange Unterhose ein.«
Sidsels Magen krampfte.
»Was ist mit meiner Ausrüstung?«
»Die Technik ist schon dabei, deine Sachen zu verpacken.«
»Aber ich stemm die ganze Technik nicht allein.«
»Die Obduktionen werden mit unserem Institut abgestimmt. Du kriegst so schnell wie möglich einen Rechtsmediziner an die Seite gestellt. Bis dahin dürftest du dir einen Überblick über die kriminaltechnischen Details am Tatort verschafft haben. Die Polizei vor Ort hat einunddreißig Beamte zusammengetrommelt. Ein Fünftel der färöischen Polizeistärke.«
»Du hast eben gesagt, die Beamten hätten Nebenjobs als Kassiererinnen und Touristenführer. Die will ich nicht in der Nähe meines Tatorts haben.«
»Das klingt schon viel besser, Sidsel!«
»Oh nein, stopp, ich meine …«
»Du wirst da oben die absolute Arbeitsruhe haben. Keine Ablenkung.«
Die Tränen bliesen sich zu einem Ballon hinter Sidsels Augen auf. Sie fühlte sich nicht in der Lage, die praktischen oder persönlichen Aspekte der Situation abzuschätzen.
»Du hast gesagt, die Morde hätten ›stattgefunden‹, nicht, dass sie begangen wurden. Was genau meinst du damit? Was hab ich mir unter einem stattgefundenen Mord vorzustellen?«
Lærke holte tief Luft.
»Das Beste wird sein, wenn ich es dir zeige.«
7
Blut.
Glänzende Blutlachen.
Die Wände der Sakristei waren von roten Lackmustern überzogen, als wäre in der Mitte des Raums ein blutgefüllter Ballon explodiert. Über die Bodenbretter war ein tiefroter zäher Brei verteilt wie nach einer Elefantengeburt, und überall lagen umgekippte Stühle, Glasscherben und verstreute Papierstapel.
Während Lucas’ Blick die makabren Details der Fotografien aufnahm, tauchten aus der Masse Silhouetten auf. Vier menschliche Körper. In Talare gekleidet. Sie lagen wie Schlenkerpuppen hineingeworfen in den explosiven Blutrausch, der selbst als unbewegtes Foto eine spürbare Aura von Geschrei und Tumult ausstrahlte. Die weißen Beffchen sahen aus wie Sabberlätzchen nach dem Zahnziehen. Vor Eintreten des Todes waren sie offensichtlich blutspuckend durch den Raum getaumelt, während das Blut aus den Stichwunden in ihren Talaren, Handflächen und Gesichtern geleckt hatte.
Lucas riss den Blick vom Bildschirm los.
Jonas Riel stand mit verschränkten Armen auf der Anschiss-Seite seines eigenen Schreibtisches.
»Die brauchen dich da wirklich.«
Lucas studierte das verkniffene Gesicht seines Vorgesetzten.
»Die Pfarrer haben Waffen in den Händen.«
Riel nickte, unkonzentriert, als schössen ihm tausend Gedanken gleichzeitig durchs Hirn.
»Laut Aussage der färöischen Polizei sind das Waffen für die Grindwaljagd.«
Lucas hatte von der färöischen Tradition des Grindwalfangs gelesen. Er stellte sich die Wale als schwarze Berge an einem blutroten Strand vor, von Fischkuttern zu ihrer Abschlachtung mit Haken, Speeren und Messern ins flache Wasser getrieben. Eine gewisse Ähnlichkeit mit den schwarzen, blutverschmierten Talaren der Pfarrer war nicht zu leugnen.
»Tieraktivisten?«, fragte er.
»Es ist noch zu früh, um Näheres zur Symbolik und zu den Motiven zu sagen.«
»Noch gar keine Theorien?«
»Der färöische Polizeidirektor hat eine vorsichtige Vermutung geäußert.«
»Die da wäre?«
»Dass die Pfarrer sich gegenseitig in einer Art religiösem Blutrausch umgebracht haben.«
Lucas sah, dass der Chef nach einer emotionalen Reaktion in seinem Gesicht suchte, etwas, das seinen eigenen Schockzustand widerspiegelte. Er fand nichts.
»Mord ist eine christliche Sünde«, sagte Lucas belehrend. »Genau wie Selbstmord. Das ergibt keinen Sinn, dass vier Pfarrer sich gegenseitig umbringen oder rituell Selbstmord begehen.«
Riels Augen flackerten. »Fünf.«
»Was?«
»Es waren fünf Pfarrer in der Kirche, als es … passiert ist. Aber der fünfte Pfarrer ist verschwunden.«
»Woher wissen sie dann, dass es fünf waren?«
»Der fünfte ist der Pfarrer der Ortsgemeinde. Er hatte seine vier Kollegen an diesem Wochenende zu einer Art Konzil eingeladen.«
Lucas schüttelte den Kopf.
»Bei einem Konzil werden auf höherer kirchlicher Ebene kirchenrechtliche Beschlüsse getroffen. Das hier war vermutlich eher eine Synode. Ein kleineres Treffen mit lokalen Themen auf der Tagesordnung.«
»Macht das einen Unterschied?«
»Synoden sind in der Regel … kontrollierender. Die Pfarrer erheben sich sozusagen zur Sittenpolizei in Gemeindeangelegenheiten. Ein selbstgerechter Euphemismus, der im Grunde nur die kirchlichen Machtstrukturen festzurrt.«
»Woher weißt du solche Sachen?«
»Ich bin mal Gott begegnet.« Lucas massierte die leichte Spannung in seiner Brust.
Riel kratzte sich im Nacken.
»Kann ich das als Ja deuten?«
»Es kann ja wohl nicht so schwer sein, in einer kleinen Inselgemeinde einen Mörder dingfest zu machen, wo jeder jeden kennt.«
»Das hier ist kein Agatha-Christie-Krimi. Das hier ist … Mir fällt kein passender Ausdruck ein, es zu beschreiben.«
»Was ist mit den Überstunden?«
»Du wirst deine verflixten Überstunden von Smøl Vold schon noch abgefeiert kriegen.«
»Und du schickst nur mich?«
»Und jemanden vom kriminaltechnischen Institut. Und so schnell wie möglich einen Rechtsmediziner.«
»Mager.«
»Wenn ich das große Paket auf die Färöer schicke, wird es keine Minute dauern, bis die Pressegeier in den Ort einfallen. Das würde eure Arbeitsbedingungen durch die ganzen zeitfressenden Rücksichten nur unnötig verkomplizieren. Pressemitteilungen, Absperrungen, Schikane …« Der Chef wedelte mit der Hand. »Wir halten das Ganze besser im überschaubaren Rahmen.«
Lucas nickte. Riels Strategie war riskant, entbehrte aber nicht einer gewissen Logik. Das Massengrab in Smøl Vold war bereits wenige Stunden nach seiner Entdeckung von den Medien überrannt worden. Süderjütlands Stadtgericht hatte noch immer eine Reihe Fälle von Zusammenstößen zwischen aufdringlichen Journalisten und keinen Spaß verstehenden Süderjütländern auf dem Verhandlungstisch.
»Ich weiß nicht recht«, murmelte Lucas.
»Keine weiteren Ausflüchte, jetzt!«, bellte Riel. »Ja oder nein?«
»Kommt drauf an …«
»Auf was?«
Lucas beugte sich vor. Das Lächeln auf seinen Lippen wirkte fast echt.
Mir ist noch nie ein Mensch mit einer durch und durch guten Seele begegnet. Die Seele wirft immer zwei Schatten. Hinter jeder guten Tat lauern Bedingungen, Gier, Verlangen. In gewisser Weise müsste ich meiner Mutter dankbar sein, dass sie mir meine Seele gestohlen hat. Mein nicht vorhandenes Bedürfnis dazuzugehören oder einem anderen Menschen etwas zu bedeuten, fühlt sich an wie ein lebenslanger Freifahrtschein. Zumindest, wenn ich meine naiven Mitmenschen betrachte, wie sie sich von dem Fließband des Lebens die Klischees zusammensammeln und daraus ihre ganz und gar einzigartige Identität konstruieren, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass sie doch auch bloß die Summe der gleichen begrenzten Auswahl sind, über die die anderen in der Schlange sich so idiotischerweise die Hände reiben. Sie sehen es schlicht und ergreifend nicht. Den gravierenden Unterschied zwischen dem, was sie sind, und der Idee von dem, was sie zu sein glauben. Ist das die Essenz der Seele? Verleugnung? Eine scheinheilige Schwerkraft, die all die schönen, verbotenen Impulse mit sich in die Tiefe zieht, weil der Mensch nichts mehr fürchtet als die Verurteilung durch die Gemeinschaft. Abzuweichen.
Darauf kann ich gut verzichten. Und lebe lieber frei.
Darum halte ich ihren Kopf fest, bis die Lunge sich mit Wasser gefüllt hat, bis die Spasmen, die über die Wirbelsäule rollen wie ein panischer Trommelwirbel, verebben, bis die Muskulatur erschlafft und sich am Ende nur noch ihr Haar im seichten Wasser bewegt wie dicke, rote Spinnweben.
Immer wieder der gleiche Traum. Seit meiner Geburt.
Ich fliege.
Meine Füße berühren die Erde nicht. Ich fliege. Jede Nacht.
Ich bin verkehrt. Das hat mir niemand erzählt. Ich weiß es einfach.
Nicht äußerlich. Äußerlich sehe ich aus wie ein normaler Junge. Das sehe ich, wenn ich die anderen Kinder ansehe. Wie ich haben sie dünne, knochige Beine, fressen wie die Ferkel und reden laut, egal, ob jemand zuhört oder nicht.
Es ist in mir drin. Das Verkehrte.
Ich habe noch nie geweint. Ich kriege einfach nicht raus, wie die anderen Kinder das machen. Wie man Augenbrauen, Nase und Mund verziehen muss, dass man losheulen kann, bis einem der Speichel wie Geigensaiten zwischen den Lippen zittert. Ich weiß, wie Tränen schmecken, aber nicht, wie sie sich anfühlen.
Lachen habe ich gelernt. Das ist einfacher. Wenn Ali furzt und die anderen Kinder lachen, kneife ich schnell die Augen zusammen und fletsche meine Zähne. Aber das kostet Kraft. Ich fühle mich permanent wie ein aufgescheuchtes Tier, spitze die Ohren und lasse die anderen Kinder nicht aus den Augen. Auf dem Spielplatz. In der Kantine. Die anderen Kinder leben. Ich lerne.
Wie jetzt, als Ali sein Knie auf Jerzys Hals drückt, dessen Lippen schon ganz blau angelaufen sind. Wir sind alleine im Waschraum. Die anderen Kinder schlafen. Ich musste eigentlich nur pinkeln und hab sie hier getroffen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Also glotze ich.
Jerzys Fersen schlagen auf den Boden, sein Mund pfeift wie ein Walkie-Talkie. Hätte er Ali besser nicht »Kanakenschwuchtel« genannt. Alle wissen, dass Ali aus einem dieser bombardierten, von Soldaten besetzten Wüstenländer kommt. Ich hab einen der Pädagogen sagen hören, dass seine ganze Familie von Bomben getötet wurde. Darum ist er nach Polen gekommen. Eine einzige Cousine hat überlebt. Die aber wohl nur noch ein Bein hat. Bestimmt ist das der Grund. Dass Alis Augen pechschwarz werden, wenn er sauer wird. Dann tritt er um sich und beißt und schreit unverständliche Worte, weil er kein Polnisch kann. Einer der Pädagogen hat kleine dunkelrote Punkte auf dem Handrücken von Alis Zähnen.
Jerzys Körper gibt auf. Seine Ferse liegt reglos auf dem Boden, und seine Hände, die sich an Alis Schlafanzughose mit den verwaschenen Delfinen geklammert haben, lassen los. Seine Arme fallen zur Seite, es klatscht, als seine Knöchel auf den Boden schlagen.
Ali ist mit einem Satz auf den Beinen. Jerzy liegt ganz still da. Jetzt pfeift Ali wie ein Walkie-Talkie. Er stürmt aus dem Waschraum und lässt mich alleine zurück. Die Dunkelheit legt sich wie ein nasser Schal um meine Schultern. Das EXIT-Schild über der Tür wirft schwefelgrünes Licht auf den am Boden liegenden Jerzy.
Am nächsten Tag bestellt Józef mich zum Gespräch in sein Büro. Er ist der Heimvorsteher. Als ich den Raum betrete, erhebt sich ein mir unbekannter, solariumgebräunter Mann mit Lederjacke, schwarzem Spitzbart und strengem Blick von seinem Stuhl.
»Hallo, Peter, mein Name ist Andrzej«, sagt er. »Ich bin Ermittler bei der Polizei. Wie geht’s dir, Kumpel?«
Ich schüttele seine trockene Hand, ohne zu antworten.
»Du musst keine Angst haben, Peter«, sagt eine Frau, die ich auch noch nie gesehen habe. Sie hat eine kleine Nickelbrille auf der Nase, auf den Knien ihrer braunen Stoffhose liegt ein Notizblock. »Ich heiße Alina und bin Krisenpsychologin. Magst du ein Glas Wasser?«
»Nein, danke«, stammele ich.
Der Polizist legt ein Aufnahmegerät auf den Tisch.
»Wir wollen uns nur ein Bild machen, was heute Nacht passiert ist. Und wir hoffen, dass du uns weiterhelfen kannst.«
»Ich?«
Der Polizist drückt die Aufnahmetaste.
»Hast du bemerkt, ob der Erwachsene, der im Schlafsaal bei euch gesessen hat, heute Nacht irgendwann eingeschlafen ist?«
Ich sitze steif auf meinem Stuhl. Mein Blick flackert zwischen ihren Gesichtern hin und her. Das Kassettenband dreht sich mit einem Geräusch wie ein Luftballon, aus dem Luft entweicht.
»Peter, es ist wichtig, dass du uns ehrlich antwortest«, sagt Józef.
»Die Erwachsenen schlafen dauernd ein«, sage ich heiser.
»Dann weißt du also, dass das vorkommt«, sagt Andrzej. »Hast du heute Nacht besonders auf den Erwachsenen geachtet?«
Ich starre ihn an.
Die Frau zieht ihren Stuhl so vor mich, dass ihre Knie fast meine berühren. Ihr Atem duftet nach Tee, mit Beerenaroma.
»Wir wissen, dass das nicht einfach ist. So ein Schock fährt einem schon mal bis tief in den Bauch.«
Ich nicke. Mein Magen knurrt, aber eigentlich, weil ich noch nichts gefrühstückt habe.
»Peter?« Jetzt redet der Polizist wieder. »Wir haben gehört, dass du und Jerzy euch gestern geprügelt habt. Worüber habt ihr euch gestritten?«
»Nichts Besonderes. Er hat Ali einen Schimpfnamen hinterhergerufen, und …«
»Ali?«, platzt Józef heraus.
»Lassen Sie Peter ausreden«, sagt der Polizist mit einem strengen Blick zu Józef. »Dann hast du dich mit Jerzy geprügelt, weil dir Ali leidgetan hat?«
Ich nicke. »Die anderen Kinder haben ihn ausgelacht.«
»Okay, gut«, sagt der Polizist. »Und habt ihr euren Kampf dann heute Nacht im Waschraum fortgesetzt?«
»Was?«
»Einige der anderen Kinder sagen, dass du nachts öfter mal rausschleichst.«
»A-aber …«
»Du brauchst keine Angst haben«, sagt Alina. »Warst du nachts draußen, Peter?«
»J-ja … war ich.« Ich schlucke, registriere das unterdrückte Atmen der Erwachsenen. »Ali hat …«
»Schon wieder Ali?«, sagt Józef. »Jetzt musst du aber mal …«
Der Polizist fährt ihm in die Parade. »Es ist wichtig, dass Peter ausreden kann. Was ist mit Ali?«
»Er war im Waschraum. Zusammen mit Jerzy.«
»Was hast du mitten in der Nacht im Waschraum gemacht?«
»Ich musste pinkeln.«
»Im Waschraum?«
»Ich hab Geräusche gehört und hab nachgeschaut.«
»Und was haben die Jungs dort gemacht?«
»Ali hat auf Jerzy gehockt.«
»Was heißt gehockt?«
»Mit dem Knie auf seinem Hals.«
Der Polizist fingert an dem Goldarmband an seinem Handgelenk.
»Du siehst also, dass Jerzy in der Klemme steckt. Was machst du?«
»Nichts.«
»Du hast nicht versucht, sie zu stoppen?«
»Ich hab mich nicht getraut. Die Erwachsenen schaffen es ja noch nicht mal, Ali festzuhalten, wenn er ausrastet.«
»Warum hast du nicht um Hilfe gerufen?«, fragt der Polizist.
Ich zögere. Verstehe nicht, wieso er sich so auf mich eingeschossen hat.
»Du musst keine Angst haben«, sagt die Psychologin zum dritten Mal. »Erzähl einfach in deinen eigenen Worten, wie es gewesen ist.«
»Aber das hab ich doch schon gesagt.«
Der Polizeibeamte wedelt abwehrend mit der Hand.
»Das hier bringt uns nicht weiter.«
Die Psychologin sieht ihn an.
»Muss ich Sie daran erinnern, dass Sie mit einem traumatisierten Kind sprechen?«
»Muss ich Sie daran erinnern, warum wir das machen?«
»Ich bin hier als Peters Fürsprecherin und denke, dass er eine kurze Pause braucht. Die brauchst du doch, Peter?«
Mein Herz pocht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Die nächste Zeit verbringe ich in einem Einzelzimmer. Ich esse, lese meine Comics, und nachts wird die Tür abgeschlossen. Ich habe keinen Kontakt zu den anderen Kindern. Eine Stunde am Tag habe ich in Begleitung eines Erwachsenen »Freigang«. Jeden Abend vor dem Einschlafen soll ich ein Glas Wasser trinken. Am Anfang schmeckt es noch irgendwie bitter, aber ich gewöhne mich daran.
Nach einer Woche passiert etwas Merkwürdiges. Ich schlage wie jeden Morgen die Augen auf. Aber ohne verschlafenes Blinzeln oder Reste von teilweise unbewussten Traumfetzen. Es ist ein automatisiertes Wachwerden. Die Augenlider klappen hoch wie auf Knopfdruck.
Und noch etwas ist seltsam.
Ich fliege nicht mehr in meinen Träumen.
8
Lucas Stage zog seinen großen Tumi Alpha 3 aus der Dunkelheit unter dem Bett hervor, wischte den Staub von der Unterseite und schob den Rollkoffer vor den Kleiderschrank. Beim Einpacken der bunt gemusterten Hemden, Skinny Jeans und von ein paar robusten Ledergürteln kreisten seine Gedanken um den Namen, der immer dann aus seinem Hirnnebel auftauchte, wenn er kurz zur Ruhe kam.
David Flugt.
Lucas hatte die Ermittlungen in dem grenzübergreifenden Fall eines Serienmörders geleitet, der über Jahrzehnte hinweg junge Frauen entführt, verstümmelt, ermordet und sie dann in einer alten Wallanlage in Smøl Vold in Süderjütland begraben hatte. Nach Aufklärung des Falls hatte Lucas mit einer Million Fragen dagestanden, ohne jemanden, dem er sie stellen konnte. Er hatte keine Ahnung, in was sich David in jener Nacht zusammen mit Jenny Seland verstrickt hatte, als der Fall um das Massengrab aufgeklärt – oder korrekter ausgedrückt abgeschlossen – wurde, weil er zu dem Zeitpunkt in einem Nachtzug nach Kopenhagen gesessen hatte. Doch eins wusste er mit Sicherheit: Der Fall Smøl Vold war nicht aufgeklärt. Weil sie den falschen Täter hatten.





























