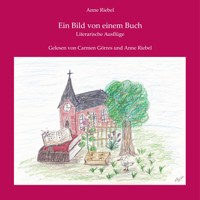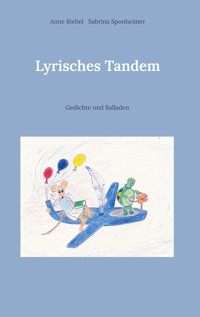Anne Riebel
DUNKELFELDER
oder ein bitterer Abgang
Alle Rechte vorbehalten · Societäts-Verlag
© 2019 Frankfurter Societäts-Medien GmbH
Satz: Bruno Dorn, Societäts-Verlag
Umschlaggestaltung: Bruno Dorn, Societäts-Verlag
Umschlagabbildung: fotolia.de
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
ISBN 978-3-95542-367-4
Für Thomas,Julia und Simone
SAMSTAG, 25. NOVEMBER
Ich habe meine Eltern getötet.
Stünde ich vor Gericht, ich könnte mich nicht auf eine Tat im Affekt berufen. Ich stieß sie mit voller Absicht und mit der größten Klarheit meiner Gedanken. Ich stieß sie hinein, in die Grube, die gut angefüllt war. Denn ich wusste in diesem Moment, dass es nicht aufhören würde. Solange sie lebte, würde ich ihren beharrlichen, detailversessenen Nörgeleien ausgesetzt sein. Solange er lebte, würde er sich in seiner Selbstherrlichkeit vor mir aufbauen. Sie fiel, und er sprang, nachdem er mich ungläubig, entsetzt und für den Bruchteil einer Sekunde erwartungsvoll angestarrt hatte.
1
Lautlos sank Josefines schlanker Körper auf einen Klappstuhl, der ganz hinten in der Ecke neben dem Eingang stand. Sie stützte ihren Kopf auf die Handballen und vergrub die Hände in ihrem sanft gewellten, rotblonden Haar. Nur mit Mühe schaffte sie es, ein Stöhnen zu unterdrücken. Sie sah an sich hinab, um sicherzugehen, dass ihre Beine nach wie vor ihre Beine waren und nicht die eines Elefanten. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals dermaßen durch die Gegend gehetzt worden zu sein. Frau Laux, haben Sie. Frau Laux, können Sie. Die fünfzig Gäste, die nun friedlich im großen Veranstaltungsraum ihres Weinguts saßen, hatten fast alle eine dämliche Frage, eine Unverträglichkeit oder sonst ein besonderes Anliegen mitgebracht. Von den Ansprüchen des Veranstalters selbst ganz zu schweigen.
Dr. Hans-Peter Thiel vom Institut für ganzheitliches Zeitmanagement war ein hochgewachsener, charismatischer Mann. Mit seiner weichen, vollen Stimme hatte er die Zuhörer schon nach wenigen Sätzen in seinen Bann gezogen. Am Nachmittag, als er kurz hergekommen war, um anzusagen, wie der Raum vorbereitet und bestuhlt werden sollte, war er allerdings alles andere als charmant gewesen. Unruhig war er herumgeschritten, hatte immer wieder betont, wie es unbedingt zu laufen hätte und was auf gar keinen Fall passieren durfte. Als ob Josefine auch nur auf die Hälfte der Punkte einen Einfluss gehabt hätte. Er war ungehalten, weil sie seine Anweisungen nicht so schnell mitschreiben konnte, wie er sie von sich gab. Und weil sie manches wiederholte, um sicherzugehen, dass sie ihn richtig verstanden hatte.
Nun stand er da. Blickte wissend, vielleicht auch ein bisschen amüsiert über sein Publikum hinweg, während er darauf wartete, dass von einem der drei Beamer, die er mitgebracht hatte, ein Schaubild an die Wand projiziert wurde. Es zeigte eine große weiße Fläche mit einem Smiley, darunter befand sich ein Herzchen und darunter wiederum ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte.
„Das Leben“, sagte er dann, „ist einfach.“
Ein erstauntes und zugleich protestierendes Raunen ging durch die Reihen der Gäste. Doch Thiel hob beschwichtigend die Hände.
„Es ist geradezu lächerlich einfach! Und es ist auch immer noch exakt dasselbe Leben wie früher …“ Einige lachten. Andere protestierten nun wirklich lautstark oder schnaubten genervt. „Meine Damen! Meine Herren! Lassen Sie mich zuerst in aller Ruhe ausführen, was ich für Sie vorbereitet habe. Schauen Sie, wir haben hier einen Menschen. Und dieser Mensch hat Kopf, Herz und Bauch.“ Thiel trat nun in den Lichtkegel des Projektors, sodass der Smiley über seinem Gesicht, das Herz auf der Brusttasche seines hellen Seidenhemdes und der Punkt im Kreis dort lag, wo Josefine seinen Bauchnabel vermutete.
„Ja“, sagte Thiel zufrieden. „Das ist unser Mensch. Seine Mitte. Körper, Geist und Seele. Und es wird immer davon gesprochen, dass wir die in Einklang bringen müssten. Doch tun wir einfach mal so, als sei das gar nicht die Frage. Tun wir einmal so, als seien wir schon zentriert. Und dann schauen wir uns an, was wir in diesem Leben zu tun haben.“ Er zeigte in die linke untere Ecke des Schaubildes. „Wir arbeiten. Wir brauchen einen Broterwerb. Üben einen Beruf aus oder leben unsere Berufung.“ Er schnippte mit den Fingern, und die drei Begriffe erschienen dort. „Dabei haben wir zwangsläufig mit anderen Menschen zu tun. Also müssen wir kommunizieren. Uns auseinandersetzen. Und um das hinzukriegen, brauchen wir Freunde.“ Er schnippte abermals mit den Fingern. Die Worte Menschen und Freunde wanderten oben links ins Bild. Oben rechts folgten die Hobbys. Besondere Begabungen, die im Berufsfeld nicht ausgelebt werden könnten. Entspannung, Ausgleich oder auch Haustiere seien hier einzuordnen. „Und irgendwann wollen wir ja auch einmal zur Ruhe kommen. Wir brauchen einen Ort, wo wir uns zurückziehen, wohlfühlen und neue Kraft sammeln können. Wenn das gelingen soll, müssen wir aber etwas tun. Nämlich putzen, Wäsche waschen, einkaufen und kochen. Und wir begegnen denen, kümmern uns um die, mit denen wir unser Zuhause teilen.“
Thiel hatte zum letzten Mal mit den Fingern geschnippt, und der Begriff Zuhause stand in der linken unteren Ecke des Schaubildes. Er lächelte stolz. „Das war es. Meine Damen, meine Herren. Das ist schon alles. Ganz einfach, oder?“ Er machte eine Kunstpause. „Bevor ich mich gleich den vielen Fragen widmen werde, die Sie auf dem Herzen haben, lassen Sie mich noch einen großen Mythos ausräumen. Den Mythos vom Hamster im Rad.“ Mit seinem Arm beschrieb er einen weiten Kreis, der sogleich in Rot auf dem Schaubild erschien. „Das Leben, meine Damen und Herren, ist eine runde Sache. Arbeit, Menschen, Hobbys, für sich und die Lieben sorgen. Im engeren wie im weiteren Sinne, denn Geist und Seele wohnen im Körper, und der Körper wohnt in den Räumen, die wir Zuhause nennen. Und dann fängt es alles wieder von vorne an.“ Thiel grinste. „It’s the circle of life.“ Die Melodie des Stückes aus dem ‚König der Löwen‘ wurde leise eingespielt. „Der Kreis des Lebens. Jeder hat seinen eigenen. Ob wir da hineingeworfen werden von einem Gott, dem Schicksal oder sonst einer höheren Macht? Ob wir das, was da heute drinsteht – bewusst oder unbewusst – selbst so geschaffen haben? Darüber ließe sich lange philosophieren. Doch bringt uns das weiter? Bei uns im Institut für ganzheitliches Zeitmanagement haben Sie die Möglichkeit, sich Ihren persönlichen Lebenskreis einmal ganz genau anzuschauen. Sie können ihn aufräumen, effektiver gestalten, ändern oder erweitern. Und Sie selbst können das Tempo bestimmen, mit dem Sie dieses Rad künftig drehen möchten. Doch genau das, was ich jetzt gerade mache“, Thiel trat aus seinem Schaubild heraus, „das können Sie im wirklichen Leben eben nicht tun!“ Seine Stimme klang nun tief und bedeutungsvoll. „Wir können nicht aussteigen. Wir können nicht raus aus dem Rad, wie es im klassischen Zeitmanagement seit über dreißig Jahren empfohlen wird. Das Leben ist ein ewiger Kreis. Und dieses große, lebendige Getriebe funktioniert nun einmal durch das Zusammenspiel vieler einzelner Räder und Rädchen, in denen jemand sitzt, der selbstverantwortlich steuert.“ Er zwinkerte schalkhaft. „Das kann ein Hamster sein.“ Die Musik schwoll an. Auf beiden Seiten des Schaubildes wurden nun Fotos und kleine Filme eingespielt. Eines zeigte tatsächlich einen fröhlich marschierenden Goldhamster. In einem geblümten Rhönrad drehte eine Frau kunstvolle Schleifen. Ein Mädchen auf einem Mini-Traktor, ein Mann auf einem Roller, in entgegengesetzter Richtung fuhren sie auf einem Rasen immer im Kreis herum. Ein junges Paar auf der Achterbahn. Eine Biene beim Rundtanz …
Josefine sprang auf und eilte nach nebenan ins Flaschenlager. Gleich wäre der erste Teil des Vortrags zu Ende, und sie musste noch die Frischhaltefolie von den Platten mit den Schnittchen und Käsespießchen nehmen. Die Mini-Quiches, die sie am Vormittag gebacken hatte, standen zusammen mit den Sektgläsern schon auf den Stehtischen bereit. Sie nahm den Spätburgunder brut aus dem Kühlschrank und öffnete die Flaschen so leise wie möglich.
„Soll ich dir beim Einschenken helfen?“ Charlotte hatte sich wohl unbemerkt aus dem Raum geschlichen und war hinter sie getreten. Über sie war der Kontakt zustande gekommen. Die engagierte Buchhändlerin hatte sich zu ihrem fünfzigsten Geburtstag im Januar selbst ein individuelles Coaching bei Dr. Thiel geschenkt und Josefine mit wachsender Begeisterung davon erzählt.
„Meinst du wirklich?“ Josefine schaute ihre Freundin forschend an. Ihre blassblauen Augen wanderten nervös umher. Als sie sich eine Strähne ihres kinnlangen, weißblonden Haares hinters Ohr strich, sah Josefine, wie sehr ihre Hand zitterte. „Bist du nicht zu aufgeregt?“
„Oh. Ja. Doch. Aber – ich habe … Ich fühle mich irgendwie mitverantwortlich. Sowohl dir als auch Hans-Peter gegenüber …“ Sie sah sich um. „Es ist ja wirklich ein großer Aufwand gewesen.“ Aus dem Raum war verhaltener Beifall zu hören.
„Wieso stellst du dich nicht an die Tür und drückst jedem der Teilnehmer ein Klemmbrett mit dem Ausdruck dieses Schaubildes in die Hand? Sie sind da drüben auf dem Wägelchen gestapelt.“
„Ja“, atmete Charlotte erleichtert auf, „das mache ich gerne! Da kann ich keinen großen Schaden anrichten.“ Sie lächelte verzückt, als sie das erste Brett in die Hand nahm. „Der Gestaltungsrahmen. Oder auch der Rahmen unserer Möglichkeiten. Meinen habe ich damals auch zusammen mit Hans-Peter ausgefüllt.“
„Wieso Rahmen?“, fragte Josefine verwirrt. „Sagte er nicht gerade, es sei ein Kreis?“
„Es ist die Quadratur des Kreises, meine Liebe. Seit ich damit arbeite, bin ich wirklich ein anderer Mensch!“
Charlotte wäre bestimmt einmal mehr ins Schwärmen geraten, wenn nicht nach und nach die Gäste hereingekommen wären und sie mit Fragen überhäuft hätten. Sie gab gezielt Auskunft, sprach mehr allgemein und doch überaus begeistert von ihrem Coaching und bemerkte zum Glück den überaus missbilligenden Blick nicht, den Dr. Thiel ihr zuwarf, als er zu der Gruppe stieß. Josefine wunderte sich darüber. Gab es denn bessere Werbung als eine zufriedene Kundin? Noch dazu eine wie Charlotte, die dermaßen seriös wirkte, sich wunderbar ausdrücken konnte und andere mit ihrem Enthusiasmus anstecken würde?
„Sie haben ein Wertungsproblem“, hörte sie ihn nun das Wort an sich reißen. Das machte er so geschickt, dass es außer Josefine wahrscheinlich niemandem aufgefallen war. Die ältere Frau, die eine Frage zur Hausarbeit gestellt hatte, würde ihn wahrscheinlich als äußerst aufmerksam und zugewandt empfinden. Da Josefine Nachschub für das kleine Büffet herbeischaffen musste, bekam sie leider nicht mit, was Thiel zu dem Thema zu sagen hatte. Doch irgendetwas an ihm, an der ganzen Situation, machte sie zornig. War es der Umstand, dass die Frau wahrscheinlich seit dreißig oder vierzig Jahren einen Haushalt führte, wohingegen Thiel lediglich ein Konzept entwickelt hatte? Josefine hatte sich abgewöhnt, zu sagen, dass ihr die häuslichen Tätigkeiten lagen und meist Spaß machten. Dass sie dabei entspannen, in Ruhe ihre Gedanken schweifen lassen konnte, wie bei einer Art von Meditation. Selbst Charlotte, die täglich eine Stunde auf ihrem Kissen im Schneidersitz zubrachte, schaute sie, wenn sie davon sprach, verständnislos an. Wenn aber einer nach Nepal ging, sich dort ein paar Wochen in ein Kloster setzte, dann zurückkam und ein Buch herausgab mit dem Titel ‚Nach der Erleuchtung Socken waschen‘, dann war Charlotte hingerissen.
Und hingerissen sahen die Frauen nun auch Thiel an, der sagte: „Bleiben Sie in der Liebe, meine Damen. Egal was Sie tun. Sie sind ja die Trägerinnen der Liebe. Waschen Sie Ihre Kartoffeln – ja jede einzelne Kartoffel –, als würden Sie einen kleinen Buddha baden.“
Nach der Pause gab sich Dr. Thiel zerknirscht. „Ich möchte Abbitte leisten. Natürlich ist es nicht ganz so einfach.“ Er hob den Blick. „Oder – um es mit den Worten eines großen Dichters zu sagen: ‚Zwar ist es leicht, doch ist das Leichte schwer‘.“
„Er meint Goethe“, flüsterte Charlotte, die nun auf dem Klappstuhl saß. Josefine lehnte, die Arme vor der Brust verschränkt, daneben im Türrahmen.
„Ja. Es wäre leicht. Es könnte ganz einfach sein, wenn unsere Lebensenergien frei fließen könnten. Wenn wir emotional total erwachsen geworden wären. Und Kind geblieben! Wenn wir wüssten, wofür es sich für uns zu leben und zu sterben lohnt, denn dann wüssten wir auch, warum wir jeden Tag aufs Neue unser Rad drehen. Und es wäre die natürliche Folge, dass wir das seelische Anhaften an Status und Hierarchie überwinden. Warum spreche ich im Konjunktiv? Ist es nur eine schöne Utopie, die ich hier beschreibe? Oder spürt der eine oder die andere doch eine gewisse Wahrhaftigkeit darin? Eine Sehnsucht oder Lust, sich auf den Weg zu machen? Doch wo führt dieser Weg hin? Auf eine einsame Insel? Ans andere Ende der Welt? In ein Kloster?“ Thiel genoss den Moment, da alle Augenpaare im Raum erwartungsvoll auf ihn gerichtet waren. „All das können wir natürlich tun. Wir können aber auch einfach bleiben, wo wir sind, und nach innen reisen. Das ist nicht weniger spektakulär. Wir können nach innen reisen und unsere Lebens-Geister aufwecken.“
Wieder entstand Unruhe im Raum. Die Teilnehmer sahen sich an. Grinsten. Zeigten sich gegenseitig den Vogel. Ein fragender Blick aus Josefines grünen Augen wanderte von Thiel zu Charlotte. „Ich verstehe das auch nicht“, flüsterte diese betrübt. „Dabei hat er es mir schon mehrmals erklärt. Es geht irgendwie darum, die eigenen Lebensenergien in Form von Bildern oder inneren Figuren sichtbar werden zu lassen. Ich kann überhaupt nichts damit anfangen. Würde viel lieber aufhören mit dem Coaching. Nur Woche für Woche meinen schönen Rahmen füllen und meine Maßnahmenliste abarbeiten.“
Es kostete Thiel einige Mühe, die Aufmerksamkeit der Gäste erneut auf sich zu ziehen. Er sprach davon, dass jeder einen Kampf-Geist hätte, der im Zuhause anzusiedeln sei, aber auch die Verantwortung für das Gesamtkonzept trage. Männliche Kampf-Geister seien im Allgemeinen mehr fakten- und zielorientiert, weibliche wollten die Ursachen verstehen und dass es allen gut ginge. Er sprach von der Jung’schen Archetypenlehre, und Josefine bemerkte, dass einige überfordert wirkten, unter anderem auch die ältere Frau mit dem Wertungsproblem im Haushalt.
„Diesen Teil übernimmt normalerweise seine Partnerin. Madame Mercier“, raunte Charlotte Josefine zu. „Sie soll eine besondere Begabung dafür haben, die Lebens-Geister der Leute aufzustellen. Angeblich kann sie sie sehen …“
Josefine schwirrte allmählich der Kopf. Und sie hatte nur noch einen Wunsch: dass dieser Thiel, der jetzt vom Frei-Geist, von inneren Närrinnen und Narren, vom Kasperltheater und in ermüdender Ausführlichkeit über die Figuren der Commedia dell’Arte sprach, ein Ende finden würde.
STELLA
Seit ich akzeptiert habe, dass ich verrückt bin, schaffe ich es ganz gut, in den Augen der anderen als normal zu gelten. Ich höre Stimmen. Ich sehe Dinge, die es gar nicht gibt. Seit ich nicht mehr dagegen ankämpfe, komme ich einigermaßen klar.
Ich träume nicht mehr von der Brücke. Und wenn ich an die Brücke denke, ergreift mich nicht mehr dieser dunkle warme Sog, sondern Angst. Diese Angst, sagt Hans-Peter, ist eine gute, eine schützende Angst. Und die Tante sieht das genauso. Sie kann Hans-Peter nicht besonders gut leiden. Obwohl sie in ziemlich vielen Punkten genauso denkt wie er, wäre es ihr lieber, ich würde mich von ihm trennen.
Ohne Hans-Peter würde ich die Tante und die anderen gar nicht kennen. Wenn er nicht da gewesen wäre, in jener Nacht, gäbe es mich nicht mehr. Ich kann mich nicht daran erinnern, über das Geländer geklettert zu sein. Ich weiß nur noch, dass ich da stand und hinabsah, auf die Schienen, die dunkel glänzten. Und ich dachte, dass sie in die Tiefe, die Stille führen. Eine gewaltige Sehnsucht durchströmte mich. Wie ein schwerer Mantel legte sie sich über mein Herz. Eingehüllt in diese samtige Schwärze spürte ich meinen Schmerz nicht mehr. Ich hatte keine Angst. Es würde nicht wehtun. Ich würde schweben. Sanft auf die andere Seite getragen werden.
Er roch nach schwarzen Kirschen und Leder, nach Rasierwasser und einem Hauch Tabak. Er hielt mich im Arm. Über das Geländer hinweg hielt er mich. Und dann begann er zu sprechen. Ganz behutsam und leise. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, nur, dass seine Stimme immer wärmer und tiefer wurde. Und dass sie mich getragen hat. Den ganzen Weg von der Brücke bis zu mir nach Hause.
Wir saßen auf meinem Sofa, wo ich endlich wieder anfing zu sprechen. Im Morgengrauen stand er auf, kochte starken Kaffee und sagte, ich dürfe mich jetzt nicht in ihn verlieben. Das sei der falsche Weg. Es sei viel Liebe in mir, doch sie sei blockiert. Und er könne mir helfen, diese Blockaden zu lösen. Wir würden meine Lebens-Geister wecken. Und dann müsste ich keine Angst mehr haben. Angst wovor, habe ich ihn gefragt. Und er hat gelächelt. Vor dem Leben?
Seit diesem Morgen, das ist jetzt zwei Jahre her, bin ich nicht mehr allein. Meine Lebens-Geister sind immer bei mir. Als Erstes kam die Tante. Hans-Peter hat sie buchstäblich auf den Plan gerufen. Er hat mir wirklich einen solchen aufgemalt. Und ich sollte ihn ausfüllen. Das war schnell erledigt. Meine Arbeit hatte ich verloren. Längst gab es keine Freunde mehr, mit denen ich in Kontakt stand. Weil mich alles so sehr anstrengte, ich für die einfachsten Aufgaben eine Ewigkeit brauchte, hatte ich kaum noch Freizeit. Ich hatte von klein auf eine große Schwäche für Filme und Serien gehabt. Habe mir DVDs ausgeliehen. Bin gerne ins Kino gegangen. Aber seit mein Leben so düster geworden war, schaffte ich selbst das nicht mehr. Ich mochte mir keine dramatischen oder gruseligen Filme ansehen, weil mich das noch weiter runterzog oder zu sehr aufregte. Aber auch die leichten Komödien, die schönen Filme fürs Herz machten mir Angst. Sie waren irgendwann zu Ende, und ich würde mich nur in dem Elend wiederfinden, zu dem mein Leben geworden war.
Als Hans-Peter mir sagte, in mir gäbe es einen Kampf-Geist, eine Kraft, die dafür zuständig sei, dass alles wieder in Ordnung käme und einigermaßen rundliefe, protestierte ich heftig. Doch er meinte, es sei sogar jemand, der sich dieser Herausforderung gerne stellen würde. Ich lachte. Ich lachte und hatte die Stimme meiner Tante Birgit im Ohr. Herzje, was machst du denn für Sachen? Und ich sah sie vor mir. Schlank, tüchtig, immer nett zurechtgemacht. Sie hatte blonde Haare, eine schicke Föhnfrisur. Sie liebte schmale, kurze Röcke. Hohe Schuhe, allerdings nur mit breiten Absätzen. Und feine Blusen. Ich erinnerte mich, wie sie samstagabends die Treppen zu unserem Haus hochkam. Den Koffer immer an derselben Stelle abstellte. Ihren Mantel an der Garderobe auf einen Kleiderbügel hängte. Dann ging sie ins Wohnzimmer und nahm den Zustand der Räume, an dem sie den Zustand meiner Mutter ablesen konnte, in Augenschein. Meistens stemmte sie dann die Hände in die Hüften. Ei, wie sieht’s denn bei euch bloß wieder aus? Sie hatte eine besondere, eine freundliche Art zu tadeln. Dafür habe ich sie geliebt. Denn die anderen spotteten über meine Mutter und lachten sie insgeheim aus.
Ich brauchte eine Weile, bis ich begriffen hatte, dass mein Kampf-Geist, die Tante, nicht Tante Birgit ist. Sie ist ihr nur in vielem ähnlich. Vielleicht hat Birgit ja gesehen, was ich bis dahin nicht sehen konnte? Vielleicht hat sie mir deshalb ihre Wohnung überlassen?
Jedenfalls war ich ein paar Wochen lang ziemlich nah am Wasser gebaut. Immer wieder ergab ich mich einem subtilen Schmerz, der in der Erkenntnis steckte, dass Birgit, meine echte Tante, längst nicht mehr – wie in meinen Erinnerungen – Ende dreißig ist, sondern vielmehr auf die sechzig zugeht. Dass sie weggegangen ist und nicht mehr zurückkommen wird. Und ich schluchzte eine übergroße Rührung aus mir heraus, als ich endlich begriff, dass die jüngere Ausführung dieser tüchtigen kleinen Person, auf die ich unbewusst die ganze Zeit über gewartet hatte, tatsächlich ein Teil von mir selbst ist.
Es ist schon spät. Gleich halb elf. Ich bin immer noch im Institut. Warte auf Hans-Peter, obwohl er gesagt hat, dass ich nicht warten soll. Auch die Tante ist der Meinung, dass es besser wäre, nach Hause zu gehen. Wir haben alles erledigt, sagt sie.
Schon bald nachdem sie das Heft in die Hand genommen hatte, konnte ich hier als Hausdame anfangen. Es ist nur ein Minijob, meinte Hans-Peter, zwölf Stunden in der Woche. Für mich war es ein Megajob. Zumindest am Anfang. Im Nachhinein hat er sich als Anker erwiesen, an dem ich mich aus den Tiefen meiner Verzweiflung herausziehen konnte.
Und trotzdem ist es wichtig, auch weiterhin gut auf sich aufzupassen, sagt die Tante. Immer gut für alle zu sorgen. Sie hat recht. Mein Mädchen wird müde. Mein Mädchen, das ist mein Frei-Geist. Mein inneres Kind. Zuständig für Hobbys und Freizeitgestaltung. Und auch das war erst einmal eine verwirrende Begegnung für mich. Denn der kindliche Teil in uns, der muss … wie hat Hans-Peter das ausgedrückt? Er muss nicht in dem Sinne erwachsen werden, aber er soll wissen, wie alt er ist und wo er im Leben steht. Und das wusste mein Mädchen. Sie sei acht Jahre alt und eine berühmte Schauspielerin, sagte sie, als wir uns zum ersten Mal trafen. Hans-Peter hielt sie zuerst für eine großartige Schaumschlägerin. Doch das stimmt nicht. Mein Mädchen kommt sehr nach meiner Mutter. Sie ist sensibel und hat viel Fantasie.
Irgendwann hat meine Mutter die Esoterik für sich entdeckt und bald kannte sie sich aus mit der Aura und blockierten Chakren. Sie wusste, wann welcher Engel angerufen werden musste. Und alles hatte eine Bedeutung. Auch dass ich Bambi liebte. Von klein auf Bambi war, in meinen Spielen. Ich verband damit die wundersame Freude, einen Schmetterling zu beobachten. Oder an einer Blume zu riechen. Dazu hatte mich das Hörspiel angeregt. Ich hatte das Cover der Schallplatte vor Augen. Meine Mutter den Medienpreis – sie sah eine große Zukunft in mir. Und sie beglückwünschte sich dazu, mich in weiser Voraussicht Stella genannt zu haben. Stella Römer. Nicht nur ihr Augenstern, sondern eines Tages auch ein leuchtender Stern am Kinohimmel.
Es war hart für mich zu erkennen und anzunehmen, was mir meine Mutter mit ihrer Weltflucht und ihren Luftschlössern angetan hatte. Vor allem eben meinem Mädchen. Alles, was ich als Kind tat, war immer wunderbar, großartig und sehr besonders. Auch als meine Freundinnen in der Schule anfingen, mich Romy zu nennen, wegen meines Nachnamens, sah sie darin ein Zeichen. Sie bestellte sämtliche Romy-Schneider-Filme, die es auf DVD gab, und in Vorbereitung meiner Karriere als Schauspielerin haben wir sie immer wieder zusammen angeschaut.
Ohne Hans-Peter hätte ich es niemals geschafft, meinen kleinen Frei-Geist aus der Traumwelt herauszuholen. Ich musste zurückgehen in die Kindheit, das Vertrauen meines Mädchens gewinnen, sie an die Hand nehmen und ihre Sicht auf die Welt sanft entzaubern. Ihr behutsam, in kleinen, verträglichen Häppchen erzählen, was in meinem Leben zwischenzeitlich wirklich passiert war. Damit habe ich in meinem ersten Jahr nach der Brücke einen Großteil meiner Zeit zugebracht. Im Oktober konnte ich, mit klopfendem Herzen und nervöser Blase, eine Halbtagsstelle im Café Harlekin antreten. Hans-Peter hatte mich über das Institut vermittelt. Der Chef wusste also, worauf er sich einlässt. Denn auch wenn mein Mädchen nun meist wieder mit aufgerichteten Flügeln durchs Leben geht, weiß, dass sie sechsundzwanzig ist, als Kellnerin und Hausdame arbeitet und sich mit großer Begeisterung ihrer Verantwortung der Freizeitgestaltung widmet, gibt es Tage, an denen sie fürchtet, dass unsere schöne, in ihren Augen neu geschaffene Realität wie einst die Luftschlösser in sich zusammenfallen könnte. Dann jammert sie in einem fort, und Kaffee zu servieren kann zu einer unüberwindbaren Herausforderung werden.
SONNTAG, 26. NOVEMBER
Ich habe meine Eltern getötet. In Wahrheit aber haben sie mich getötet. Sie haben mir das Leben geschenkt und zugleich mit der Zerstörung alles Lebendigen in mir begonnen.
Meine Mutter war eine schwarze Sonne. Sie wärmte mich, doch sie leuchtete nicht für mich. Sie nährte mich, doch mit der Milch, die ich saugte, saugte ich auch ihre Trauer, ihre Angst und ihre tiefe Resignation in mich hinein.
Mein Vater war ein kalter Mond. Er spendete Licht, doch es war ein eisiges Leuchten, das von ihm ausging. Menschen, die weder Güte noch Gnade kannten, waren es, die ihm folgten. Auf dem Weg zurück, ins ewige Gestern. In einen Urzustand des Daseins, der in ihren Vorstellungen existierte.
2
Nur widerwillig schälte sich der Sonntagmorgen aus der zähen Umklammerung der Nacht, Nebel und tief hängende Wolken hatten die Hügel der Haardt verschluckt. Die Häuser des Winzerörtchens Rittersheim waren nur als ferne Schemen zu erkennen. Josefine fröstelte, knöpfte ihre Schafwolljacke zu und leerte die Aschenbecher. Das hohe alte Holzfass, das im Hof zwischen der Bürotür und dem Eingang zum Weinprobierraum stand, hatte auch gestern wieder die Raucher um sich versammelt. Sie holte die Sonntagszeitung aus dem Briefkasten und ging nach oben in die gemütliche Wohnküche, in der es nach Kaffee und frisch aufgebackenen Brötchen roch. Ralf saß im Schlafanzug am Esstisch und lächelte sie an.
„Bist du schon wieder fleißig?“
„Guten Morgen, mein Schatz!“ Sie küsste ihn, fuhr durch sein dichtes, schwarzbraunes Haar, das ihm in allen Richtungen vom Kopf abstand. Ihr Mann war Ende vierzig und hatte die Figur eines Menschen, der nahezu ständig in Bewegung war. Trotz Vollbart und einer strengen schwarzen Brille strahlte er eine gewisse Jugendlichkeit aus. „Ich habe die Technik und all die Utensilien, die Dr. Thiel gestern dabeihatte, schon einmal in den Bus geladen.“
„Warum hat er die Sachen nicht mitgenommen?“
„Als ich ihn darauf ansprach, fühlte ich mich wie eine lästige Bittstellerin.“
„Na, aber?!“
„Du hättest seine Miene und die entsprechende Handbewegung sehen sollen! ‚Das bringen Sie mir halt irgendwann vorbei!‘“
Ralf Laux schüttelte missbilligend den Kopf. „Ich hätte nicht gedacht, dass meine Sitzung so lange dauern würde – und ihr habt noch alles picobello aufgeräumt.“ Er gähnte und schenkte sich Kaffee nach.
„Ich auch“, raunte es gedämpft aus der Tür von Josefines Kammer. War es der hellblaue Seidenpyjama, der da sprach? Oder der weinrote, mit allerlei Blüten und Ornamenten bedruckte Morgenmantel? Charlotte selbst war jedenfalls noch nicht anwesend.
„Ich hatte dich in dem Wörtchen ‚ihr‘ mit eingeschlossen“, in Ralfs kleinen, dunklen Augen lag ein schelmisches Blitzen. „Oder war sonst noch jemand da?“
„Nein. Wir haben es ganz allein geschafft, die Reste aus sämtlichen Sektflaschen auszutrinken. Und mein ‚ich auch‘ bezog sich auf Kaffee. Viel Kaffee. Am besten intravenös.“
Ralf grinste. „Na, immerhin ist das Plaudertäschchen schon wach.“
„Es funktioniert unabhängig von mir selbst, ich weiß. Es ist manchmal sehr nervenaufreibend. Oft auch peinlich. Vor allem wenn ich müde, abgelenkt oder ängstlich bin.“
Josefine lächelte, weil einer der genannten Gemütszustände fast immer bei Charlotte vorherrschte. Sie legte der Freundin ein Croissant auf den Teller und butterte für sich selbst ein Mohnbrötchen.
„War es denn sonst okay?“, wollte Ralf wissen, der sich an der Wurst- und Käseplatte zu schaffen machte.
„Na ja“, sagte Josefine. „Es war sehr anstrengend. Diese Leute! Sie haben mich ja schon im Vorfeld völlig fertiggemacht!“
„Inwiefern?“
„Ob irgendwelche Zusatzstoffe im Essen wären. Warum wir nicht mehr Parkplätze gebaut hätten. Ob wir laktosefreie Milch mit hinstellen könnten. Und dass es doch eine Unverschämtheit sei, wenn man in einem Lokal heutzutage keine kalte Cola serviert bekäme.“
Ralf verdrehte die Augen. „Ihr Armen. Haben sie wenigstens ein bisschen was gekauft?“
„Nicht eine Flasche.“ Josefine winkte ab. „Aber das will ja nichts heißen. Der eine oder andere kommt vielleicht später wieder. Oder erzählt es weiter.“
„Und Thiel?“
„Ich hoffe, er war zufrieden.“ Josefine warf ihrer Freundin einen fragenden Blick zu.
„Das denke ich schon. Hans-Peter hatte eine ganze Liste mit Interessenten, und ich glaube, dass sich einige sogar direkt für ein Coaching angemeldet haben.“
„Ich habe immer noch nicht verstanden, wozu das gut sein soll“, stichelte Ralf und griff nach der Zeitung. Doch Charlotte, die mit einem Mal hellwach wirkte, ließ ihn nicht zu seiner Lektüre kommen.
„Das, was Thiel gestern an die Wand geworfen und für die Teilnehmer ausgedruckt hat, war ja nur der Grundrahmen. Der wird im Laufe des Coachings individuell ausgefüllt und bei Bedarf angepasst.“ Sie sprang auf, verschwand in der Kammer und kam mit einem Blatt Papier wieder zurück. „Das absolut Geniale ist, dass dieser Lebensplan auf eine einzige DIN-A4-Seite passt!“
Josefine betrachtete das mit vielen winzigen Listen, Kästchen zum Abhaken und einer Tabelle versehene Werk eingehend und meinte: „Das ist aber nicht gerade wenig.“
„Natürlich nicht. Aber ich habe es im Überblick. Ich habe nicht mehr ständig das Gefühl, etwas zu vergessen. Und darüber hinaus habe ich für dieses Pensum jede Woche über hundert Stunden zur Verfügung.“
Ralfs Stirn legte sich in kritische Falten. „Stimmt“, meinte er dann erstaunt. „Einhundertzwölf, wenn wir davon ausgehen, dass wir acht Stunden am Tag schlafen.“ Er sah sich das Papier genauer an. „Und morgen früh nimmst du das her und fängst an abzuhaken?“
„Ja. Dinge, die einfach erledigt werden müssen, hake ich ab. Anderes trage ich ein. Zum Beispiel ein lachendes Gesicht für eine Stunde Meditation oder Lesen. Da ich für jeden Tag eine andere Farbe benutze, habe ich immer die Übersicht, was wann gelaufen ist. Und ich sehe, dass mein Leben, trotz der vielen Routineaufgaben und Wiederholungen wild und bunt ist. Das Allerbeste aber ist, dass ich nicht mehr ständig mit einem schlechten Gewissen im Nacken herumlaufe.“
Ralf nickte bestätigend. Josefine, die sich irgendwie unwohl bei der Vorstellung fühlte, alles so rational und haarklein strukturiert angehen zu müssen, beäugte das Papier skeptisch. „Hauptsache, es hilft dir.“ Sie hatte wohlwollend klingen wollen, dieses ungute Gefühl, das sie inzwischen mit Thiel verband, wohl aber nicht aus ihrer Stimme heraushalten können.
„Du magst Hans-Peter nicht besonders“, schloss Charlotte.
„Ich weiß nicht … Ich …“
„Du bist eben mehr der kreative Typ. Du wärst bei Madame Mercier wahrscheinlich besser aufgehoben. Schade, dass sie gestern nicht da war. Sie hält einen Workshop in Münster.“
„Ist das die Frau, die die Lebens-Geister der Leute sieht?“, fragte Josefine. Ralf musste lachen und verschluckte sich an seinem Kaffee.
„Das ist kein Scherz“, belehrte ihn Charlotte. „Es läuft wohl ähnlich wie bei einer Familienaufstellung. Nur dass eben eine Art inneres Team gebildet wird; jeder Lebens-Geist ist für einen der Lebensbereiche, die Hans-Peter gestern vorgestellt hat, verantwortlich. Ich habe mit einigen gesprochen, die total begeistert waren …“
„Begeistert von den eigenen Lebens-Geistern?!“ Ralf schüttelte sich vor Lachen. „Das passt zu diesen Egozentrikern!“
„Ich selbst kann ja auch nichts damit anfangen“, versetzte Charlotte kläglich, „aber …“
„Es ist doch ganz einfach, einer deiner Geisterlein ist Hamilkar Schaß.“ Ralf nahm seine Brille ab und wischte sich die Augen. „Und du zahlst denen wirklich achtzig Euro die Stunde?!“
„Wieso Hamilkar Schaß …?“
„Hamilkar Schaß, mein Großvater, ein Herrchen von, sagen wir mal, einundsiebzig Jahren, hatte sich gerade das Lesen beigebracht, als die Sache losging“, murmelte Josefine vor sich hin. Und lächelnd fügte sie hinzu: „Nur noch das Kapitelchen zu Ende.“
„Ahhh! Ja. ‚So zärtlich war Suleyken‘.“ Charlotte strahlte. „Das könnte ich wirklich mal wieder lesen!“ Dann schaute sie ihre Freundin verblüfft an. „Du zitierst Siegfried Lenz auswendig?“
Josefine zuckte die Achseln: „Ich kenne nur den Leseteufel so gut. Mein Vater hat diese Geschichte geliebt. Er hat sie mir oft vorgelesen.“
Josefine spürte in der darauffolgenden Stille ihre Augenwinkel heiß werden. Ihre Kehle schnürte sich zu. Sie raffte die Teller zusammen und floh in die Küche. Tränen rannen ihr die Wangen hinab. Tränen der Wut. Sie verstanden sie nicht. Sie dachten wohl, dass sie über den Verlust ihres Vaters nicht hinwegkam. Natürlich vermisste sie Eugen. Sie vermisste seine zu stark gebackenen Pfannkuchen. Seine viel zu festen Umarmungen. Seine freundlichen, humorvollen Sprüche. Sie war traurig, dass er nicht mehr da war. Was ihr aber wirklich zu schaffen machte, war der Umstand, dass es ihr unmöglich war, mit den beiden über ihn zu sprechen. Charlotte, die unter hastig vorgetragenen Entschuldigungen im Bad verschwunden war, versuchte ihr jedes Mal ein Verdrängungsproblem einzureden, wenn sie nicht wehklagen und jammern, sondern von den schönen Momenten mit Eugen sprechen wollte. Und was Ralf ritt, der sich mit seiner Zeitung ins Wohnzimmer verkrümelt hatte, verstand sie noch weniger. Er hatte ihren Vater doch so gut gekannt. Hätte so viele Erinnerungen mit ihr teilen können. Fünfundzwanzig Jahre lang war ihr Mann in das kleine Häuschen in Eußerthal gekommen, in dem die Zeit irgendwie langsamer vorangeschritten war. Josefine war dort aufgewachsen, in den zugigen Räumen mit ihren Holz- und Ölöfen. Einer winzigen Küche, in der es anstelle einer Spüle einen Wasserstein mit Boiler und ein altmodisches Radio gegeben hatte.
Sie sah ihren Vater dort stehen, wie er im Sommer seinen Salat wusch und Radieschen schnitt. Wie er sich freute, wenn er etwas frisch aus dem Garten, der sich steil hinter dem Haus den Hang hinaufzog, auf den Tisch bringen konnte. Sie dachte an seine Unfähigkeit, sich zu organisieren, den Haushalt zu führen. Zum Ende hin war es zuweilen mühsam gewesen, da nahezu alles an ihr hängen geblieben war. Sie dachte an seinen Durst, den sie zweifelsohne von ihm geerbt hatte. Oder sie hatten eben beide eine Reblaus als Lebens-Geist an ähnlich prominenter Stelle in ihrer Persönlichkeit sitzen. Josefine konnte sich ohnehin nicht vorstellen, dass es nur vier dieser Geister geben sollte. Die Menschen waren doch vielseitiger. Eugen mit seinen tausend Interessen war es in jedem Fall gewesen.
Als sie ihn an jenem Samstagnachmittag im vergangenen August auf der schweren Holzbank oben im Garten fand, den Kopf etwas schief an den Stamm der Eberesche gelehnt, war er weit über achtzig gewesen. Der Strohhut hatte vor ihm auf dem Boden gelegen. Das wenige schüttere Haar wiegte sich im Wind und sie hatte seine Stimme im Ohr. Die Stimme des leidenschaftlichen Lehrers. ‚Die Vogelbeere gehört zur Familie der Rosengewächse. Wenn die Beeren im Sonnenlicht leuchten, hat der Sommer seinen Zenit erreicht.‘
Er hatte ein ausgefülltes, intensives Leben gehabt. Ganz ohne Gestaltungsrahmen oder sonstigen Schnickschnack. Dabei hatte er sein Tal und die Villa Himmelreich, wie er sein Häuschen nannte, nur selten verlassen. Und er war gestorben, wie er es sich gewünscht hatte. Ohne aus seinem Haus ausziehen zu müssen. Und ohne zu frieren. Denn vor der Eiseskälte, die der Tod seiner Einschätzung nach mit sich brachte, hatte er sich sehr gefürchtet und während des letzten Winters so tüchtig eingeheizt, dass sie ein ums andere Mal Angst gehabt hatte, er könnte ersticken. Oder die Villa Himmelreich in Flammen aufgehen lassen.
Josefine schnäuzte sich. Wenn sie etwas von ihrem Vater gelernt hatte, dann, dass die Vergänglichkeit zum Leben dazugehörte. ‚Wir sterben nicht am Ende, Kind. Das sieht nur so aus. Jeden Abend stirbt ein Tag. Und in einem toten Baum wird ein Universum geboren.‘ Vielleicht war er deshalb auf die Idee verfallen, in einem Wald beigesetzt zu werden. In einer Urne aus einem kompostierbaren Material. An jenem Tag, als sie ihm dort einen Baum mit einem besonders schönen Ausblick reserviert hatte, saßen sie am Küchentisch in der Villa Himmelreich beisammen, lachend und weinend zugleich.
Ja, sie vermisste ihn. Doch das heiße Gefühl, dass sich, wenn sie an ihn dachte, in ihrer Brust ausbreitete und ihr zuweilen noch immer die Tränen in die Augen trieb, entsprang nicht Trauer oder Schmerz, sondern einer tief empfundenen Dankbarkeit, einem geradezu überwältigenden Gefühl der Gnade. ‚Was für ein schöner Tod.‘ So hatten es seine Freunde bei der Trauerfeier ausgedrückt. Die einen sehnsüchtig. Die anderen voller Bewunderung, als wäre es Eugens eigener Verdienst.
3
Charlotte trug gefütterte Leggins, Funktionsshirt und Softshell-Jacke sowie spezielle Nordic-Walking-Schuhe. Alles war farblich aufeinander abgestimmt, sogar die Stöcke passten dazu. „Laufen wir nicht von hier aus los?“, fragte sie erstaunt, als sie sah, wie zielstrebig Josefine auf ihren Wagen zuging.
„Ich dachte, wir bringen dem guten Dr. Thiel noch schnell seine Technik vorbei. Dann können wir nach Gleisweiler weiterfahren, wenn du möchtest. Oder lieber Richtung Eschbach?“
Charlotte wollte es sich überlegen und stieg auf der Beifahrerseite ein. Vom Weingut, das von Reben umschlossen außerhalb lag, fuhren sie auf der schmalen Landstraße nach Rittersheim. Das malerische Winzerdorf lag noch in friedlichem Schlummer. Die Fachwerkfassaden schwiegen. In den von Bundsandstein eingefassten Fenstern waren nur vereinzelt Lichtquellen auszumachen. Zu ihrer Linken führte eine Straße steil bergan in ein Neubaugebiet. Ganz oben ragte ein gewaltiger Felsen weit über die Dächer der Häuser hinweg in die Landschaft.
Sie fuhren an dem kleinen Dorfplatz vorbei, passierten Kirche und Friedhof, Schuhmanns Weinstube und die Apotheke am Ortsausgang. Dahinter öffnete sich der Blick auf die Ebene, in der Landau lag. Sie erkannten die Zwillingstürme der Marienkirche, dem aus dieser Richtung betrachtet wohl markantesten Bauwerk der Stadt. Keine zehn Minuten später standen sie vor einem protzigen Haus im Fliegerviertel. Die gewaltigen Säulen, die sich dem Besucher aufdringlich in den Weg stellten, ließen ein entsprechend dimensioniertes Eingangsportal erwarten. Tatsächlich aber fanden sie sich vor einer einfachen Haustür wieder. Auch in der Höhe verloren sich die Säulen, sie verjüngten sich bis auf die Hälfte ihres Durchmessers und stützten lediglich einen winzigen Balkon. Neben der Tür war ein Schild befestigt: „Institut für ganzheitliches Zeitmanagement, Dr. Hans-Peter Thiel, Beratung. Coaching. Seminare.“
„Es ist nicht sehr rücksichtsvoll von uns, am Sonntagmorgen um diese Zeit zu erscheinen“, gab Charlotte zu bedenken.
„Nein. Ist es nicht.“ Josefine verkniff es sich, hinzuzufügen, dass der gute Dr. Thiel auch alles andere als rücksichtsvoll mit ihr umgegangen war. „Aber da das Licht an ist, wird er vermutlich schon wach sein.“
„Wo? Ich sehe gar nichts.“
„Auf der rechten Seite. Ich habe es bemerkt, als wir von der Straße hergefahren sind.“
„Also klingle ich jetzt?“
Josefine nickte. Sie vernahmen einen voluminösen Gong, aber weiter geschah nichts. Charlotte versuchte es erneut, dann dreimal hintereinander. Alles blieb ruhig.
„So ein blöder Hund“, grummelte Josefine, die in einer Art von lakonischem Scherz die Kiste mit den Projektoren an die Tür presste. Sie hätte fast das Gleichgewicht verloren, als diese nach innen aufschwang.
„Das können wir doch nicht machen, Josefine. Das ist mehr als unhöflich.“
„Ich will die Verantwortung für diese teuren Dinger los sein.“
„Ich weiß nicht. Mir ist irgendwie nicht wohl dabei …“
Doch Josefine hatte bereits den kurzen Windfang durchquert und stand in einer atriumartigen Halle, die in der Höhe zwei Geschosse umfasste und Licht von oben hereinließ. Frei schwingende Konferenzstühle waren in Reihen aufgestellt. An der gegenüberliegenden Wand befand sich ein Rednerpult, daneben ein Tisch, auf dem Bücher und Broschüren arrangiert waren.
„Hallo“, rief Josefine. „Hallo, ist jemand da?“
„Wir sollten wieder gehen“, flüsterte Charlotte, die ihr nur zögernd gefolgt war.
„Irgendwie ist das doch merkwürdig“, murmelte Josefine, die sich nach rechts wandte, hin zu dem Raum, aus dem sich das Licht in die Halle ergoss. Sie stellte die Kiste auf den Boden und klopfte an den Türrahmen. Sie wollte abermals rufen, doch die Worte blieben ihr im Hals stecken: Das Zimmer wirkte durch seine wuchtigen Möbel eng und beklemmend. Dunkle Teppiche und schwere Vorhänge taten ein Übriges. Die Wand zur Halle hin wurde von Bücherregalen eingenommen, allesamt mit abschließbaren Glastüren versehen. Am Ende des Raumes befand sich eine Sitzgruppe, bestehend aus einem antiken Sofa, zwei Sesseln sowie einem überdimensionierten Couchtisch aus Mahagoni. Dahinter führte eine schmale Treppe in die obere Etage.
Ihr Blick wanderte zurück und blieb an einem Buchhalterschreibtisch hängen. Auch wenn sie den Einrichtungsstil als ungewöhnlich empfand, so gab es doch zwischen all den Stücken, angefangen von den Lampen bis hin zu den Accessoires, etwas Verbindendes. Selbst der immense, mit grünem Leder bespannte Bürosessel mochte mit dem restlichen Mobiliar auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sein. Nicht jedoch jener unförmige, aus rohem Naturholz gefertigte Schreibtisch.
„Er schläft“, hauchte Charlotte mit Blick auf das andere Ende des Raumes, wo eine mit tiefviolettem Samt überzogene Chaiselongue stand. „Ich finde nicht, dass wir ihn aufwecken sollten. Ich glaube, das wäre ihm unangenehm.“
Josefine trat näher. Sie betrachtete Thiel. Das dunkle, leicht ins Rötliche changierende Haar, das sein blasses, fein geschnittenes Gesicht einrahmte. Die ungewöhnlich vollen Lippen. Seine Arme, die in schmale, gepflegte Hände mündeten, lagen locker neben seinem Körper. Seine Augen waren geschlossen. Ja, man hätte ihn leicht für einen Schlafenden halten können, wäre da nicht ein rostroter Fleck auf dem hellen Seidenhemd gewesen und der dem Tod unmittelbar auf den Fersen folgende widerwärtige Geruch.
4
Marius Hilzendegen schwang sich auf den Sattel seines hellgrünen Retrovelos. Das klassische Herren-Spazier-Fahrrad, ein Geschenk seines Lebensgefährten, ächzte unter dem Gewicht des großen, breitschultrigen Mittdreißigers. Zum Glück war es nicht so kalt. Zwölf Grad, schätzte er. Doch der Ostwind fuhr ihm eisig ins Gesicht und durch sein dichtes, weizenblondes Haar.
Der Kriminalhauptkommissar wollte nicht glauben, was ihm da gerade durchgegeben worden war. Es war mehr als unwahrscheinlich, dass sie es mit einem Mord zu tun bekämen. In der Kriminalstatistik nahmen sich die Straftaten gegen das Leben klein aus. Im letzten Jahr hatte sich die Polizei in Rheinland-Pfalz mit sechsundsiebzig Delikten befassen müssen, wobei es schon allein in vierzig Fällen bei einem Versuch geblieben war. Zog man von der verbleibenden Anzahl die Fälle von fahrlässiger Tötung, Tötung auf Verlangen und die strafbaren Schwangerschaftsabbrüche ab, so blieben ungefähr ein Dutzend. Ein Dutzend für das ganze Bundesland.
Er überquerte die Eichbornstraße und radelte an den schmalen Reihenhäusern entlang, die den Alten Messplatz nordwestlich begrenzten. Der Dynamo surrte. Ein breiter Lichtkegel lotste ihn durch den verhangenen Morgen und den schmalen Weg entlang, der sich zwischen Zoo und Gymnasium krümmte. Auf der Hindenburgstraße musste er kräftiger in die Pedale treten, um der Steigung zu trotzen. Rechter Hand bog er kurz darauf ins Fliegerviertel ein. So nannten die Landauer diesen Teil ihrer Stadt, weil die Straßennamen an berühmte Piloten erinnerten. Seine Hände waren schon ganz steif geworden und begannen wehzutun und auch die Ohren brannten vor Kälte.
Dass ein Streifenwagen mit blinkendem Blaulicht in der Einfahrt des besagten Anwesens stand, musste noch nichts heißen. Hilzendegen klammerte sich weiter an seine Hoffnung. Irgendjemand hatte bestimmt überreagiert und die Kollegen mussten ja erst einmal vor Ort die Lage checken. In einer halben Stunde wäre er wieder zu Hause und … Ein wüster Fluch entfuhr ihm, als er den dunkelblauen Kleinbus mit einer ihm wohlvertrauten Bacchus-Darstellung auf der anderen Straßenseite entdeckte. Josefine! Er sah seine Statistik schwanken.
Josefine Laux und ihr Mann Ralf betrieben ein kleines Weingut. Wie eine bunte Oase lag es in den weiten Rebflächen zwischen Rittersheim und Birkenfeld. Ralf war ein feiner Mensch. Er hatte seinem Liebsten damals sehr geholfen, als dieser von seinem tyrannischen Vater einen viel zu großen und hoffnungslos vergreisten Betrieb geerbt hatte. Ohne seine Hilfe, seine Rechenkünste und klugen Ratschläge hätte es Matti wahrscheinlich niemals über sich gebracht, das Weingut zu verkaufen, sich eine Teilzeitstelle als Winzer zu suchen und sich mit ganzer Seele dem zu widmen, wovon er schon als Kind geträumt hatte – der Musik. Auch Josefine war Hilzendegen an sich nicht unsympathisch. Doch sie hatte nun einmal das unselige Talent, überall, wo sie auftauchte, zufällig über Leichen zu stolpern. Sie könnte sich natürlich auch einmal geirrt haben. Ihre Fantasie könnte mit ihr durchgegangen sein. Oder ihre Freundin, Charlotte Messerschmidt, war wieder einmal in einen ihrer merkwürdig-zerstreuten Zustände abgeglitten. Das war ihr eine Zeit lang ziemlich häufig passiert. Was sie dann von sich gab, war mit diffus noch äußerst galant umschrieben. Andererseits konnte die Buchhändlerin auch sehr couragiert sein. Vor einigen Jahren hatte sie mithilfe der gesammelten Werke Shakespeares maßgeblich dazu beigetragen, einen Triebtäter dingfest zu machen.
Im Türrahmen des irgendwie grotesk anmutenden Gebäudes stand Paul Geiger und nickte ihm zu. Der Kommissar grüßte den Beamten in Uniform. Er schätzte den um einiges älteren Kollegen vor allem wegen seiner korrekten und unaufgeregten Art.
„Dann ist es also wahr?“
„Unnatürliche Todesursache durch Fremdeinwirkung. Dr. Hans-Peter Thiel. Hat hier gewohnt. Sie haben das Schild gelesen?“
„Da es so eindrucksvoll illuminiert ist, lässt es sich nur schwer übersehen.“
„Er hängt mit einem Bewegungsmelder zusammen.“
„Wer?“
„Der kleine Strahler, der das Schild beleuchtet.“
„Ah! Ich verstehe.“
„Die Tür war nicht verschlossen.“ Geiger deutete auf das Schließblech im Türrahmen. „Sehen Sie diesen Schnapper hier, wenn der umgelegt ist, kann jeder hinein. Man muss nur dagegendrücken.“
„Das ist ungewöhnlich.“