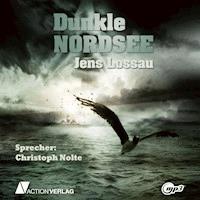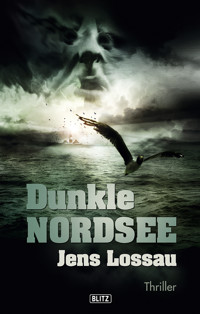
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Thriler, Krimi und Mystery
- Sprache: Deutsch
Bizarres Morden im Norden. Ein rätselhafter Serienmörder geht um. Grausam entstellte Leichen liegen an der Nordseeküste. Die beiden von der Kripo, die bisher ein ruhiges Leben führten, sind vollkommen überfordert. Doch als man den Fall abgeben möchte, kommt es zu weiteren Morden. Eine dunkle Vergangenheit wird lebendig. Ein abgründiges Sammelsurium liebevoll schräger Charaktere. So rau und authentisch wie der Norden selbst. Ein genialer, abgründiger Psychothriller voll überraschender Wendungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BÜCHER DIESER REIHE
DUNKLE NORDSEE
ALLGEMEINE REIHE
BUCH 3
JENS LOSSAU
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
© 2014 Blitz Verlag
Ein Unternehmen der SilberScore Beteiligungs GmbH
Mühlsteig 10 • A-6633 Biberwier
Redaktion: Jörg Kaegelmann
Umschlaggestaltung: Mark Freier, München
Illustration: Ralph G. Kretschmann
Alle Rechte vorbehalten
eBook Satz: Gero Reimer
www.BLITZ-Verlag.de
ISBN 978-3-95719-308-7
7003 vom 19.07.2024
INHALT
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Epilog
Über den Autor
PROLOG
21.07.1978
Das hier gehört nicht Ihnen!!!!!!!!
Und überhaupt, wie kommen Sie eigentlich dazu, das zu lesen? Das war nie für Sie bestimmt! Also verschwinden Sie! Glauben Sie mir, Sie wollen das nicht lesen! In Wirklichkeit suchen Sie etwas Spannendes, einen raffinierten Roman, eine clevere Geschichte mit Suspense und allem, was dazugehört. Das kann ich nicht bieten, nicht mal im Ansatz. Ich glaube, die wirklichen Autoren wissen, was sie machen. Sie führen einen Handwerkskoffer mit sich, in dem ihre Instrumente verstaut sind. Ich habe keine Ahnung, was ich da fabriziere. Irgendwer hat mal behauptet, ich sei talentiert. Czapsky, hieß es, warum schreibst du eigentlich nicht?
Saublöde Frage.
Aber der neue Psychologe ist nett. Ich will nicht so weit gehen und sagen, dass man ihm vertrauen kann (dieser Spezies kann man prinzipiell nicht vertrauen), aber ich glaube, dass er den Kram hier wirklich lesen könnte, ohne mich danach für total debil zu halten. Was also habe ich zu verlieren?
In einem Roman gibt es verbindende Elemente, einen Spannungsbogen und weiß der Kuckuck was sonst noch alles. Mit der Realität ist das so ein Problem, sie hält sich nicht ans Drehbuch. Ich kann nur hinschreiben, was in diesem Jahr passiert ist, damit ich selbst nicht die Übersicht verliere. Trotzdem – es gibt keinen Spannungsbogen und erst recht keine versteckte Moral im Subtext. Mir wird schon schlecht, wenn ich solche Begriffe hinschmiere.
Subtext, also wirklich! Das ist etwas für clevere Leute.
Andere Mannschaft.
Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt.
Das hier gehört nicht Ihnen!
KAPITELEINS
Sommer in Norden, von wo aus man mit der Fähre nach Norderney und Juist übersetzen kann. Norden. Vielleicht die einzige Stadt in der Region, wo einen die Ladenbesitzer noch mit Vornamen anreden.
Norden hat mit seinen Vororten rund fünfundzwanzigtausend Einwohner, und die bekanntesten Einrichtungen sind das Meerwasserschwimmbad und das Nationalparkzentrum an der Küste mit der Seehundaufzucht- und Forschungsstation. Norden, ruhig und verschwiegen. Die Ängste spült das Meer davon.
Manche Leute sagen, die Norder seien so grau und unsichtbar, weil hier das Wetter so schnell umschlägt. Im Sommer kann alles hell und strahlend sein, und dann, binnen weniger Minuten, regnet es plötzlich. Oder es regnet schon, und dann scheint auf einmal die Sonne. Die Wolken kommen immer von Südosten. Aber manchmal kommt auch die Sonne von dort. Alles kommt von Südosten – wie auch das Treibgut, das an den Norder Strand gespült wird.
Norden lebt von diesem Treibgut, das Busse scharenweise in die Stadt bringen. Im Winter ist Norden so gut wie ausgestorben, aber im Sommer kommen die Touristen und Kurgäste aus dem Süden, um die Stille zu suchen und nicht zu finden. Sie kommen, um Krabben und Matjes zu essen und am Strand unter dem blauen Himmel zu liegen und Fotos von Nordens Mühlen zu machen. Sie kommen, um abends kühles Bier auf der Terrasse des Norder Strandhotels oder in Grüppchen direkt am Strand zu trinken, verbotene Lagerfeuer zu machen und Bußgelder zu zahlen, wenn sie dabei erwischt werden und Gitarre spielen und falsch singen und sich besinnungslos kiffen, im leise rauschenden Wind der kühlen Nordsee. Touristen, die mit ihren Familien über die Stadt herfallen und nachmittags in kurzen Hosen lächelnd durch die Norder Altstadt walzen und nach historischen Kultstätten Ausschau halten und den Tag damit beenden, Tinnef in Nordens Souvenirläden zu kaufen, der auseinanderfällt, sobald man hundert Meter vom Laden entfernt ist. Sie kaufen Tassen, die mit Möwen, Leuchttürmen und Windmühlen bemalt sind (echte Handarbeit, made in Hongkong), und zerbrechen sie dann in ihren Koffern, im Hotel oder am Strand.
Im Sommer herrscht in Norden Hochbetrieb, das Strandgut kommt tonnenweise. Im Sommer ist Norden ein feuchtgrünes, idyllisches Biotop, voller Moos und Möwen. Das grüne Tor zum Meer. Im Sommer schleicht der Efeu über Nordens rote Backsteinhäuser, Efeu, der so dunkelgrün ist, dass er fast blau schimmert. Überall strotzen farbige Blüten aus den Gebüschen, rosa und gelb und blau und weiß.
Norden, eine der ältesten Städte Ostfrieslands, mit seinem kitschigen Melodrama der Alltäglichkeit.
Kein Ausschlag nach oben oder unten.
Kein Platz für die Dunkelheit.
KAPITELZWEI
21.07.1998
Das Norder Kreiskrankenhaus. Ein aus rotem Backstein bestehender Komplex, der wie eine Fabrik aus der Zeit der Industrialisierung aussieht, mit einem kreisrunden Vorplatz, wo eine merkwürdige moderne Stahlkonstruktion, die wohl Kunst darstellen soll, die Besucher empfängt.
„Auf geht’s.“ Paul Czapsky wischte sich die Schweißperlen von der Stirn und trank einen Schluck von seiner Capri-Sonne. „Schauen wir mal, was hier los ist. Wie hieß doch gleich der Arzt, der uns angerufen hat?“
Er wandte sich seinem Kollegen Patrick Tomek zu, der in leicht gebückter Haltung neben ihm stand. Wie immer trug Patrick eine schwarze Stoffhose und ein schwarzes T-Shirt. Er war groß, athletisch, hatte eine gesunde braune Hautfarbe und schwarzes Haar, das er zurückgekämmt hatte. Auf seiner Nase saß eine Sonnenbrille mit spiegelnden runden Gläsern. Er drehte sich um, sodass Paul sich in den Gläsern begutachten konnte.
Paul sah einen Mann Mitte dreißig in einem bunten Hawaiihemd und kurzen Hosen. Erste graue Strähnen hatten sich in seine braunen Haare verirrt. Sein Gesicht war rund und blass. Er hatte dreißig Pfund Übergewicht, die sich augenscheinlich auf seinen Hals und seine Leibesmitte verteilten.
„Perlmann“, sagte Patrick. „Doktor Rudi Perlmann.“ Er lächelte und boxte Paul gegen die Schulter. „Alles in Ordnung mit dir? Du siehst nervös aus.“
Paul wandte den Blick von seinem verzerrten Spiegelbild ab und zerknüllte die Getränkepackung. „Sommer und Krankenhaus, das passt einfach nicht zusammen.“
„Wird alles halb so schlimm werden“, versuchte Patrick ihn zu beruhigen. „Wir wissen ja noch gar nicht, was …“
„Wir wissen nichts!“ Paul blinzelte in die Sonne, die wie eine weiße Perle am Himmel stand. „Wollen wir eine Wette eingehen? Ich sage, unser Tag ist hinüber, noch bevor er angefangen hat.“
Wenige Minuten später berührten ihre staubigen Schuhe das graue Linoleum des Norder Krankenhauskorridors. Eine unangenehme Geruchsmischung aus Desinfektionsmitteln und Fäkalien schwebte durch die Gänge, wahrscheinlich die Geister der Verstorbenen. Die Wände waren mit der Farbe einer Leiche gestrichen. Es gab keine Bilder oder Pflanzen, nur einen verlassenen Rollstuhl und Plakate mit medizinischer Werbung: Stützverbände, Tabletten, Schmerzmittel, Antidepressiva …
… Heroin, einen Strick, einen schnellen Tod, dachte Paul und betastete seine schweißnasse Stirn. Früh am Morgen herrschten bereits Temperaturen von über dreißig Grad, die auch von den Toren des Betonkomplexes nicht abgehalten werden konnten.
„Ich muss erst noch aufs Klo“, sagte Patrick. „Ist wirklich dringend.“
„Wenn's sein muss.“
Patrick verschwand hinter der nächsten Biegung.
Paul betrachtete die Plakate an den Wänden, die jede Hoffnung raubten, als plötzlich ein kleiner Junge in einem gelben Schlafanzug mit Dinosaurieraufdrucken wie aus dem Nichts neben ihm auftauchte. Er hatte dünnes, blondes Haar und ein blasses Gesicht, in dem dunkle Augen groß hervorstanden.
„Sie sind ganz schön dick“, sagte der Junge und starrte Paul an.
„Ich werd verrückt! Wie kommst du denn darauf?“
„Sie sind ein Wal, aber das macht nichts.“
„Nein?“ Paul zog die Augenbrauen hoch. Er mochte Kinder, auch wenn sie neunmalklug waren.
„Dicke sterben nicht“, behauptete der Kleine.
„Ach? Wer sagt das?“
„Es ist so. Mein Papa ist dünn.“
„Oh. Wo ist denn dein Papa?“
„Bei den Dicken.“
Verdammt, das war kompliziert.
„Er wollte nicht zu den Dicken. Ich wollte das auch nicht.“
Paul verknotete die Finger ineinander. „Wie heißt du denn, mein Kleiner?“
„Paul“, sagte der Kleine.
„Hey, ich auch!“ Paul war entzückt. „Ein schöner Name, nicht wahr?“
Der Kleine ging nicht darauf ein. „Ich werde auch mal so extrem fett wie Sie“, sagte er.
„Das ist eine seltsame Idee, aber wenn du meinst. Abgesehen davon bin ich gar nicht so fett, ich kenne da ganz andere. Bist du hier auf der Kinderstation?“
„Meine Mutter ist auch bei den Dicken.“
„Na, so was. Und wo sind die Dicken?“
„Na, wer von uns ist denn hier dick?“
Ohne Pauls Antwort abzuwarten, drehte sich der Junge plötzlich um und rannte davon. Paul blickte ihm nach. Der Kleine sah krank aus, irgendwie verwirrt. Aber kleine Kinder wirkten eigentlich oft verwirrt, dachte er.
Patrick kam zurück. „Das war wirklich notwendig.“ Er zog sich den Reißverschluss am Hosenstall hoch. „Also, wenn man muss, dann muss man.“
„Hast du den Kleinen gesehen?“, fragte Paul. „Ist in deine Richtung gerannt.“
„Den Kleinen? Nein, hab ich nicht. Suchen wir lieber mal nach diesem Doktor Perlmann, wir haben unsere Zeit schließlich auch nicht geschissen.“
Als hätte er Patrick gehört, trat ein großer, älterer Herr am Ende des Flurs aus einer Tür und kam zügig auf sie zu. Er hatte weiße Haare, seine Augen waren gerötet, und seine Tränensäcke erinnerten an Pflaumen. Aus der Tasche des wehenden Kittels ragte ein Stethoskop. Seine Schritte hallten auf dem Linoleum wider.
„Gut, dass Sie da sind, meine Herren“, rief er im Näherkommen. „Ich bin Doktor Perlmann. Sie sind von der Polizei? Das ist gut. Bei uns ist eingebrochen worden.“
Paul nickte. „Das wurde uns mitgeteilt. Ich bin Paul Czapsky, das ist mein Kollege Patrick Tomek.“ Er betrachtete den Arzt. „Sie sehen müde aus, Doktor Perlmann.“
„Ja, das bin ich in der Tat.“
„Nachtdienst?“
„So ist es.“
„Viel los?“
„Fünf Herzstillstände.“
„Fünf? Ich werd verrückt. Ganze Menge, was?“
„Bei Herzstillstand lautet die erste Regel: zunächst den eigenen Puls fühlen.“
„Haben Sie jetzt Dienstschluss?“
„In der Tat.“
„Nun, dann werden wir diese Sache möglichst schnell abwickeln. Bei Ihnen ist also eingebrochen worden? Ich hoffe, nicht in der Pathologie.“ Paul lachte, versuchte, Doktor Perlmanns Vertrauen zu gewinnen. Doktor Perlmann lachte nicht. „Doktor Perlmann, sagen Sie jetzt nicht, dass jemand in die Pathologie eingedrungen ist und Leichenteile mitgenommen hat!“
Doktor Perlmann rieb sich die geschwollenen Augen und sagte: „Ungefähr das ist passiert.“
KAPITELDREI
Paul fand, dass Perlmann ein Typ war, auf den die Bezeichnung vielleicht passte. Vielleicht war er ein netter Mensch, vielleicht ein pathologischer Neurotiker. Vielleicht war sein Händedruck warm, vielleicht war er zu trocken. Vielleicht hatte er einen leichten bayrischen Akzent, vielleicht rollte er auch einfach nur das R.
Paul und Patrick folgten dem Arzt, der vielleicht müde war, vielleicht aber auch zu viele Aufputschmittel während seines Nachtdienstes geschluckt hatte, über die Krankenhausflure, wobei sich Paul mit jedem Schritt beklommener fühlte. Auf ihrem Weg begegneten sie keiner Menschenseele.
Pauls Krankenhausassoziationen waren ausschließlich negativer Natur. Ins Krankenhaus ging man, um zu verfallen. Im Krankenhaus roch es schlecht. Ins Krankenhaus kamen Menschen mit Viren, Bazillen, Geschwüren und anderen Dingen, die ihren Körper zerstörten. Im Krankenhaus wurden Körperteile abgeschnitten. Im Krankenhaus nahm man Abschied von den Menschen, die der Verfall besiegt und entstellt hatte. Im Krankenhaus wurden Leute auseinandergeschnitten. Im Krankenhaus verlor man.
Unmittelbar vor der Leichenhalle stand ein Automat mit Süßigkeiten für das Krankenhauspersonal. Es war wie ein schlechter Witz: schnell noch einen Keksriegel, dann die bunkerartige Metalltür geöffnet und hinein ins Vergnügen zu den stählernen Wannen. Hallo, liebe Zangen, Haken und Knochensägen!
Perlmann steckte einen Schlüssel in das Schloss der Prosekturtür und drehte ihn herum. Kalte Luft floss aus dem sich öffnenden Raum in den Korridor. Auf Pauls Armen bildete sich eine Gänsehaut.
„Nettes Hemd, das Sie da tragen“, wandte sich Perlmann an ihn, vielleicht beruhigend, vielleicht sarkastisch.
„Es ist mein Glückshemd.“ Paul zwang sich zu einem Lächeln. „Stammt noch aus meiner Im the walrus-Zeit.“
„Interessant.“ Doktor Perlmann lächelte, vielleicht aufmunternd, vielleicht diabolisch, und betrat die Leichenhalle.
Der Raum war weiß gekachelt. Die rechte Seite wurde von einem großen Stahlschrank mit sechs Fächern eingenommen. Am anderen Ende war neben einer weiteren Bunkertür ein Waschbecken in die Wand eingelassen. Zwei Birkenfeigen aus Plastik sowie ein schlichtes Holzkreuz füllten den linken Bereich aus. Daneben warteten zwei Stahlwannen mit Rädern auf Kundschaft. Die nebelhafte Eiseskälte schmeckte nach Toilettenreiniger.
„Sieht doch alles normal aus“, sagte Patrick. „Dachte, hier hätte einer gewütet, aber …“
„In dem Raum hinter dieser Tür da“, sagte Doktor Perlmann, vielleicht gelangweilt, vielleicht nervös, und deutete mit dem Zeigefinger auf die zweite Bunkertür, „bewahren wir für die Universität diverse Exponate auf: amputierte Extremitäten, Gallenblasen, Därme et cetera et cetera.“
Paul spürte, wie er auf die Größe eines Gartenzwerges schrumpfte.
„Haut, Gehirne, Knochengewebe, Gesichter …“
„Wie bitte?“, fragte Patrick. „Haben Sie eben Gesichter gesagt, Doktor?“
„Sicher. Verstehen Sie, für einen angehenden Medizinstudenten ist es notwendig, alles über die menschliche Anatomie zu lernen. Und wie gelangt er zu diesem notwendigen Wissen?“
„Lehrbücher“, krächzte Paul.
„Er lernt an den organischen Objekten.“ Doktor Perlmann blickte zu den Leichenkästen, holte einen Inhalator aus der Tasche seines Kittels und gab sich einen Schuss.
„Und aus diesem Raum sind Objekte verschwunden“, stellte Patrick fest. Paul klammerte sich an sein Hawaiihemd, um nicht vornüber zu kippen.
„So ist es. Die Objekte sind aus dem Raum dahinten verschwunden. Wir nennen ihn unser Gruselkabinett.“
Wie ein blasses Gespenst im Arztkittel schwebte Perlmann durch die Prosektur, schloss die Bunkertür auf und winkte wie ein Platzanweiser im Theater. „Kommen Sie, meine Herren. Bitte, kommen Sie.“
Der Raum, der sich vor ihnen auftat, war bis unter die Decke angefüllt mit Regalen, auf denen Dutzende von Gläsern standen, in denen Organisches lagerte. Es gab blaue Müllsäcke, die mit Karteikärtchen versehen waren, und große Kolben mit gelben, wurmartigen Gebilden, die in einer trüben Flüssigkeit schwammen. Paul entdeckte ein Behältnis mit einem in der Mitte zerteilten Gehirn. Er sah Herzen und eine gehäutete Hand. In einem Glas schwammen einige Dutzend Augen, die hier aufbewahrt wurden wie Murmeln von kleinen Jungs.
„Wir haben erst gar nicht bemerkt, dass hier etwas fehlt“, berichtete Doktor Perlmann, vielleicht glücklich, vielleicht traurig, vielleicht jenseits von allem. „Das Schloss war nicht beschädigt, und es kommt öfter vor, dass ein Professor für eine Vorlesung etwas … wie soll ich sagen … mopst.“
„Mopst?“, rief Paul.
„Nun, Professor Ernestin wollte heute Morgen auch etwas mopsen. Er unterrichtet an der Uni. Und da die dort keine Gesichter haben, kam er in aller Früh hierher, um ein Gesicht zu mopsen.“
„Kann man denn hier einfach so Gesichter mopsen?“, fragte Patrick. „Ich meine, es gibt doch gewiss Formulare, die man vorher ausfüllen muss.“
„Oh, sicher gibt es die.“ Doktor Perlmann lächelte, vielleicht verächtlich, vielleicht über die Naivität des Polizisten staunend. „Daran halten wir uns auch, das kann ich Ihnen versichern. Man muss ein Formular ausfüllen, in der Tat.“
„Ich finde es schon seltsam“, sagte Paul. „Ich meine, das hier ist doch keine Universitätsklinik. Warum werden hier überhaupt Körperteile aufbewahrt? Warum nicht gleich an der Universität?“
„Das ist eine Frage der Kapazität. An der Uni lagern Tausende von anatomischen Präparaten, das stimmt schon. Aber die Räumlichkeiten sind erschöpft. Sehen Sie, die meisten Ärzte und Professoren verkehren hier regelmäßig. Das hier ist ein angesehenes Krankenhaus. Unser kleines Gruselkabinett ist eine Gefälligkeit an die Obrigkeit. Wir sorgen für Übersicht.“
„Es ist grotesk.“
„Das mag für Sie vielleicht so aussehen, aber es ist effektiv. Wir haben jemanden, der sich um die Präparate kümmert, sie hegt, pflegt und katalogisiert.“
„Und wer ist dieser jemand?“, fragte Paul.
Doktor Perlmann sah ihn mit großen Augen an, vielleicht verwundert, vielleicht verunsichert. „Ich natürlich.“
„Sind Sie auch an der Uni beschäftigt?“
„Nein, aber ich unterrichte die Auszubildenden der Krankenpflege in Anatomie.“
„Benutzen Sie dabei die Präparate?“
„In der Tat.“
„Wie werden sie transportiert?“
„In mit Alkohol gefüllten Behältnissen.“
„Werden alle Präparate auf diese Weise konserviert?“
„In der Tat.“
„Das heißt, man müsste sie eigentlich gar nicht in einem Kühlraum lagern.“
„Nein, eigentlich nicht. Aber doppelt gemoppelt hält besser. Es ist eben eine Tradition, verstehen Sie? Hier werden für ein Kleinstadtkrankenhaus recht viele chirurgische Eingriffe vorgenommen und …“
„Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen, Doktor Perlmann – es ist sonderbar.“
„Hören Sie, meine Herren …“ Perlmanns Gesicht zog sich in die Länge und simulierte eine verstörende Mischung aus Wut und Resignation. „Es mag Ihnen sonderbar vorkommen oder nicht, aber finden Sie sich einfach damit ab, dass es diesen Raum gibt. Deshalb sind Sie nicht gerufen worden.“
„Nun gut.“ Paul betrachtete die Gläser. „Schön. Heute Morgen wollte also dieser Professor Ernestin ein Gesicht … mopsen … und es war keines da, richtig?“
„Wir bewahren hier ein halbes Dutzend Gesichter auf. Es kommt schon mal vor, dass sich ein Kollege ein Gesicht mopst und vergisst, das auf dem entsprechenden Formular zu quittieren. Aber heute Morgen waren alle sechs Gesichter verschwunden.“
„Da hat das Krankenhaus also sozusagen sein Gesicht verloren“, sagte Paul. „Haben Sie sich erkundigt, ob eventuell jemand anderes die Gesichter gemopst hat?“
„Natürlich. Aber ich versichere Ihnen, niemand …“
Ein heiseres Röcheln erklang aus der linken Ecke des Raumes. Paul zuckte zusammen und drehte sich in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war.
Neben einem Regal, auf dem sich ungefähr zwei Dutzend Gläser aufeinandertürmten, saß, halb durch einen blauen Plastiksack verdeckt, ein alter Mann, dessen Augen aus ihren Höhlen quollen, sodass Paul einen schlimmen Moment lang befürchtete, sie würden gleich herausspringen und über seine bebenden, unrasierten Wangen kullern. Die weißen Haare des Mannes waren an den Schädel geklatscht, die Hände hielt er wie zum Gebet über ein rot kariertes Hemd verschränkt.
„Bernhard?“, stieß Perlmann hervor. „Bernhard, was …?“
Patrick trat einen Schritt vor. „Wer ist das?“
„Das … das ist Bernhard Kopper, unser technischer Hausmeister, aber …“
„War er heute Morgen schon hier?“
„Ich habe ihn jedenfalls nicht gesehen.“
„Was ist denn mit ihm passiert? Er sieht ja total verängstigt aus.“
Paul ging vor Bernhard, der sich hinter dem blauen Sack zu verstecken versuchte, in die Hocke. „Bernhard“, sagte er, so sanft es ihm in seiner Verwirrung möglich war. „Bernhard, was ist passiert? Was machen Sie hier? Kommen Sie, ich helfe Ihnen.“
„Die Gesichter!“ Bernhards Stimme war hell und brüchig, wie die eines Todkranken. Die Worte tropften von seinen aufgesprungenen Lippen wie halb geronnenes Blut. „Die Gesichter …“
„Was ist mit den Gesichtern, Bernhard?“
Bernhards Mund öffnete und schloss sich wie bei einem Fisch. „Die Gesichter … da war etwas … und hat sie genommen!“ Er legte den Kopf zurück und starrte zu den grellen Neonröhren an der Decke. „Da war etwas … und hat sie gegessen“, flüsterte er und begann zu weinen.
KAPITELVIER
Paul und Patrick saßen in Perlmanns Arbeitszimmer, das in klinischem Weiß gehalten und zweckmäßig eingerichtet war. Es gab eine harte, braune Pritsche, über der sich durchsichtige Behälter mit Spritzen befanden. Am Fenster stand ein Skelett und grinste in den schwülen Juli hinaus.
Patrick holte aus seiner Hosentasche ein kleines Diktiergerät, drückte die Aufnahmetaste und stellte es auf den Tisch. Der Arzt sah nicht gerade taufrisch aus, wie er in seinem weißen Kittel hinter dem unaufgeräumten Schreibtisch kauerte und sich unentwegt durch die Haare fuhr. Er öffnete eine Schublade und zauberte zwei Pillen hervor, die er sich wie Fruchtgummi in den Mund warf.
„Was war das denn?“, fragte Patrick.
„Zum Wachbleiben“, sagte Perlmann. „Und es geht Sie auch gar nichts an.“ Er blickte zu dem Diktiergerät, als handle es sich um eine Bombe, die gleich explodieren könnte. „Was soll das? Muss ich jetzt singen?“ Er mühte sich ein zerknittertes Grinsen ab.
„Wir lachen etwas später.“ Paul lehnte sich nach vorne. „Jetzt aber mal was Ernstes: Was ist mit Bernhard?“
Perlmann holte den Inhalator aus seinem Arztkittel. „Was weiß ich. Bernhard ist unser Hausmeister und gleichzeitig eine Art Nachtwächter. Er gehört quasi zum Inventar des Hauses. Um Mitternacht kontrolliert er die Heizung, ansonsten sitzt er am Empfang und flirtet mit der diensthabenden Schwester. Er ist sechsundfünfzig Jahre alt, Diabetiker, nicht sehr gesprächig. Und außerdem kann ich es nur noch mal betonen: Wir sind alle hier genauso verwirrt wie Sie! Heute Morgen fehlten unsere anatomischen Gesichtspräparate. Kein Arzt kam, um sie …“
„… zu mopsen“, sagte Paul.
„… zu entleihen!“, fuhr Perlmann fort. „Der Zweitschlüssel am Empfang wurde entwendet, als der Nachtdienst Kaffee trinken war. Jemand Unbefugtes ist in die Prosektur eingedrungen und wurde wahrscheinlich von Bernhard überrascht. Wie wir bisher feststellen konnten, hat man ihm mit einem stumpfen Gegenstand auf den Hinterkopf geschlagen. Das ist alles.“
„Ist das Krankenhaus nachts abgeschlossen?“, fragte Patrick.
„Um dreiundzwanzig Uhr werden die Hauptportale geschlossen, aber man kann noch durch die Notaufnahme rein. Allerdings wird man dabei von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.“
„Und die Kamera war in Betrieb?“
„Selbstverständlich war sie in Betrieb! Wir haben das Band durchlaufen lassen. Es gab ein paar Notfälle, sonst nichts.“
„Kann man das Krankenhaus in der Nacht verlassen?“
„Das hier ist kein Gefängnis, meine Herren. Natürlich kann man hinaus, wenn einem danach ist, auch wenn die Hauptportale abgeschlossen sind. Durch die Notaufnahme oder jedes x-beliebige Fenster im Erdgeschoss.“
„Fehlt ein Patient?“
„Nein, wir sind vollzählig. Zwei Todesfälle in der Nacht.“ Perlmann versuchte, grimmig dreinzublicken. „Von denen hatte keiner ein Gesicht bei sich.“
„Können wir mit Bernhard sprechen?“
„Körperlich fehlt ihm nicht viel. Eine leichte Gehirnerschütterung und Unterkühlung. Nichts Gefährliches, wenn er keine Pneumonie bekommt. Aber er steht unter Schock und ist demnach nicht vernehmungsfähig. Er schläft.“
Die Tür ging auf, und ein elegant gekleideter Herr mit grauem Vollbart und Halbglatze betrat das Zimmer. In der Brusttasche seines Jacketts steckte eine künstliche Rosenblüte.
„Doktor Perlmann hat jetzt keine Zeit für Sie“, meinte Patrick, doch der Arzt sprang auf und lief um seinen Schreibtisch herum. „Doktor Mertens! Die Herren sind von der Polizei, in der Tat.“
Mertens schenkte Paul und Patrick ein apokalyptisches Grinsen. „Ah ja, sehr gut. Die Polizei. Aber ich bitte Sie, behalten Sie doch Platz. Gestatten Sie: Doktor Alfons Mertens. Ich bin der Chefarzt des Krankenhauses.“
„Czapsky, Kriminalpolizei. Das ist mein Kollege Tomek. Wie geht es Ihnen?“
Mertens’ Gesicht nahm einen betrübten Ausdruck an. „Nun, meine Herren, nach den nächtlichen Ereignissen nicht sonderlich gut. Was für ein Skandal!“
„In der Tat, ein echter Skandal!“, rief Doktor Perlmann. „Was will denn jemand mit anatomischen Gesichtspräparaten?“
„Unsere Leute werden nach Fingerabdrücken suchen“, sagte Patrick. „Aber ich glaube kaum, dass uns das weiterbringen wird. Wir müssten eigentlich das gesamte Krankenhaus umkrempeln. Vielleicht hat ja ein Patient die Gesichter gemopst und bewahrt sie in seinem Zimmer auf? Wie auch immer. Wenn Sie die Gesichter finden oder dieser Nachtwächter wieder zur Besinnung kommt, geben Sie uns bitte Bescheid.“
„Ja, das wär’s dann.“ Paul schob sich Patricks Diktiergerät in die Tasche. „Einen schönen Tag noch.“
„Aber … wollen Sie denn gar nichts unternehmen?“ Mertens sah zu gleichen Teilen schockiert und empört aus.
„Sagen Sie mir, was wir unternehmen sollen, dann tun wir’s.“
Mertens blickte die beiden verwirrt an, während sich Perlmann an zwei Tabletten gütlich tat, die er aus den Tiefen seines Arztkittels zauberte.
„Hören Sie, ich weiß, dass das keine angenehme Sache für Sie ist“, sagte Paul. „Wir werden die Patienten befragen, vielleicht hat jemand etwas gehört oder gesehen. Geben Sie uns eine Liste des Nachtpersonals, wir werden alle interviewen. Wir gehen davon aus, dass sich der Täter bereits vor dem Schließen des Hauptportals im Krankenhaus befand, die Gesichter entwendete und dann durch ein Fenster oder so das Weite suchte. Wir schlendern jetzt durch die Flure und quatschen ein bisschen mit Ihren Patienten, Doktor Mertens, wenn es Ihnen recht ist.“
KAPITELFÜNF
Sie durchsuchten das Krankenhaus, eine Aktion, die den gesamten Nachmittag in Anspruch nahm, obwohl bei dem Einsatz fünf Polizeibeamte mithalfen, die Brecker, ihr Boss, ihnen geschickt hatte. Sie interviewten sämtliche Patienten und hörten sich ihre persönlichen Leidensgeschichten an. Ein alter, schizophrener Mann, dem beide Beine abgesägt worden waren, erklärte, er sei Jesus Christus.
Sie kamen zu keinem Ergebnis. Jemand hatte Gesichter gemopst, und die würden wahrscheinlich nie wieder auftauchen.
Kurz nach fünf verließen Paul und Patrick müde das Gebäude und stiegen in Patricks fliegengrünen Renault, der sich auf dem Krankenhausparkplatz aufgeheizt hatte.
„Was hältst du von Perlmann?“, fragte Patrick, als er den Wagen über die Straßen lenkte, die von der tief stehenden Sonne in einen goldenen Schimmer getaucht wurden.
Paul fühlte sich nicht besonders, sein Magen bereitete ihm Schwierigkeiten. Psychosomatische Reaktion.
„Paul?“
„Entschuldige, ich war gerade woanders. Was hast du gesagt?“
„Doktor Perlmann. Was hältst du von ihm?“
„Keine Ahnung. Schwer einzuschätzen. Zugeknöpft. Hat Angst vor einem Skandal. Hat nicht alles erzählt. Seltsame Sitte, das mit dem Mopsen. Ich glaube übrigens, dass er auf Tabletten ist.“
„Du magst Krankenhäuser nicht, was?“
„Nein, nicht besonders.“ Er hasste Krankenhäuser. Und die Nummer mit den Gesichtern hatte ihn mehr mitgenommen, als er zugeben mochte.
„Was glaubst du, wie geht’s jetzt weiter?“
Paul grunzte durch die Nase. „Wir fahren zu mir nach Hause, spielen Tischtennis, und du wirst wie immer gewinnen.“
„Ich meine mit diesem Fall.“
Paul zuckte die Achseln. „Keine Ahnung. Wir schreiben unsere Berichte. Man wird die Gesichter finden, oder man wird sie nicht finden, aus, fertig. Morgen besuchen wir diesen Bernhard, dann wissen wir vielleicht mehr.“
Patrick bog in das Viertel ein, in dem sich Pauls Haus befand.
KAPITELSECHS
Große Bäume und Hecken, die rosa, gelb und blau blühten und in denen Hunderte von Insekten summten, beschützten das rote Backsteinanwesen der Czapskys. Einen Moment lang blieb Paul in der Kieseinfahrt stehen und ließ sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Er atmete tief ein, sodass er die nahe Nordsee riechen konnte.
Die Eingangstür öffnete sich, und Viola erschien auf der Schwelle. Sie trug blendend weiße Shorts und ein mintgrünes T-Shirt, auf dem eine Tarantel abgebildet war. Ihr schulterlanges, rotes Haar glitzerte in der Sonne.
„Hey, Jungs!“, rief sie. „Da seid ihr ja endlich!“
Paul breitete die Arme aus und stolzierte auf Viola zu. „Krieg’ ich keinen Kuss?“ Er rollte die Lippen zum O. Viola drehte sich zur Seite, und Paul presste seine Lippen auf den lachenden Mund seiner Frau.
„Du hast heute überhaupt nicht angerufen“, sagte sie. „Hier war der Teufel los.“ Sie wandte sich an Tomek. „Tag, Patrick, wie geht’s dir? Seid ihr den ganzen Tag unterwegs gewesen?“
„Komische Geschichte“, sagte Patrick und nickte. „Diebstahl im Krankenhaus.“
„Diebstahl? Was denn für einen Diebstahl?“
„Du wirst es nicht glauben, Viola, aber jemand hat anatomische Präparate entwendet. Makaber.“
„Ach du große Güte! Ist etwa eine Leiche gestohlen worden?“
„Nein, keine Leiche“, sagte Paul. „Nur Teile sozusagen. Gesichter.“
„Gesichter?“
„Ja. In Alkohol konservierte Gesichter zu chirurgischen Lehrzwecken. Frag mich nicht, ich wusste auch nicht, dass hier so etwas aufbewahrt wird. Wahrscheinlich keine große Sache. War aber zeitaufreibend. Ist nicht so wichtig.“ Die Sache mit Bernhard ließ er unter den Tisch fallen. „Was machen die Kleinen? Patrick ist schon ganz wild auf sie. Vielleicht will er auch noch ’ne Runde mit ihnen in den Swimmingpool.“
Viola fuhr Paul durchs Haar. Ihr Geruch stieg ihm in die Nase. Lavendel und irgendein unbekanntes, mildes Gewürz.
„Wie gesagt, hier war die Hölle los, Schatz. Wegen Bert. Er ist auf Kafka getreten.“
Paul schloss die Augen. „Verdammt! Ist er verletzt?“
„Er ist tot, Paul. Wir haben ihn von Berts Füßen gekratzt und hinten im Garten beerdigt. Bert ist barfuß in ihn hineingelatscht! Schlimme Sache.“
Paul biss sich auf die Unterlippe. „Scheußlich. Hat er gelitten?“
„Kafka? Nein, er war sofort hinüber. Ich glaube, er starb mit einem Lächeln auf den Lippen.“
„Wer zum Teufel ist Kafka?“, wollte Patrick wissen. „Etwa einer von denen?“ Er deutete auf Violas T-Shirt.
„Kafka ist – oder vielmehr war – ein Vogelspinnenmännchen“, erklärte sie. „Avicularia versicolor. Er ist heute Morgen aus seinem Terrarium gekrabbelt, zusammen mit Brecht und Thomas Mann.“
„Ich hoffe, du hast Brecht und Thomas Mann finden können“, sagte Paul. „Nicht, dass sie heute Nacht aus Versehen zu uns ins Bett kommen.“
„Brecht war in der Küche, er hat sich mit Gilmour angelegt, aber ich konnte ihn retten. Von Thomas Mann fehlt bisher jede Spur. Und Kafka … Bert wollte Limonade holen und schwupps – hatte er ihn an den Füßen kleben. Er ist total ausgerastet.“
„Er ist doch nicht etwa gebissen worden?“
„Kafka hatte keine Chance. Bert war so vernünftig und ist sofort kreischend in den Swimmingpool gesprungen. Danach war er ein bisschen hysterisch und wollte nicht mehr herauskommen.“
„Bert mag deine Spinnen nicht. Kann man ihm das verdenken?“
„Diese Spinnen sind mein Job. Ich muss mich um sie kümmern. Die Tiere brauchen Ruhe und Entspannung.“
Paul prustete. „Gut, dass du nicht gesagt hast, sie wären deine Familie. Wie geht’s ihm jetzt?“
Viola winkte ab. „Wie Kinder so sind. Alles längst vergessen.“
Viola war Entomologin. Sie hatte Paul mit fünfundzwanzig Jahren in der Universität kennengelernt, an der er zwei Semester lang versucht hatte, Germanistik zu studieren. Ein Unterfangen, das böse in die Hose gegangen war. Er hatte die Geisteswissenschaft wieder aufgegeben und war zur Polizei übergewechselt, kurz nachdem er und Viola geheiratet hatten. Viola hatte ihr Entomologiestudium mit dem Schwerpunkt Arachnologie abgeschlossen und sich der Forschung verschrieben. Dreißig Terrarien befanden sich im Keller ihres Hauses.
Paul litt nicht unbedingt an Spinnenphobie, aber er konnte die Biester auf den Tod nicht ausstehen. Er hasste es, wenn sie aus ihren Terrarien flohen, um fröhlich durch die Küche und ins Schlafzimmer zu marschieren. Seine fünfjährige Tochter Madeleine schien keine Probleme mit den Viechern zu haben, aber Paul machte sich um seinen Sohn Bert Sorgen. Als Zweijähriger war Bert von einer monströsen Vogelspinne überfallen worden, und seitdem waren er und Paul ein wenig traumatisiert. Niemals würde Paul dieses widerliche Bild vergessen – Bert weinend in seinem Bett, die fette, haarige Vogelspinne mitten in seinem Gesicht.
Bert und Madeleine kamen, mit riesigen Wasserpistolen bewaffnet, um die Ecke gestürmt und fingen an, wild um sich zu schießen, sodass Paul und Patrick entzückt losbrüllten. Madeleine sprang an Patrick hoch, der sie unter den Achseln packte und in die Höhe warf.
„Patrick!“, rief sie. „Kafka ist tot!“ Und sie lachte, wie nur ein Kind an so einem warmen Juliabend lachen konnte. Vom Nachbargrundstück der Asmussens wehte der Geruch frisch gegrillten Fleisches herüber.
„Hey, Bert!“ Paul schnappte sich seinen zehnjährigen Sohn, der ihn nass zu spritzen versuchte. „Alles klar bei dir?“
Bert presste seine Pistole gegen Pauls Bauch und drückte ab.
„Nicht!“ Paul begann zu lachen. „Aufhören, das kitzelt do-ho-hoch …“
Nichts deutete daraufhin, dass diese Sommerabende jemals anders sein könnten.
KAPITELSIEBEN
Bert drückte sich seinen Teddybären an die Wange und kuschelte sich in seine Decke. Paul setzte sich neben ihn ans Bett und streichelte ihm über das blonde Haar.
„Ich hab gegen Patrick gewonnen“, eröffnete Paul nicht ohne Stolz. „Beim Tischtennis. Es war nicht mal knapp.“
Glatt gelogen, aber egal. Bert lachte, aber etwas Trauriges lag in seinen dunkelbraunen Augen.
„Alles in Ordnung?“, fragte Paul.
„Ja. Es ist nichts.“
„Wirklich nicht? Macht dir was zu schaffen?“
Bert war ein intelligenter Junge, er schien sofort zu kapieren, worauf Paul hinauswollte. „Du meinst wegen Kafka.“ Er drehte sich auf die Seite und starrte an die Wand. „Ich bin auf ihn draufgetreten. Mutti war sauer.“
„Ich glaube nicht, dass Mutti sauer war. Sie hat sich nur Sorgen um dich gemacht, das ist alles. Na ja, sie hat Kafka gemocht.“
„Sie mag ihre Spinnen lieber als uns.“
„Hey, nein, nein. Die Spinnen sind ihr Job. Die Tiere brauchen Ruhe und Entspannung.“
„Aber wir sind doch auch ihr Job.“
„Nein, sind wir nicht. Sie hat uns lieb. Sie ist da, weil sie uns lieb hat und wir sie.“
„Thomas Mann läuft noch im Haus herum.“
„Keine Sorge, wir haben ihn gefunden.“ Das war zwar ebenfalls gelogen, aber Paul wollte Bert beruhigen.
„Wie kommen die Spinnen eigentlich die Treppe aus dem Keller hoch, Papa?“
Paul zuckte die Achseln. „Keine Ahnung. Sie klettern, denke ich.“
„Können wir die Spinnen nicht in die Garage bringen? Ich find’s nicht gut, dass sie im Haus sind.“
„Ich find das, ehrlich gesagt, auch nicht so gut. Ich rede mal mit Mutti, vielleicht können wir ja den Wintergarten umbauen oder so.“
„Ich mag Spinnen nicht.“
„Ich auch nicht.“
„Ich hasse alle Spinnen dieser Welt!“
„Ich …“ Paul schloss den Mund und kraulte seinen Sohn im Nacken. „Schlaf jetzt, okay?“, sagte er. „Soll ich dir noch was vorlesen?“
„Harry Potter!“
„Okay.“ Verdammt! Schon wieder!
„Ich hab das Buch nicht. Ich hab’s dem Christian geliehen.“
„Oh. Na ja, dann …“
Sie lasen abwechselnd eine halbe Stunde lang aus den Drei Fragezeichen. Während die helle Stimme seines Sohnes das Zimmer erfüllte, wäre Paul fast auf seinem Stuhl eingeschlafen, aber als er zu dösen begann, schreckte er plötzlich auf.
Eine zweite Stimme lauerte zwischen seinen Schläfen. Eine Stimme, die flüsterte: „Die Gesichter … Da war etwas und hat sie gegessen.“
KAPITELACHT
Er rieb sich die Augen, doch das Krachen zwischen seinen Schläfen wurde immer schlimmer. Er fuhr sich mit den Fingern übers Gesicht und betrachtete den Schwarz-Weiß-Film hinter seinen Lidern.
Er wollte, dass die Männer weggingen. Die Männer trugen schwere, schwarze Uniformen, stampften durch die Wohnung und fegten das Porzellan von der Anrichte, sodass es auf dem Boden zersplitterte.
Die Männer hatten sie in den Keller gesperrt, ein schwarzes Loch voller Kohle und alter Ölfässer. Papa hatte ihn vor Jahren mal hierhergeschickt, um etwas zu holen, aber er hatte geweint. Papa war daraufhin selbst in den Keller gegangen. Er zwang ihn nicht zu Dingen, vor denen er sich fürchtete.
Er hatte Angst vor den Männern, obwohl er das eingekreiste Zeichen auf ihren Ärmeln toll fand. Er hatte mal eine Armbinde mit diesem Symbol in den Trümmern der Straßen gefunden und mit nach Hause gebracht, woraufhin Papa ihn verhauen hatte. „Weißt du nicht, was das ist?“, hatte er geschrien. „Weißt du gar nichts?“
Wahrscheinlich wusste er gar nichts. Er war fünf Jahre alt gewesen.
Mutti saß auf einem der Kohlehaufen und hielt das Gesicht in den Händen verborgen, sodass ihr das schwarze Haar in die Augen fiel. Sie weinte und schimpfte mit Papa.
„Du machst dem Jungen Angst“, sagte Papa. „Mach ihm doch nicht noch mehr Angst.“