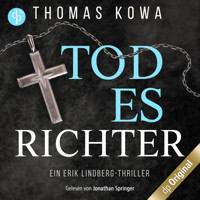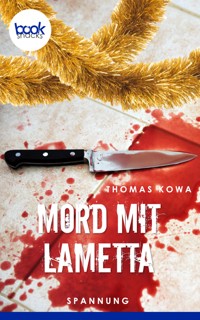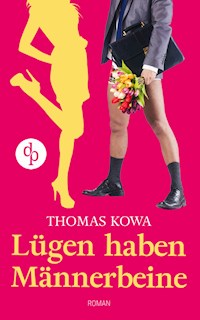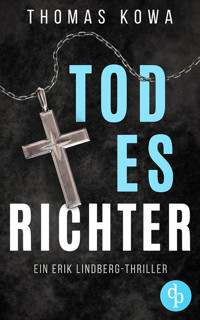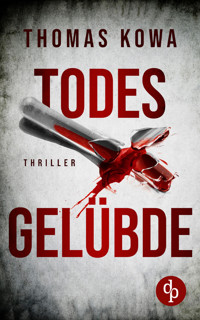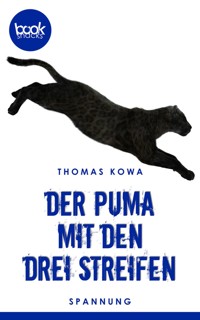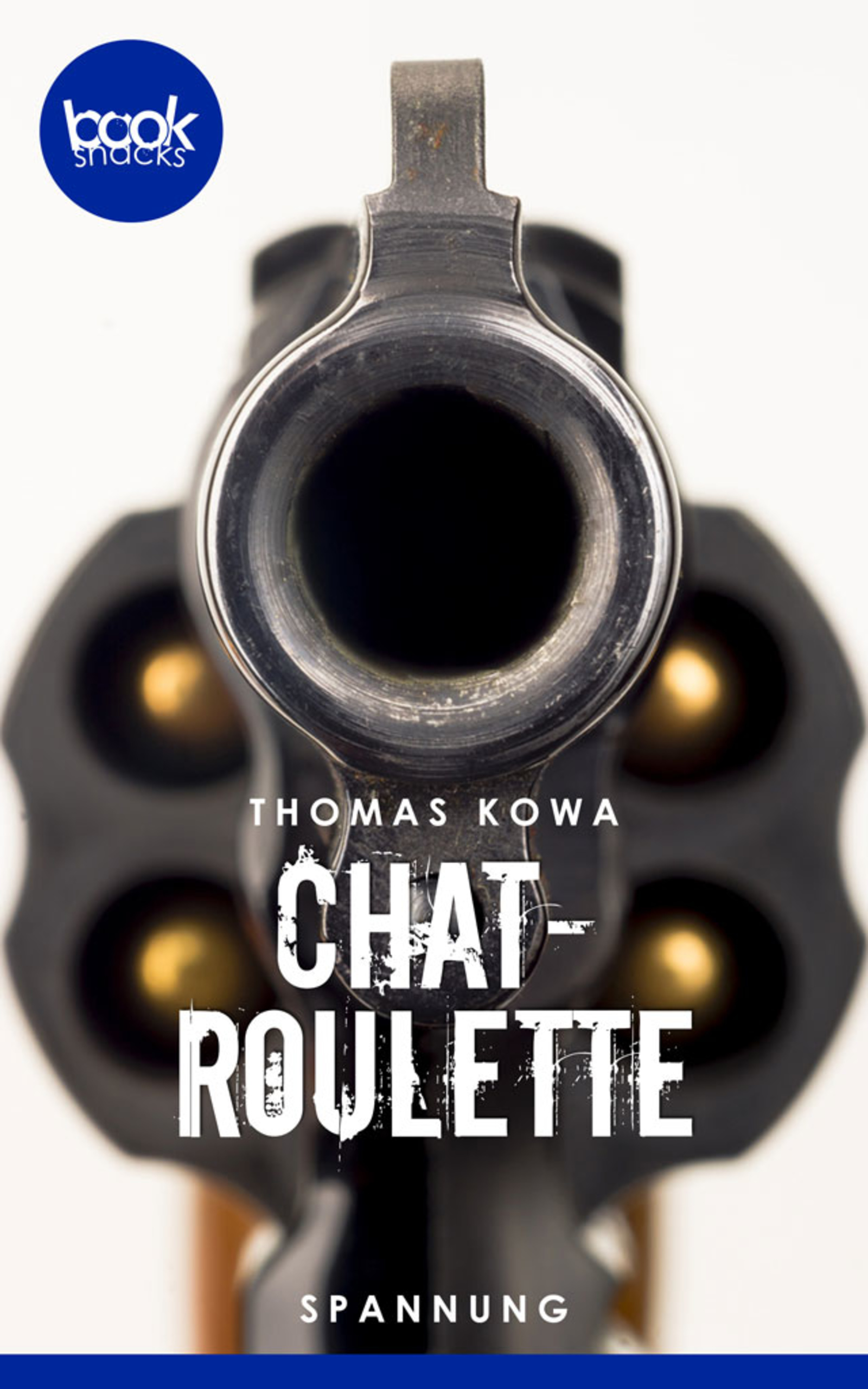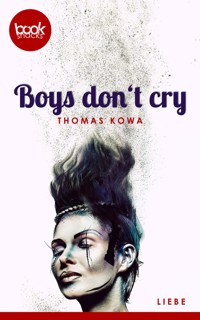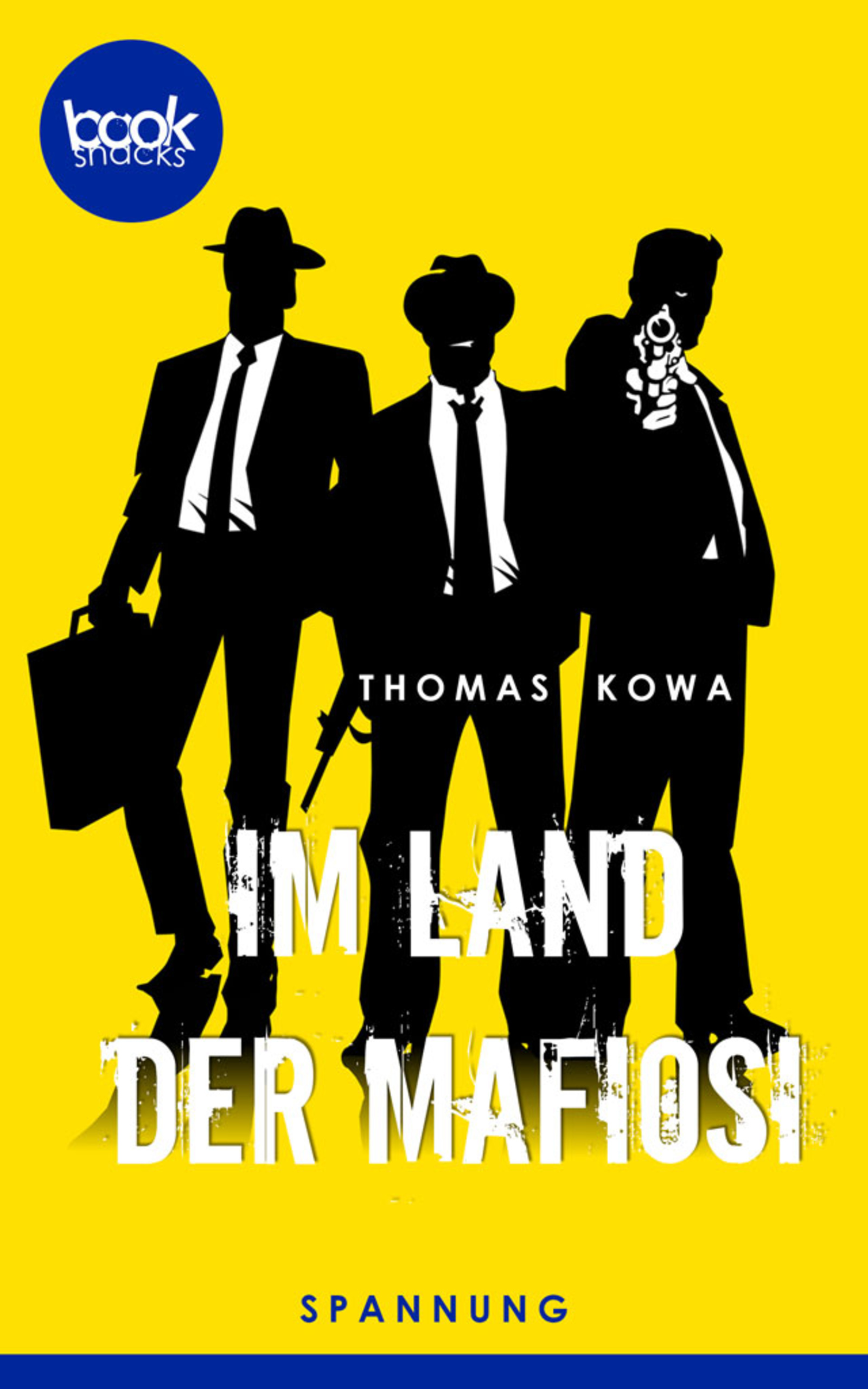5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Erik Lindberg-Thriller
- Sprache: Deutsch
Eine unaufhaltsame atomare Bedrohung und ein Täter, der für Profit über Leichen geht …
Das große Finale der spannenden Thriller-Reihe mit Kommissar Erik Lindberg
Inmitten der politisch heiklen Situation einer Volksabstimmung zum Atomausstieg geschehen tragische Todesfälle: Zwei Umweltaktivisten sterben an schwerer Verstrahlung. Einer von ihnen ist der Sohn des schwerreichen AKW-Betreibers Ernesto Bernasconi. Kommissar Erik Lindberg stößt bei seinen Ermittlungen auf eine brisante Spur: Die Aktivisten waren in Sibirien unterwegs, auf der Suche nach einer vermeintlich sicheren Endlagertechnologie für radioaktiven Müll. Mussten sie sterben, weil sie zu viel wussten? Gleichzeitig zwingt der Polizeichef Lindberg im Verborgenen gegen den Bundesanwalt zu ermitteln. Doch als ein Hinweis auf einen möglichen atomaren Anschlag auftaucht, hat er bei der Polizei keine Rückendeckung mehr. Um eine Katastrophe zu verhindern, muss Lindberg den Wettlauf gegen die Zeit gewinnen …
Dies ist eine bearbeitete Neuauflage des bereits erschienenen Titels Todesstaub.
Erste Leser:innenstimmen
„Die Thriller-Reihe um Ermittler Erik Lindberg geht gewohnt spannend weiter!“
„brandaktuell und daher super fesselnd“
„Sympathisches Ermittlerteam, das mich, wie von Thomas Kowa gewohnt, mitgerissen hat.“
„Voller überraschender Wendungen, die ich nicht habe kommen sehen!“
„atemberaubend bis zur letzten Seite“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses E-Book
Inmitten der politisch heiklen Situation einer Volksabstimmung zum Atomausstieg geschehen tragische Todesfälle: Zwei Umweltaktivisten sterben an schwerer Verstrahlung. Einer von ihnen ist der Sohn des schwerreichen AKW-Betreibers Ernesto Bernasconi. Kommissar Erik Lindberg stößt bei seinen Ermittlungen auf eine brisante Spur: Die Aktivisten waren in Sibirien unterwegs, auf der Suche nach einer vermeintlich sicheren Endlagertechnologie für radioaktiven Müll. Mussten sie sterben, weil sie zu viel wussten? Gleichzeitig zwingt der Polizeichef Lindberg im Verborgenen gegen den Bundesanwalt zu ermitteln. Doch als ein Hinweis auf einen möglichen atomaren Anschlag auftaucht, hat er bei der Polizei keine Rückendeckung mehr. Um eine Katastrophe zu verhindern, muss Lindberg den Wettlauf gegen die Zeit gewinnen …
Dies ist eine bearbeitete Neuauflage des bereits erschienenen Titels Todesstaub.
Impressum
Überarbeitete Neuausgabe Juni 2024
Copyright © 2025 dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Made in Stuttgart with ♥ Alle Rechte vorbehalten
E-Book-ISBN: 978-3-98778-870-3 Hörbuch-ISBN: 978-3-98778-818-5 Taschenbuch-ISBN: 978-3-98778-897-0
Dies ist eine Neuausgabe des bereits 2021 beim dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH erschienenen Titels Todesstaub (ISBN: 978-3-96817-964-3978-3-96087-667-0).
Dies ist eine Neuausgabe des bereits 2019 beim dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH erschienenen Titels Erhebe dich (ISBN: 978-3-96087-667-0978-3-96087-667-0).
Copyright © 2017, dp DIGITAL PUBLISHERS Dies ist eine überarbeitete Neuausgabe des bereits 2017 bei dp DIGITAL PUBLISHERS erschienenen Titels Reaktor – Der unsichtbare Mörder (ISBN: 978-3-96087-136-1).
Covergestaltung: Nadine Most unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com: © MD SAJJAD MOLLAH, © MilousSK Lektorat: Daniela Höhne
E-Book-Version 18.03.2025, 15:45:50.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Sämtliche Personen und Ereignisse dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
Abhängig vom verwendeten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Unser gesamtes Verlagsprogramm findest du hier
Website
Folge uns, um immer als Erste:r informiert zu sein
Newsletter
TikTok
YouTube
Dunkle Wahrheit
Jetzt auch als Hörbuch verfügbar!
Eine unaufhaltsame atomare Bedrohung und ein Täter, der für Profit über Leichen geht …Das große Finale der spannenden Thriller-Reihe mit Kommissar Erik Lindberg
Vorwort
Als 2016 mein Roman, der erste Teil der Erik-Lindberg-Trilogie, „Remexan“ erschien, kam noch im selben Jahr der zweite Teil heraus „Redux – der letzte Atemzug“. Beide Teile hatte ich schon in der Schublade und wieso das so war, kann man in den Vorwörtern der neu erschienen Titel „Tödlicher Schlaf“ und „Todesrichter“ nachlesen. Nun hatte ich eine Trilogie geplant, doch mir fehlte der dritte Teil.
Kurz davor fand in der Schweiz eine Volksabstimmung zum Ausstieg aus der Atomkraft statt, die wie alle Abstimmungen bis dahin verloren ging. Das ärgerte mich, zumal meine erste Tochter gerade geboren worden war und die Bundesstadt Bern, wo ich damals wohnte, innerhalb der 20 Kilometer-Zone lag, die im Falle eines Falles unbewohnbar geworden wäre. Denn neben Bern stand das Atomkraftwerk Mühleberg, welches technisch vergleichbar mit Fukushima war, das 2011 in Folge eines Tsunamis eine Nuklearkatastrophe verursacht hatte. Beide Atomkraftwerke wurden von General Electric als Siedewasserreaktoren gebaut, Fukushima 1 wurde 1970 in Betrieb genommen, Mühleberg 1973, mit einem baugleichen Sicherheitsbehälter der ersten Generation. Natürlich argumentierte man, die Schweiz habe kein Meer, sondern Berge und so könne in dem Land wohl kaum ein Tsunami entstehen. Man unterschlug aber, dass Mühleberg hinter einem mehr als hundert Jahre alten Staudamm stand, zumal noch in einer Gegend mit erhöhtem Erdbebenrisiko.
Wenn einem die Realität schon so eine Steilvorlage liefert, dann muss man einen Thriller daraus machen, fand ich.
Die Behörden verlangten aufgrund des neubewerteten Risikos Nachrüstungen, doch die waren dem Betreiber zu teuer und so wurde Mühleberg Ende 2019 vom Netz genommen. 2034 soll dann dort wieder eine grüne Wiese stehen, aber allein Rückbau und Entsorgung der Brennstäbe schätzt der Betreiber des Kraftwerks auf läppische drei Milliarden Franken.
Nun aber genug der Polemik, ich verspreche, dass der Roman im Gegensatz dazu mindestens so ausgewogen ist wie der Bericht jedes beliebigen Energielobbisten. Und viel, viel spannender.
Thomas Kowa
PS: Ob dieser Roman einen klitzekleinen Anstoß dazu gegeben hat, Mühleberg endlich zu schließen, weiß ich leider nicht, aber der Gedanke daran ist doch zu verlockend …
Fakten und Fiktion
Es gibt tatsächlich ein Land, in dem man so clever war, ein Atomkraftwerk nur 1300 Meter unterhalb einer Staumauer zu bauen. Diese Staumauer wurde im 1. Weltkrieg unter erschwerten Bedingungen gebaut, sie besteht aus Stampfbeton und ist nach aktuellen Erkenntnissen nicht ausreichend erdbebenfest, genau wie das darunterliegende Atomkraftwerk. Das Wasserwerk samt Staudamm ist nur durch eine einfache Tür gesichert und nachts unbemannt.
Dieses Atomkraftwerk liegt nicht – wie uns unsere Vorurteile vielleicht gerne suggerieren würden – in Osteuropa oder China, sondern in der Schweiz.
Die Swissair Maschine SR 330 ist 1970 tatsächlich nach einem Bombenattentat abgestürzt, keine 300 Meter entfernt vom Schweizer Atomforschungsreaktor Würenlingen und 900 Meter neben dem AKW Beznau. Die im Buch geschilderten Begleitumstände entsprechen dem letzten Stand der inzwischen eingestellten Ermittlungen.
Der Verkauf der Atomkraftwerke in der Schweiz wurde zwar bisher – im Gegensatz zu diesem Buch – nicht realisiert, der Anbieter Alpiq wollte jedoch seine Atomkraftwerke erst an den französischen und dann an den Schweizer Staat verschenken, beide lehnten dankend ab.
Die Wirkungsweise des im Buch beschriebenen ANC-Sprengstoffs ist authentisch. Ich habe lediglich auf ein paar entscheidende Details in der Handhabung verzichtet, um keine Blaupause für einen möglichen Anschlag zu liefern. Denn die Grundstoffe dieses Sprengstoffs sind in jedem Baumarkt erhältlich.
An der Transmutation von Atommüll wird seit Jahrzehnten geforscht, allerdings ohne verwertbares Ergebnis. Wahrscheinlich verhält es sich damit wie mit der Kernfusion, von der behauptet man auch schon seit fünfzig Jahren, diese werde in dreißig Jahren serienreif sein.
1
Das war ein guter Ort zum Sterben. Wenn er sich jetzt hinsetzte, würde er nie wieder aufstehen. Chris Bernasconi ging trotzdem auf die Holzbank zu.
Sein Körper schmerzte, als würde er von innen zerfressen, in seinem Kopf hämmerte es wie in einem aktiven Bergwerk.
Chris Bernasconi atmete tief aus und setzte sich. Er spürte das warme Holz der Bank und blickte auf den endlos erscheinenden Baikalsee. Das Wasser funkelte in der Sonne. Es roch nach Fisch und Meer, auch wenn Letzteres im Grunde nicht sein konnte.
Aber in diesem Land war ohnehin alles anders, als er erwartet hatte.
Die meisten Klischees über Russland stimmten nicht, das galt erst recht für Sibirien. So brannte auf seiner von Ekzemen übersäten Haut die Sonne und statt von Schneeflocken wurde er von Schnaken umschwärmt.
Sie stachen ihn gleich zu mehreren, doch Chris Bernasconi wehrte sich nicht. Es war sinnlos, die Schnaken zu töten, wahrscheinlich würden sie es ohnehin nicht überleben, wenn sie von seinem Blut tranken.
Außerdem hatte er keine Kraft mehr, sie zu verjagen.
Er hatte einen der größten Umweltskandale der Neuzeit aufgedeckt, doch das war nichts gegen das, was noch kommen würde.
Die Menschheit musste gewarnt werden.
Was, wenn es Darius nicht schaffen würde?
Wenn sie ihn vorher abfingen?
Gemeinsam hatten sie jahrzehntelang für höhere Sicherheitsvorkehrungen gekämpft, für funktionierende Notfalllösungen, für echte Alternativen.
Doch für sich selbst hatten sie darauf verzichtet.
Mit zittrigen Händen nahm Chris Bernasconi ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber aus seiner Hemdtasche. Er atmete schwer, jede Bewegung schmerzte, sogar das Anknipsen des Kugelschreibers.
Es ging um die Wahrheit.
Er wusste, die Menschen wollten die Wahrheit gar nicht hören, sondern das, was gut klang, was in ihr Weltbild passte.
So wie die Legende, dass die Amerikaner für die Mondlandung Millionen Dollar für die Entwicklung eines Kugelschreibers ausgegeben hatten, der in der Schwerelosigkeit schreiben konnte, während die Russen einfach Bleistifte verwendet hatten.
Die Geschichte klang gut, fußte auf bekannten Vorurteilen und war massenhaft verbreitet worden. Doch sie war von vorn bis hinten erfunden. Fake News.
Willkommen im postfaktischen Zeitalter.
Die Menschen glaubten nur das, was sie glauben wollten.
Und was sie nicht sahen, das gab es nicht.
Obwohl es die größte Gefahr von allen war.
Doch er musste die Menschen warnen, selbst wenn es nur ein Teil von ihnen verstehen würde.
Unter Schmerzen strich Chris Bernasconi das Papier glatt, setzte zu schreiben an und spürte wieder dieses wahnsinnige Hämmern unter seiner Schädeldecke.
Ein Tropfen Blut fiel auf die Spitze des Kugelschreibers und benetzte das Papier darunter. Chris Bernasconi fasste sich an die Nasenflügel, betrachtete seine blutverschmierte Hand und schloss für einen kurzen Moment die Augen. Konzentrier dich!
Der Kugelschreiber versagte, ließ ihn die Worte ins Leere schreiben.
Er drehte das Papier um, drückte den Kugelschreiber fester, doch er schrieb immer noch nicht.
Das Blut tropfte weiter.
Chris Bernasconi wollte aufstehen, aber seine Beine gehorchten ihm nicht mehr. Er sackte zur Seite, riss noch einmal die Augen auf, doch als er auf dem harten Boden aufschlug, bemerkte er es schon nicht mehr.
2
Mia Adam hing am Kühlturm eines Atomkraftwerks auf hundertzwanzig Metern Höhe und fragte sich, warum von allen Aktivistinnen ausgerechnet sie nicht mit einem Polizeieinsatz gerechnet hatte.
Weil sie ausnahmsweise auf der anderen Seite stand? Weil Tim sie mit seinem Charme überredet hatte, bei der Aktion dabei zu sein, da er drei Mitstreiter ersetzen musste?
Also hatte sie mitgemacht, obwohl sie Polizistin war.
„Ohne dich muss ich die Aktion abblasen“, hatte er erklärt und hinzugefügt, dass sich die Polizei die letzten Male immer zurückgehalten habe. „2014 haben wir mit über hundert Aktivisten das AKW Beznau geentert, sind am Reaktorgebäude hochgeklettert und niemand hat uns daran gehindert.“ Er hatte ihr versprochen, dass niemand erfahren würde, wer diese kleine, junge, hübsche Aktivistin mit dem rothaarigen Bubikopf war.
Das Wörtchen hübsch hatte den Ausschlag gegeben und sie verfluchte sich dafür.
Dieser Sommermorgen wäre ideal für ein entspanntes Picknick im Grünen gewesen, doch stattdessen war sie schon um vier Uhr morgens aufgestanden, vom Treffpunkt nach Däniken gefahren worden und hing jetzt am Kühlturm, ausgestellt wie ein Orang-Utan-Weibchen im Zoo. Neben Mia prangte ihr Plakat, mit der wenig diplomatischen Aufschrift: Atomkraft ist scheiße, in Japan gibt’s Beweise.
Unten am Kühlturm standen ein paar Sicherheitsleute des Kraftwerks und Dutzende Polizisten.
Die Polizei war eben nie dort, wo man sie brauchte.
Und gerade jetzt konnte Mia die Kollegen überhaupt nicht brauchen.
Einer der Polizisten schrie etwas in ein Megafon, aber sie verstand kein Wort.
Sie blickte zu den anderen Aktivisten, Ratlosigkeit stand in ihren Gesichtern. Dann gab Tim das Signal zum Abseilen.
Sie schaute ihn voller Unverständnis an, doch er schien entschlossen, aufzugeben.
Aber Mia war nicht hier, um aufzugeben, sie war hier, um zu kämpfen. Wenn sie festgenommen wurde und Bundespolizeichef Graf das mitbekam, dann konnte sie ihre Marke abgeben.
Und wie sollte Graf es nicht mitbekommen, wenn die Polizisten sie verhafteten?
Tim seilte sich ein paar Meter ab und alle anderen folgten ihm.
Bis auf Mia.
„Was ist?“, rief er und blickte nach oben zu ihr. „Wir müssen runter!“
„Warum?“, entgegnete sie und kannte doch die Antwort schon.
„Wir haben keine Chance.“ Er deutete auf die Polizisten unter ihnen. „Außerdem ist unser Ziel erreicht. Wenn sie uns festnehmen, kommen wir bestimmt in die Tagesschau.“
Alles, nur das nicht, dachte Mia und hielt sich weiter am Seil fest.
3
Montage hatten etwas Bedrückendes an sich, aber der erste Tag nach dem Urlaub war noch viel deprimierender. Fiel beides zusammen, fühlte sich der Morgen wie eine kleine Katastrophe an. Das Lebenswerte trat in den Hintergrund und der Zwang in den Vordergrund.
Als Erik Lindberg nach dem Aufstehen in den Spiegel schaute, sah er nicht – wie die Kolleginnen immer meinten – Jude Law mit Anfang dreißig, sondern einen übermüdeten Kommissar mit Ringen unter den Augen.
Als er später einen der dunkelblauen Anzüge anlegte, die er normalerweise auf der Arbeit trug, kam dieser ihm zentnerschwer vor. Klar war es schön, Kolleginnen wie Mia Adam und Katharina Zach wiederzusehen, auf andere wiederum hätte Erik Lindberg noch jahrelang verzichten können.
Zu letzteren zählte sein Vorgesetzter, Bundespolizeichef Beat Graf.
Lindberg fuhr zur Arbeit und war keine fünf Minuten anwesend, da zitierte Graf den Kommissar schon zu sich.
Kurz darauf saß Lindberg auf diesen unbequemen Besucherstühlen in Grafs Büro und sah dem Bundespolizeichef zu, wie der sich einen Espresso aus seiner persönlichen Kaffeemaschine eingoss. Natürlich, ohne Lindberg einen anzubieten.
„Während Ihrer Abwesenheit hat sich einiges getan.“ Graf strich sich über die polierte Glatze und fragte nicht mal anstandshalber, wie denn Lindbergs Urlaub verlaufen war.
„Gibt es einen neuen Fall?“, fragte Lindberg, obwohl er sich sicher war, dass er davon aus der Presse erfahren hätte.
Graf schüttelte den Kopf. „Ich hatte Kontakt mit den Kollegen vom Landeskriminalamt in Berlin.“ Er legte eine genüssliche Pause ein, nippte an seinem Espresso – und in dem Moment wurde Lindberg klar, dass es heute nicht bei einer kleinen Katastrophe bleiben würde.
„Ich hab mich schon immer gewundert, wie Sie diesen Wohlers so schnell wieder fassen konnten, nachdem er aus dem Gefängnis entflohen war.“ Graf blickte Lindberg überheblich an.
„Das war ein mehrfacher Mörder“, erwiderte Lindberg. „Meine Freundin lag wegen ihm monatelang im Koma, erst jetzt, während meines Urlaubs, konnte sie auf eine Aufwachstation verlegt werden, sie muss jedes Wort einzeln lernen, sie kann noch nicht wieder laufen …“
„Rache war noch nie ein guter Ratgeber“, unterbrach ihn Graf.
„Ich habe mich nicht gerächt“, sagte Lindberg. „Ich habe Wohlers nur dorthin gebracht, wo er hingehört: ins Gefängnis.“
„Genaugenommen hat das die Kollegin Adam erledigt.“ Graf runzelte die Stirn. „Wo steckt die eigentlich?“
„Ich habe keine Ahnung“, antwortete Lindberg und auch wenn er hoffte, dass das Thema Berlin damit erledigt war, ahnte er, dass der Bundespolizeichef ihm diesen Gefallen nicht tun würde.
„Zum Dienstbeginn um acht Uhr war niemand in ihrem gemeinsamen Büro.“ Graf schüttelte ungehalten den Kopf.
„Wenn wir einen Fall haben, arbeiten wir dafür am Wochenende oder nachts.“
„Oder Sie fliegen mal eben nach Berlin.“
Lindberg schluckte.
„Den Kollegen dort ist aufgefallen, dass der Schlüssel zur Asservatenkammer fehlt. Also haben die eine Inventur der Beweismittel gemacht und dabei festgestellt, dass ein Sudoku-Heft des besagten Herrn Wohlers ausgetauscht wurde.“
Lindberg schloss die Augen, doch er spürte förmlich, wie Grafs Blicke ihn durchbohrten.
„Jedenfalls stammt das Sudoku-Heft, welches in der Asservatenkammer lag, aus dem letzten Jahr, Wohlers hingegen ist viel früher festgenommen worden. Also kann es sich nicht um das Heft handeln, welches konfisziert worden ist.“ Er grinste herablassend. „Es sei denn, Wohlers hat eine Zeitmaschine erfunden.“
Lindberg schluckte noch mal. Er hatte das Heft bei seinem Besuch in Berlin entwendet, weil Wohlers es nach seinem Gefängnisausbruch von ihm erpressen wollte. Also musste das Heft ein Geheimnis in sich tragen. Zusammen mit seinem Freund Gehirnklitschko hatte Lindberg schließlich herausgefunden, dass in den Sudoku-Zahlen die Kontonummer für ein Schweizer Nummernkonto verschlüsselt war, auf dem die Beute aus vorherigen Raubzügen von Wohlers lagerte. Daraufhin hatte er Wohlers in der Bank eine Falle gestellt. Dieser hatte sie leider gewittert, war am Ende aber mit Mias Hilfe festgenommen worden.
Soweit perfekte Polizeiarbeit, auf die man hätte stolz sein können, wäre da nicht das illegal entwendete Beweismittel gewesen.
„Was Sie vielleicht nicht wussten“, sagte Graf und trank mit Genießermiene seinen Kaffee aus. „In der Asservatenkammer in Berlin gibt es neuerdings eine Überwachungskamera.“
Lindberg blickte seinen Vorgesetzten mit großen Augen an. Er wusste, wie sich unbedarfte Verdächtige verhielten, und hatte gerade jeden derer Fehler begangen. Das musste selbst Graf auffallen.
„Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten“, sagte Graf. „Ich kündige Sie fristlos …“ Er machte eine Pause und ließ den Satz wirken.
Fassungslos schaute Lindberg ihn an. Du mieser, dreckiger Bastard.
4
Darius Rebarski knöpfte sein Holzfällerhemd auf und sah mit Erschrecken, dass die krebsroten Ekzeme und die eitrigen Entzündungen wieder aufgeblüht waren. Sein Kopf fühlte sich an, als sei darin ein Staudamm gebrochen und er konnte sich kaum auf den Beinen halten. Angesichts der Umstände war das mehr als verständlich. Doch warum hatte er sich erst besser gefühlt und jetzt dieser Rückschlag?
Vorsichtig richtete er sich auf, nahm das Gummi aus seiner Jeans, strich sich die Haare glatt und band sie zu einem Pferdeschwanz. Er blickte auf seine Armbanduhr. Er musste die Zeit nutzen, die ihm blieb. Man weiß nie, wann es zu Ende geht.
Manchmal fragte er sich, wie sein Leben verlaufen wäre, hätte er Chris damals in Berlin nicht kennengelernt. Glücklicher? Vielleicht, aber Lämmer waren nur deshalb glücklich, weil sie nicht wussten, dass sie bald auf die Schlachtbank geführt wurden.
Chris. Ein Schweizer, der in Berlin Physik studierte. Das gab es selten. In London, New York oder Boston, dort studierte man Physik, wenn man über das nötige Kleingeld verfügte und Karriere machen wollte. Aber nicht in Berlin. Doch Chris hatte nicht Karriere machen wollen. Er hatte etwas lernen wollen. Fürs Leben.
Was für eine abgedroschene Phrase. Und doch stimmte sie. Wo gab es noch einen Lehrstuhl für Physik, der wirklich unabhängig war? Der nicht von einem Energiekonzern, einem Anlagenbauer oder einem Elektronikmulti gesponsert wurde? Wo der Lehrplan nicht von den Ehemaligen bestimmt wurde, die Karriere gemacht hatten?
Auf dem Papier waren alle unabhängig, aber auf dem Papier ließ sich auch das Restrisiko gegen Null rechnen. „Es ist immer eine Frage der Rundung“, pflegte ihr Professor zu sagen, wenn man ihn fragte, wie groß die Risiken wirklich waren.
Ja, man konnte alles abrunden, selbst die größten Werte. Man musste nur noch Größere finden und die beiden in ein Verhältnis zueinander bringen.
Was sie allerdings entdeckt hatten, ließ sich nicht mit irgendwelchen Rundungen beseitigen. Es waren keine hypothetischen Berechnungen, es waren Fakten.
Niemand würde diese Beweise je beseitigen können. Er musste nur dafür sorgen, dass man sie fand.
Es klang so einfach und doch war es unglaublich schwer.
Darius Rebarski nahm eine Literflasche Wasser, die noch zu einem Drittel gefüllt war, leerte sie und hatte immer noch Durst. Er schleppte sich ins Bad, stolperte dabei, hielt sich am Waschbecken fest und setzte sich dann auf die Schüssel. Es kamen nur ein paar Tropfen. Es brannte.
Doch das war nun wirklich sein geringstes Problem. Er schmiss sich eine Handvoll Wasser ins Gesicht, fuhr sich durch den zerzausten Bart und blickte in den Spiegel. Seine Augen waren rot wie Streichholzköpfe. Und ebenso schmal. Das Licht im Bad schmerzte. Vielleicht sollte er sich eine Sonnenbrille besorgen? Das letzte Mal hatte er eine in den Achtzigern getragen. Klar, wer hatte das damals nicht?
Hatte man sich damals abschirmen wollen, von dem was um einen herum geschah? Bhopal, die Challenger-Katastrophe, Tschernobyl, Sandoz, Rammstein, die Exxon Valdez. Die Aufzählung ließ sich beliebig fortsetzen. Er war in den Achtzigern als Spätaussiedler aus Polen nach Deutschland gekommen und hatte gedacht, jetzt würde alles besser.
Doch dann war eine Katastrophe nach der nächsten geschehen. Er war noch ein Kind gewesen und hatte trotzdem alles hautnah mitbekommen. Vielleicht genau aus diesem Grund. Waren seine Eltern nicht schon viel zu abgestumpft gewesen? Er hatte damals viele Fragen gehabt, doch Antworten hatte es keine gegeben. Beschwichtigungen ja, aber keine Antworten.
Darius Rebarski nahm sich ein schwarzes Tuch, band es über seine Haare wie ein Pirat und steckte sich eine Selbstgedrehte an. Er nahm einen Zug und hustete. Sein Atem rasselte, als habe man ihn in Ketten gelegt. Er hätte schon lange mit dem Rauchen aufhören sollen.
Doch jetzt war es auch egal.
Er öffnete seine Sporttasche, versicherte sich zweimal, dass die Fotokamera und der Chip gut darin verpackt waren und schloss sie wieder. Er hatte es aus Sibirien hierher geschafft, jetzt musste er nur noch zum Treffpunkt. Ohne sich noch einmal umzublicken, nahm er den Hotelschlüssel und verließ das Zimmer.
Rebarski reichte dem Portier den Schlüssel, zahlte in bar, kaufte sich am Kiosk nebenan zwei Flaschen Wasser und stieg in das erstbeste Taxi. Erschöpft ließ er sich auf die Rückbank fallen. Er spürte, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb.
5
Polizeichef Graf nippte noch mal an seinem Espresso und warf Lindberg dann ein selbstgefälliges Grinsen zu. „Ich werde Sie also fristlos entlassen“, wiederholte er. „Oder, Möglichkeit zwei, Sie erledigen einen Spezialauftrag für mich.“
„Einen Spezialauftrag?“ Lindberg wiederholte die Worte betont langsam, damit seine Gedanken mitkamen. „Ist das etwas Illegales?“
„Etwas politisch Brisantes“, antwortete Graf, ohne die Frage wirklich zu beantworten.
„Also illegal.“
„Ich würde eher sagen, es ist riskant. Wenn Sie Ihre Tarnung verlieren, sind Sie Ihren Job los. Und nicht weil ich Sie dann rausschmeiße, sondern weil es jemand anders tut.“
„Das sind ja tolle Aussichten.“
„Ich weiß, dass Sie ein relativ guter Mann sind.“ Graf schaffte es, selbst einem Lob noch eine Portion Gift mitzugeben.
Der Polizeichef holte einen Brief sowie ein ausgefülltes und unterschriebenes Formular aus seinem Schreibtisch und hielt Lindberg beides vor die Nase. „Ich habe eine Antwort an das LKA Berlin aufgesetzt, in dem ich erkläre, der Herr Kommissar Lindberg sei in meinem Auftrag in Berlin gewesen, weil wir Hinweise auf Wohlers Aufenthalt in der Schweiz hatten und der Antrag zur Beweismitteleinsicht sei bei den Kollegen in Berlin wohl verloren gegangen, genauso wie das originale Sudoku-Heft.“ Graf klang so großkotzig-generös wie ein Adeliger, der gerade seine soziale Ader entdeckt hat. „Sie haben Glück im Unglück, dass ich an einer Sache dran bin, bei der ich jemanden wie Sie brauchen kann.“ Er legte beide Papiere wieder auf seinen Schreibtisch. „Davon gibt es nur diese Originale, unterschrieben von mir. Haben Sie den Spezialauftrag in zwei Wochen abgeschlossen, können Sie diese Unterlagen nach Berlin schicken. Falls nicht, sind Sie gefeuert.“
Graf will mich echt erpressen. „Was ist das für ein Spezialauftrag?“
„Das sage ich Ihnen erst, wenn Sie den Auftrag annehmen.“
„Und in der Zwischenzeit vernichten Sie das Schreiben und können sich an nichts mehr erinnern …“
„Sehen Sie, deswegen sind Sie Kommissar und kein Streifenpolizist.“ Graf grinste. „Wir legen beide Papiere in ein Bankschließfach, das nur mit zwei verschiedenen Schlüsseln geöffnet werden kann. Einen Schlüssel bekommen Sie, einen ich.“
Ist er ein verdammter Geheimagent, oder was? Der hat anscheinend nur darauf gewartet, dass ich einen Fehler mache. „Und worum geht es jetzt?“
„Das kann ich Ihnen erst sagen, wenn Sie mir versprochen haben, mitzumachen.“ Graf lächelte entschuldigend. „Ich würde das ja gerne schriftlich fixieren, aber das würde mich im Fall der Fälle leider auch belasten, also vertraue ich ausnahmsweise auf Ihr Wort.“
„Und wenn ich Ihren Auftrag ablehne?“
„Dann werde ich Sie entlassen. Und dafür sorgen, dass Sie nie wieder als Polizist arbeiten.“
Lindberg schüttelte den Kopf. „Das ist Erpressung.“
„Erpressung ist ein unschönes Wort“, entgegnete Graf. „Ich gebe Ihnen eine zweite Chance, sehen Sie das mal so.“
Lindberg rieb sich die Stirn. Das Schweizer Kündigungsschutzgesetz war löchriger als Emmentaler Käse. Genaugenommen bestand es nur aus Löchern, denn jeder konnte jederzeit gekündigt werden, außer während einer Schwangerschaft, Krankheit oder dem Wehrdienst. Zwar galt das nicht für fristlose Kündigungen, aber was spielte das schon für eine Rolle? Außerdem hatte Graf als Bundespolizeichef weitreichende Beziehungen. Er konnte es ihm tatsächlich unmöglich machen, wieder eine Stelle als Kommissar zu finden. „Wie lange habe ich Bedenkzeit?“, fragte Lindberg.
„Gar nicht.“ Graf zuckte nicht mal mit der Wimper. „Wenn Sie das Büro verlassen, habe ich entweder Ihre Zusage oder Sie sind gefeuert.“
„Dann gehe ich.“ Lindberg stand auf.
Graf blickte überrascht auf. Zum ersten Mal wirkte er verunsichert. „Das ist nicht Ihr Ernst?“
„Nehmen wir mal an, ich erledige den Auftrag. Woher weiß ich, dass Sie mich danach nicht immer noch in der Hand haben, weil Sie mich zu etwas Illegalem gezwungen haben?“
„Ich zwinge Sie zu gar nichts“, sagte Graf.
Lindberg ging zur Tür.
„Sie … Sie müssen nur so ermitteln, wie Sie es sonst auch tun“, erklärte Graf. „Und Sie wissen genauso gut wie ich, dass Sie sich dabei nicht immer an die Gesetze halten.“
„Weil es der Gerechtigkeit dient.“ Lindberg war stehen geblieben, drehte sich wieder zu Graf. „Und weil ich damit niemandem schade. Außer dem Täter.“
„Das gilt in diesem Fall genauso.“
„Und was ist das Ziel der Ermittlung?“
„Sie sollen mir Beweise beschaffen, damit ich jemanden vor Gericht bringen kann.“
„Warum engagieren Sie keinen Privatdetektiv?“
„Ich habe Ihnen genug erzählt.“
„Und wenn es diese Beweise nicht gibt?“
„Es gibt sie. Punkt.“ Graf blickte Lindberg ernst an. „Wenn es schiefgeht, wird es auch meinen Kopf kosten.“
Na endlich mal was Positives. Lindberg atmete tief aus und ging langsam zurück zu Grafs Schreibtisch.
„Ich wusste doch, dass ich mich auf Sie verlassen kann.“ Graf lächelte. Das Lächeln des Teufels, der kurz davor stand, eine Seele zu kaufen.
Lindberg setzte sich. „Wir gehen direkt von hier zur Bank.“
Graf nickte und steckte beide Schreiben in einen frankierten und an das Berliner LKA adressierten Umschlag. „Aber vergessen Sie nicht, Sie haben nur zwei Wochen. Danach wird das Schließfach aufgelöst und der Inhalt von der Bank vernichtet.“
Lindberg seufzte, wollte etwas antworten, doch im nächsten Moment klingelte sein Handy. Es war die Leiterin der Spurensicherung Katharina Zach. Halb aus Fluchtreflex, halb aus Interesse nahm er das Gespräch an.
„Bist du wieder aus dem Urlaub zurück?“
Lindberg brummelte ein Ja.
„Ich kann deine Begeisterung durchs Telefon spüren“, entgegnete sie. „Demnach wirst du dich freuen zu hören, dass wir einen Todesfall im rechtsmedizinischen Institut haben.“
„Im rechtsmedizinischen Institut? Ist Molet endgültig durchgedreht?“
„Le ’Obbydiktator erfreut sich immer noch bester Gesundheit“, entgegnete Katharina. „Und der Todesfall hat sich auch nicht dort ereignet, sondern in Sibirien. Aber die Leiche wurde jetzt überstellt, in zwei Stunden beginnt die Obduktion. Ich dachte, du willst vielleicht dabei sein.“
Lindberg blickte Graf an. „Ich muss noch etwas erledigen, aber das sollte zu schaffen sein.“
„Gut“, entgegnete Katharina. „Sei ausnahmsweise mal pünktlich. Molet hat nämlich etwas von besonderen Sicherheitsvorkehrungen erzählt.“
6
Mia Adam saß am Fuß des Kühlturms, die Hände hinter dem Rücken mit einem Kabelbinder zusammengebunden. Anscheinend waren den Polizisten die Handschellen ausgegangen, oder man machte das hier im Aargau so.
Mia sagte kein Wort, starrte nur den Betonboden an, als könne der ihr helfen. Sie hatte sich nicht abgeseilt, also waren zwei Polizisten zu ihr hinaufgekommen und hatten sie wie einen reifen Apfel gepflückt.
„Aufstehen!“, rief einer der Polizisten, doch sie reagierte nicht. Erst als alle schon aufgestanden waren, ließ Mia sich von einem Polizisten aufhelfen.
Sie liefen an der Umzäunung des Kraftwerks entlang in Richtung Eingangstor und Mia konnte schon von Weitem den Übertragungswagen des Schweizer Fernsehens erkennen. Sie unterdrückte einen Fluch, dann erst sah sie, wie Tim strahlte.
Auf der anderen Seite des Metallzaunes standen ein paar Dorfbewohner und grinsten höhnisch, einer brummelte etwas, das klang wie: Das geschieht denen recht.
So kurz vor der Volksabstimmung über die Zukunft der Atomkraft in der Schweiz war die Meinung im Land in zwei unvereinbare Lager gespalten.
Die Schweizer AKWs waren allesamt in die Jahre gekommen. Bei der Abstimmung ging es darum, ob man die Kraftwerke nach fünfundvierzig Jahren abschaltete oder weiterlaufen ließ, mit einer unbefristeten Betriebsbewilligung.
Die es weltweit in keinem einzigen Land für ein Atomkraftwerk gab.
In zwei Wochen würde es sich entscheiden. Alles war offen, denn Mia wusste, man war gerne autark in der Schweiz. Nur schienen dabei aus ihrer Sicht einige zu vergessen, dass man Uran importieren musste, Wind, Wasser und Sonne aber nicht.
Fünfundvierzig war zwar ein gutes Alter, aber nicht für ein Atomkraftwerk.
In Basel, Bern, Genf und Zürich war die Meinung eindeutig, doch befand Mia sich in keinem dieser Städte, sondern in der Nähe des Örtchens Däniken, auf dessen Gemarkung das Atomkraftwerk Gösgen stand.
In solchen Orten herrschte eine gewisse Bunkermentalität. Die Einwohner, die das AKW als Gefahr betrachteten, waren schon lange weggezogen.
Und so hoffte man in Däniken – und in den umliegenden Ortschaften –, dass sich die Bevölkerung für den Weiterbetrieb entschied. Denn man wusste, dass eine Entscheidung gegen die Atomkraft langfristig den Tod der Gemeinden um das Kraftwerk herum bedeuten würde. Ohne das AKW gab es dort keine Arbeit. Und ohne Arbeit gab es keinen Lohn. Und ohne Lohn niemanden, der in den lokalen Geschäften einkaufen würde. Außer ein paar Rentnern. Glorreiche Konsumentenzukunft sah anders aus. All das machte Aktionen in solchen Orten so heikel. Für beide Gruppen ging es um ihre Art zu leben.
Für einen bulligen Kerl mit Glatze, Bomberjacke und Springerstiefeln schien es jedoch um etwas anderes zu gehen. Er streckte den rechten Arm aus. „Landesverräter!“, brüllte er in Richtung der Aktivisten.
Mia trug auch Springerstiefel, aber ihre politische Einstellung hätte nicht gegensätzlicher sein können.
Sie fand es ohnehin absurd, dass es in der Schweiz Nazis gab, schließlich hatte aus ihrer Sicht Hitler nur deshalb die Eidgenossenschaft nicht eingenommen, weil sie ihm neutral nützlicher schien, denn als Protektorat. Doch Köpfe, die auf einfache Lösungen programmiert waren, würden das ohnehin nicht verstehen, also ignorierte Mia den Skinhead.
Er jedoch schien an Mia Gefallen zu finden, stellte sich direkt an den Zaun. „Hey, Rotschopf!“, rief er. „Du brauchst mal einen echten Schweizer Mann, damit du auf andere Gedanken kommst!“ Er steckte seine Zunge durch den Zaun und bewegte sie provozierend hin und her.
Mia tat so, als würde sie ihn ignorieren, doch als sie auf seiner Höhe war, holte sie mit dem rechten Fuß aus und traf so zielsicher, wie sie es im Judo-Training nie geschafft hatte.
Die Glatze krümmte sich vor Schmerzen, Blut lief aus seinem Mund.
Einer der Polizisten riss Mia vom Zaun weg, die Glatze sank theatralisch auf den Boden und brummelte irgendetwas Unverständliches in seinen Hohlkörper hinein.
Dann erst erblickte Mia den Fotografen. Ein Kamerablitz knallte ihr in die Augen. Und Mia wusste, das würde kein gutes Ende nehmen.
7
„Was hätten Sie eigentlich gemacht, wenn ich nicht in Berlin gewesen wäre?“, fragte Lindberg, während er mit Graf per Lift in die Tiefgarage der Bundespolizei fuhr.
„Glauben Sie wirklich, Sie haben so wenig Fehler?“ Der Bundespolizeichef grinste. „Ich hätte immer etwas gefunden.“
Lindberg schenkte sich eine Antwort. Vielleicht hatte Graf mit seiner Behauptung ja recht. „Also, worum geht es?“
„Ich erkläre es Ihnen während der Fahrt.“ Graf stieg in seinen neuen Jaguar. „Toller Schlitten, oder?“ Seine Augen funkelten vor Stolz.
„Ich steh nicht so auf Autos.“
„Ihre Kollegin schon.“
Wie meint er das jetzt? Hat er Mia genauso in der Hand?
Graf schaltete sein Handy aus. „Machen Sie das bitte auch“, sagte er. „Falls wir geortet werden.“
Lindberg blickte ihn irritiert an, tat aber, was Graf befohlen hatte. Der Polizeichef gab Gas und fuhr auf die Hauptstraße. „Ist Ihnen am Bundesanwalt in letzter Zeit etwas aufgefallen?“
„Sie meinen Schiller?“
„Genau. Der Giftzwerg.“
Lindberg war überrascht, dass der Bundespolizeichef Schillers Spitznamen kannte. Vielleicht war er aber auch zu offensichtlich, denn jeder von Schillers hundertneunundfünfzig Zentimetern bestand aus ausgehärteter, giftiger Galle. Zumindest sah er so aus. Blass, drahtig und mit einer Frisur, die selbst Kojak stolz gemacht hätte. „Was ist mit ihm?“, fragte Lindberg.
„Sie sollen ihn beschatten.“
„Beschatten?“ Lindberg warf Graf einen fragenden Blick zu. „Und wie soll ich das machen, jetzt, wo wir einen neuen Fall haben?“
„Für das Timing kann ich nichts.“ Graf räusperte sich. „Außerdem gibt es Abkürzungen zum Glück.“
„Wie meinen Sie das?“
„Wie ich gehört habe, ist kein Türschloss vor Ihnen sicher.“
Lindberg blickte aus dem Seitenfenster, die Sonne schien, doch seine Laune entsprach eher tausend Tagen Regenwetter. „Sie wollen, dass ich bei Schiller einbreche? Beim Bundesanwalt?“
„Wie Sie zu den Beweisen kommen, bleibt Ihnen überlassen.“
Lindberg beugte sich näher zu Graf. „Und was soll ich beweisen?“
„Das erzähle ich Ihnen, nachdem wir im Tresorraum waren.“
Graf parkte den Wagen auf dem Kundenparkplatz der Bank Privé. Mein Chef muss ja einiges beiseitegelegt haben, wenn er hier ein Konto hat.
Graf klingelte an der verschlossenen Außentür der Bank. „Das Reden überlassen Sie mir.“
Die beiden wurden hineingebeten, doch die Freundlichkeit des Bankangestellten bezog sich ausschließlich auf Graf. „Wir würden gerne das reservierte Schließfach eröffnen“, sagte der Bundespolizeichef.
Der Bankangestellte warf Lindberg einen blasierten Blick zu. „Können Sie sich legitimieren?“
Lindberg schob seinen Ausweis über den Tresen.
Der Angestellte kopierte den Ausweis, ging an ein Terminal und gab ein paar Daten ein. „Zugriff erhalten die Herren Lindberg oder Graf, nur innerhalb der nächsten vierzehn Tage und nur nach vorheriger Ausweiskontrolle sowie mittels beider Schlüssel“, sagt er schließlich und führte sie in einen Tresorraum im Keller. Er deutete auf ein Schließfach. „Nach vierzehn Tagen wird das Fach aufgelöst und der Inhalt vernichtet.“ Er blickte Graf an. „Möchten Sie jetzt etwas deponieren?“
Der Polizeichef nickte.
Der Angestellte ging zu dem Schließfach, nahm erst den einen Schlüssel, steckte ihn hinein und drehte ihn nach links. Dann nahm er den anderen und tat dasselbe.
Das Schließfach öffnete sich. Es war keine zehn Zentimeter hoch und nur zwanzig Zentimeter tief sowie breit. Graf holte den frankierten Umschlag aus seiner Jacketttasche und legte ihn in das Fach. Der Bankangestellte drückte die kleine Tür zu, drehte die beiden Schlüssel wieder zurück und zog sie ab. Dann gab er einen Schlüssel Graf und einen Lindberg.
Wieder oben im Foyer wurden sie von dem Bankangestellten verabschiedet. Es grenzte an ein Wunder, dass der Mann sich durchringen konnte, Lindberg die Hand zu geben.
Auf dem Weg zum Jaguar schwieg Graf.
„Warum ich?“, fragte Lindberg schließlich.
Graf grinste. „Man muss eben die Opportunitäten nutzen, die sich einem bieten.“
„Was genau für Beweise wollen Sie gegen Schiller?“
Graf stieg in den Wagen und ließ den Motor an. „Sie müssen wissen, dass Herr Schiller und ich nicht das beste Verhältnis haben.“
Du willst seinen Job. Und mich dafür benutzen. „Das ist kein Grund, ihn überwachen zu lassen.“
„Nein, das ist es nicht.“ Graf strich sich über die Glatze. „Ich habe aber den Verdacht, dass Schiller eine minderjährige Freundin hat.“
„So etwas muss nicht illegal sein.“
„Wenn es sich um eine Schutzbefohlene handelt, ist es das. Oder wenn sie gezwungen wird.“
„Und wie soll ich das Verhältnis beweisen?“
„Da er mit ihr nicht einfach in ein Hotelzimmer spazieren kann, treffen sie sich anscheinend bei ihm zu Hause.“
„Schiller ist doch verheiratet“, entgegnete Lindberg. „Und hat er nicht sogar eine minderjährige Tochter?“
„Seine Tochter ist siebzehn, ist gemeinsam mit der Mutter vor vier Wochen ausgezogen, die Scheidung ist aber noch nicht eingereicht.“
Lindberg musterte Graf. „Sie wollen Schiller also loswerden, weil er Sex mit einer Minderjährigen hat?“
„Dafür würde ich wohl kaum meine Karriere riskieren“, entgegnete Graf. „Ich will, dass er mir Informationen liefert, um die Hintermänner dranzubekommen.“
„Hintermänner für was?“
„Es ist besser, wenn Sie nicht alles wissen.“
„Mir könnte bei der Überwachung aber etwas auffallen.“
„Schiller ist kein Anfänger.“
„Immerhin geht er nach Ihren Informationen mit einer Minderjährigen ins Bett.“
„Manche haben viele Schwachstellen.“ Graf lächelte Lindberg an. Es war klar, wen er damit meinte. „Schiller hat nur eine einzige. Wir bekommen ihn so, oder wir bekommen ihn gar nicht.“
„Als Bundesanwalt steht Schiller unter Personenschutz“, entgegnete Lindberg. „Wie soll ich ihn da unauffällig überwachen? Und wieso empfängt er die Minderjährige daheim? Wo es jeder Personenschützer mitbekommt?“
„Wenn er seine Dates hat, schickt er die Personenschützer anscheinend vorher weg.“ Graf grinste. „Das kam denen merkwürdig vor, daher stammt der Tipp auch aus diesen Kreisen.“
„Und warum überwachen ihn dann diese Kreise nicht gleich selbst und liefern den Beweis?“
Graf bog in die Tiefgarage der Bundespolizei und parkte seinen Jaguar. Dann erst blickte er Lindberg an und zuckte mit den Schultern. „Da wollte niemand das Risiko eingehen.“
Klar, die konnte man ja auch nicht erpressen. Lindberg rieb sich die Stirn. „Ich beweise, dass Schiller Sex mit einer Minderjährigen hat, wir gehen zur Bank und ich bekomme den Umschlag mit meiner Entlastung für das LKA in Berlin?“
„Exakt.“
„Keine Nebenabreden?“
Graf stieg aus dem Jaguar. „Nur absolute Verschwiegenheit. Niemand darf je von unserem kleinen Arrangement erfahren.“
„Das gilt auch für Sie?“ Lindberg stellte sich vor den Polizeichef.
„Selbstverständlich.“ Graf lächelte, klopfte Lindberg auf die Schulter und ging an ihm vorbei. „Ich muss auf ein Meeting. Ich erwarte morgen früh einen Bericht von Ihnen, alles klar?“
„Zu dem Todesfall im rechtsmedizinischen Institut oder zu dem Spezialauftrag?“
Graf rieb sich die Hände. „Natürlich zu beidem.“ Dann ließ er Lindberg einfach stehen.
8
Sie nahm die Pistole aus der Jackentasche, entsicherte sie und hielt sie im Anschlag. Dann erst schob sie die Zugangskarte in den Leser an ihrer Hotelzimmertür und drehte den Türknauf herum. Es hatte lange gebraucht, bis sie den Portier überzeugt hatte, dass sie ihren Ausweis verloren hatte. Die Leute werden immer paranoider. Vor Harmlosem haben sie Angst und gleichzeitig verdrängen sie ihre gefährlichsten Gewohnheiten.
Doch sie hatte ihren Charme spielen lassen und ihm sogar noch eine zweite Zugangskarte für das Zimmer abgelächelt, die sie am vereinbarten Ort deponiert hatte. Mit einem Ruck öffnete sie die Tür, lauschte kurz in das Zimmer und huschte hinein. Sie schloss die Tür hinter sich, die Vorhänge, überprüfte Bad sowie Schränke und stöpselte das Telefon aus. Schließlich setzte sie sich auf das Bett, Erschöpfung stand in ihren Augen. Sie hasste es, tagsüber im Dunkeln sitzen zu müssen, aber falls jemand sie entdeckte, war alles vorbei.
Schon öfter hatte sie sich gewünscht, nicht so attraktiv auszusehen. Die Leute sahen ihre kleine Statur und ihr puppenhaftes Gesicht und glaubten nicht, dass sie auch über ein gut funktionierendes Hirn verfügte. Die schwarzgefärbten Haare machten alles noch schlimmer. Sie standen ihr viel zu gut. Aber was sollte sie tun? Mit einem roten Irokesenschnitt war man nicht wirklich unauffällig oder mit kurzrasierten Haaren. Selbst ihr Augenbrauenpiercing hatte sie entfernt. Wenigstens hatte sie kleine Brüste. Und mit einem Jeansoverall konnte man einiges an ihrer schlanken Figur kaschieren. Das manche Frauen so was freiwillig trugen?
Dennoch hatte sie den Eindruck, immer noch zu sehr aufzufallen. Vielleicht lag es daran, dass sie noch nie gut im Verstecken gewesen war. Das Suchen hatte ihr schon immer mehr gelegen. Jetzt aber ging es einzig und allein darum, nicht gefunden zu werden. Wie lange würde sie das noch aushalten?
Sie schaltete den Fernseher ein und stellte den Ton leise. In den Nachrichten lief das Übliche: Palästina-Konflikt; Amis, die sich unter dem Vorwand der Militärhilfe in die Politik anderer Länder einmischten und damit alles schlimmer machten, irgendeine Promihochzeit. Von Chris oder Darius war immer noch nicht die Rede. War das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes?
Im Bad legte sie die Pistole auf eine Ablage, zog sich aus und stellte sich unter die Dusche. Das warme Wasser perlte an ihr ab wie an einer Schutzhaut. Sie atmete tief durch.
Es half nichts. Sie wurde das Gefühl nicht los, dass jemand ihr folgte.
Seit drei Tagen fühlte sie sich beobachtet. Kein Wunder, nach dem was geschehen war. Und nach dem, was noch geschehen würde. Bestimmt wäre es anders gelaufen, wenn ich Chris und Darius begleitet hätte! Warum hatten die beiden es unbedingt allein durchziehen müssen? Männer!
Sie stellte die Dusche ab, rieb sich mit dem Tuch trocken und legte den Jeansoverall an, den sie heute Mittag in einem Secondhandladen gekauft hatte. Sie nahm ihr Portemonnaie und zählte das Geld. Zweihundertfünfzig Franken, das war alles, was ihr geblieben war. Wenigstens hatte sie das Hotel schon bezahlt. Spätestens übermorgen musste sie einen Weg finden, an neues Geld heranzukommen.
Andere gingen dafür zum Geldautomaten, doch dann wussten die Bullen sofort, wo sie sich befand. Und wie sie aussah. Die Überwachungskameras an den Automaten ließen sich nicht austricksen.
Wenn sie einen Vorteil hatte, war es ihre Anonymität. Den würde sie sich nicht nehmen lassen. Nicht für Geld.
Sie schaltete den Fernseher aus und legte sich aufs Bett. Einmal wieder ohne Angst schlafen können. Sich einfach fallen lassen. An nichts denken. Und von nichts überrascht werden. Nur daliegen und schlafen. Keine Träume. Jedenfalls keine Albträume.
Sie schaute auf die Uhr. Es war früher Nachmittag, ihre produktivste Zeit, jedenfalls war das früher so gewesen, bevor der Arzt ihr diese Medikamente verschrieben hatte. Er hatte ihr eingebläut, die Dinger regelmäßig zu nehmen, hatte sie sogar überredet, einen Alarm an ihrer Armbanduhr zu aktivieren, der sie an die Einnahme erinnerte. Immer wenn das Teil piepte, wurde ihr Widerwillen dagegen größer. Weil sie dann nicht sie selbst war? Jedenfalls nicht in allen Ausprägungen?
Doch noch jedes Mal hatte sie die Medikamente genommen.
Sie seufzte.
Momentan blieb ihr nichts anderes übrig, als sich hier zu verstecken. Wenn sie wenigstens in Chris’ Wohnung könnte! Aber es war zu gefährlich.
Noch.
So sehr sie den Drang spürte, etwas zu tun, wusste sie, sie musste noch warten.
Sie öffnete die Nachttischschublade, fand eine Bibel und blätterte ziellos darin herum. Plötzlich hielt sie inne. Auf dem Flur waren Schritte zu hören. Nein, keine tiefen, bedrohlichen, auch keine unachtsamen eines Hotelgastes, sondern leise schleichende Schritte. Sie kamen näher und stoppten kurz vor ihrer Zimmertür.
Verdammt! Sie hatte die Pistole im Bad liegen lassen! Bis sie dort war, konnte es schon zu spät sein. Außerdem würde die Person vor der Tür hören, wenn sie ins Bad rannte.
Sie horchte in die Stille, dachte schon, sie habe sich getäuscht, als sie plötzlich aufschreckte. Der Türknauf ihrer Zimmertür drehte sich.
9
Als Erik Lindberg das frisch eingeweihte rechtsmedizinische Institut betrat, blieb er, obwohl er in Eile war, kurz stehen und blickte sich staunend um. Der Neubau wirkte hell und freundlich, fast wie ein modernes Kunstmuseum. Zu seiner Überraschung roch es dezent nach Flieder, wahrscheinlich irgendein Raumparfüm. Doch schon nach den ersten paar Metern stellte Lindberg fest, dass er wie immer in der Rechtsmedizin dieses unangenehme Bauchgrimmen verspürte.
Also lag es nicht am Gebäude, nicht an den Gerüchen, sondern an Dr. Molet.
›Le ’Obbydiktator‹, der führende Pathologe der Schweiz. So bezeichnete er sich jedenfalls selbst und es wagte niemand, ihm zu widersprechen.
Allerdings gab es seit einiger Zeit im rechtsmedizinischen Institut einen Mitarbeiter, der brisante Details der Obduktionen an die Presse verriet und damit auch Molets Autorität untergrub. Bisher hatte der Pathologe dem ratlos zugesehen, daher hatte Lindberg sich im Urlaub einen Plan überlegt, wie man den Maulwurf enttarnen konnte.
Der Kommissar war überzeugt, dass der Plan gelingen würde, doch ob Molet ihn überhaupt hören wollte, das wusste er nicht.
Lindberg hastete in den Umkleideraum, natürlich war er mal wieder zu spät. Aber er hatte erst noch ein Versteck für den Tresorschlüssel suchen müssen und dann war er aus Gewohnheit zur alten Rechtsmedizin gefahren, die inzwischen leer stand.
In der Umkleidekabine vor den Obduktionsräumen legte er den üblichen Einweg-Schutzkörperanzug an, samt Schuhüberzug und Haarnetz. Ohne das brauchte man Molet gar nicht erst gegenüberzutreten. Lindberg ignorierte die Warnhinweise an der Tür, anscheinend wollte man hier jetzt alles ganz genau nach Vorschrift machen und ging in den Raum.
Vor einem Stahltisch standen Molet, Katharina Zach und zwei Assistenten, die er nicht kannte. Alle vier trugen nicht die üblichen Overalls, sondern irgendwelche gelben Ganzkörperanzüge, bei denen sogar der Kopf eingeschlossen war. Waren die Dinger auch neu?
Molet erblickte ihn, ließ das Skalpell fallen und rannte auf Lindberg zu. Er schrie ihm etwas entgegen und trotz des Ganzkörperanzugs verstand Lindberg jedes Wort. „’Auen Sie sofort ab!“
„Was?“
Im nächsten Moment packte Katharina Zach den Kommissar und schob ihn aus dem Obduktionsraum in die Umkleide. Dort zog sie die Kopfmaske ihres Ganzkörperanzugs aus. „Sag mal bist du bescheuert?“
„Du hast mich doch hierherbestellt!“
„Ja, aber da wusste ich nicht, das wir nur vier Strahlenschutzanzüge haben.“
„Was?“
„Meinst du die Warnhinweise hängen da zum Spaß?“ Sie zeigte auf die Tür, mit den Magnetschildern, die Lindberg ignoriert hatte. „Außerdem habe ich dir doch per SMS Bescheid gegeben!“
Lindberg nahm sein Diensthandy. „Mist, ist immer noch ausgeschaltet.“
„Warum das denn?“
Lindberg biss sich auf die Lippe. „Dummheit“, antwortete er schließlich. „Was ist mit dem Leichnam? Irgendein Giftstoff? Schon wieder Anthrax?“
„Schlimmer“, sagte Katharina Zach. „Wenn ich den Messwerten glauben kann, die ich vorhin ermittelt habe, wurde Chris Bernasconi so massiv radioaktiv verstrahlt, dass Molet ihn als Atommüll behandeln und ins Endlager schicken müsste. Wenn wir denn eins hätten.“
10
„Sie haben also keinen Ausweis bei sich und weigern sich, Ihre Personalien anzugeben?“ Der Polizist erhob sich von seinem abgenutzten Schreibtisch in seinem abgenutzten Büro und stellte sich vor Mia.
Sie nickte nicht einmal.
„Verstehen Sie mich überhaupt?“
Mia blickte die Wand an. Dorfpolizisten! So doof war sie ganz sicher nicht, als Antwort auf diese Frage mit dem Kopf zu schütteln.
„Also noch mal, wie heißen Sie?“
Mia antwortete nicht, wie schon die ganze Zeit, nachdem man sie vom Kühlturm gezerrt hatte.
Denn jedes Wort, das sie sagen würde, gäbe etwas über sie preis. Das war zwar nicht gerade ein großartiger Plan, aber etwas Besseres fiel ihr momentan nicht ein.
Der Dorfpolizist trat einen Schritt näher an Mia heran. „Ich kann auch Ihre Kollegen fragen, irgendwie werden Sie sich ja mit denen verständigt haben, oder?“
Mia seufzte. „Ich Maryan Kochilowanski.“
„Was?“
„Ich … schreibe … auf.“ Mia ruckelte an dem Kabelbinder an ihren Händen, damit der Polizist sie aufschnitt.
Er grinste. „Sie halten sich wohl für besonders clever?“
Normalerweise hätte Mia genickt, aber heute fand sie keinen Grund dafür.
„Dann sag ich Ihnen mal, was ich glaube. Diese junge, rothaarige Frau, die dem Nazi vorhin die Zunge poliert hat, weil sie jedes Wort von ihm verstanden hat, kann wahrscheinlich besser Deutsch, als sie vorgibt, oder?“ Der Polizist zeigte mit dem Finger auf sie. „Wahrscheinlich sind Sie eine verwöhnte Bankkauffrau, wollten mal mutig sein und jetzt haben Sie Angst vor den Konsequenzen, stimmt’s?“
Mia nickte, obwohl es nicht stimmte.
Er lächelte zufrieden. „Helfen Sie mir, dann helfe ich Ihnen.“
Mia legte ihren unterwürfigsten Blick auf, so dass sie sich fast vorkam wie eine Hündin, die um Futter bettelte. „Können Sie mich nicht einfach laufen lassen? Ich habe doch niemandem etwas getan.“
Das Lächeln des Polizisten verschwand so schnell wie es gekommen war. „Meine Kollegen mussten extra wegen Ihnen auf den Kühlturm klettern! Das ist eine bewusste Gefährdung der Staatsgewalt!“
Du weißt gar nicht, was Gefahr ist, dachte Mia, doch sie lächelte nur unschuldig und nannte ihm einen Fantasienamen und eine Fantasieadresse.
Während er beides überprüfte, petzte Mia die Beine zusammen. „Ich müsste mal aufs Klo“, sagte sie. „Oben auf dem Kühlturm konnte ich ja schlecht. Einfach laufen lassen, hätte ihre Kollegen ja noch mehr in Gefahr gebracht.“
Er seufzte und rief eine Polizistin.
Mist, dachte Mia. Die kommt bestimmt mit auf die Toilette. Frauen bei der Polizei sind echt das Letzte!
Die Polizistin führte Mia auf die Frauentoilette. Mia huschte in eine Kabine. „Und wie soll ich mir die Hose runterziehen?“ Sie ruckelte mit verbundenen Händen hinter ihrem Rücken. „Und wie den Po putzen?“
Die Polizistin zog genervt einen Mundwinkel nach oben, doch dann holte sie eine Schere heraus, bückte sich und schnitt Mia den Kabelbinder durch.
Im nächsten Moment packte Mia den Kopf der Polizistin, knallte ihn gegen die Kabinentür und rannte so schnell sie konnte auf die Toilettentür zu.
Die Polizistin rief etwas, doch Mia drückte schon die Klinke herunter, riss die Tür auf und starrte direkt auf den Brustkorb dieses verdammten Dorfpolizisten.
Offensichtlich hatte er hinter der Tür auf sie gewartet, drehte ihr die Arme auf den Rücken und legte ihr mit großem Vergnügen ein paar Handschellen an.
11
Erik Lindberg stand vor Mia Adams Wohnungstür und klingelte zum dritten Mal. Als niemand reagierte, nahm er das Handy, rief sie an, doch er erreichte nur die Mailbox. Er hatte schon vor einer halben Stunde darauf gesprochen, also legte er auf.
Zuvor war sie weder an ihr privates Handy gegangen, noch an ihr dienstliches, noch an ihr Festnetztelefon, sie hatte nicht auf SMS und WhatsApp reagiert und jetzt auch nicht auf das Klopfen an ihrer Haustür. „Mia!“, rief er.
Stille.
Was, wenn sie in Ohnmacht gefallen war? Hilflos daheim auf dem Fußboden lag? Er biss sich auf die Lippe und holte seine Lockpicks heraus, schmale Metallstäbe, mit deren speziell geformten Enden man fast jedes Schloss aufbekam. Lindberg war schon einige Jahre Mitglied bei den Sportsfreunden der Sperrtechnik. Bei den Vereinstreffen demonstrierten Lockpicker, wie sie selbst modernste Sicherheitsschlösser knackten, ohne diese zu zerstören. Und zwar innerhalb von Sekunden.
So schnell war Lindberg zwar nicht, aber bisher hatte er noch jede Tür öffnen können.
Er führte den sogenannten Spanner in das Schloss ein, um die darin befindlichen Stifte einem leichten Druck auszusetzen. Mit der anderen Hand nahm er einen schmalen Pick, dessen Ende perfekt geformt war, um die Stifte im Schloss einzeln herunterzudrücken und bearbeitete jeden einzelnen Stift, bis er gesetzt war. Es dauerte keine Minute, dann klickte das Schloss und Lindberg schob die Tür auf.
Er schlich in die Wohnung, die überraschend hell und freundlich eingerichtet war. Er kam sich vor wie ein Einbrecher und blickte nur kurz in jedes Zimmer.
Mia war nicht da.
Er wollte gerade gehen, als sein Blick auf den Wohnzimmertisch fiel, auf dem ein Briefumschlag lag. Darauf prangte ein gelbes Logo mit drei konzentrisch angeordneten schmalen Halbkreisen, in deren Mitte eine Kugel ruhte. Darunter kein Text, kein Absender, der Brief war an Mia adressiert. Lindberg rieb sich die Stirn. Das Ganze sah nach einer Geheimorganisation aus.
Er zuckte mit den Schultern, verließ die Wohnung, das Haus und stieg in den Dienstwagen, einen Tesla. Bundespolizeichef Graf stand eben auf schnelle Autos, doch noch mehr stand er darauf, sich als moderner Macher profilieren zu können.
Lindberg zwang sich, wieder an den Fall zu denken. Noch in der Rechtsmedizin hatte ihm Katharina Zach – nachdem sie sich wieder beruhigt hatte – die bisher bekannten Fakten zu dem Toten mitgeteilt: Er hieß Chris Bernasconi und war vor acht Tagen von seiner Mutter als vermisst gemeldet worden. Sie hatte den Verdacht auf eine Entführung geäußert, weswegen die Bundespolizei ermittelt hatte. Es gab zwar keine Lösegeldforderung, aber Chris Bernasconi stammte aus einer vermögenden Familie und hatte angeblich vor seinem Verschwinden gesagt, dass er sich bedroht fühle. Doch zwei Tage später war Bernasconis Vater in die Bundespolizei gestürmt und hatte die Vermisstenmeldung zurückgenommen. Und nun war Chris Bernasconi in Sibirien aufgetaucht, dort massiv verstrahlt worden und nach ersten Erkenntnissen daran gestorben.
Mehr hatten die lokalen Behörden nicht mitzuteilen gehabt, die Ermittlungen zur Ursache der Verstrahlung seien ergebnislos gewesen, der Mann erst aufgefunden worden, als er schon verstorben war.
Also hatte man den Leichnam per Bleisarg in die Schweiz überführt und die Bundespolizei hatte die Ermittlungen wieder aufgenommen.
Das Bemerkenswerteste an dem Fall war jedoch das familiäre Umfeld des Opfers. Der Vater von Chris Bernasconi war Ernesto Bernasconi, Geschäftsführer von SWISS SUSTAIN ENERGY, jener Firma, die vor Kurzem alle Schweizer Atomkraftwerke von den kantonalen Energieerzeugern übernommen hatte, samt allen Entsorgungskosten. Ein politisch hoch umstrittener Deal, der nur möglich gewesen war, weil SWISS SUSTAIN ENERGY eine neue Endlagertechnologie entwickelt hatte, die angeblich alle Entsorgungsprobleme lösen sollte.
Und jetzt war sein Sohn tot und verstrahlt in Sibirien gefunden worden.
Lindberg war sich sicher, dass Mia mehr über SWISS SUSTAIN ENERGY wusste, als er je im Internet herausfinden konnte.
Er blickte noch mal durch die Seitenscheibe des Teslas auf Mias Wohnung und gab dann Gas. Lindberg fuhr in Richtung Autobahn und eine knappe Stunde später in Baden im Kanton Aargau von dieser wieder herunter. Der Aargau war der Atomkanton der Schweiz, also war es nicht weiter verwunderlich, dass Bernasconi hier residierte.
Oder eben doch, wenn man Atomkraftwerke für potenzielle Zeitbomben hielt.
Lindberg parkte den Wagen vor einer kubistischen Villa aus Sichtbeton, stieg aus und wurde am Eingangstor von einem Mitarbeiter eines lokalen Security-Unternehmens aufgefordert, sich auszuweisen. „Ich habe einen Termin“, Lindberg zeigte seine Polizeimarke. Der Security-Mitarbeiter schaute in einer Liste nach und nickte.
„Hat Ihr Auftraggeber Angst vor Anschlägen?“, fragte Lindberg.
Der Mann zuckte mit den Schultern, ihm schien es egal, wen oder was er bewachte, Hauptsache er wurde dafür bezahlt. Ein anderer Kollege führte Lindberg in ein Büro, an dem ein Mann um die sechzig hinter einem Schreibtisch saß. Graue Haare, hohe Stirn, randlose Brille, dunkler Anzug. Ernesto Bernasconi. Der Manager erhob sich und reichte Lindberg die Hand.
„Mein herzliches Beileid“, sagte Lindberg. „Wann wurden Sie über den Tod Ihres Sohnes informiert?“
„Vor zwei Tagen, die Botschaft hat uns angerufen.“
Lindberg setzte sich auf den Besuchersessel. „Was können Sie uns über Ihren Sohn erzählen, wie war er so?“
Bernasconi räusperte sich. „Er war sehr eigenwillig. Und er lebte ja schon länger nicht mehr daheim.“
Lindberg lupfte eine Augenbraue. Kein Wort über Trauer, den Schmerz, den Verlust. Bernasconi schien wie ein typischer Manager, der immer nur nach vorn blickte, selbst wenn er verbrannte Erde hinterließ.
Oder genau deshalb.
„Warum haben Sie die Vermisstenanzeige zurückgezogen?“
„Wir hatten Hinweise, dass sich Chris auf einem Selbstfindungstrip in Asien befindet.“
„Hinweise?“
Bernasconi kaute auf seiner Lippe herum. „Er hatte eine Postkarte geschickt.“
„Kann ich die mal sehen?“
„Ich … ich weiß nicht, ob wir die noch haben.“
„Ihre Frau hatte angegeben, Chris vor zehn Tagen das letzte Mal gesehen zu haben, hier in der Schweiz, drei Tage später hat sie ihn vermisst gemeldet und zwei Tage später haben Sie also diese Postkarte bekommen, richtig?“
Bernasconi nickte vorsichtig.
„Ganz schön schnell für eine Postkarte aus Asien, oder?“
Bernasconi petzte seine Lippen zusammen. Und Lindberg wartete. Für Menschen, die glaubten, sich rechtfertigen zu müssen, war Stille der größte Feind.
„Chris war häufiger verschwunden“, sagte Bernasconi schließlich. „Ich dachte, das wäre wieder so eine Phase und wollte das nicht überbewerten.“
„Ihre Frau hatte von einer möglichen Entführung gesprochen. Vor Ihrem Haus stehen Security-Mitarbeiter. Und Sie wollten das nicht überbewerten?“
Bernasconi seufzte. „Chris und ich hatten erhebliche Differenzen, ich wollte nicht, dass diese in die Öffentlichkeit getragen werden.“
Tja, das hat wohl nicht geklappt, dachte Lindberg, doch er wollte Bernasconi nicht noch zusätzlich reizen. „Was für Differenzen hatten Sie denn?“
Bernasconi rieb sich die Stirn. „Möchten Sie einen Kaffee?“
„Nein, danke.“ Lindberg lächelte unverbindlich.
Bernasconi blickte ausweichend aus dem Fenster. „Es war politischer Natur.“ Er atmete tief aus. „Wie Sie vielleicht wissen, bin ich der Geschäftsführer von SWISS SUSTAIN ENERGY und er war in der Antiatomkraftbewegung engagiert.“
„Dann hätte er doch froh sein müssen, dass Sie die Endlagerfrage gelöst haben“, sagte Lindberg.
„Wir hatten eine ideologische Auseinandersetzung“, antwortete Bernasconi. „Da ging es nicht um einzelne Erfolge.“
„Ist Ihre Technologie denn ein Erfolg?“
Bernasconi nickte und lächelte fast. Bei dem Thema schien er sich deutlich wohler zu fühlen als bei Fragen zu seinem Sohn. „Wir wandeln die radioaktiven Stoffe mittels Transmutation zu ungefährlichen Materialien um. Diese strahlen nur noch wenige Jahrzehnte statt einer Million Jahre.“
„Und das funktioniert einfach so?“
„Man hat weltweit seit über fünfzig Jahren daran geforscht. Vorstufe dieser Technologie war beispielsweise der Schnelle Brüter, bei dem man allerdings den Atommüll weiter angereichert hat, bis Plutonium entstanden ist. Wir machen im Prinzip das Gegenteil. Wir entziehen dem Atommüll die Radioaktivität.“
„Und das ist sicher?“