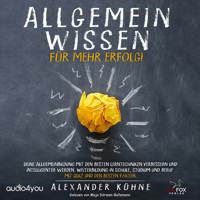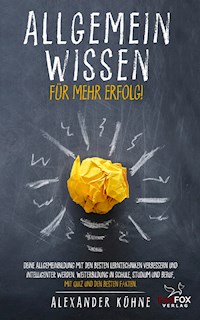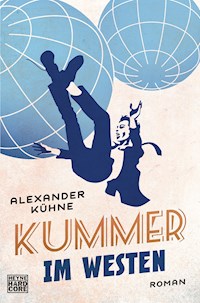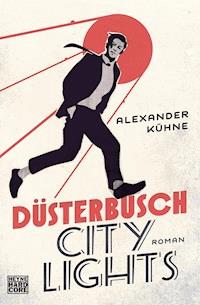
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Düsterbusch-Romane
- Sprache: Deutsch
»David Bowie spielt hier nicht, Anton.« – »Doch, irgendwann schon.«
Düsterbusch ist kein Ort für Helden. Nicht Preußen, nicht Sachsen, ein Kaff am Rande des Spreewalds. Anton wohnt hinter dem Mähdrescherfriedhof und träumt vom großen Leben. Bis er eine glänzende Idee hat: Sein Dorf soll Metropole werden, mit U-Bahn-Anschluss und Leuchtreklamen. Mit einer Handvoll Freunden macht er sich daran, mitten in der DDR einen Szene-Club nach Londoner Vorbild aufzuziehen. Alexander Kühne erzählt die Geschichte von einem, der bleibt und kämpft – aber nicht politisch, sondern mit den Waffen der Popkultur. Er erzählt von den großen Träumen im Kleinen und vom Scheitern einer Utopie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Mit Ausnahme der zeitgeschichtlichen Figuren sind die Charaktere in dieser Geschichte reine Fiktion, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt und rein zufällig.
Das Buch
»Es ging jetzt Schlag auf Schlag. Petticoat-Röcke wechselten mit Anzügen, Popperlocken mit verschnittenen Iros, Glatzen mit Schmalztollen, schwarze Nylons mit quietschgrünen Lederhosen und Doc-Martens-Stiefel mit Grufti-Schnabeltretern. Als hätte sich halb London nach Düsterbusch aufgemacht. Dabei kamen die alle aus Cottbus. Es war irre. Da waren echte Punks dabei, Modetanten, Existenzialisten und Lebenskünstler. Leute mit ganz anderen Biografien, dort geboren, wo Gegensprechanlagen sich miteinander unterhielten. Ich dachte an fahles Neonlicht, tot Hühnchen im Tiefkühlregal und ganz viel Plaste. Die Lumpenbrigade verschwamm vor meinen Augen, und ich kam mir auf einmal ganz banal vor, ein Dörfler mit herausgewachsener Bowie-Frisur. Aber ich wusste: Das war der Auftakt zu etwas Größerem.«
Der Autor
Alexander Kühne wuchs in Lugau, Brandenburg, auf. Nach der Lehre in einer Schraubenfabrik arbeitete er auf einem Kohleplatz, bei der Staatlichen Versicherung und verkaufte Modelleisenbahnen. Gleichzeitig organisierte er mit Freunden in seinem Heimatdort Konzerte mit Bands der DDR-Punk- und New-Wave-Szene.
1990 zog er nach Berlin und machte eine Ausbildung zum Fernsehjournalisten. Er schreibt für Film, Fernsehen und Zeitschriften.
ALEXANDERKÜHNE
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.
Weitere News unter facebook.com/heyne.hardcore
Copyright © 2016 by Alexander Kühne
Copyright © 2016 by Wilhelm Heyne Verlag, München,In der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Ulla Mothes
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel / punchdesign, München
Umschlagmotiv: © Martin Aleith / Pfadfinderei
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-16645-8V001
www.heyne-hardcore.de
Für meine Elternund alle Mitstreiter von damals.
Prolog
Irgendetwas trug mich durch die Nacht, scheinbar schwerelos. Ich drehte mich um. Fahl die Lichter des Bahnhofs im Hintergrund, oder waren es Positionsleuchten, der letzte Kontakt zur Welt? Vor mir nur Dunkel. Lief ich, oder fuhr ich? Plötzlich ein Knall, helle Blitze in meinem Kopf, in meinen Ohren kreischendes Schrammen, dann Stille. Ich sank immer tiefer. Quietschende Geräusche. Etwas fiel um.
»Mensch, Anton, was machst du denn hier?«, drang eine Stimme in meinen benebelten Schädel.
Ich schlug die Augen auf. Undeutlich sah ich die Räder einer Kutsche. Davor schemenhaft eine Fee unter Apfelbäumen. Sie half mir auf. Das Bild verschwamm und schärfte sich wieder. Die Kutsche war ein Minifahrrad und die Fee ausgerechnet Elke.
»Wo sind wir?«, fragte ich.
»Auf der Straße, kurz vor Düsterbusch.«
Ich dachte an ihre Titten, die ich damals anfassen durfte, mit dreizehn, als noch alles gut war. Ewigkeiten schienen seitdem vergangen. Ich versuchte, Elke zu küssen, doch sie zuckte zurück. »Dein Kopf ist ganz schief.«
»Bin, glaub ich, gefallen …«
»Soll ich dich mitnehmen?«
Ich nickte, was mich zum Schwanken brachte, setzte mich seitwärts auf ihren Gepäckträger, und wir schaukelten los. Meine Hände suchten Halt, fanden schließlich ihre weichen Hüften. Bei jeder Erschütterung sammelte sich Schmerz in meinem Kopf, bis er unerträglich wurde. Ich versuchte, meine Stirn zu ertasten, verlor das Gleichgewicht und fiel ins Dunkle mit dem Gesicht auf etwas Hartes. Es schmeckte nach Gummi, Gras und Kuhscheiße.
»Was hast du denn?« Elkes Stimme echote dramatisch, als sie sich über mich beugte. »Siehst irgendwie komisch aus.«
Ich quälte mich hoch, nahm die Landstraße wahr, halb verdauter Wermut schoss aus meiner Kehle in den Straßengraben. Dann spürte ich Elkes Hand auf meinem Rücken, ein kurzer Moment der Geborgenheit. Der bohrende Schmerz kam schnell zurück und verschwand wieder. Ich hockte mich erneut auf den Gepäckträger, und weiter ging es. Vor unserem Hoftor lud sie mich ab, ich taumelte gegen den Zaun, was ich ständig tat, aber irgendwas war heute anders.
»Kommste klar?«
»Ja«, presste ich hervor und schwankte auf den Hof, die Tür quietschte vertraut in den Angeln. Zum Glück regte sich nichts im Zimmer meiner Mutter. Sie wartete also nicht, um mich wieder mit Vorwürfen über mein verkorkstes Leben zu quälen. Ich schlich ins Haus. Nur noch schlafen, vielleicht für immer, war mein letzter Gedanke.
Ein heller Lichtstrahl auf meinem Gesicht weckte mich. Ich versuchte, den Kopf zu heben. Tonnenschwere Gewichte zogen mich auf das Kissen zurück. Mein Blick fiel auf den Satelliten. Ein wenig Erleichterung machte sich in mir breit, es war alles an seinem Platz. Doch dieser Moment währte nur kurz. Etwas Schwarzes, Undefinierbares engte mein Blickfeld ein, ich bekam Panik, setzte mich mit letzter Kraft auf. Jemand kam zur Tür herein.
Ich erkannte die humpelnde Silhouette meiner Mutter. Sie zog die Vorhänge zurück. Ich hörte einen kurzen Schrei und ihre verzweifelte Stimme. »Anton, wie siehst du denn aus?«
»Mir gehts scheiße, Mutti.«
»Bin gleich wieder da.« Türenschlagen. Der Satellit tauschte vor meinen Augen mit dem Kachelofen die Position. Ich legte mich wieder hin und zog die Decke über den Kopf. Ein kalter Luftzug und Hâttric-Rasierwasser kündigten meinen Vater an. Seit Jahren hatte er mein Zimmer nicht mehr betreten. Ich schlug die Decke zurück und sah verschwommen sein Gesicht über mir.
»Der ist doch wieder besoffen«, sagte er nur, und seine Stimme klang fern.
»Guck doch mal, wie der aussieht, der muss sofort ins Krankenhaus«, flehte meine Mutter.
»Ich muss zum Fußball.«
Ihre streitenden Stimmen entfernten sich, meine Mutter weinte. Ich quälte mich hoch zu einem kleinen Spiegel, der an der Wand hing. Im Rahmen steckte noch Connys Foto. Sie saß auf ihrem Fahrrad und lächelte mich an. Alles vorbei. Ich erblickte mein Gesicht und erschrak. Die Stirn, deren klassische Form meine Freundin einst rühmte, war aufgebläht wie ein Ballon und blauschwarz verfärbt. Die rechte Seite hing dicklippig über meinem Auge herunter. Mir wurde schwindlig.
Mit dem Kopf lag ich auf dem Schoß meiner Mutter, ich hatte mich ihr schon lange nicht mehr so nahe gefühlt. Sie strich zärtlich über mein Gesicht, ihr silberner Armreif streifte mein Kinn. Es schaukelte, und ich stellte fest, dass ich auf der Rückbank unseres Autos lag.
»Mensch, beeil dich! Der stirbt gleich!«, schrie sie meinen Vater an.
Danach dämmerte ich vor mich hin, verlor das Gefühl für Raum und Zeit. Ich lag in einem Zimmer, schräge Balken über mir. Manchmal hatte ich den Eindruck, Decke und Fußboden würden sich näher kommen und mich in die Zange nehmen. Der Text einer alten Genesis-Platte fiel mir ein, in dem es hieß: »Stalaktiten und Stalagmiten formen und verändern sich.« Ich rief nach meiner Mutter, bekam aber keine Antwort.
Eine Männerstimme sagte: »Der hat nichts, der kann Montag wieder raus.« Kurz danach bekam ich Schnupfen. Jemand hielt mir eine Schale unter die Nase und brabbelte was von »Gehirnwasser«. Plötzlich hatte ich klare Bilder im Kopf. Ich sah hinter dem Konsum von Düsterbusch vor glutrotem Himmel Hochhäuser aus dem Boden schießen, ich sah meine Mutter in ihrem Blut, Conny mit dem Kinderwagen und Sprenzel, wie er in Baades Tschaika saß. Die ganze Scheiße zog noch mal an mir vorbei.
Es war September 1989. Ich war vierundzwanzig Jahre alt, und meine Zeit in der Zone, wie ich die DDR nur noch verächtlich nannte, schien abgelaufen. Der Traum vom selbstbestimmten Leben in einer pulsierenden Großstadt hatte sich nicht erfüllt. Krepierte ich jetzt etwa in diesem nach Bohnerwachs stinkenden Zimmer?
01 Küsse an den Rieselfeldern
Im Alter von zehn Tagen geriet ich das erste Mal auf die schiefe Bahn. Schuld war der hemmungslose Konsum von Alkohol. Mein Vater hatte aus Freude über die Ankunft seines Sohnes an einem Oktobertag des Jahres 1964 mit Onkel Werner stark getrunken. Der war kein richtiger Onkel, mehr ein Saufkumpan meines Vaters. Tatort war die Kneipe von Düsterbusch. Ein Korn jagte den anderen.
»Los, Dicker, wir müssen …«, lallte Onkel Werner irgendwann, doch mein Vater war nicht mehr wachzukriegen.
Ein paar Stunden später schwankte Onkel Werner zur Tür des Krankenhauses Frankenwalde herein. Statt Blumen für die Mutti hatte er einen Dreizehner-Maulschlüssel in den öligen Fingern. Der Keilriemen seines F9 war unterwegs abgesprungen. Ohne Gratulationskitsch verfrachtete er Mutter und Kind in sein Auto. Von Fehlzündungen unterbrochen und mit reichlich Promille auf dem Kessel, raste er aus der Kreisstadt über die Landstraße. Irgendwo im Wald passierte es: Der Keilriemen riss, sein F9 wurde aus der Kurve getragen. Das Auto überschlug sich und landete im Straßengraben. Diese rasanten Richtungswechsel stifteten erste Verwirrung in meinem zarten Gehirn. Äußerlich unverletzt wurden Mutter und Kind aus den Trümmern geborgen. Mit einem Krankentransport kam ich zurück in die Klinik. Ein Halswirbel hatte etwas abbekommen. Meine Mutter stieß Flüche auf meinen Vater gen Himmel, während mir eine Krause angelegt wurde. Dann kam ich endlich in mein Heimatdorf.
Düsterbusch lag in der Mitte zwischen Dresden und Berlin und trotzdem irgendwo am Rand. Nicht Preußen, nicht Sachsen. Nicht Spreewald, nicht Braunkohle. Auf den ersten Blick ein Dorf wie alle im Osten. Der Konsum, das LPG-Büro, der Sportplatz und die meisten der Gehöfte und Wohnhäuser säumten beidseitig die von Schlaglöchern verwundete Hauptstraße. Dazwischen das zugewachsene Kriegerdenkmal, ein riesiger Findling, auf dem der deutsche Adler thronte. Niemand kümmerte sich mehr um ihn. Dumpf sein Blick aus schimmligen Augen über die Dorfaue, die von der Bache durchzogen wurde, einem verkrauteten Seitenarm der Schwarzen Elster.
In der Dorfmitte, wo die Hauptstraße einen Knick machte, lagen die beiden Wahrzeichen des Ortes: eine große gotische Kirche mit zwei majestätischen Türmen, die von Weitem wie überdimensionale Schnapsflaschen aussahen. Gegenüber stand die Kneipe, in der mein Vater eingepennt war.
Die Kneipe war das kulturelle Zentrum von Düsterbusch. Angeblich hatte hier schon im Mittelalter der als Popstar geltende Walther von der Vogelweide seine Hits gespielt. Einst hieß sie Zur Linde, weil ein riesiger Baum den Vorplatz zierte. Später sägten die Kommunisten die Linde ab und tauften den Laden in Konsum-Gaststätte Düsterbusch um. Die Genossen hatten eben keinen Sinn für Romantik. Der Volksmund behielt jedoch den alten Namen bei. In der Linde wurden die Männerfastnacht, Hochzeiten und Erntedankfeste gefeiert. Vor allem sonntags stapelten sich zig Fahrräder am Eingang, wenn die Düsterbuscher beim Frühschoppen soffen, als ob es kein Morgen gäbe.
Meine Mutter war eher durch Zufall nach Düsterbusch geraten und sagte später immer: »Das Schlimmste, was mir passieren konnte, war dieses elende Kaff.«
Eigentlich kam Elisabeth Schmidt aus Berlin. Nach dem Krieg musste sie dort mit anderen ehemaligen BDM-Mädchen Munition wegräumen. Sie machte den Rücken krumm und malte sich mit Kohle das Gesicht schwarz, damit sie möglichst hässlich aussah, denn die Soldaten der Roten Armee wurden zudringlich.
Bald tauchten neue Marschierer auf, sie trugen jetzt blaue Hemden und versprachen, dass in ihrem Reich die Sonne niemals untergehe. Elisabeth ließ sich anstecken vom Programm der Freien Deutschen Jugend, vom Klang der Trommeln und Schalmeien. »Nie wieder Krieg«, das klang so schön – eine Vision, für die es sich zu kämpfen lohnte. Sie trat der FDJ bei und wurde Mitglied der SED, einer neuen Partei, die das bessere Deutschland wollte.
Schon immer gut in Mathe entschied sie sich, Lehrerin zu werden. Die Bildung lag brach im sowjetischen Sektor. Die alten Pädagogen, meist Nazis, hatten Berufsverbot bekommen oder waren in den Westen getürmt. Elisabeth verließ Berlin und zog durch die Lande, im Kopf den Satz des Pythagoras und im Herzen den Sieg des Sozialismus. Die Schulen, an denen sie unterrichtete, waren provisorisch, die Klassenräume überfüllt. Ihre blauen Augen versprühten Wissen und Begeisterung für die neue Sache. Die barfüßigen Dorfkinder verehrten sie, denn meine Mutter konnte motivieren und zog auch die Schwächsten mit.
Einer ihrer Kollegen war Hans, ein braunhaariger Schönling und Sohn gläubiger Protestanten. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ein halbes Jahr lang trafen sich die beiden, bis er eines Tages einfach so Schluss machte. Seine Eltern verbaten ihm den Umgang mit einer Kommunistin. Dabei war sie gar keine, zumindest keine richtige, wie sie später immer betonte.
Dass Hans gehorchte, traf meine Mutter hart. Wenn sie sich schon verliebte, dann für ein ganzes Leben. Dieses Leben schien ihr plötzlich nicht mehr viel wert, sie nahm Tabletten. Ihre Schwester fand und rettete sie. Einer von der Partei rügte sie am Krankenbett: »Elisabeth, der Suizid ist etwas zutiefst Bürgerliches und dient nicht der großen Sache.«
Meine Mutter gelobte Besserung und versprach, ihr Dasein nun ganz der Idee Lenins zu verschreiben. Nach ihrer Genesung wurde sie nach Düsterbusch delegiert – eine große Frau, die Hochdeutsch sprach und Kostüme trug. Ihre verwundete Seele verbarg sie hinter einem strahlenden Lächeln. »Die ist aus Berlin«, raunten sich die Bauernburschen zu und rannten ihr hinterher, wenn sie mit ihren langen Beinen die Dorfaue überquerte.
Zu ihren Verfolgern gehörte auch Klaus Kummer. Er ging bei ihr zur Schule. Klaus war ein ständig Witze reißender Junge, der im Matrosenanzug die Dorfstraße unsicher machte. Seine Mutter, meine Oma Else, mästete ihr einziges Kind nach dem Krieg mit Sahne und guter Butter. Sie war eine einfache Frau, eine Seele von Mensch, und hielt die Versorgung von Klaus mit reichlich Fett nach all den mageren Jahren für eine gute Sache. Das Resultat: Sein Hintern und sein Bauch wuchsen bedenklich an und brachten ihm den Spitznamen »Dicker« ein. Als der Matrosenanzug aus allen Nähten platzte, hatten sich die Mitschüler mit ihren Hänseleien auf ihn eingeschossen.
Zum Heulen ging er in seine »Bude«, ein aus Blättern und Zweigen errichtetes Häuschen, und ließ die angestaute Wut an Fröschen aus. Er blies sie auf und brachte sie mit einer Nadel zum Platzen.
Mit zunehmendem Alter verebbten die Hänseleien, denn er wurde trotz seiner Körperfülle ein exzellenter Fußballer und standfester Kampftrinker. Ausgerechnet diesem tief in der Dorftradition verharrenden jungen Mann brachte meine Mutter Mathe bei und einige Monate später auch noch was anderes.
Sie ließ sich mit einem Bauernburschen ein, der ihr Schüler war, sechs Jahre jünger und obendrein einen Kopf kleiner als sie. Vielleicht wollte sie nach der Enttäuschung mit Hans einen jüngeren Mann, der sie vorbehaltlos anhimmelte. Oder die Torschlusspanik setzte ein, sie war ja schon Mitte zwanzig. Es wird mir immer ein Rätsel bleiben, was diese beiden Menschen zusammenbrachte.
Anfangs durfte niemand etwas von ihrer Beziehung erfahren. Die Turteltäubchen trafen sich außerhalb von Düsterbusch, ganz romantisch an den Rieselfeldern, wo die Exkremente der Werktätigen aus der Kreisstadt Frankenwalde gewässert wurden. Meine Mutter lehrte Klaus das Küssen, während sie sich gegenseitig die Nasen zuhielten. Klaus genoss die Aufmerksamkeit der blonden Erscheinung, er konnte mit ihr prahlen, welcher Schüler war 1956 schon mit seiner Lehrerin zusammen? Durch seinen beschwingten Stolz kam ihre Beziehung an die Öffentlichkeit. Das System zeigte sich das erste Mal von seiner unerbittlichen Seite. Meine Mutter musste sich beim Schulrat für ihr Verhalten verantworten. Da sie eine Lösung der Verbindung ablehnte, blieb nur eines: Heirat. Um nicht zu viel Wirbel auszulösen, feierten sie zu zweit Hochzeit im Fichtelgebirge und zogen danach zusammen. Klaus war gerade achtzehn geworden. Ihr neues Domizil gehörte seinen Eltern.
Es war eine aus Kuhscheiße und Lehm gemauerte Kate. Die Decken hingen so tief, dass ich mir später immer den Kopf daran stieß. Die noble Adresse war der Nordweg 6. Das Wohnzimmerfenster gab den direkten Blick auf den Kuhstall der LPG frei. Nur im Sommer wurde dieses Panorama von einem davor liegenden Sonnenblumenfeld getrübt.
Die ersten Jahre lebten sie unbeschwert. Klaus – ausgestattet mit einem derben, treffenden Humor – brachte meine Mutter zum Lachen, er profitierte von ihrem flirrenden Wesen.
Er lernte Schlosser und ließ sich von ihr überreden, auch in die SED einzutreten. Sie fütterte ihn mit ideologischer Literatur. Nikolai Ostrowski und Ilja Ehrenburg lagen jetzt unter seinem Kissen. Er las allerdings nie darin. Spartacus sollte Jahre später seine einzige Lektüre werden, und das auch nur bis zur Hälfte. Dagegen glänzte er weiterhin beim Fußball. Meine Mutter feuerte ihn an, wenn er als Mittelfeldstratege von Einheit Düsterbusch die Bälle verteilte. Er war der geborene Spielmacher und sorgte entscheidend dafür, dass die Mannschaft von der Kreisklasse in die Kreisliga aufstieg. Dünner wurde Klaus dadurch aber nicht. Bei Hektolitern Bier ließ er sich nach den Spielen in der Linde von Bewunderern huldigen. Das führte zu ersten zarten Spannungen. Denn mit zunehmendem Erfolg widersprach er immer öfter seiner Frau und fand Gefallen an gleichaltrigen Mädchen, die ihm auf dem Sportplatz zujubelten.
Meine Mutter wurde ein geachtetes Dorfmitglied und fungierte nicht nur als Mathelehrerin, sondern gründete auch eine Kabarettgruppe an der Schule. Sie schrieb selber Stücke wie »Die Frauentagswette« und »Guten Tag, Frau Briefumschlag«, die den Sozialismus feierten und ihn mit seinen kleinen Fehlern auf die Schippe nahmen. Doch blind vereinnahmen ließ sie sich nicht. Heimlich gab Elisabeth Kummer Geld für die Sanierung der Kirche und schwärmte für Elvis, dessen Platten sie sich bei Kurztrips nach Westberlin kaufte. So viele Widersprüche in einem Menschen, das schrie nach geistigem Austausch und Reibung. Doch da war sie bei meinem Vater auf Dauer an der falschen Adresse.
»Du musst dich mal als Mensch entwickeln«, maßregelte meine Mutter ihn.
»Nur der Schaum im Bierglas entwickelt sich, wenn das Fass noch frisch ist«, entgegnete er.
Sie träumte von einer neuen Gesellschaft, er von Eisbein mit Sauerkraut.
Immer häufiger kritisierte er sie für ihr Engagement. »Das passt nicht aufs Dorf, Elisabeth«, schimpfte er, wenn sie bei der Männerfastnacht an das Mikro trat und derbe Verse zum Besten gab. Sie solle lieber lernen, wie man Rouladen macht, jede Woche die Gardinen waschen und die Füße still halten. Die Frauen seiner Fußballkumpels machten das so, und er wollte nicht aus der Rolle fallen.
»Du bist ’n Duckmäuser und Einfaltspinsel«, konterte meine Mutter. Immer häufiger kam es zu lauten Streits. Irgendwann wurde das Sonnenblumenfeld vor ihrem Wohnzimmerfenster untergepflügt. Ein Landmaschinenfriedhof entstand. Rostige Pflüge neben ausgedienten Dreschmaschinen.
Dieses morbide Panorama passte zum Niedergang ihrer Beziehung. Weil es zu Hause immer mehr kriselte, widmete meine Mutter ihr ganzes Wesen der Schule. Jeden Tag sechs Stunden am Lehrertisch stehen, dann Kabarett und abends Dorfclub. Ihre Beine litten immer mehr vom langen Stehen und Laufen. Sie bekam Krampfadern. Furchen durchzogen ihr gut geschnittenes Gesicht.
Ein zusätzlicher Schicksalsschlag war der Bau der Mauer. Offiziell begrüßte sie den notwendigen Schritt ihrer Genossen. Aber insgeheim war sie traurig, dass sie ihre Verwandten nicht mehr sehen konnte. Und Elvis-Platten galten jetzt als Teufelswerk. Es musste etwas Neues her, an dem sie sich erfreuen konnte. Irgendwas, was sich bewegte und was sie nach ihren Wünschen verändern konnte. Und nun, als ich vor ihr im Bettchen lag, gerade dem frühen Tod entronnen, begriff sie, dass das Leben doch einen Sinn hatte. Sie schaute hinüber zum Kuhstall und flüsterte liebevoll: »Aus dir wird mal was ganz Besonderes.«
02 Erquickung für Körper und Geist
»Da musst du durch, Kleener, damit du nicht krank wirst«, schnarrte meine Mutter im Lehrerbefehlston und spritzte mich mitten im Dezember mit eiskaltem Wasser aus einem Schlauch ab. Ich schlug in der Badewanne abwehrend die Hände über dem Kopf zusammen, während die feindliche Wasserfront auf meinen spindeldürren Körper klatschte. Ich hatte das Gefühl, Eisbären krallten sich in meine Zehen, und schrie wie am Spieß. Nach dieser Tortur frottierte sie mich mit einem Handtuch ab. »Kaltes Wasser am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen«, reimte sie und überhäufte mich mit warmen Küssen. Mein kleiner Emotionshaushalt hüpfte hoch und runter. Diesen Abhärtungsarien folgten Tage, an denen ich sie gar nicht sah.
Den größten Teil meiner Kindergartenzeit verbrachte ich bei Oma Else. Sie wohnte im Nachbarhaus. Bei ihr roch es immer gut, und sie fütterte mich mit Plinsen – Spreewälder Eierkuchen –, die man mit Zucker und Butter bestrich. Deshalb geriet sie oft in Streit mit meiner Mutter, die mir am liebsten nur geriebene Möhrchen und Fallobst verabreichen wollte. »In drei Jahren ist der ’n Pfannkuchen auf Beinen, Mensch«, herrschte sie meine Oma an.
»Aber der muss doch essen, Elisabeth«, jammerte Oma Else ihrer Schwiegertochter vor.
»Damit er so aussieht wie dein Sohn, oder was?«
Zu Hause gab es dann wieder gedämpfte Kartoffeln, klein geschnittenen Rettich und rohe Futterrüben. Manchmal knirschte es beim Kauen.
»Hab dich nicht so, Dreck reinigt den Magen«, war dann Mutters Kommentar, schließlich sollte aus mir ein sportlicher, von den Früchten der Erde gestählter Typ werden.
Oma Else fiel an einem Montag um, als sie den Ofen in der Waschküche mit Reisig befeuerte. Ich sah meinen Vater das erste Mal weinen und Oma Else nie wieder.
Nach ein paar Wochen der Anstandstrauer entwickelte mein Vater eine regelrechte Vergnügungssucht. Vielleicht wollte er den Verlust von Oma Else wegtrinken. Meiner Mutter schien das recht zu sein, denn beim Saufen verstanden sie sich immer noch prächtig. Fast jeden Sonnabend brausten die beiden zu einer anderen Tanzveranstaltung ab. Seit Oma Elses Tod gab es aber niemanden mehr, der abends auf mich aufpasste. Es wurden Tanten und Nachbarn bemüht, bei denen sie mich ohne viel Federlesens abparkten. Ich erinnere mich an abweisende Gesichter und verschnörkelte Kaffeekannen, an die Pendel der Standuhren, die damals noch in vielen Wohnzimmern die bleierne Zeit verkörperten. Und an eine Frau, die sehr alt war, leuchtend rote Farbe auf ihren Fingernägeln trug und mir Backpfeifen gab, wenn ich etwas fallen ließ. Schreiend und mit den Füßen stampfend, machte ich meinen Eltern klar, dass ich zu diesen Leuten nicht mehr wollte.
Schließlich gab meine Mutter nach. »Wie du willst. Dann bleibst du eben allein!«
Beim sonnabendlichen Betriebsvergnügen des VEB Kraftverkehr war es dann so weit. Ich wusste inzwischen, wie man den Fernseher bediente, und ergötzte mich an den laufenden Schwarz-Weiß-Bildern. Doch schon bald sehnte ich mich nach Gesellschaft. Also hielt ich Zwiesprache mit meinem großen Teddy Puck, aber der schaute nur desillusioniert aus seinen mit Fell verhangenen braunen Knopfaugen über den Mähdrescherfriedhof. Eine Form frühen Ostfrustes übermannte mich. Beklemmende Einsamkeit gepaart mit der Angst davor, dass überhaupt nichts mehr passiert. Ich drehte meinen Brummkreisel auf dem Kinderteppich. Ein wenig Bewegung in einem lähmend stillen Düsterbusch zu Beginn der Siebzigerjahre. Doch je öfter der Kreisel austrudelte, desto einsamer fühlte ich mich.
Als die Konturen der Landmaschinen vor unserem Fenster sich gegen den dunkler werdenden Himmel schärften, nahm eine große Verlorenheit von mir Besitz. Ich rief nach meinen Eltern, rannte durch die kleinen Räume unseres alten Hauses und knipste überall das Licht an. Ich hatte keine Angst vor bösen Menschen, ich wollte nur einfach nicht allein sein. Aus Scham traute ich mich aber nicht, zu den Nachbarn zu gehen. Als schließlich der Fernseher nur noch Streifen zeigte, bekam ich Panik. Mitten in der Nacht zog ich mir eine dicke Jacke über den Schlafanzug und ging nach draußen. Ich stiefelte los über die Pfützen des Nordwegs zur Hauptstraße, blieb stehen und lauschte. Immer wenn sich der Lichtkegel eines Autos am Kuhstalltor brach, hielt ich den Atem an und hoffte, dass meine Eltern nach Hause kamen. Bei jedem Gefährt, das einfach weiterfuhr, wuchs meine Angst.
Von der Linde wehten Musik und Lachen herüber. Ich rannte los, dort waren meine Eltern bestimmt. Erleichtert bummerte mein kleines Herz. Die Gaststube war hell erleuchtet und die Fahrradparade davor beachtlich. Ich stürmte um die Ecke durch das geöffnete Hoftor zu den Saalfenstern, die im Takt der Musik lautstark schepperten. Im Schein des riesigen Kronleuchters sah ich, wie sich lachende Erwachsene im Kreis drehten.
Ich zog mich auf ein Fensterbrett und blieb mit dem Gesicht an der Scheibe kleben. Meine Augen suchten fieberhaft den blonden Dutt meiner Mutter. Doch Fehlanzeige, meine Eltern schienen nicht da zu sein. Auf der Bühne stand eine Kapelle. Die Musiker hatten gerötete Gesichter, bliesen in Trompeten oder spielten Gitarre. Dazu sang eine Frau im Glitzerkleid »Häng den Mond in die Bäume«. Das Lied hatte ich mal im Radio aufgeschnappt.
Die Furcht war wie weggeblasen. Jetzt hatte ich direkten Kontakt zur Welt. Hier waren Bewegung, Austausch, Fröhlichkeit. Irgendwann betraten zwei Männer die Terrasse und liefen merkwürdig torkelnd Richtung Toilette. Ich versteckte mich schnell unter dem Betonvorbau, um, nachdem sie weg waren, gleich wieder meinen Stammplatz einzunehmen. Hochnäsig blickende Kellner in schwarz-weißen Uniformen schoben sich mit Tabletts in den Händen durch die Menge. Darauf standen langstielige Gläser, deren flüssiger Inhalt bei jedem Rempler überschwappte. Als ich meine Knie kaum noch spürte, trat ich den Heimweg an und tänzelte irgendwie befreit am Kuhstall vorbei.
Es folgten noch viele solcher Wochenenden. Ich schlich immer wieder zum Saal und schaute dem Treiben gebannt durch die Fenster zu. Manchmal waren meine Eltern auch dabei. Ich staunte nur, dass meine Mutter von fremden Männern durch die Menge geschoben wurde. Ein paar Meter weiter verhakte mein Vater seinen Arm mit ebenfalls fremden Frauen und trank ruckartig aus kleinen Gläsern. Danach küssten sie sich auf den Mund.
Wenn sie im Morgengrauen nach Hause kamen, lag ich im Bett – vor mir die Vision eines pulsierenden Nachtlebens, dessen Teil ich irgendwann werden wollte. Und dann würde ich nie wieder einsam sein.
03 Eine Nacht mit Alice Cooper
Ich war stolz wie Bolle, als ich 1971 in Raum eins der Polytechnischen Oberschule Düsterbusch meine Zuckertüte entgegennahm. Sie war riesengroß, mit goldenen Sternen verziert und erregte Aufsehen. Während die anderen verklebte VEB-Hustenbonbons aus ihren jämmerlichen Pappzylindern hervorpulten, regnete es aus meiner bunte Riegel und Kaugummi. Es waren Geschenke von meiner sagenumwobenen Tante Klara. Sie lebte in Westberlin, einer Märchenstadt jenseits meiner Vorstellungswelt.
Durch die bunten Süßigkeiten hatte ich blitzschnell jede Menge Freunde. Bemerkenswert erschien mir Elke Lippschitz, eine Grazie mit straßenköterblonden Haaren und himmelblauen Augen, die immer an den falschen Stellen lachte. Unter ihrem Pulli wölbten sich schon damals zwei beachtliche Hügel, und sie hatte Connections zu welchen aus der dritten Klasse. Dann war da noch Matthias Felder, der Sohn des Pfarrers. Er musterte mich immer tiefgründig aus seinen Knopfaugen. Sie hatten Ähnlichkeit mit meinen Toffifee, die er in Windeseile verdrückte. Der dritte hieß Steffen Naumann, ein blonder Mecki-Typ. Ohne Danke zu sagen, schnappte er sich meine Kaubonbons, und als ich ihn später einmal im Sechzigmeterlauf schlug, warf er mit Steinen nach mir.
Die Schule machte mir in den ersten Jahren keine Probleme. Mühelos bewältigte ich Schreiben und Heimatkunde, indem ich »geschickt aktuelle Ereignisse mit einbezog«, wie mir die Klassenlehrerin ins Zeugnis schrieb. Zusätzlich engagierte ich mich in der AG Fußball und erwarb schon mit acht Jahren die erste Schwimmstufe.
Meine Mutter war extrem stolz, ihr kleiner Prinz entwickelte sich. Sie glaubte, dass ich jetzt ohne Weiteres zu einem vorbildlichen Schüler reifen würde. Schon damals war es mir allerdings peinlich, wenn sie in den Pausen an meiner Kleidung herumnestelte oder mir vor allen die Haare kämmte. Steffens Häme ließ nicht lange auf sich warten. Er rief mich »Muttipfeife«. Das hatte erste Kinderschlägereien zur Folge, bei denen uns die Hofaufsicht in der Zehnerpause nur mit Mühe trennen konnte.
Einer hielt dabei immer zu mir. Es war Frank Sprenzel. Mit ihm teilte ich meine Westschätze am liebsten. Er hatte am ersten Schultag gar keine Zuckertüte gehabt und lief meistens mit gesenktem Kopf herum. Die fettigen hellbraunen Haare ergossen sich wie ein Wasserfall in sein rundes Gesicht. Sprenzel war ständig Mode bei den Lehrern, weil er absolut nichts kapierte. Das machte ihn natürlich angreifbar. Steffen Naumann sagte fast jeden Tag dreimal »Du bist doch hässlich« oder »Du stinkst« zu ihm.
Dann lief Sprenzel heulend nach Hause oder drohte damit, seinen Bruder Dietmar zu holen. Doch der kam ihm nie zur Hilfe, denn er saß im Knast. Um ihn rankten sich Gruselgeschichten, die von Einbruch, Republikflucht und Schneisen der Zerstörung handelten.
»Typische Assi-Familie«, sagte mein Vater mal beim Abendbrot.
»Halt dich fern von dem«, rügte auch meine Mutter.
Das machte mich neugierig, und bald saßen Sprenzel und ich zusammen in der letzten Reihe und beschossen die anderen mit Krampen. Deshalb flogen wir oft aus dem Unterricht und mussten vor der Tür stehen. Dann klauten wir die Fruchtmilch aus den Kästen, die für die Zehnerpause bestimmt waren. An uns beide traute sich Naumann nicht ran. Und wenn doch, rächten wir uns und packten ihm einmal einen verstümmelten Frosch auf seine Stulle.
Mit unseren Kinderfahrrädern legten wir riesige Strecken zurück. Wir fuhren zum zwei Kilometer entfernten Kirchhausener Bahnhof und schauten den Zügen hinterher. Von dort aus konnte man in alle vier Himmelsrichtungen fahren. Zumindest so weit, bis der Sozialismus zu Ende war.
Ich erledigte Sprenzels Hausaufgaben, und er schenkte mir leere Munitionshülsen, die er auf einem Schießplatz der Russen gesammelt hatte. Die goldenen Geschosse trug ich ständig in den Taschen meiner kurzen Lederhosen mit mir herum.
Eines Nachmittags nahm er mich mit zu sich. Ich kannte niemanden, der je bei seiner Familie gewesen war. Im Dorf genossen sie Außenseiterstatus. Sprenzels Eltern waren nie in der Kneipe zu sehen. Auch beim Einkauf im Konsum hielten sie sich von den anderen fern und sprachen wenig.
Aufgeregt trat ich durch ein großes Holztor. Vor mir lag ein riesiger, von Treckerreifen zerfurchter Hof. Charly, Sprenzels Hund, kläffte heiser, um dann gleich wieder in seiner Hütte zu verschwinden. An seinem buschigen Schwanz klebten Sägespäne. Auf der linken Seite des Hofes lagen das Wohnhaus und die Waschküche, auf der rechten ein paar verfallene Ställe mit halb offenen morschen Türen. Überall lagen alte Holzbohlen und Feldsteine kreuz und quer übereinandergeschichtet. Hier gab es hinter jeder Ecke irgendwas zu entdecken. Wir fütterten die Schweine, dann malten wir mit Kreide eine Zielscheibe auf die Stalltür und warfen unsere Taschenmesser drauf. Danach guckten wir in der Waschküche Sesamstraße.
Als der Nachmittag zur Neige ging, begann Sprenzel unruhig auf dem abgeschabten Stuhl hin und her zu rutschen. Das Hoftor knarrte, und Charly bellte. Ein sicheres Zeichen, dass Herr Sprenzel aus dem Betonwerk kam.
»Frank, scher dich auf den Hof«, hörten wir ihn brüllen. Sprenzel sprang auf, und ich folgte ihm nach draußen.
Ein schmallippiger rotblonder Mann mit nikotinverfärbtem Schnauzer stand vor uns, die Hände in die Hüften gestemmt. Auf seinem linken Unterarm prangte eine verblichene Ankertätowierung. Er trug einen kalkverschmutzten Arbeitsanzug und hatte eine Zigarette zwischen den Fingern der rechten Hand. Mit der deutete er auf unsere Schuhe, die nicht in einer Reihe standen.
»Wie bei de Polen sieht’s hier aus«, krächzte er mit Raucherstimme.
»Ja, Vati«, hauchte Sprenzel.
Als ob er einen Fußball trat, kickte der Vati Sprenzels Schuhe über den Hof.
»Und jetzt stellste die hin, wie es sich gehört«, polterte er und beäugte Sprenzel lauernd.
Der trottete mit gesenktem Kopf los, um seine Schuhe zu holen. Ich schlotterte vor Angst.
»Schlaf nich ein, Mensch«, bellte Herr Sprenzel. Schnell klaubte Frank seine Treter zusammen.
Ich wollte nur noch weg. Da zog der Alte an seiner Zigarette und wandte sich an mich. »Benimmst du dich bei Frau Lehrerin auch wie so ’n Doofkopp?« Stakkatoartig entwich beim Sprechen der Rauch aus seinem Mund, während seine blassblauen Augen mich taxierten.
Dumpfer Zorn brodelte in mir, und ich wollte etwas sagen, traute mich aber nicht.
Als Sprenzel seine Schuhe vor ihm abgestellt hatte, gab der Vater ihm links und rechts schnelle Ohrfeigen, packte sein Kinn, drückte es nach oben und guckte ihm in die Augen.
»Wie heißt das?«
Sprenzels Blick war eine Mischung aus Trotz, Trauer und Verachtung. »Kommt nicht mehr vor, Vati«, sagte er laut. Herr Sprenzel ließ von ihm ab. Dann griff er in seine Hosentasche und wurde plötzlich leutselig.
»So, und jetzt holt ihr mir zwee Flaschen Bier.«
Zusammen liefen wir über die Hauptstraße hinauf an der Kirche vorbei zum Konsum. Ich hatte weiche Knie, und wir sagten beide kein Wort. Bauer Brahmke quälte sich mit seinem alten Fahrrad und zwei Milchkannen links und rechts am Lenker die Straße hinauf. Wir sagten artig Guten Tag, aber er grunzte nur und trat mit seinen Holzpantinen in die Pedalen.
Zu Hause umarmte ich meinen Vater impulsiv. Er wusch gerade sein Auto. Ich war so froh; gegen Herrn Sprenzel kam er mir wie ein Märchenonkel vor.
Im folgenden Sommer traten Sprenzel und ich die erste große Reise an. Unsere Väter kannten sich von der Arbeit im Betonwerk, deshalb durften Frank und ich zusammen in das Betriebsferienlager nach Rügen, und zwar für ganze drei Wochen. Wir waren riesig aufgeregt, schmiedeten am Dorfgraben Wanderpläne und träumten von den weißen Schiffen auf der Ostsee.
Als der Ferienlagerbus an der Düsterbuscher Haltestelle stoppte, umarmte meine Mutter mich innig, denn drei Wochen hintereinander waren wir bisher nicht getrennt gewesen. Sprenzel schaute bedröppelt, und mir war es peinlich. Ich spürte, dass ihn noch nie jemand umarmt hatte.
»Ich spendier dir ’nen Himbeersirup«, sagte ich, um ihn zu trösten.
Nach sechs Stunden Fahrt kamen wir in einem Dorf auf Rügen an. Die Luft flirrte vor Hitze. Ich sah das erste Mal das Meer, und einen Moment lang war ich wie betäubt von dieser Weite. Bisher hatte ich nur bis zum Kuhstall gucken können.
Als ich abends mit meinem Kulturbeutel in den Waschraum ging, wurde Sprenzel von mehreren Älteren gepeinigt. Sie pietschten ihn in einer Ecke mit nassen Handtüchern, die sie zusammengerollt hatten. Brüllend versuchte er, seine Gliedmaßen zu schützen. Ohne nachzudenken, ging ich dazwischen. Mir gelang es, einem dieser Typen die Pietsche zu entreißen. Mit klatschenden Treffern auf seine Beine trieb ich ihn an die Wand. Er war einen Kopf größer als ich und hatte eine Affenschnute. Sein Name war Hans-Jörg, und er war der Sohn des Lagerleiters. Meine Wut verlieh mir ungeahnte Kräfte, doch ich hatte keine Chance. Als sie mit Sprenzel fertig waren, gaben mir seine Kumpane von hinten den Rest. Mit roten Striemen übersät, lagen wir danach in der Ecke, direkt neben den Fußwaschbecken. Bräunliches Wasser tropfte aus den Hähnen darüber.
Am nächsten Morgen wurde ich unsanft geweckt. Der Lagerleiter zog mich an den Ohren aus dem Bett.
»Wie hast du denn den Hans-Jörg zugerichtet?«, schimpfte er.
»Die haben angefangen.« Ich versuchte, mich aus dem schmerzhaften Griff zu befreien.
»Du hast drei Tage Frühstücksverbot. Und hier wird niemand mehr zusammengeschlagen.« Ich war fassungslos angesichts dieser Ungerechtigkeit. Während die anderen morgens beim Essen saßen, musste ich den Appellplatz harken.
Auf dem Weg zur Schnitzeljagd holte Sprenzel Marmeladenbrote aus den Taschen seiner Lederhosen und gab sie mir.
»Ohne Butter, wie du es magst«, flüsterte er. Ich verdrückte sie voller Heißhunger.
»Mensch, Sprenzel, du bist in Ordnung.«
»Und du erst.« Wir ließen unsere Hände aufeinanderklatschen und schworen uns ewige Freundschaft wie Huck Finn und Tom Sawyer.
Die nächsten drei Wochen verbrachten wir mit nervigen Geländespielen, Frühsport und erwehrten uns allerlei Schikanen der Älteren. Manchmal heulten wir auch vor Heimweh, und am Strand las ich ihm aus Die Reise nach Sundevit vor. Dann blinzelten wir, auf unsere Ellenbogen gestützt, über das Meer.
»Kommt man von hier aus bis nach Afrika?«, fragte Sprenzel in die bräsige Stille.
»Nee, die Ostsee ist ein Binnenmeer. Irgendwo dahinten ist Schweden, und dann ist Schluss.« Ich zeigte über das Meer, um meine Schlauheit zu unterstreichen.
»Oh, Anton, was du alles weeßt. Du könntest wie Steffen der Beste sein.«
»Das ist doch langweilig.«
»Ich bin doch ooch langweilig.«
»Nee, du bist Sprenzel.«
Am letzten Tag, bevor es nach Hause ging, war Disco im Essensaal. Alle freuten sich schon drauf. Sprenzel und ich durften Girlanden an die Decke hängen, während Hans-Jörg mit Kreide »D.I.S.K.O.« an die Tafel malte.
»Disco wird mit C geschrieben«, rief ich.
»Halt’s Maul, du Einzeller«, ranzte er mich an. Zu allem Überfluss bediente er auch noch das Tonbandgerät.
Die Disco begann lahmarschig mit DDR-Liedern. Erst als die Erzieher weg waren, traute sich Hans-Jörg, Westmusik zu spielen. Los ging es mit »Tiger Feet« von Mud. Die Tanzfläche füllte sich, und ich konnte meinen Blick nicht von Britta losreißen – einer Blondine, deren lockige Mähne, von Sonne und Ostsee stark gebleicht, geradezu engelhaft erschien. Britta war mindestens zwölf und einen Kopf größer als ich. Ich hatte noch nie so ein schönes Mädchen gesehen. Fast schon wollte ich sie aberwitzig zum Tanz auffordern. Doch Hans-Jörg höchstpersönlich räumte mich aus dem Weg und führte sie zu »Goodbye Mama« von Ireen Sheer auf die Tanzfläche, wo sie sich eng aneinanderschmiegten.
Nach dem Ferienlager waren Sprenzel und ich unzertrennlich. Ich durfte sogar bei ihm übernachten, wenn meine Eltern wieder die Sonnabende irgendwo durchfeierten. Das erste Mal war aufregend. Verschämt schob ich mein Kinderfahrrad in den Hof, Charly kam mir bellend entgegen. Herr Sprenzel musterte mich finster, und meine Angst vor diesem unheimlichen Mann blieb. Irgendwann verschwand er mit seinem alten Fahrrad und einer Zigarette im Mundwinkel vom Hof.
»Wir dürfen sogar in Dietmars Zimmer schlafen«, sagte Sprenzel. Er saß kauend am Tisch in der Waschküche und zappelte mit den Füßen, die in Kniestrümpfen und Kindersandalen steckten. Genau wie ich freute er sich darauf, endlich Gesellschaft zu haben.
»Wo ist eigentlich Dietmar?«
»In Luckau im Kittchen, atmet jesiebte Luft, sagt Vadder.«
»Warum denn?«
»Der wollte in den Westen abhauen.«
Ich konnte mich nicht daran erinnern, Dietmar jemals gesehen zu haben. Er war zehn Jahre älter als wir, und es gab immer nur diese Gerüchte, in welchem Gefängnis er jetzt wieder saß.
Vorsichtig öffnete Sprenzel die Tür. Ein unordentliches Bett kam zum Vorschein. Ein alter Holztisch, auf dem ein rot-weißer Wecker in Form des Berliner Fernsehturms stand. In der Ecke eine Couch.
»Da schläfst du«, sagte Sprenzel. Ich ging zu der Couch und stellte den Campingbeutel mit meinem Schlafanzug darauf ab. Direkt über der Lehne war ein riesiges Poster an die vergilbte Blümchentapete gepinnt. Ein seltsam geschminkter Typ grinste mich an. Er sah gefährlich aus. Vampirzähne ragten aus seinen Mundwinkeln. In der Hand hielt er ein Mikrofon.
»Das ist Alice Cooper«, sagte Sprenzel stolz, während ich das Poster wie vom Donner gerührt betrachtete.
»Sieht der immer so aus?«
Sprenzel zuckte die Schultern und warf mir eine Decke zu.
»Is ’n Sänger.«
»Oh, haste Musik von dem?«
»Dietmar hatte zwee Kassetten. Hat mein Vadder versteckt, bevor die Polizei hier alles durchsucht hat.«
Ich war total aufgeregt, als ich mich direkt unter dem Vampir auf der Couch bettete.
»Wo kommt’n der her?«, fragte ich.
»Na, aus dem Westen.«
Da war er wieder, der verbotene Westen.
»Lieste mir noch was vor?«
Ich holte Die Reise nach Sundevit aus dem Rucksack und begann zu lesen. Dabei schwelgten wir in letzten Ostseeträumen. Trotz der langsam verheilenden roten Striemen auf den Beinen fanden wir es doch beide lässig, die große weite Welt gesehen zu haben.
»Hörst du noch zu?«, fragte ich nach zehn Minuten. Als ich keine Antwort bekam, stand ich noch mal auf, betrachtete Alice Cooper und ahmte seine Pose nach. Irgendwie begann ich zu ahnen, dass sich hinter dem Popstar an der Wand möglicherweise eine ganz neue Welt verbarg.
04 Den Sieger erkennt man am Start
Das Schuljahr 1976 begann mit einer Weltsensation. Steffen Naumann wurde von der Klassenlehrerin nach vorn gerufen und bekam einen Blumenstrauß.
»Steffen hat alle Eignungstests für die Kinder- und Jugendsportschule bestanden und wird uns Richtung Berlin verlassen. Steffen, wir sind stolz auf dich.«
Alle klatschten, die Mädels schauten ihn bewundernd an. Nur Sprenzel und ich verweigerten den Beifall.
»Und was willst du danach werden?«, fragte ihn die Lehrerin.
»Fußballer«, antwortete er und lächelte mit Siegerblick über die Klasse.
Wir hatten uns oft über Steffen amüsiert, wenn wir in der Dämmerung vom Rumtreiben nach Hause gingen. Er stand dann immer noch auf dem Sportplatz, übte mit seinem Vater Seilspringen und Klimmzüge am Fußballtor. Bei Einheit Düsterbusch schoss er die meisten Tore in der Saison.
»Das hab ich eigentlich von dir erwartet«, sagte meine Mutter, als sie mit grimmiger Miene in der Küche an der Brotmaschine stand und Stullen absäbelte.
»An Steffen kannste dir ’n Beispiel nehmen, der hat Mumm«, ergänzte mein Vater. In letzter Zeit liebte er es, mich zu demütigen. Aus der AG Fußball war ich kurz zuvor wegen Disziplinlosigkeit rausgeflogen. Während eines Punktspiels unserer Schülermannschaft ging ich auf einen Zuschauer los, der mich von der Seitenlinie beleidigte. Das wurmte ihn als Hobbytrainer. Und ich wollte auch auf keine Kinder- und Jugendsportschule, um mich den ganzen Tag rumkommandieren zu lassen. Ich wollte was anderes, nur was, wusste ich noch nicht. Es sollte auf jeden Fall mit Musik zu tun haben. Inzwischen hatte ich einige Lieder von Alice Cooper im Radio gehört. »School’s Out« war mein Lieblingssong.
Ich hatte auch meine Begeisterung für die Bay City Rollers und Slade entdeckt, indem ich, von meiner Mutter geduldet, im Westfernsehen Musikladen guckte. Eine wilde Katze, die uns zugelaufen war, taufte ich Noddy Holder. Meine Betteleien um einen Kassettenrekorder blieben jedoch ungehört.
»Kümmer dich lieber um die Schule«, wehrte meine Mutter ab.
Um mich nach dieser Enttäuschung abzureagieren, köpfte ich das Gros meiner einst ruhmreichen Cowboy- und Indianerarmeen. Nur zwei meiner Lieblingskrieger überlebten das Massaker. Die Torsos warf ich in den Ofen und beobachtete, wie der Gummi langsam zerschmolz. Ich hatte mein Spielzeug und die Schule satt, genau wie die Einsamkeit, die mich zwar nicht mehr auf die Straße rennen ließ, aber dafür sorgte, dass ich jeden Abend in anderer Position schlief: manchmal im Sessel, dann unter dem Tisch, oder auf dem Fensterbrett, um ein wenig Abwechslung in mein Dasein zu bringen. Auch schnappte ich mir öfter das Kursbuch meiner Mutter und lernte die Abfahrtszeiten der D-Züge vom Bahnhof Kirchhausen auswendig.
Sprenzel war jetzt der Schlechteste der Klasse, knapp davor kam ich. Wir ließen uns treiben und verbrachten die meiste Zeit hinter der Dorfkneipe, wo der zusammengekehrte Abfall der Gäste einfach ins Gras geschüttet wurde. Wir förderten halb aufgerauchte Kippen zutage, die wir dann zu Ende pafften. Dabei laberte ich ihm eine Bulette ans Ohr, zitierte Dialoge aus Kojak oder versuchte, ihm Musikfragen zu stellen. Ich wedelte mit einer Bravo vor ihm herum, die ich einem aus der achten Klasse aus der Schulmappe geklaut hatte.
»Wer sind Die zwei im Schatten der T. Rex?«
»Ach, weeß ich doch nich, Anton.«
»Na, Bill Legend und Steve Currie.«
»Ach Anton, das ist mir zu hoch.«
Ich wollte, dass Sprenzel auch mal rumflippt, doch der schüttelte nur den Kopf und sagte immer das Gleiche.
»Du bist ’n Kunde, Anton, ey.« Dann lachte er verschämt, weil ich mich so abmühte, ihn zu begeistern.
Der erste Schritt in Richtung Freiheit war das Kino in Kirchhausen. Mühsam hatte ich meiner Mutter die Erlaubnis abgerungen, sonntags mit Sprenzel die Union Lichtspiele zu besuchen. Sie willigte nur ein, weil ich versprach, meine gestreiften Steppke-Schlaghosen zu tragen. Ich hasste diese Dinger, sie sahen echt bescheuert aus.
»Musst doch was Vernünftiges anziehen, wenn du in die Stadt fährst.«
Es war das erste Mal, dass wir mit dem Fahrrad nach Kirchhausen reinradelten. An der Kreuzung auf dem Markt stiegen wir vorsichtshalber ab und liefen drüber weg.
Das alte Kino lag mitten in der Stadt. Die Beleuchtung des Schriftzuges über dem Eingang war kaputt. Nur das U leuchtete noch, und die beiden nachfolgenden Buchstaben flackerten. Deshalb wurde es auch Uni-Kino genannt. Schon als kleiner Junge hatte mich die Leuchtreklame in den Bann gezogen, wenn ich im Auto sitzend mit meinen Eltern vom Einkaufen daran vorbeikam.
Die Kirchhausener lärmten schon vor dem Eingang, und wir hielten Abstand. Alle trugen die Haare über die Ohren und gaben sich selbstbewusst in ihren Levi’s- und Wrangler-Anzügen.
»Gibt’s die Hosen auch in Gestreift?«, fragte mich einer aus der Gruppe, als wir zum Eingang huschten.
Dann hörte ich nur noch was von »Konsumjeans«.
»Scheiß-Kirchhausener. Denken, die sind was Besseres«, zischte Sprenzel hinter mir.
Unser erster Film war ein amerikanischer. Er hieß Grenzpunkt Null und handelte von einem Mann, der im Auto durch halb Amerika raste und am Ende auf der Flucht vor der Polizei Selbstmord beging. Zwischendurch lernte er einen schwarzen DJ kennen, der sich Super Soul nannte und von weißen Rassisten zusammengeschlagen wurde. Ich saß noch völlig apathisch in der Sitzreihe, als schon alle draußen waren, und reagierte auch nicht auf Sprenzels Bettelei, endlich aufzustehen.
Irgendwann schälte ich mich doch aus dem weichen Sessel. »Starker Film, oder?«
Sprenzel nickte. »Auf jeden Fall starke Autos.«
»Wollen wir ’ne Disco aufmachen, die Super Soul heißt?«
»Beeil dich lieber, ich muss nach Hause, füttern.«
05 Büchsenbier und Arbeitslose
»Anton hält es nicht für nötig, im Physikunterricht mitzuarbeiten, stattdessen raucht und frühstückt er.«
Nach diesem Eintrag in mein Hausaufgabenheft fixierte mich meine Mutter mit enttäuschtem, ratlosem Blick und tat mir ein bisschen leid. Sie litt nicht nur an meiner Fehlentwicklung und dem ständigen Druck der anderen Lehrer, auch ihre Beine wurden schlimmer. Das lange Stehen in der Schule tat ihr nicht gut. Mein Vater hielt sich immer mehr raus aus der Erziehung. Manchmal drohte er mir Schläge an, doch das war eher lächerlich. Ihn nervte es zusehends, sich überhaupt mit mir beschäftigen zu müssen. Das störte bloß seinen Trott aus Arbeit, Kneipe und Fußball. Er hatte sich inzwischen zum Trainer der ersten Männermannschaft von Einheit Düsterbusch emporgearbeitet.
Eines Morgens kam meine Mutter ins Zimmer und legte ein kariertes Hemd und eine Krawatte auf das Bett. Es war die Uniform der Kabarettgruppe. Schon lange warb sie darum, dass ich eintreten sollte, bisher hatte ich es immer wieder verhindern können.
»Morgen ist Probe, und du kommst, sonst passiert ein Unglück.«
Sie gab mir Texte, die bereits farbig markiert waren. Hinter einigen Dialogzeilen stand ganz groß ANTON. Ich las mir das Zeug durch. Rote Verse, versetzt mit kleinen Witzchen, zugeschnitten auf die Werktätigen des Kreises Frankenwalde. Eine Woche später fand ich mich auf der Bühne vor etwa zwanzig versammelten Busfahrern und ihren Ehefrauen im Speisesaal des VEB Kraftverkehr wieder. Anlass war das dreißigjährige Bestehen ihres Betriebes. Die Busfahrer waren eine besondere Spezies und genossen großes Ansehen auf dem Land. Sie brachten die Werktätigen morgens pünktlich zu ihrem Arbeitsplatz. Außerdem lenkten sie eine Flotte von Omnibussen der ungarischen Marke Ikarus. Es war eine Ehre, vor Busfahrern aufzutreten.
Unsere Kabarettgruppe bestand aus drei Mädchen und drei Jungen aus verschiedenen Klassen der Schule. Meine Klasse war mit Elke und mir beteiligt.
»Wir haben keine Levi’s-Hosen, Büchsenbier und Arbeitslosen, aber Arbeit, die haben wir …«, trällerten wir im Chor, und ich schämte mich in Grund und Boden. Alice Cooper würde mich mit seinen Vampirzähnen zerfleischen. Halbherzig trug ich meinen Vers vor.
»Im Kabarett wird stets gebracht,
was uns noch alles … Sorgen macht.
Drum merkt gut auf, schärft euren …
Blick und übt ein bisschen ähh … Selbstkritik?«
Fragend und mit rotem Kopf drehte ich mich zu meiner Mutter um, die zischelnd soufflierte. Ich spürte ihre Blicke wie Pfeile in meinem Rücken. Meine Textunsicherheit provozierte Lacher im Publikum.
Als Nächstes war Elke dran. Sie trug inzwischen riesige Titten vor sich her. Ihre enge Kabarettbluse machten sie noch größer.
»Wir hoffen sehr,
ihr habt gelacht
und auch ein wenig mitgedacht.
Wir danken euch recht schön,
und nun – Auf Wiederseh’n!«
Spielend sagte Elke ihren Text auf, und wir verbeugten uns alle. Nach dem Beifall mussten wir auf einer Stuhlreihe hinter dem Rednerpult warten. Es regnete Orden für verdiente Busfahrer, und ich schlief fast ein. Als die letzten Aktivisten unter Beifall das mit Kunstblumen verzierte Podium verließen, gesellte sich meine Mutter zum Parteisekretär, und sie unterhielten sich angeregt. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich an irgendwas abmühte, an das sie selbst nicht glaubte. Sie war schlauer als diese Phrasen dreschenden Männer mit Parteiabzeichen, die keinen Spaß verstanden und mir unheimlich vorkamen.
Kurz darauf lobte sie alle, nur mich nicht.
Ich ging auf die Toilette. Unterwegs kam mir Elke entgegen, was mich in eine gewisse Aufgeregtheit versetzte.
»Schämst du dich nicht? Deine Mutti tut doch alles für dich, und du lässt sie so im Regen stehen!« Sie baute sich vor mir auf, indem sie ihre Hände in die Hüften stemmte und ihren Oberkörper nach vorn schob.
Ihre blauen Augen fixierten mich. Ich schluckte nervös und konnte meinen Blick nicht von den Titten abwenden. Ein plötzlicher Impuls, meine Hand schnellte nach oben, und ich berührte ihre feste rechte Brust über der Bluse.
Elke ließ es sich gefallen und blickte mir direkt in die Augen. Sie lachte aufreizend, nahm meine Hand von ihrer Brust und ging. Mit weichen Knien blieb ich zurück.
Als wir wieder zu Hause waren, kam meine Mutter in mein Zimmer. Sie hinkte stark, und ihr anklagender Blick traf mich.
»Musst du mich so blamieren?«
»Ich hab doch gesagt, ich will nicht in deine Kabarettgruppe.«
»Was soll bloß aus dir werden?«, motzte sie. Ich hasste diese Frage, sie kam immer häufiger in letzter Zeit.
»Keene Ahnung, Terrorist!« Ich wollte sie provozieren. Die RAF war gerade in aller Munde, in der Schule hatte sogar jemand »Andreas Baader« in die Bank des Matheraums geritzt. Die fieberhafte Suche des Lehrerkollegiums nach dem Übeltäter blieb erfolglos. Sie knallte mir eine, aber es tat nicht weh, und ich hielt ihrem Blick stand.
»Das wirst du mir nicht auch noch antun.« Sie ging hinaus und warf die Tür hinter sich zu. So war meine Kabarettkarriere schneller vorbei, als sie angefangen hatte. Wir sprachen nie wieder davon.
06 Guck nicht so doof!
Beim Abendbrot ließ meine Mutter die Bombe platzen: »Tante Klara kommt.«
Ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. »Tante Klara aus Westberlin?«
Massig Geschichten rankten sich um diese achtzig Jahre alte Frau. Sie hatte bis zur Rente beim Westberliner Senat gearbeitet, und wir waren ihre einzigen Angehörigen. Sie war nie verheiratet gewesen, und als junge Frau hatte sie Beziehungen mit verschiedenen Männern. Damals war sie Haushälterin bei einem sozialdemokratischen Politiker. Nachdem der von den Nazis abgeholt wurde, arbeitete sie als S-Bahn-Schaffnerin und später, im Krieg, als Krankenschwester an der Ostfront. Sie schickte regelmäßig ein Päckchen mit Feinstrumpfhosen für meine Mutter, Rasierwasser für meinen Vater und Süßigkeiten für mich. Das erregte immer wieder Aufsehen in der Schule, und ich wurde ständig von Neidern in der Klasse angeranzt: »Deine Mutter quatscht nur rotes Zeug, und du Hirni hast alles aus dem Westen.«
Und jetzt sollten wir Tante Klara aus Berlin abholen. Schon vor unserer Abfahrt herrschte nervöse Aufgeregtheit zu Hause. Meine Mutter bezog die Couch in der Wohnstube mit einem Laken, zog es dann aber sofort wieder ab, um nochmals ein neues aufzuziehen. Mein Vater machte sich über sie lustig.
»Am liebsten würdest du ihr ’n goldenes Bett hinstellen, was?«, frotzelte er. »Du bist ’ne feine Genossin.«
»Na und? Tante Klara ist ’ne geschichtliche Figur«, ätzte sie und knallte die Tür zur Wohnstube zu.
Dann putzte sie Schränke, und unser Plumpsklo glänzte nach ihrer Scheueraktion wie neu. Ich musste eine fliederfarbene Jacke mit gelben Knöpfen anziehen und wieder die gestreiften Steppke-Schlaghosen. Ich kam mir vor wie ein Papagei, doch meine Mutter bestand auf dieser Jugendmode-Uniform. »Was soll denn sonst Tante Klara denken?« Das fragte ich mich auch, als mein Vater den Wartburg aus der Garage steuerte und wir losfuhren.
Ich war doppelt aufgeregt. Nicht nur wegen Tante Klara. Es war mein erster Berlinbesuch. Mein Vater traute sich nicht mit dem Auto in die Innenstadt, und wir nahmen von Altglienicke aus die S-Bahn. Am Bahnhof Plänterwald mussten wir umsteigen und ewig auf den nächsten Zug warten. Vor uns erhob sich ein schneeweißes Hochhausgebilde, das von der Sonne angestrahlt noch heller wirkte. Davor zog sich die Mauer wie eine graue Schlange durch wucherndes Buschwerk.
»Das ist Westberlin, oder?«, fragte ich und blickte fasziniert auf diese weiße Unberührtheit. Sie bildete den totalen Kontrast zu dem bröckligen S-Bahnsteig, auf dem wir standen.
»Ja, da kommt Tante Klara her«, sagte meine Mutter bedeutungsvoll.
»Und nur weil Dietmar Sprenzel da hinwollte, sitzt er jetzt im Knast?«
»Schrei noch lauter!«, zischte meine Mutter vorwurfsvoll und zerrte an mir herum, während mein Vater sich unsicher umschaute.
»Na siehste«, ranzte er, »das ist deine Erziehung.«
Jede weitere Frage wurde unterbunden, und ich klebte an den Fenstern der Bahn, als es endlich weiterging.