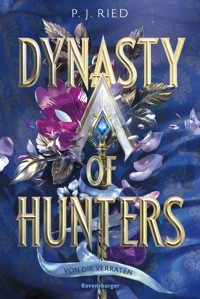
Dynasty of Hunters, Band 1: Von dir verraten (Atemberaubende, actionreiche New-Adult-Romantasy) E-Book
P.J. Ried
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Dynasty of Hunters
- Sprache: Deutsch
Wenn du vor deiner großen Liebe fliehen musst. Seit Jahrhunderten laufen die Jagdspiele im Reich der fünf Fürstentümer nach demselben Muster ab: Die Adligen sind die Jäger, die Bürgerlichen die Gejagten. Doch als Laelia de Bleu ihr Los zieht, geschieht das Unfassbare: Die Fürstentochter ist eine Gejagte – und ihre große Liebe, Laurent de Vert, ihr Jäger. Ihr gemeinsames Schicksal scheint besiegelt. Denn am Ende der Jagd wird einer von ihnen dem anderen lebenslag untertan. Fünf Adelshäuser. Fünf Farben. Ein Königreich, in dem eine einzige Berührung dir alles nehmen kann. Tauche ein in die Welt der "Dynasty of Hunters" - voller Bälle, Intrigen, Verrat und einem gefährlichen Wettstreit: Band 1: Von dir verraten Band 2: Von dir gezeichnet
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 632
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2024 Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg
© 2024 Ravensburger Verlag GmbH Text © 2024 P. J. Ried Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover. Covergestaltung und -illustration: Isabelle Hirtz, Hamburg Lektorat: Sarah Heidelberger (www.sarah-heidelberger.de) Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-473-51256-0
ravensburger.com
Für Tante Evi
Für all die Briefe, die ich dir nicht mehr schreiben kann, schreibe ich dir Geschichten.
Le règne des couleurs pour l’éternité
Die Herrschaft der Farben bis in alle Ewigkeit
1. Das Los ist Gesetz.
2. Töte niemanden.
3. Zeichne mit Bedacht.
4. Nur die Stärksten überleben.
5. Sei unter den Stärksten.
Prolog
Vier Jahre zuvor
Mit pochendem Herzen drücke ich mich tiefer in den Schatten der Marmorstatue eines Mädchens, das seine blauen Fingerspitzen dem wolkenfreien Himmel entgegenstreckt, und umklammere den Holzstab in meiner Hand fester. Er ist fast so groß wie ich, und inzwischen fühlt er sich beinahe unerträglich schwer an. Fieberhaft überlege ich, ob ich etwas vergessen haben könnte, aber weder lugt ein Zipfel meiner Kleidung hinter der Skulptur hervor noch kann man mich aus dem Winkel sehen, in welchem ich meine Jägerin vermute. Selbst die Strähnen, die sich aus meinem Zopf gelöst haben, habe ich in den Kragen gesteckt, damit sie nicht im Wind flattern. Nein, diesmal habe ich wirklich an alles gedacht.
Erleichtert atme ich auf, lehne den Kopf an das glatte Gestein in meinem Nacken. Es ist warm, aufgeheizt von der Sonne, jedoch nichts im Vergleich zu meiner Körpertemperatur nach der stundenlangen Flucht. Der fein gewebte Leinenstoff meines Hemdes klebt mir am Oberkörper, reibt mit jedem Atemzug über meine erhitzte Haut, und ich widerstehe nur mit Mühe dem Drang, es mir vom Leib zu reißen. Kein Mensch ist zu sehen, kein Geräusch zu hören. Selbst die steinernen Sitzbänke mit den eingemeißelten Hyazinthen vor mir, auf denen um diese Zeit normalerweise immer jemand anzutreffen ist, sind verlassen, die Besuchenden auf schattige Plätze ausgewichen.
Meine Kehle brennt vor Durst, der durch den süßen Duft, der vom Pfirsichhain zu mir herüberströmt, noch befeuert wird. Was gäbe ich jetzt darum, in eine der Früchte zu beißen, während die Luft über dem Pflaster des Platzes in der Mittagshitze flirrt. Das leise Zwitschern eines Vogels dringt an mein Ohr, und einen Moment lang ist alles friedlich. Ruhig. Sicher.
Dann höre ich ein leises Schnaufen, dicht gefolgt von nahenden Schritten, und fluche innerlich. Wie hat sie mich bloß gefunden?
So schnell ich kann, stürme ich über den Platz, stütze mich mit einer Hand ab und springe über die niedrige Mauer, die ihn umgibt, den schweren Atem meiner Verfolgerin nun deutlich hörbar im Nacken. Dem Klang ihrer Schritte nach trennen uns nur noch wenige Meter voneinander, und sie holt rasch auf.
Nein! Nicht schon wieder!
Ich sprinte den seichten Hügel hinab, der zum Hain führt, in der Hoffnung, dass ich mir zwischen den Baumstämmen einen Vorteil verschaffen kann. Meine Muskeln brennen, Schweiß rinnt mir Gesicht und Rücken hinab, und es kostet mich meine gesamte Willenskraft, meine Beine nach all den Kilometern, die mir bereits in den Knochen stecken, zur Eile anzutreiben. Der schwere Stab, um den sich meine Finger krampfen, macht es nicht gerade leichter. Immer wieder droht er, mir aus den von Lederhandschuhen verhüllten Fingern zu rutschen, sodass ich ständig meinen Griff korrigieren muss. Aber ich weigere mich, aufzugeben und zu scheitern. Nicht noch einmal. Denn wenn ich erneut versage …
Plötzlich zischt ein dünner Holzpfeil mit stumpfer Spitze an meinem Kopf vorbei, verfehlt mein Gesicht nur um Millimeter. Doch er kommt mir nah genug, um eine lange, kupferfarbene Haarsträhne zu streifen.
Wären wir alt genug, um echte Waffen zu benutzen, würde sie jetzt im Wind davonflattern.
»Der Nächste trifft dich!«, ruft Astoria mir hinterher. Ihre Stimme klingt nah, viel zu nah.
Träumweiter!, würde ich gern zurückrufen, aber ich spare mir die Puste. Stattdessen verlasse ich den gepflasterten Pfad, der unter den Bäumen hindurchführt, und biege scharf nach rechts ab, um die Stämme als Deckung zu nutzen. Die tief hängenden Äste ächzen unter dem Gewicht ihrer rotgoldenen Früchte. Im Laufen hebe ich einen Pfirsich vom Boden auf, um ihn mit aller Kraft hinter mich zu schleudern. Ich grinse zufrieden, als ich ein dumpfes Geräusch vernehme, gefolgt von Astorias Fluchen.
»Das war mein Bogen!«, schimpft sie.
»Selbst schuld«, antworte ich keuchend, während ich angestrengt überlege, wie ich sie abschütteln könnte. Doch es hilft nichts – ich bin inzwischen viel zu erschöpft, um sie noch lange auf Distanz zu halten, und sie war schon immer die Schnellere von uns beiden. Also muss ich sie mit einem Angriff überraschen.
Erneut zwinge ich mich dazu, das Tempo zu erhöhen, mobilisiere meine letzten Kraftreserven. Das Hämmern meines Herzens dröhnt so laut in meinen Ohren, dass es meinen hektischen Atem übertönt. Ich haste am Ufer des Sees entlang, bis er sich zu einem Bach verjüngt, und biege scharf nach links auf die Rundbogenbrücke ab, die auf die andere Seite und in Richtung des Pfauengeheges führt. Aber statt dort hineinzuflüchten, klettere ich auf das schmale, schulterhohe Holzgeländer und stürze mich auf Astoria, die nur wenige Schritte hinter mir auf die Brücke stürmt und nichts anderes tun kann, als überrascht ihren Bogen hochzureißen. Dumpf prallt meine Stange gegen das Holz ihres Bogens, das sich unter der Wucht bedenklich biegt. Wir keuchen, unsere Waffen zittern. Meine Finger, die ich so fest um meinen Stab geschlossen habe, dass ich schon fast fürchte, er könnte zerbersten, schmerzen, doch ich gebe nicht nach. Langsam, Stück für Stück, drücke ich Astoria nach unten, um sie in die Knie zu zwingen.
Sie hebt den Kopf und funkelt mich zornig an. »Da musst du dir schon was Besseres einfallen lassen!«, zischt sie.
»Meinst du? In meinen Augen sieht das schon ganz gut aus!«
Mit einem Ruck drücke ich zu, bis eines von Astorias Knien auf dem Boden aufkommt. Sie ächzt, aber nur einen Sekundenbruchteil später zucken ihre Mundwinkel verräterisch. Bevor ich weiß, wie mir geschieht, verkantet sie ihren Bogen mit meinem Stab und dreht ihn ruckartig herum. Das Holz entgleitet meinen verkrampften Fingern, rutscht am Leder entlang und schlägt mit einem dumpfen Poltern auf der Brücke auf. Ich verliere das Gleichgewicht und stürze auf Astoria, reiße sie mit mir zu Boden. Keuchend rangeln wir miteinander, versuchen beide, die Oberhand zu gewinnen, bis es mir plötzlich gelingt, sie auf den Rücken zu werfen. Nur einen Wimpernschlag später knie ich über ihr und presse ihr triumphierend den linken Unterarm auf den Brustkorb.
»Na schön, ich gebe mich geschlagen.« Sie lacht, löst ihren Widerstand und schaut mich an, doch ich kann ihren Blick nicht erwidern.
Wie gebannt starre ich auf ihre Halskuhle unter mir, die von dem durch den Kampf verrutschten Hemd entblößt wird. Auf die nackte, leicht sonnengebräunte Haut, auf der der Schweiß glänzt. Auf den verletzlichen Punkt, an dem ihr Puls im Gleichklang mit meinem hämmert.
Mein Mund wird trocken, und ein unheilvolles Prickeln breitet sich in meinen Fingerspitzen aus. Es ist ein unangenehmes Gefühl, das rasend schnell intensiver wird, bis ich es kaum noch aushalte. Wie ein Funkenschauer jagt es meine Arme hinauf, fühlt sich bald an wie Glut, die erst schmerzhaft, dann verlockend durch meine Adern pocht und sich als Brennen in meinen Händen zentriert.
Bevor unser Training losging, haben wir oft so getan, als wären wir bereits sechzehn und würden an den Jagdspielen teilnehmen, die alle drei Jahre stattfinden. Dabei treten sämtliche adeligen Jugendlichen der fünf Reiche Prismeïas an, um auf der Insel Arc-en-ciel den ihnen zugeteilten bürgerlichen Gejagten zu zeichnen und damit auf ewig zu ihrem Diener zu machen. Je nach Haus und Farbe kontrolliert der Schriftzug, mit dem die Jagenden ihre Gejagten dabei versehen, unterschiedliche Aspekte eines Menschen: Weiß für die Kontrolle über den Tod, Rot für die Emotionen. Grün für die Manipulation von Erinnerungen, Gold für den Geist. Oder Blau – für die Bestimmung über den Körper.
Unzählige Male haben Astoria und ich gespielt, dass eine von uns die andere zeichnet, und die andere tat so, als wäre sie daraufhin eine Marionette, die Anweisungen befolgt, auf Kommando Pirouetten dreht und Sprünge ausführt. Manchmal haben wir uns sogar mit Federn und blauer Tinte beholfen. Doch jetzt … fühlt es sich an, als wären wir dieser Tinte entwachsen.
Als wäre ich dieser Tinte entwachsen.
»Lia?«, fragt Astoria unter mir besorgt. »Ist alles in Ordnung?«
Ich antworte ihr nicht. Denn tief in mir, in meiner Brust, regt sich etwas, ausgelöst von der plötzlichen Hitze in mir. Etwas Dunkles, Lauerndes, das zu rumoren beginnt. Es fühlt sich an, als hätte es mein Leben lang in mir geschlafen. Und jetzt ist es erwacht und will sich mit aller Gewalt Bahn brechen.
Beinahe glaube ich zu spüren, wie es von innen heraus die Klauen nach meinem Bewusstsein ausstreckt, begierig, die Kontrolle zu übernehmen. Sich zu befreien, seine Bestimmung einzufordern und meine angeborene Kraft fließen zu lassen. Wie es mich dazu bringen will, meine Handschuhe abzustreifen und die bloßen Finger auf Astorias Hals zu senken, um sie zu zeichnen. Um ihr mit blauer Farbe Worte auf die Haut zu schreiben, die ihren Körper für immer meinem Befehl unterwerfen. Der Drang, zum ersten Mal diesen Rausch der Macht zu spüren, zu sehen, wie sich meine Finger unwiderruflich blau färben, wird so stark, dass ich kaum noch etwas anderes wahrnehme als das Kribbeln in ihnen, das inzwischen ein Echo in jeder meiner Fasern gefunden hat.
»Lia?«, wiederholt Astoria. Ihre Stimme klingt beunruhigt, beinahe ängstlich, was mir ein leichtes Lächeln entlockt.
Es wäre so leicht, so einfach, diesem Drang nachzugeben. So natürlich.
Wie von selbst hebe ich die freie Hand an den Mund, versuche mit den Zähnen, die Knöpfe am Handgelenk zu fassen zu bekommen, die den Stoff dort fixieren.
»Du tust mir weh. Geh runter von mir.«
Ich nehme einen leichten Druck auf den Schultern wahr, mit dem Astoria versucht, mich von sich hinunterzuschieben, doch ich stemme mich dagegen, starre nach wie vor auf ihre bloße Haut. Auf die helle Stelle, die sich vor meinen Augen zu einer Leinwand formt, zu einer unbeschriebenen Buchseite, die nur darauf wartet, von mir mit blauen Buchstaben gezeichnet zu werden. Erfüllt von meiner Macht.
Endlich bekomme ich die Knöpfe zu fassen und reiße sie vom Stoff, streife den Handschuh ab und schleudere ihn neben mich. Die Luft, die über die nackte Haut streicht, ist angenehm, geradezu befreiend. Meine Finger fühlen sich zugleich verletzlich und kraftvoll an.
»Okay, das reicht jetzt, Lia. Du machst mir Angst.« Astorias Stimme zittert, aber das stachelt das Monster in meiner Brust, das mir befiehlt zu tun, wofür ich geboren wurde, nur noch mehr an.
Langsam senke ich die Hand. Vor meinen Augen färbt sich die Welt blau, und das schmerzhafte Pulsieren in meinen Handflächen wandert in meine Fingerspitzen hinein, nimmt dort immer weiter zu, bis sie lichterloh zu brennen scheinen. Nur noch eine dünne Schicht Luft trennt meine Finger von Astorias Hals, und es kommt mir vor, als hätte ich noch nie klarer gesehen als jetzt. Als begriffe ich erst jetzt das Naturgesetz hinter meinen Fähigkeiten.
Haut auf Haut, wie Buchstaben auf Papier.
Kontrolle über den Körper, Kontrolle über den Menschen.
»Ich sagte: Geh runter von mir, verdammt!«, brüllt Astoria jetzt so laut, dass ihre Worte über das Anwesen hallen.
Doch es ist nicht die Lautstärke, die mich innehalten lässt, sondern die Panik, die in ihrer Stimme mitschwingt und sie schrill klingen lässt. Die dafür sorgt, dass das Glühen in mir jäh erstirbt und einer von Entsetzen erfüllten Kälte weicht, die mein Herz beinahe zum Stillstand bringt.
Fassungslos starre ich erst in Astorias schreckgeweitete blaue Augen, dann auf meine entblößte Hand über ihrem Hals.
Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Wollte ich gerade etwa wirklich …
Mein Magen krampft sich schmerzhaft zusammen, und eine Welle heftiger Übelkeit steigt in mir empor. Ich spüre, wie Säure meine Kehle hinaufkriecht, und wünschte, sie würde mich von innen heraus an Ort und Stelle verbrennen, bis nichts mehr von mir übrig bleibt.
Wie kann das bloß sein? Es ist viel zu früh dafür. So etwas dürfte ich noch gar nicht fühlen. Dieser Drang, jemanden zu zeichnen, sollte eigentlich erst wesentlich später in mir erwachen. In vier Jahren, wenn ich als Jägerin an den Jagdspielen teilnehme. Erst dann sollte ich mit den Worten, die ich meinem Gejagten auf die Haut schreibe, einen Menschen auf Lebenszeit meinem Willen unterwerfen wollen. Gelingt mir das nicht, so werde ich für immer verbannt und alles verlieren – meine Kraft, meine Familie, meine Freiheit.
Aber dieser Gejagte muss ein Bürgerlicher sein, nicht meine Cousine. Die Person, die für mich wie eine Schwester ist. Allein bei dem Gedanken daran, was ich gerade tun wollte, steigt erneut Galle in meiner Kehle auf. Astoria bedeutet mir alles! Und als wäre das nicht schon schlimm genug, hätte ich mit ihr außerdem beinahe eine Adelige gezeichnet, was außer in genau regulierten Ausnahmefällen streng verboten ist und mit dem Tod bestraft wird.
Erst jetzt spüre ich ihre Fäuste, die auf meine Schultern einhämmern, und den Schmerz, der dort pocht. Bumm, bumm, bumm, jeder einzelne Hieb wie ein Hammerschlag.
Schockiert lasse ich von ihr ab und krieche auf allen vieren rückwärts, schnappe mir meinen Handschuh und zerre ihn so grob über meine Finger, dass mir die Nägel einreißen und die Haut darunter schmerzt. Meine Hände zittern, mein Körper bebt, und ich versuche vergeblich, die kleinen Knöpfe wieder zu schließen.
In meinem Kopf überschlagen sich die Gedanken. Zeitgleich ist er erfüllt von einer unangenehmen, brennenden Leere, die das Monster in mir hinterlassen hat. Ein Hohlraum, in dem es auf der Lauer liegt. Und mir graust es vor dem Tag, an dem es sich wieder erheben wird.
Ich sollte es sein, die diese Kraft kontrolliert, nicht andersrum. Ich sollte sie durch Wörter bannen und lenken können. Nicht umgekehrt.
Ich spüre Astorias Blick auf mir, weich und behutsam. Keine Spur von Wut und Entsetzen, nachdem der erste Schock sich gelegt hat, kein Anzeichen von Abscheu oder Empörung. Dabei wäre mir das weitaus lieber gewesen als die Behutsamkeit, mit der sie nun vorsichtig die Hände nach meinem Unterarm ausstreckt, an dem ich noch immer verzweifelt an den Knöpfen zerre.
»Ist schon gut, Lia. Ich helfe dir«, sagt sie leise.
Ich verdiene ihre Sanftheit nicht.
Der Zorn, der Ekel und die Angst, die sie verspüren sollte, tosen durch meine Adern, vermischen sich mit Verbitterung und Hass. Hass auf meine angeborene Kraft, Hass auf das Ungeheuer in meiner Brust, Hass auf meine Bestimmung, eine Jägerin zu sein. Doch am allermeisten Hass auf mich selbst, weil ich beinahe die Kontrolle und mit ihr gemeinsam alles verloren hätte, was mir wichtig ist.
Hektisch rappele ich mich auf und stolpere zurück, wobei ich die halb nackte Hand mit der anderen an die Brust presse, um sie dort festzuhalten. Von Astoria fernzuhalten. Unsanft pralle ich gegen das Brückengeländer in meinem Rücken, wechsele die Richtung und weiche weiter nach hinten zurück.
»Bleib weg«, würge ich hervor.
»Lia …«, setzt sie an, aber ich schüttele heftig den Kopf.
»Bleib weg von mir!«, wiederhole ich eindringlich, während meine Augen zu brennen beginnen. Ohne ihre Antwort abzuwarten, wirbele ich herum und renne los, über die Wiese und zurück in den Schutz des Pfirsichhains. Ich laufe und laufe, ohne stehen zu bleiben, denn egal, wie viele Meter ich auch zurücklegen werde – es wird nicht weit genug sein.
Es wird nie weit genug sein.
Das spüre ich mit jeder Faser meines Seins.
Denn von diesem Tag an hat mich das Monster nie wieder losgelassen.
Kapitel 1
Nervös streiche ich über den mit Stickereien verzierten Rock meines hellblauen Kleides, das sich wie Wasser um meine Beine bauscht. Zum Saum hin werden die Ornamente golden, ebenso wie auf den transparenten, langen Ärmeln und dem eng geschnittenen Korsett. Es ist ein Kleid, wie es sich für eine de Bleu geziemt, und trotzdem stellt es alles in den Schatten, was ich jemals getragen habe. Anlässlich der Zeremonie, bei der die Lose für die bevorstehenden Jagdspiele gezogen werden und die dieses Jahr in unseren Hallen abgehalten wird, hat die Hofschneiderin sich selbst übertroffen. Zu gern würde ich den seidigen Stoff mit bloßen Händen berühren, herausfinden, ob er sich unter meinen Fingerspitzen genauso fließend weich anfühlt wie auf dem Rest meiner Haut. Doch dazu müsste ich meine Handschuhe ausziehen. Etwas, das in Anwesenheit anderer strengstens untersagt ist – besonders, solange man noch kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft ist. Mit Sicherheit könnte ich sie für einen Moment abstreifen und meine Zofe Amélie um Verschwiegenheit bitten. Aber das will ich nicht. Denn meine Finger sind gefährlich. Eine einzige unbedachte Berührung, Haut auf Haut, kann alles verändern und ganze Königreiche zerstören. Das hat mir der eine Moment vor vier Jahren mehr als deutlich gemacht.
Seitdem gehe ich keine Risiken mehr ein. Nicht einmal zum Schlafen ziehe ich die Handschuhe noch aus. Ich lege sie täglich nur für wenige Minuten ab, um mich zu waschen oder sie zu wechseln. Und auch das nur, wenn ich vollkommen sicher bin, dass niemand in der Nähe ist, den ich mit meinen bloßen Fingern verletzen könnte.
»Ist alles zu Eurer Zufriedenheit, Mademoiselle?«, fragt Amélie und zupft leicht an dem Rock, in den ich meine Finger gekrallt habe.
Ich nicke und lasse den Stoff los, doch das hält sie nicht davon ab, mir eine weitere Schicht pfirsichfarbenes Rouge auf die Wangen zu tupfen. Dabei achtet sie sorgsam darauf, nicht das Muster aus winzigen Saphiren zu berühren, das sie mir in mühseliger Feinarbeit vom äußeren Rand meiner Augen bis hinauf zu den Schläfen aufgeklebt hat. Bereits seit drei Stunden kleidet sie mich ein, bearbeitet unermüdlich mein Gesicht wie eine Leinwand und bildet einen Rahmen aus meinen Haaren. Bevor sie jedoch auch meine Lippen ein weiteres Mal nachziehen kann, schüttele ich lächelnd den Kopf. Behutsam ergreife ich ihre zierlichen Handgelenke, wobei ich darauf achte, sie nicht mit den Fingerspitzen zu streifen. Zwar schützt der Stoff der Handschuhe sie vor meiner direkten Berührung, aber ich möchte keine Angst in ihr auslösen. »Wenn du so weitermachst, ist bald nichts mehr von der Schminke übrig. Oder von meinem Gesicht.«
Amélie macht keine Anstalten zurückzuzucken. Entweder, weil sie sich wegen der Handschuhe in Sicherheit wähnt, oder weil sie weiß, dass ich ihr niemals etwas antun würde. Sie ist eine der wenigen engen Dienerinnen meiner Familie, die nicht gezeichnet sind, und mir liegt viel daran, dass das auch so bleibt.
»Ich habe schon verstanden«, erwidert sie ein wenig eingeschnappt und beginnt, die unzähligen Pinsel, Puder- und Farbtöpfchen in den Schubladen des Frisiertischchens zu verstauen, allerdings nicht, ohne mir vorher mit einem sauberen Pinsel scherzhaft auf die Nasenspitze zu tippen. Ihre grauen Augen blitzen vergnügt, ehe sie die Lippen zu einem Lächeln verzieht. »Ihr seid unverbesserlich, Mademoiselle.«
»Dann ist es ja gut, dass man mir das heute Abend nicht ansieht.«
Wie vermutlich ohnehin kaum eine Gefühlsregung unter den zahlreichen Schichten aus Cremes und Puder, aber das behalte ich lieber für mich.
Amélie lässt geräuschvoll eine Schublade zuschnappen, und ich blinzele sie mit Unschuldsmiene an, bis sie sich kopfschüttelnd abwendet, um ihr leises Lachen zu überspielen.
Ich nutze die Gelegenheit, um einen kurzen Blick in den Spiegel neben dem Schminktischchen zu werfen, der zur Hälfte von Amélies schlichtem blauem Leinenrock und – mieder verdeckt wird. Mein Kleid fühlt sich nicht nur an wie Wasser, das an meiner Haut hinabfließt, es sieht auch genauso aus. Das Korsett ist weich und bequem, und die goldenen Ornamente heben den Kupferton meiner Haare dezent hervor. Ein paar geschickt drapierte Wellen fallen aus der Hochsteckfrisur in mein Gesicht und betonen gemeinsam mit den aufgeklebten Saphiren und dem blauen Lidstrich meine blauen Augen.
Amélie hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Niemand wird darauf achten, wie nervös ich bin, solange ich so aussehe.
»Danke, Amélie«, murmele ich.
Meine Zofe schließt die letzte Schublade, ehe sie sich umdreht und auf mich zutritt. Ich betrachte das kleine silberne Medaillon um ihren Hals, die eingravierten Ranken um den Buchstaben A, dann die sorgfältig gebundene Schleife um ihre Taille, schaue überallhin, nur nicht in ihre Augen. Ich würde es nicht ertragen, die Sorge darin zu sehen. Mit einer kaum spürbaren Berührung rückt sie ein letztes Steinchen zurecht. »Nicht doch, Mademoiselle. Dafür bin ich da. Aber lächeln müsst Ihr schon selbst.« Sanft tätschelt sie mir die Wange, was mich tatsächlich die Mundwinkel heben lässt. In dieser kurzen, vertrauten Berührung liegt so viel mehr, als sie je mit Worten zum Ausdruck bringen könnte. Zuneigung, Mitgefühl, Besorgnis. Sie öffnet die schmalen Lippen, schließt sie jedoch wieder.
Diese kleine Geste verursacht ein leichtes Stechen in meiner Brust. Für einen kurzen Moment will ich mich ihr anvertrauen. Endlich mit jemandem offen über das sprechen, wovor ich mich fürchte. Über das, was vor vier Jahren geschehen ist. Das, was Astoria und ich seit jenem Tag nie wieder angesprochen haben, obwohl wir sonst über alles reden; über diese unsichtbare Barriere, die seitdem kaum merklich zwischen uns steht und die wir beide geflissentlich ignorieren. Doch sie ist da. Und heute spüre ich sie mehr denn je.
In wenigen Stunden werde ich vor den Augen der Gäste aus allen fünf Reichen unseres Landes ein Los mit der Nummer meines zukünftigen Gejagten ziehen – und damit offiziell zur Jägerin. Schon morgen früh werde ich mit den anderen adeligen Jugendlichen Prismeïas zusammen auf die Insel Arc-en-ciel gebracht, um meinen Gejagten zu fangen und zu zeichnen – und mich jede einzelne Sekunde vor dem Monster zu bangen. Vor dem Moment, in dem es mich überwältigt, um meinen Gejagten und alle in meinem Umfeld zu seiner Leinwand zu machen.
Seit damals habe ich jeden Tag meines Lebens damit zugebracht, mich anzupassen. Brav zu sein, belesen zu sein, höflich zu sein. Kein Aufsehen zu erregen. Meine Gefühle so gut es geht abzuschwächen, um keinen erneuten Ausbruch des Monsters zu provozieren. Umso mehr graut es mir davor, meine Handschuhe abstreifen zu müssen, sobald wir zur Insel aufbrechen, und mich und die anderen der Gefahr aussetzen zu müssen, die ich bedeute.
Amélie steht vor mir, die Daumen noch immer federleicht auf meinen Wangen platziert, und betrachtet mich aufmerksam.
Ich setze gerade an, etwas zu sagen – sie einen Blick hinter die Mauer, die ich um mein Geheimnis errichtet habe, werfen zu lassen –, als es hektisch an meine Tür hämmert. Ehe eine von uns auch nur reagieren kann, fliegt das getäfelte Eisbirkenholz auf, und Astoria rauscht mit wehendem Rock ins Zimmer, um sich auf mein Bett fallen zu lassen. Wie ein unglückliches Törtchen versinkt sie in einem Berg aus hell- und dunkelblauem Tüll und Satin und lässt ein lautes Seufzen vernehmen, während die dicke Matratze unter ihr nachfedert. Selbst mit all der Schminke sieht sie ungewöhnlich blass aus. Nicht einmal die funkelnden blassblauen Saphire, die in einem filigranen Muster auf ihre Wangenknochen geklebt wurden, oder der gleichfarbige Lidstrich vermögen davon abzulenken.
»Tori? Ist alles in Ordnung?«
Verzweifelt schaut sie mich an, nagt die blassrote Farbe von ihrer Unterlippe. Ihr Brustkorb hebt und senkt sich in einem raschen Rhythmus, und ihre Finger krallen sich in meine Bettdecke.
Schnell hole ich einen meiner Lippenstifte aus der Schublade hervor, stehe auf und setze mich neben meine Cousine aufs Bett, um sie in die Arme zu schließen. »Willst du drüber reden?«, frage ich sie, und sie lässt zu, dass ich die Farbe behutsam erneuere. Dabei ignoriere ich das unangenehme Prickeln, das sich seit jenem Tag vor vier Jahren jedes Mal in meinem Brustkorb breitmacht, wenn ich Astoria zu nahe komme.
Als ich fertig bin, schüttelt sie den Kopf, doch dann holt sie tief Luft. »Es ist nur … Morgen wird es ernst.«
Ich lasse die Hände sinken, während das nervöse Stechen in meinem Magen zunimmt und das Kribbeln in meiner Brust ablöst. Das Lampenfieber vor der Losziehung heute Abend ist wahrscheinlich nichts im Vergleich dazu, was uns danach auf Arc-en-ciel erwartet. Eine Insel, über die mir nichts bekannt ist außer den Schauergeschichten, die wir uns als Kinder erzählt haben, um uns gegenseitig Angst einzujagen. Ich erinnere mich gut an die unzähligen Male, die Astoria und ich versucht haben, unseren Eltern Antworten zu entlocken. Aber selbst, wenn sie uns welche geben wollten, sie könnten es nicht. Denn sie wurden im Anschluss an die Jagdspiele gezeichnet. Als Zeichen der Ehre für ihren Erfolg und damit ihr Schweigen über ihre Erlebnisse auf der Insel gewahrt bleibt.
»Ich weiß, was du meinst«, murmele ich leise.
Astoria nickt, wobei die winzigen blauen Steinchen an ihren äußeren Wimpern aufblitzen. »Ich wüsste zu gern, wie sich das Zeichnen anfühlt … Ich meine, stell dir mal vor, es klappt nicht auf Anhieb. Oder … oder gar nicht.« Ihre Stimme klingt mit einem Mal rau. »Oder ich finde meinen Gejagten nicht.«
»Hey«, flüstere ich und schließe sie erneut in die Arme. »Lass das bloß nicht Papa hören.« Ich löse mich von ihr, stemme die Hände in die Hüften und versuche, mit tiefer Stimme nachzuahmen, was mein Vater mir immer gesagt hat, als ich noch ein kleines Mädchen war. »Du bist eine de Bleu, und de Bleus kennen keine Angst! Bärenstarker Körper, bärenstarke Seele!«
Eine mehr schlechte als rechte Anspielung auf die Fähigkeit der de Bleus, mit ihrer blauen Farbe Einfluss auf den Körper eines Menschen nehmen zu können. Aber auf eine Vierjährige macht sie durchaus Eindruck. Deutlich mehr als der Leitspruch unseres Hauses: Seule l’âme la plus forte domine le corps – Nur die stärkste Seele beherrscht den Körper.
Früher fand ich die Vorstellung aufregend, über diese Stärke zu verfügen. Mit einem einzigen Wort, das ich jemandem auf die Haut schreibe, diese Person zu meiner Marionette machen zu können, ihren Körper jeden erdenklichen Befehl ausführen zu lassen. Entweder, indem ich ihr direkten Gehorsam auf Lebenszeit anweise, oder indem ich mit meinem Schriftzug die Konsequenzen festlege, die sie erleidet, wenn sie sich mir widersetzt. Ich könnte ihren Körper heilen oder zerstören, sofern ich die richtigen Worte finde und über genügend Kraft verfüge. Und solange die Farbe an meinen Händen und Armen, die sich mit jeder Zeichnung ein Stück weiter nach oben ausbreitet, noch nicht bis zu meinem Herzen hochgewandert ist. Denn sobald sie es erreicht, hört es auf zu schlagen.
Diese Gefahr und die Beschränkung jeder Farbe auf eine einzelne Facette des menschlichen Daseins – Körper, Erinnerungen, Tod, Gefühle oder Geist – sind die einzigen Grenzen unserer Fähigkeiten. Ansonsten ist uns alles möglich, was unsere Vorstellungskraft erlaubt. Allerdings müssen wir unsere Sätze weise wählen, da jede Zeichnung Wort für Wort funktioniert. Und je mächtiger ein Bann ist, desto schneller kann er durch eine undurchdachte Formulierung nach hinten losgehen. Für den Gezeichneten und für den Zeichnenden.
All das jagt mir seit dem Vorfall vor vier Jahren entsetzliche Angst ein, wenn auch eine andere als die, die meine Cousine jetzt verspürt, während sie mich so zerknirscht anschaut.
Ich weiß, was sie plagt – die Furcht, aus der Gesellschaft ausgestoßen zu werden, falls die Jagd misslingt. Familie, Freunde und das eigene Zuhause nie wiederzusehen und fernab unter den Bürgerlichen zu leben, die den Ausgestoßenen mit Verachtung begegnen. Alles zu verlieren, was einem wichtig ist. Eine Angst, die ich zwar teile, die jedoch weniger schwer wiegt als die vor dem Monster in mir, das ich all die Jahre über so sorgsam vor der Welt verborgen habe.
Und mit jedem Tag wächst die Furcht, was es tun wird, sobald ich es aus seinem knöchernen Käfig in die Freiheit entlasse.
»Das wird nicht passieren«, versichere ich Astoria. »Du bist die beste Bogenschützin, die es gibt. Und das Zeichnen schaffst du auch mit links.«
Mit dem Anflug eines Lächelns zupft sie an der gelockten Strähne, die mir in die Stirn fällt. Bei einer unserer Trainingsstunden vor drei Wochen hat sie sie mit einem Pfeil gekürzt – sehr zu Amélies Missfallen. »Da ist wohl was dran. Ich hatte die Wahl zwischen deiner Nase und deinem Haar.«
»Meine Nase wäre Amélie vermutlich lieber gewesen.« Grinsend schaue ich zu meiner Zofe hinüber, die gerade eine Auswahl an Korsetts und Handschuhen zurück in den Schrank sortiert. Dabei bewegt sie sich so flink, dass ihr blauer Leinenrock mit der hellgrauen Schürze um ihre Beine wirbelt.
»Allerdings«, bemerkt Amélie trocken, aber ihre Mundwinkel zucken verräterisch, und ihre Lachfalten vertiefen sich.
»Nächstes Mal also die Nase, ist notiert.« Astoria greift in mein Gesicht und tut so, als würde sie sie stehlen, wobei ein wenig getönte Creme am Stoff ihres Handschuhs zurückbleibt.
»Bon sang! Ihr verschmiert meine ganze Arbeit!«, protestiert Amélie, hastet hinüber zum Frisiertisch und will gerade erneut mit Tiegel und Pinsel auf mich losgehen, als es an der Tür klopft.
»Laelia?«
Beim Klang dieser Stimme jagt ein wohliger Schauer über meinen Rücken, breitet sich aus und konzentriert sich in meiner Magengegend. Ich würde sie überall erkennen. Dunkel, aber zugleich warm und sanft. Eilig springe ich auf, schlüpfe an Amélie vorbei, ohne auf ihr scherzhaftes Augenrollen und Kopfschütteln einzugehen, und öffne die Tür.
»Bonjour, étoile de ma vie«, sagt Laurent de Vert und zieht mich in eine stürmische Umarmung, wobei er beinahe den gigantischen Strauß grüner Hortensien fallen lässt, den er in den Händen hält.
Stern meines Lebens. Beim Klang seines Kosenamens für mich huscht ein Lächeln über meine Lippen.
»Wo hast du so lange gesteckt?«, frage ich, während ich mich an ihn schmiege und dabei die Nadeln der Hochsteckfrisur ignoriere, die sich unangenehm in meine Kopfhaut bohren. Ich spüre sein Herz an meiner Brust, wie es fest und stark gegen meines pocht, und fühle seine Wärme durch seine Handschuhe und den Stoff des Kleides hindurch auf meiner Taille.
Er schnaubt leise. »Du weißt schon. Verbeugungen, ein bisschen Small Talk, der kurze Gedanke, dass es vielleicht angenehmer wäre, aus dem nächstbesten Fenster zu springen. Das Übliche eben.«
»Und das, obwohl die Feier noch nicht einmal angefangen hat«, erwidere ich mit einem mitfühlenden Lächeln. »Aber ich glaube, Irina würde dich umbringen, wenn du das tätest.« Ich lege den Kopf in den Nacken, um seine blassgrünen, dunkelgrau umrandeten Augen zu betrachten. Das intensive Grün seiner mit Smaragden bestickten Korsettweste, passend zum Haus de Vert, beißt sich mit ihrer Farbe und der Sanftheit darin. Neben seinem weizenblonden Haar sind diese Augen das Einzige, worin er seiner Zwillingsschwester äußerlich ähnelt.
»Soll sie nur. Schlimmer kann es wohl kaum werden.« Laurent lacht gedämpft, bevor er den Kopf senkt und seine Lippen auf meine legt. Sie schmecken nach dem berühmten Pfirsichblütenschnaps meiner Familie, der Gästen stets als Aperitif serviert wird. Er küsst mich zärtlich und so sanft, als könnte ich unter seiner Berührung zerbrechen, was mir ein leises Seufzen entlockt.
»Ich fände es schrecklich, wenn du das tätest«, murmele ich an seinem Mund, bevor ich mich auf die Zehenspitzen stelle – in den hohen Schuhen gar kein so leichtes Unterfangen – und seinen Kuss erwidere.
Dann jedoch löse ich mich von ihm und mustere ihn prüfend, betrachte die Sorgenfalten auf seiner Stirn und seine Lippen, die er nervös zusammenpresst. »Und jetzt mal ehrlich, wie geht’s dir?«
Er zuckt mit den Schultern, aber über seine Augen legt sich ein Schatten, der mir allzu vertraut ist. Es ist der gleiche Schatten, der sich immer wieder in seine Miene schleicht, wenn wir über die Jagd sprechen. Er war da, als wir uns vor drei Jahren zum ersten Mal begegnet sind – bei der letzten Losziehung, die im Reich der de Blancs stattfand. Er war da, als wir überlegten, ob es einen Weg gäbe, die Jagd zu umgehen. Und er war da, als wir versuchten, uns eine Zukunft nach der Jagd auszumalen. Er ist oft da, dieser Schatten. Und wie jedes Mal, wenn er sich auf Laurents Zügen ausbreitet und die Aussicht auf die Jagd auch mein Herz vor Angst verdunkelt, verschränke ich meine Finger mit seinen. Ich hebe unsere Hände, bis sie auf Höhe unserer Herzen verharren und wir das rhythmische Pulsieren durch den Stoff unserer Handschuhe spüren können. Er schließt die Lider, und ich tue es ihm gleich, nehme ein paar tiefe Atemzüge. Einen Moment lang herrscht Ruhe in meinem Kopf. Kein Monster, keine Jagd, keine Angst. Nur Laurents Hand in meiner, sein Herzschlag so nah an meiner Haut. Nur wir beide, ein angenehmes Prickeln in meinem Körper und Stille.
Schließlich öffne ich die Augen wieder und sehe Laurent an. Seine Stirn ist glatter, der angespannte Zug um seinen Mund einem geradezu erleichterten Ausdruck gewichen. Der Schatten verblasst.
»Besser?«, wispere ich, und er nickt.
»Danke.«
Statt einer Antwort löse ich meinen Griff, beuge mich vor und küsse ihn erneut. Es tut gut, Laurent bei mir zu wissen. Er versteht mich auf eine Weise, wie niemand sonst es kann. Denn auch er trägt innere Kämpfe aus, das habe ich sofort gespürt, als ich ihn zum ersten Mal sah. Wir mögen zwar nicht im selben Boot sitzen, doch wir trotzen dem gleichen Sturm. Und seltsamerweise gibt mir diese Gewissheit Halt, auch wenn wir bis heute nie wirklich darüber gesprochen haben.
Langsam lässt er die Hand von meiner Taille nach oben an meine Wange wandern, wobei er eine prickelnde Spur über meinen Körper zieht. Ich verschränke die Finger über dem Pferdeschwanz in seinem Nacken, und für einen Sekundenbruchteil spiele ich mit dem Gedanken, die grüne Satinschleife zu lösen, damit ich durch seine Haare fahren kann.
Ein Räuspern hinter Laurent lässt uns innehalten.
»Was denn?«, fragt er, den Mund noch immer so nah an meinem, dass sein Atem dabei über mein Gesicht streicht und mir einen sanften Schauer den Rücken hinabjagt.
»Spart euch das besser für nach der Jagd auf«, antwortet Blaise de Bleu und mustert uns. Er hat das gleiche schwarze Haar, die blauen Augen und Sommersprossen wie seine Schwester. Obwohl er bereits achtzehn und damit knapp zwei Jahre älter ist als Astoria und ich, wirkt er mit seinen vollen Wangen und den runden, blau umrandeten Augen auf eigenartige Weise jünger. Das Hellblau seiner Korsettweste verstärkt diesen Eindruck zusätzlich. »Außerdem sollten wir uns beeilen. Es geht jeden Moment los.«
Der Stoff von Astorias Kleid raschelt in meinem Rücken, als sie zu mir an die Tür tritt und ihren Bruder abschätzig mustert. »Charmant wie immer, mon frère. Geh doch schon mal vor, wenn du so nervös bist.«
»Du weißt genau, dass das nicht geht. Nicht, solange Laurent dann mit euch allein wäre. Obwohl ich mir den Anblick liebend gern ersparen würde.«
Astoria verdreht die Augen. »Gib ruhig zu, dass Maman dich schickt, um den Anstandswauwau zu spielen.«
»Danke für die Blumen«, sage ich an Laurent gewandt, bevor die Geschwister in ihre übliche Zankerei verfallen können.
»Ach ja«, erwidert Laurent zerstreut und überreicht sie mir. Mit einem Anflug von Belustigung bemerke ich, dass ein paar Stiele durch unsere Umarmungen geknickt sind. »Tut mir leid.«
Vorsichtig nehme ich das Bouquet entgegen und schnuppere daran. »Das macht doch nichts. Sie duften himmlisch.«
»Bitte, Mademoiselle, ich werde mich darum kümmern«, bemerkt Amélie, nimmt mir den Strauß ab und verschwindet mit einem Knicks durch eine in der Wand eingelassene Tür im Dienstbotengang, aber nicht, ohne mir vorher ein aufmunterndes Lächeln zu schenken.
»Das ist aber noch nicht alles«, erwidert Laurent, zieht eine Schatulle aus dunkelgrünem Samt aus seiner Hosentasche und hält sie mir hin.
Verlegen schaue ich ihn an. Es ist mir peinlich, dass ich ihm kein Geschenk besorgt habe. Ich war so sehr damit beschäftigt, mir Gedanken um die Jagd zu machen und darüber, wie wir den heutigen Abend überstehen, dass es mir nicht einmal in den Sinn gekommen ist. »Das wäre doch nicht nötig gewesen.«
»O doch, das war es. Für den étoile de ma vie tue ich alles.«
Blaise lässt ein leises Würgegeräusch vernehmen, während ich die Schachtel öffne und darin eine filigran gearbeitete Armspange entdecke. Das Gold wurde ringsum mit zarten Blättern graviert, und in der Mitte thront so, dass sie den Verschluss verdeckt, eine kleine Pfirsichblüte mit einem winzigen Smaragd anstelle von Fruchtknoten und Staubblättern.
»Ich weiß, der Stein beißt sich mit deinem Kleid, aber …«, setzt Laurent an.
»Er ist wunderschön«, flüstere ich. Es rührt mich, dass er mir für den heutigen Anlass ein Geschenk in den Farben seines Hauses überreicht. Es ist ein Zeichen der Einheit, ein wortloses Versprechen, das wir auf diese Weise stolz nach außen tragen.
Eigentlich ist es verboten, etwas in den Farben eines anderen Hauses zu tragen. Kurz zögere ich, ringe mit mir, ehe ich mir einen Ruck gebe. Wenn je ein Anlass dazu einlud, eine winzige Regel zu brechen, dann den heutigen Abend. »Legst du sie mir an?«
»Natürlich.«
Er nimmt mir die Schatulle ab und das Schmuckstück heraus, umschließt meine Hand mit seiner und legt es mir um. Mit Ausnahme des grünen Edelsteins fügt sich der Armreif nahtlos in das aufgestickte Spitzenmuster meiner Handschuhe ein.
Laurents Berührung jagt ein warmes Prickeln meinen Arm hinauf und bis in meine Brust hinein, sodass mein Herz schneller zu pochen beginnt. Als er anschließend meine Hand an sein Gesicht hebt, um sie zu betrachten, verharrt er einen Moment zu lange in dieser Position – vermutlich wegen des Parfums aus Pfirsichblüte und Vanille, das ich darunter trage. Diesen Duft sprühe ich nur für ihn auf meine Haut. Ich trug ihn bei unserer ersten Begegnung vor drei Jahren und seitdem jedes Mal, wenn wir uns sehen. Selbst die Briefe, die ich ihm jeden zweiten Tag schicke, benetze ich damit, in der Hoffnung, dass ihm der Geruch beim Öffnen ebenso ein Lächeln entlockt wie der seiner Antworten mir. Ich bewahre jeden einzelnen Brief, den ich je von ihm erhalten habe, in einer verschlossenen Kiste neben meinem Bett auf. Wann immer ich sie öffne, schließe ich die Augen und lasse mich von den Noten von Hortensien, Lavendelöl und Sandelholz umhüllen – und manchmal auch von einem Hauch Olivenblüte, die Laurent in den Umschlag legt, solange die Bäume blühen.
Ich wünschte, du wärst hier, um sie zu sehen.
Ein wohliger Schauer kriecht mein Rückgrat hinab.
Blaise räuspert sich vernehmlich.
»Hast du was im Hals? Möchtest du vielleicht ein Glas Wasser? Ich bin sicher, Laelia hat einen Krug im Zimmer stehen«, knurrt Laurent über seine Schulter hinweg.
»Nicht nötig. Im Festsaal gibt es mehr als genug zu trinken, habe ich mir sagen lassen.«
»Halt die Klappe, Blaise«, schnappt Astoria und tritt aus meinem Zimmer, um sich bei ihm unterzuhaken. Als sie an mir vorbeigeht, bemerke ich den großzügigen Rückenausschnitt, der von fließendem Stoff begrenzt wird und mit einer schweren Saphirquaste beschwert bis auf ihre Taille hinabfällt. Er entblößt das kleine Muttermal auf ihrem rechten Schulterblatt, neben dem ihre halb offenen, langen Haare über ihre nackte Haut streichen.
Ich folge ihr und ergreife den Arm, den Laurent mir anbietet, wobei mein Blick auf die goldene Brosche auf seiner Brust fällt. Sie ist oval, mit der erhabenen Gravur eines gewaltigen, gewundenen Baumes darauf, dessen Anblick mir fremd ist. Bevor ich ihn jedoch danach fragen kann, spüre ich den Druck von Blaises Handschuh auf meinem Schulterblatt, mit dem er mich vorwärtsschiebt. Selbst durch den Stoff des Kleides hindurch fühlt er sich unangenehm rau an.
»Los jetzt, sonst kommen wir wirklich noch zu spät. Und das will die Dame des Hauses sich bestimmt nicht zuschulden kommen lassen.«
Der kühle Unterton, der sich bei diesen Worten in seine Stimme schleicht, vertreibt die Wärme, die Laurent eben noch in mir entfacht hat, und bringt die Nervosität mit einem Schlag zurück.
Denn als Tochter der Hauptfamilie des Hauses de Bleu sind die Jagdspiele vermutlich nichts gegen das Haifischbecken der Adeligen, das mich im Salon Bleu erwartet.
Kapitel 2
Die von Kerzenlicht und Körpern erhitzte Luft im Saal scheint vor Spannung förmlich zu vibrieren, als wir eintreten. Arm in Arm schreiten wir über die indigofarbenen Marmorfliesen an einem Meer aus blauen, grünen, roten, goldenen und weißen Stoffen vorbei. Überall ragen kunstvoll drapierte Sträuße aus Hyazinthen in den unterschiedlichsten Blautönen aus Kristallvasen in die Höhe und erfüllen den Raum mit ihrem süßen Duft. Für die Losziehung, den Höhepunkt des Abends vor dem Festmahl, sind die prunkvoll eingedeckten Eisbirkenholztische so weit an den Rand der Halle geschoben worden, dass die Gäste gerade noch so daran sitzen können. Sie stehen auf Podesten, damit das Publikum später freie Sicht auf die Ziehung hat. Doch im Moment tummeln sich alle auf der freien Fläche in der Mitte, um Belanglosigkeiten, Klatsch und Tratsch auszutauschen und die Anwärterinnen und Anwärter aus nächster Nähe zu betrachten. Selbst in der Masse aus edlen Gewändern sind sie leicht an der Nervosität in ihren Gesichtern zu erkennen, die sie vergeblich zu verbergen suchen.
Wie erwartet, richten sich Dutzende Augenpaare auf uns. Blicke streifen meine Hochsteckfrisur, verfangen sich in den Saphiren auf meinen Schläfen, huschen zu meiner Hand an Laurents Ellenbeuge. Durchdringen förmlich meine Handschuhe und mein Kleid, bis ich mich trotz der zahlreichen Schichten aus Seide, Satin und Tüll nackt fühle. Zwar habe ich bereits damit gerechnet, doch die Realität ist um einiges unangenehmer als erwartet. Als Tochter der Hauptfamilie nehmen die Gäste mich besonders intensiv in Augenschein, skeptisch, wie sich die zukünftige Repräsentantin des Hauses de Bleu schlägt. Denn als nächste Thronfolgerin – sofern ich als Jägerin Erfolg habe – werde ich in einigen Jahren nicht nur die Aufgabe haben, über unser Reich zu herrschen, sondern auch, die Interessen sämtlicher Zweige der de Bleus auf den Ratsversammlungen zu vertreten. Dort finden sich in regelmäßigen Abständen die Oberhäupter aller fünf verbliebenen Adelshäuser zusammen, um über die Belange des gesamten Landes zu entscheiden.
Ich straffe die Schultern, während mein Magen sich unangenehm zusammenzieht, und bin froh, ihnen nicht allein gegenübertreten zu müssen. Vor Aufregung wird mir beinahe schwindelig, und meine Kehle ist mit einem Mal wie ausgetrocknet. Als ich schlucke, klingt der Laut rau und angestrengt.
»Warte kurz«, raunt Laurent mir zu, der mein Unbehagen zu bemerken scheint, und legt beruhigend seine freie Hand auf meine. Als Sohn der Hauptfamilie der de Verts steht auch er unter Beobachtung, doch im Gegensatz zu mir scheint er die abschätzigen Blicke ignorieren zu können, ebenso wie das Getuschel über unsere Beziehung. »Ich hole uns etwas zu trinken.«
Dankbar nicke ich ihm zu und drehe mich zu Astoria und Blaise um. Aber sie sind nicht mehr hinter mir. Meine Cousine unterhält sich ein paar Meter entfernt mit ihrer Maman, meiner Tante Béatrice, die ihr zärtlich das Haar über die Schulter streicht und ihr vermutlich ein Kompliment macht. Ihr Bruder hingegen steht ein wenig abseits der anderen Gäste, um Camille de Bleu schöne Augen zu machen, einem jungen Mädchen mit hellbraunem Haar aus einer entfernten Nebenfamilie.
Ohne Astorias Nähe erscheint mir die Luft noch stickiger, beinahe zu dick zum Atmen. Bis ich die geöffneten, halbrunden Fenster zu meiner Linken erblicke, die auf einen Balkon hinausführen. Die dünnen Seidenvorhänge bauschen sich in einer leichten Sommerbrise, die ein wenig Abkühlung verspricht. Ich nicke einer Gruppe nervöser Anwärterinnen in goldenen und weißen Kleidern und Lidstrichen zu, ehe ich auf den rettenden Ausgang zusteuere, so schnell meine hohen Absätze es erlauben.
»Mal schauen, wen wir nach den Jagdspielen wiedersehen. Ein paar Taugenichtse sind ja immer dabei«, raunt eine Frau in einem ausladenden roten Kleid mit einem tropfenförmigen Rubin an einer Goldkette ihrem Gatten zu, als ich mich an ihr vorbeidränge. Die Bissigkeit ihrer Worte wird durch die rote Umrandung ihrer Augen noch befeuert, die sie im Kerzenlicht wirken lässt, als würden Flammen darin lodern. Sie stammt aus dem Haus de Rouge, das dazu in der Lage ist, mit seinen Zeichnungen Emotionen zu manipulieren. Hinter ihr, gerade mal eine Armlänge entfernt, steht ihr bei der Jagd gezeichneter Leibdiener in einer roten Leinentunika und starrt mit mühsam beherrschter Miene auf den Mann neben ihr. Auf seiner Wange prangt gut sichtbar der rote Schriftzug Mireille de Rouge ist dein Leben.
Der Ärmste. Vermutlich sind aufgrund dieser ausschweifend gewählten Worte nicht nur seine Gefühle, sondern auch seine gesamte Lebensspanne an Mireille de Rouges gekoppelt.
»Mir würde es ja schon reichen, mal wieder ein paar Garnelen zu haben«, murrt ihr Ehemann und schiebt sich missmutig ein mit getrocknetem Schinken umwickeltes Melonenschiffchen in den Mund. Seine weinrote, straff gespannte Korsettweste beißt sich mit seinen leicht rötlichen Haaren. »Diese ständigen Knappheiten momentan bringen mich noch ins Grab.«
»Da sagst du was. Diese Kette muss ich nun bereits zum dritten Mal in einem Jahr tragen, weil kein Nachschub kommt. Unfassbar.«
Ein junger Mann in einem blütenweißen, mit Diamantsplittern besetzten Korsett über einem ebenso hellen Hemd beugt sich verschwörerisch zu ihnen herüber, sobald er bemerkt, dass ich in Hörweite bin. »Bei den ganzen Unruhen momentan wundert es mich, dass die de Bleus überhaupt so viele Delikatessen beschaffen konnten. Die Amuse-Bouches sind absolut vorzüglich. Sie müssen wirklich ausgezeichnete Kontakte haben.«
Ich verkneife mir ein Augenrollen und eine Bemerkung darüber, dass die kleinen Häppchen eigentlich dafür gedacht sind, erst gemeinsam mit dem Champagner genossen zu werden, der vor der Ziehung serviert wird. Der de Blanc weiß genau, dass er sich diese Spitze erlauben kann. Kaum jemand würde es wagen, ihm öffentlich zu widersprechen, denn sein Haus ist seit dem Untergang des Hauses de Noir mit der Aufgabe der Rechtsprechung betraut. Der Bereich passt zu den de Blancs, denn sie kontrollieren Leben und Tod. Mit ihrer weißen Farbe schreiben sie Menschen den Tod auf die Haut, sei es als Datum, als Bedingung oder als Konsequenz bei einem Fehltritt. Ein würdiger Nachfolger für die de Noirs, deren schwarze Schrift alle anderen Farben zu überschreiben vermochte. Eine mächtige Fähigkeit – die gemeinsam mit dem Haus de Noir ausgelöscht wurde.
Statt dem de Blanc zu antworten, setze ich ein unverbindliches Lächeln auf, während er sich mit einem falschen Kichern von dem de Rouge-Pärchen feiern lässt, und trete hinaus ins Freie. Dort lege ich die wenigen Schritte bis zur mit Hyazinthenbouquets bestückten Brüstung zurück und schaue auf den Schlossgarten hinab. Unter mir entdecke ich eine Schar kleiner Kinder in Kleidern, Westen und Stoffhosen in den Farben ihrer Häuser, die johlend einem aus dem Gehege entwischten Pfau hinterherjagen. Die leichte Brise weht den entfernten Duft der Pfirsiche zu mir hinauf, wo er sich mit dem der Hyazinthen mischt. In der Ferne erkenne ich den Platz mit der Marmorstatue des Mädchens mit den blauen Fingerspitzen, die ich in den letzten Jahren oft betrachtet habe.
Blau werden auch meine Finger sein, wenn ich meine Bestimmung auf der Insel erfüllt habe.
»Hier steckst du«, sagt Laurent hinter mir und tritt an die marmorne Brüstung heran. »Ich habe dich schon überall gesucht.«
»Entschuldige. Ich … brauchte ein wenig frische Luft.«
Er schnaubt leise, wobei seine Augen amüsiert aufblitzen, ehe er einen hochnäsigen Tonfall aufsetzt. »Wieso denn das, Mademoiselle de Bleu? Sind Euch die Gespräche über die Amuse-Bouches etwa nicht Ablenkung genug? Ich muss doch sehr bitten.«
»Ich weiß nicht, wie ich es Euch sagen soll, Monsieur, aber – ich habe keine Ahnung, wie ich ohne Garnelen überleben soll«, gestehe ich und führe theatralisch eine Hand an den Mund.
Ich meine, einen verbitterten Zug zu sehen, der sich um seine Mundwinkel schleicht, so kurz, dass ich es mir ebenso gut eingebildet haben könnte. Schon ist das leichte Lächeln zurück, wenn auch etwas schief und angespannt. »Na ja, fürs Erste könnte vielleicht ein wenig Pfirsichwein Abhilfe schaffen?«
Vorsichtig nehme ich das schwere Kristallglas mit dem silbernen, saphirbesetzten Stiel entgegen und nippe an der rosafarbenen Flüssigkeit. Anschließend stelle ich das Gefäß auf dem Geländer ab, wobei ein paar Blütenblätter in den Garten unter uns schweben, und wende mich ihm zu. »Es ist zumindest ein Anfang.«
Er tritt einen Schritt näher an mich heran. »Hm, und wie wäre es hiermit?«, flüstert er mir ins Ohr, streicht mir mit der freien Hand behutsam eine verirrte Strähne aus dem Gesicht und beugt sich zu mir hinab, um mich zu küssen.
»Laurent!«, ruft jemand hinter uns. Energische, schnelle Schritte kommen von der Tür auf uns zu. »Verdammt noch mal, Laurent!«
»Nicht jetzt, Irina«, knurrt Laurent dicht an meinem Mund.
Ich fühle seinen Atem, der warm darüberstreicht, recke das Kinn und streife flüchtig mit meinen Lippen über seine, hole mir einen Vorgeschmack des Kusses, den er mir eben noch geben wollte.
»Doch, genau jetzt, Bruderherz«, zischt seine Zwillingsschwester, packt Laurent am Arm und zieht ihn von mir fort. Wütend deutet sie auf den goldenen Anstecker auf seiner Brust. »Was denkst du dir bloß dabei, sie zu tragen? Papa ist außer sich!«
»Ich zeige nur, wofür ich einstehe«, entgegnet Laurent kühl. »Das sollte ihn eigentlich stolz machen.«
Irina verschränkt die Arme vor der Brust, wobei Dutzende Smaragde auf ihren langen, transparenten Handschuhen aufblitzen. Verärgert wischt sie sich eine der kunstvoll drapierten Locken aus dem Gesicht, die sich in den aufgeklebten Schmucksteinen verfangen hat. »Das steht dir aber noch nicht zu, und das weißt du! Wieso legst du es so sehr darauf an, ihn gegen dich aufzubringen?«
Ich umklammere das Glas fester und mache einen Schritt auf die Geschwister zu, um den goldenen Baum näher in Augenschein zu nehmen. »Was hat es damit denn auf sich?«
Die beiden tauschen einen Blick. Irina schüttelt mahnend den Kopf, aber Laurent beachtet sie nicht.
»Unser Vater«, setzt er an, während auf seiner Schläfe eine Ader hervortritt, »hatte die Idee, eine Force d’élite ins Leben zu rufen. Eine Eliteeinheit, die sich der aufkeimenden Unruhen annimmt.«
»Du meinst die Unruhen der Bürgerlichen?«
Es ist nicht ungewöhnlich, dass einige Bürgerliche vor der Jagd aufbegehren. Meist geschieht dies in den Wochen vor und nach der Ziehung der Jugendlichen, die als Gejagte in allen Fürstentümern gleichmäßig verteilt ausgelost werden, immer ein Gejagter für jeden Jagenden. Die Gemüter sind angespannt, die Angst vor der Jagd ist allgegenwärtig. Manchmal gibt es heftige Auseinandersetzungen mit den bürgerlichen Stadtwachen, die die Ziehungen beaufsichtigen. Denn sie wenden sich mit ihrer Loyalität den Adeligen gegenüber gegen ihr Volk, um ihre eigenen Familien zu schützen. Die Kinder der Stadtwachen sind von der Jagd befreit – sofern diese sich ebenfalls in unseren Dienst stellen. Manchmal versuchen ein paar Gruppierungen auch vergeblich, die Losziehung selbst im Vorfeld zu sabotieren, und ab und zu kommt es vor, dass einige Güter durch Sabotage, Streiks oder Auseinandersetzungen knapp werden. Nach allem, was ich an Unterhaltungsfetzen aufgeschnappt habe, scheinen die Unruhen in diesem Jahr stärker zu sein als üblich, obwohl sich die Bürgerlichen selbst damit am meisten schaden. Viele Lebensmittelspeicher sind bei den Auseinandersetzungen bereits in Brand geraten, und es sind nicht die Adeligen, die als Erstes Hunger leiden. Auch wenn sich die Knappheit selbst in unseren Kreisen deutlich bemerkbar macht.
Aber deshalb gleich eine Force d’élite ins Leben zu rufen, erscheint mir ein wenig übertrieben. Anscheinend sind den Häusern ihre Amuse-Bouches heilig.
Laurent nickt. »Genau. Es wurde vor sechs Monaten auf der letzten Versammlung der Häuser beschlossen. Papa hat sich sehr dafür eingesetzt, dass wir de Verts sie bis zu Beginn der Jagd aufbauen dürfen, um nach dem Fall der de Noirs das Machtgleichgewicht wiederherzustellen. Noch besteht sie nur aus Mitgliedern unseres Hauses, aber der Plan ist, sie auszuweiten und …«
»… und auf jeden Fall findet Papa, dass niemand sich mit dem Abzeichen schmücken sollte, der seinen Platz in der Gesellschaft noch nicht verdient hat«, fällt Irina ihm scharf ins Wort. Dann wird ihre Stimme plötzlich weich, geradezu sanft, während sie nach dem Anstecker greift und ihn behutsam von Laurents Weste entfernt. Zurück bleibt nichts als ein winziges Loch an der Stelle, an der zuvor das schwere Gold geglänzt hat. »Warte einfach bis nach der Jagd, Bruderherz. Mir zuliebe.«
Sie sehen einander an. Ich erkenne Verbitterung in Laurents Augen, den brennenden Drang, sich zu beweisen – und noch etwas anderes, das ich nicht zu deuten vermag. Doch bevor ich dem näher auf den Grund gehen kann, gesellt sich Astoria zu uns auf den Balkon, gefolgt von Blaise mit zwei Gläsern in der Hand. Astoria sieht merklich blass um die Nase herum aus und presst sich eine Hand auf den Bauch.
»Ist alles in Ordnung?«, frage ich und trete zu ihr.
»Geht gleich wieder«, behauptet sie und umklammert eine der rankenbewachsenen Säulen, die das Glasdach über unseren Köpfen stützen. »Aber die Luft da drin …«
»Hier, das beruhigt die Nerven.« Ihr Bruder betrachtet die beiden Gläser mit Pfirsichwein in seiner Hand und reicht ihr das vollere. »Wenn ihr mich entschuldigt – ich muss wieder rein, Small Talk und so. Ich wollte Tori nur nach draußen bringen.«
»Small Talk, pffft«, murmelt Irina und verdreht die Augen. »Dieser Small Talk hat zwei Beine, einen Hundeblick und nennt sich Camille.«
Ich pruste, was mir ein wütendes Schnauben von Blaise einbringt.
»Passt einfach auf Tori auf«, knurrt er, ehe er sich abwendet und den Balkon verlässt.
Irina schnaubt. »Der versteht ja überhaupt keinen Spaß heute.«
Astoria nimmt wortlos einen großen Schluck Wein, mit dem sie das halbe Glas leert, und verzieht prompt das Gesicht. Sie hat nicht einmal die Energie, ihrem Bruder einen genervten Blick hinterherzuschießen, weil er ihr nicht zutraut, auf sich selbst aufzupassen.
Mitfühlend tätschele ich ihren Oberarm, nehme ihr das Getränk ab und stelle es zu meinem auf das Geländer. »Ich glaube, das ist gerade nicht besonders hilfreich, oder?«
Astoria nickt matt und verbirgt das Gesicht an meiner Schulter. Ich nutze die Gelegenheit, um einen Blick nach drinnen zu riskieren, wo eine Gruppe Diener gerade ein schweres Gefäß in die Mitte des Saales schiebt und Stühle darum herum aufstellt. »Liegt es an der Luft oder der Urne?«
»Beides.«
»Ach, mach dir nichts draus«, sagt Irina, als meine Cousine sich wieder aufrichtet. Sie tritt an mir vorbei und legt den Arm um Astorias Schultern, um ihr tröstend über den Rücken zu streichen. Ihre Lippen formen ein aufmunterndes Lächeln. »Ein bisschen Lampenfieber hat noch niemandem geschadet.«
»Einfühlsam wie immer«, kommentiert Laurent. Er setzt an, noch etwas zu sagen, als die Glocke ertönt, die den Beginn der Zeremonie einläutet. »Ich glaube, wir sollten reingehen.«
Angespannt schlucke ich und spüre, wie mir in den Handschuhen der Schweiß ausbricht. Meine Kehle ist mit einem Mal vor Nervosität wie zugeschnürt. Ich fange den Blick meiner Cousine auf, der seltsam glasig wirkt, bis Irina sie sanft vorwärtsschiebt und eilig Astorias leicht zerzauste Haare richtet, sodass sie sich wieder in dichten Wellen über ihre Schultern ergießen. Astoria schüttelt energisch den Kopf, als ob sie auf diese Weise ihre Nervosität vertreiben müsste. Dann sieht sie mich mit einem unsicheren Lächeln an, als wollte sie sagen: »Na, dann wollen wir mal.«
Laurent bietet mir erneut seinen Arm an, den ich ergreife, während Irina mir im Vorbeigehen eine Hand auf die Wange legt, die in einem gefährlich dünnen Spitzenhandschuh steckt. Ich fühle ihre Wärme auf meiner Haut, beinahe fiebrig heiß, und fast kommt es mir vor, als befände sich keine Schicht aus Stoff zwischen ihr und mir. Jäh breitet sich Gänsehaut auf meinem Körper aus.
»Bonne chance«, flüstert sie mir zu. Es sieht aus, als läge ihr noch etwas auf der Zunge, doch sie sagt nichts mehr.
»Bonnechance«, erwidere ich ihre Glückwünsche mit einem Nicken.
Auch Laurent setzt sich in Bewegung, aber einem plötzlichen Impuls folgend lasse ich meine Hand an seinem Ärmel hinabgleiten und ergreife die seine, ziehe ihn an mich heran und presse meine Lippen auf seine, lege all meine Nervosität und Angst hinein. Im ersten Moment wirkt er überrumpelt, dann erwidert er meinen Kuss, fährt mit den Fingern sanft an der Seite meines Kiefers entlang, was mir einen Schauer über den Rücken jagt und mir ein leises Seufzen entschlüpfen lässt.
Dieser Kuss ist anders als sonst, weniger zart und vorsichtig, sondern erfüllt von einem eigenartigen Hunger. Er ist kein vorsichtiges Herantasten, keine Frage, sondern eine Antwort und ein Versprechen. Das Versprechen, dass egal, was auf der Insel geschehen wird, wir uns nicht verändern werden. Dass wir zusammenhalten werden.
Als wir uns schließlich voneinander lösen, vergrabe ich das Gesicht an seiner Schulter, atme seinen Duft ein und lege die Arme um seine Taille. »Ich will nicht reingehen«, murmele ich in seine Korsettweste, spüre, wie die eingewebten Smaragde leicht an den Saphiren in meinem Gesicht kratzen.
Laurent zieht mich dichter an sich, schlingt die Arme um meinen Oberkörper und bildet einen warmen Kokon um mich herum. »Ich weiß. Ich will auch nicht«, murmelt er mir ins Ohr. Seine Brust vibriert leicht unter meiner Stirn, und es dauert einen Moment, ehe ich begreife, dass er beinahe lautlos in sich hineinlacht. »Um ehrlich zu sein, habe ich eine Scheißangst. Komisch, oder? Dabei sollte das doch kein Problem sein nach all dem Unterricht, den wir unser Leben lang bekommen haben. Zehn Tage auf einer unbekannten Insel überleben? Ein Kinderspiel. Unsere Gejagten aufspüren und zeichnen? Nichts leichter als das. So natürlich wie atmen. Und stattdessen mache ich mir ins Hemd.«
Ich schüttele den Kopf. »Es wäre eher komisch, wenn du keine Angst hättest.«
»Am liebsten würde ich für immer mit dir hier stehen bleiben. Allein. Keine Adelsgesellschaft, keine Insel, kein Zeichnen. Und vor allem keine Jagd. Nur wir beide auf diesem Balkon.« In seine Stimme hat sich ein leichtes Beben geschlichen, das sie rauer klingen lässt als üblich, geradezu verzweifelt.
»Das wäre schön.« Ich schmiege mich an ihn, genieße das Prickeln, das seine Worte in mir auslösen. Ein Schmuckstein rutscht von meiner Schläfe und fällt mit einem kaum hörbaren Geräusch auf den Marmorboden, aber es könnte mir nicht gleichgültiger sein. Ich würde jeden Saphir auf meiner Haut, jedes Kleid und jeden Stein dieses Palasts dafür eintauschen, dass Laurents Wunsch in Erfüllung geht.
Kurz schweigen wir, versinken in der tröstlichen Wärme des anderen, ehe ich beginne: »Falls jemand von uns es nicht schafft –«
»Wir schaffen es«, unterbricht mich Laurent. Er sagt es mit solch einer energischen Bestimmtheit, dass es mir beinahe schwerfällt, ihm nicht zu glauben.
Aber nur beinahe.
Denn er ahnt nichts von dem Monster in meiner Brust. Von der Gefahr, die in mir lauert, nur wenige Millimeter von seinem Herzen, nur ein paar dünne Schichten Kleidung von seiner Haut entfernt.
Zittrig hole ich Luft, zwinge mich, jeden Gedanken daran zu verbannen. Nicht auffallen, nicht aus der Reihe tanzen, nicht daran denken, lauten meine Regeln, die ich vor vier Jahren aufgestellt habe. Einfach nichts tun, was den trügerischen Frieden beenden und das Rumoren in meiner Brust heraufbeschwören würde.
Und heute wird nicht der Tag sein, an dem ich diese Regeln breche.
Also nicke ich nur, obwohl alles in mir danach schreit, Laurent meine Sorgen anzuvertrauen, und löse mich widerwillig von ihm.
Vielleicht, denke ich, vielleicht kann ich ihm nach der Jagd endlich alles erzählen. Wenn es vorbei ist. Wenn ich das Monster gezähmt habe.
»Wir sollten reingehen«, murmele ich. »Die Anwärter der Hauptfamilien sollten nicht zu spät kommen.«
Er nickt und bietet mir erneut seinen Arm an, den ich ergreife. Seine Finger zittern leicht, und ich schließe meine andere Hand fest darum, um ihn zu beruhigen. Wir sehen uns an. Über seinen blassgrünen Augen liegt der vertraute Schatten, der sie eine Nuance dunkler färbt, und das ermutigende Lächeln, das er mir zuliebe aufgesetzt hat, wirkt dünn wie Papier. Unter meiner Berührung scheint er sich zwar ein wenig zu entspannen, doch das Düstere bleibt.
Dann lasse ich ihn los. Sofort fühlt meine Hand sich kühler an, und ich kralle sie Halt suchend in meinen Rock.
»Denk dran: Nur noch ein paar Tage, dann steht unserem Glück nichts mehr im Weg«, wispert Laurent mir ins Ohr, und mein Herz beginnt zu flattern. Mir entgeht nicht, wie sein Blick flüchtig das Loch in seiner Weste streift, ehe er sich davon losreißt. Noch ein letztes Mal streicht er zärtlich über meinen Unterarm, bevor wir vier gemeinsam den Saal betreten und auf die dunkelblaue Los-Urne zusteuern, die unser Schicksal bereithält.
Kapitel 3
Wir reihen uns in die Prozession aus Jagdanwärterinnen und – anwärtern ein, die nach Farben geordnet an den erhöhten Tischen vorbei auf die Mitte des Salon Bleu zusteuern. Ein Strom aus funkelnden blauen, grünen, goldenen, roten und weißen Kleidern und Korsetts, passend zum Namen der Insel, auf der wir die nächsten zehn Tage verbringen werden: Arc-en-ciel – Regenbogen.
Wo sonst ausgelassen gelacht, getanzt, getuschelt und gefeiert wird, stehen jetzt achtundvierzig mit dunkelblauem Samt gepolsterte Stühle in einem Kreis bereit. In ihrem Zentrum erhebt sich auf einem Podest das glänzende dunkelblaue Gefäß, das mit Hyazinthenblättern aus Blattgold verziert ist.
Blaise bietet mir seinen Arm an. Als erstgeborenes Kind der höchstrangigen Nebenfamilie der de Bleus ist er der Nächste in der Thronfolge, falls ich die Jagd nicht erfolgreich absolvieren sollte – sofern er nicht in ein anderes Adelshaus einheiratet. Aus diesem Grund ist es unser beider Pflicht, den Aufzug anzuführen, während Astoria und die restlichen Anwärterinnen und Anwärter sich hinter uns einreihen.
»Bereit?«, raunt er mir zu. Seine Miene wirkt verschlossen, und es ist unmöglich zu erkennen, was in ihm vorgeht.
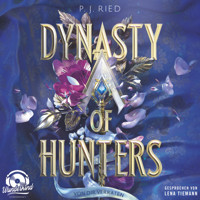
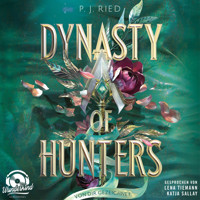
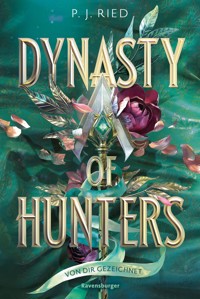
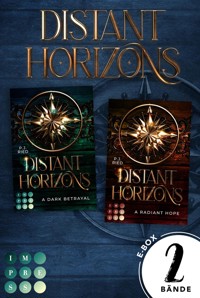
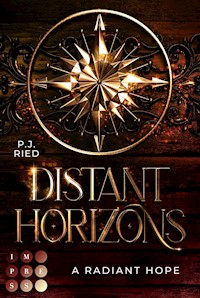
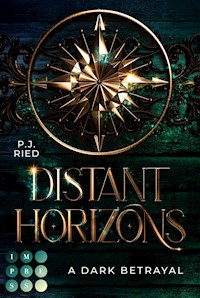












![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










