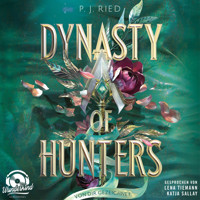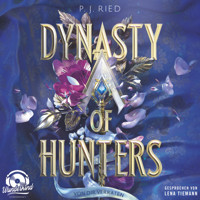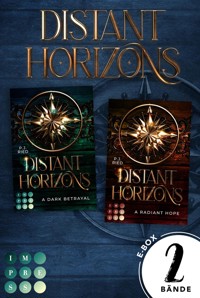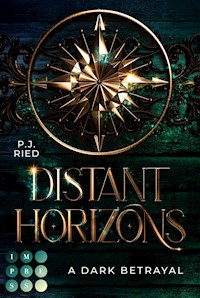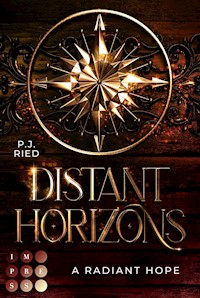
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Reiß mich nicht in die Fluten** Seit der Zerstörung der Kuppelstadt ist Alizea eine Gefangene von Evangeline. Hilflos muss sie mitansehen, wie die rücksichtslose Kapitänin die Herrschaft über Ark an sich reißt und ihre Crew in den Ruinen wüten lässt. Als es Alizea mithilfe von Ari, Aimée und Snap gelingt, die Diverin zu überwältigen, flieht die Kapitänin der Astarte und begibt sich auf die Suche nach ihrer restlichen Crew, um ihr Schiff zurückzuerobern und Kian zu finden. Denn der Piratenjäger besitzt das Einzige, das Evangeline daran hindert, die Kontrolle über Ark vollständig an sich zu reißen. Obwohl Alizea ihm nach seinem Verrat nicht mehr vertrauen kann, sind die beiden gezwungen, zusammenzuarbeiten, um die Welt vor der Zerstörung zu bewahren … Bist du bereit, den sicheren Boden unter deinen Füßen zu verlassen und dich auf eine gefährliche Reise voller Gefahren, Intrigen und großer Gefühle einzulassen? //Dies ist der zweite Band der dystopischen Piraten-Fantasy-Buchserie »Distant Horizons«. Alle Romane der Piraten-Fantasy: -- Distant Horizons: A Dark Betrayal -- Distant Horizons: A Radiant Hope Diese Reihe ist abgeschlossen. //
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
P.J. Ried
Distant Horizons 2: A Radiant Hope
**Reiß mich nicht in die Fluten**
Seit der Zerstörung der Kuppelstadt ist Alizea eine Gefangene von Evangeline. Hilflos muss sie mitansehen, wie die rücksichtslose Kapitänin die Herrschaft über Ark an sich reißt und ihre Crew in den Ruinen wüten lässt. Als es Alizea mithilfe von Ari, Aimée und Snap gelingt, die Diverin zu überwältigen, flieht die Kapitänin der Astarte und begibt sich auf die Suche nach ihrer restlichen Crew, um ihr Schiff zurückzuerobern und Kian zu finden. Denn der Piratenjäger besitzt das Einzige, das Evangeline daran hindert, die Kontrolle über Ark vollständig an sich zu reißen. Obwohl Alizea ihm nach seinem Verrat nicht mehr vertrauen kann, sind die beiden gezwungen, zusammenzuarbeiten, um die Welt vor der Zerstörung zu bewahren …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
© privat
P.J. Ried wurde 1997 geboren und lebt als Autorin und freie Lektorin in Hannover. Durch ihr Studium der Literaturwissenschaft entdeckte sie ihre Leidenschaft fürs Schreiben neu. Seitdem verirrt sie sich regelmäßig in fantastische Welten, was dank ihres mangelnden Orientierungssinns zum Glück kein Problem darstellt. Wenn sie nicht gerade in Geschichten abtaucht, liebt sie es zu zocken oder Serien und Animes zu schauen. Außerdem träumt sie von einem Leben am Meer mit Sushi-All-you-can-eat-Restaurants und einer Katze.
Für alle, die zwischen diesen Seiten ein Stück Familie finden.
Kapitel 1
Vergangen ist vergangen
Drei Jahre zuvor
»Na, wer bin ich?«
Ich grinse, während ich nach den schlanken Fingern taste, die meine Augen bedecken. »Sind wir nicht ein bisschen zu alt dafür?«
»Wer bin ich?«, beharrt er und ich höre das Lachen in seiner Stimme.
»Hm, ich weiß nicht … Walter?«
»Ach, komm schon, Al.«
»Waltraud.«
»Al!«
Mein Grinsen wird breiter, während ich kurz seine Handgelenke umschließe, um sie von meinen Lidern zu nehmen, und herumwirbele. »Du weißt genauso gut wie ich, dass ich jeden anderen direkt aufgespießt hätte, Kian.« Mit dem Kinn rucke ich in Richtung des hölzernen Übungsschwerts, das ich auf der Trainingstasche zu meinen Füßen abgelegt habe.
»Mit einem Holzschwert.«
»Splitter tun auch weh.«
»Das sind die schlimmsten.« Seine Mundwinkel zucken.
»Du bist spät dran«, bemerke ich. »Ist alles okay?«
Er bückt sich und hält anschließend zwei Mehrweg-to-go-Becher mit der Aufschrift Hot and Steamy in die Höhe.
»Heiße Schokolade!«, entfährt es mir.
»Mit extra Schokoraspeln.«
Ich hebe eine Braue. »Womit habe ich das denn verdient?«
Statt einer Antwort grinst er nur geheimnisvoll. »Ich will dir was zeigen.«
»Was denn?«
»Siehst du dann. Komm mit!«
»Warte!« Ich zögere. Eigentlich wollte ich hier, an unserem geheimen Platz auf dem Dach meines alten Wohnhauses, mit ihm über meinen Entschluss sprechen, Ark zu verlassen und meine Mutter zu suchen. Ich wollte ihn bitten, mir dabei zu helfen, ein Schiff zu stehlen. Doch so erwartungsvoll wie er mich ansieht, bringe ich es nicht übers Herz. »Was ist mit meiner Tasche? Ich hab keine Lust, sie durch die ganze Stadt zu schleppen.«
Kian winkt ab. »Wer soll sie hier oben schon finden?«
»Touché.«
Ich schiebe sie in die hinterste Ecke, dorthin, wo in knapp einer Stunde der nachmittägliche Schatten einer Metallstrebe des Kuppelgerüsts hinfallen und den dunklen Stoff in Dunkelheit hüllen wird. Dann folge ich Kian durch das schmale Loch ins Innere des Gebäudes hinein, durch die seit Jahren unbewohnte Dachgeschosswohnung bis zum Aufzug in der 120. Etage. Im Inneren empfängt uns wie immer Bobby McFerrins Song Don’t worry, be happy, der mich gleichermaßen mit Melancholie und Genervtheit erfüllt.
Wie schon damals, als wir Kinder waren, ergreift Kian meine Hand, um mir Kraft zu geben, während wir am siebten Stock vorbeifahren, in dem ich mit meiner Mutter gewohnt habe, bevor sie verschwunden ist. Beruhigend streicht sein Daumen über meine Haut, spendet mir Wärme und Geborgenheit. Doch in letzter Zeit sendet diese Berührung ein Prickeln durch meinen Arm bis hinein in meine Brust, von wo aus mein Herz es wie Stromstöße durch meinen gesamten Körper pumpt.
Mit einem leisen Pling öffnen sich die Türen und wir treten über den Flur auf die Straße. Dutzende Hochhäuser mit spiralförmigen Zierelementen ragen vor uns empor, manche von ihnen mit Grünflächen oder Gewächshäusern auf den Dächern. Ihre Fenster glänzen in der Sonne mit dem Metall ihrer Fassaden um die Wette. Ich bin froh darüber, dass die Meteorologen sich heute dazu entschieden haben, das Wetter möglichst natürlich zu belassen, statt wie so oft mit tierförmigen oder regenbogenfarbenen Wolken zu experimentieren – zum Amüsement der Bevölkerung, versteht sich.
Für einen Moment schließe ich die Augen und genieße das Gefühl von wärmenden Strahlen auf meiner Haut, bis mich Kians Stimme aus dem friedlichen Augenblick reißt.
»Komm schon!«, ruft er und ergreift erneut meine freie Hand, um mich mit sich zu ziehen, wobei ich beinahe meinen Kakao verschütte.
Wir folgen den von Rasenflächen und Bäumen gesäumten Wegen und quetschen uns durch die uns entgegenströmenden Menschen in Stoffhosen, Hemden und zugeknöpften Westen, die auf dem Heimweg von der Arbeit sind. Pikierte Blicke streifen unsere Sweathosen und Hoodies, bevor die Leute Kian erkennen und hastig wegsehen oder zu einem knappen Gruß ansetzen. Ich kann förmlich hören, was sie später tuscheln werden, über das Mädchen, das seine Mutter verloren hat, und den gnädigen Präsidenten Arks, der ihr ein Zuhause gegeben hat. Über seinen Sohn, der aus Mitleid ständig mit ihr zusammen ist. Über den schlechten Einfluss, den ich auf ihn ausübe. Doch das interessiert mich alles schon lange nicht mehr, denn bald werde ich nicht mehr hier sein.
Endlich erreichen wir den Eingang zur unterirdischen Bahnstation, vor dem die Statue des Wikingers Leif Eriksson mit einer Hand an der Axt und einer auf der Brust dramatisch in die Ferne schaut. Wie allen Skulpturen in Ark wurde ihr Kopf oben geöffnet und mit einer Kolumneepflanze bestückt, um den angeblich so offenen Geist der Stadt zu repräsentieren. Ironisch, wenn man bedenkt, dass ein Gerüst aus Glas und Stahl sie eisern vom Rest der Welt abschottet.
Doch statt wie gewohnt die Treppen hinabzusteigen, steuern wir geradewegs auf das Hochhaus dahinter zu. Die unteren Etagen wurden ausladend in Form eines Schiffrumpfs erbaut und ein wellenförmiges Muster in das Metall geschliffen. Anstelle von Masten ragt ein quaderförmiges Gebäude vom »Deck« in die Höhe, das fast bis hinauf zur Kuppel reicht. Dort, wo sich bei Schiffen die Reling befindet, wachsen Dutzende sorgfältig gestutzte Büsche, Farne und Sträucher empor, während ein paar Ranken ein Schild mit der Aufschrift Genius Exhibition umrahmen.
»Was willst du denn im Museum?«, frage ich irritiert und umklammere meinen Becher fester, um den Inhalt nicht auf den Metallstufen zu verschütten, die hinauf zum »Deck« führen.
»Siehst du gleich!«
»Ist es nicht schon geschlossen?«
Kian beachtet meinen Protest nicht, sondern geht, ohne zu zögern, an der auf Hochglanz polierten Eingangstür vorbei zum Hintereingang, wo er dreimal kurz die Klingel betätigt.
»Mir ist jetzt echt nicht nach einem Bildungsausflug«, setze ich erneut an, aber er wehrt ab.
»Vertrau mir. Das willst du sehen.«
Ein Summen ertönt, mit dem die Tür entriegelt wird, und wir treten ein. Kühle, trockene Luft schlägt uns aus den Klimaanlagen entgegen, weht den scharfen Geruch von Putzmittel in unsere Gesichter.
»Willkommen zur exklusiven Sonderausstellung im Genius Exhibition«, verkündet eine Frau stolz und tritt an uns heran. Sie trägt einen hellblauen Hosenrock, einen gestreiften, hautengen Pullover und ein Halstuch aus glänzendem Stoff, das sie vorn zusammengeknotet hat. Wendy, lese ich auf dem Namensschild, das sie an ihr Oberteil geheftet hat.
Ich runzele die Stirn, weil ich mich an keine Plakate oder Ankündigungen in der Schule oder der Stadt erinnern kann. Normalerweise wird jeder Zentimeter, der entbehrlich ist, mit Werbung tapeziert, sobald es eine neue Ausstellung gibt – als wäre der Besuch für Schülerinnen und Schüler nicht ohnehin verpflichtender Unterrichtsbestandteil. »Sonderausstellung? Was denn für eine?«
»Folgt mir bitte«, fährt sie fort und setzt ein Lächeln auf, das ihre perlweißen Zähne entblößt.
»Was soll das werden?«, zische ich Kian zu, doch dieser grinst mich bloß an und geht an mir vorbei ins Museum hinein.
Mit einem ergebenen Seufzen schließe ich mich den beiden an und folge ihnen durch einen nur noch spärlich beleuchteten Raum mit merkwürdigen Haushaltsgeräten der Alten Welt – darunter ein winziger Fingerfood-Teller mit Ring an der Unterseite, ein eher schlecht als recht erhaltener Selfie-Toaster sowie eine Gabel, die sich laut Beschreibung einmal um sich selbst drehen konnte, um eine spezielle Nudelsorte in mundgerechte Häppchen aufzuwickeln. Hinter einer Art Fahrrad mit Laufband anstelle von Pedalen öffnet Wendy eine schwere Tür und hält sie uns auf, wobei ihr Lächeln nicht eine einzige Sekunde lang verrutscht.
Ein paar Sekunden später schlägt mir ein so kräftiger Geruch nach Lösungsmitteln entgegen, dass ich Kopfschmerzen bekomme. Die Museumsmitarbeiterin führt uns eine lange Treppe hinab und einen gebogenen Flur entlang, bis sie vor einer unscheinbaren Tür mit der Aufschrift Restauration stehen bleibt.
»Bist du bereit?«, fragt Kian und ich nicke, ohne zu wissen wofür.
Doch sobald wir den Raum betreten, setzt mein Herz einen Schlag aus. Dutzende Menschen in spezieller Schutzkleidung wuseln um ein gigantisches Etwas herum, das mit unzähligen gepolsterten Pflöcken stabilisiert ist. Neben dem Geruch von Chemikalien bemerke ich beim Näherkommen auch den von Brackwasser und feuchtem Holz. Unwillkürlich rümpfe ich die Nase, bis ich realisiere, was sich da vor mir befindet. Ungläubig betrachte ich den hinteren Teil eines antiken Schiffswracks, das sich vor mir erstreckt. Ein abgebrochener Mast ragt vom Achterdeck in die Höhe und die Scharten, aus denen wahrscheinlich einst Kanonenrohre herausgelugt haben, scheinen mich leblos anzustarren. Das dunkle Holz, aus dem der Rumpf besteht, wirkt stumpf und rau von den Gezeiten und Mikroorganismen, die sich über viele Jahrhunderte hinweg an ihm gütlich getan haben. Für mich hingegen scheint es vor Leben geradezu zu summen.
»Wow«, entfährt es mir.
Kians Schulter streift meine. »Gern geschehen.«
»Das … Das ist einfach unglaublich.« Ehrfürchtig hebe ich meine freie Hand, fahre die Konturen in der Luft nach, als könnte ich das Fragment auf diese Weise tatsächlich berühren. Die Vergangenheit, das Meer, die Freiheit auf meiner Haut spüren.
»Wir sind uns noch nicht sicher, aber wir vermuten, dass dieses Schiff aus dem siebzehnten Jahrhundert stammen muss«, informiert uns Wendy. »Es ist unfassbar gut erhalten, besonders wenn man bedenkt, dass es aus organischen Materialien gefertigt wurde. Allerdings war es ein ganz schöner Akt, das Wrack zu bergen und hierherzubringen.«
Ich drehe mich zu Kian um. »Ich … Wow«, stammele ich erneut.
Er lächelt und sieht dabei so glücklich aus, als hätte ich ihm die Freude bereitet und nicht umgekehrt. »Ich dachte mir, dass dir das gefallen wird.«
Fasziniert trete ich vor, strecke erneut die Hand aus, bis ich einen der Stützpfeiler der Restaurateure berühre, wobei ich geflissentlich Wendys erschrockenes »Vorsicht! Nichts verschütten!« und ihren panischen Blick auf den To-go-Becher in meiner Hand ignoriere. Ganz oben auf dem Achterdeck meine ich die Umrisse einer Wand zu erkennen, die einmal die Kapitänskajüte vom Rest abgegrenzt haben könnte. Wie sehr ich mir wünschte, das Schiff betreten zu haben, als es sich noch auf hoher See befand. Die Meeresbrise in meinem Haar zu spüren, den echten, kühlen Wind, nicht den künstlich erzeugten Luftstrom innerhalb der Kuppel. Salzige Gischt auf meinen Lippen zu schmecken, die Sonne auf meiner Haut zu fühlen, bevor sie durch Glas gebrochen wird. Wer immer Captain dieses antiken Schiffes war, hat sich mit Sicherheit glücklich schätzen können, das Gefährt über den Ozean zu steuern. Er oder sie konnte segeln, wohin er wollte. Suchen und finden, was er vermisste.
Wie gern wäre ich an seiner Stelle gewesen.
***
»Alles okay?«, fragt Kian, während wir eine halbe Stunde später in der unterirdischen Station auf die Schwebebahn warten. »Du bist so still, seit wir aus dem Museum raus sind.«
»Ich bin einfach nur … überwältigt, das ist alles.«
Es stimmt – der Eindruck, den das Schiffswrack hinterlassen hat, ist noch frisch. Doch es ist nicht die ganze Wahrheit. Allerdings kann ich ihm schlecht sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Schon gar nicht, nachdem er mir solch eine Freude bereitet hat, ohne zu ahnen, dass er damit das Feuer, das in mir lodert, umso stärker entfacht hat.
Ich wende den Kopf, um ihn anzusehen. Lässig lehnt er neben mir an der Wand, die Kapuze seines Hoodies halb über den Kopf gezogen. Seine zerzausten braunen Locken quellen darunter hervor. Auch er schaut mich an, sucht meinen Blick und ich zwinge mich zu einem Lächeln. »Ehrlich. Ich bin unfassbar froh, dass du mir das gezeigt hast.«
»Aber?«
»Das Training war bloß anstrengend«, winke ich ab. »Versprochen, ich freue mich. Siehst du?« Mit den Fingern ziehe ich meine Mundwinkel noch weiter nach oben. »Fröhlich. Ignorier die Augenringe.«
Kian lacht auf, bevor er wieder ernst wird. »Meinst du nicht, dass du es mit dem Training ein bisschen übertreibst? Ich weiß, du willst zur Marine, aber …«
»Was denn? Sag nicht, du würdest mich vermissen«, stichele ich.
»Hättest du wohl gern.«
»Vielleicht.«
Er öffnet die Lippen, doch ehe er etwas erwidern kann, fährt die Bahn mit einem leisen Rauschen ein. Mit den Händen in der Bauchtasche meines Hoodies steige ich ein und nehme am Fenster Platz, gefolgt von Kian, der sich neben mich fallen lässt. Schulter an Schulter sitzen wir da, jeder in seine eigenen Gedanken versunken, und beobachten, wie erst die unterirdischen Tunnel an und kurz darauf die Kuppelstadt in einem Rausch aus Grün, Silber und Schwarz unter uns vorbeifliegen.
»Nächster Halt: Hafen – Pickie Fun Park«, ertönt nach einer Weile die Ansage und ich stehe auf.
Fragend sieht Kian mich an.
»Ich … Ich will noch nicht nach Hause.«
Selbst nach fünf Jahren stockt meine Stimme bei den Worten nach Hause. Kaum merklich, für die meisten vermutlich nicht einmal hörbar, aber mir versetzt es jedes Mal aufs Neue einen Stich, denn es ist nicht wirklich mein Zuhause. Weil die Person, die es dazu gemacht hat, nicht mehr da ist.
Kian nickt und gemeinsam steigen wir aus, um uns durch die mit unzähligen quietschbunten Fanartikeln bestückte Menschenmenge zu quetschen, die nach einem langen Tag im Pickie Fun Park in die Schwebebahn drängt. Kinder schreien, Eltern rufen nach ihnen, Plastikspielzeuge fallen zu Boden. Für einen Moment werde ich durch eine Masse aus Leibern von Kian getrennt, ehe die Türen sich schließen und die Bahn uns allein zurücklässt.
»Puh«, mache ich und er nickt. »Na, Lust auf eine Runde Schwanentretboot?«
Er verzieht das Gesicht.
»Schon gut, ich mach nur Spaß.«
»Haha.«
»Ach, komm. Hab dich nicht so.«
Wir steuern auf die solarbetriebenen Paternosteraufzüge zu, die von dem Turm, der die Station bildet, hinab auf die Straße führen, und warten, bis eine der Einheiten vor uns anhält. Ich stütze mich mit beiden Ellbogen auf das Geländer, das das gut einen Meter breite Standbrett umgibt, und beobachte, wie sich auf der anderen Seite weitere durchnässte und erschöpfte Vergnügungsparkbesucher zu den Gleisen hochtragen lassen. Unten angekommen schlüpfen wir ins Treppenhaus, bis das glänzende Schild Hafenebene – 150 Meter bis zum Pickie Fun Park in Sicht kommt. Kian zieht ein schwarzes Band mit einer Schlüsselkarte unter seinem Hoodie hervor und hält es vor ein in der Wand eingelassenes Kontrollfeld. Mit einem kaum wahrnehmbaren Zischen schwingt die Tür auf und gewährt uns Einlass.
Ich grinse ihn an. Es hat definitiv Vorteile, mit dem Sohn des Präsidenten befreundet zu sein.
Während wir an Dutzenden Werbeplakaten mit schlechten Slogans für den Vergnügungspark vorbeigehen – Sprüche wie Pick your fun! sowie Bereit, in See zu stechen? unter dem Abbild einer grausigen Schwanentretboot-Flotte –, beginnt mein Herz vor Aufregung stärker zu klopfen. Denn hier im Hafen, wo die Schleusen ab und an für einfahrende Boote geöffnet werden, bekommt man zumindest eine Ahnung vom wirklichen Duft des Ozeans.
»Wenn ich jemals so ein verdammtes Schwanentretboot aus der Nähe sehe, erlöse ich es«, murmelt Kian.
Ich hebe eine Braue. »Versprochen, sollte ich je unter die Piraten gehen, dann nicht mit so einem.«
Es sollte ein Scherz sein, ein harmloser Spaß, um die Stimmung aufzulockern. Doch mein verräterisches Herz zieht sich zusammen, als er mich mit gerunzelter Stirn anschaut.
»Komm«, sage ich deshalb und beschleunige meine Schritte. »Wer zuerst am Dock ist.«
»Hey!«, ruft er mir nach, ehe ich höre, wie er die Verfolgung aufnimmt.
Es ist Jahre her, dass wir zuletzt ein Wettrennen veranstaltet haben und zwischen den Schiffen von Arks Flotte über die Docks gesprintet sind. Damals kamen sie mir noch gewaltiger vor, wie Monster aus Stahl, mit Segeltüchern als Haut, Kanonen als Zähnen und Motoren als Herzen. Das Spiel entstand aus der Angst heraus, allein zwischen ihnen stehen zu bleiben, bis es zu einer Tradition wurde, wann immer wir den Hafen betraten. Irgendwann erschien es Kian und mir zu kindisch, aber heute ist genau der richtige Tag, um unsere frühere Tradition wieder aufleben zu lassen. Eine weitere gemeinsame Erinnerung, bevor …
Abrupt halte ich an und klammere mich an das Geländer von Dock sieben, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
»Erste«, verkünde ich grinsend, obwohl Kian nur Sekundenbruchteile nach mir die Balustrade berührt. »Du schuldest mir heute dein Dessert.«
Gespielt theatralisch sieht er mich an. »Würdest du mir das wirklich antun?«
»Klar. Für Mousse au Chocolat tue ich so ziemlich alles.«
Er presst die Hände auf die Brust und tut so, als hätte ich ihm ein Messer hineingerammt.
»Hey, ihr zwei!«, ruft jemand. »Seid ihr hier, um die Albatros 138 zu bewundern? Das Mädchen ist endlich wieder flott.«
Gleichzeitig drehen wir uns zu Nico um, einem Bootsbauer in einem ölfleckigen Blaumann, der ungefähr in unserem Alter ist. Liebevoll gibt er der Albatros 138 einen Klaps. Schon zwei Jahre lang arbeitet er als Gehilfe daran, das Schiff zu reparieren, nachdem es einem Piratenangriff im Sturm getrotzt hat – zwar mit erheblichem Schaden, aber es hat die Crew sicher zurück nach Ark gebracht.
Seit es hier vor Anker liegt, ist der Plan in mir gereift loszufahren, um meine Mutter zu suchen. Zuerst bin ich, so oft es ging, allein hierhergekommen und habe Nico und seinen Kollegen bei der Arbeit zugesehen, unter dem Vorwand, mich für meine künftige Rolle als Mitglied der Marine weiterbilden zu wollen. Niemand ahnt, dass ich nicht mehr bis zu meinem Abschluss warten will, um in See zu stechen. Oder dass ich ein Auge auf die Albatros 138 geworfen habe.
»Läuft sie dann also bald wieder aus?«, frage ich mit einem Kloß im Hals.
»Aye.«
»Scheint, als müssten wir uns bald ein anderes Schiff zum Anschmachten suchen«, zieht Kian mich auf. Nach ein paar Monaten hat er damit begonnen, mich zum Dock begleiten, und mit jedem Tag, den wir gemeinsam hierhergegangen sind, ist mir das Herz schwerer geworden unter der Last meines Geheimnisses.
»Na ja, ich mache Feierabend und lasse euch dann mal … allein«, verkündet Nico mit einem anzüglichen Grinsen. »Man sieht sich. Passt mir ja gut auf mein Mädchen auf, solange ihr hier seid!« Behände sammelt er die Überreste seines Politurzeugs ein, mit dem er wohl die letzten Flecken vom Heck gewischt hat, winkt noch einmal und verschwindet.
»Schon komisch«, durchbricht Kian irgendwann die Stille, die sich zwischen uns ausgebreitet hat, ehe er seinen Mehrwegbecher auf dem Boden neben der Balustrade abstellt und ich es ihm gleichtue. »Zwei Jahre und endlich ist sie fertig.«
»Ja, wirklich komisch«, erwidere ich eine Spur zu schnell, während ich angestrengt beobachte, wie das Wasser im spärlichen Schein der Nachtbeleuchtung Muster auf das Metall des Schiffes zeichnet. Der Anblick ist so schön, so verheißungsvoll, dass mein Herz mit einem Mal eine Tonne zu wiegen scheint.
»Ist alles okay?«
Ich schaue ihn an, erkenne die Besorgnis in seinen Augen. Die Wellen zeichnen seine Züge weich, werfen tanzende Reflexe auf seine Wangen. Als würden wir auf dem Dach stehen und das Mondlicht sich im Glas der Kuppel brechen, nur sanfter. Lebendiger.
Ich kann es nicht länger vor ihm verheimlichen.
»Kian, ich …«
»Al, ich …«
Wir grinsen uns an.
»Du zuerst«, sagt er dann und ich nicke, weil ich es keine Sekunde länger für mich behalten kann.
»Ich … Ich werde von hier fortgehen«, presse ich hervor. »Ich werde mir ein Schiff nehmen und meine Mutter suchen. Und ich möchte, dass du mitkommst.« Zögerlich hebe ich den Blick, doch seine Miene ist mit einem Mal wie versteinert. »Ich weiß natürlich, dass das für dich nicht so einfach ist mit deiner Thalassophobie, aber ich verspreche dir, ich pass auf dich auf! Und ich bin für dich da. Wie sonst auch. Bloß … außerhalb der Kuppel.«
Er schweigt, den Kiefer zusammengepresst, die Augen vor Schreck leicht geweitet. Die Härte in seinem Gesicht bildet einen scharfen Kontrast zu den weichen Mustern auf seiner Haut.
»Stell dir vor, wie schön es wäre. Nur du und ich auf hoher See«, fahre ich fort. Die Worte sprudeln immer hektischer aus mir heraus, je länger er schweigt. Je länger er mich anstarrt, als würde er mich gar nicht kennen. »Niemand, der weiß, wer wir sind, und uns Vorschriften macht. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Und sobald wir meine Mutter gefunden haben, können wir –«
»Du meinst, falls sie überhaupt noch lebt?« Seine Stimme klingt merkwürdig hohl.
»Natürlich tut sie das. Wir haben das doch besprochen – wenn ich ihr einen Funkspruch senden kann, dass ich auf dem Weg bin, kommt sie sicher zurück, um mich zu holen, und dann –«
»Dann was? Denkst du, wir können sie einfach fröhlich zurück nach Ark bringen? Sie ist eine Verräterin, seit sie einfach so verschwunden ist. Niemand wird sie hier frei herumlaufen lassen. Und das weiß sie genauso gut wie wir.«
»Du könntest bei deinem Vater ein gutes Wort für sie einlegen«, entgegne ich. »Er kann bestimmt etwas tun.«
Kian wendet sich ab, fährt sich hektisch durch die Haare. »Ich weiß, wie viel dir deine Mutter bedeutet, aber … Glaubst du wirklich, dass sie nach all der Zeit dort draußen noch am Leben ist?«
»Ich hätte es sicher gespürt, wenn nicht.«
Er schüttelt den Kopf. »Al …«
»Nein!«, rufe ich. »Sie ist am Leben, das weiß ich. Und sie würde mich suchen, wenn sie wüsste, wo ich bin – Da bin ich mir sicher.«
»Und warum kommt sie dann nicht und holt dich?«, erwidert Kian hitzig. »Sie weiß ganz genau, wo du bist. Aber sie ist trotzdem nicht zurückgekehrt. Dabei hatte sie in den letzten Jahren mehr als genug Zeit dafür. Und wo ist sie?«
Ich schlucke, weiche einen kleinen Schritt zurück, als hätte er mich geohrfeigt. Seine Worte schmerzen und ich muss blinzeln, damit meine Sicht nicht verschwimmt. »Sie hat sicher ihre Gründe. Warum sonst sollte sie –«
Mit beiden Händen umklammert er das Geländer. »Warum sollte sie dich verlassen haben? Genau das frage ich mich seit fünf Jahren. Und ich bin es leid, täglich mit anzusehen, wie dich das zerfrisst, wenn du doch Leute hast, die dich lieben. Die sich für dich entscheiden, jeden Tag. Hör endlich auf, einen Geist zu jagen.«
»Sie ist meine Mutter«, flüstere ich heiser.
Kurz schließen sich Kians Finger fester um die Balustrade, ehe er sie entspannt und so tief durchatmet, dass ich deutlich erkenne, wie sich seine Schultern heben und senken. »Ich weiß. Es tut mir leid«, sagt er sanft und dreht den Kopf zu mir. »Ich ertrage es nur nicht mehr, dich so zu sehen. Ich bin so … so unfassbar machtlos dagegen.«
»Das stimmt doch gar nicht. Ohne dich hätte ich schon längst aufgegeben.«
Ein freudloses Grinsen huscht über sein Gesicht. »Dann hab ich wohl einen beschissenen Job gemacht.«
Wir tauschen einen Blick und die Luft zwischen uns scheint mit einem Mal zu dick zum Atmen. Wir beide wissen, was ich als Nächstes sagen werde, sagen muss, und es gibt nichts, das daran etwas ändern könnte.
»Es tut mir leid, aber ich muss gehen, Kian. Ich kann nicht weiter bloß herumsitzen und darauf warten, dass sie zurückkehrt. Denn das wird nicht passieren. Ich muss sie selbst finden.«
»Ich weiß«, murmelt er.
»Bitte komm mit.«
Er schüttelt den Kopf. »Ich kann nicht. Nicht nur wegen des Wassers. Ich … Ich werde hier gebraucht.«
»Bitte«, wispere ich.
»Bitte bleib«, erwidert er stattdessen und wendet sich nun ganz zu mir um. »Wenn du gehst … Dann geht es mir wie dir.«
Mein Herz zerspringt. »Kian …«
»Ich bin in dich verliebt, Al.«
Mit einem Mal scheint alles zum Stillstand zu kommen. Mein Puls, der eben noch gerast ist, mein Atem, das Rauschen des Blutes in meinen Ohren. Selbst die Reflexionen des Wassers scheinen auf seinem Gesicht zu verharren.
Dieser eine kurze Satz stellt meine Welt innerhalb eines Wimpernschlages völlig auf den Kopf, auch wenn ich ihn mit jedem Tag mehr von seinen Augen habe ablesen können. Ihn selbst mit jedem Tag mehr in mir heranreifen gespürt habe.
Nur habe ich mich nie getraut, diesem Gefühl einen Namen zu geben.
Bis heute.
»Kian … Ich …«
Er macht einen Schritt auf mich zu und ergreift meine Hand, verschränkt seine Finger mit meinen. Der Geruch seines Apfelshampoos steigt mir in die Nase. Seine Berührung sendet ein nervöses Kribbeln durch meinen gesamten Körper. Mit einem Mal bekomme ich kaum noch Luft. Ich hebe den Blick, finde seinen und in meiner Brust braut sich ein Sturm zusammen. Zuerst ist es nur eine sanfte Brise, die mich zögerlich näher zu ihm trägt, und dann, als seine Lippen sanft über meine streifen, zu einem regelrechten Orkan anschwillt. Ich erwidere seinen Kuss, beantworte seine unausgesprochene Frage. Er schlingt die freie Hand um meine Taille, zieht mich behutsam näher an sich heran, während ich die Finger in seinen Locken vergrabe.
»Bitte bleib«, wispert er und legt seine Stirn sanft an meine. »Für mich.«
»Wie könnte ich jetzt Ark verlassen?«
Kapitel 2
Mitgefangen, mitgehangen
Sechs Monate nach Arks Untergang
Sie hat mir meinen Ozean gestohlen.
Meinen wundervollen, nebelweichen, gewittertrüben Ozean.
Sie hat mich eingesperrt in den dunkelsten Winkel eines fremden Schiffes, weit weg von meiner Crew. Weit weg von allem, was mir wichtig ist. In ein finsteres Loch, in dem ich nichts davon hören, nichts sehen, nichts bewegen kann.
Aber das Schlimmste ist, dass sie mir das Meer gestohlen hat.
Zuerst habe ich geschrien, bis mir die Stimme ausblieb und meine Kehle wund war. Dann habe ich mich gegen die Ketten gewehrt, die mich an die Wand in meinem Rücken fesseln, bis meine Handgelenke bluteten. Ich habe um mich getreten, das Essen verweigert, ins Leere gestarrt.
Doch all das hat nichts gebracht.
Also bleibt mir nur noch, das von Evangelines Untergebenen extra für mich angebrachte Metallschild über der Tür mit Blicken aufzuspießen. Ankerplatz. Daneben eingravierte Ankersymbole und ein Herzchen, das ich am liebsten ankotzen würde, wenn ich etwas Vernünftiges im Magen hätte.
Wie sehr ich Evangeline hasse. Sie und ihre verfluchte Klinge.
Aber am allermeisten hasse ich mich selbst.
Dafür, dass ich mit einem Blutgefallen meine gesamte Crew und Siebenklinge ins Verderben gestürzt und mein Schiff verloren habe. Dafür, dass ich so naiv war, Kian bedingungslos zu vertrauen. Für meine Mitschuld an Arks Untergang durch die Piraten.
Und vor allem für Moms Tod.
Ein Scharren lässt mich aufhorchen. Anschließend ertönt ein Klicken und kurz darauf schabt die Tür mit einem grässlichen Geräusch über den metallenen Boden.
Natürlich taucht sie genau in dem Moment auf, in dem meine Stimmung auf dem Tiefpunkt ist. Wie bereits unzählige Male zuvor. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Nicht dass ich in diesem fensterlosen Raum genau wüsste, wie draußen die Zeit vergeht.
Hin und wieder verschwindet sie für lange Schlaf- und Wachabschnitte, lässt mich mit meiner Schmach zurück, alles verloren zu haben. Dann bin ich gefühlte Wochen allein bis auf eine Frau, die mir einmal am Tag Essen und Trinken bringt – ohne Besteck, das ich nutzen könnte – und den Eimer neben meinen Füßen leert, der mir als Toilette dient. Manchmal bringt sie eine weitere Wächterin sowie einen zweiten Eimer voll Wasser mit und löst für ein paar Minuten meine Fesseln, damit ich mich waschen kann.
Zumindest bedeutet Evangelines Rückkehr stets, dass ich etwas von dem mitbekomme, was außerhalb meiner Zelle vor sich geht. Trotz der dicken Wände dringen dann schwere Motorengeräusche, manchmal metallisches Klirren und Flüche zu mir herein. Ab und zu wehen auch Gesprächsfetzen an mein Ohr, genuschelte Worte über Ark, Baupläne oder neue Bergungsgeräte. Ich nehme an, dass sie in Evangelines Abwesenheit versuchen Teile der Maschine ADAD aus den Trümmern der Kuppelstadt zu bergen, jener Maschine, an der meine Mutter ihr Leben lang geforscht hat. Jener Maschine der Alten Welt, von der ich hoffe, dass sie sie nie wieder zusammensetzen wird. Denn sonst wird die Welt erneut in ein unvorhersehbares Chaos gestürzt.
Und nur selten hat Evangeline nach ihren Ausflügen erträgliche Laune.
»Guten Morgen, Sonnenschein«, flötet diese jetzt und betritt die Zelle. Hinter ihr stehen zwei bullige Männer mit kurz geschorenen Haaren, die jemand Dritten in ihrer Mitte eingehakt haben. Undeutlich erkenne ich eine Gestalt mit dunklen Haaren, Rock und Bluse. »Zeit zum Aufstehen. Ich habe eine Überraschung für dich.«
Ich schweige, starre auf meine bloßen Füße. Auf die verdreckten Sohlen, die schwarz von Ruß und Asche sind, die damals die Astarte und vermutlich noch heute jedes Schiff bedecken, das in der letzten Nacht der Kuppelstadt dort verankert war. Die letzten Spuren Arks. Die letzten Spuren meiner alten Heimat.
Jetzt habe ich keine mehr.
»Sieh mich wenigstens an, wenn ich dir schon eine Freundin mitbringe.«
Ein Schauer läuft mir über den Rücken. Eine Freundin? Wechselt sie etwa ihre Methode, um mir Informationen über ADAD zu entlocken? In unregelmäßigen Abständen verhört sie mich stundenlang, versucht mir die Verstecke von Bauplänen, Quellen von Bauressourcen oder Beobachtungen meiner Mutter zu entlocken, um die Maschine wieder zusammenzusetzen. Manchmal ändert sie ihre Taktik, schlägt einen sanften Tonfall an und will mir einreden, dass sie und Mom das gleiche Ziel von einer friedlichen Welt ohne Ressourcenknappheit und Kämpfe verfolgen. Dass sie ADAD zum Wohle der Menschheit nutzen will und Opfer eben erbracht werden müssen. Dass wir beide uns in unserer Wut auf Ark zusammentun sollten, weil die Stadt uns beiden alles genommen hat. Doch egal, wie oft ich sie frage, sie will mir nicht verraten, was sie verloren hat – ich sehe nur Zorn in ihren Augen, der alles andere verzehrt. Das Einzige, was sie die letzten Monate – so glaube ich zumindest – über davon abgehalten hat, mich an die Fische zu verfüttern, ist die Lüge, in sämtliche Forschungen meiner Mutter über ADAD eingeweiht zu sein. Doch je länger ich schweige, desto mehr wächst meine Angst aufzufliegen.
Ein Knall ertönt, gefolgt von einem Scharren. »Setz dich, Liebes«, sagt sie. »Wir sind ja keine Barbaren.«
»Scher dich zum Teufel«, zischt jemand. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Beängstigend bekannt.
Mit einer schlimmen Vorahnung sehe ich auf. Evangelines Gesicht liegt zur Hälfte im Dunkeln, nur erhellt vom Schein einer Öllampe. Das unregelmäßige Zucken der sterbenden Flamme verzerrt ihr Lächeln zu einer grotesken Grimasse, während die zwei auffällig blassen Männer hinter ihr hervortreten, um eine Frau auf einen ramponierten Stuhl in der Mitte des Raums zu drücken und dort festzubinden. Eine Frau mit langen schwarzen Locken, einem dunkelblauen Rock und einer weißen Bluse, die einen sanften Kontrast zu ihrer hellbraunen Haut bildet. Eine Frau, die mit blassgrünen Augen meinen Blick sucht.
Ari.
Mein Herz zieht sich schmerzhaft zusammen.
»Was willst du?«, knurre ich.
Die Diverin stützt sich lässig mit den Händen auf der Rückenlehne des Stuhls ab, sodass sie Aris Schultern berührt und die verwobenen Münzen und Angelhaken ihres Oberteils unheilvoll aufblitzen. Dazwischen erkenne ich die Umrisse von Kapitänsketten, Zeichen der vielen Captains, die bereits vor mir ihrer Masche mit dem Blutgefallen zum Opfer gefallen sind. Das Plättchen mit dem Logo von Ark suche ich allerdings vergeblich – vermutlich hat sie es nach dem Untergang der Kuppelstadt entfernt.
Ich lasse meinen Blick von Evangeline zu meiner Navigatorin wandern, die vor der Berührung der Diverin zurückzuckt, so weit ihre Fesseln es erlauben. Das letzte Mal habe ich sie an Bord der Astarte gesehen, während Ark lodernd in den Fluten versunken ist. Danach hat die Diverin mich auf ihrem Schiff eingesperrt und mich von meinen Freunden getrennt. Jeden Tag frage ich, wie es ihnen wohl geht. Ari jetzt vor mir zu haben, ausgemergelt, verschmutzt, aber am Leben, sendet einen jähen Strom von Erleichterung durch mich hindurch. Das bedeutet, dass es vielleicht auch den anderen gut geht.
»Ach, Al. Müssen wir etwa jedes Mal wieder von vorn anfangen?«
Schweigend funkele ich Evangeline an. Obwohl mir das Herz bis zum Hals klopft, versuche ich meine Fassade aufrechtzuerhalten. Sie soll nicht wissen, dass die Angst um meine Freundin sich wie eine Faust um meine Brust schließt und mir das Atmen erschwert.
»Na gut, dann werden wir den Einsatz eben ein wenig erhöhen.«
Panik wallt in mir auf, doch ich bemühe mich sie mir nicht anmerken zu lassen. Ich muss jetzt einen kühlen Kopf bewahren, den Spieß umdrehen, um Ari und mich aus dieser Situation zu befreien. Wenn ich mich unüberlegt verplappere, sind wir beide vermutlich schneller Möwenfutter, als wir blinzeln können.
»Du findest den Reaktor also immer noch nicht«, stelle ich fest und genieße den Anflug von Zorn, der kurz über ihr Gesicht zuckt. »Und auch keine Baupläne.«
»Macht nichts. Du wirst mir schon verraten, wie ich diese Maschine zum Laufen bekomme.«
Ich schnaube, um zu überspielen, wie sich mein Atem beschleunigt. »Vergiss es.«
Ari hebt kurz die Fußspitze, um meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, und sieht mich eindringlich an.
»Und wenn nicht?«, zische ich, um Zeit zu schinden, obwohl mir klar ist, warum Evangeline Ari zu mir gebracht hat. Sie will sie als Druckmittel einsetzen.
»Dann erinnere ich dich daran, was mit denjenigen passiert, die den Blutschwur brechen.« Beiläufig fischt die Diverin ihr Messer aus der Hosentasche.
Ich erkenne die Klinge mit den bronzenen Knochenfingern um den Griff, die mich alles gekostet hat, und fühle sogleich, wie eine Welle der Wut wie eine kochende Flut durch mich hindurchströmt. Als die Diverin die Klinge an Aris Hals hält, jagt die Gischt Feuer durch meine Adern, jeder Tropfen eine lodernde Flamme. Ich werfe mich gegen meine Ketten, höre, wie mir ein Laut irgendwo zwischen einem Schrei und einem Knurren entweicht. Die Fesseln schneiden mir in die Haut, aber ich spüre es kaum.
»Hast du mir irgendwas zu sagen?«, fragt Evangeline.
Ich spucke aus.
»Wie du meinst. Ich glaube, ein, zwei Finger wird sie nicht vermissen, oder?« Das Messer wandert von Aris Kehle, wo es einen feinen Schnitt hinterlässt, hinab zu ihrer Hand. Mit federleichten Berührungen fährt Evangeline die einzelnen Finger entlang. »Wo fangen wir am besten an …«
Sie holt aus.
Ari atmet tief durch und wappnet sich. Ihr Blick ist entschlossen, doch darin liegt noch etwas anderes. Sie fährt mit dem Stiefel über den Boden und als ich hinschaue, erkenne ich, dass sie ein C zeichnet.
Da begreife ich, was sie vorhat. Sie hat sich bewusst von Evangeline zu mir bringen lassen, damit sie denkt, sie hätte die Oberhand – während wir sie eigentlich in eine Falle locken.
Wäre ich nicht gefesselt, würde ich Ari um den Hals fallen.
»Stopp!«, rufe ich an Evangeline gewandt. »Schon gut, hör auf. Ich sag dir, was du wissen willst – wenn du ihr nichts tust.«
Nur Millimeter über Aris linker Hand hält die Diverin inne, hebt die Klinge wieder hinauf an ihren Hals. »Du bist nicht in der Position, Forderungen zu stellen.«
»Stimm zu oder lass es.«
Kurz sieht sie mich an. Wir beide wissen genau, dass sie lediglich eine einzige Bewegung zu machen braucht und Ari wäre Geschichte. Aber auch, dass ich für immer schweigen werde, sollte sie das tun.
Angespannt versuche ich meinen rasenden Puls zu beruhigen und mein Pokerface zu bewahren. Ich muss sie unbedingt von Ari und vom Verbleib des Reaktors … von ihm ablenken.
»Schön«, sagt sie schließlich. »Du hast mein Wort. Ich werde ihr nichts tun.«
Ich nicke, schlucke demonstrativ laut und atme auf, wobei Letzteres nur zur Hälfte gespielt ist. »Die Baupläne … sind auf Crescent Island.«
Und garantiert restlos durch das Feuer vernichtet worden. Ari, du bist ein Genie.
»Al, hör auf«, zischt meine Navigatorin, wobei sie mir zublinzelt. »Das ist es nicht wert!«
Die Diverin legt den Kopf in den Nacken und lacht kurz auf. »Eine Insel. Und das soll ich dir glauben?«
Ari wirft sich gegen ihre Fesseln, tut so, als wollte sie mich mit aller Kraft daran hindern, unser Geheimnis zu offenbaren.
»Tu es oder nicht, aber es ist alles, was ich weiß!«, fauche ich. »Meine Mutter …« Ich stocke, zwinge mich mit Mühe dazu weiterzusprechen. »Sie hat schon lange daran geforscht, eine alternative Energiequelle zu finden.«
Bilder steigen in mir auf, schnell und gewaltig wie Donner. Das Aufblitzen einer Klinge. Blut. Blondes Haar auf metallenem Grund. Eine Explosion, die mich dazu zwingt, ihren Körper in den rasch eindringenden Fluten zurückzulassen.
»Ich weiß«, bemerkt Evangeline trocken.
Natürlich weiß sie das. Immerhin kannte sie meine Mutter durch die jahrelangen Tauchaufträge, die sie für Arks Forschungsteam erfüllt hat. Zumindest, solange es noch auf der Suche nach Maschinenteilen war. Soweit ich aus den Gesprächen heraushören konnte, hat die Kuppelstadt Evangelines gesamtes Equipment finanziert, mit dessen Hilfe sie unter allen Divern die wertvollsten Waren bergen konnte, wofür ich sie damals in Trezuego bewundert habe. Rückblickend betrachtet hätte ich wohl misstrauisch werden sollen, spätestens beim Anblick des Plättchens mit dem Zeichen von Ark, das ich als bloße Trophäe abgetan habe. Ihr hingegen kommt die Ausrüstung nun natürlich umso gelegener, weil es ihr bei der Suche nach den Trümmerteilen hilft.
Evangeline schnaubt verächtlich. »Das letzte Mal, als ich Diana gesehen habe, schien sie alles daransetzen zu wollen, die Maschine zu zerstören. Wieso sollte sie also Baupläne horten, statt sie zu vernichten?«
»Was macht dich da so sicher?«, halte ich dagegen und versuche meiner Stimme einen spöttischen Klang zu verleihen. In meinem Inneren krampft sich jedoch alles zusammen bei den Unwahrheiten, die ich über meine Mutter erzähle. »Glaubst du ernsthaft, du bist die Einzige, die ADAD für sich nutzen wollte? Die Einzige, die Ark bluten sehen wollte? O nein. Meine Mutter ist Piratin geworden, um sich an Ark zu rächen. Was sie ihr angetan haben, ist unverzeihlich.«
Lügen, die mir förmlich das Herz zerquetschen, aber die ein notwendiges Übel für unser Vorhaben sind. Mom würde es verstehen. Sie hat nie einen Groll gegen Ark selbst gehegt, sondern sich lediglich bemüht Alcott davon zu überzeugen, dass der Einsatz der Maschine, um die Landmassen aus dem Ozean zurückzuholen, die Welt nur tiefer ins Chaos stürzen würde. Als sie daran gescheitert ist, hat sie das Einzige getan, was ihr blieb: die Energiequelle entwenden und fliehen, damit niemand ADAD aktivieren kann. Niemals hätte sie die Maschine eingesetzt, um jemandem zu schaden.
»Al, halt die Klappe, verdammt!«, zischt Ari. »Wenn du ihr alles erzählst –« Sie unterbricht sich.
»Sei still, Ari, ich versuche dir deinen Hintern zu retten!«, fauche ich.
Evangelines Augen verengen sich, während sie mich prüfend mustert.
»Glaubst du ernsthaft, sie hätte freiwillig ihre eigene Tochter zurückgelassen, wenn sie nicht verbannt worden wäre?«, frage ich. Mein Herz krampft sich zusammen, pocht schmerzhaft gegen meine Rippen. Lüge, Lüge, Lüge.
Kurz huscht ein Schatten über Evangelines Gesicht. Anscheinend habe ich einen wunden Punkt getroffen. Ist sie vielleicht gar nicht aus freien Stücken Diverin geworden?
»Ihr wollt mir also weismachen, du und Diana hättet unter einer Decke gesteckt?«
Betont gleichmütig zucke ich die Achseln. »Sie ist meine Mutter. Was hast du denn erwartet?«
»Du warst doch diejenige, die verhindern wollte, dass ich ADAD zum Laufen bekomme.«
»Weil Mom mir von dem Fehler des Reaktors erzählt hat«, bluffe ich. »Außerdem war es nie unser Plan, die Maschine in Ark zu aktivieren. Wir wollten sie stehlen und Alcott damit erpressen.«
Skeptisch mustert Evangeline mich. »Ich glaube dir kein Wort. Aber eure Pläne sind mir auch egal – mich interessieren nur die Baupläne. Ich frage dich also ein letztes Mal: Wo sind sie?«
»Auf Crescent Island«, beharre ich.
»Aha. Und was soll das für eine Insel sein?«
»Eine Plattform aus Arks Müll. Die Karte dazu war in dem Kästchen, das du mir verkauft hast.«
»Du meinst das Kästchen, für das du dir beinahe den Arm abgehackt hättest?«
Bitterkeit erfüllt mich und Galle steigt in meiner Kehle auf. Tatsächlich wäre es mir lieber gewesen, ich hätte genau das tun können, statt meine Seele und meine Crew an die Diverin zu verkaufen.
Evangeline lacht leise. »Da haben sie uns wohl beide zum Narren gehalten, was?«
»Ich weiß nicht, was du meinst«, entgegne ich kühl, obwohl sich mein Magen zusammenkrampft.
»Na ja«, sagt sie und fährt mit dem Griff des Messers über Aris Unterarm. »In Ark konnte es niemand öffnen, deshalb hat man es mir gegeben, damit ich es an dich verkaufe. Irgendwie nahmen sie wohl an, dass du das schaffen würdest.«
Kälte sackt schwer in meine Glieder. Wie mechanisch höre ich mich fragen: »Wer?«
»Dein Piratenjäger-Freund hat sie mir gebracht. Wie hieß er noch gleich? Der Abyss Hunter.«
Jäh breitet sich Kälte bis in meine winzigsten Fasern aus, erfüllt jeden Zentimeter meines Körpers und lässt mich betäubt zurück.
Kian hat von dem Kästchen gewusst, vielleicht auch geahnt, dass der Inhalt mich … ihn zu meiner Mutter führen würde. Zu ihrem Geheimnis, das er lüften und anschließend triumphierend mit Mom und mir als Gefangene zurück nach Ark bringen wollte. Ich habe bereits gewusst, dass er hinter mir her gewesen ist, um im Auftrag seines Vaters über mich an Mom und die gestohlene Energiequelle heranzukommen. Das hat er mir überdeutlich zu verstehen gegeben. Aber bis eben ist mir nicht klar gewesen, dass selbst das Finden des Kästchens ein abgekartetes Spiel war, oder warum er damals so angespannt wirkte, als ich zu ihm in die Zelle kam, um den Code zu knacken. Ganz zu schweigen von seiner Verbindung zu Evangeline.
Die beiden sind gute Schauspieler, das muss ich ihnen lassen.
»Schade. Die Karte kann ich wohl nicht mehr überprüfen«, höre ich die Diverin sagen. »Wo soll die Insel denn liegen?«
»Hinterm Star Ariel«, murmele ich und suche Aris Blick, um einen Anker zu finden, einen Halt in dem Strudel, der mir das letzte bisschen Boden unter den Füßen wegzieht.
»Glaubt ihr wirklich, dass ihr mich in solch eine offensichtliche Falle locken könnt?«, fragt Evangeline zornig. »Niemand durchquert das Star Ariel. Das ist viel zu riskant.«
»Darum brauchst du dir wohl keine Sorgen mehr zu machen«, sage ich düster. »Denn die Person, die es zum Star Ariel gemacht hat, ist nicht mehr am Leben.«
***
Zum ersten Mal seit Monaten stehe ich an Deck eines Schiffes und sehe den Ozean. Spüre die Gischt auf meinen Wangen, den Wind in meinen Haaren, schmecke das Salz auf meinen Lippen. Grobe Stricke scheuern an meinen Handgelenken, reißen die Haut auf, wodurch der Luftzug dort brennt, aber es macht mir nichts aus.
Zumindest bis ich mich umdrehe und die verkohlten Überreste der Containerstadt erblicke. Metallstreben ragen wie Gerippe in die Höhe und ein Gestank nach verbranntem Kunststoff weht zu uns herüber. Keine Spur von mit Farbe besprühten Laken, von Pflanzen, von Leben. Statt dass das Weiß des Plastikmülls uns in der Sonne blendet, verschluckt das bis zur Unkenntlichkeit zerschmolzene Schwarz ihre Strahlen vollends.
Die Stadt ist tot wie ihre Königin.
Ari lehnt den Kopf sanft gegen meine Schulter, um mir trotz ihrer gefesselten Hände Trost zu spenden, und ich bin dankbar für diese Berührung. Dankbar dafür, dass ich diesen Ort nicht allein betreten muss, auch wenn der Teil in meinem Inneren, der all die Jahre über nach meiner Mutter gesucht hat, genauso verlassen ist wie die Insel. Genauso dunkel. Genauso leer.
»Los jetzt«, faucht Evangeline und stößt uns voran auf eine schmale Metallgitter-Planke, die in einem beängstigend steilen Winkel zum Beiboot hinabführt.
Das Metall ist warm und scharfkantig unter meinen Fußsohlen, als ich hinabstolpere. Beinahe verliere ich das Gleichgewicht, gerate ins Schwanken und kurz überlege ich, ob es so schlimm wäre, ins ehemalige Star Ariel zu stürzen und in ihm unterzugehen wie Mom in Arks Trümmern. Doch im selben Moment schließt sich Evangelines Hand wie ein Schraubstock um meinen Oberarm und reißt mich zurück. Ein Ächzen entfährt mir.
»Du bleibst schön hier«, zischt sie und lässt mich nicht los, bis ich neben einem ihrer Crew-Mitglieder, einem muskulösen Mann mit zerschlissenem Hemd und roten Lederstiefeln, auf der Bank im Beiboot hocke. Ari sitzt mir gegenüber neben einer brünetten Frau, die angespannt ihren mit Perlen geschmückten Säbel umklammert, wohingegen Evangeline in unserem Rücken eine ganze Reihe für sich allein hat. Die Diverin betätigt den Knopf, woraufhin der Motor erst ein Stottern, dann ein Brummen von sich gibt und wir über die Wellen jagen, zwei weitere Beiboote dicht hinter uns.
Ari sucht meinen Blick und hält ihn fest. Nach den Strapazen der Reisetage, die sie getrennt von mir eingesperrt worden ist, wirkt sie ausgezehrt und erschöpft. Trotzdem gelingt es ihr, mir mit dieser kleinen Geste die Kraft zu geben, die ich brauche. Ich blinzele, dränge all die Tränen zurück, die ich seit Moms Tod noch nicht vergossen habe. Nicht vergießen konnte. Und jetzt nicht vergießen will.
Eisern wende ich den Kopf und schaue auf den Horizont. Mit jedem Meter, den wir uns der Insel nähern, wird der Gestank nach verbranntem Kunststoff intensiver, bis er mir in der Kehle brennt und Übelkeit verursacht. Evangeline und ihre Leute binden sich dicke Tücher um, ehe sie uns grobe Lumpen vor Mund und Nase schnüren. Ich bin dankbar dafür, denn auf eine zweite Rauchvergiftung verzichte ich gern. Doch die Dämpfe, die in der Hitze der Sonne über der Insel in der Luft flirren, dringen mit jedem Meter stärker durch den dünnen Stoff, lassen mich husten und keuchen, obwohl ich darauf achte, flach zu atmen.
Am Ufer angekommen betätigt einer von Evangelines Kameraden einen weiteren Knopf, woraufhin ein Enterseil an der Seite hervorschießt. Es dauert, bis der Haken auf der zusammengeschmolzenen Fläche Halt findet, und der Mann muss das Stahlseil mehrmals einholen und neu werfen. Endlich bohrt es sich mit einem widerlichen Knirschen in die fest mit einer Bergspitze der Alten Welt verankerten Müllinsel. Wir springen von Bord, ins knietiefe Wasser hinein, um ans Ufer zu waten. Widerlich dunkel und dreckig schwappt es um meine Beine. Spitze Kunststoffteile bohren sich mir in die Haut und ich muss aufpassen, wo ich hintrete, um mir nicht an einem scharfkantigen Überbleibsel die Fußsohlen aufzuschneiden.
Trotzdem fällt es mir schwer, nicht von Trauer übermannt zu werden, als die Erinnerungen an das Wiedersehen mit Mom mit aller Macht auf mich einprasseln. Erinnerungen, die ich so lange versucht habe zu verdrängen, dass sie sich nun beinahe fremd anfühlen. An unsere erste Umarmung. An ihren Geruch, ihre Augen, ihr Lächeln. An den Kampfgeist, der jede Faser ihres Körpers erfüllt hat.
Einen Kampfgeist, den ich nicht enttäuschen darf.
Hinter uns brechen sich die Wellen am Ufer, lecken in dem vergeblichen Bemühen, den Ruß von ihm zu waschen, am schwarzen Kunststoff. Stumpfe Glasscherben ragen überall in die Höhe, vermischen sich mit scharfkantigen Metallsplittern und Bolzen, die von der Hitze aus den Containern gesprengt wurden. Eine Möwe hockt auf einem abgebrannten Gerüst und beobachtet uns argwöhnisch. Ein paar Schritte entfernt kann ich ein schwaches goldenes Funkeln ausmachen und mit einem beklommenen Gefühl in der Magengegend denke ich an den Sextanten der Astarte zurück, mit dem Kian hier – hoffentlich aus Versehen – einen Brand verursacht hat.
An diesem Ort ist nichts mehr wie vorher und trotzdem ist alles schmerzlich vertraut.
Sogar das Gerüst des Kontrollturms ragt im Zentrum der Insel ungebrochen in die Höhe. Sein Metall ist rußgeschwärzt und stellenweise geradezu grotesk verformt. Es wirkt zwar baufällig, doch die Hälfte des Raumes mit dem Aussichtsfenster scheint seltsamerweise intakt zu sein. Wenn ich Evangeline dorthin und in eine Falle locken könnte … Vorausgesetzt, dass der Turm nicht vorher unter unserem Gewicht zusammenbricht …
»Was steht ihr hier so faul herum? Seht euch um und bergt alles, was brauchbar erscheint!«, befiehlt die Diverin in diesem Moment ihrer Crew. Sie hält sich die Hand vor den nackten Bauch, krallt sich in die Metallketten und atmet tief durch.
Ein Grinsen umspielt meine Lippen. Scheint, als hätte sie wie meine Crew damals mit der Landkrankheit zu kämpfen, obwohl sie in Ark aufgewachsen ist.
»Muss das sein?«, stöhnt einer ihrer Kameraden und hält sich den Bauch. »Mir ist verdammt –« Er taumelt davon und übergibt sich.
»Weichei«, murmelt Ari, die selbst etwas blass um die Nase wirkt.
Evangeline verdreht bloß die Augen, ehe sie anscheinend einen vielversprechenden Container entdeckt, mich an den Fesseln packt und vor sich herschiebt. »Bewach die andere, Charlotte!«, ruft sie einer jungen Frau zu, die kaum älter als Ari ist.
»Du wirst nichts finden«, sage ich über meine Schulter hinweg, wobei sich der Gestank als beißender Geschmack in meinem Mund festsetzt. Er legt sich auf meine Zunge wie ein Pelz. »Zumindest nicht hier unten.«
Sie bleibt stehen und reißt mich zu sich herum. »Und wo dann?«
Ich wende den Kopf und funkele sie an.
»Muss ich dich wirklich daran erinnern, was ich mit deiner Freundin anstelle, wenn du nicht kooperierst?«
Versuch’s doch, würde ich am liebsten erwidern, lasse jedoch stattdessen meinen Blick flüchtig über die Scherben auf dem Boden gleiten. Der Kunststoff mag zwar zu einem einzigen dunklen Klumpen verbrannt sein, aber falls wir ein Stück Glas daraus lösen und es zersplittern lassen könnten, hätten wir eine brauchbare Waffe. Mehr als eine. Hunderte.
Und Ari wird Evangeline kein zweites Mal lebend davonkommen lassen.
»Denk nicht mal dran. Eine falsche Bewegung und ihr beide seid tot.«
»Jaja«, antworte ich und hebe die Schultern. Ich rucke mit dem Kopf in Richtung des Turms. »Dort oben war ihre Zentrale. Da hat sie alles in einem Safe gelagert.«
Evangeline mustert mich. Ihre grauen Augen wirken hart wie der Rumpf eines Schiffes. Dann stößt sie mich voran. »Nach dir. Nicht dass der Turm noch zusammenbricht.«
Ich stolpere über die Insel, vorbei an den Crew-Mitgliedern, die sich durch die verkohlten Müllberge wühlen, ab und an etwas hervorziehen und achtlos auf einen Haufen werfen. Es erfüllt mich mit Wut zu sehen, wie sie Moms Vermächtnis, Moms früheren Traum von einem friedlichen Zusammenleben verschiedenster Menschen auf dieser Insel plündern, als wäre es bloß ein weiteres Beuteschiff. Als wäre sie nie hier gewesen.
Am Turm nimmt Evangeline mir widerstrebend die Fesseln ab, obwohl sie genauso gut weiß wie ich, dass ich keinen Fluchtversuch unternehmen werde. Nicht, solange Ari nicht bei mir ist. Außerdem habe ich nicht den Hauch einer Ahnung, wie wir fliehen sollten – ohne Waffen, ohne Proviant, ohne Schiff.
Also bleibt mir vorerst keine andere Wahl als mitzuspielen und die Leiter emporzuklettern. Statt des Gestanks von rostigem Metall steigt mir nun der scharfe Geruch von Rauch, Asche und Feuer in die Nase. Unter meiner Berührung löst sich bröckelnd eine Schicht aus Ruß- und Metallklumpen, legt sich wie ein rauer Belag auf meine Handflächen und kratzt bei jeder Bewegung. Ich umklammere die Stange und stelle den Fuß auf die untere Sprosse. Vorsichtig verlagere ich das Gewicht auf sie und zu meiner Erleichterung ächzt sie zwar vernehmlich, hält meinem Gewicht aber stand. Mit steifen Bewegungen mache ich mich an den Aufstieg, dicht gefolgt von Evangeline. Bereits nach wenigen Metern bin ich am Keuchen. Nach all den Monaten in der beengten Zelle sind meine Muskeln solch eine Belastung nicht mehr gewohnt. Als wir auf dem Turm vor der Tür ankommen, die Eagle und ich während des Feuers aufgebrochen haben, schnappe ich kläglich nach Luft. Sie steht sperrangelweit offen, ist verbogen und rußgeschwärzt, die Scharniere hoffnungslos verformt. Dahinter klafft der Raum auf wie ein schwarzes Loch.
»Was ist?«, fragt Evangeline und zückt ihren Säbel.
»Nichts«, murmele ich und wende den Kopf, damit sie mein Gesicht nicht sieht. Meine Trauer geht sie nichts an. Mit trockenem Mund wische ich die Hände an meiner Hose ab und trete ein.
Schwarz schlägt mir entgegen. Schwarze Wände, schwarzer Boden, schwarze Schränke, die offen stehen und noch mehr Schwärze enthüllen. Aus der Ferne dringt der Geruch nach Ozean zu mir, doch er ist zu schwach, um den nach Feuer und Schuld zu vertreiben, der hier drin herrscht. Die einzige Lichtquelle ist eine große Öffnung an der Stirnseite, wo statt einer gigantischen Glasscheibe Splitter klaffen wie Schorfränder einer offenen Wunde. Scherben liegen überall auf dem Boden verteilt, glänzen weiß in der Sonne. Weiß wie Moms Lieblingsblumen, die ich ihr zu ihrem letzten Geburtstag in Ark geschenkt habe. Sie ziehen sich wie eine Spur aus Blütenblättern bis hin zu einem umgestürzten, zum Großteil verbrannten Stuhl, verleihen dem Raum eine raue Zartheit, die er nicht verdient hat.
Staub und Aschepartikel flirren durch die Luft und setzen sich in meiner Kehle und meinen Augen fest, bis ich blinzeln muss. Zögerlich mache ich einen Schritt in den Raum hinein und beobachte, wie der Luftzug meiner Bewegungen sie auf- und durcheinanderwirbelt, bevor sie sich wieder hauchzart auf die Scherben senken. Die groteske Schönheit dieses Anblicks schmerzt so sehr, dass ich das Gefühl habe, Evangelines Dolch hätte mein Herz durchbohrt anstatt das meiner Mom.
Evangeline schweigt, gibt mir einen Moment Zeit, den Raum zu betrachten, während ich gegen meine Tränen ankämpfe. Um mich abzulenken, starre ich durch das Loch in der Wand, wobei ich versuche die ausgebrannte Konsole nicht anzusehen. Wie damals funkelt weit unter uns die Sonne auf dem Meer, verliert sich in der schäumenden Gischt, wenn die Wellen sich am Ufer brechen und getrübt wieder zurückziehen.
Doch den Ozean kümmert das nicht. Das tut es nie.
Diese Sätze habe ich schon oft gedacht, aber nie haben sie mich so geschmerzt wie heute.
Ich hole tief Luft – und stocke, als mir plötzlich etwas Helles ins Auge sticht.
Dort hinten, an der Rückseite der Insel … Hat dort nicht gerade … Nein, das war sicher bloß eine Reflexion. Oder?
»Also, wo ist der Safe?«, fragt Evangeline, tritt vor und streicht mit einem Finger über die Konsole, auf der sie eine helle Spur hinterlässt.
Alles in mir sträubt sich bei diesem Anblick, weil ihre Berührung diesen Ort entweiht. Weil sie diesen Ort entweiht.