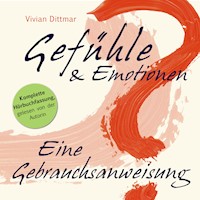12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
Was im Leben wirklich wichtig ist
In unserer Gesellschaft definieren wir Wohlstand fast ausschließlich materiell. Doch Konsum aktiviert zwar unser Belohnungssystem, aber wirklich reich macht er uns nicht - echter Wohlstand muss sich auf vielen Ebenen entfalten.
Vivian Dittmar skizziert die Grundpfeiler eines Lebens, das in einer völlig neuen Weise reich ist: reich an Zeit, erfüllenden Beziehungen, Kreativität, Verbundenheit mit den Mysterien des Lebens und der unbändigen Schönheit der Natur. Sie zeigt, dass ein gutes Leben nicht im Widerspruch zu einem notwendigen ökosozialen Wandel der Gesellschaft steht, sondern im Gegenteil dadurch erst ermöglicht wird.
Ein Weckruf für eine echte Wohlstandsgesellschaft und für das, was wirklich wichtig ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Vivian Dittmar
Echter Wohlstand
Warum sich die Investition in inneren Reichtum lohnt
Ein Plädoyer für neue Werte
Inhalt
Einführung
Reich und arm
Eine unbequeme Reise
Back to the Roots?
Richtungswechsel für alle
TEIL I: WAS IST WOHLSTAND?
1 Unsichtbare Armut
Wer ist hier eigentlich arm?
Symptome unserer Armut
Geld und Reichtum als Sucht
Was ist der Treiber unserer Armut?
Ungleichheit, Statusangst und die Not der reichen Industrienationen
2 Die unendliche Leiter
Wer ist hier eigentlich reich?
Der unlöschbare Durst
Wie viel ist genug?
Das Problem der relativen Armut
Von langen und kurzen Leitern
Die soziale Rolltreppe
Mythos Meritokratie und soziale Mobilität
Statusangst, Minderwertigkeitsgefühle und Narzissmus
Der soziale Überlebenskampf
3 Wohl-Stand
Qualität statt Quantität
Was ist dir heilig?
Haben oder Sein
Aber was ist eigentlich echter Wohlstand?
Lebensqualität statt Status
Richtungswechsel. Jetzt
Die Tragik von Statussymbolen
4 Das liebe Geld
Macht Geld frei?
Frei von oder frei für?
Geld: universelles Mittel, universeller Zweck?
Die Einbahnstraße des Geldes
Böses Geld?
Wie Geld arm machen kann
Die Rolle des Belohnungssystems
Das Zucker-Problem
TEIL II: FÜNF DIMENSIONEN ECHTEN WOHLSTANDS
1 Zeitwohlstand
Zeitwohlstand in traditionellen Kulturen
Zeitarmut heute – hast du Zeit oder hat sie dich?
Ist Zeit Geld?
Die zwei Dimensionen von Zeit
Dieser eine ewige Moment
Der Schlüssel: Entschleunigung
Effizienz versus Effektivität
Zeit und Zeitqualität
Alles zu seiner Zeit
2 Beziehungswohlstand
Alle meine Beziehungen
Verbindung und Verbindlichkeiten
Die Suche nach Halt
Rückzug ins Private
Die Geschichte von Roseto
Der Verlust von Gemeinschaft
Beziehungsarmut heute
Segen und Fluch des Austauschbaren
Wo kannst du nackt sein?
Hosen runter
Inkubationsräume einer neuen Kultur
Vom unbequemen Miteinander
3 Kreativitätswohlstand
Die Macht der Bilder
Kulturelle Armut
Herzensnahrung
Konsum macht nicht glücklich
Standardisierung versus Potenzialentfaltung
Zurück in die gute alte Zeit?
Kann man das zu Geld machen?
Spiel ist Arbeit, Arbeit ist Spiel
Finde deinen Flow, immer wieder
Aufgabe, Hingabe und Sinn
4 Spiritueller Wohlstand
Die Normalität des Heiligen
Das Problem mit dem Glauben
Spirituelle Armut
Schönheit
Liebe
Weisheit
Sinn
Die innere Anbindung
Wie entsteht spiritueller Wohlstand?
5 Ökologischer Wohlstand
Besitz oder Beziehung
Objekt oder Geschenk
Auf dem Lebensfeld
Im Schlaraffenland
Mehr als nur Gemüse
Eine falsche Landkarte
Ein böses Erwachen?
Jenseits der Blase
Zurück auf Los
Jenseits von Konsum
Beginne mit Dankbarkeit
Verzicht, Verzicht, Verzicht?
Wenn weniger mehr ist
Ankommen
TEIL III: MEHR ALS GENUG
1 Echter Wohlstand und Geld
Zweigeteiltes Leben
Was ist Arbeit?
Ein fauler Hund?
Der Wunsch nach Wirksamkeit
Arbeitsteilung neu denken
Die Kehrseite der Zuckerproblematik
Neue Verteilungsstrukturen
Wofür arbeiten wir eigentlich?
Gratis Geld für alle?
Das Ende des Homo oeconomicus
Vom Bekommen zum Ermöglichen
Lohnt es sich oder rechnet es sich?
Die Magie des Schenkens
Was macht dein Geld, wenn es bei dir ist?
2 Wirtschaft für echten Wohlstand
Wirtschaft und Bedürfnisse
Die wahren Ökonomen
Wirtschaft und Zeitwohlstand
Wirtschaft und Beziehungswohlstand
Wirtschaft und Kreativitätswohlstand
Wirtschaft und spiritueller Wohlstand
Wirtschaft und ökologischer Wohlstand
Echter Wohlstand und Wirtschaftlichkeit
3 Ein gutes Leben
Würdige deine Sehnsucht
Bestandsaufnahme: Wie geht es dir?
Fragen zu Zeitwohlstand
Fragen zu Beziehungswohlstand
Fragen zu Kreativitätswohlstand
Fragen zu spirituellem Wohlstand
Fragen zu ökologischem Wohlstand
Würdige deine Gefühle
Dein Leben als Garten
Den großen Sprung wagen
Langsamer, tiefer, näher
Verantwortung für das Ganze übernehmen
Das Private ist politisch
Danksagung
Literaturverzeichnis
Quellen
Register
Für meinen Vater,
in Liebe und Dankbarkeit
Einführung
Bald ist es fünfzig Jahre her, seit uns der legendäre Bericht an den Club of Rome zu den »Grenzen des Wachstums« darauf aufmerksam machte, dass es so nicht weitergehen kann. Nicht jede einzelne Vorhersage ist genau so eingetroffen, wie in dem Bericht postuliert, doch das ist nebensächlich. Viel wichtiger ist, dass wir es seit fünfzig Jahren versäumt haben, den entscheidenden Richtungswechsel zu vollziehen, der eine zukunftsfähige Zivilisation ermöglichen würde. Warum? Wie kann es sein, dass wir direkt auf eine Klippe zusteuern und dennoch nicht zu einer Kurskorrektur bereit sind?
Es gibt auf diese Frage sicher nicht nur eine Antwort, da sie sehr komplex ist. Unzählige Faktoren, Interessenskonflikte, Gewohnheiten, Annahmen, Verdrängungsmechanismen und vieles mehr spielen hier zusammen. Theoretisch können wir noch dreißig Jahre darüber diskutieren, praktisch fehlt uns die Zeit dafür. Gemein haben die vielen Ansätze, dass sie das Problem gerne verlagern: Unternehmen sehen die Verantwortung bei den Konsumierenden, Bürger bei den Politikerinnen und Politikern, die Jungen bei den Alten und umgekehrt. Viele meinen, jeder müsse eben bei sich anfangen – wohl wissend, dass den meisten das viel zu unbequem ist und ohnehin nur Sinn ergibt, wenn alle mitziehen. Also geschieht im Großen und Ganzen nichts, während weiter diskutiert wird. Und in gewisser Weise scheint das allen ganz recht zu sein, denn solange wir uns nicht einig sind, was es zu tun gilt, machen wir eben weiter wie bisher. Ja, klar, ein bisschen schlechtes Gewissen haben wir schon dabei, aber was soll ein Einzelner denn groß verändern?
Ich möchte mit diesem Buch zu einer neuen Betrachtungsweise einladen. Wie wäre es, wenn wir unseren Wohlstandsbegriff grundlegend hinterfragen? Könnte es nicht sein, dass vieles von dem, woran wir uns verzweifelt klammern, eigentlich überflüssig ist? Und könnte es nicht ebenso sein, dass unser einseitiges Streben nach materiellem Wohlstand uns zwingt, auf nicht-materielle Formen von Wohlstand zu verzichten, die für unser Wohlergehen und Glück jedoch von übergeordneter Bedeutung sind? Anders ausgedrückt: Was wäre, wenn wir die vielfältigen Krisen unserer Zeit nutzen würden für einen Kurswechsel hin zu mehr Lebensqualität? Und wie könnte das konkret aussehen?
Ich werde diesen Fragen nicht in Form von abstrakten, theoretischen Überlegungen nachgehen, sondern dich auf eine ganz persönliche Reise mitnehmen. Ich werde dir viel aus meinem Leben erzählen, das mich sehr unterschiedliche kulturelle und sozio-ökonomische Kontexte kennenlernen ließ. Vermutlich wirst du durch meine Augen das Thema Wohlstand aus anderen Perspektiven sehen lernen. Doch viel wichtiger als meine Erfahrungen wird deine eigene Reise sein. Wie reich ist dein Leben, jenseits von Kontostand und Statussymbolen? Wie kannst du dich vielleicht noch mehr auf echten Wohlstand ausrichten, um dieses kostbare Leben so schön wie möglich zu gestalten?
Doch ich greife vor. Ich möchte ganz am Anfang beginnen. Dort, wo alles für mich begann: bei meiner Auseinandersetzung mit dem Thema Wohlstand und meinem tiefen Ringen mit der Frage, was wirklicher Reichtum sein könnte. Bei mir begann sie mit einem kleinen balinesischen Mädchen, das ganz unverhofft in meinem Leben auftauchte und es von Grund auf veränderte.
Reich und arm
Ich erinnere mich noch sehr lebhaft an den Moment, als Nyoman Siti in mein Leben kam. Ich war damals vier Jahre alt und lebte seit Kurzem mit meinen Eltern in einem kleinen Dorf auf Bali. Unser Haus lag an einem Fluss, eingebettet in unzählige Schattierungen von Grün, die sich in allen erdenklichen Formen bis zum Horizont erstreckten.
Nyoman tauchte eines Tages bei uns auf und erklärte meinen Eltern, sie sei von den Eigentümern des Hauses beauftragt, die Küche zu wischen. Meine Eltern wussten nicht, wie sie darauf reagieren sollten: Vor ihnen stand ein Kind.
Wir wissen bis heute nicht, wie alt Nyoman damals war, niemand wusste es. Es war auf Bali Mitte der 1970er-Jahre noch nicht üblich, Geburtstage zu notieren. Doch Nyoman war eindeutig noch sehr jung, meine Eltern schätzten ihr Alter auf etwa neun Jahre. Sie hatte ein wunderschönes Lächeln, das ihr ganzes Gesicht aufleuchten ließ, lange schwarze Haare, die in der Sonne glänzten, und war von jener grundlosen Heiterkeit erfüllt, die bei den Balinesen damals noch weit verbreitet war.
Meine Eltern wussten nicht, wie sie sich verhalten sollten. In ihrem Weltbild war Kinderarbeit etwas Schreckliches, Unmenschliches, Kriminelles. Zugleich war es offensichtlich, dass Nyoman sehr froh war, diese Arbeit zu haben. Sie berieten sich kurz miteinander, zuckten dann ratlos mit den Schultern und ließen sie gewähren. Fasziniert folgte ich Nyoman in die Küche und beobachtete, wie sie mit einem großen Lappen den Boden wischte.
Nyoman wurde meine beste Freundin und eine wichtige Lehrerin. Von ihr lernte ich nicht nur die Landessprache, sie führte mich auch mit großer Selbstverständlichkeit in die balinesische Kultur ein. Es ist mir unmöglich, auch nur ansatzweise in Worte zu fassen, was ich alles von ihr lernte. Sie teilte ihre Kultur mit mir, die unermesslich reich war – reich an Farben, an Düften, an Bräuchen, an Lachen, an Miteinander, an Natur, an Geistigkeit und so vielem mehr.
Oft begleitete ich sie am späten Nachmittag zum Fluss. Dort versammelte sich zu jener Zeit das ganze Dorf. An einer Quelle, die wie jede Quelle als heilig galt, wurde gebadet, Wäsche gewaschen, Zähne geputzt – und natürlich der neueste Klatsch ausgetauscht. Und es wurde gelacht, so viel gelacht! Die mutigen Jungs sprangen mit viel Geschrei von den Felsen in den Fluss, einer wichtiger als der andere. Es war so schön, dass es noch heute wehtut, daran zu denken.
Gerne besuchte ich Nyoman auch bei ihr zu Hause. Die ganze Großfamilie lebte auf einem einfachen Gehöft. Während reichere Familien oft aufwendig gestaltete Torbögen hatten, die ihr Areal von der Straße abgrenzten, bestand der Eingang zu Nyomans Familiengehöft aus zwei einfachen Lehmsäulen. Sie waren etwas schief und standen eindeutig schon länger dort, da auf ihnen Gras wuchs.
Die Küche der Familie war ebenfalls aus Lehm gebaut und ohne Fenster. Sie war so klein, dass nur ein Mensch darin Platz hatte, und die Wände waren an der Innenseite schwarz vom Ruß des offenen Feuers. Wann immer ich Nyoman besuchte, schämte sie sich dieser Einfachheit. »Meine Küche ist schmutzig«, pflegte sie dann zu sagen. »Ich bin arm.«
Das Thema Armut und Reichtum begann uns beide schon bald sehr zu beschäftigen. Wir waren Kinder, also sprachen wir nicht wirklich darüber, aber es floss in unser Spiel mit ein. Ich erinnere mich sehr lebhaft an ein Rollenspiel, das wir immer und immer wieder spielten. Die Rollen waren stets die gleichen: Es gab eine Arme und einen Reichen. Und immer war es so, dass der Reiche die Arme aus ihrer Armut erlöste.
Wir spielten dieses Spiel in immer gleicher Besetzung: Jedes einzelne Mal wollte ich die Arme spielen und sie den Reichen. Ich erinnere mich noch genau, wie befreiend es für mich war, in die Rolle der Armen einzutauchen – es war immer eine Frau. Und ich wunderte mich einerseits, verstand es aber auch irgendwie, dass sich Nyoman in der Rolle des Reichen – der immer ein Mann war – so wohlfühlte.
Es dauerte viele Jahre, bis ich begriff, was wir vermutlich beide übersehen hatten: Nicht sie war die Arme gewesen und ich die Reiche. Wir hatten gar keine Rollen getauscht. Ich war es gewesen, die durch sie einen Reichtum kennengelernt hatte, den wenige Menschen aus meinem Kulturkreis je erleben dürfen. Doch was war das für ein Reichtum? Ist es nicht bloß die verklärte Idealisierung einer tropischen Idylle, der so viele Menschen des westlichen Kulturkreises anhängen? Das wäre natürlich eine bequeme Erklärung. Bequem, weil wir uns dann nicht hinterfragen müssen.
Eine unbequeme Reise
Mein Anliegen in diesem Buch ist es, dich auf eine Reise mitzunehmen, die auch unbequem sein kann. Ich werde dich einladen, lieb gewonnene Annahmen infrage zu stellen. Hinter einigen Annahmen wird möglicherweise ein Schmerz zutage treten, mit dem du so vielleicht nicht gerechnet hast. Ich tue das nicht, um dich zu quälen, dir Schuldgefühle zu machen oder dich anzugreifen. Ich möchte dich auf Dimensionen von Wohlstand hinweisen, die uns meiner Ansicht nach abhandengekommen sind und die auch den Balinesen seit meiner Kindheit dort zunehmend abhandenkommen. Mit Palmen und Sonnenschein hat er gar nichts zu tun. Es ist der natürliche Reichtum traditioneller Kulturen, der früher weit verbreitet war, auch bei uns in Europa.
Wenn ich von traditionellen Kulturen spreche, dann meine ich jene Lebensweisen, die sich über Jahrtausende in enger Kooperation mit den natürlichen Gegebenheiten einer Region entwickelt haben. Der Begriff beinhaltet indigene Kulturen, jedoch auch jene von Völkern, die sich später in einer Region niedergelassen haben und im Einklang mit den vorhandenen Ressourcen wirtschaften. Diese Kulturen beinhalteten Fertigkeiten und Bräuche, die weltweit durch den überwältigenden Erfolg der industriellen Revolution überflüssig gemacht und von einer globalen Monokultur verdrängt werden. Was hierbei leider übersehen wird, ist, dass diese traditionellen Lebensweisen nicht nur materielle Bedürfnisse stillten, sondern auch soziale, psychische und spirituelle.
Die meisten von uns, die wir in reichen Industrienationen leben, haben natürlich nie die Gelegenheit, eine traditionelle Kultur von innen zu erleben. Wir wissen daher oft gar nicht, was uns fehlt. Wir nehmen den Zustand des vielfachen Mangels, den ich in diesem Buch noch viel genauer beschreiben werde, als normal und alternativlos hin. Und wir werden von klein auf mit Bildern gefüttert, die besagen, dass wir die Reichen sind und die anderen die Armen. Ich stelle das bewusst infrage.
Ich erlebte auf Bali einen inneren und einen kulturellen Reichtum, der in starkem Kontrast zur materiellen Armut stand. In Europa und später in den USA, wo ich meine Teenagerzeit verbrachte, begegnete mir hingegen unfassbarer materieller Wohlstand. Dieser konnte jedoch eine ausgeprägte innere Armut nur notdürftig verbergen. Indem ich konkrete Dimensionen des inneren, nicht materiellen Wohlstands beschreibe, möchte ich diese Armut sichtbar machen und uns ermutigen, diese hinter uns zu lassen.
Back to the Roots?
Nein, dieses Buch ist kein Plädoyer, in die »gute alte Zeit« zurückzukehren, als »die Welt noch in Ordnung war«. Mir ist durchaus bewusst, dass sich unsere Welt in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten auch zum Besseren entwickelt hat. Ja, wir haben vieles verloren, das in traditionellen Kulturen selbstverständlich war: die Geborgenheit einer Gemeinschaft, kulturelle Fertigkeiten und Traditionen, Gelassenheit oder ein enger Kontakt mit der Natur, um ein paar Beispiele zu nennen.
Zugleich aber haben wir vieles entwickelt, das traditionellen Kulturen schmerzlich fehlte. Auch hier ein paar Beispiele: Materiell gesehen ging es noch nie so vielen Menschen so gut wie heute. Kriege und gewaltsame Auseinandersetzungen sind stetig zurückgegangen, auch wenn die Medien nicht müde werden, ein schreckliches Bild von der Welt zu zeichnen. Die Rechte von Frauen, von Minderheiten, von Andersdenkenden wurden in traditionellen Kulturen sehr häufig mit Füßen getreten. Und auch wenn wir in unseren Gesellschaften noch einen guten Weg zu gehen haben: Die universelle Erklärung der Menschenrechte, die Meinungsfreiheit, der Rechtsstaat sind Errungenschaften, die ich nicht missen möchte.
Es geht in diesem Buch also nicht um ein Zurück. Und es geht auch nicht um eine romantische Verklärung, weder der balinesischen Kultur noch irgendeiner anderen traditionellen Kultur, auf die ich mich in diesem Buch auch beziehen werde. Es ist sehr leicht, traditionelle Kulturen zu idealisieren, doch es ist genauso leicht, ihre Vorteile zu übersehen. Ich möchte dich einladen, im Spiegel traditioneller Kulturen zu erkennen, was uns fehlt. Diese Kulturen haben sich über Jahrhunderte, teils sogar über Jahrtausende entwickelt. Vielen gelang eine erstaunliche Balance zwischen verschiedenen Aspekten von echtem Wohlstand, die uns heute abhandengekommen sind. Jede Kultur ist oder war ein faszinierendes, unfassbar komplexes Kunstwerk.
Richtungswechsel für alle
Dieser teilweise schmerzhafte Blick in den Spiegel ermöglicht es uns, eine neue Richtung einzuschlagen. Bei dieser neuen Richtung geht es nicht vorrangig um Verzicht, sondern um nicht-materielle Formen von Wohlstand. Je mehr wir uns auf diese ausrichten, desto uninteressanter werden unsere vielfältigen Ersatzbefriedigungen.
Ich betrachte dies als einen Schlüssel für die Heilung unserer Welt. Wir wissen seit inzwischen fünfzig Jahren, dass unsere Lebensweise nicht zukunftsfähig ist, und dennoch ist uns ein Kurswechsel bislang nicht geglückt. Ich denke, das liegt auch maßgeblich daran, dass wir einer falschen Vorstellung von Wohlstand hinterherjagen. Uns ist nicht bewusst, dass unsere Lebensweise nicht nur für die Ökosysteme und die armen »Entwicklungsländer« eine Katastrophe ist, sondern auch für uns selbst.
Doch solange die Armut in den reichen Industrienationen – die innere Armut, die menschliche Armut, die kulturelle Armut – ausgeblendet wird, kann die krasse Überkompensation auf materieller Ebene nicht aufgegeben werden. Daher geht jedes Plädoyer für Umweltschutz, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit, das allein in das Verzichtshorn bläst, aus meiner Sicht nach hinten los. Das ist wie der Versuch, einen Alkoholiker vom Suff zu heilen, indem man ihm sagt, er solle weniger trinken. Ich weiß, das ist ein heftiger Vergleich, doch unsere konsumistische, materialistische Lebensweise macht hochgradig süchtig. Natürlich ist es sehr unangenehm, sich dies einzugestehen. Nicht umsonst besagt ein beliebter Kneipenspruch: »Als ich las, wie schädlich das Trinken ist, hörte ich auf zu lesen.«1
Ich hoffe, dass es dir nicht ebenso mit diesem Buch ergehen wird. Denn ich möchte vor allem die Möglichkeit eines Kulturwandels hin zu echtem Wohlstand aufzeigen – für dich ganz persönlich und für uns kollektiv. Mein Anliegen ist, dass wir erkennen, was ein wirklich gutes Leben ausmacht und dass ein solches keine Utopie ist. Unser Leben wird durch diese Auseinandersetzung besser und nicht schlechter, auch wenn es zunächst wehtut.
Diese Veränderung ist nicht nur für dich persönlich wichtig. Die krasse soziale Ungleichheit, die uns global entgegenblickt, ist Spiegel unseres Hyperkonsums wie auch unserer eigenen inneren Armut. Das Gleiche gilt für die weltweit voranschreitende Zerstörung der Ökosysteme. Innere Armut ist der blinde Fleck, wenn es um die Heilung von sozialer Ungerechtigkeit und ökologischer Zerstörung geht. Sie ist das fehlende Puzzlestück. Wenn wir den Mut haben, dieser Tatsache ins Auge zu blicken, entwickeln wir eine neue Sicht auf uns selbst und auf die Welt, in der wir leben. Wir erkennen, wie der kongolesische Philosoph Boniface Mabanza Bambu es formuliert, dass alle Länder Entwicklungsländer sind.
TEIL I:WAS IST WOHLSTAND?
1Unsichtbare Armut
Der enorme Erfolg unseres industriellen und kapitalistischen Systems, materiellen Reichtum zu schöpfen, lässt uns leicht seine Folgen übersehen. Wir haben so viele Dinge, Angebote, Möglichkeiten, Annehmlichkeiten wie keine Generation vor uns. Der Preis, den wir und andere für diesen materiellen Wohlstand zahlen, ist schwer greifbar. In jüngster Zeit wird viel unternommen, um auf die ökologischen Folgen aufmerksam zu machen: das Massensterben von Tieren und Pflanzen, die Entgleisung des Erdklimasystems, die weltweite Zerstörung von Ökosystemen. Und schon seit Jahrzehnten werden die sozialen Folgen angeprangert. Hungernde Kinder in Afrika und Asien werden wirkungsvoll in Szene gesetzt, um Spenden zu sammeln. Immer wieder wird auf die menschenverachtenden Bedingungen hingewiesen, unter denen Arbeitende in den Fabriken dieser Welt schuften, um unsere Billigprodukte herzustellen. Und das sind natürlich nur zwei Beispiele von vielen.
Jede dieser Kampagnen scheint mit einem anklagenden Finger auf uns zu zeigen und zu sagen: »Schau, wie gut es dir geht, während andere leiden!« Aber stimmt das? Geht es uns wirklich so gut? Meine Wahrnehmung ist, dass es uns ganz und gar nicht gut geht. Und zwar nicht nur, weil andere leiden, sondern auch, weil wir selbst leiden. Wir sind eingesperrt in einen goldenen Käfig und finden den Schlüssel nicht mehr. Wir ersticken an Dingen und haben keinen Raum mehr, um zu atmen. Wir sind angewiesen auf einen nie abreißenden Strom an Konsum und Unterhaltung, um den inneren Mangel im Schach zu halten.
Wahrscheinlich findest du jetzt, dass ich übertreibe. Oder vielleicht sogar, dass ich Hirngespinste habe. Wo soll denn all dieses große Unglück sein? Womöglich bin ich einfach selbst ein unglücklicher Mensch, der seinen Mangel auf alle anderen projiziert. Zumindest was den letzten Punkt angeht, kann ich dir versichern, dass das nicht zutrifft. Was die ersten Punkte betrifft, möchte ich dir näher erklären, wie ich zu meiner Einschätzung komme: Es sind zum einen die Gesichter. Wenn ich an das Bali meiner Kindheit zurückdenke, dann sind es vor allem die Gesichter, an die ich mich erinnere. Vor meinem inneren Auge sehe ich Menschen, die von innen zu leuchten scheinen.
Ich hatte das, ehrlich gesagt, fast vergessen. Doch dann bekam ich Post. Es geschah vor gar nicht langer Zeit, als ich mit der Be the Change Stiftung das Projekt »Bäume für den Wandel« ins Leben rief. Mit diesem Projekt lade ich Menschen ein, einen Teil ihres Geldes regelmäßig einzusetzen, um Bäume zu pflanzen. Von unserem Pflanzpartner Eden Projects bekam ich Fotos zur Verfügung gestellt. Sie zeigen Menschen, die in den ärmsten Regionen der Welt Bäume pflanzen. Es handelt sich um die Ärmsten der Armen, die durch das Projekt sinnvolle Arbeitsplätze zu fairen Bedingungen bekommen. Als ich in ihre Gesichter blickte, kamen mir die Tränen. Ja, ich sah Menschen, die fast nichts haben. Doch vor allem sah ich genau jenes Leuchten, das ich fast vergessen hatte. Nicht in jedem Gesicht, nein, aber in einigen.
Vielleicht hast du ein solches Leuchten auch schon mal gesehen, obwohl es bei uns kaum zu finden ist. Als mein Mann, der Südtiroler ist, die Bilder sah, sagte er spontan: »Ich kenne solche Gesichter. Ich kenne sie von Bergbauern, die bei uns noch ganz einfach irgendwo hoch oben leben.« Das meine ich mit: Wenn ich mich heute in unserer Gesellschaft umsehe, dann sehe ich keine Menschen, denen es »so gut geht«. Ich sehe und spüre Menschen, die arm sind, ohne es zu wissen, und denen den ganzen Tag erzählt wird, dieses oder jenes Produkt könnte ihre Not lindern.
Okay, vielleicht ist das mit den leuchtenden Augen etwas dünn als Erklärung dafür, warum ich unsere Gesellschaft als arm empfinde. Auf jeden Fall ist es hochgradig subjektiv. Ich werde daher im Folgenden noch auf andere, wissenschaftlich belegte Merkmale unserer Armut eingehen.
Wer ist hier eigentlich arm?
Wenn wir an Armut denken, dann denken wir an Slums, an Hungerbäuche, an zerfetzte Kleidung. Wir denken an Sweat-Shops und Kinderarbeit, weit weg. Vielleicht denken wir auch an Obdachlose, die nach Ladenschluss auf den Stufen unserer Konsumtempel ihr bescheidenes Schlafzimmer herrichten. Oder an soziale Brennpunkte, wo es so gut wie niemand aufs Gymnasium schafft. Es sind Bilder einer sichtbaren Armut.
Manchmal versuchen wir, Armut in Zahlen zu greifen, etwa indem wir sagen, in manchen Ländern würden die Menschen von weniger als einem Euro pro Tag leben. So arm sind sie! Oft wird dann angeführt, dass ein Euro in Nigeria oder in Indien ja eine ganz andere Kaufkraft hat als bei uns. Leider stimmt das nur bedingt, wenn man die zugrunde liegenden Rechnungen genauer unter die Lupe nimmt. Doch dazu kommen wir noch. Unabhängig davon blendet die Behauptung, Menschen würden von einem Euro am Tag leben, etwas Grundlegendes aus: Viele Bedürfnisse, die bei uns durch Konsum und Geld abgedeckt werden, sind in weniger privilegierten Ländern Teil einer Tausch- oder Schenkökonomie. Das bedeutet, dass für sie kein Geld fließt. Etwa: Kinderbetreuung, Alten- und Krankenpflege, Unterhaltung, Bildung, Freizeitaktivitäten, kulturelle Veranstaltungen, spirituelle und psychologische Begleitung, Reparaturen, Geburtshilfe oder Sterbebegleitung. Auch viele materielle Bedürfnisse werden auf diesem Wege abgedeckt: Die Fortbewegung, der Verleih von Geräten, der Bau von Häusern, der Anbau von Nahrungsmitteln, das Hüten und Schlachten von Tieren, die Altersvorsorge und viele andere Formen von Versicherung. All diese Wirtschaftsleistungen kommen in dem einen Euro am Tag nicht vor, da sie erbracht werden, ohne dass dafür Geld bezahlt wird.
Das bedeutet, dass die Information, wie wenig oder wie viel Geld jemand pro Tag zur Verfügung hat, kaum etwas darüber aussagt, wie gut er versorgt ist. Ein Mensch kann mit weniger als einem Euro pro Tag in einer traditionell bäuerlichen Dorfstruktur oder einer indigenen Stammesstruktur ein Leben führen, in dem weitaus mehr Bedürfnisse abgedeckt sind als bei einem gut situierten Stadtmenschen. Und genauso kann ein Mensch mit nur einem Euro am Tag in einem Slum täglich um sein Überleben kämpfen.
Aber gilt das Gleiche auch für uns in den reichen Industrienationen? Sagt, wie viel Geld wir pro Tag oder pro Monat zur Verfügung haben, auch bei uns nichts darüber aus, wie gut wir versorgt sind? Zu einem gewissen Grade ja. Auch bei uns gibt es Menschen, die von sehr wenig Geld leben und auf anderem Wege gut versorgt sind. Ein extremes Beispiel ist mein lieber Freund Raphael Fellmer, der fünf Jahre im Geldstreik lebte und dem es dabei ausgezeichnet ging. Seine Gabe, tragfähige Beziehungen aufzubauen, seine Talente der Welt zu schenken und Geschenke von anderen anzunehmen, machten ihn zu einem reichen Mann, der auch für seine Umgebung eine Bereicherung war.2 Und es gibt Menschen, die sehr viel Geld haben und trotzdem in großer Armut leben. Robert West, Chefredakteur des Wissenschaftsjournals Addiction und Professor für Gesundheitspsychologie in London, erzählt beispielsweise von seinem Bruder, dieser sei als CEO einer Bank »höllisch unglücklich« gewesen: »Auch noch so viele Ferraris und Häuser in Miami halfen nichts … Er betrachtete auch die Menschen, mit denen er arbeitete, als unglücklich, denn egal wie viel Reichtum sie hatten, es war nicht genug.«3
Diese beiden Männer sind natürlich zwei Extreme. Der eine hat gar kein Geld und ist innerlich reich, wodurch es ihm gelingt, auch seine materiellen Bedürfnisse abzudecken. Der andere hat weit mehr Geld, als er bräuchte, um seine materiellen Bedürfnisse zu stillen, und ist offenbar innerlich arm, was ihn sehr unglücklich macht. Ich habe diese beiden Pole hier angeführt, um aufzuzeigen, dass es neben der sichtbaren materiellen Arm-Reich-Skala eine zweite gibt, die offenbar sehr wenig mit finanziellen Mitteln zu tun hat.
Beide Männer haben übrigens ihren Lebensstil inzwischen geändert. Mein Freund Raphael Fellmer beendete seinen Geldstreik, um seiner Mission, der Reduzierung von Lebensmittelverschwendung, noch effektiver nachgehen zu können. Er gründete Sirplus, ein Sozialunternehmen, das Lebensmittel im großen Stil rettet. Ist er nun weniger glücklich, weil er mehr Geld hat? Natürlich nicht. Der Banker hingegen verließ die Welt des großen Geldes und ist laut seinem Bruder seitdem viel glücklicher.
Symptome unserer Armut
Doch was ist diese zweite Armut, von der ich hier spreche? Wie macht sie sich bemerkbar? Eines ist klar: Sie zeigt sich nicht in zerfetzten Kleidern oder schäbigen Behausungen. Doch sie hinterlässt andere Spuren, sie hat eindeutige Symptome, die in unseren reichen Gesellschaften weit verbreitet sind. Das erste Symptom habe ich bereits erwähnt: Es ist jener verhärmte Blick der Menschen, der von einer chronischen Unzufriedenheit zeugt, die uns schon normal erscheint.
Ein zweites Symptom ist unser Verhältnis zur Zeit. Das zeigt sich in ständiger Hetze, dem Empfinden, nie Zeit zu haben. Oder in ihrem Gegenstück, der Notwendigkeit, sich die kostbare Zeit mit irgendetwas zu »vertreiben«. Wir befinden uns, so scheint es, in einem fortwährenden Kampf mit der Zeit, die ja nichts anderes als Leben ist. Unablässig versuchen wir, sie auszudehnen oder ihr Verstreichen voranzutreiben. Wirklich mit der Zeit im Einklang scheinen wir hingegen selten zu sein.
Symptome unserer Armut
chronische UnzufriedenheitHetze & Stress / ZeitvertreibEinsamkeitinnere LeereSüchteEinsamkeit ist ein drittes Symptom unserer Armut, das inzwischen zunehmend Aufmerksamkeit erregt, nicht zuletzt durch zahlreiche Studien. Diese belegen nicht nur, dass Einsamkeit in unseren Gesellschaften epidemische Ausmaße angenommen hat,4 sie zeigen auch, wie schädlich sie für uns ist.5 Besonders beunruhigend sind Studien, die verdeutlichen, dass zunehmend auch junge Menschen einsam sind. Laut neueren Erhebungen ist die sogenannte Generation Z (Jahrgang 1996 bis 2000) sogar noch einsamer als die Millenials (Jahrgang 1981 bis 1996), die wiederum deutlich einsamer sind als Senioren – eine Altersgruppe, um deren Isolation wir schon lange wissen.6
Ein viertes Symptom unserer Armut ist eine innere Leere oder ein Erleben von Sinnlosigkeit. Zu beidem gibt es meines Wissens keine direkten statistischen Erhebungen. Lediglich die steigenden Raten psychischer Erkrankungen, insbesondere Depressionen und Angststörungen, geben uns einen Hinweis darauf. Denn für jeden Menschen, der in diesen Statistiken auftaucht, gibt es unzählige andere, die nicht krank genug sind, um mit irgendetwas diagnostiziert zu werden. Da psychische Erkrankungen jedoch entlang eines Kontinuums existieren, müssen wir davon ausgehen, dass es unterhalb der Schwelle der erfassten Fälle viele Menschen gibt, denen es nicht gut geht.7 Und auch wenn es von außen nicht sichtbar ist – es ist spürbar, wenn wir uns in die Menschen hineinfühlen, die uns auf der Straße, in der U-Bahn oder im Supermarkt begegnen.
Äußerlich sichtbar und damit auch zu einem gewissen Grad messbar wird die innere Leere zudem durch die weite Verbreitung von Süchten, dem fünften Symptom auf meiner Liste. Neben den stofflichen Süchten nach legalen und illegalen Drogen werden seit den 1980er-Jahren zunehmend auch nicht-stoffliche Süchte thematisiert, wie zum Beispiel Spielsucht, Sportsucht oder Sexsucht. Jede dieser Süchte, stofflich oder nicht stofflich, ist ein Symptom eines inneren Mangels. Doch es gibt auch Süchte, die so normal sind, dass sie gar nicht als solche betrachtet werden.
Geld und Reichtum als Sucht
2014 kam es in den USA vermehrt zu Protesten gegen jenen Teil der Gesellschaft, der als »das oberste eine Prozent« bezeichnet wird. Einige Angehörige dieser Finanzelite fühlten sich zu Unrecht angegriffen, verstiegen sich sogar zu Vergleichen mit dem Judenhass im Dritten Reich. Andere Stimmen argumentierten, die Superreichen würden für etwas belangt, das sie nicht im Griff hätten. Die Jagd nach immer mehr Geld sei eine Sucht. Ein ehemaliger Hedgefonds-Manager schrieb dazu in der New York Times: »In meinem letzten Jahr an der Wall Street betrug mein Bonus 3,6 Millionen Dollar – und ich war wütend, weil er nicht hoch genug war … ich wollte aus dem gleichen Grund mehr Geld, aus dem ein Alkoholiker noch einen Drink braucht: Ich war süchtig.«8 Verschiedene Experten unterstützen seine Selbsteinschätzung.
Der Psychotherapeut Stanton Peele, Autor eines Buches über Suchttherapie, formulierte es wie folgt: »Die Sucht nach Reichtum ist bezeichnend für eine Gesellschaft, in der Sinn und sozialer Status ausschließlich durch die Anhäufung von Reichtum erlangt werden. Am einfachsten lässt es sich als … Leere und die Abwesenheit von nachhaltigen Werten, Gemeinschaft, und Lebenssinn beschreiben, weshalb Reichtum, Geld und Besitz als glitzernder, attraktiver, süchtig machender Ersatz angestrebt werden.«9
Okay, so gesehen ist es vielleicht nicht so attraktiv, zu diesen armen Topverdienern zu gehören. Wer will denn schon ein Junkie sein? Aber das sind ja Extreme. Die meisten Menschen haben diese Probleme doch nicht, oder?
Aufgrund meiner Kindheit auf Bali habe ich hier eine etwas andere Perspektive. Aus Sicht der Balinesen sind in den reichen Industrienationen alle superreich. Und ich wage zu behaupten, dass wir alle zu einem gewissen Grade Suchtdynamiken unterworfen sind, wenn es um Geld, Konsum und materiellen Wohlstand geht. Vielleicht sind wir nicht so süchtig nach dem nächsten Kick wie der Wall-Street-Banker, der wütend wird, weil ihm sein 3,6 Millionen US-Dollar-Bonus zu niedrig ist. Vielleicht sind wir eher wie Pegeltrinker: Alkoholiker, die sich so an einen bestimmten Alkoholanteil im Blut gewöhnt haben, dass sie ohne diesen Pegel massive Entzugserscheinungen bekommen. Oder wie geht es dir bei der Aussicht, deinen Lebensstandard zu reduzieren? Weniger zu konsumieren? Weniger Geld zur Verfügung zu haben? Der Soziologe Philip Slater schrieb dazu in seinem Buch Wealth Addiction: »Süchte haben mit unseren Gefühlen über uns selbst zu tun: Wenn du denkst, dass du dich ohne etwas unvollständig, weniger wert fühlst und meinst, du könntest dann nicht richtig funktionieren.«10
Hand aufs Herz: Sind das nicht genau die Themen, die in der Corona-Krise hochkochten? Und zuvor in der verschleppten Klimadebatte? Würdest du dich »weniger wert« fühlen oder sogar »unvollständig«, wenn du weniger Geld hättest? Eine kleinere Wohnung? Ein älteres Auto? Wären wir als Gesellschaft »unfähig zu funktionieren« ohne Auto, ohne Flugzeuge? Wenn diese Fragen bei dir eine Enge auslösen und vielleicht sogar den Wunsch, das Buch wegzulegen, dann könnte das ein guter Grund sein weiterzulesen. Keine Sorge, ich will dir weder dein Auto wegnehmen noch das Fliegen verbieten. Ich möchte dich jedoch einladen, dein Verhältnis zu den Annehmlichkeiten in deinem Leben zu hinterfragen.
Die mehr oder weniger subtilen Suchtdynamiken zu erkennen und zu hinterfragen ist ein wichtiger Schritt in Richtung echter Wohlstand. Das ist nicht immer angenehm. Der Alkoholiker schätzt es auch nicht, wenn man ihn auf seine Trinkgewohnheiten anspricht. Doch wenn wir uns aus unserer Armut befreien wollen, kommen wir nicht umhin, uns jener Mechanismen bewusst zu werden, die diese nicht nur verursachen, sondern auch verdecken. Denn das sind zwei Aspekte, die bei jeder Art von Sucht auftreten: Erst verdecken sie einen inneren Mangel, und dann verstärken sie ihn, da die Sucht immer weitere Bereiche des Lebens vereinnahmt.
Was ist der Treiber unserer Armut?
Nun habe ich verschiedene Symptome unserer inneren Armut beschrieben und hoffe, dass du damit eine genauere Vorstellung davon bekommen hast, was ich meine. Doch was steckt hinter diesen Symptomen? Was ist der Treiber unserer Rastlosigkeit, unserer Unerfülltheit, unseres unlöschbaren Dursts? Warum vereinsamen wir, sind oft so unzufrieden mit unseren vollen Kühlschränken und weichen Betten? Warum werden so viele Menschen in unseren wohlhabenden Industrienationen psychisch krank?
Diese Fragen haben mich jahrzehntelang beschäftigt. Ich spürte schon als Kind zurück in Europa, dass uns etwas von innen aushöhlt, konnte jedoch nicht greifen, was es ist. Dieses Empfinden intensivierte sich, als ich mit 13 Jahren mit meiner Mutter in die USA zog, nachdem wir mehrere Jahre in Deutschland gelebt hatten. Aufgrund einer Verkettung von Umständen landete ich dort in einem Internat. Es war eine dieser elitären College-Prep-Schools, die Jugendliche für die rigorosen Auswahlverfahren der amerikanischen Universitäten fitmachen. Die Schulgebühr kostete pro Jahr mehr, als meine Eltern je auf einmal besessen hatten. Der Campus sah aus wie in dem Film DerClub der toten Dichter: malerische rote Backsteingebäude auf einem weitläufigen grünen Areal von Wiesen und Wäldern. Jede Fakultät befand sich in einem eigenen Gebäude, wie bei einem College, dazwischen Tennisplätze, ein Reitstall, eine Schwimmhalle. Ich war umgeben von den Sprösslingen der New Yorker Upperclass, den Söhnen und Töchtern derjenigen im ganzen Land, die es geschafft hatten oder schon immer ganz oben waren. Kurzum: Ich fand mich erneut in einer komplett fremden Welt wieder.
Es dauerte nicht lange, da bemerkte ich, dass die innere Armut, die ich bereits in Europa gespürt hatte, hier noch ausgeprägter war. Immer noch konnte ich sie zwar nicht benennen, doch sie war nicht zu übersehen. Wichtigstes Symptom waren die psychischen Krankheiten, allen voran Depressionen und Essstörungen, die unter meinen Mitschülern weit verbreitet waren. Viele nahmen Psychopharmaka. Ein weiteres Symptom war der hohe Drogenkonsum, obwohl selbst Rauchen strengstens verboten war, von Alkohol ganz zu schweigen. Für beide Vergehen wurden Schülerinnen konsequent der Schule verwiesen. Doch nicht alle interessierten sich für diese leichten Drogen; einige bevorzugten die Leistungsdroge der Elite, Kokain, oder rauchten Crack.
Ich begann, innerhalb kürzester Zeit innerlich zu verhungern. Ich brachte mein Abitur in Rekordzeit hinter mich, verließ die Schule und das Land fast fluchtartig. Ich war die einzige Person in meinem Jahrgang von über hundert Schülern, die sich gegen ein Studium entschied. Alle anderen gingen auf die berühmten Universitäten des Landes und bereiteten sich darauf vor, ihren Platz in der amerikanischen Elite einzunehmen.
Lange dachte ich, es sei einfach der hohe materielle Wohlstand gewesen, der die Menschen so arm machte. Für meinen jugendlichen Blick war diese Schlussfolgerung naheliegend: Auf Bali hatte ich bei armen Menschen einen unfassbaren Reichtum erlebt. In Europa war meine Familie Teil der Mittelschicht. Diese war für meinen balinesisch geprägten Blick innerlich arm und materiell sehr reich. In den USA lebte ich dann unter den Superreichen, deren innere Armut noch gravierender, ja geradezu erschreckend war. Die Schlussfolgerung, dass Menschen mit zunehmendem Wohlstand innerlich verarmen, lag auf der Hand. Doch etwas störte mich daran. Ich spürte, dass irgendwas an meiner Hypothese nicht stimmte. Nicht jeder arme Mensch war innerlich reich und nicht jeder reiche Mensch innerlich arm. Außerdem gab es zwischen einzelnen Ländern auch erhebliche Unterschiede, die allein durch den materiellen Wohlstand nicht zu erklären waren. Und ich verstand immer noch nicht, was da eigentlich wirklich vor sich ging.
All das änderte sich, als ich auf die Arbeit von Richard Wilkinson und Kate Pickett stieß. Das britische Professorenteam, beide Epidemiologen, widmet sich seit Jahrzehnten der wissenschaftlichen Erforschung genau dieser Frage, die mich schon mein ganzes Leben umgetrieben hat: Was ist eigentlich unser Problem, warum geht es uns trotz unseres Komforts, teilweise sogar Luxus, nicht gut? Ihre Erkenntnisse waren wie ein fehlendes Puzzlestück in meiner eigenen Erforschung des Phänomens. Sie vervollständigten ein Bild, das sich seit jener ersten Begegnung mit Nyoman in mir geformt hatte. Die unzähligen Daten, die sie für ihre Arbeit ausgewertet haben, machten jene Teile des Bildes sichtbar, die ich bislang nur schemenhaft erahnt hatte. Und was sich dort zeigte, war verblüffend.
Ungleichheit, Statusangst und die Not der reichen Industrienationen
Die Quintessenz der jahrzehntelangen, akribischen Forschungsarbeit von Wilkinson und Pickett lautet: Ungleichheit macht krank. Je größer die Ungleichheit in einer Gesellschaft ist, desto kranker sind alle Teile dieser Gesellschaft. Doch was genau ist mit »krank« gemeint? Zum einen psychische Krankheit: je stärker die Ungleichheit in einem Land, desto mehr Menschen leiden an psychischen Erkrankungen wie Depression, psychotischen Symptomen, Schizophrenie und narzisstischen Persönlichkeitsmerkmalen.11 Und nein, leider lassen sich diese Zahlen nicht dadurch erklären, dass normale psychische Prozesse, wie beispielsweise Trauer nach einem Verlust, durch unsere Diagnosesysteme fälschlicherweise als Depressionen pathologisiert werden.12 Es liegt auch nicht daran, dass psychische Erkrankungen in manchen Ländern eine höhere Akzeptanz besitzen. Diese Faktoren wurden bei den Erhebungen berücksichtigt.
Die Zahlen bestätigen leider genau das, was ich erlebt hatte. Was ich damals nicht wusste: Die USA sind einer der absoluten Spitzenreiter, wenn es um soziale Ungleichheit geht. Aktuell besitzt 1 Prozent der Bevölkerung 40 Prozent des Privatvermögens, um nur eine Zahl von vielen zu nennen, die das Ausmaß sozialer Ungleichheit in einem Land ausdrücken können.13 Entsprechend viele Menschen sind psychisch krank. 2010 hatte beispielsweise jeder vierte US-Amerikaner innerhalb des Vorjahres eine psychische Erkrankung. In Großbritannien war es jeder fünfte Bürger. In Deutschland und Japan hingegen »nur« jeder zehnte. Eine 2017 erschienene Meta-Studie, in der die Daten von 27 Einzelstudien zusammengeführt wurden, bestätigte den Zusammenhang von Einkommensungleichheit und psychischen Krankheiten.14
Einkommensungleichheit und psychische Erkrankungen im Ländervergleich15
Doch psychische Probleme sind nur ein Symptom der Krankheit, die mit wachsender Ungleichheit einhergeht. Der sogenannte Index der gesundheitlichen und sozialen Probleme beinhaltet eine lange Liste von Indikatoren für körperliche, mentale und soziale Gesundheit: Lebenserwartung, Vertrauen, psychische Erkrankungen, Drogen- und Alkoholsucht, Übergewicht, Kindersterblichkeit, Lese- und Rechenfähigkeit bei Kindern, Anteil der Bevölkerung im Gefängnis, Mordraten, Teenagerschwangerschaften und soziale Mobilität. Und jetzt bitte festhalten: Jeder dieser Indikatoren verschlechtert sich mit der Ungleichheit, die in einem Land herrscht.16
Finanzielle Ungleichheit und sozio-gesundheitliche Probleme im Ländervergleich17
Diese Erkenntnisse gingen mir sehr nahe. Sie wühlten mich innerlich auf, brachten längst vergessene Erinnerungen an die Oberfläche, ließen vieles in einem neuen Licht erscheinen. Auf einmal war alles so greifbar, was ich all die Jahre gespürt hatte; die Not, die ich nie hatte benennen können, war schwarz auf weiß dingfest gemacht in Zahlen, die eine klare Botschaft hatten: Es geht uns nicht gut. Ja, manchen geht es besser als anderen. Doch je größer dieser Unterschied ist, desto mehr leiden wir alle darunter.
Die Arbeiten von Wilkinson und Pickett sind nicht nur deshalb so bahnbrechend, weil sie eindeutig zeigen, dass Ungleichheit uns alle krank macht. Ihnen gelang es auch, nachvollziehbar zu machen, auf welche Weise Ungleichheit diese Effekte verursacht. Denn natürlich liegt es nicht an der Ungleichheit an sich, sondern an dem, was sie mit uns und unseren Beziehungen macht. Das ist wichtig, denn es betrifft jeden von uns, ob es uns bewusst ist oder nicht. Dies zu erkennen ist ein Schlüssel, um ein neues Verhältnis zu unserem vorherrschenden Wohlstandsbild zu entwickeln. Erst wenn wir erkannt haben, was uns an unserem derzeitigen Wohlstandsstreben krank macht und uns zugleich daran festhalten lässt, können wir beginnen, uns daraus zu befreien.
2Die unendliche Leiter
Vor einigen Jahren war ich mit meiner Familie zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Es war keine gewöhnliche Geburtstagsfeier, zumindest nicht für mich. Wir waren zwar nur zu neunt, doch das Geburtstagskind hatte in Venedig für einige Tage einen ganzen Palazzo gemietet. Dort waren wir alle gemeinsam untergebracht. Die Agenda? Venedig genießen und zwar offenbar so, als ob Geld keine Rolle spielen würde. Wir wurden in die exklusivsten Restaurants ausgeführt, machten die üblichen Ausflüge nach Murano und Burano, bestiegen den Campanile und schlenderten durch die Stadt, wie es uns gefiel.
Wenn wir in einem Restaurant saßen und die Speisekarte studierten, auf der kein Gericht unter 50 Euro zu haben war und die Vorspeisen bei 20 Euro begannen, beschlich mich schnell ein Gefühl der Enge. Unsere Gastgeber hingegen zögerten nicht, jedes Gericht, das sich irgendwie interessant anhörte, zu bestellen, ohne sich darum zu kümmern, ob wir das alles aufessen würden. Allein es mal probieren zu können war Grund genug, es zu bestellen.
Ihre völlige Sorglosigkeit, was Geld betraf in einer Stadt wie Venedig, wo allein das Atmen etwas zu kosten scheint, war mir zugleich fremd und vertraut. Fremd, weil ich Venedig immer nur als Tagestouristin besucht hatte und mir schon das Tagesticket für die Wasserbusse horrend teuer erschienen war. Als ich überlegte, in welcher Hinsicht mir die Situation vertraut erschien, fühlte ich mich plötzlich an Asien erinnert. Genau, das war es: Wenn ich als Europäerin in Asien unterwegs gewesen war, dann hatte ich genau diese Unbekümmertheit an den Tag gelegt. Denn egal wie teuer etwas für lokale Verhältnisse sein mochte, für mich war es immer noch spottbillig gewesen. Ich war selbst oft mit der gleichen Nonchalance in ein Taxi gestiegen und hatte am Ende der Fahrt eine Summe ausgegeben, die für den Fahrer selbst unbezahlbar gewesen wäre. Und wenn ich doch mal einen Moment des Unwohlseins verspürte, reichte es, die Summe in D-Mark oder Euro umzurechnen, um mir klarzumachen, dass es nichts war.
Offenbar war es für meine Gastgeber in Venedig genauso. Auch eine Restaurantrechnung über 1700 Euro oder eine Taxifahrt zu 120 Euro waren Peanuts für sie. Und ja, ich kannte sie gut genug, um zu wissen, dass sie beide – das Geburtstagskind und ihr Partner – Multimillionäre sind. Insofern ergab es Sinn, dass die Verhältnismäßigkeit eine ähnliche war: mein finanzieller Wohlstand im Vergleich zu einem durchschnittlichen Asiaten und ihrer in der Hauptstadt der Nepperei Venedig.
Wer ist hier eigentlich reich?
Der Schlüsselmoment kam für mich jedoch am Geburtstagsabend selbst. Wir hatten uns natürlich in Schale geschmissen. Ich trug das einzige Outfit, das ich besaß, von dem ich hoffte, es würde in dem edlen Restaurant nicht schäbig aussehen. Das Geburtstagskind ließ sich von uns beraten, welcher der unzähligen Designerfummel, die sie sich gerade in Mailand zugelegt hatte, ihr am besten stand. Sie war mit mehreren gigantischen Koffern angereist, die sie sich laut ihrem Partner extra zugelegt hatte, um ihre Einkäufe zu verstauen. Die anderen Geburtstagsgäste lagen irgendwo zwischen diesen beiden Extremen.
Wir stiegen in das Wassertaxi, das vor dem Palazzo auf uns wartete, und glitten schon bald auf Ledersitzen durch den festlich beleuchteten Canal Grande. Ein kurzer Abstecher in das Hotel, in dem George Clooney seine Amal geheiratet hat, um einen Tisch für den kommenden Abend zu reservieren, und dann weiter hinaus in die Lagune.
Unser Ziel war ein Restaurant auf einer der Inseln, mit Blick auf den Markusplatz. Als wir in die Lagune hinausfuhren, wurde es plötzlich still an Bord. Das aufgeregte Geschnatter legte sich, alle blickten wie gebannt auf das Wasser. Als ich ihren Blicken folgte, um herauszufinden, was sie so faszinierte, entdeckte ich eine gigantische Jacht. Es war keine gewöhnliche Luxusjacht. Sie war mindestens so groß wie ein Einfamilienhaus, und man konnte nur erahnen, welch unvorstellbaren Luxus sie in ihrem Inneren bieten mochte. Ich blickte von der Jacht in die Gesichter meiner Reisegefährten und wieder zurück. In ihren Blicken las ich Neid, Sehnsucht, Ehrfurcht, Scham, Anerkennung.
Und mir wurde schlagartig bewusst: In Anbetracht dieser Jacht, die selbst für meine gut betuchten Gastgeber völlig unerschwinglich war, fühlten sie sich arm. In ihren Augen waren sie selbst nicht reich. Es war für sie normal, Geburtstag so zu feiern. Nein, es war nicht normal, es war sogar bescheiden. Denn zu ihrem Vierzigsten hatte meine Freundin mich noch mit mehreren Dutzend Freunden und Bekannten auf eine einwöchige Fünfsternesafari nach Afrika eingeladen, inklusive Flug und allem Drum und Dran. Es war für sie normal, alles von der Speisekarte zu bestellen, nur um es mal zu probieren. Es war für sie normal, die Designerboutiquen in Mailand leerzukaufen und mehrere große Koffer damit zu füllen, die sie sich extra dafür zulegen musste. Reich fühlte sie sich deshalb nicht. Reich waren die Besitzer dieser Jacht. Das waren die Menschen, die es wirklich geschafft hatten.